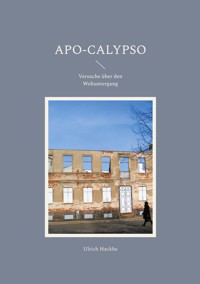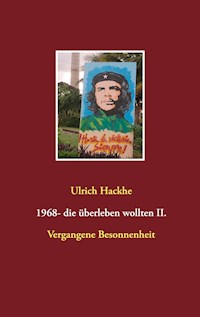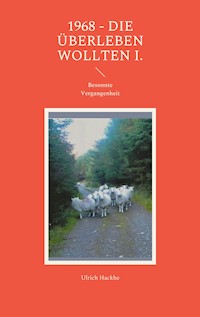
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was? Noch ein Buch über 1968? Nein - keine Sorge! Nicht ganz! Der Roman schildert das Leben des Protagonisten und einiger seiner Vorfahren und Mitmenschen von 1832 bis 1968, wobei der Schwerpunkt auf 1945 bis 1968 liegt. Manchmal bitterernst und oft auch komisch. Die Frage: Was hat ihn und eine ganze Generation so krötig und rebellisch gemacht? Vielleicht gibt es eine Antwort. Manchmal verliert sich der Erzählstrang auch über die Grenze des Romans in das Reich des Sachbuchs, des Hörspiels oder des Drehbuchs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Schon wieder ein Buch über 1968! Das muss doch nicht sein! Da gibt es doch schon mehr als genug!
Nein, keine Sorge, hier kommt kein Sachbuch! Und auch keine Autobiografie! Nur ein Roman, der in erster Linie unterhalten will. Die Geschichte von Arnald Dagghe und seiner Familie. Von 1820 bis 1968. Arnalds Vorfahren waren arme schleswigsche Moorbauern oder noch ärmere holsteinischen Knechte und Mägde. Denen wurde nichts oder nur sehr wenig geschenkt. Nur einmal bekamen sie zwei Bauernhöfe vom König geschenkt. Fast, aber nicht ganz wie im Märchen. Meistens mussten sie bitterhart um ihr tägliches Brot ringen. Und auch Arnald hat nichts geschenkt bekommen. In den 50er und 60er Jahren hatten junge Leute nicht viel zu lachen. Zunehmend ratlos tappt und torkelt der Protagonist durch eine braune, autoritäre, von Gewalt und Verschweigen einer verbrecherischen Vergangenheit geprägte Welt und versucht, mit ihr klar zu kommen. Das, was heute oft als besonnte Vergangenheit verkauft wird, war meistens ziemlich furchteinflößend und oft auch top-gefährlich. Eine Schulzeit in den 50er und 60er Jahren war selten ein Vergnügen. Aber nie ganz ohne unfreiwillige Komik. Die Stimmung am sich anspruchsvoll gebenden Gymnasium war muffig und vom autoritären Geist geprägt. Kein Wunder, dass Arnald schließlich die Schnauze gestrichen voll hat von dieser Form von Gesellschaft. Immer wieder verspielt sich die Handlung ins Sujet des Sachbuchs. Oder es kommt zu hörspielartigen Dialogen. Man fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt, in eine gute alte Zeit, die so gut nicht war.
Inhalt:
Besonnte Vergangenheit
Teil 1: Politik der ersten Stunde (1799 – 1950)
1.Von Döhnsdorf nach Ellerbek
2.Von Ellerbek nach Berlin
3. Der 8. Mai
4. Wer waren die Dagghes?
5.Vom Landtag ins Privatleben
6. Zucht und Unzucht in den 50er Jahren
Teil 2: Alles im braunen Bereich (1949 – 1967)
1. Von guten Mächten wundersam geborgen, ein Kleinkind blickt in die Welt
2. Autoritäre Knacker und echte Autoritäten
3. Wo der Rohrstock regierte, aus dem Leben eines kleinen Grunzschülers
4. Kleine Fluchten und großes Homogia-Leid
5. Können Bücher bilden und bessern?
6. Höherer Blödsinn an der Höheren Lehranstalt, aus dem Leben eines kleinen Sextaners
7. Wissen ist Macht. Nix wissen macht auch nix
8. Braun in Büsum(pf) und anderswo, Zur Hölle mit den Paukern
9. K wie Katz, alles für die
10. Mens sana in corpore sanella, Sport, Medizin im Dienste der Volksgesundheit
11. Wie hältst du es mit der Religion?
12. Bonhoeffer und das Schweigen
13. War Hitler Einzeltäter?
14. Excurs über die ollen Germanen und ihre Götter
15. Der Richter und sein Henker
16. Die Mörder sind unter uns
17. Globke, Kies- und Filbinger, drehten ziemlich krumme Dinger
18. Arnald und Mephisto- die Umwertung der Werte oder alles prima in der Oberprima
19. Aus der Hölle die Pauker – ein kleines Drehbuch
20. - Mit sowohl Tschingderassa als auch Bumderassa
21. Wie Soren Kierkegard dem Arnald Dagghe mal den Arsch gerettet hat
22. Schwanengesang
Und auf vorgeschrieb‘nen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur. Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle – Schafsnatur!
J.W. Goethe, Faust II, 4. Akt
Hinweis: Es handelt sich bei diesem Buch nicht um Memoiren oder tatsächliche Lebenserinnerungen sondern um einen Roman. Alle handelnden Personen sind frei erfunden, seien sie nun tot, untot oder gar lebendig. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit verstorbenen, lebenden oder noch geboren werdenden Personen sind zufällig und von daher zu erklären, dass damals viele Menschen ein ähnliches Schicksal hatten, ähnlich gedacht und ähnlich geredet haben. Auch die genannten Orte der Handlung wie zum Beispiel Kiel, Hamburg oder Döhnsdorf sind frei erfunden.
Besonnte Vergangenheit
l. Teil - Politik der ersten Stunde
1. Von Döhnsdorf nach Ellerbek
Jach peitscht der eisige Nordostwind über das ostholsteinische Hügelland. In diesem Jahr 1878 will es gar nicht Frühling werden in Döhnsdorf, dem winzigen Dorf an der Hohwachter Bucht. Die kümmerlichen Kätnershäuser scheinen sich in dem eisigen Sturm zu ducken. Es knarrt im Gebälk. Es zieht aus allen Ritzen. Die rußenden und rauchenden Öfen können der klirrenden Kälte nur wenig entgegensetzen. Und jetzt setzt noch der Schneefall ein. Am 31.März! Da sollten doch schon die Krokusse blühen. Innerhalb einer halben Stunde sind alle Straßen und Wege mit teilweise meterhohen Schneewehen versperrt. Da kommt keiner mehr durch.
An der Straße nach Oldenburg, schon etwas außerhalb des Dorfes, linker Hand, liegt ein besonders kümmerliches Häuschen. Obwohl der Wind so schaurig brüllt und heult, hört man sie doch: Die Schreie einer Frau in den Wehen. Und das schon seit fast einem ganzen Tag. Krischahn Däubler treibt seine achtköpfige Kinderschar in die Scheune:
„Kinnersch! Mutter kann euch jetzt nicht gebrauchen! Kommt in die Scheune. Da ist es halbwegs warm, und ich lese euch was vor! Aus der Bibel! Das mit dem Turmbau von Babel! Und Sodom und Gomorrha! Dass hört ihr doch so gerne!“
Seine zahlreichen Kinder sind aber nicht doof. Landkinder, die wissen, was der Stier mit der Kuh macht und der Hengst mit der Stute:. „Vadder förtäll keen Schiet. Wi kreeg en neege Söster or een neegen Broder.“
Krischahn Däubler ist nicht froh, dass es schon wieder Nachwuchs gibt. Acht Kinder hat er schon. Eigentlich zehn. Aber zwei sind schon als Säuglinge gestorben. Und die arme Johanna. Schon wieder ein Kind. Dabei hat er doch so aufgepasst. Aber aufpassen alleine hilft nicht. Noch ein Fresser mehr in der Kate. Eigentlich zu viel. Aber irgendwie ist es bisher ja immer weiter gegangen.
Hermine Höppner, die Hebamme aus Wangels ist schon seit über einem Tag in der Kate, und versucht, der Gebärenden beizustehen und dem neuen Menschenwesen in die ärmliche Welt der Landarbeiter zu helfen. Der erfahrenen Hebamme kann man nichts vormachen. Die weiß, wie Menschen auf die Welt kommen. Ist immer Quälkram. Sie kommt aus der Stube in die Scheune, wo Vadder Däubler umringt von seiner Kinderschar aus der Bibel vorliest. Auf die Kinder nimmt sie keine Rücksicht. Auf Kinder darf man sowieso keine Rücksicht nehmen. Sie wissen sowieso alles. Es gibt keinen Grund sie zu schonen. Das Leben wird sie auch nicht schonen. Hermine wendet sich mit ernstem Gesicht an Christian:
„Vadder Däubler, wi brukt den Doktor! Dat ward eernst! Verdammich eernst!“
Christian Däubler ist verzweifelt: „Wer soll das bezahlen. Ich habe nur noch drei Groschen!“1)2)
Hermine versucht, ihn zu beruhigen: „Das zahlt der Reichsgraf. Macht der immer, wenn es ernst wird. Jedenfalls bei Geburten. Der will auch gesunde Mägde und Knechte für seinen Hof.“
Christian zeigt mit der Hand nach draußen: „Bei dem Sturm können wir nicht anschirren. Da kommt keiner bis Oldenburg durch. Da geht noch einer bei drauf! Und die Pferde machen das auch nicht mit. Gäule sind nicht doof. Die gehen bei so einem Wetter nicht einen Schritt vor den Stall.“
Hermine überlegt einen Augenblick: „Na, mal sehen! Vielleicht kriegen wir das auch ohne Doktor hin. Muss ja! Aber es wird dauern und es wird eine Qual. Heute kommt es nicht mehr. Das Kind wird bestimmt ein Aprilscherz.“
Und dann zeigt sie auf Anna-Katharina, die älteste der Däubler-Geschwister: „Und du kommst mit. Du musst mir helfen. Du bist jetzt groß genug. Und die anderen bleiben draußen! Und wehe, wenn ich Lärm höre.“
Anna-Katharina ist eigentlich schon zu alt, um noch bei den Eltern zu wohnen. Sie ist schon letztes Jahr am Palmsonntag eingesegnet worden. Eigentlich hätte sie in Stellung gehen müssen und für sich selbst sorgen. Aber sie ist einfach bei der Mutter geblieben, die den kinderreichen Haushalt ohne die tatkräftige Hilfe ihrer Ältesten nicht hätte bewältigen können. Und die Eltern dulden es auch so, weil es nicht anders geht. Und Mädchen heiraten ja sowieso. Früher oder später – hoffentlich früher!
Christian ist ein harter, schweigsamer Mann. Viel hat er mit der Kirche und dem Kram vom Pastor nicht zu tun. Aber heute Abend betet er inbrünstig: „Herr lass meine Frau das überstehen!“ Und seine Kinder beten mit, während der Orkan draußen sich zu einer Symphonie des Grauens steigert.
Und dann eine Minute nach Mitternacht hört man in all dem Getöse ein leises aber doch irgendwie fröhliches Krähen. Die Hebamme, die so erschöpft aussieht als habe sie in den ganzen Tag Holz gehackt und Steine geklopft, kommt mit einem winzigen Bündel in den Scheunenraum und lacht: „Der Aprilscherz ist da! Mutter und Kind sind wohlauf. Anna-Katharina hat sich gut gehalten. Aber sie ist zum Schluss in Ohnmacht gefallen, ist aber auch schon wieder halb bei Bewusstsein. Nur die Hebamme braucht jetzt einen tüchtigen Schluck aus der Pulle, sonst fällt sie auch noch um.“
Ja, soweit die Geschichte der Geburt von Arnald Dagghes Großvater Johann!
*****
Unvoreingenommener Leser: „Ich denke du willst hier über die Geschehnisse von 1968 erzählen, und wie man das überleben konnte? Und nun willst du im 19. Jahrhundert anfangen?“
Arnald: „Die ganze Geschichte fängt natürlich noch viel früher an. Wahrscheinlich mit Adam und Eva oder den Dinosauriern. Oder gar dem Urknall? Aber das würde zu weit führen. Selbst wenn man sehr alte Leute fragen würde, die noch beim Urknall dabei waren, könnten die sich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig daran erinnern oder hätten alles missverstanden.“
Unvoreingenommener Leser: „Ja, wahrscheinlich! Aber wieso schreibst du überhaupt etwas über deine Eltern und Großeltern? Und was hat das mit 1968 zu tun?“
Arnald: „Das, was wir wurden, hat auch etwas mit unseren Vorfahren zu tun!“
Unvoreingenommener Leser: „Aber geht es vielleicht auch etwas sachlicher. „Symphonie des Grauens!“ „Ein harter und schweigsamer Mann“! Das sind doch alles Klischees. Ist doch viel zu dick aufgetragen. Das ist doch auch alles wahrscheinlich erfunden.“
Arnald: „Na gut! Dann eben etwas sachlicher!“
*****
Arnalds Mutter war Elfriede Elisabeth Däubler, die es als eine der wenigen Mitglieder der Familie immerhin zu einer gewissen Berühmtheit als schleswig-holsteinische Politikerin der ersten Stunde nach 1945 gebracht hatte. Heute ist sie weitgehend vergessen. Elfriede wurde am 09.04.1911 in Kiel-Ellerbek geboren, als jüngste von vier Schwestern. Ein jüngerer Bruder kam erst nach dem Weltkrieg zur Welt.
Ellerbek war ein idyllisches Fischerdorf, aber Anfang des 20. Jahrhunderts ist die ganze Idylle rückstandslos abgerissen worden, da Platz für die Werft gebraucht wurde. Die meisten Fischer zogen ganz einfach dahin, wo man noch etwas fischen konnte. Die neuen Bewohner Ellerbeks waren fast alle Werftleute, die meistens aus dem Holsteinischen Umland, teilweise aber auch aus Ostpreußen und Schlesien oder gar Italien und sonst woher nach Kiel gekommen waren, um auf der Werft ihr Glück zu suchen. Und sie wohnten in eher einfachen Einfamilienhäusern. Von den alten Fischerkaten war bis auf eines kein einziges stehen geblieben. Die Bevölkerung war vollständig ausgetauscht worden.
Elfriede Däublers Eltern waren 1904 aus Ostholstein nach Kiel gekommen. Elfriedes Vater war der Dienstknecht Johann(es) Heinrich Däubler aus Döhnsdorf im Landkreis Oldenburg/Holstein, geboren am 01.04.1878. Seine Eltern waren der Landarbeiter Christian Friedrich Däubler und Frau Johanna Däubler, geborene Petersen, beide ebenfalls aus Döhnsdorf. Man weiß fast gar nichts über sie. Nur eines: Sie sollen sehr ruhige, zurückhaltende, fast schon schüchterne und sehr schweigsame Menschen gewesen sein. So waren wohl damals die meisten Menschen, die ihr täglich Brot bei harter Land- und Feldarbeit verdienen mussten. Vor allem, wenn sie nicht einmal auf eigenem Boden ackern durften. Glücklicherweise hatten einige ihrer Söhne diese schweigsame und zurückhaltende Art nicht geerbt, denn sonst wäre ja nichts überliefert worden. Johann, der Jüngste war jedenfalls immer recht mitteilsam. Allerdings muss nicht alles gestimmt haben, was er erzählt hat, denn er betonte immer wieder: „Eine Geschichte muss gut sein. Wenn sie auch noch wahr ist, macht das nichts. Aber auch wenn sie wahr ist, darf sie trotzdem nicht langweilig sein.“
Als Elfriede viele Jahre später mit ihrer älteren Schwester Anni auf der B 202 im dicken Mercedes ihres Gatten, der auch tatkräftig an Lenkrad und durchgedrückten Gaspedal hantierte, durch Döhnsdorf brauste, rief Tante Anni, als sie an einem sehr schönen Fachwerkhaus aus leuchtenden, roten Backsteinen mit prächtigem Strohdach vorbei fuhren: „Schau nur! Da ist Vaters Elternhaus! Wie schön es doch ist!“
Doch Elfriede lachte nur bitter und wies auf eine winzige, früher wohl einmal weiß gekalkte, jetzt graue Kate, die fast im Boden versunken war: „Nein, das verwechselst du! Das Strohdachhaus ist neu und erst vor kurzem in der Schöner Wohnen vorgestellt worden. Der elende Pisspott da drüben, das ist sein Elternhaus.“
Döhnsdorf ist ein winziges Dörfchen mit nur ca. 300 Einwohnern, das heute zur Gemeinde Wangels gehört. Vor dem Ersten Weltkrieg wohnten dort noch 750 Leute. Obwohl das Dorf nur 1 ½ Kilometer von der Ostsee entfernt liegt, ist der Tourismus wie wohl überhaupt die Zeit irgendwie an diesem Ort vorbeigerauscht. Aber die Nähe zur offenen See bestimmt natürlich den Charakter der Gegend. Und wohl auch den der Menschen.
Und da stellt sich eine wichtige Frage: Wer oder was ist die Ostsee eigentlich? Ist sie nur ein großer Binnensee oder doch ein wenn auch kleines aber doch schon richtiges Meer? Die von der Nordsee sagen, dass die Ostsee nur ein Tümpel ist. In Kiel gilt das mare balticum als allegorisches Wesen, dem die Stadt ihren bescheidenen Wohlstand verdankt. In der Außenförde ist sie auch ganz schön salzig, wenn auch kein Vergleich mit dem offenen Ozean oder auch nur der Nordsee. In Tallinn oder Luleå kann man das Wasser aus der Ostsee ohne weiteres trinken. Naja, abkochen wäre vielleicht tunlich. Arnald hat mal eine Handvoll Ostseewasser in
Oulu/Uleåborg einfach so getrunken. War Süßwasser! War auch nicht abgekocht und schlecht ist ihm auch nicht davon geworden.
Gezeiten gibt es zwar in der Ostsee, aber man merkt sie nicht. So kümmerlich fallen sie aus. Es hat sogar schon echte Tsunamis auf der Ostsee gegeben. Arnald durfte selbst einmal in Laboe im Sommer 1959 einen ganz kleinen Tsunami mitmachen. Innerhalb von Sekunden stieg das Wasser um gut 40 cm und verschwand genauso schnell wieder. Sagen Sie jetzt nicht, dass so etwas harmlos sei! Ein 10-jähriges Kind, das mit Eimer und Schaufel am Strand spielt, erschrickt sehr wohl bei einem solchen Phänomen. Das Wort Tsunami war damals aber noch völlig unbekannt.
Und wenn man bei Döhnsdorf auf die Ostsee blickt, so kann man keine Gegenküste erkennen, selbst bei guter Sicht nicht. Der dicke Buck Mulligan3), der in einem seltsamen Türmchen direkt an der Irischen See hauste, hatte einmal behauptet, dass alleine der Anblick des Meeres die Wirkung habe, das sich das Skrotum zusammenzöge. Wahrscheinlich stimmt das aber nur, wenn man an einem leicht diesigen Tag jenen schmalen Strich mit den Augen sucht, an dem die beiden Blaus, das des Himmels und das der See zusammentreffen. Und wenn dieser Strich wegen des Dunstes nicht zu erkennen ist, dann kann alles Mögliche geschehen. An solchen Tagen herrschen auch die besten Bedingungen, um Nixen und dreiköpfige Seeschlangen zu beobachten.
Überhaupt ist es schwierig, den Weg der einzelnen Däublers nachzuvollziehen. Johann hatte 8 Geschwister. Da der Standesbeamte, oder vielmehr der Kirchspielschreiber, der dieses Amt in Döhnsdorf inne hatte, des Lesens und Schreibens wohl auch nicht so recht mächtig und kundig war, wie es für einen Standesbeamten tunlich gewesen wäre, hat er den Geschwistern dann nicht nur verschiedene Vornamen gegeben, was ja in Ordnung wäre, sondern die Nachnamen auch noch verändert. Da heißen die Geschwister plötzlich mit Nachnamen Döwel, Diwell, Debel, Döbel und Deubel.4) Ja, hol‘s der Deubel! Wie soll man da ernsthafte Familienforschung betreiben. Von Johanns zahlreichen Geschwistern sind nur zwei berühmt geworden.
Großonkel Heinrich Debel wurde Schneidermeister in Kiel-Wik und gewann kurz von dem Ersten Weltkrieg 1000 Goldmark in der Lotterie. Unter großer Anteilnahme der Wiker Bevölkerung hat er dann seine Nähmaschine in den Hafen geschmissen und ist dann vierspännig durch die Wik gefahren, und hat die Schampuskorken knallen lassen. Natürlich waren 1000 Goldmark vor 1914 eine Riesensumme Geld. Ewig hielten die Talerchen indes auch nicht. Die Wiker Volkslegende berichtet, dass das Geld schneller alle war als gedacht, und Heinrich habe am Schluss seine Nähmaschine wieder aus dem Hafen gezogen, weil er weiter als Schneider arbeiten musste. Aber das wird wohl so nicht stimmen. Die Maschine wäre sicherlich durch das Hafenwasser völlig korrodiert gewesen. Unstreitig ist aber, dass er schließlich wieder Tag für Tag für seinen kümmerlichen Lebensunterhalt nähen, flicken und zuschneiden musste. Vielleicht war ja wenigstens noch so viel Geld übrig geblieben, dass er eine neue Nähmaschine kaufen konnte. Diese Geschichte wurde früher
den Kindern in der Wik und in Arnalds Familie als warnendes Beispiel dafür erzählt, wohin Verschwendungssucht führen kann. Ist aber ein ganz schlechtes Beispiel. Wenn Heinrich gespart hätte, wäre das Geld in der Inflation auch weg gewesen. So hat er wenigstens noch etwas davon gehabt.
Großonkel Walter Dobel, später Walt Doble, war auch ein aus Döhnsdorf zugewanderter Ellerbeker und gehörte zu den Werftleuten. Leider frönte er in hohem Maße dem Genuss geistlicher Getränke, insonderheit dem braunen Rum am liebsten in Form von Grog. Überhaupt war ja der Grog das Getränk, das in Kiel das gesellschaftliche Leben antrieb. Nicht etwa das Bier oder gar der Wein. Walters Gattin hatte von der Prohibition in den USA gehört, hielt dies für eine sehr vernünftige Idee des nordamerikanischen Staates. Laut sagte sie natürlich nur: „In Amerika werden die Arbeiter nicht wie der letzte Dreck behandelt. Dort gibt es den Achtstundentag, bezahlten Urlaub und vernünftigen Lohn für gute Arbeit.“
Sie drängte nun auf Auswanderung ins gelobte Land. Die Familie kam dann auch im Jahre 1923 wohlbehalten in Buffalo NY an, wo Großonkel Walter einen gut bezahlten Job auf der dortigen Binnen-Werft fand. Das Problem mit dem seit 3 Jahren in den USA herrschenden Alkoholverbot löste er auf seine Weise. Buffalo liegt am riesigen Eriesee, den der Zoll gerade in wolkenverhangenen Neumondnächten in keiner Weise richtig überwachen kann. Mitten durch den See verläuft die Grenze zwischen den USA und Kanada. Am anderen Ufer gegenüber von Buffalo liegt das ruhige kanadische Städtchen Fort Erie, in dem es seit 1920 mit der Ruhe aus war. Zahlreiche Schnapsdestillen waren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und in denen konnte man völlig legal unbeschränkte Mengen besten Whiskys kaufen. Offiziell war der natürlich zum Genuss im liberalen Kanada bestimmt. Aber wer sich da mit kleinen, schnellen und seegängigen Booten auskannte, und sich traute, nachts ohne Positionslaternen zu navigieren, war bald ein gemachter Mann.
Johann war es nicht vergönnt, reich oder berühmt zu werden, Er begann seine berufliche Karriere zunächst als Knecht auf Schloss Weißenhaus und versuchte die Kühe zu überreden, dass sie mehr und fettere Milch gaben. Aber Preußen wäre nicht Preußen gewesen, wenn sie ihn nicht geholt hätten. Von 1899 bis 1901 musste er Wehrdienst in der Festung Ehrenbreitstein in Coblenz ableisten. Das war kein Zuckerschlecken.
Das ganz normale Leben in einer Döhnsdorfer Landarbeiterfamlie war um 1900 natürlich auch überhaupt kein Zuckerschlecken. Da schaue man sich die Landarbeiterhäuser im Freilichtmuseum in Molfsee an! Es reichte nicht einmal zu einem richtigen Fußboden. Der Boden in der Wohnstube war mit Sand bedeckt, der sonnabends aufgekehrt wurde. Und dann wurde neuer, sauberer Sand vom nahen Ostseestrand geholt. Diese Ausflüge an die Ostsee waren so ziemlich die einzige Freizeitgestaltung, die es gab, außer dem Gasthaus. Und wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit mal ein Vollbad zu nehmen. Sanitär ging es unvorstellbar rustikal zu. Da gab es ein Häuschen neben dem Misthaufen und eine Pumpe auf dem Hof. Und im Winter war das Häuschen auch noch eingefroren. Allerdings gab es im Winter auch nicht so viel zu essen……. Hungersnot herrschte indes nie.
Die vielen Kinder der Däublers hatten nicht einmal alle eigene Betten und selbst Schuhe waren für Kinder Mangelware. Im Sommer liefen sie ohnehin barfuß, und im Winter hatten sie ein Problem. Die Verpflegung war sehr einfach und ärmlich: Kartoffeln und Buchweizengrütze. Am Sonntag ein wenig Fleisch, oft in Form von Schwarzsauer. Und was darin schwamm, blieb, wie der Name sagt, oft im Dunkel. Im Prinzip hatten sich die steinzeitlichen Lebensverhältnisse zwischen der Jungsteinzeit und 1890 nur minimal verändert. Aber es war ein Leben, in dem es doch so eine Art Reich der Freiheit gab. So schwärmte Johann davon, wie schön es war, am Sonnabend bei einsetzender Dunkelheit in den Dorfkrug zu fahren, und sich dort nach einer arbeitsreichen Woche einmal die Kante zu geben. Die Rückfahrt war auch kein Problem, denn die Pferde hatten auch mit promillegeschwängerten Kutschern keine Probleme, den Rückweg in den Stall zu finden. Auch der Reichsgraf wusste zwar wo oben und unten war, und wollte daran nichts ändern. Aber er wusste auch, was er an seinen Leuten hatte, und suchte den kameradschaftlichen Kontakt mit ihnen. Am Wahlsonntag lud er seine Knechte in den Dorfkrug ein. Natürlich nach dem Gottesdienst, weil ja der Pastor auch auf die Gläubigen einwirken sollte, nur solche Parteien zu wählen, die für Beständigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse standen. Die Mägde durften nicht mit ins Gasthaus, denn die durften ja nicht wählen, wie auch selbst die hoch gebildete Reichsgräfin nicht wählen durfte. Dort schenkte der Herr seinen Knechten recht kräftig ein und appellierte an sie, doch ja nicht SPD zu wählen. Richtig böse war er aber wohl auch wieder nicht, dass die Mehrzahl der Landarbeiter stramm zur SPD stand. Und wenn ein Knecht mal einen Tag blau machte, war das auch kein Unglück, Hauptsache die Arbeit wurde gemacht. Opa Däubler berichtete von einem Gespräch, das sich so oder so ähnlich abgespielt haben soll:
Graf: „Johann, wo büst du güstern wesen? Du würst nich bi de Arbeet.“
Johann: „I hefff unnern Boom leegen, Herr Graf.“
Graf: „Wat hest du da mookt?“
Johann: „Ick heff över dat Leven nahdacht.“
Graf: „Na, dann ist ja good, ick heff all dacht, du büst malad. Dann muss du hüüt man doppelt rinhauen bi de Arbeet!“
Wahrscheinlich hatte der Opa schon darüber nachgedacht, dass er dem Landleben Tschüß sagen wollte. Aber es sollte mit dem Wehrdienst erst einmal alles noch schlimmer kommen. Was man den einfachen Soldaten damals zumutete, war viel härter als das an Härte ohnehin schon harte, tägliche Leben. Damals bekamen Wehrpflichtige fast niemals Heimaturlaub, wurden grottenschlecht verpflegt, lebten in stinkigen Unterkünften, teilweise unter der Erde. Sie mussten sich die feuchten Strohsäcke, auf denen sie schlafen sollten, mit den Wanzen teilen. Und in den Strohsäcken war oft noch nicht einmal echtes Stroh sondern Häcksel. Und dann wurden die einfachen Soldaten auch noch von den Unteroffizieren wegen jeder Kleinigkeit geschlagen. Und man wurde nicht nur wegen Ungehorsam oder Ungeschicklichkeit, sondern auch wegen übergroßen Gehorsams verprügelt, weil auch das verdächtig war. Die Offiziere auf Ehrenbreitstein hingegen lebten in unvorstellbarem Luxus, frönten in ihren Casinos einem Leben wie in einem englischen Herrenclub. Da kam nichts Billiges auf den Tisch. Fünfgängige Menüs, beste Weine und französischer Cognac standen auf der Tagesordnung. Und die Mannschaften lebten in den nasskalten Kasematten auf faulendem Stroh und Häcksel. Zum Essen bekamen sie oft Eingeweide mit Graupen, die so lange gekocht worden waren, bis das Ganze wieder fest geworden war. Wer jetzt nicht Sozialist wurde, dem hatte man das Gehirn geklaut. Allerdings hatte man wohl vielen Leuten das Gehirn geklaut, sonst hätte das Kaiserreich ja nicht funktioniert.
Endlich wurde Johann im Jahre 1901 als Canonier des 1. Schleswig-Holsteinischen Fußregiments mit einem Entlassungsgeld von 1,32 Reichsmark nach Döhnsdorf zurückgeschickt. Das war damals auch schon sehr wenig Geld gewesen, aber jetzt durfte er sich wieder den Kühen von Schloss Weißenhaus widmen. Und hier lernte er die schlaue Magd Elise Voß kennen, die in Weißenhaus allerlei Büroarbeiten und die Buchhaltung erledigte.
*****
Am 01.11.1903 heiratete Johann Däubler dann vor dem Standesamt in Kaköhl die Dienstmagd Elise Caroline Ernestine Voß. Elise Voß war am 22.03.1877 in Blekendorf bei Lütjenburg geboren worden. Deren Eltern waren Johann Friedrich Karl Voß und seine Gattin Friederike Marie Christiane Voß, geborene Kardel, beide aus alt eingesessenen Blekendorfer Familien. In der Familie Voß hatte man eigenes Vieh auf eigenem Land und legte auch Wert auf gute Ausbildung, selbst für die Mädchen. Auch wenn Elise Voß nur die preußische Volksschule abgeschlossen hatte, besaß sie doch eine relativ weit gefächerte Bildung. Lesen und fehlerfreies Schreiben auch längerer Texte waren für sie normal. Und landwirtschaftliche Buchhaltung kannte sie von ihrer Familie. Zur Zeit der Eheschließung mit Johann Däubler lebte sie tatsächlich auf einem Schloss: Dem prächtigen, adeligen Anwesen Schloss Weißenhaus. Das hört sich jetzt großartiger an, als es war, denn sie war ja nur Dienstmagd und keine Prinzessin. Aber auch die Reichsgrafen Platen-Hallermund waren froh, wenn sie Gesinde hatten, das gut Lesen, Schreiben und Rechnen konnte und vertrauten solchen Leuten schon einiges an Verantwortung an. Wenigstens einer musste ja wissen, wie viele Kühe auf den Wiesen grasten und wie viele Kälber geboren wurden und wie viele Liter Milch die einzelnen Kühe gaben und wieviel Milch eine Kuh im Durchschnitt gab, und wieviel Raufutter je Kuh im Winter zu gefüttert werden musste. Die Gutsherren selbst wollten sich mit derartigen Fragen auch nicht allzu sehr beschäftigen, denn sie hatten ja gesellschaftliche Verpflichtungen.
Denn es war keineswegs normal, dass jemand der die preußische Volksschule absolviert hatte, irgendwie besonders viel oder überhaupt etwas konnte. Das wurde dort eigentlich auch nicht verlangt. Den eigenen Namen schreiben, Verbotsschilder der Obrigkeit lesen können, die Grundrechenarten bis 100 und ein bisschen Beten reichten für den Schulabschluss. Opa Däubler erzählte:
„Ich durfte als kleiner Junge im Sommer gar nicht zur Schule gehen, weil ich in der Landwirtschaft mithelfen musste, und im Winter war der weite Schulweg nach Wangels wegen dem Schnee nicht zu bewältigen. Ich hatte auch überhaupt keine Schuhe.“ Das war zunächst glaubwürdig. Ostholstein ist ja auch heute noch berüchtigt wegen plötzlicher Schneeverwehungen. Und damals war irgend so etwas wie eine Zwischeneiszeit und es gab ständig Schneeverwehungen von November bis März. Weiße Ostern waren normal.
Allerdings kann die Geschichte nicht stimmen, auch wenn sie schön ist. Es gab damals eine zweiklassige Dorfschule in Döhnsdorf, für die der Reichsgraf alle finanziellen Defizite ausglich, wie einige Heimatforscher herausbekommen haben. Und natürlich konnte Johann lesen und schreiben und hatte oft einen erstaunlichen Durchblick auch bei schwierigen Sachverhalten politischer und naturwissenschaftlicher Art. Und, was Arnald immer faszinierte: Er sprach nicht nur fast ausschließlich Plattdeutsch, er schrieb es auch. Nach festen Rechtschreibregeln. Weiß der Teufel, wo diese Regeln herkamen. Vielleicht doch aus der Döhnsdorfer Volksschule. Umgekehrt las er auch völlig ohne jedes Problem die in Hochdeutsch gedruckte Kieler Volkszeitung.
Arnald wollte natürlich noch mehr über die Schulerfahrungen seines Großvaters hören: „Aber Opa! Wieso kannst du denn lesen und schreiben, wenn du gar nicht zur Schule gegangen bist?“
Opa Däubler war nie um eine Antwort verlegen: „Ich bin am Ersten April geboren. Kinder, die am Ersten April geboren sind, können von Natur aus lesen und schreiben. Auch Rechnen und Heimatkunde!“ Arnald rechnete verzweifelt. Er war zehn Tage zu früh geboren.
Opa Däubler gab seinen Beruf immer mit Knecht an. Man muss bei der Berufsbezeichnung Knecht aber bedenken, dass sich das Wort Knecht heute schlimmer anhört, als es das Berufsbild damals war. Ein Knecht wird zwar geknechtet, wie sein Name schon sagt, andererseits ist ein Knecht eine landwirtschaftliche Fachkraft, die den gesamten Produktionsprozess von Aussaat bis Ernte eigenständig organisieren kann. Oder wie das mit den Kühen geht.
Es gibt auch berühmte Knechte wie Uli, den Knecht, Knecht Ruprecht und Franz Gans, den Knecht von Oma Duck. Als der in Kur geschickt wird, weil er zu fett geworden ist, bestellt sich die Oma eine Ersatzkraft beim Knechteschnelldienst. Und der von diesem Dienst geschickte Knecht, Toby Treibauf, organisiert Oma Ducks Bauernhof von Grund auf neu. Sehr zum Verdruss der Bäuerin, die gar keine Neuerungen und Arbeitserleichterung will. Also: Knecht ist eigentlich ein ganz angesehener, ehrbarer Beruf, nur das Wort ist in Verruf geraten.
Die jungen Eheleute Däubler verließen das Landleben und die Kühe und zogen nach Ellerbek bei Kiel, um dort ihr Glück zu machen. Treibende Kraft bei dem Projekt war wahrscheinlich Elise:
„Jehan, wir sollten in die Stadt ziehen. Hier auf dem Land können wir schuften bis zum Umfallen und bleiben doch nur in unserem Pisspott hocken.“
Johann: „Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe schon in Lütjenburg und Oldenburg rumgefragt. Aber die haben auch keine vernünftige Arbeit für uns.“
Elise: „Ich hatte mehr an eine richtige Stadt gedacht.“
Johann: „Wie? Was? Richtige Stadt? Du meinst wir sollten nach Plön oder Preetz gehen. Oh, Gott! Das Leben in so großen Städten! Wie soll das gehen?“
Elise: „Ich hatte an Kiel oder Lübeck gedacht. Oder Hamburg. Auf den Werften suchen sie Leute und die werden gut bezahlt. Da gibt es zehnmal mehr Lohn als in der Landwirtschaft.5) Außerdem gibt es in der Stadt vernünftige Schulen für die Kinder. Die sollen mal was Besseres werden als Knechte und Mägde auf dem Gutshof von einem Grafen.“
Johann: „Welche Kinder?“
Elise: „Unsere natürlich, du Schaf!“
Johann wird aber wohl auch sehr einverstanden gewesen sein mit den Umzugsplänen und froh darüber, dass es jemanden gab, der das organisierte. Das Landleben riss ihn nicht so richtig vom Hocker. Er äußerte sich oft, wenn jemand vom naturnahen Landleben schwärmte: „Dat Liv upp‘n Dörp is so‘n Elend. En Wunner, dat dor nich alle Kommunissen sün.“
Der Reichsgraf ließ seine Buchhalterin nicht gerne ziehen, hatte aber Verständnis für den Wunsch, sich zu verbessern. Er gab Elise noch mit auf den Weg: „Das Leben in der Stadt ist auch kein Honigschlecken! Aber wenn Sie mal Hilfe brauchen, können Sie sich an mich wenden.“
Viele Jahre später war es dann so weit, dass der Reichsgraf an dieses Versprechen erinnert werden sollte.
*****
Das Leben in Kiel schien zunächst zu halten, was es versprochen hatte. Johann bekam Arbeit auf der Germania-Werft. Auf dem Grundstück Klosterstraße 38 in Ellerbek entstand ein für die damaligen Verhältnisse wohl recht großzügiges Einfamilienhaus. Zeichnungen und Bilder gibt es nicht mehr, aber nach den Erzählungen muss es wohl recht weiträumig gewesen sein. Das musste es auch sein. Immerhin wurden zwischen 1906 und 1911 vier Töchter geboren: Paula, Emmi, Anni und Elfriede.
Johann schuftete auf der Germania-Werft und Elise verwaltete das Geld. Trotz ihrer eigentlich guten Bildung, denn welche Frau konnte damals schon Buchhaltung, und ihren wirtschaftlichen Talenten konnte sie es aber nicht zu einer eigenen beruflichen Selbständigkeit schaffen. Allerdings hatte sie sich selbst zur weisen Frau ausgebildet, wohl auch einiges von ihrer eigenen Mutter gelernt, und beherrschte die Künste der weißen und möglicherweise auch der schwarzen Magie. Johann lachte immer darüber. Höhnerkrom, nannte er alles, was ihm zu metaphysisch war, und das war für ihn alles, was nicht mit den fünf Sinnen zu fassen war oder von mindestens drei ernst zu nehmenden Professoren bestätigt worden war. Immerhin soll Elise gerade bei Hühnern gute Heilerfolge erzielt haben. Johann spottete: „Wenn es bei den Hühnern mit dem Eierlegen nicht klappt, muss man der Legalität mit Zaubersprüchen auf die Sprünge helfen. Und wenn sie nicht brüten wollen, muss man die Brutalität beschwören.“ Allerdings gab es bei guten Heilerfolgen auch immer mal ein Dutzend Eier oder ein Suppenhuhn als Erfolgsprämie. Nach dem Tod von Elise haben ihre Töchter ihre beiden Zauberbücher verbrannt, damit es nicht heißt:
„Oma Däubler war eine Hexe.“
Etwas freundlicher könnte man natürlich auch sagen, dass sie als erfahrene Heilpraktikerin erfolgreich tätig war und zwar gleichermaßen für menschliche und tierische Patienten. Und dass sie außerdem noch die Zukunft voraussagte, ist ja auch nicht ehrenrührig.
Das Leben der Werftleute in der Kaiserzeit war bewusstseinsmäßig schwierig. Einerseits verschafften die Werften ihnen sichere Arbeitsplätzte und wer fleißig war und etwas konnte, machte auch eine Menge Geld, jedenfalls daran gemessen, was man in der Landwirtschaft verdiente. Aber alles war ein Strohfeuer, das auf der maßlosen Aufrüstung der Kriegsmarine fußte. Die Werftleute selbst standen durchweg politisch links. Auf dem Ostufer in Kiel bekam die SPD normalerweise 60 bis 80 % der Stimmen. Aber ohne das verhasste kaiserliche, militaristische System war der Wohlstand nicht denkbar. Abrüstung hätte für viele der internationalistisch denkenden Werftarbeiter das ökonomische Aus bedeutet. Und welche Alterativen es zur Hochrüstung gab, war unklar.
2. Von Ellerbek nach Berlin
Die Ellerbeker Idylle nahm dann auch ein rasches und bitteres Ende. Der Erste Weltkrieg brach aus – ausbrechen ist kein so guter Ausdruck für das, was die Mächtigen damals veranstaltet haben – Vulkane brechen aus, wilde Stiere können aus der Koppel ausbrechen - Kriege werden von Menschen vom Zaun gebrochen - und der Kaiser glaubte, nicht ohne den sozialdemokratischen Werftarbeiter Johann Däubler das aus irgendeinem Grund als feindlich angesehene Frankreich niederringen zu können. Schon ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges stand es fest, dass das hoch gerüstete Kaiserreich nur ein Riese auf sehr tönernen Füßen war.
Nicht nur dass es außerstande war, für eine auch nur halbwegs annehmbare Ernährung seiner Bürger zu sorgen, es war auch weitgehend unfähig, seinen Soldaten an der Westfront in vernünftigem Ausmaß Heimaturlaub zu organisieren. Erst nach einem Jahr Krieg konnte Johann für einige Tage zu seiner Familie, und mit ihnen Rübenschnitzel in warmem Salzwasser essen. Elise war gezwungen, mit Hilfsarbeiten in der Rüstungsindustrie Geld heranzuschaffen. Die älteren Geschwister mussten auf die jüngeren aufpassen. Dabei war Paula bei Kriegsbeginn auch erst 8 Jahre alt. Auf der Werft gab es schon 1915 Unruhen wegen des andauernden Krieges, der schlechten Versorgungslage, ab 1916 dann auch Meutereien bei der Marine.
Elfriede war bei Ausbruch des Krieges erst 3 Jahre alt. Sie erzählte, dass sie natürlich überhaupt nicht begriffen hatte, was los war. Sie nahm es als selbstverständlich hin, dass ein Vater nicht existierte und mehr und mehr in Vergessenheit geriet, dass die Mutter immer verhärmter und verzweifelter wurde, und auch dass es nichts zu essen gab. Hunger als Normalzustand! Im Jahre 1917 wurde sie dann hungrig und verfroren an einem eisigen Tag im April in die evangelische Bugenhagenschule in Kiel-Ellerbek eingeschult. Dort ging es streng zu. Aber irgendwelche Probleme schien sie in der Schule nicht gehabt zu haben.
Für Johann hatte der Irrsinn des Ersten Weltkrieges bereits Ende 1917 ein Ende. Drei Jahre und vor allem drei Winter im feuchten Schützengraben hatten zu einem rheumatischen Leiden geführt, dass es ihm nicht mehr möglich machte, für seinen Kaiser nun auch noch den vierten Winter im Schützengraben zu stehen. Mit 39 Jahren war er nach damaligen Vorstellungen ja auch nicht gerade mehr ein junger Mann.
„Krankheitshalber nach Kiel-Ellerbek beurlaubt“, heißt es in seinem Wehrpass etwas bedrohlich, denn Urlaub kann seinem Wesen nach ja auch zu Ende gehen. Paula, die das ganze Grauen des Krieges schon ziemlich genau mitbekommen hatte, war ein sehr ernstes Mädchen geworden. Und jetzt kam auch bald noch ein Sohn, Herbert, auf die Welt.
Schließlich kam auch noch die Weltgeschichte nach Ellerbek. Anfang November brach die Novemberrevolution aus, allerdings auf dem Kieler Westufer, in der Wik, am Wilhemsplatz und in der Legienstraße am Gewerkschaftshaus. Nach einigen Tagen kam die Revolution auch ins verschlafene Ellerbek. Elfriede spielte auf der damals noch kaum befahrenen und nicht gepflasterten Klosterstraße. Sie war gerade einmal sieben Jahre alt, war aber der Meinung, dass sie die Welt schon verstand. Da kam ein Matrose mit einem Haufen Stielhandgranaten, die an seinem Gürtel baumelten, die Klosterstraße von der Werft aus hoch. Ehe sie den Matrosen fragen konnte, was der Onkel da machte, und warum er so große Lollies am Gürtel hatte, rief ihre Mutter: „Komm sofort von der Straße. Da draußen ist Revolutschon und so lange Revolutschon ist, wird nicht auf der Straße gespielt.“
„Was ist Revolutschon?“ wollte Elfriede wissen. Die Mutter schüttelte verständnislos den Kopf: „Dafür bist du noch zu klein. Ich habe die Revolutschon übrigens schon 1914 prophezeit: „Und das Volk wird sich erheben und die Kaiser und Könige von den Thronen stoßen. Und ihr Blut wird in die Gräben fließen und die Raben werden sich an dem Blute laben. Ja, in Russland haben sich die Raben ja schon ganz schön gelabt und nun wird das in Deutschland auch so kommen.“
Am Abend kam der Vater von der Arbeit zurück. Wegen seines Kriegsleidens arbeitete er jetzt nicht mehr auf der Werft, sondern bei der Stadtreinigung, wo man gerade einen revolutionären Arbeiterrat gewählt hatte. Elfriede wollte auch von ihm wissen: „Papa, was ist eine Revolutschon.“ Und der Vater, der noch ganz euphorisiert und erregt war von der Wahl des Arbeiterrates, meinte ganz zuversichtlich:
„Das heißt, dass jetzt nicht mehr der Kaiser sagt, wo es lang geht, sondern dass wir Arbeiter selbst unser Schicksal bestimmen! Man de Revolutschon mutt ook struturell sien, sünst ward dat nix.“
Zwischen dem Frühjahr und dem Dezember 1923 reckte die Weltwirtschaft ihre schmierigen Finger auch nach Ellerbek in Form der Hyperinflation. Elfriede war jetzt zwölf Jahre alt, hatte eine Eins in Rechnen bekommen und meinte, sich mit der Wirtschaft auszukennen. Wenn sie für fünf Pfennige eine Zuckerschnecke beim Bäcker kaufte, dann musste der davon einen Pfennig an den Müller bezahlen für das Mehl, einen Pfennig an den Zuckerfritzen, damit die Schnecke auch schön süß wurde. Ein Pfennig ging für das Backen drauf. Der Ofen hatte Geld gekostet und die Kohlen kosteten auch. Und mit einem weiteren Pfennig finanzierte der Bäcker sein Ladengeschäft und bezahlte seine Leute. Und einen Pfennig brauchte er zum Leben für sich und seine Familie. Wirtschaft war nicht wirklich schwierig.
Aber plötzlich kostete die Schnecke zehn Pfennige, dann zehn Mark, dann tausend Mark und schließlich mehrere Millionen. An manchen sehr schlechten Tagen kostete die Schnecke morgens zehn Millionen Mark, mittags zwölf Millionen und abends schon fünfzehn Millionen. Die vier Schwestern mussten täglich mit einem Wäschekorb zum Lohnbüro der Stadtreinigung, wo ihnen der Lohnbuchhalter Vaters Tageslohn hineinschaufelte. Und dann ab im Laufschritt zum Bäcker oder zum Milchmann oder zum Lebensmittelhändler und rasch eingekauft, ehe das Geld entwertet war. Die Geldscheine wurden hinter den Tresen der Läden geschüttet.
Elfriede, die ja geglaubt hatte, den Kreislauf der Wirtschaft verstanden zu haben, begann zu zweifeln und fragte ihre Mutter: „Wie macht der Bäcker das eigentlich. Mittags bekommt er ein paar Milliarden Mark für Brot und Schnecken. Aber abends ist das Geld noch weiter entwertet. Wovon kauft er dann beim Müller Mehl, das ja auch laufend teurer geworden ist. Wieso gibt es überhaupt noch Brot?“
Die Mutter stutzte einen Augenblick. Offenbar hatte sie sich darüber auch noch keine Gedanken gemacht sondern war froh, dass es überhaupt noch Brot gab. Sie antwortete in der Art, in der Erwachsene so antworten, wenn sie auch keinen blassen Schimmer haben: „Dafür bist du noch zu klein. Aber ich habe schon 1914 prophezeit: Es wird eine große Teuerung über das Land kommen und die Menschen werden froh sein, wenn sie noch Wasser und Brot bekommen. Aber selbst das tägliche Brot und das Wasser werden knapp werden. Und es wird Heulen und Zähneklappern herrschen und der Verzweiflung kein Ende.“
Elfriede war klar: Von Muttern würde keine befriedigende Erklärung kommen. Hier war väterlicher Rat gefragt: „Papa, wieso haben wir eigentlich Inflation. Und wieso kann der Bäcker noch Mehl kaufen, wenn das Geld, das er tagsüber einnimmt schon am Abend nichts mehr wert ist.“ Vattern war beim Schulungsabend der Partei gewesen und wusste tatsächlich mehr:
„Ich glaube wir müssen jetzt den Krieg bezahlen. Ihr Kinder habt ja keine Ahnung, was allein schon das normale alltägliche Leben so kostet. Aber der Krieg ist noch viel teurer gewesen. Der Kaiser will ihn nicht bezahlen, die Fabrikbesitzer und Gutsherren wollen nicht zahlen und die Banken schon gar nicht. Deshalb müssen wir Arbeiter jetzt auch noch den Krieg bezahlen.“
„Ja, und wie geht das mit dem Bäcker und dem Mehl?“
„Also, das versteh ich auch nicht. Da müssen wir die Nationalökonomen fragen.“
„Was sind Nationalökonomen, Papa?“
„Das sind schlaue Leute, die die Wirtschaft studiert haben. Und die wissen so etwas.“
„Dann will ich auch Nationalökonom werden, wenn ich groß bin.“
„Na, dann mal to mit dat Studeeren!“ kommentierte Vater Däubler den Berufswusch seiner Tochter.
*****
Als Elfriede 1925 die Volksschule mit einem sehr guten Zeugnis verließ, war sie schon vollkommen für die Ideen des Sozialismus entflammt. Aber die Zeiten für 14-jährige Sozialistinnen waren gar nicht gut. An eine qualifizierte Ausbildung war gar nicht zu denken. Sie nahm, damit Geld in die Kasse kam, eine Stelle als Gänsehirtin an. Irgendwo da, wo heute der Stadtrat-Hahn-Park liegt. Damals ein Ökotop an dem Flüsschen Ellerbach, das damals noch nicht verrohrt und noch weitgehend als Flüsschen zu erkennen war und vom Tröndelsee in Elmschenhagen durch den Schwanensee zur Mündung in die Förde bei eben jenem Orte Ellerbek strömte, der nach ihm benannt war. Das klingt jetzt romantisch. Nach kleiner Gänsehirtin von Hans-Christian Andersen! Allerdings war der Job wohl die reine Knochenarbeit. Gänse sind sehr selbstbewusst und eigensinnig wie junge Katzen, aber viel stärker. Außerdem haben sie Flügel. Um Gänse am Starten zu hindern, muss man sie blitzschnell an den Schlagfittichen festhalten.6)
Möglicherweise war aber der Umgang mit dem Geflügel eine gute Vorbereitung für den späteren Lehrerberuf. Gemein war es, dass die Herrin der Gänse, eine Bäuerin aus dem damals noch ländlichen Gebiet zwischen Klausdorf/Schwentine und Ellerbek, ihre Angestellte überhaupt nicht bei der Sozialversicherung anmeldete, was dann tatsächlich ein Problem ergab, als Elfriede Rente beantragte. Aber so war die Bewusstseinslage damals bei vielen Dienstherren: Mädchen heiraten ja sowieso. Was sollen wir da Rentenversicherungsmarken für sie kleben. Dabei war illegale Beschäftigung nicht sozialversicherter Arbeitnehmer damals schon verboten und strafbar.
*****
So ganz ist der weitere berufliche Lebensweg von Elfriede jetzt nicht zu rekonstruieren. Zunächst arbeitete sie als Hausgehilfin bei dem reichen Bäcker Lange am Alten Markt. Zwischen Juni 1926 und November 1928 hatte sie eine feste Stelle als Helferin im Landesjugendheim Cismar. Vom Juni 1929 bis Februar 1930 war sie als Haushälterin oder doch eher Hausgehilfin im Hause Böttner im feinen Niemannsweg in Kiel tätig. Von Februar 1930 bis September 1933 arbeitete sie dann im Kindererholungsheim Dibbersen als Küchenleiterin. Das Erholungsheim gehörte der sehr proletarischen Stadt Harburg, heute südlichster Bezirk Hamburgs, in dem es natürlich sehr viele erholungsbedürftige, blasse und magere Arbeiterkinderkinder gab. Dibbersen liegt eigentlich nur am Stadtrand Harburgs in den so genannten Harburger Bergen. Aber für ein Harburger Arbeiterkind war das ziemlich weit draußen. Wie es möglich war, dass Elfriede als nur gerade einmal 20-jährige, die eigentlich gar nichts gelernt hatte, Leiterin einer Großküche geworden war, ist bei den heutigen Anforderungen an Berufsqualifikation nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Idylle war fragil. Schon 1932 drohte ein besoffener SA-Mann, der vor dem Kinderheim randalierte: „Eure rote Höhle werden wir bald ausräuchern!“
Und dann kamen die Nazis tatsächlich an die Macht. Elfriede bezeichnete sie öffentlich als „arbeiterfeindliche Schweinebande“. Eine Partei die sich selbst mit Nachnamen „Sozialistische Arbeiterpartei“ nennt, ließ das nicht auf sich beruhen. Elfriede flog aus ihrem Traumjob raus. Mehr Schikanen hatte sie aber nach eigenem Bekunden nicht erfahren außer einigen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, eine neue Stelle zu finden. Sie schlug sich in der Folgezeit mit diversen Tätigkeiten durch, teils auch mit ziemlich niedrigen Hilfsarbeiten im Tiefbau. Dokumente finden sich nicht und die Erzählungen der Alten gingen oft sehr durcheinander. Aber irgendwie ist sie beruflich wieder auf die Beine gekommen.1935 war sie schon wieder als Küchenleiterin tätig, zunächst im noblen Helenenbad in Neustadt/ Holstein. Allerdings verlor sie auch diese Stelle schon nach einem Jahr, weil die Leitung des Etablissements Wert darauf legte, dass die leitenden Angestellten stramme Nazis waren.
Nun war die Not groß. Elfriede kehrte erst einmal ins Elternhaus in die Klosterstraße in Ellerbek zurück. Platz gab es da ja. Die großen Schwestern waren alle schon außer Haus. Vater Däubler fasste die desolate Lage realistisch zusammen: „Du bist jetzt schon Mitte Zwanzig, hast keinen richtigen Beruf erlernt und hast keinen Mann. Und der Sozialismus kommt auch nicht, jedenfalls nicht so bald. Wenn du keine richtige Arbeit mehr findest, musst du heiraten.“
Elfriede war den Tränen nahe und protestierte: „Aber ich wollte doch Wirtschaft studieren und Lehrerin werden.“
Ihr Vater brummte: „Heutzutage gibt es keine Wirtschaft mehr. Nur noch Misswirtschaft!. Ohne Geld kannst du nicht studieren. Und ohne Arbeit hast du kein Geld. Oder du musst reich heiraten. Dann betohlt din Mann villich dat Studium. Een annern Wech gifft dat nie.“
Mutter Elise mischte sich ein: „Dann muss uns der Reichsgraf von Platen-Hallermund helfen. Das hat er mir versprochen, als wir nach Kiel gezogen sind. ‚Wenn einer von Ihnen mal in Not gerät, zögern Sie nicht, mich anzusprechen. Wenn ich helfen kann, werde ich es versuchen.‘ Hat der Reichsgraf jedenfalls gesagt.“
Elfriede und ihr Vater riefen wie aus einem Munde: „Nein, das geht nicht. Der Graf erinnert sich überhaupt nicht mehr an so Leute wie uns.“
Aber Mutter Däubler war zuversichtlich: „Doch, doch! Versprochen ist versprochen. Und mit den Nazis hat Graf der auch nichts am Hut.“
Dann hat sie wahrscheinlich einen Brief geschrieben, in dem so etwas stand wie: „Herr Graf, können Sie nicht etwas für meine Tochter tun. Die ist mit den Nazis angeeckt und kriegt nun keine Arbeit mehr. Dabei kann sie gut und auch für viele Menschen kochen. Im Kinderheim hat sie schon für mehr als hundert Leute gekocht. So eine wird doch auf Schlössern auch immer gebraucht!“
Und schon stand Elfriede in der Schlossküche und wirtschaftete drauf los. Allerdings nicht mehr im prächtigen Schloss Weißenhaus, denn die Reichsgrafen waren 1933 in das wesentlich schlichtere Gutshaus Friederikenhof umgezogen. Wie allerdings jemand, der den Kochberuf gar nicht gelernt hat und in einem proletarischen Kinderheim Haferschleim und Bohnensuppe gekocht hat, in einer Schlossküche reüssieren konnte, bleibt letztlich ein Rätsel. Elfriede vertrat aber immer die Ansicht:
„Man muss nur die Prinzipien verstehen. Dann findet sich der Rest von selbst.“
Die Prinzipien einer Schlossküche hatte sie wohl verstanden, denn die gräfliche Familie hing sehr an ihr und ihren Kochkünsten. Aber die Welt außerhalb des Schlosses wurde immer härter und gleichgeschalteter. Als der Reichsgraf hörte, dass die NSDAP einen Eintopfsonntag eingeführt hatte, bei dem an einem bestimmten Sonntag im Monat nur Eintopf gegessen werden sollte und das für den Sonntagsbraten bestimmte Geld dem Winterhilfswerk gespendet werden musste, ordnete er an:
„Fräulein Däubler, holen Sie bitte beim Hofmeister vier Perlhühnchen und machen Sie uns doch bitte einen schmackhaften Eintopf daraus. Wir wollen doch nicht abseits stehen, wenn die ganze Volksgemeinschaft Eintopf isst.“
Als im Jahre 1936 eine pseudodemokratische Abstimmung über die Ziele Adolf Hitlers stattfand, holte die SA ab 16.00 Uhr alle Bürger von zuhause ab, die noch nicht gewählt hatten, weil ja eine Wahlbeteiligung von 99 % erreicht werden sollte. Als die SA-Leute beim Reichsgrafen erschienen, erklärte er:
„Wir dürfen leider nicht zur Wahl. Wir sind nämlich allesArgentinier hier.“
SA-Mann: „Wie? Was? Argentinier? Auch ihre Leute?“
Graf: „Ja, hier gibt es nur Argentinier!“
SA-Mann: „Ach so! Dann nichts für ungut!“
So blieb es auch Elfriede als Beuteargentinierin erspart, bei dieser Wahl zur erscheinen, bei der die NSDAP angeblich 98,6 % Zustimmung erhalten hat. Kein Wunder für den, der etwas von Wahlfälschung versteht! Die Streichung aller Bewohner von Friederikenhof aus dem Wählerverzeichnis als vermeintliche Argentinier war da sicher noch die harmloseste Übung gewesen. Als der Reichsgraf dann tatsächlich nach Argentinien auswandern wollte, weil es mit Deutschland doch nichts mehr werde, und er Elfriede mitnehmen wollte, bekam sie es mit der Angst vor der Fremde und den fremden Sprachen:
„Aber, Herr Graf, ich kann doch noch nicht einmal Englisch. Wie soll ich mich denn in Argentinien zurechtfinden. Ich könnte ja nicht einmal einkaufen, weil man mich im Laden nicht versteht.“
„Das macht doch nichts! Außerdem spricht man in Argentinien Spanisch. Und das lernt sich schnell!“
Elfriede meinte, dass sich auch Spanisch nicht so schnell lernt und blieb lieber in Nazi-Deutschland mit seinen düsteren Zukunftsaussichten. Irgendwie schlängelte sie sich weiter durch die Nacht und Not der Zeit. Wohl durch alte Verbindungen nach Harburg, das seit 1937 Teil Hamburgs geworden war, wurde sie wieder Küchenleiterin eines Harburger Kinderheims und zwar in Cuxhaven-Duhnen, wo sich nach und nach auch die anderen aus dem Heim in Dibbersen herausgeflogenen Mitarbeiterinnen einfanden.
Viele Genossen aus Kiel waren aber verschwunden, teils saßen sie im KZ, einige waren auch ins Ausland gegangen. Und mehrere alte Bekannte kämpften ab 1936 bei den Interbrigaden in Spanien. Die spanische Republik hatte versprochen, die Spanienkämpfer nach dem Sieg alle einzubürgern. Und einige alte Freunde waren auch umgebracht worden. Und wieder einige waren selbst zu Nazis geworden. In Cuxhaven stellte ihr dann auch noch ein hünenhafter SS-Mann nach. Kein Wunder, denn Elfriede war erstaunlich groß, blond und und blauäugig. Einerseits waren Beziehungen zu SS-Männern natürlich ganz gut, weil sie einen irgendwie beschützen konnten, andererseits waren sie auch gefährlich, weil man zu nahe bei den Trägern der Macht war. Und wenn ein SS-Mann heiraten wollte, musste er eine Genehmigung seines Unterführers und seines Oberführers beibringen. Die Beziehung ging dann auch bald zu Ende – warum auch immer- und der tief betrübte Nazi schenkte Elfriede zum Abschied eine Prachtausgabe der Edda mit der persönlichen Widmung: „Nicht im Sieg zeigt sich die wahre Größe, sondern in der Niederlage“.
Schwer getroffen wurde Elfriede vom Tod ihrer ältesten Schwester Paula. Die hatte einen steilen beruflichen Aufstieg hingelegt. Sie war Leiterin einer Kindergärtnerinnen- und Fröblerinnenschule geworden. Auch Herta Wuff, eine enge Freundin Elfriedes, hatte sich für eine Fröblerinnenausbildung an eben dieser Anstalt beworben. Sie kam aus dem Vorstellungsgespräch völlig demoralisiert und verweint nach Hause: „Die Leiterin der Ausbildungsanstalt, eine gewisse Frau Kuklinski, ist eine ganz böse Frau. Die kann nicht einmal lächeln. Die mag mich nicht. Da werde ich bestimmt nicht genommen.“
Elfriede lachte und erklärte: „Das war doch nur meine große Schwester. Die ist nicht böse, sondern nur ernst, weil es so viel Unrecht in der Welt gibt.“
Sie hatte den sehr linken Sozialdemokraten Wilhelm Kuklinski (1892 – 1963) geheiratet. Kuklinski stand für eine kompromisslos sozialistische Politik und war Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterjugend. Er war gelernter Schriftsetzer und hatte einige Semester Wirtschaftswissenschaften an der Uni in Kiel studiert, bevor er hauptamtlicher Parteisekretär der SPD wurde. Im Jahre 1935 wurde der erste Enkel von Johann und Elise geboren: Ernst Kuklinski. Und nur zwei Jahre später war Paula gestorben.
*****
Dann brach der zweite Weltkrieg aus. Johann konnte wegen seines inzwischen vorgerückten Alters – 61 Jahre - und seiner angeschlagenen Gesundheit hoffen, nicht schon wieder nach Frankreich oder sonst wohin an die Front geschickt zu werden, sondern bemühte sich um eine Invalidenrente. Überhaupt nahm er das kriegerische Geschehen recht gelassen hin: „Diesmal müssen Kaiser, Führer oder wer auch immer ohne mich den Krieg verlieren. Und wo findet dieser Krieg überhaupt statt? In Polen? Na, das ist ja glücklicherweise weit weg. Bis Ellerbek wird der Krieg wohl nicht kommen.“
Elfriede war etwas verzweifelter: „Wenn die Nazis jetzt Blitzsieg auf Blitzsieg erringen, dann bleiben sie ewig an der Macht. Aber wir in Kiel werden wohl vom Schlimmsten des Krieges verschont bleiben.“
Elise war hingegen völlig verzweifelt. Schon wieder ein Krieg, wo sie den letzten noch gar nicht richtig verdaut hatte. Und nun redeten ihr Ehemann und ihre Tochter das Problem auch noch klein. Sie schimpfte: „Aber der Hunger hat keine Mühe, nach Ellerbek zu kommen. Der findet uns überall. Im letzten Krieg sind die Leute hier in der Straße schon verhungert. Und sind geschwächt, wie sie waren, an der Spanischen Grippe verreckt.“
Dann schleppte sie einen alten, schwarzen Folianten heran, der schon halb aus dem Leim gegangen war, und auf dessen Vorderseite geheimnisvolle Hieroglyphen zu sehen waren. Mit Grabesstimme las sie vor, was da geschrieben stand: „Im vierzigsten Jahr im Jahrhundert des Wolfes wird ein zweiter großer Orlog über die Welt kommen. Und dieser Orlog wird schlimmer und länger wüten als der erste. Wenn die Posaune des Würgeengels ertönt, wird Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, und alle, die sich dann noch auf den Beinen sind, werden davon gebrannt werden, und alles, was ihres war, wird zu Asche zernichtet sein. Die Hungernden werden nicht essen und die Dürstenden nicht trinken können. Die Kranken werden nicht geheilt und die Verzweifelten nicht getröstet werden. Es wird ein gewaltiges Heulen und Zähneklappern sein. Die Ströme des Reiches werden sich rot färben vom Blut der Erschlagenen und Erstochenen.“
Vater Däubler stöhnte: „Elise, das ist doch Höhnerkrom.“ Und Elfriede setzte ernst hinzu: „Die Lage ist schon schlimm genug, aber abergläubisches Zeug wollen wir nicht auch noch hören.“
Elise war beleidigt, ging zum Hühnerstalle und schlachtete ein Huhn. Dann las sie in dessen Eingeweiden: „Der Krieg wird sechs Jahre dauern und er wird nach Ellerbek kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird. 70 Millionen Menschen werden getötet und unzählige werden verstümmelt, verschleppt und verjagt. Die Lebenden werden die Toten nicht beweinen sondern beneiden. Und jetzt kommt das Huhn in den Topf, damit wir noch etwas Gutes zu essen haben, ehe die Welt ganz untergeht.“
So ganz falsch waren die Prophezeiungen in der Tat nicht. Und der Krieg kam auch bald nach Ellerbek. Im Juli 1940, als der Bombenkrieg gegen Deutschland noch gar nicht richtig begonnen hatte, schlug tatsächlich eine Sprengbombe in der Klosterstraße 38 ein. Die Germania-Werft, das eigentliche Ziel des Angriffs, hatte kaum etwas abbekommen. Die Häuser der Nachbarn waren auch heil geblieben. Nur das Anwesen der Däublers war gründlich verwüstet und zerstört. Wenigstens war niemand ernsthaft verletzt worden. Die NS-Machthaber, jedenfalls die der unteren Chargen, gingen zu diesem Zeitpunkt wohl tatsächlich davon aus, dass es bis zum baldigen siegreichen Ende des Krieges nur bei vereinzelten Bombenschäden bleiben würde. Und später würde der Endsieg ja auch schon da sein, und für alle Volksgenossen würden Paläste gebaut werden. Es gab daher tatsächlich noch ein Aufbauprogramm für die wenigen ausgebombten Bürger der Stadt.
Unter Anwesenheit der örtlichen Presse überreichte der Gauleiter persönlich einen namhaften Scheck an Opa Däubler für den Wiederaufbau des Hauses und versprach tatkräftige Hilfe durch den Arbeitsdienst. Tatsächlich wurde das Haus auch relativ rasch wieder aufgebaut, wenn auch einfacher, schäbiger und kleiner als der Vorgängerbau. Inzwischen waren auch alle Töchter aus dem Haus. Elise konnte dieser Wiederaufbau nicht trösten. Das gute Geschirr, die Deckchen, das Leinen und das Gemälde mit den Nixen am Tümpel, das war alles ein Opfer des Bombenkrieges geworden.
Dumm aber auch, dass der RAD7) vor dem wieder aufgebauten Haus eine Fahnenstange einbetoniert hatte. Die war natürlich für die Hakenkreuzfahne gedacht, die keiner aus der Familie so eigentlich mochte. Tochter Emmi hatte inzwischen den strammen Sozialdemokraten Willy Kähler geheiratet und es war ein zweiter Enkel, Wolfgang, zur Welt gekommen. Willy Kähler weinte immer noch seinem Lieblingskanzler Hermann Müller nach, den er für den letzten wirklichen Demokraten der Weimarer Republik hielt.8) Schwiegersohn Willy riet aufgrund seiner Erfahrungen im politischen Kampf zu einer abwartenden Haltung. Tochter Anni hatte Alfred Lemke geheiratet. Schwiegersohn Alfred meinte hingegen:
„Man darf wenigstens nach außen hin, die Nazis nicht zu sehr provozieren. Man muss ja sogar damit rechnen, dass Deutschland bzw. Hitler. bzw. die Nazis den Krieg gewinnen werden. Und dann wird man ziemlich dämlich mit seinem Antifaschismus dreinschauen.“
Opa Däubler begann bei diesen Aussichten zu jammern und hatte nach der Bombenacht über Ellerbek auch viel von seiner Zuversicht verloren: „Das wird wirklich ein großes Unglück, wenn Deutschland den Krieg gewinnt. Dann müssen wahrscheinlich doch noch selbst so alte Leute wie ich noch einmal zur Armee, um die besetzten Länder zu bewachen. Schließlich bin ich 1917 ja nur beurlaubt worden.“
„Wie meinst du das, Opa?“
„So viele Länder sind jetzt schon besetzt: Polen, Frankreich, Holland, Dänemark, Paphlagonien und es werden immer mehr. Die Leute da in den fernen Ländern werden ja nicht die ganze Zeit vor Freude herumspringen und freiwillig Hurra und Heil Hitler schreien. Die muss man doch ständig mit Flinten bewachen. Und dafür braucht man dann alle Männer, sogar den Landsturm. So olle Knochen wie mich. Da werden wir die Heimat nie wieder sehen.“
Oma schlug vermittelnd vor: „Vielleicht können wir ja Blau-Weiß-Rot flaggen. Als Bekenntnis zu unserer Schleswig-Holsteinischen Heimat!“
Alfred meinte zu diesem Vorschlag aber nur: „Jaja, Sleswig-Holsteen meerumslungen, hannelt nu mit Ossentungen! Die Nazis sind doch nicht doof. Das ging vielleicht noch vor ein paar Jahren. Heute kommt man nicht mehr durch mit Blau-Weiß-Rot. Wie leicht kann man auch die schleswigholsteinische Fahne mit der französischen verwechseln, vor allem wenn man sie falsch herum aufhängt. Und dann ist der Ärger riesengroß.“9)
Alfred besorgte kurzerhand auf eigene Kosten eine große Hakenkreuzfahne und zog sie am nächsten Sonntagmorgen auf. Abends fing es an zu regnen. Es dämmerte. Die Hakenkreuzfahne hing nass und traurig herunter. Das dürfen Fahnen natürlich nicht. Nachts hängen und schon gar nicht traurig herumhängen. Alfred erschien wieder und zog die Fahne ein. Am nächsten Sonntag war die Fahne spurlos verschwunden. Einige Monate später tauchte sie im Hühnerstall auf. Mehrere brutfreudige Glucken brüteten auf ihr. Soviel zum Thema Nazifahne und Brutalität.
Elfriede hatte sich inzwischen aus dem Heim in Cuxhaven abgesetzt und in Kiel an der Städtischen Lehranstalt für Frauenberufe am 15.03.1940 die externe Prüfung zur Hauswirtschaftsleiterin gemacht. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt mehrere große Küchenbetriebe geleitet hatte, war dies ihr erster berufsqualifizierender Schulabschluss. Sie war 8 Jahre zur Volksschule gegangen und hatte keinerlei Lehre gemacht. Es wundert einen aus heutiger Sicht wirklich, dass man mit dieser Qualifikation große Küchenbetriebe in Kinderheimen und auf adeligen Schlössern leiten durfte. Was zwischen März 1940 und April 1941 im Leben von Elfriede passiert ist, wissen wir heute nicht mehr. Wahrscheinlich besuchte sie zwei Semester lang Studienvorbereitungskurse an der Städtischen Lehranstalt und wohnte nun mit 29 Jahren wieder im Elternhaus, wo von den Geschwistern jetzt nur noch ihr kleiner Bruder Herbert zurückgeblieben war.
Im April 1941 ging es dann nach Berlin. Vier Semester am Staatlichen Berufspädagogischen Institut Berlin. Aus irgendeinem Grund ist in keinem Dokument verzeichnet, weder wo diese Hochschule lag, noch wo Elfriede in Berlin gewohnt hat. Man könnte denken, dass die Ämter der Nazi-Zeit alles wissen wollten. Andererseits mussten auch ständig alle Leute und Institutionen wegen Bombenschäden umziehen. Und immerhin gelang es ja auch verfolgten und von Deportation und Ermordung bedrohten Juden und politisch Verfolgten und steckbrieflich gesuchten Nazigegnern jahrelang in Berlin untergetaucht zu leben. Das Chaos in Berlin muss schon sehr groß gewesen sein. Nach den Erzählungen von Elfriede muss das BIB damals in der Treskowallee in Karlshorst gesessen haben, wahrscheinlich in dem Gebäude, in dem später zu DDR-Zeiten die Hochschule für Planökonomie ihren Sitz hatte. Die Treskowallee hieß schon damals so, weil sie natürlich nicht nach dem gleichnamigen Widerstandskämpfer benannt war, sondern nach einem anderen Herrn Treskow, dem Gründer von Karlshorst.
Elfriede zog zunächst in die damals noch vornehme Feuerbachstraße in Steglitz. Arnald und seine Mutter haben 1975 versucht, das Haus wieder zu finden. Wahrscheinlich war es die Hausnummer 28. Dort steht heute ein hässlicher Neubau. Elfriede erinnerte sich, dort in einer riesigen, prachtvoll möblierten Wohnung in einem sehr schönen 4-Etagenhaus mit Stuck und Erkern, bei einer preußischen Oberschulrätin in einem nicht ganz so prächtig möblierten Zimmer gewohnt zu haben. Das Haus erlitt aber bald einen Bombentreffer. Die Oberschulrätin zog beleidigt zu Verwandten nach Niederschlesien aufs Land. Elfriede suchte sich nun ein ganz bescheidenes Zimmerchen in der Schnellerstraße in Schöneweide. Vermieterin war eine Halbjüdin, die zwar aufgrund der Beschlüsse der Wannseekonferenz nicht zu dem vorrangig zu deportierenden Personenkreis gehörte. Da aber niemand die Beschlüsse von Wannsee genau kannte, lebte ihre Vermieterin in ständiger Angst, auch abgeholt zu werden. Verzweifelt wandte sie sich an Elfriede. Sie sähe doch so germanisch aus, und könne ihr sicher helfen. Die hatte aber selbst Angst vor den Nazis, von denen sie ständig an der Hochschule agitiert wurde. Derartige Erlebnisse, die ständigen Bombenangriffe, der andauernde Hunger, der militärische Drill an der Hochschule, der permanente Druck, in die NSDAP einzutreten, machten die Zeit des Studiums in Berlin eher zu einem zweifelhaften Vergnügen. Immerhin gab es im Sommer 1941 noch eine längere Wandertour durchs Riesengebirge mit einer Kommilitonin. Die für 1942 geplante Wandertour durch Ostpreußen fiel dann schon wegen des Kriegs aus. Touristische Privatreisen nach Ostpreußen waren verboten worden.
Das Bildungsangebot an der Hochschule war weit gefächert: Gewerbelehre, Pädagogik, Reichskunde, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Elfriede wählte die Betriebswirtschaft als Hauptfach, damals ein eher junges Wissenschaftsgebiet und vor allem eine Männerdomäne. Während des Studiums musste sie eine Arbeit über das Thema „Arbeiter und Soldat als Typ des neuen deutschen Menschen“ schreiben. Das war gefährlich. Da geriet man schnell auf ideologisches Glatteis. Man weiß auch nicht so recht, was das mit Betriebswirtschaft zu tun hat. Da konnte man nur entweder schleimen oder mit den Mächtigen anecken. Allerdings konnte Elfriede dann eine lange Suada über mittelalterliche Kunst, insonderheit den Bamberger Reiter10), der angeblich schon den neuen deutschen Menschen symbolisiert habe, abliefern, ohne dumm aufzufallen. Ein anderes Forschungsprojekt beschäftigte sich mit der Frage, ob der Deutsche Branntweinessig besser für die Volksgesundheit sei als die welsche Zitrone. Das Ergebnis stand von vorne herein fest: Natürlich war der Deutsche Branntweinessig besser. Später nach dem Krieg gab es daher bei Elfriede nur Zitronensaft als Säuerungsmittel für Speisen. Der Branntweinessig wurde zum Badputzen verdammt.
Am 29. März 1943 legte sie die Lehrerprüfung ab. Ihre Abschlussarbeit trug den Titel: „Der Weg der Deutschen Hausgehilfin.“ Damit konnte man auch nicht so schlimm anecken. Denn Hausarbeit war es ja, was die Nazis den Frauen zugestanden. Damit man ihr nichts