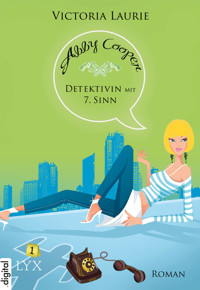9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ABBY COOPER erwartet den Leser ein origineller und unglaublich witziger Chick-Lit-Krimi, der Einblicke in die Welt eines professionellen Mediums verschafft.
Medium Abby Cooper und ihr bester Freund Dave haben eine neue Geschäftsidee: Sie kaufen ein Haus, um es auf Vordermann zu bringen und dann mit Gewinn zu verkaufen. Doch während der Reparaturarbeiten ereignen sich mysteriöse Dinge, und Abby ist schon bald davon überzeugt, dass in dem alten Haus ein Geist sein Unwesen treibt. Recherchen bringen ans Tageslicht, dass dort jemand ermordet wurde - und der Fall ist nie aufgeklärt worden. Gemeinsam mit ihrem Geliebten, dem Polizisten Dutch, macht sich Abby auf die Suche nach dem Täter.
Der Lesespaß ist vorprogrammiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
VICTORIA LAURIE
Abby Cooper
Hilferuf aus dem Jenseits
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Angela Koonen
Zu diesem Buch
Mit einer neuen Geschäftsidee wollen das Medium Abby Cooper und ihre Freunde durchstarten: Sie kaufen Häuser und führen Reparaturarbeiten durch, um das Ganze dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Doch gleich das erste Haus bringt ihnen einen Sack voller Ärger – wenn Dave, Abbys bester Freund, von der eigenen Kettensäge aus dem Haus gejagt wird, kann das nämlich nur eines bedeuten: Hier spukt’s! Und tatsächlich – dank Abbys übersinnlicher Fähigkeiten treffen sie auf den Geist einer attraktiven Blondine. Das Medium spürt, dass die Frau vor langer Zeit ermordet wurde, doch das Verbrechen wurde nie gesühnt, und der Mörder ist noch auf freiem Fuß.
Abby will der Sache auf den Grund gehen, auch wenn ihr Geliebter – der Polizist Dutch – ruhiger schlafen würde, wenn sie ihr Spür-näschen in andere Sachen steckte. Da häufen sich seltsame Vorfälle – jemand will offenbar verhindern, dass die Tat 0aufgeklärt wird. Doch Abby lässt sich nicht beirren, und sie kommt einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur, das ihr Leben in große Gefahr bringt …
Für Jim McCarthy und Martha Bushko.
Einfach indem ihr Ja gesagt habt, habt ihr mein Leben
verändert und so viele Träume wahr werden lassen.
Ich bin euch ewig dankbar.
1
Ich halte mich für einen Profi. Ich bin ein Medium und stolz, mein Geld damit zu verdienen, und vor allem bin ich überzeugt davon, dass ich mithilfe meiner angeborenen, einzigartigen Fähigkeiten mit jeder ungewohnten, sonderbaren, befremdlichen oder unheimlichen Situation fertig werden kann, die in meiner beruflichen Praxis auftritt.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Erste bin, die kreischend wegrennt, wenn es auch nur im Entferntesten um Geistererscheinungen geht. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber bei allem, was nachts Geräusche macht, bin ich ein riesengroßer Feigling.
Ich habe solche Angst vor Geistern und den Orten, wo sie sich rumtreiben, dass ich mir nicht mal einen Film darüber ansehen, geschweige denn in einem Haus bleiben kann, in dem vielleicht welche sind. Dass ich mal ein Spukhaus besitzen würde, in dem ein Geist festsitzt und jede Nacht aufs Neue seine Ermordung durchlebt – auf den Gedanken wäre ich bestimmt nicht gekommen.
Alles fing an dem Tag nach Weihnachten an, als meine Schwester Cat und ich in ihrem Wohnzimmer entspannt Grand Marnier tranken und quatschten.
»Ich sage dir, Abby, das ist eine großartige Idee. Ich wollte schon immer ins Immobiliengeschäft einsteigen, aber – sehen wir’s realistisch – hier in Massachusetts sind die Häuserpreise völlig überzogen. Soweit ich weiß, ist der Markt in Michigan wesentlich günstiger. Ich meine, denk nur mal an dein Viertel. Die Leute ziehen scharenweise dorthin. Das ist eine gute Idee, ganz sicher.«
Seufzend schwenkte ich die bernsteinbraune Flüssigkeit in meinem Cognacglas. An dem Gesprächsverlauf war ich selbst schuld. Ich hatte ihr gegenüber beiläufig erwähnt, dass Dave, mein Handwerker, mir kurz vor Weihnachten von einem alten Haus in der Nachbarschaft erzählt habe, das schon seit Jahren zum Verkauf stehe und quasi für ein Butterbrot verscherbelt werden solle.
»Wo ist der Haken?«, fragte ich ihn skeptisch.
»Es braucht nur ein paar geschickte Hände, die es ein bisschen herrichten«, antwortete er und wackelte vielsagend mit den Augenbrauen.
»Dann kauf es doch«, sagte ich leichthin.
»Würde ich gern, aber das gibt mein Kreditrahmen nicht her.«
»So? Wo liegt der denn?«
»Bei null.«
»Ach.« Ich ahnte schon, wo das hinführen würde.
»Darum rede ich ja mit dir darüber, verstehst du? Du bist diejenige mit der Bank im Rücken. Was hältst du von dem Vorschlag, mit mir zusammen ein Geschäft aufzuziehen? Wir beide könnten Häuser kaufen, in die man ein bisschen Arbeit reinstecken muss, dann renovieren wir sie und verkaufen sie mit Gewinn. Du übernimmst den Kauf und die Finanzierung, während ich das ganze Material und die Arbeitsleistung beisteuere. Wenn wir fertig sind, teilen wir den Gewinn fifty-fifty.«
Dave erwischte mich damit natürlich in einem schwachen Augenblick. Ich hatte mir selbst gerade ein neues Haus gekauft und die Anzahlung mithilfe des Schecks geleistet, den mir die Versicherung zum Ausgleich für mein altes geschickt hatte – das neulich abgebrannt war. Es war noch eine beträchtliche Summe übrig, und ich schwelgte in dem Gefühl, dass mein Kontostand einige Stellen mehr vor dem Komma hatte.
Geld zum Investieren hatte ich also, ich war mir bloß nicht sicher, ob die Idee so vernünftig war. Außerdem brauchte man für eine Immobilie normalerweise zwanzig Prozent als Anzahlung, was mein Konto wieder auf null bringen würde.
Ich trank einen Schluck Grand Marnier, als Cat nachfasste. »Wirklich, Abby, ich habe Daves Arbeit gesehen und traue ihm zu, dass er seine Sache fantastisch machen wird. Wenn ich die Anzahlung leiste, du die Hypothekenzahlungen übernimmst und Dave sich um das Handwerkliche kümmert – wo ist da das Risiko?«, fragte sie zuversichtlich.
Grübelnd ließ ich die Flüssigkeit im Glas kreisen und seufzte. Schließlich fragte ich: »Und wie soll diese Partnerschaft laufen? Ich meine, im Einzelnen.«
»Das ist ganz einfach«, begann sie. »Wir drei sollten eine Immobilienfirma gründen. Meine Anwälte können die Verträge so gestalten, dass wir wirklich gleichberechtigte Partner sind, und als Gruppe können wir in Immobilien mit Potenzial investieren. Ich kann die besten Wohngegenden ausfindig machen und die Häuser anzahlen, du besorgst die Finanzierung, und Dave kann seine Zauberhände wirken lassen.«
Ich drückte mich tiefer in meinen Sessel. Das klang nach einem Haufen Arbeit.
Da sie meine Unentschlossenheit sah, machte sie ein Angebot: »Lass es uns doch an diesem Haus einmal ausprobieren und abwarten, wie es läuft. Wir können jederzeit wieder aussteigen, wenn es nicht gut klappt.«
»Na ja …«, druckste ich herum. »Ich weiß nicht, Cat, das ist eine Riesenverpflichtung.«
»Ach, stell dich nicht so an«, erwiderte sie mit einem strengen Blick. »Wir gründen keine Wohlfahrtseinrichtung, sondern eine Immobilienfirma. Das kann für uns alle sehr lukrativ werden.«
Cat glaubte offenbar, ich zögerte bloß, weil ich ihr Geld nicht nehmen wollte – welches sie haufenweise hatte. Damit lag sie nicht falsch, aber das machte mir nicht halb so viel aus wie die Vorstellung, ihr Geschäftspartner zu werden.
Verstehen Sie mich nicht falsch – ich liebe meine Schwester sehr. Aber ich kenne sie auch gut und weiß, wie sie arbeitet. Cat ist ein Finanzgenie und leitet ganz allein ein millionenschweres Unternehmen, das sie anfangs nur mit Chuzpe aufgebaut hat, aber als Chef ist sie ein Tyrann. Nicht nur dass sie sich bestens auskennt, sie weiß auch, dass sie alles besser weiß.
»Ich weiß ja nicht …« Ich blieb unschlüssig.
»Also gut«, sagte sie, um anders anzusetzen, »was sagt deine Intuition dazu?«
»Die habe ich noch nicht befragt«, gab ich zu.
»Warum nicht?«
»Keine Ahnung, hab nicht dran gedacht«, antwortete ich ausweichend. In Wirklichkeit hatte ich es absichtlich noch nicht getan, weil ich die Antwort fürchtete – nämlich, dass ich mich auf die Idee einlassen solle.
Und zur Abwechslung wollte ich mal eine rationale Entscheidung treffen und keine, zu der mir die Geister, die mich leiteten, geraten hatten. Sicher, die würden mich nicht in die falsche Richtung lenken, aber manchmal ist es einfach schön, sich ganz allein zu entscheiden, unabhängig davon, was dabei herauskommt.
»Dann frag sie doch jetzt«, beharrte Cat.
Ich warf ihr einen ärgerlichen Blick zu. »Jetzt nicht, Süße, ich bin müde …«
»Ach, papperlapapp!«, unterbrach sie mich barsch. »Meine Güte, Abby, du bist manchmal so entscheidungsscheu. Glaub mir, das ist ein gutes Geschäftsmodell, und wenn du Daves Angebot nicht annehmen willst, werde ich es tun … ohne dich.«
Ich riss die Augen auf. »Ach, wenn ich also ablehne, willst du dich ohne mich mit Dave zusammentun?«
»Ohne zu zögern«, bestätigte sie entschlossen. »Und sei es auch nur, damit ich dir in einem halben Jahr den Erfolg unter die Nase reiben kann.«
Ich sah sie böse an. Ich hatte keinen Zweifel, dass Cat den Plan sofort in die Tat umsetzen würde. Ich konnte eigentlich nur noch auf den fahrenden Zug aufspringen. So war sie immer: Wenn sie sich einmal für etwas entschieden hatte, packte sie es an, und ich fand, dass ich Dave unmöglich zumuten konnte, alleine mit ihr klarzukommen. Er würde einen Puffer brauchen.
»Na schön«, sagte ich ärgerlich seufzend.
»Wirklich?« Sie beugte sich in ihrem dick gepolsterten Sessel nach vorn. »Oh, Abby, das ist wunderbar! Siehst du nicht, wie aufregend das wird?« Sie strahlte.
»Wahnsinnig aufregend«, pflichtete ich ihr düster bei. »Ich werde Dave gleich morgen anrufen und die Sache ins Rollen bringen. Wir sollten das vermutlich über meine Bank finanzieren, da ich noch Kontakte in der Kreditabteilung habe und wahrscheinlich günstige Konditionen bei den Abschlusskosten bekomme.« Ich meinte die Bank, bei der ich gearbeitet hatte, bevor ich mich als Intuitivberaterin selbstständig gemacht hatte.
Cat lächelte mich begeistert an und hob ihr Glas. »Gut gemacht! Siehst du? War doch gar nicht so schwer, oder?«
Später, als ich für meine Heimreise am nächsten Morgen packte, klingelte das Telefon, und ein paar Augenblicke später kam Donna, Cats Haushälterin, an meine Schlafzimmertür. »Ein Anruf für Sie«, sagte sie steif.
»Haben Sie den Apparat nicht mitgebracht?«, fragte ich mit einem Blick auf ihre leeren Hände. Jeder im Haus wusste, dass der Nebenanschluss in Cats Zimmer schlechten Empfang hatte.
»Nein«, antwortete sie mit einem kleinen Lächeln, das mich an ein Krokodil erinnerte.
Ich konnte Donna nicht leiden, und es ärgerte mich, dass Cat auf meinen Rat, sie zu ersetzen, nicht hören wollte.
»Dann bitte nach Ihnen«, sagte ich gereizt und ging hinter ihr die Treppe hinunter. Dabei irritierte mich wieder dieses schlechte Gefühl, das mich immer beschlich, wenn die Frau in meiner Nähe war. Ich hätte nicht sagen können, was es war, aber sie führte etwas im Schilde, und ich traute ihr nicht so weit, wie ich sie werfen könnte, was bei ihrer stattlichen Figur vielleicht ein guter Millimeter wäre.
Unten angelangt, flitzte ich an ihr vorbei. Der einzige Mensch, der mich so spät noch anrief, war Dutch, mein Freund. Ich würde ihn zwar am nächsten Vormittag sehen, da er mich vom Flughafen abholen wollte, trotzdem freute ich mich darauf, meinen Lieblingsbariton am Telefon zu hören.
Ich nahm den Hörer auf und sagte mit der seidigsten Stimme, die ich aufbieten konnte: »Hallo, mein Schatz, rate mal, wer gerade keine Unterwäsche anhat.«
»Wie bitte?!«, fragte eine entrüstete Frau am anderen Ende.
»Äh … äh … äh …«, stotterte ich. Die Stimme gehörte meiner herzallerliebsten Mutter.
»Abigail, bist du das?«, verlangte sie zu wissen.
»Äh … haha … hallo Claire, fröhliche Weihnachten!« Mein Gesicht glühte, und ich schwitzte an den Handflächen.
»Ja … dir auch, Liebes«, erwiderte sie knapp und kühl wie immer. »Ist deine Schwester da? Ich möchte sie gern sprechen.
»Natürlich, ich hole sie, und sag Sam auch fröhliche Weihnachten von mir«, schob ich hinterher, während ich versuchte, meine Fassung wiederzuerlangen.
Da meine Mutter nichts darauf sagte, legte ich den Hörer auf den Küchentresen und sah mich um. Donna stand höhnisch grinsend am Geschirrschrank. Mir war sofort klar, dass sie nun ihre Rache für neulich Abend bekommen hatte.
Heiligabend hatte ich Cat nämlich geraten, ihre Haushälterin im Auge zu behalten, und im nächsten Moment war sie hereinspaziert. Nach dem tödlichen Blick zu urteilen, den sie mir am Weihnachtsmorgen zugeschossen hatte, schien sie das ganze Gespräch belauscht zu haben.
Und es war kein Geheimnis, dass meine Eltern in mir das schwarze Schaf der Familie sahen und dass ich dieses Weihnachten nur bei meiner Schwester verbrachte, weil meine Eltern, die in South Carolina lebten und eigentlich zu Besuch hatten kommen wollen, sich umentschieden hatten und zu meiner Tante nach Kalifornien geflogen waren.
»Wo ist Cat?«, fragte ich.
Donna sah mich mit Engelsaugen an und stieß ein spöttisches »Oh!« aus. »Ist der Anruf für Mrs Masters? Ich dachte, er wäre für Sie. Tut mir leid«, flötete sie.
Lügner, Lügner …, sang der angeborene Lügendetektor in meinem Kopf.
»Ja, ganz bestimmt«, erwiderte ich schneidend. »Wo ist meine Schwester?«
»Vermutlich im Wohnzimmer mit den Jungen. Soll ich sie holen?«
»Nein, Donna, Sie haben für heute Abend genug getan.« Ich stapfte aus der Küche und hörte sie hinter mir leise kichern.
Im Wohnzimmer fand ich Cat, die mit meinen Neffen spielte, Mathew und Michael.
»Hey«, sagte ich, um Cats Aufmerksamkeit zu erregen. »Claire und Sam sind am Telefon und wollen uns was wünschen.«
Cat drehte ruckartig den Kopf, sowie die Namen unserer Eltern fielen. Übrigens hatten die beiden verlangt, dass wir sie so anredeten, sobald wir ins Teenageralter kamen. Ich hatte eine ganz andere Beziehung zu ihnen als meine Schwester und konnte mir beim besten Willen nicht erklären, wie wir uns in unserem Urteil über sie – hohl wie Christbaumkugeln – so völlig einig sein konnten und sie dann doch so unterschiedlich behandelten.
Für mich war’s einfach: Ich ignorierte sie. Was mir umso leichter fiel, da sie mich schon mein ganzes Leben lang nicht beachteten und es wahrscheinlich auch nicht bemerkt hatten, als von mir keine Geburtstagskarten mehr im Briefkasten landeten.
Cat verhielt sich da ganz anders. Sie biss sich auf die Zunge, schluckte ihren Stolz hinunter und blieb höflich. Es war ein schlagender Beweis ihrer Willenskraft, dass ihr das schon so lange gelang, denn Claire und Sam Cooper sind die bigottesten, stumpfsinnigsten und hochnäsigsten Leute, die jemals »Pat Buchanan for President« gerufen haben.
»Sie sind am Telefon?«, fragte sie nervös und griff sich an die Perlenkette.
»Sie wollen dich sprechen«, bestätigte ich und sah sie mitfühlend an.
»Oh!« Cat sprang auf und straffte die Schultern. »Wünsch mir Glück«, flüsterte sie im Hinauseilen.
Sie würde mehr als Glück brauchen, doch ich nickte ihr zu und hob beide Daumen nach oben, als sie noch einmal über die Schulter blickte, bevor sie in der Küche verschwand. Arme Cat. Wie ein Lämmchen, das zur Schlachtbank gelockt wird.
Ein Weilchen später war ich wieder oben und wollte gerade ein in Seidenpapier gewickeltes Päckchen in meinem Koffer verstauen, als die Zimmertür aufflog. Vor Schreck stieß ich einen kurzen Schrei aus.
»Entschuldige!«, sagte Cat mit einem unterdrückten Kichern. »Ich bin’s nur. Oje, du bist aber schreckhaft heute.«
Ich merkte, dass ich das Seidenpapierpäckchen an mich gedrückt hielt, und drehte mich unauffällig weg, um es aus dem Blickfeld zu schaffen, bevor sie darauf aufmerksam würde.
»Was hast du da?«, fragte sie und spähte über meine Schulter.
»Das? Ach nichts.« Ich griff nach dem Reißverschluss des Koffers. »Wie war das Gespräch mit Claire und Sam?«
»Puh! Sie kommen zu Besuch«, sagte Cat, während sie versuchte, in meinen Koffer zu sehen.
»Wie bitte? Ich dachte, sie wollten nach dem Besuch bei Betty gleich nach Hause.« Ich rückte näher an den Koffer heran, um Cat den Blick zu verstellen.
»Nein, sie haben es sich anders überlegt. Offenbar hat Tante Betty ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie keine aktuellen Fotos von ihren Enkeln haben. Darum sind sie jetzt unterwegs hierher – du weißt schon, um zu zeigen, was für gute Großeltern sie sind.«
»Aha«, sagte ich, zog den Reißverschluss zu und hob den Koffer an. »Erinnere mich gelegentlich daran, dass ich sie für die Wahl der Großeltern des Jahres nominiere.«
»Da bin ich dir zuvorgekommen«, erwiderte Cat trocken. »Was versteckst du da?«, fragte sie und sah zu, wie ich mich mit dem schweren Ding abmühte.
»Nichts«, antwortete ich ein bisschen zu schnell.
»Wirklich?« Ihr Mund verzog sich zu einem wissenden Lächeln. »Hat es vielleicht damit zu tun, dass du neulich im Shoppingcenter bei Victoria’s Secret reingehuscht bist, als du behauptet hast, du müsstest auf die Toilette?«
»Und wann wollen sie hier sein?«, sagte ich in dem Bemühen, das alte Thema beizubehalten.
»Ach komm, Abby! Sag mir, was du gekauft hast!«, forderte Cat und zeigte auf den Koffer.
Ich seufzte wegen ihrer Neugier und wusste schon, dass ich aus der Sache nicht mehr rauskommen würde. »Nur was Kleines, das ich im Vorbeigehen mitgenommen habe«, sagte ich in beiläufigem Ton, während ich den Koffer auf den Boden stellte. »Wirklich nichts Besonderes.«
»Warum willst du es mir dann nicht zeigen?«
»Na ja …« Ich suchte fieberhaft nach einer Ausrede, die sie mir abkaufen würde. »Es ist ein bisschen gewagt, und ich fürchte, du verurteilst mich deswegen.«
»Warum sollte ich das tun? Na komm, für welche Gelegenheit ist es?«
Einen Moment lang sah ich sie skeptisch an, dann zuckte ich die Achseln und erklärte: »Dutch fliegt an meinem Geburtstag mit mir nach Toronto, und dafür wollte ich etwas Besonderes haben – du weißt schon: was ein bisschen Wow-Effekt hat. Ich will sehen, wie seine Augen größer werden.«
»Seine Augen?« Cat funkelte mich belustigt an. Meine Schwester hatte nicht für fünf Cent Taktgefühl.
»Und du wunderst dich, wieso ich es dir nicht gleich zeigen wollte«, sagte ich und sah zu, wie Cat den Koffer wieder aufs Bett hievte und den Reißverschluss aufzog. Sie zog das inzwischen zerknitterte Seidenpapierpäckchen hervor, riss es auf und hielt einen schwarzen Spitzenbody hoch.
»Oooooh, Abby! Der ist hinreißend!«
»Ja, danke. Können wir ihn jetzt wieder wegpacken?« Ich bekam an dem Abend nun schon zum zweiten Mal heiße Wangen.
»Erst mal sehen, wie er sich macht«, sagte Cat und ließ den Body neben dem Bett auf den Boden fallen. »Jep«, meinte sie kichernd, »er ist perfekt.«
»Haha!« Ich bückte mich nach meiner Errungenschaft. »Du bist albern, Cat.«
»Ach, jetzt lach doch mal«, sagte sie und ließ sich aufs Bett fallen. Keine Chance, sie loszuwerden. Ihre Neugier war geweckt. »Also los! Erzähl mir von eurem kleinen Liebesausflug.«
Ich verdrehte die Augen und kämpfte mit dem Drang, aus dem Zimmer zu marschieren. »Das ist keine große Sache. Dutch hat sich einfach was Nettes für meinen Geburtstag ausgedacht.« In zwei Tagen würde ich zweiunddreißig werden, und es wäre mein erster Geburtstag nach sehr langer Zeit, den ich in einer neuen Beziehung feierte.
»Das ist so romantisch!«, schwärmte Cat. »Wann soll’s denn losgehen?«
»Morgen, aber …«
»Aber?«
»Tja, es ist seltsam. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass Dutch mir noch absagen wird. Ich meine, es ist alles organisiert, und ich habe gestern noch mit ihm telefoniert – er war wild entschlossen. Aber irgendetwas sagt mir, dass er in letzter Minute aussteigt.«
»Meinst du, er wird vielleicht arbeiten müssen?«, fragte Cat.
»Ich weiß nicht. Eigentlich schließt er gerade einen Fall ab, aber beim FBI weiß man nie.«
Cat sah mich an und tippte sich mit dem Finger an die Unterlippe. Sie kannte mich gut genug, um zu glauben, was meine Intuition ankündigte. Dann hellte sich ihr Gesicht auf. »Du musst eben das Beste hoffen. Ich bin sicher, dass alles gut wird. Du bist bloß nervös wegen eurer ersten Nacht.«
»Ich will nicht mal wissen, woher du das schon wieder weißt«, sagte ich ärgerlich.
»Oh bitte, Abby. Du bist rot geworden, als ich den Body ausgepackt habe. Ich verstehe nur nicht, wie ihr beide so lange warten könnt. Ich meine, habt ihr kein Verlangen?«
»Können wir vielleicht über etwas anderes reden?«, fragte ich und schlug mir die Hände vors Gesicht.
Es war demütigend. Dutch und ich waren seit mehreren Monaten zusammen und hatten noch keine Nacht miteinander verbracht. Die Gründe reichten von schlechtem Timing über Gekränktheiten bis zu kalten Füßen. Immer wenn einer bereit war, wich der andere aus, wie es schien, und der entstandene Druck, nachdem wir es so lange aufgeschoben hatten, schnürte mir den Magen zusammen wie bei einer Jungfrau in der Hochzeitsnacht.
»He, es wird bestimmt toll«, meinte meine Schwester beruhigend. »Ihr scheint euch wirklich zu mögen, und das ist der wichtige Teil an der Sache. Viele meiner Freundinnen haben den körperlichen Teil ihrer Beziehung überstürzt und später dafür bezahlt, als ihnen nämlich klar wurde, dass sie, nie eine gute Basis aufgebaut hatten. Ihr beide dagegen habt sie und ich denke, es wird schön werden, ob mit oder ohne Body.«
»Meinst du wirklich?« Ich linste zwischen meinen Fingern hindurch.
»Ganz bestimmt«, versicherte sie mit einem aufmunternden Lächeln.
In dem Moment klopfte es, und Donna stand in der Tür. »Ja?«, fragte Cat.
»Da ist wieder ein Anruf für Sie, Miss Cooper«, sagte Donna zu mir.
Klar doch, dachte ich. »Wer ist es?«, fragte ich misstrauisch.
»Ein Herr. Er sagt, es sei dringend und Sie sollten schnell kommen.«
Dutch, der Witzbold. Dringend war unser Codewort für angeturnt. Ich grinste Cat an, wedelte mit den Fingern und lief die Treppe hinunter zum Küchentelefon.
»Hallo!«, sagte ich.
»Abby?« Eine Männerstimme, die nicht Dutch gehörte.
»Ja?« Ich erkannte ihn nicht gleich.
»Hier ist Milo.«
»Milo! Schönen Urlaub übrigens! Bist du bei Dutch?«, fragte ich. Milo war sein ehemaliger Partner bei der Polizei von Royal Oak und sein bester Freund.
»Nein. Hör zu, ich weiß nicht, wie ich’s dir sagen soll …«, begann er, und mir fiel plötzlich auf, wie angespannt er klang. Da lief es mir auch schon kalt über den Rücken, was meine Ahnung bestätigte.
»Mein Gott«, hauchte ich. »Es ist was passiert, oder?«
»Ich fürchte, ja. Es ist Dutch.« Die Welt begann zu schlingern. »Du musst heute noch nach Hause kommen, Abby. Dutch hat eine Kugel abbekommen.«
2
»Willst du den ganzen Tag in der Schmollecke sitzen?«, fragte Dutch.
Ich schoss ihm von meinem Krankenhausstuhl einen mörderischen Blick zu und sah gleich wieder auf meinen Fuß, mit dem ich gereizt auf den Boden tippte.
»Na komm, Edgar«, sagte er. Das war sein Spitzname für mich. Er bezog sich auf Edgar Casey, den großen Hellseher der Zwanzigerjahre. Dutch hatte Bücher über ihn gelesen, um seine neue Freundin und ihre Fähigkeiten zu begreifen, und hielt sich jetzt für einen Experten. »Sei etwas nachsichtiger mit mir. Schließlich wurde ich angeschossen.«
»Am Hintern«, fügte ich eisig hinzu.
»Trotzdem tut es weh«, hielt er mir entgegen und hob seinen Bariton um eine Oktave, um mein Mitgefühl zu erregen.
»Gut. Das freut mich!« Ich stand auf und beugte mich über ihn, da er auf der Seite lag. »Beim nächsten Mal hörst du dann vielleicht auf mich.«
»Musst du mir das ständig unter die Nase reiben?«
»Ja!«, fauchte ich und sah ihn wütend an. »Ich habe dir gesagt, du sollst dem dunkelhaarigen Mann mit dem Papagei nicht trauen. Dass er ein falsches Spiel mit dir treibt und du ihm kein Wort glauben sollst und in der Nähe von Lagerhäusern besonders vorsichtig sein musst. Ich weiß nicht, was daran unklar sein soll!«
Dutch war in einem Lagerhaus von seinem Informanten angeschossen worden – einem Dunkelhaarigen, der ein Papageien-Tattoo am Arm hatte.
»Was soll ich denn deiner Meinung nach meinem Boss sagen? Dass meine Freundin meint, ich solle den Fall nicht zu Ende bringen, weil ein Kerl mit einem Papagei es auf mich abgesehen habe?«
»Ja!«, jammerte ich mit tränennassen Augen. »Genau das! Verstehst du denn nicht? Ist dir nicht klar, dass du da draußen fast ermordet worden wärst?«
»He«, sagte er mit tiefer, beruhigender Stimme, als er die Tränen sah. »Komm, Edgar, nicht weinen.«
Jetzt strömten mir die Tränen nur so über die Wangen. »Warum glaubst du mir nicht?«, fragte ich und wischte mir übers Gesicht.
»Was für ein Unsinn! Natürlich glaube ich dir.« Er griff nach meiner Hand.
»Nein, tust du nicht. Ich habe diese Gabe aus einem bestimmten Grund, nämlich damit ich Menschen helfe. Und wenn du meine Gabe infrage stellst, stellst du mich infrage.«
»Abby.« Er zog meinen Namen seufzend in die Länge. »Ich stelle weder dich noch deine Gabe infrage. Ich weiß, du denkst, dass ich deine Warnung ignoriert habe, aber in Wirklichkeit habe ich sie sehr wohl befolgt. Ich habe eine schusssichere Weste getragen, was ich normalerweise nicht tue, wenn ich mich mit einem Informanten treffe, und gerade weil ich diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen habe und auf Ärger vorbereitet war, konnte mir der Kerl nur eine Kugel in den Hintern verpassen. Siehst du? Wenn ich nicht auf dich gehört hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot, anstatt deine Gesellschaft in dieser bezaubernden Umgebung zu genießen.«
»Nein«, widersprach ich mürrisch. »Wenn du auf mich gehört hättest, wären wir jetzt in Toronto.«
Stöhnend beugte sich Dutch über die Bettkante, betätigte den Hebel, um das Gitter wegzuklappen, und zog mich zu sich heran, bis ich auf dem Bett saß. Die Schweißperlen auf seiner Stirn verrieten mir, dass ihm jede Bewegung wehgetan hatte, darum leistete ich keinen Widerstand.
»Hör mir zu«, bat er sanft und strich mir die Haare aus dem Gesicht. »Ich werde immer auf deinen sechsten Sinn hören, aber ich muss auch meine Arbeit tun, und das geht nicht effektiv, wenn ich mir ständig Gedanken mache, was vielleicht passieren könnte. Ich kann nur auf deine Ahnungen hören und entsprechend vorsichtig sein. Wenn ich mehr tue, kann ich auch gleich den Dienst quittieren, was ich im Augenblick nicht will. Kannst du das verstehen?«
Ich seufzte schwer und wischte erneut die Tränen weg. Mir war klar, dass er recht hatte, aber ich wollte nicht einlenken. Ich war noch viel zu aufgewühlt und schob meine Wut vor, um die schreckliche Angst zurückzudrängen, die ich seit Milos Anruf hatte.
»Wann werden sie dich hier entlassen?«, fragte ich nach kurzem Schweigen, um das Thema zu wechseln.
Dutch holte erleichtert Luft und drückte meine Hand. Er war klug genug, um auf eine letzte Bemerkung zu verzichten, wenn er gewonnen hatte. »Heute.«
»Sie lassen dich schon gehen?«, fragte ich besorgt.
»Ja. Die Verletzung ist ja nicht kritisch. Außerdem habe ich ihnen gesagt, dass meine Freundin Krankenschwester spielen wird, und der Arzt meint, solange jemand für mich kocht und wäscht und mir jeden Wunsch von den Augen abliest, geht das in Ordnung.«
Ich blickte ihn mit schmalen Augen an, dann sah ich mich suchend um. »Und wo ist diese Freundin? Sie sollte die Hufe schwingen und herkommen, wenn sie dich bemuttern soll.«
»Ach komm, Abby. Sei lieb«, sagte er und setzte seinen Hundeblick auf.
»Du solltest dir überlegen, eine echte Pflegerin zu engagieren. Ich meine, ich bin für so was wirklich nicht geschaffen. Außerdem habe ich allerhand Arbeit.«
»Ich dachte, du hast dir den Monat freigenommen.«
Jetzt hatte er mich erwischt. Ich hatte mir den Superluxus gegönnt und im Januar keine Termine angenommen. Bis zum ersten Februar war mein Terminbuch leer, und ich hatte die Zeit zum Ausspannen nutzen und mein neues Haus einrichten wollen. »Ich meinte, im Haus. Da hatte ich mir eine Menge vorgenommen.«
»Ach so.« Er sah zum Fernseher. »Na gut. Mir war nicht klar, dass dir das so lästig wäre. Ich werde eine Pflegerin anheuern.«
Mist! Warum waren Beziehungen in Filmen immer so viel einfacher? Schließlich gab ich nach. Ich verdrehte die Augen und fragte: »Wie lange soll ich dir denn Verbände wechseln und Wärmflaschen machen?«
»Zwei Wochen.«
»Und du willst vermutlich, dass ich so lange bei dir wohne, hm?«
»So hab ich mir das vorgestellt.«
Ich seufzte kopfschüttelnd. »Na schön. Aber nur damit das klar ist: Du schuldest mir was.«
»Ich habe nichts anderes erwartet«, erwiderte er augenzwinkernd.
Mehrere Stunden später hatte ich für mich und Eggy, meinen Zwergdackel, für einen zweiwöchigen Besuch gepackt und fuhr zum Krankenhaus zurück, um Dutch abzuholen. Er wurde behutsam in mein Auto verfrachtet und auf ein donutförmiges Kissen gesetzt. Trotzdem zuckte er während der Fahrt bei jedem Hubbel und Schlagloch zusammen.
»Warum biegst du hier ab?«, fragte er, als ich einen kleinen Umweg einschlug.
»Dave und ich wollen ein Haus kaufen, um es nach einer Renovierung wieder zu verkaufen. Das will ich mir mal ansehen.«
»Muss das jetzt sein?«, fragte er und versuchte vorsichtig, eine angenehme Sitzposition zu finden.
»Es dauert nur eine Minute«, sagte ich, durch das Abbiegen ein bisschen abgelenkt. Eggy kläffte freudig auf dem Rücksitz.
»Siehst du? Eggy will auch lieber nach Hause. Kannst du das nicht ein andermal erledigen?« Dutch rückte sich seufzend zurecht.
»Entspann dich«, befahl ich mitleidlos, als ich auf die Fern Street einbog und langsamer fuhr, um die Hausnummern zu lesen. »Hier sollte es gleich kommen …«, murmelte ich, zählte die Hausnummern weiter, bis ich im Wendehammer bei der letzten angelangte. Noch bevor ich die Ziffern an der Mauer sah, wusste ich, dass es das richtige war.
»Das ist nicht dein Ernst, oder?«, fragte Dutch mit skeptischem Blick auf das Haus.
»Leider doch.« Ich sah von meiner Wegbeschreibung auf die Fassade und wieder zurück. Das Ding war eine Bruchbude, ein eingeschossiger Bau mit zerbrochenen Fenstern und Läden, schadhaftem Putz und fehlenden Dachziegeln – wie aus einem Hitchcock-Film. Der Vorgarten hatte mehr Löcher als Rasen, wuchernde Büsche und riesige Laubhaufen an der Seitenmauer. Ein rostiger Zaun verlief ringsherum, und das Tor schwang quietschend in den Angeln, wenn der Wind hindurchfegte.
»Das Ding ist eine Bruchbude«, sagte Dutch.
»Danke. Darauf wäre ich nicht gekommen.«
In dem Moment sprang Eggy, der durch die Heckscheibe gespäht hatte, auf die Beifahrerseite und begann wie verrückt zu bellen. Als ich mich zu meinem Dackel umdrehte, sah ich, wie er die Nackenhaare sträubte. Er zog die Lefzen zurück, knurrte kurz und bellte weiter das Haus an. Sein Gebell war durchdringend, und ich versuchte ihn zu beruhigen, indem ich ihm den Rücken tätschelte, doch je länger wir dort standen, desto aufgeregter wurde er. Schließlich fuhr ich vom Rinnstein weg und wendete, aber Eggy bellte noch, bis wir ein paar Blocks entfernt waren.
»Was hatte er denn?«, fragte Dutch, als es endlich still war.
»Ich hab keine Ahnung«, sagte ich und merkte, dass ich selbst eine Gänsehaut an den Armen hatte. Ich schauderte, als es mich noch mal kalt überlief.
»Frierst du?«, fragte Dutch.
»Ja, ein bisschen. Also gut, Cowboy, bringen wir dich nach Hause.«
Später, nachdem ich es Dutch auf der Couch bequem gemacht hatte, ging ich ins Arbeitszimmer und rief Dave an.
»Hallo Abby!«, grüßte er gut gelaunt.
»Willst du mich mit dem Haus eigentlich auf den Arm nehmen, Dave?«, fragte ich, ohne Zeit auf Nettigkeiten zu verschwenden.
»Dir auch ein frohes Neues«, sagte er vorwurfsvoll.
»Entschuldigung.« Ich zog die Krallen ein. »Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so eine Bruchbude ist.«
»Darum ist es ja spottbillig. Glaub mir, wenn ich damit fertig bin, wirst du es nicht wiedererkennen.«
»Okay, okay«, sagte ich eingedenk der fantastischen Arbeit, die er in meinem Haus geleistet hatte. »Ich habe also mit Rick gesprochen, meinem Freund in der Bank, und er sagt, dass er die Papiere für unsere Firma bekommen hat und wir den Deal nächste Woche abschließen können, wenn wir wollen.« Cat, Dave und ich hatten gerade die CO-MAS-MAC gegründet, die hoffentlich etwas abwerfen würde, auch wenn der Name, der sich aus den Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen zusammensetzte, kein glanzvoller Einfall war. »Cat übernimmt die Anzahlung«, berichtete ich weiter, »und das Haus wird ziemlich niedrig bewertet, sodass die Kreditsumme ebenfalls niedrig ist. Hast du mit der Immobilienmaklerin gesprochen?«
»Ja, alles ist startklar. Sie sagt, ihr könnt den Abschluss jederzeit unter Dach und Fach bringen.« Ich war zum Firmenchef und zur Geschäftsführerin von CO-MAS-MAC ernannt worden und war zeichnungsberechtigt. Dave und Cat brauchten bei dem Kauf keine Unterschrift zu leisten. »Je schneller wir das in trockenen Tüchern haben, desto eher kann ich mit der Instandsetzung anfangen. Also sag mir Bescheid, sobald wir es haben, okay?«, sagte Dave.
»Es sollte Ende nächster Woche so weit sein, aber ich melde mich bei dir mit dem offiziellen Datum in den nächsten zwei Tagen.«
»Klingt gut. Dann werde ich diese Woche zum Baumarkt fahren und schon mal Material bestellen.«
»Übrigens, was hat es mit dem Haus eigentlich auf sich?«, fragte ich. »Es sieht völlig verwahrlost aus.«
»Soweit ich weiß, hat schon seit einiger Zeit keiner mehr darin gewohnt. Die Maklerin sagt, es habe lange leer gestanden und der Besitzer versuche seit zwei Jahren, es zu verkaufen.«
»Man sollte meinen, er hätte ein bisschen was daran machen lassen, bevor er es anbietet.«
»Ja, das war auch mein Gedanke, aber mit einem bisschen wäre es nicht getan gewesen, und das hätte den Besitzer Geld gekostet. Vielleicht hatte er die Mittel nicht.«
Plötzlich meldete sich meine Intuition, die übrigens folgendermaßen funktioniert: Wenn es etwas gibt, das ich unbedingt wissen sollte, stellt sich bei mir ein Gefühl ein, als würde in meinem Kopf ein Telefon klingeln, ungefähr so laut, als käme es aus dem Nebenzimmer. Wenn ich wissen will, worum es geht, gehe ich sozusagen einfach ran.
Automatisch richtete ich meine Aufmerksamkeit darauf, was meine Leitgeister mir mitteilen wollten. Vor meinem geistigen Auge erschien das Haus, dann sah ich einen Smaragd, einen Saphir und einen Diamanten in einem Vogelnest liegen. Ich schüttelte verständnislos den Kopf und sah als Nächstes ein Bild von einem Hakenkreuz an einem Panzer. Ratlos blendete ich Dave aus, der munter weiterredete, und konzentrierte mich stärker auf die Vision. Ich sah ein kleines Café mit einer französischen Flagge an der Tür. Sonderbar. Was hatten diese Bilder mit dem Haus zu tun?
»Abby?« Ich hörte Dave aus dem Hörer sprechen. »Abby, bist du noch dran?«
»Äh, ja, ich bin hier«, sagte ich und tauchte aus meinen Gedanken auf. »Sag mal, weißt du etwas über den Besitzer? Hat er zum Beispiel Verbindungen nach Europa?«
»Tut mir leid, ich weiß nichts über ihn, außer dass das Haus ursprünglich einem Kerl gehört hat, der Anfang der Neunziger gestorben ist. Er hat es seinem Enkel vermacht, dem jetzigen Besitzer.«
Bei mir schrillten die Alarmglocken. Ich hatte eine unbestimmte Ahnung, dass uns das Haus noch Ärger einbringen würde. Doch bei der Überlegung, von dem Kauf zurückzutreten, stellte sich gleichzeitig das Gefühl ein, dass das keine gute Idee war.
Dave musste meine Gedanken gelesen haben, denn er fragte: »Überlegst du gerade, dich aus der Sache zurückzuziehen?«
Ich zögerte nur einen Moment, dann sagte ich: »Nein, das nicht. Ich hoffe nur, du hast dich nicht übernommen, wenn ich sehe, wie viele Reparaturen an dem Haus nötig sind.«
»Keine Sorge«, versicherte er. »Ich hab alles im Griff.« Lügner, Lügner …
Na super! Jetzt war ich wirklich beunruhigt.
Zehn Tage später, am 8. Januar, stand ich nach geleisteter Unterschrift vom Tisch auf, um meiner Maklerin die Hand zu schütteln. Der Verkäufer war nicht gekommen, sondern hatte die Verträge schon vorher unterschrieben, sodass ich sie in Rekordzeit durchblätterte.
»Gratuliere«, sagte Kimber Relough.
»Danke, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon angebracht ist.«
»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte sie augenzwinkernd. »Da haben Sie sich wirklich viel vorgenommen.«
»Nicht ich, sondern mein Handwerker.« Ich zog mein Handy aus der Tasche und drückte Daves Kurzwahlnummer. »Du kannst dich an die Arbeit machen, Partner.«
»Wurde auch Zeit, ich stehe jetzt schon eine Stunde in der Einfahrt.«
»Geduld ist nicht deine Stärke, wie?«
»Je eher ich anfange, desto eher bin ich fertig und desto eher können wir unseren Gewinn einsacken.«
Ich lachte im Stillen über die Veränderung, die ich seit Beginn des Projekts an ihm beobachtete. Als er noch mit der Renovierung meines alten Hauses beschäftigt gewesen war, hatte er ein absolut gemütliches Tempo drauf, und jetzt, wo ein saftiger Gewinn winkte, hatte er plötzlich Feuer unterm Hintern.
»Ruf mich mal an, wie du vorankommst«, sagte ich, als ich seine Wagentür quietschen hörte.
»Aber sicher«, sagte er und legte auf.
Ich verließ das Maklerbüro und fuhr zu Dutch, hatte es aber nicht besonders eilig, Krankenschwester zu spielen. Sosehr ich auf ihn stand, neuerdings ging es mir doch auf die Nerven, dass wir so viel zusammen waren. Dieses Gefühl, gepaart mit dem Umstand, dass er sich unselbstständig gab wie ein Vierjähriger, stellte meine Geduld auf eine harte Probe. Scheinbar ist ein Schuss in den Hintern viel entkräftender, als man annimmt. Die Verletzung machte es ihm schwer, aufzustehen und herumzulaufen. Er kam auch nicht an die Zeitung auf dem Sofatisch heran, konnte selbst mithilfe der Fernbedienung nicht den Sender wechseln und sich nicht die Zähne putzen. In den vergangenen paar Tagen hatte ich an meinem Freund eine Seite kennengelernt, von der ich mir wünschte, sie wäre mir verborgen geblieben. Die »schönen Stunden zu zweit« hatten sich nicht so wie erwartet entwickelt. Auf jeden Fall musste ich mit ihm darüber reden, eine professionelle Pflegekraft zu engagieren, damit ich wieder zu Hause wohnen konnte.
Als ich jedoch durch seine Haustür spazierte, empfing mich eine angenehme Überraschung. Ein geduschter und frisch rasierter Adonis stand im Wohnzimmer auf eine Krücke gestützt. »Hallo Traumfrau«, begrüßte er mich.
»Hallo. Was hat das denn zu bedeuten?«, fragte ich und zeigte auf das neue Erscheinungsbild.
»Ich war es leid, herumzusitzen und dir was vorzujammern. Es hat den halben Vormittag gedauert, aber ich habe es geschafft, mich allein zu duschen und anzuziehen«, sagte er stolz.
»Und du hast aufgeräumt«, stellte ich fest. Die Zeitungen lagen nicht mehr am Boden, sondern ordentlich zusammengelegt auf dem Beistelltisch, und die Decken auf dem Sofa waren zusammengefaltet.
»Das war das Mindeste, was ich tun konnte«, sagte Dutch und kam steif zu mir gehumpelt. Er war bisher mehrere Schritte pro Tag durchs Wohnzimmer gelaufen, als krankengymnastische Übung, und es war ihm täglich ein bisschen leichter gefallen. Heute ging er die zehn Schritte schon, ohne das Gesicht zu verziehen.
»Weiter so!«, sagte ich lächelnd.
»Ich hab etwas für dich«, sang er.
»Einen neuen Haufen Schmutzwäsche?«
»Genau, und das hier.« Er zog etwas aus der Hosentasche.
Ich neigte mich zu ihm, um das kleine rote Samtkästchen zu beäugen, das er in der Hand hielt.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Geschenk.«
»Zu welchem Anlass?«
»Zu deinem Geburtstag.«
»Der war vor einer Woche, Hinkebein«, sagte ich, und in dem Augenblick brach die Kränkung durch. Mein Geburtstag war vergangen, ohne dass Dutch auch nur ein Wort dazu verloren hatte. Ich hatte mir daraufhin eingeredet, dass er vor lauter Schmerzen nicht mehr an das Datum gedacht hatte, und jetzt, wo es ihm doch noch eingefallen war, gab es mir einen Stich.
»Ich weiß. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Du hättest mich erinnern sollen«, sagte er zerknirscht.
»Du bist ein großer Junge«, meinte ich, »bestimmt alt genug, um dir die wichtigen Dinge selbst zu merken.«
»Mach’s auf«, sagte er mit einschmeichelnder Stimme und hielt mir das Kästchen hin.
Lächelnd nahm ich es, klappte den Deckel hoch und entdeckte darin den schönsten Anhänger, den ich je gesehen hatte: eine kleine goldene Triangel mit einem feuerroten Opal in der Mitte, der orange, violett und grün gesprenkelt war. »Der ist ja wunderschön«, hauchte ich.
»Genau wie die Frau, für die er bestimmt ist«, sagte er und strich mir über die Wange.
In dem Moment klingelte das Handy in meiner Handtasche. Ich sah kurz hin und dann Dutch an.
Willst du etwa rangehen?, fragte sein stummer Blick.
Grinsend ignorierte ich den Anruf und trat dicht an ihn heran, um eine leidenschaftliche Knutscherei anzufangen, doch da klingelte sein Telefon. Wir drehten den Kopf zur Küche hin und sahen uns dann an, beide versucht abzunehmen, aber unwillig, den plötzlich entstandenen romantischen Augenblick zu zerstören. Darum gingen wir den Kompromiss ein und warteten, ob der Anrufer auf Band sprechen würde.
Aus der Küche hörten wir den Automaten verkünden, dass Dutch nicht ans Telefon kommen könne und darum bitte, eine Nachricht zu hinterlassen. Sowie das Gerät gepiept hatte, rief eine panische Stimme: »Abby?! Dutch?! Wenn ihr da seid, geht ran!«
Ich flitzte um Dutch herum in die Küche, ergriff den Hörer und drückte auf den Knopf. »Dave? Ich bin hier, was ist los?«
»Ihr müsst sofort herkommen!« Vor lauter Angst klang er schrill.
»Warum? Was ist passiert?«, fragte ich.
»Ich … ich … ich weiß es nicht«, stammelte er. »Ihr müsst es selbst sehen.«
»Wir sind unterwegs.« Ich legte auf.
»Dann los«, sagte Dutch und zog seine Jacke von der Stuhllehne.
Zehn Minuten später hielten wir vor dem verwahrlosten Haus. Als wir ausgestiegen und die Auffahrt ein Stück hinaufgegangen waren, sahen wir Dave in seinem Lieferwagen sitzen: Bleich und zitternd starrte er blicklos zum Haus. Ich klopfte gegen die Scheibe, weil er uns nicht zu bemerken schien. Er stieg nicht aus, sondern kurbelte nur das Fenster einen Spaltbreit herunter.
»Da drinnen«, sagte er und zeigte auf die Haustür.
»Was ist da?«, fragte Dutch.
»Oh Mann … ich weiß es nicht!«, antwortete Dave mit schreckgeweiteten Augen. Seine Hand zitterte, als er sich durch die langen Haare fuhr. »Ich weiß nur, dass ich dabei war, den alten Putz abzuschlagen, als plötzlich Sachen durch die Luft flogen.«
»Wie bitte?« Dutch und ich sahen uns mit großen Augen an.
»Ich weiß, es klingt bescheuert!«, sagte Dave eine Oktave zu hoch. »Aber so war es, klar? Ich riss gerade die Gipsplatten herunter, als plötzlich meine Bohrmaschine durch die Luft flog, direkt auf mich zu. Wenn ich mich nicht geduckt hätte, hätte ich jetzt ein Loch im Kopf! Und dann sah ich meine Kreissäge anspringen, ganz von selbst, und sie hat mich durch den Raum gejagt! Ich sag euch, es war das reinste Tollhaus da drinnen!«
Dutch neigte sich ein bisschen näher an den Fensterspalt. Ich sah ihn unauffällig schnüffeln, ob Dave etwa eine Fahne hatte.
»Was hast du zu Mittag gegessen, Kumpel?«, fragte er ruhig und beschwichtigend.
»Ein Schinkensandwich – mit Zitronenlimo. Ich bin nicht betrunken, Rivers«, sagte Dave verärgert wegen der Unterstellung.
»Er sagt die Wahrheit, Dutch.« Während Daves angstvoller Schilderung war mein eingebauter Lügendetektor stumm geblieben.
Dutch sah mich ziemlich perplex an. »Ihr beide bleibt hier. Ich gehe nachsehen.«
»Ein echt guter Plan, Hinkebein.« Ich zeigte auf seine Krücke. »Du kannst kaum humpeln, geschweige denn rennen. Was ist, wenn dich da drinnen einer angreift?«
»Ich bin vorbereitet«, sagte er und klopfte an seine linke Brust.
»Oh bitte«, erwiderte ich. »Ich komme mit und damit basta!« Entschlossen ging ich auf die Tür zu, während Dutch brummend hinter mir versuchte, Schritt zu halten.
»Nicht so schnell!«, zischte er.
Seufzend ging ich ein bisschen langsamer, aber nicht so, dass er mich überholen konnte. Ich traute ihm zu, mich mit Handschellen ans Verandageländer zu ketten, damit ich das Haus nicht betreten konnte. Meine Vermutung war, dass ein paar Jugendliche sich einen Streich erlaubt hatten, andererseits hatte ich noch nie erlebt, dass Dave log oder übertrieb, und ich konnte mir nicht vorstellen, was ihn derartig in Angst versetzt hatte.
Als wir an der Veranda ankamen, blieb ich stehen, plötzlich unsicher, ob ich wirklich reingehen sollte. Dutch überholte mich und schob mich hinter seinen Rücken. Bei der Bewegung zuckte er zusammen, und es tat mir geradezu selbst körperlich weh, ihn so zu sehen. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn, weil er sich trotz Schmerzen beeilt hatte, und plötzlich kam ich mir supergemein vor.
»Bleib dicht hinter mir, und keinen Ton, bevor ich Entwarnung gebe.« Erschrocken bemerkte ich, dass er schon die Pistole gezogen hatte. Langsam drückte Dutch mit der Krücke die Tür auf, und nachdem er kurz gehorcht hatte, schlich er bis zum Türrahmen und warf einen raschen Blick in den Raum.
Im Haus war es still. Kein Klopfen, Klirren oder Kettenrasseln, keine schaurige Stimme, die uns aufforderte zu verschwinden. Trotzdem wirkte die Stille bedrohlich. Dutch trat über die Schwelle, ich folgte ihm auf den Fersen, die Finger an seinem Jackensaum, um ihn notfalls abzufangen und um mich zu beruhigen. Vorsichtig rückte er in den Raum vor und nahm mit schnellen Blicken die Szene in sich auf.
Ich konnte kaum glauben, was ich sah: Die Wände hatten so viele Löcher, als wären sie von einem Vorschlaghammer attackiert worden. Der Teppichboden hatte überall Risse, und es ließ sich kaum mehr feststellen, welche Farbe er ursprünglich gehabt hatte, vielleicht Blau oder Grün. Es gab keine Lampen, aber Dave hatte eine Glühbirne an die Decke des Wohnzimmers gehängt, und obwohl es gerade erst Mittag war, wirkte der Raum düster und unheilvoll. Während Dutch und ich uns schrittchenweise weiter vorwagten, zogen unsere Schatten über die Wände und machten alles noch unheimlicher. Rechts von uns steckte Daves Bohrmaschine in der Wand wie ein Dartpfeil.
Ich machte Dutch darauf aufmerksam, und er nickte. Konzentriert und angespannt ging er weiter. Wir durchquerten das Wohnzimmer bis zum Kücheneingang und stolperten beinahe über Daves Kreissäge, die friedlich auf der Schwelle lag.
In dem Augenblick stieg mir ein Geruch in die Nase. Alarmiert riss ich Dutch an der Jacke zurück, sodass er mit dem Hintern gegen mich stieß. Er zuckte zusammen und unterdrückte ein Stöhnen. Entschuldigend zog ich die Schultern hoch, dann deutete ich auf meine Nase und atmete demonstrativ ein. Da war es wieder: Zigarettenrauch.
Dutch schnüffelte ebenfalls, schüttelte aber den Kopf. Er roch nichts. Ich steckte die Nase in die Küche. Dutch schnüffelte erneut und schüttelte den Kopf. Er roch noch immer nichts. Ich deutete mit dem Kinn in den Raum, und langsam schoben wir uns hinein. Sowie wir in der Küche standen, war der Geruch verschwunden. Verwundert schnupperte ich nach allen Seiten, aber ohne Ergebnis. Ich schob mich an Dutch vorbei und durchquerte die Küche mit der Nase in der Luft, aber der Geruch blieb aus.
Nach ein paar Runden winkte er mir mitzukommen, und wir nahmen die anderen Räume in Augenschein – durchs Wohnzimmer, den Flur entlang zu den beiden Schlafzimmern und dem Bad –, fanden aber keine Spur, dass jemand da gewesen oder sonst etwas nicht in Ordnung war, abgesehen von der stark beschädigten Einrichtung. Schließlich kehrten wir in die Küche zurück.
»Was hältst du davon?«, fragte er mich.
Ich breitete ratlos die Arme aus. »Wenn ich das wüsste. Ich kenne Dave seit einem Jahr und könnte nicht behaupten, dass er nicht richtig tickt. Hast du gesehen, wie die Bohrmaschine in der Wand steckt? Bis über das Bohrfutter!«
»Was hast du vorhin gerochen?«, fragte Dutch.
»Ich verstehe nicht, dass du nichts gerochen hast. Ich hätte schwören können, dass hier jemand raucht.«
»Zigarettenrauch?«
»Ja. Ganz eindeutig, als würde nebenan jemand qualmen, aber es war kein Rauch zu sehen. Und du hast überhaupt nichts gerochen?«
»Nein.«
»Komisch.«
»Allerdings.«
In dem Moment kam es wieder: eindeutig Zigarettenrauch. »Da! Da ist es wieder, Dutch! Riechst du es?«, flüsterte ich aufgeregt und blähte die Nasenlöcher.
»Nicht das Geringste«, antwortete Dutch schnüffelnd.
»Es kommt von da drüben!« Ich zeigte an Dutch vorbei zu einer Tür, die nach dem Zugang zum Keller aussah.
Wir näherten uns, und Dutch stellte sich mit schussbereiter Waffe an die Seite und schob mich hinter seinen Rücken. Nachdem er seine Krücke an die Wand gelehnt hatte, griff er an die Klinke und zog die Tür auf. Als sie aufschwang, spannte ich den Körper an, aber nichts geschah. Nach einem Moment spähte ich um Dutch herum in den dunklen Treppenabgang, wo nur die obersten Stufen zu erkennen waren. Nichts rührte sich, und keiner machte »Buh!«, sodass ich mich ein wenig entspannte.
Dutch griff zum Lichtschalter, und die schmale Stiege wurde beleuchtet. Gerade als ich mich einen Schritt um ihn herum wagte, flatterte etwas mit lautem Getöse aus dem Keller herauf, und Flügel schlugen mir gegen den Kopf. Zu Tode erschrocken warf ich mich zu Boden und barg schreiend den Kopf in den Armen.
Dutch rüttelte an meiner Schulter und rief: »Abby! Abby, hör auf!«