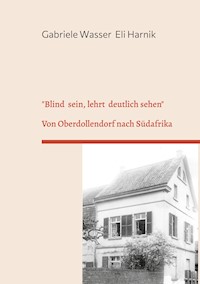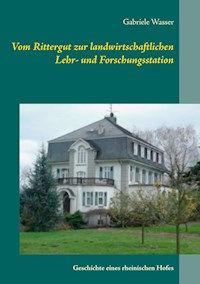Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Abraham Auerbach wächst in der strengen Welt der Talmud-und Toraerziehung des 18. Jahrhunderts in Worms und dem Elsass auf. Die französische Revolution verurteilt ihn zum Tode, er überlebt wie durch ein Wunder und kommt in Napoleonischer Zeit als Rabbiner nach Bonn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laß dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht ; denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln.
(Josua 1,8)
Gewidmet
Rabbiner Nathan Rafael Auerbach, Jerusalem
mit Dankbarkeit.
Bis zur Zeit des Nationalsozialismus haben die Rabbinerfamilien Auerbach, Bamberger und Carlebach die Geschichte der jüdischen Gemeinden entscheidend mitgestaltet und bis heute gültige Richtlinien für jüdisches Leben gegeben. Heute wirken einige ihrer Nachfahren in Israel und setzen dort die Familientraditionen fort.
Inhaltsverzeichnis
Der Talmud als Wissensideal
Aschkenaz | Heimat und Herkunft
Der Großvater | Zwi Hirsch Auerbach
Der Vater | Selig Aviezri
Buchsweiler | Geburt und Kindheit
Frankfurt | Talmudstudien
Bischheim | Leben mit D. Sinzheim
Gleichstellung | Abschaffung des Leibzolls
Stiftung | Die Talmudschule
Revolution | Schreckensherrschaft und Gefangenschaft
Rettung | Neue Aufgaben
Neue Stationen | Forbach und Neuwied
Notabelnversammlung | Sanhedrin
Oberrabbiner | Konsistoriums Bonn
Verlust | Sinzheims Tod und Testament
Napoleons Ende | Alltag in Bonn
Preußen | Neue Herausforderungen
Letzte Jahre | Tod
Der Talmud als Wissensideal
Der Talmud ist nicht nur eines der wichtigsten Werke, sondern er ist eine Säule des Judentums. Seine Bedeutung ist jedoch für die verschiedenen Ausrichtungen des Judentums unterschiedlich groß. Für eine große Zahl Rabbiner gilt das Talmudstudium als höchstes Wissensideal.
Gott gibt Moses am Sinai nicht nur die geschriebene Tora, sondern auch die ›mündliche Lehre‹. Diese Lehre nennt sich Mischna. Sie besteht aus Religionsgesetzen für alle Bereiche (Halacha) und aus ergänzendem Material bestehend aus Geschichten, Gleichnissen und Begebenheiten ethischen Charakters (Aggadah). Der Gelehrte Jehuda ha Nasi1 ordnete die mündliche Lehre und hielt sie schriftlich fest. Er teilt die Mischna in sechs Ordnungen auf:
Seraim – Saaten
Moed – Festzeiten
Naschim – Ehe und Familienrecht
Nesikin – Beschädigungen ; Zivil und Strafrecht
Kodaschim – Heilige Dinge – Tempel und Opferriten
Toharot – Reinheitsgebote
Der Talmud besteht aus dieser Mischna und ihrer Diskussion, der Gemara. Beide gemeinsam bilden den Talmud. Im Laufe der Geschichte werden auch diese Texte kommentiert und besprochen. In jeder Ausgabe des Talmuds ist deshalb der Raschi-Kommentar zu finden. Raschi ist ein Akronym für Rabbi Schlomo ben Jitzchak2, der 1040 in Troyes geboren wurde. Die Arbeiten Raschis zum Talmud und zur Tora sind bis heute unvergleichlich und daher unverzichtbar.
Den Talmud kann man nicht einfach nur lesen, den Talmud muss man studieren. Je mehr man vom Talmud weiß, desto mehr Fragen stellen sich noch. Wie schon bereits erwähnt wurde, besteht der Talmud aus Mischna und Gemara, der Talmud ist also von seiner Struktur her »dialogisch«. Während die Mischna eine Sammlung von Gebräuchen und Einrichtungen ist, diskutiert die Gemara darüber und bringt auch Gegenmeinungen vor, die gleichfalls wieder diskutiert werden. Im Talmud kommen so viele verschiedene Sprecher zu Worte und es gibt immer Diskurse über neue Stichwörter. So werden nicht nur religiöse Gesetze besprochen (Halacha), sondern auch Geschichten, Auslegungen, Sinnsprüche oder Gleichnisse erzählt (Aggada).
Die Religionsschulen beschäftigen sich heute fast ausschließlich mit dem Babylonischen Talmud, der in den Lehrstätten Babylons entstanden ist, während es noch den Jerusalemer Talmud gibt, der in den Lehrhäusern Israels entstanden ist.
Nach jüdischer Tradition hat der Rabbiner jeder Gemeinde das Recht, eine eigene Schülerschaft in einem Beit Midrasch3 genannten Gebäude, das sich in der Regel in der Nähe der Synagoge befindet, zu unterrichten. Ihr Auskommen wird aus dem Steueraufkommen der Gemeinde bestritten oder häufig privat gestiftet. Nach einigen Jahren können die Schüler entweder nach Ablegen der S’micha4 selbst eine Rabbinerstelle antreten oder sich einem weltlichen Beruf widmen.
Im deutschsprachigen Raum genossen im 11. bis 13. Jahrhundert die drei kooperierenden Talmudschulen von Mainz, Worms und Speyer, den SCHUM-Städten5, besonderes Ansehen, auch in der christlichen Welt.
1 Jehuda ha-Nasi * ca. 165 ; † 15. Kislew 217 in Sepphoris, war ein wichtiger jüdischer Gelehrter und Patriarch. Sein großes Verdienst ist die abschließende Redaktion der Mischna.
2 Genannt Raschi (geboren 1040 in Troyes, gestorben am 5. August 1105 ebenda). 1055 ging Raschi zunächst nach Mainz und dann nach Worms, um dort an den jüdischen Lehrhäusern, die zu den bedeutendsten in Europa gehörten, zu studieren.
3 Beit Midrasch wird auch Jeschiwa, Klaus oder Lehrhaus genannt.
4 S’micha ( Auflegen (der Hände)), bezeichnet im Judentum die formelle Einsetzung als Rabbiner. Durch die S’micha wird die Berechtigung zugesprochen, gültige Entscheidungen in Fragen des Religionsgesetzes, der Halacha, zu treffen.
5 Das Wort SchUM ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben ihrer mittelalterlichen, auf das Latein zurückgehenden hebräischen Namen: Schin (Sch ) für Schpira, Waw (U ) für Warmaisa und Mem (M ) für Magenza.
Aschkenaz | Heimat und Herkunft
Ursprünglich kommt die Familie Auerbach wohl aus dem gleichnamigen Städtchen in der Oberpfalz. Im Archiv von Karlsruhe wird ein Schutzbrief6 für »Moishe Jude von Auerbach« von 1499 erwähnt. Moishe wird erlaubt, in Auerbach zu wohnen und als Geldeintreiber7 zu arbeiten.
Die ersten besser belegten Wurzeln der Familie Auerbach liegen im Wien des 16. Jhd. Rabbiner David Tevele Auerbach ist einer der herausragenden Gelehrten der Stadt. Sein ältester Sohn Rabbi Isaak Auerbach stirbt 1607 in Wien nach langjähriger Lehrtätigkeit. Die nachfolgenden Generationen sind als Rabbiner in Prag, Krakau, Lublin, Horochow und Brody tätig.8 Alle bekleiden herausgehobene Ämter unter den Rabbinern, sind Vorsitzende der rabbinischen Gerichtsbarkeit, leiten Lehrhäuser oder arbeiten als »Maggidim«9. Das Wissen über diese Generationen der Familie ist allerdings ziemlich dürftig, die Quellenlage wird erst im 18. Jhd. genauer.
Die jüdischen Familien, die am Beginn des Hochmittelalters10 entlang des Rheins und der Mosel leben, nennen sich selber »Aschkenasim«. Die Herkunft des Wortes stammt aus dem Hebräischen. »Ashkenaz« ist ein Urenkel des Noah, ein Enkel seines Sohnes Jafet. Nach biblischer Vorstellung zweigen sich von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Jafet, die Völker ab, die nach der Vernichtung der Menschheit in der Sintflut die Erde neu bewohnen sollen. Dass sich die von Sem abstammenden Völker von Israel aus nach Osten, die von Ham abstammenden in südwestlicher und die von Jafet abstammenden in nordwestlicher Richtung ausgebreitet hätten, ist in der Zeit des europäischen Mittelalters bis in die Neuzeit und in allen von der biblischen Überlieferung beeinflussten Regionen eine gängige Vorstellung. Das hebräische Wort »Ashkenaz« bedeutet also unter Bezug auf die Nachkommen Noahs, Teile des mittelalterlichen Deutschlands und des heutigen Frankreich entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse. Mit der zunehmenden Verbreitung der Juden geht der Name auf alle europäischen Juden über, mit Ausnahme der in Portugal und Spanien ansässigen »Sepharden«11. Die aschkenasische Kultur erstreckte sich in dieser Zeit von Prag im Osten bis Metz im Westen12. Einigende Elemente der aschkenasischen Kultur sind u.a. die einheitliche Sprache (Yiddisch), das Judentum und seine textliche Tradition im Studium heiliger Schriften und deren Auslegung, sowie eine gemeinsame materielle Kultur, gemeinsame Erziehungsvorstellungen, soziale Wohlfahrt und eine traditionelle Streitbeilegungskultur13. Die aschkenasischen Juden werden im Verlauf der Geschichte immer wieder in politische Konflikte und Interessen der Herrscher involviert. Von der römischen Ära, den Kreuzzügen, Pestzeiten, der Reformation, dem Dreißigjährigen Krieg usw. bis in die Jetztzeit werden sie mit immer neuen Zwangsmaßnahmen belegt, vertrieben, verfolgt und gemordet. Bedingt durch Migrationsbewegungen ziehen die Aschkenasim weiter nach Osten. Es entsteht eine blühende aschkenasische Kultur in Polen.
Im Verlauf der Chmielnicki-Aufstände14 in Polen fliehen viele Juden wieder westwärts, an die Ufer des Rheins.
Die Rabbinerfamilien der Auerbachs prägten ganz entscheidend das aschkenasische Judentum über viele Jahrhunderte bis zum Holocaust. Einen einzigartigen Stempel hinterlässt wohl der Lebensweg des Abraham Auerbach in der Zeit zwischen der Regierung des Bourbonen Ludwig XVI., der Französischen Revolution, der Herrschaft Napoleons und dem Hohenzollern Friedrich Wilhelm IV. Für einen großen Zweig der Familie Auerbach gilt er als »Patriarch«15.
6 Judenprivilege, Judengeleit oder Judenschutz stellten die Juden unter den Schutz des Herrschers, oft gegen erhebliche Gegenleistungen meist finanzieller Art.
7 Pfälzer Kopialbücher 67/818 – Badisches Generallandesarchiv Karlsruhe.
8 Auerbach, Siegfried M.: The Auerbach Family S. 17.
9 Maggid (hebr. »Sprecher«, »Erzähler«) ist die Bezeichnung für einen jüdischen Wanderprediger, zusammen mit der Bezeichnung »umore zedek« »und Lehrer der Gerechtigkeit« bezeichnet es vereinzelt auch einen rabbinischen Richter. Die Prediger-Maggidim traten in Erscheinung seit dem 16. Jahrhundert bis in die Vor-Holocaust-Zeit in Gebieten mit großer jüdischer Bevölkerung, vor allem in Osteuropa und hatten im Volk häufig Kultstatus.
10 1000–1300 n.Chr.
11 Als Sepharden bezeichnen sich die Juden und ihre Nachfahren, die bis zu ihrer Vertreibung 1492 und 1513 auf der Iberischen Halbinsel lebten. Nach ihrer Flucht ließen sich die Sepharden zum größten Teil in Siedlungsgebieten des Osmanischen Reiches (Bosnien) und in Nordwestafrika (Maghreb) nieder. Ein kleiner Teil siedelte sich auch in Nordeuropa an, insbesondere in den Seehandelsstädten der Niederlande (unter anderem Amsterdam), und in Norddeutschland (vor allem in Hamburg), aber auch in Frankreich (Bordeaux, Bayonne), in Italien (Livorno, Ferrara), in Amerika, Indien und Afrika.
12 Vgl. Berkovitz, R.
13 Vgl. Miller, D.Jacobs, N. »Ashkenaz« http://www.brooklyn.net/classes/y241/ashkenaz.html
14 Bogdan Chmielnicki, ein ukrainischer Kosak, will 1648–1649 die Ukraine von den Polen und den Juden befreien.
15 Vgl. Auerbach, Nathan Rafael,- Shomri Mischmeret Ha Kodesh.
Der Großvater | Zwi Hirsch Auerbach
Im Jahr 1733 erhält Rabbiner Zvi Hirsch Auerbach16 eine wichtige Nachricht von Rabbiner Juda Loeb Sinzheim,17 einem Freund der Familie aus Wien. Juda Loeb Sinzheim ist Shtadlan18 der Juden in Wien und Hoflieferant in Mainz. Er hat Macht und Prestige, ist wohlhabend und hoch angesehen in der jüdischen Gesellschaft. Die jüdische Gemeinde in Worms hat ihm die Errichtung und Fundierung einer großen Talmud-Lehranstalt, der sogenannten Raschi-Kapelle zu verdanken, in der in der Folge Männer von Ruf eine rege Lehrtätigkeit entfalten. Loeb Sinzheim bestimmt Zvi Hirsch zum Vorsitzenden seiner Talmudschule in Worms. Nach vielen Wohnortswechseln schlimmer politischer Umstände wegen, einer schrecklichen Flucht aus Brody19 nach Wien, bleibt Worms nun für Zvi Hirsch und seine Frau Dabrish20 sowie dem siebenjährigen Sohn Selig Aviezri der Lebensmittelpunkt. Dabrish ist eine wohlhabende Geschäftsfrau und so kann Zvi Hirsch ohne finanzielle Sorgen seine Studien betreiben. Seiner großen Gelehrsamkeit verdankt er den Zuzug vieler Schüler und sein hohes Ansehen lässt ihn 1763 zum Vorsitzenden der rabbinischen Gerichtsbarkeit in Worms aufsteigen. Bis weit in den Osten Europas hinein, wurden die Talmudauslegungen, Rechtsgutachten, Zusammenstellungen lokaler Riten oder synagogaler Gesänge jüdischer Gelehrter aus Worms beachtet und hochgeschätzt.
Abb. 1:Lehrhaus des Zvi Hirsch Auerbach in Worms. Heute steht dort das jüd. Museum der Stadt.