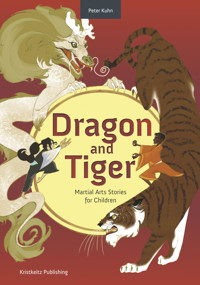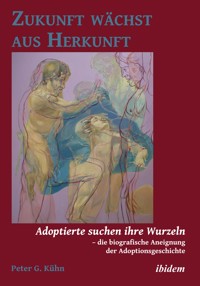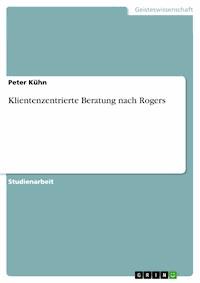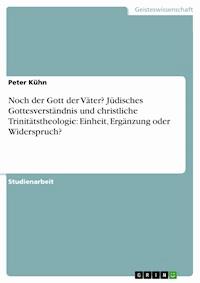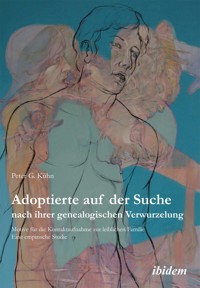
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Häufig suchen Adoptierte die Begegnung mit ihrer leiblichen Familie und forschen nach ihrer genealogischen Abstammung. Was genau motiviert sie dazu, ihre Herkunftsfamilie zu ermitteln? Aus welchen lebensgeschichtlichen Zusammenhängen heraus beginnen sie mit dieser Suche? Wie verarbeiten und bewerten sie die sich daraus ergebenden Prozesse bezüglich ihrer Identitätskonstruktion und ihres familiären Zugehörigkeitsgefühls? Peter Kühn geht diesen Fragen mit einem qualitativ-empirischen Ansatz nach und präsentiert in seinem vorliegenden Band die seit langen Jahren erste detaillierte wissenschaftliche Bearbeitung dieses spannenden Themenkomplexes. Narrativ-biografische Interviews mit Adoptierten bilden die empirische Grundlage. Als theoretischer Erkenntnisrahmen dienen die Bindungstheorie und der symbolische Interaktionismus, aber auch Rational-Choice-Ansätze, Identitätstheorien und die Feldtheorie Kurt Lewins fließen mit ein. Daneben werden umfangreiche statistische Daten zur Suche Adoptierter nach ihrer genealogischen Verwurzelung und zu Adoptionen in Deutschland vorgestellt. Im Ergebnis finden sich zahlreiche neue Erkenntnisse zu diesem sensiblen Thema, darunter ein feldtheoretisches Modell zur Erklärung der biografischen Aneignung der individuellen Adoptionsgeschichte durch die Betroffenen sowie Impulse zur wissenschaftlichen, rechtspolitischen und fachlichen Weiterarbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Dank
Ich möchte mich bei alldenen bedanken, die michwährend der Entstehung dieser Arbeitbegleitet und unterstützt haben.Dasindzuerstdie MitgliedermeinerFamilie, die die Zeit und die Ressourcen, die ich in diese Arbeit investierte, tolerierten und mir immer wieder Mut zugesprochen haben. Danken möchte ich den Interviewpartnerinnen und -partnern, die mir ihre Lebensgeschichte, ihr Deutungswissen, ihre Gedanken, Gefühle, Ängste, Hoffnungenund Vermutungenerzählten. OhneihrVertrauenwäre die Arbeit nicht zustande gekommen.
Die vorliegendeStudiewurde an Technischen Universität Dresden, Fakultät für Erziehungswissenschaften,im Jahr 2012 als Dissertation angenommen[1].HerzlichenDank an Prof. Dr.habil.Wolfgang Melzer von der TU Dresdenfür diezuverlässigeund wertschätzendeBetreuung der Dissertation.Ergab mir, besonders in der Schlussphase,viele hilfreicheImpulse für diese Forschungsarbeit. Prof. Dr. Harald Wagner von der Evangelischen Hochschule Dresden(EHS)hatüberdieJahredie Entstehung der nun vorliegenden Studieermutigendundempathisch,inspirierendund korrigierendbegleitet.Er warstetsoffenfür meine Fragen und Gedanken und standmirunterstützendzur Seite.Danke!
Daneben danke ich der Bundesarbeitsgemeinschaft Adoptierter (www.bargea.de) für die Unterstützung und das Vertrauen, ebensodenAdoptionsvermittlungsstellen, Ämtern, Archiven und Behörden, die mir die notwendigen Informationen gern bereitstellten und mit Interesse den Forschungsprozess verfolgten. Dankauch an die Kolleginnen und Kollegen aus den Doktorandenkolloquien der TU Dresden und der EHS. Ich habe vonihnenwichtigeHinweiseund konstruktive Kritik erhalten, die meinen Horizont erweiterten oder die Blickrichtung fokussierten.Vielen Dankauch andie Menschen, diemithalfen, der Arbeitden letzten Schliffzu verleihen. Sie unterstützten mich beistilistischen,gestalterischen,technischen und manchenanderenFragen. Genannt seien Steffi Baldow,Ingo Bochmann,Franziska Hofmann, Juliane Kühn,Manuela Lorenz,Petra Sprenger,Thorsten Stechow,Mary Tikalsky,Jörg Wagnerund Christine Winkler-Dudczig.Besonderer Dank giltProf.Henri Deparade(www.deparade-art.de), der mir eines seiner großartigen Bilder für die Covergestaltung zur Verfügung stellte.Die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden (EHS) unterstützt die Veröffentlichung dieses Bandes. Auch dafür vielen Dank.
Ich widme diese Arbeit meinen ElternKaren und Reinhard Kühn, ChristaBeloualiund JanosGál, sowiemeiner Frau Steffi undunserenKindern Juliane, Jonathan und Janita.
Peter G. Kühn
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wo komme ich her? Wer sind meine Wurzeln? Diese Fragen treiben Menschen um. Sie wollen mehr als nur eine Ahnung ihrer Herkunft gewinnen. Sie suchen nach Wurzeln für Talente, nach Quellen von Charaktereigenschaften, nach Ursachen ihrer Neigungen und Interessen. Häufig werden Kirchenbücher gewälzt, Standesämter befragt. Viele reisen an Orte, die eine besondere Rolle in der familiären Vergangenheit spielen. Computerprogramme zur Erstellung eigener Stammbäume haben Hochkonjunktur; Internet-Suchmaschinen liefern Anhaltspunkte. Seit Urzeiten definieren sich Menschen über Generationsfolgen. Exemplarisch stehen dafür Familienamen wie Hansson (Sohn des Hans) aus dem skandinavischen Bereich und der Zusatz „ben“ oder „ibn“ im Hebräischen bzw. Arabischen (jeweils: Sohn des...) mögen dafür als Beispiele dienen.[2]
Es istanscheinenddie leibliche Familie, um die sich alles dreht. „In der leiblichen Familie aufzuwachsen ist in unserer Kultur selbstverständlich. Ein Kind ist Teil seiner Verwandtschaft, letztes Glied von Generationen. Durch seine Familie weiß es, wer es ist, bekommt es seine Besonderheit, seinen Namen, seine Identität.“ (Krappel 1999, 62) Tyrell (1988, 147) spricht davon, dass „mitEheund(notwendig hinzutretend) Filiation exklusiv und vollständig die beiden Rekrutierungsprinzipienbenannt sind, die – unter Ehemann/Vater, Ehefrau/Mutter und Kind – die familiale Zusammengehörigkeit unabweisbar herstellen.“Was aber, wenn die leibliche Familie fehlt? Was bleibt jenen unter uns, die früh schon adoptiert worden sindund ihre genealogischen Wurzeln nicht kennen? Adoptierte haben keine Herkunft außerhalb ihrer Adoptivfamilie. Tatsächlich liegen dort ihre sozialen Wurzeln. Die biologische Herkunft jedoch ist abgerissen.Für die meisten Menschengehörenbiologische und soziale Elternschaft zusammen. Bei Adoptierten wird beides schon am Beginn des Lebensweges getrennt. Sicher ist das ansatzweise auch in Pflegefamilien oder so genannten „Patchworkfamilien“der Fall. Bei einer Adoption[3]sind jedoch die Verbindungen zu den leiblichen Eltern in besonders drastischer Weise gekappt. Fragen und Schwierigkeiten von Bindung oder Identität, die auch in anderen Konstellationen auftreten können, werden bei der Inkognito-Adoption am schärfsten auf den Punkt gebracht. So kann die Forschung an der verhältnismäßig kleinen Untersuchungsgruppe der Adoptierten Ergebnisse zutage bringen, welche auch für viele andere Bevölkerungsgruppen relevant sind. Die gewonnenen Erkenntnisse können auf weitere Familienarrangements übertragen und bei der sozialen Arbeit angewandt werden.
Adoption ist eine seit alters her bekannte Methode zur Nachwuchsgenerierung. Die Trennung von sozialer und biologischer Elternschaft beschäftigte sowohl die archaischen Mythen (z.B. Ödipus und Mose), als auch immer wieder die Literatur. In den letzten Jahrzehnten dringt das Thema der Suche Adoptierter nach ihrer Herkunft auch in Deutschland immer wieder durch Berichte, Talkshows und Filme in die mediale Öffentlichkeit. Diesem Phänomen widmet sich die vorliegende Arbeit. „Unklar ist, wie vieleAdoptierte Informationen über die leiblichen Eltern wünschen bzw. mit diesen zusammentreffen wollen. Für die Bundesrepublik Deutschland liegen keinerlei Zahlen vor. Befragungen älterer Adoptivkinder erbrachten unterschiedliche Angaben über den Anteil derjenigen, die eine Suche beabsichtigen: Die ermittelten Prozentsätze reichen von 45 Prozent über mehr als ein Drittel bis 20 Prozent.“ (Textor 1988, 456) Es ist anzunehmen, dass mit einer zunehmenden öffentlichen Thematisierung der Suche Adoptierter in den letzten 25Jahren der Prozentsatz inzwischen erheblich höher liegt. Genaue Zahlen sind jedoch immer noch nicht verfügbar.
Der Verfasser selbst wurde als Kleinkind von seinen Eltern adoptiert und hat vor über fünfzehn Jahren die leiblichen Eltern zum ersten Mal getroffen. Als Insider hat er einen ganz besonderen Blick auf die Thematik. Das zeigt sich schon im schnellen Zugang zu Betroffenen, im raschen Herstellen eines Vertrauensverhältnisses. Dies kann besonders für die narrativen Interviews gewinnbringend sein. Gewiss birgt eine solche Position auch Risiken, wie zum Beispiel die Gefahr, dass das eigene Erleben die Forschungsergebnisse beeinflussen könnte und Zitate der Interviewpartner durch die eigene Geschichte hindurch interpretiert oder mit dieser ins Verhältnis gesetzt werden. Diese Risiken sind dem Verfasser bewusst und erstelltein allen Arbeitsphasensicher, sieweitgehendfernzuhalten. Das fiel umso leichter, da die eigene biografische Spannung dank mehrerer Kontakte und Begegnungen mit den leiblichen Eltern vor Jahren schon gelöst wurde.Methodisch dienten die Auswertung zentraler Interviewpassagen in einer Forschergruppe und die konsequente Reflexion der eigenen Position im Untersuchungsprozess dieser Sicherstellung.„Die Wissenschaftlichkeit der Soziologie hängt […] davon ab, dass die Forscherin und der Forscher ihre eigene Beteiligung an der sozialen Welt, ihre Einbindung, Interessen, Wertungen, Sichtweisen, Emotionen erkennen und von ihrem wissenschaftlichen Standpunkt abtrennen.“ (Krais/Gebauer 2010, 12f) Wenn dies gelingt, bietet sich dem Forscher, der zugleich Insider ist, ein besonderer Blickwinkel auf das sensible Forschungsfeld, sodass die hieraus erwachsenen Chancen weitaus gewichtiger betrachtet werden können,als mögliche Risiken.Die hier vorliegende Studie soll deshalb in besonderer Weise eine wissenschaftlich reflektierte Sicht des Phänomens der Herkunftssuche Adoptierter bieten. Insiderwissen war Ausgangspunktfür die Themenwahl und formt einen besonderen Blick auf die Problematik. Dennwissenschaftliche Beiträge, die den Prozess der Adoption und zum Teil auch die Herkunftssuche Adoptierter von außen betrachten, gibt es selbst im deutschen Sprachraum schon einige[4]. Diesen Studien sollen die hier erarbeiteten Ergebnisse zur Seite gestellt werden und so einen multiperspektivischen Blick ermöglichen. Der Standpunkt des Forschers im Geschehen ist in jedem Fall zu berücksichtigen. Durch die Anwendung qualitativ-empirischer Methodik ist der Forscher in jedem Fall direkt mit dem Geschehen verbunden, was ein Merkmal qualitativen Forschens ist. „Die Involviertheit des Forschers ist konstitutiver Bestandteil des Forschungsprozesses und damit auch des Ergebnisses dieses Prozesses.“ (Lamnek 2005, 23) In der vorliegenden Studiewirddie thematische Involviertheit desForschers gesehen,bei der Auswertungberücksichtigtundals Chance genutzt.
Im Folgenden soll nun derAufbau der Forschungsarbeitbeschrieben werden. Zunächstwird die Ausgangsfrage für die Forschung formuliert und begründetunddamitdas Ziel der Forschung fokussiert und von anliegenden Bereichen abgegrenzt. Das erste Kapitel beleuchtet denthematischenHintergrundder empirischen Forschung. Hier gibt es grundlegende Informationen, welche zum Verständnis des Forschungsthemas relevant sind. Zunächst geht es um die Grundsätze und die Geschichte von Adoption: Welche Formen gab es und gibt es, was wird heute anders gehandhabt als früher? Was waren die ursprünglichen Intentionen von Adoption und wie ging die Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert weiter? Danach werden wichtige Begriffe rund um das Adoptionsgeschehen und die Herkunftssuche beleuchtet, erklärt und interpretiert. Die heute möglichen Formen von Adoption werden beschrieben und auf die sich ergebenden unterschiedlichen Voraussetzungen für die Kontaktaufnahme mit der Ursprungsfamilie hin untersucht. Um die Rollen und Beziehungen im Adoptionsgeschehen nachvollziehbar zu machen, wirddasArbeitsmodell desAdoptionsvierecksvorgestellt. Die Seiten dieses Vierecks sind die Vermittlungsstelle, die Herkunftseltern, die Adoptiveltern sowie die Adoptierten.Es schließen sich statistische Zahlen zur Adoption in der alten Bundesrepublik und der DDR sowie teilweise bis heute im wiedervereinigten Deutschland an. Diesewerdenauf die Forschungsfrage hin untersucht und ausgewertet. Auch auf das Verhältnis zwischen Herkunftssuchen und den aktuell vermittelten Adoptionen wird eingegangen.In diesem statistischen Abschnitt sind einesteils Daten des statistischen Bundesamtes ausgewertet worden. Zum anderen werden Zahlen und Daten vorgestellt, die im Rahmen dieser Forschungsarbeit völlig neu erhoben oder erfasst wurden. Das betrifft die Adoptionszahlen der DDR sowie das aktuelle Verhältnis zwischen vermittelten Adoptionen und Herkunftssuchen.Die Würdigung des rechtlichen Rahmens ist der nächste Schritt. Die wichtigsten Aussagen des BGB und anderer Gesetze zur Adoption und der Suche nach den leiblichen Eltern werdendargestellt. Dabei wird auch auf die Gesetze und das Verfahren in der DDR eingegangen. Die Literaturrecherche zeigt, dass es wenig strukturiertes Material im deutschen Sprachraum zum konkreten Thema gibt. Neben einzelnen Büchern gibt es lediglich Artikel in Fachzeitschriften und Kapitel in Büchern über Adoption. Das Thema der Herkunftssuche Adoptierter wurde in der Sozialforschung im deutschen Sprachraum bisher nur sehr spärlich bearbeitet. Die meisten Fachveröffentlichungen stammen aus den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Dagegen sind auf dem aktuellen Markt mehrere Berichte von Betroffenen zu finden. Abschließend wird im ersten Kapitel ein exemplarischer Fall aus beobachtendem Blickwinkel vorgestellt, um die angesprochenen Frage- und Problemstellungen aus der Praxis heraus zusätzlich zu begründen.
Im anschließenden Kapitel wird dertheoretische Hintergrunddieser Studie vorgestellt und der heuristische Rahmen beschrieben. Für die Bearbeitung des Themas Adoption erweist sich die Bindungstheorie alsergiebig, da es hier um Beziehungen, Bindungen und Interaktionen sowiederenAuswirkung auf das Individuum geht. Der soziale Kontext ist für die Entwicklung einer persönlichen Identität von entscheidender Bedeutung. Die Anfänge der Formulierung der Bindungstheorie liegen in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby sowie die kanadische Psychologin Mary Ainsworth sind hier als Pioniere zu nennen. Es schließt sich eine Diskussion über Identität, Identitätsfindung und –konstruktion an. Die Frage nach dem „Sein“ und „Werden“ scheint im Prozess der Suche nach der Herkunft zentral zu sein. Verschiedene Konzepte werdenkomparativnebeneinander gestellt und auf ihre Relevanz im Bezug auf das Thema untersucht. Neben verschiedenen Klassikern der Identitätsforschung, wie Erik H. Erikson und George Herbert Mead werden auch neuere Ansätze (Heiner Keupp, Stuart Hall) zu Wort kommen.Als handlungstheoretischer Ansatz wurde die Rational-Choice-Theorie nach Hartmut Esser,eine Theorie der erwarteten Folge einer bestimmten Handlung im Sinne einer Wert-Erwartungs-Theorie,gewählt. Obwohl das theoretische Interesse bei den direkten Akteuren liegt, ist „Rational-Choice“ ein soziologischer Ansatz. Um allgemeine Erklärungen zu finden, muss man nach Esser auf die Ebene der Akteure(also der Individuen)gehen und von daher eine Handlungstheorie entwickeln, die soziale Prozesse erklärt. Wenn man die Wahl einer Handlung der Individuen aufgrund einer theoretisch typisierbaren Situation erklären kann und weiterhin die Wirkung dieser Handlung auf das Entstehen einer nun neuen sozialen Situation beschreibt, hat man in der Gesamtheit eine Theorie sozialen Handelns und sozialer Prozesse. Ein vierter theoretischer Ansatz ist die Feldtheorie Kurt Lewins,welche sich im Verlauf der Forschung als zusätzlichesrelevantesBetrachtungsmuster für das zu untersuchende Phänomen ergab. Lewin entwickelte ein psychologisches Feldmodell in Anlehnung an die physikalische Feldtheorie.Kräfte mit anziehenden oder abstoßenden Gerichtetheiten beeinflussen das Feld, in dem sich die Person bewegt, um eine bestimmte Zielregion zu erreichen bzw. ein Ersatzziel zu finden.Dabei können Barrieren zwischen den Regionen des Feldes durchbrochen oder neu errichtet werden.Die Feldtheorie hat sich alswichtigerSchlüssel zum Verständnis der Herkunftssuche Adoptierter erwiesen.
ImfolgendenKapitelwird dasmethodische Vorgehenbeschrieben. Die empirischen Forschungsmethoden, das Experteninterview sowie das narrativ-biografische Leitfadeninterview,werdenvorgestellt. Dabei bildet die Grounded Theory (nach Strauss/Corbin 1996) die wichtigste Grundlage für die Auswertung. Es werdenzusätzlich weitere Methoden, wie die Auswertung des Adult-Attachment-Interviews oder ein gestalttheoretischer Blick auf die Interviewtexte(nach Rosenthal 1995), vorgestellt, welche in der anschließenden praktischen Auswertung angewandt werden, um eine umfassenden Blick auf das Thema zu erhalten.
Imempirischen Teil(Kapitel 4 und 5)fließen dieverschiedenenInterviews in diese Arbeit ein.Es wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt:Drei Experteninterviewsdientenvor allem der Exploration und Feldforschung,jedoch konnten in der Auswertung bereitserste inhaltlicheZwischenergebnissegeneriert werden. Darauf folgend wurdenzehn narrativ-biografische Interviews mit Betroffenen geführt, transkribiert und ausgewertet.Hier war ein vertieftes Eintauchen in die Problematik der Suche Adoptierter nach ihren genealogischen Wurzeln möglich. Es wurden weitreichende Erkenntnisse über die Motive und Barrieren für diesen Schritt gefunden.Die Auswertung nach verschiedenen Kriterien und unter Zuhilfenahme der im Theorieteil beschriebenen Ansätze nimmt den Hauptteil der Studie ein. Die Interviews werden dabei anhand der Forschungsfrage auf Ergebnisse und Erkenntnisse hin untersucht. Schließlichsindin Kapitel 6dieErgebnissein Form von theoretisch formuliertenEssentials der Forschungsarbeitfokussiert. Dabei wird ein feldtheoretisches Modell zur Motivation und zu den Barrieren der Suche Adoptierter nach ihrer leiblichen Familie entwickelt. Anschließend werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund bisheriger Forschungen diskutiert, sowieHinweise für die praktische Relevanz dieser Studie gegeben.
Forschungsfrageund thematische Abgrenzung
Adoptivkinder werden nach den aktuellen Adoptionsgesetzen vollständig in das Familiensystem der Adoptivfamilie integriert. Alle Verwandtschaftsverhältnisse, auch die Großfamilie, gehören dazu. Dies ist vom Gesetzgeber gewollt und dient dem Wohl des Kindes, das auf diese Weise in normalen Familienverhältnissen aufwachsen kann. Dennoch bleibt immer auch die andere Seite bestehen. Der unklare Beginn der eigenen Lebensgeschichte, die ursprüngliche Zugehörigkeit zu einer anderen Familie bzw. die Beschäftigung damit können dazu führen, so dass sich Adoptierte auf den Weg machen, ihre genealogischen Abstammung zu rekonstruieren und dabei Kontakt zur leiblichen Familie suchen.An dieser Stelle setzt die Forschungsarbeit ein. Es geht um das Verständnis und die Interpretation der Prozesse, die Adoptierte für den Schritt der aktiven Suche motivieren. Dabei sind diezuvor beschriebenenTheorien als grundlegenderheuristischerRahmenzu verstehen. Da der Forschungsansatz induktiv ist, müssen diese Theorieansätze dennoch zunächst vorläufiger Natur sein und ein Hinzuziehen anderer oder weiterer Theorien erscheint möglich. Ein Betrachten der Fragestellung von recht verschiedenen Denkansätzen her ermöglicht jedoch bereits zu Beginn ein breites Erfassen der auftretenden Phänomene.
Eine empirisch belegte Theorie speziell zur Suche Adoptierter nach ihrer Herkunft undder Rekonstruktionihrer Adoptionsgeschichte gibt es nicht. Ziel dieser Forschungsarbeit soll sein, eine solche Theorie zu entwickeln und zu begründen: Wie sehen die Lebensgeschichten, Bindungsrepräsentationen und Identitätskonstruktionen der Adoptierten, die auf die Suche gehen, aus? Welchen Einfluss hat der (geglückte oder missglückte) Kontakt mit der Herkunftsfamilie auf das Selbstbild der Betroffenen? Welchen individuellen Nutzen oder welche Befriedigung streben sie mit der Kontaktsuche an? Werden diese Erwartungen erfüllt? Welche typischen Situationen und Konstellationen führen zuder Entscheidung, die Suche nach der Herkunft tatsächlich in Angriff zu nehmen? Wie wirkt sich die (erfolgreiche oder erfolglose) Suche nach den leiblichen Eltern auf den sozialen Kontext der Betroffenen aus?Gibt estypisierbare, sich wiederholende Handlungs- oder Interpretationsmuster?
Das sich daraus ergebende Anliegen der Forschung lautet:Adoptierte und ihre Herkunftssuche verstehen.DiekonkreteForschungsfrageist:Was motiviert Adoptierte für die Suche nach ihrer Herkunftsfamilie und aus welchen lebensgeschichtlichen Zusammenhängen heraus beginnen sie mit dieser Suche? Wie verarbeiten und bewerten sie die sich daraus ergebenden Prozesse bezüglich ihrer Identitätskonstruktion und ihres familiären Zugehörigkeitsgefühls?Daraus abgeleitet ergibt sich folgende Zielstellung:Es gilt, eine Theorie zu entwickeln, die Motive, Hintergründe und Verläufe des Suchens nach der leiblichen Familie bei Adoptierten belegt und erklärt.Dabei sind verschiedene theoretische Ansätze zunutzenund mitdenempirisch ermittelten Forschungsergebnissen zusammenzuführen, um ein neues Erkenntnisniveau zu erreichen.
Die Forschungsfrage soll anhand einiger Rahmenbedingungen weiter eingegrenzt werden:Zielgruppe sindAdoptierte, die mindestens mit einem leiblichen Elternteil nach der Suche Kontakt haben oder hatten.Interessant wäre esauch, Lebensgeschichten suchender und nicht-suchender Adoptierter miteinander ins Verhältnis zu setzen. Das würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ebenfalls nicht betrachtet wird, wenn die Herkunftssuche zu keinem Kontakt mit den leiblichen Eltern geführt hat, die Suche als das Ziel nicht erreicht hat.Der Schwerpunkt der Fragestellung liegt bei den Adoptierten selbst.Die Blickwinkel der abgebenden Mütter und der Adoptiveltern sowie die Rolle der vermittelnden Stellen werdenergänzendin die Studie einfließen.
In der vorliegenden Forschungsarbeit, die sich ausschließlich auf Deutschland bezieht, geht es nicht um Auslandsadoptionen (mit weiteren, kulturellen Schwierigkeiten der Begegnung mit der leiblichen Familie), sondern der Fokus liegt auf Inkognitoadoptionen innerhalbder Bundesrepublikbzw. der DDR.Stiefkindadoptionen[5]und Verwandtenadoptionen waren und sind ebenfalls ein wichtiger Teil der Adoptionsvermittlungsarbeit. Das Kind wird auf diese Art nahe an seiner Herkunftsfamilie untergebracht und aufgenommen.Dadurch wird jedoch der Blick in Hinsicht auf unsere formulierte Forschungsfrage getrübt, so dass dieser Teil der Adoptierten hier ebenfalls nicht untersucht wird undspezielle Probleme und Fragen aus diesem Bereich nicht imFokusstehen. Die Ergebnisse könnenjedoch sowohl in Richtung der Auslandsadoptionen, als auch bezüglich der Stiefkind- und Verwandtenadoptionausgewertet und durch Folgestudien erweitert werden.
Zielgruppe für die Untersuchung ist die Kohorte der Fremdadoptierten aus den Jahren 1950-1990. Bei dieser Zielgruppe sind die Voraussetzungen für das Vorhaben, nach der leiblichen Abstammung zu suchen, besonders gegeben. Der Beginn mit dem Jahr 1950 ergibt sich daraus, dass da die Zeit der Kriegswaisen undderenUnterbringung in Pflege- und Adoptivfamilien weitgehend abgeschlossen sein dürfte. Bei ihnen ist noch mal ein besonderer Blickwinkel durch den Krieg und den Verlust der Eltern gegeben. Eine Begegnung mit den leiblichenElternist nicht mehr möglich. Die Kinder, die aus Beziehungen mit Besatzungssoldaten entstanden sind, sind in der Untersuchungsgruppe weitgehend inbegriffen.Außerdem gibt es verlässliche statistische Zahlenerstnach der Gründung der Bundesrepublik, also ebenfalls erst ab 1950, so dass ab diesem Zeitpunkt belastbare Aussagen möglich werden.
Das Jahr 1990 ergibt sich aus einem inhaltlichen und einem praktischen Grund. Erstens istspätestensmit Beginn der 90er Jahre eine zunehmende Öffnung der Adoptionspraxis zu beobachten. Formen von halboffener und offener Adoption[6]werdenimmer mehr alltäglich. Damit erledigt sichoftdas Problem der Herkunftssuche, da die leiblichen Eltern zumindest teilweise,in irgendeiner Form bekannt sind. Bis 1990 kann mandagegensagen, dass sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland die Inkognitoadoption bei Fremdadoptionen infastallenFällenkonsequent angewandt wurde. Ein zweiter Grund ist praktischer Natur: Wenn 1990 als letztes Adoptionsjahr in diese Studie einfließt, sind alle Interviewpartner zum Zeitpunkt des Interviews mindestens 18 Jahre alt und können rechtlich selbständig Informationen über die Adoptionsvermittlungsstelle einholen. Zudem ist von jedem Interviewpartner ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit zu erwarten (wobei das bei diesem sensiblen Thema stark variieren wird) und rechtlich können die Interviews geführt werden, auch ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Adoptiveltern zu haben.
Untersucht werdenin dieser StudieBetroffene von Fremdadoptionen, die möglichst als Kleinkind oder Säugling zu ihrer Adoptivfamilie gekommen sind. Zeiten als Pflegekind bzw. Adoptionspflege / Anbahnungszeit werden dazu gerechnet, wenn anschließend eine Adoption erfolgte. Entscheidend für die Zugehörigkeitzur untersuchten Kohorte ist der Tag der Adoption, der zwischen dem 01.01.1950 und dem 31.12.1990 liegen soll.
1Forschungshintergrund
In diesem Kapitel werden die relevanten geschichtlichen, strukturellen und rechtlichen Fragen, die mit der Herkunftssuche Adoptierter in Verbindung stehen, beleuchtet.Dabei wird das Adoptionsviereck als Arbeitsmodell erklärt.Daneben wird ausführlich auf die Adoptionsstatistiken der Jahre 1950-1990 in beiden deutschen Staaten, sowie im wiedervereinigten Deutschland bis zum Jahr 2012 eingegangen. Ein Exkurs über politisch motivierte Zwangsadoptionen in der DDRist in das Kapitel eingebunden. Schließlich wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema dieser Studieaufgegriffenund gewürdigt. Durch die Präsentation eines Fallbeispiels wird zum Abschluss die praktische Relevanz derForschungsarbeit, u.a. für die Arbeit von Adoptionsvermittlungsstellen, dargestellt.
1.1Geschichte und Intention der Adoption
Adoption heißt übertragen „hinzuwünschen“ und war schon im Altertum bekannt. Die ursprüngliche Intention war, bei Kinderlosigkeit einen Erben zu gewinnen. „Geht man auf die Ursprünge der Adoption zurück, so zeigt sich, dass beherrschendes Motiv lange Zeit die Sicherung der Familiennachfolge in Fällen der Kinderlosigkeit war, wobei die vermögensrechtliche Seite oft eine bedeutende Rolle spielte. Sehr häufig handelte es sich deshalb auch um die Adoptionen von Volljährigen.“ (Paulitz 2006, 7) In der späteren bürgerlichen Gesellschaft mit dem (immer noch vorherrschenden) Ideal der Kleinfamilie wurde Adoption volkstümlich als Möglichkeit für ungewollt kinderlose Paare gesehen, doch zu einem Kind zu kommen. Hier spielte auchder patriarchale Gedanke vom „Kind als Besitz“ eine Rolle.
Bekannte geschichtlich-mythische Beispiele für Adoptionen sind der Ödipus-Mythos und die biblische Geschichte der Aussetzung des hebräischen Kindes Moses, das von der Pharaonentochter aufgezogen und adoptiert wird. Bei dieser Geschichte istzu beobachten, dass Moses zu seinem ursprünglichen Volk zurückkehrt und sich mit diesem identifiziert, es dann schließlich in die Freiheit von der Unterdrückung durch die Ägypter führte. Bei deren Hauptrepräsentanten war er jedoch aufgewachsen. Auch Mose hatte also eine eigene Geschichte der Herkunftssuche nach seinen ursprünglichen Wurzeln.
1.1.1Historischer Blick auf die Adoption
An dieser Stelle kann nur ein kurzer Überblick geboten werden.[7]Adoption ist ein schon seit Jahrtausenden bekanntes und genutztes Mittel der Sicherung des Familienverbandes. Im Altertum wurde adoptiert, um Blutsverwandtschaft bei eigener Unfruchtbarkeit zu ersetzen und so den Fortbestand der eigenen Sippe und des Stammes zu sichern. So sind auch alte babylonische Regelungen einzuordnen, die eine unveränderliche Verbindung mit den Annehmenden sichern sollte: „Vor viertausend Jahren wurde dem Adoptierten, der es wagte, öffentlich zu sagen, dass er nicht das Kind seiner Eltern sei, die Zunge herausgeschnitten wurde. Wenn er gar nach seinen leiblichen Eltern suchte, dann wurde er zur Strafe geblendet.“ (Sorosky/Baran/Pannor 1982, 25) Das Inkognito und dessen Wahrung durch ein Nicht-Reden- und Nicht-Sehen-dürfen wurden auf drastische und brutale Weise durchgesetzt. Auch in anderen Kulturräumen, wie in China und Indien, sind Adoptionsbräuche nachzuweisen (vgl. Sorosky/Baran/Pannor 1982, 27).DieAdoptionhat sichalsMöglichkeit der Familiengründung bzw. der Erbengewinnung in verschiedenen Kulturen weltweit und zu allen Zeiten etabliert.
Im deutschen Sprachraum wurde Adoption mit dem römischen Recht eingeführt. Aus dieser Zeit sind erste Gesetze zur Adoption bekannt. „Bereits das Römische Recht kannte die Adoption. Vor Justinian (527-565 n. Chr.) war sie eine sogenannte ‚adoptio plena‘, das heißt, eine Adoption, die mit allen Folgen einer Kindschaft ausgestattet war (insbesondere mit der ‚patria potestas‘). Seit Justinian erzeugte die ‚datio in adoptionem‘ nur noch ein Kindeserbrecht gegen den Adoptivvater, dagegen kein Kindesverhältnis mehr. Dies war die sogenannte ‚adoptio minus (quam) plena‘.“ (Oberloskamp 1993, 14) Auch hier ging es vor allem um Gewinnung von Erben und Fortbestand der eigenen Familie. Adoption wurde im Römischen Reich nicht verschwiegen oder als beschämend angesehen. Auch wurde nicht erwartet, dass der Adoptierte die Verbindungen zu seiner bisherigen Familie abbrach. Wie ein Ehevertrag war die Adoption ein Weg, familiäre und politische Allianzen zu stärken. Bekanntestes Beispiel einer Adoption damals ist wohl die Adoption des Augustus Octavian durch Julius Cäsar, der ihn so zum Kaiser machte. Es folgten später die sogenannten Adoptivkaiser. „Die Bezeichnung erklärt sich aus der Art der Nachfolgeregelung: Nach dem Vorbild von Augustus und Galba versuchten die Adoptivkaiser, durch möglichst frühzeitige Adoption und dadurch gewährleistete Vorbereitung des jeweiligen Nachfolgers der bestgeeigneten Persönlichkeit die Herrschaft zu sichern.“ (Meyers Lexikon 1992, Bd. 1, 82) Adoption war im Römischen Kaiserreich ein flexibles Mittel, die eigene Nachfolge besser abzusichern, als es natürliche Nachfolge tat, wenn z.B. der leibliche Nachwuchs als nicht tauglich genug für die hohe Verantwortung erachtet wurde. Es ist davon auszugehen, dass diese Praxis sich nicht auf die Kaiser beschränkte, sondern in den Oberschichten des Römischen Reichesgenerellpraktiziert wurde.Meist wurden Erwachseneadoptiert. Wenn es Kinder waren, so standen dennoch die Erhaltung des eigenen Stammbaumes und die Nachfolge im Mittelpunkt. Ein heutiges Verständnis vom Wohl oder den Bedürfnissen des Kindes war nicht im Spiel.
1.1.2Entwicklung inDeutschland
„Über das Gemeine Recht, also über das seit dem Ende des Mittelalters in Deutschland rezipierte römische und mit kanonischen und germanischen Elementen vermischter Recht, fand die Adoption als ‚adoptio minus plena‘ Eingang in alle großen europäischen Gesetzeswerke.“ (Oberloskamp 14) Der Blick nach Deutschland zeigt, dass es hier ebenfalls eine lange Geschichte der Aufnahme fremder Kinder in die eigene Familie gab. Manche klingen nahezu modern: „Eine frühe Maßnahme im Sinne des Kindes war die im germanischen Kulturkreis vorzufindende ‚Ankindung’, die dazu diente, den unehelich Geborenen die Rechte ehelicher Kinder zu garantieren.“ (Krappel 1999, 10; vgl. Napp-Peters 1978, 7)Im mittelalterlichen Deutschland hatte die Adoption eine geringere Bedeutung, wurde jedoch im Ständestaat des 18.Und 19.Jahrhunderts beispielsweise zur Erhaltung von Adelstiteln, wichtig.[8]Auch hier zeigt sich wieder der primär materiell-strategische Zweck von Adoptionen in dieser Zeit.
Bis ins späte 19. Jahrhundert und noch darüber hinaus waren in Europa uneheliche Kinder der allgemeinen Diskreditierung ausgesetzt, sie waren „Bastarde“,[9]die im vorherrschenden engen christlich-ethischen Weltbild kaum einen Platz fanden. Die bürgerliche Kleinfamilie wurde mit der Urbanisierung allmählich die Richtschnur der angestrebten und anerkannten Lebensform und löste so die bäuerliche Großfamilie ab, die in den Jahrhunderten davor das primäre Familienmodell darstellte. Uneheliche Kinder passten dort nicht hinein. Alleinerziehende Mütter hatten kaum eine Chance auf ein vernünftiges, materiell abgesichertes Leben. So wurden viele Kinder in dieser Zeit ausgesetzt oder fortgegeben. Ähnliches passierte auch mit Kindern, die aus armen Familien stammten und von den Eltern nicht ernährt und aufgezogen werden konnten. Solche Kinder wurden gelegentlich bis in das 20. Jahrhundert hinein auch in Europa als billige Arbeitskräfte in andere Familien aufgenommen. „Das System des ‚Verdingens‘, [bedeutet], die Annahme diente der Beschaffung von Arbeitskraftundverpflichtete das Kind, die ihm gewährte Nahrung, Unterkunft und Kleidung etc. abzuverdienen.“ (Napp-Peters 1978, 23) Fjodor Dostojewski beschreibt am Rande seinesRomans„Die Brüder Karamasow“ einen solchen Fall, der die Selbstverständlichkeit dieser Handlungsweise illustriert: „Dieser war unehelich geboren, die Eltern hatten ihn als sechsjähriges Kind irgendwelchen Hirten in den Schweizer Bergengeschenkt, die Hirten zogen ihn auf, um ihn zur Arbeit zu verwenden. Er wuchs bei ihnen heran wie ein kleines wildes Tier, die Hirten gaben ihm keinerlei Unterricht, im Gegenteil, als Siebenjähriger musste er auf ihr Geheiß schon die Herde hüten, musste hinaus in die Nässe und Kälte, und sie kleideten ihn schlecht und nährten ihn kaum. Versteht sich, keiner von ihnen machte sich Gedanken darüber, dass sie so handelten, keiner empfand Gewissensbisse, im Gegenteil, sie glaubten sich ganz im Recht, weil [er] ihnen wie eine Sache geschenkt worden war, sie hielten es nicht einmal für notwendig, ihn zu ernähren.“ (Dostojewski1981,383) Auch wenn dieses Beispiel der Literatur entstammt, so zeigt es recht deutlich die allgemeine Einstellung zu unehelichen, fortgegebenen Kindern.
Im besseren Fall fanden sich solche Kinder in Waisenhäusern wieder, die vor allem von christlichen und wohltätigen Frauen und Männern gegründet wurden. Von da aus wurden sie etwa seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von verschiedenen Organisationen zur Adoption vermittelt worden. „Die Ortsgruppen des Caritasverbandes, des katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder, dasSeraphischeLiebeswerk und einige evangelische Organisationen […] lernten durch ihre Fürsorgetätigkeit viele verlassene Kinder kennen und fanden unter denen, die ihre Arbeit unterstützten, auch Ehepaare, die bereit waren, diese Kinder in ihre Familie aufzunehmen.“ (Napp-Peters 1978, 27) Um die Kinder vor Diskreditierung zu schützen, wurde das strikte Inkognito propagiert.„1928 erhob das Reichsgericht die Inkognitoadoption zum Standardmodell.“ (Breitinger 2011, 79)Die Kinder sollten ggf. gar nicht wissen, dass sie adoptiert seien und der Kontakt zu den leiblichen Eltern war nicht erwünscht und normalerweise auch nicht möglich. So wurde den „Bastarden“ ein relativ normales Leben in einer Familie, die sichaus erbrechtlichen, altruistischen oder anderen Gründen (noch) ein Kind wünschte,ermöglicht.Auch die Adoptiveltern konnten durch das Inkognito die Abweichung von der Norm der bürgerlichen Kleinfamilie, die ausverheiratetenEltern und leiblichen Kindern bestand, möglicherweise verbergen oder vergessen machen.„Gegen diese gesellschaftliche Norm verstießen nun die Ehefrau, die ihrer angeblich natürlichen Bestimmung nicht nachkam, weil sie keine Kinder gebären konnte und die ledige Frau, die zwar Kinder in die Welt setzte, aber sie nicht aufzog. Beiden Frauen drohte die gesellschaftliche Ächtung, beide rettete die Adoption. Sie übertünchte mit ihrer Geheimniskrämerei die Schande der Kinderlosigkeit und das Stigma der unehelichen Geburt.“(Breitinger 2011, 81)
In Deutschland blieb über die Jahrhunderte das Hauptziel einer Adoption, meist wohlhabenden, kinderlosen Ehepaaren den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen und sie zur Weiterführung ihres Familienstammbaumes zu befähigen, „das Andenken an ihren Namen und ihre Familie fortzupflanzen.“ (§§1741-1772 BGB, alte Fassung, zitiert in Jungmann 1987, 3) Die Grundidee des Römischen Rechtes lebte fort. Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900 brachte eine einheitliche rechtliche Regelung der „Annahme an Kindes statt“ für alle deutschen Länder. Vorher galten unterschiedliche landesrechtliche Gesetze. „Mit der Übernahme in das Bürgerliche Gesetzbuch wurde der Adoption zusätzlich zu der Interessen- auch eine Schutzfunktion zugewiesen.“ (Napp-Peters 1978, 35) Auch wenn das Hauptziel einer Adoption weiterhin im familialen Bereich und weniger im fürsorgerischen Bereich zu sehen war, sind doch bereits im BGB und bei der weiteren Entwicklung im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts Bestrebungen zu verzeichnen, Adoption mehr mit Blick auf die Fürsorge des Kindes zu gestalten. Dennoch blieb das Adoptionsrecht weitgehend unverändert. In der Zeit des Nationalsozialismus vorgenommen Änderungen dienten vor allem der Durchsetzung der Rassenpolitik.
Im BGBwarursprünglichdas Mindestalter für Adoptiveltern bei 50 Jahren festgelegt. Eine Eltern-Kind-Beziehung konnte durch den großen Altersunterschied bei einer Adoption Minderjähriger so kaum entstehen. Die Adoption Volljähriger zur Beschaffung eines Erben und zur eigenen Sicherung im Alter war nach wie vor durchaus normal. Erst Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde dieses Mindestalter auf 35 Jahre gesenkt, die Annahme Minderjähriger wurde zur Regel (vgl.§§ 1744 Satz 3, 1745 c BGB alte Fassung). Die Einwilligung der leiblichen Mutter zur Adoption konnte erst gegeben werden, wenn der Säugling mindestens drei Monate alt war. Diese Einwilligung konnte allerdings in Ausnahmefällen gerichtlich ersetzt werden. 1973 wurde das Mindestalter für Adoptiveltern auf 25 Jahre gesenkt. Bei einer Adoption blieben dennoch Verwandtschaftsverhältnisse zur Ursprungsfamilie bestehen und zur Verwandtschaft der Adoptiveltern entstand kein Rechtsverhältnis.„Das bis 1976 geltende bundesdeutsche Adoptionsgesetz sah keine Volladoption vor. Der Adoptionsvertrag […] konnte sogar in begründeten Fällen wieder aufgehoben werden. Das adoptierte Kind war zwar mit seinen Adoptiveltern, nicht aber mit deren Verwandten verwandt, sondern blieb der Familie der leiblichen Eltern verwandtschaftlich verbunden. Es erhielt nicht automatisch die Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern und konnte durch einen Vertrag vom Erbrecht ausgeschlossen werden.“ (Ahlemeier 1982,202)Adoptionunterlag demVertragsrecht, das Vormundschaftsgericht musste allerdings bei Minderjährigkeitzustimmen.
Inzwischen hat sich der Blickwinkel auf Adoption grundlegend geändert. „Zunächst war die Adoption als Vertrag ausgestaltet, der vor einem Notar zu schließen war. Erst die große Reform des Adoptionsrechts von 1977 brachte hier eine grundlegende Änderung. Eine vertragliche Gestaltung, die eigentlich voraussetzt, dass gleichwertige Partner eine Übereinkunft schließen, schien für die Minderjährigenadoption nicht mehr geeignet. Man änderte die rechtliche Konstruktion, und nunmehr wurde die Adoption durch einen Beschluss des Vormundschaftsgerichts ausgesprochen (§ 1752 BGB). Weiter wurde normiert, dass Adoption nur zulässig ist, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.“ (Paulitz 2006, 8) Adoption wurdezunehmend als Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfeinterpretiert, wie es sich auch später mit Einführung des KJHG und im Adoptionsvermittlungsgesetz niederschlug. Das adoptierte Kind wirdnunvollständig rechtlich aus der Herkunftsfamilie gelöst und in die Adoptivfamilie integriert. Die Änderung der Formulierung‚Annahme an Kindes statt’zu‚Annahme als Kind’im Gesetzestext spiegelt die Intention der vollständigen Verwurzelung in der Adoptivfamilie wider. Es werden –das ist der Paradigmenwechsel – nicht mehr Kinder für kinderlose Eltern gesucht, sondern Kindern, die nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen können, werden Eltern vermittelt. Gesucht werden also Eltern für das Kind – nicht umgekehrt. Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt. Rechtlich sind adoptierte Kinder leiblichen Kindern absolut gleichgestellt, eine Adoption ist prinzipiell unwiderrufbar. „An Stelle der bisherigen Teiladoption mit schwachen Wirkungen trat die Volladoption, d.h., das Kind wird wie ein eheliches Kind der annehmenden Eheleute oder des Annehmenden voll in deren Familienverband eingegliedert (§1754 BGB) und ganz aus seinem ursprünglichen Familienverband herausgelöst.“ (Napp-Peters 1978, 42) Mit der großen Reform des Adoptionsrechtes fällt die alte Vertragsform des Adoptionsaktes weg. Adoption ist nun Akt gerichtlichen, staatlichen Handelns. Die Inkognitoadoption – also das Verheimlichen und Verschweigen der biologischen Herkunft gegenüber dem Kind – wird zur rechtlichen Norm. Diese Form wurde allerdings auch vorher schon bei Minderjährigenadoptionen regelmäßig angewandt und scheint historisch durchaus gut begründet, wie oben dargestellt wurde.
Seit 2004 ist durch das Lebenspartnerschaftsgesetz es auch gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern möglich, im Sinne einer Stiefkindadoption das leibliche Kind des Partners zu adoptieren. Gemeinsame Adoption fremder Kinder ist durch das Gesetz noch nicht geregelt. Allerdings kann sich ein Partner allein für eine Adoption bewerben. Aktuelle Gesetzesinitiativen bemühen sich darum, auch bei der Adoption gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften der Ehe gleichzustellen und so auch eine gemeinsame Adoption eines Kindes durch beide Partner zu ermöglichen. Die Fragestellung liegt momentan (Stand 06/2011) dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidungsfindung vor.
1.1.3Adoption in der DDR
Nach 1945 wurde in der sowjetischen Besatzungszone relativ schnell eine „Verordnung zur Erleichterung der Annahme an Kindes statt [erlassen], um Kriegswaisen und von ihren Familien getrennten Kindern die ungestörte Entwicklung und die Geborgenheit in der Gemeinschaft einer erzieherisch geeigneten Familie zu sichern“ (Grandke 1976, 271f) Das 1965 verfasste Familiengesetzbuch bringt ein Adoptionsrecht mit sich, das in vielen Punkten mit dem heutigen vergleichbar ist und moderner war, als bis in die 70er Jahre in der Bundesrepublik geltendes Recht. Warnecke (2009) vergleicht die bundesdeutsche Rechtsnorm des aktuellen BGB mit dem Adoptionsrecht der DDR. „Betrachtet man die in beiden Rechtsnormen vorgesehenen Voraussetzungen für eine Adoption, so ist festzuhalten, dass mit Ausnahme des §79 Abs. 2 Alt. 2 FGB[10]im Wesentlichen strukturelle Ähnlichkeiten bestehen und gleiche Ansätze verfolgt wurden.“ (Warnecke 2009, 157) Auch auf anderen Gebieten des Familienrechtes, z.B. bei der Gleichstellung von Mann und Frau, der Stellung unehelicher Kinder oder beim Scheidungsrecht war die Gesetzgebung des FGB der DDR durchaus liberaler und aus heutiger Sicht „moderner“, als die Gesetzgebung der alten Bundesrepublik.Eswurden bei der Eignungsprüfung potenzieller Pflege- oder Adoptiveltern in den achtziger Jahrenzum TeilMaßstäbe angelegt, die mit heutigen Ansichten des SGB VIII zum Thema Kindeswohl durchaus korrespondieren. So wurde eine Unterbringung in einer fremden Familie nur angedacht, wenn dies für die Entwicklung des Kindes förderlich war, die Eltern nicht „egozentrische“ Motive verfolgen und nötigenfalls (v.a. bei älteren Pflegekindern) Verbindungen zu leiblichen Verwandten aufrechterhalten werden können. Die individuellen Eigenschaften und Besonderheiten des Kindes sollten in der neuen Familie mindestens ebenso gefördert und entwickelt werden können, wie unter den Bedingungen des Heimes. Die Familie musste kommunikations- und beratungsfähig sein und sich den Möglichkeiten und Besonderheiten des Kindes anpassen können (vgl. Bundesarchiv, DR/2 Nr. 13750).[11] „Das, was in den vorgenannten familienrechtlichen Gebieten in der Bundesrepublik zum Zeitpunkt ihrer Änderung als Fortschritt angesehen worden ist, war in der DDR bereits gesetzlich verankert.“ (Warnecke 2009, 162) Sie hebt jedoch ebenfalls heraus, dass speziell in Bezug auf das Adoptionsrecht „die einzelnen Voraussetzungen des [aktuellen] BGB jedoch insbesondere unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips weitaus detaillierter gestaltet sind.“ (Warnecke 2009, 157)
Adoption war in der DDR Teil des„sozialistischen Erziehungskonzeptes“. Nach §42 (1) FGB ist „die Erziehung der Kinder eine bedeutende staatsbürgerliche Aufgabe der Eltern.“ ImselbenParagrafen wird ausgeführt, was damit konkret gemeint ist. Neben dem Ziel der Erziehung „zu geistig und moralisch hochstehenden und körperlich gesunden Persönlichkeiten“ wird festgestellt: „Durch verantwortungsbewusste Erfüllung ihrer Erziehungspflichten, durch eigenes Vorbild und durch übereinstimmende Haltung gegenüber den Kindern erziehen die Eltern ihre Kinder zur sozialistischen Einstellung zum Lernen und zur Arbeit, zur Achtung vor den arbeitenden Menschen, zur Einhaltung der Regeln des sozialistischen Zusammenlebens, zur Solidarität, zum sozialistischen Patriotismus und Internationalismus.“ (§42, Abs. 2 FGB) Das bedeutet für den Adoptionsprozess, dass „in der DDR auch für notwendig befunden wurde, dass der Annehmende als ‚erzieherisch wertvoll‘ eingestuft werden könne, er dem anzunehmenden gegenüber als ‚guter Staatsbürger‘ in Erscheinung treten werde, eine systemkonforme politisch-moralische Grundhaltung aufweise und vollständig in die sozialistische Gesellschaft integriert sei.“ (Warnecke 2009, 150) Wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen einer Adoption in der DDR war unter anderem, dass die Betriebe, in denen die Annehmenden arbeiteten, eine Stellungnahme bezüglich der Eignung und der Adoptionsbewerber im Hinblick auf deren moralischer und politischer Eignung abgeben mussten.
Nach § 68 des Familiengesetzbuches (FGB) der DDR traf die Entscheidung über eine Adoption der Staat und nicht ein unabhängiges Gericht. „Zuständig für die Entscheidung über den Antrag des Annehmenden auf Annahme an Kindes statt ist der Jugendhilfeausschuss des Rates des Kreises.“ (BI-Universallexikon 1988, Bd.1, 89) Im damaligen LehrbuchzumFamilienrecht wurde das so begründet: „Die gesellschaftliche Wertschätzung und die von Konsequenz geprägte familienrechtliche Ausgestaltung, die die Annahme an Kindes statt unter sozialistischen Verhältnissen erfährt, wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass sie unter Wegfall ihres früheren Vertragscharakters Gegenstand eines staatlichen Entscheidungsaktes ist.“ (Grandke 1976, 273) Der Jugendhilfe wurde damit eine staatstragende Rolle zugewiesen, die deutlich von unserem heutigen Verständnis von Institutionen wie dem Jugendhilfeausschuss oder der Verwaltung des Jugendamtes abweicht. Die Jugendhilfe in der DDR hatte nach § 70 (1) FGB als einzige Institution Klagebefugnis, wenn es um die Ersetzung der Einwilligung abgebender Eltern zur Adoption ging.DerParagrafbesagt, dass gerichtlich ersetzt werden kann, wenn „sich aus dem bisherigen Verhalten eines Elternteils ergibt, dass ihm das Kind und seine Entwicklung gleichgültig sind.“Die Klage der Organe der Jugendhilfe musste zwar von einem Gericht bestätigt werden. „Jedoch wurde die Jugendhilfe dazu aufgefordert, die Adoption von elternlosen und familiengelösten Minderjährigen zu forcieren und auch die durch § 70 Abs. 1 FGB eingeräumten Möglichkeiten aktiv zu nutzen, um auf diese Weise möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, in einer Familie aufwachsen zu können.“ (Warnecke 2009, 121) Es ist ein deutlich offensiveres staatliches Handeln in Bezug auf Familie und Kindeserziehung zubeobachten, als das in der bundesdeutschen Rechtslage jemals denkbar gewesen wäre. Dies istdurch denin der DDR grundsätzlichenVorrang des Kollektiven gegenüber dem Individuellen erklärbar.Mit diesem Vorgehen die Adoption deutlich vom Bereich der Privatverträge abgegrenzt, wie es in der Bundesrepublik bis in die 70er Jahre hinein üblich war. Adoption war, wie generell die Familie, keine reine Privatsache, sondern immer auch von gesellschaftlichen und staatlichen Interessen geleitet. Auch wenn die Entscheidung über die Ersetzung der Einwilligung zur Adoption letztlich ein Gericht fällen musste, waren die „Organe der Jugendhilfe“ in fast allen Bereichen, die die Adoption betrafen, Themensetzer und Entscheidungsträger. In der DDR wurden bspw. in den Jahren 1968 und 1969 zwischen 10 und 15% der Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern vollzogen. Davon ca. ¾ nach § 70 (2) FGB[12] und ¼ nach § 70 (1) FGB. (vgl. Bundesarchiv DR/2 Nr. 13754)[13]Der Vater eines unehelichen Kindes musste nach § 69 FGB nur einwilligen, wenn er das Erziehungsrecht übertragen bekommen hat. Dieswar eher selten der Fall.
Dazu kommt, dass nach § 249 des Strafgesetzbuches der DDR „asoziales Verhalten“ – was zum Beispiel durch ein fehlendes Arbeitsverhältnis begründet wurde – ein Grund war, Müttern das Erziehungsrecht für ihre Kinder zu entziehen und diese dann anders unterzubringen. Auch eine Ersetzung der Einwilligung der Eltern „auf Klage des Organs der Jugendhilfe“ und damit die zwangsweise Freigabe zur Adoption waren möglich. Das kann prinzipiell auch nach heutigem Adoptionsrecht, gemäß § 1748 BGB (Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils) unter bestimmten Umständen geschehen. Dennoch geraten wir an dieser Stelle in den Bereich der potenziellen Zwangsadoptionen. Auf dieses Thema wird im folgenden Exkurs eingegangen.
Trotz dieser Einschränkungenkann davon ausgegangen werden, dass für die überwiegende Anzahl von ausgesprochenen Adoptionen im jeweiligen rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext in der DDR gilt, dass das Wohl des Kindes wichtigste Zielrichtung war. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die damalige Interpretation des Kindeswohls nicht in allen Punkten mit der aktuellen Definition übereinstimmt. Bei der Bewertung des Adoptionswesens in der DDR sind einerseits der gesetzliche Rahmen und die allgemein verordnete Zielrichtung der Erziehung in der DDR zu sehen. In diesem Kontext wurden auch alle Fragen um Adoptionen behandelt. Auf der anderen Seite stehen der fürsorgerische Anspruch, der ebenfalls gesetzlich verankert war, sowie das situationskonkrete Handeln der einzelnen Adoptionsvermittlerinnen. Die meisten Adoptionen, die in der DDR ausgesprochen wurden, halten auch heutigen Kriterien weitgehend stand. Dies gilt genauso, wenn man die parallele Entwicklung des Adoptionswesens in der damaligen Bundesrepublik betrachtet. Dennoch gab es auch eine andere Seite, die keinesfalls verschwiegen werden darf: Zwangsadoptionen.
Exkurs: Zwangsadoptionen
Durch die oben beschriebene Einordnung der Adoptionsgesetzgebung in das Globalziel, die Menschen zu „sozialistische Persönlichkeiten“ zu erziehen, ist die Trennung zwischen normaler Adoptionsfreigabe und staatlichem Willkürhandeln nicht immer scharf zu ziehen. Durch die Ersetzung der Einwilligung zur Adoption durch die leiblichen Eltern wurde, wie auch im aktuellen Recht, ein Instrument zur Machtausübung gegen den Willen der Eltern gesetzlich novelliert. Offizielles Ziel einer solchen Intervention war sicherlich stets das Wohl des Kindes. Allerdings, wie oben bereits angedeutet, ist dies nicht mit heutigem Verständnis des Kindeswohls nach dem KJHG bzw. BGB in allen Belangen gleichzusetzen, da die gesamtgesellschaftliche sozialistisch-kollektive Ausrichtung wenig Platz für alternative, nonkonforme Lebensweisen bot und das Wohl des Kindes stets auch unter politisch-gesellschaftlicher Prämisse bewertet wurde. So stellte Heinz Funke, Sektorenleiter des Ministeriums für Volksbildung der DDR, während des 20. Plenums des Obersten Gerichtes der DDR Ende der 60er Jahre fest, „dass das Kindeswohl nur vom Klassenstandpunkt aus betrachtet werden könne und es dann als gewahrt gelte, wenn die Entwicklung des Kindes zum sozialistischen Staatsbürger gesichert sein.“ (Warnecke 2009, 86)
Die Frage nach politisch motivierten Zwangsadoptionen wurde erstmals in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert, als der „Spiegel“ in 1975 mehrere Artikel zu diesem Thema veröffentlichte.[14]„Der Zentralen Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltungen in Salzgitter zur Erfassung von Gewalttaten in der DDR sind bisher 13 Zwangsadoptionen von Kindern‚republikflüchtiger‘ Eltern in der DDR bekannt geworden. Wie der Leiter der Behörde, Oberstaatsanwalt Tetemeyer, gestern auf Anfrage mitteilte, sind die Informationen darüber inoffiziell gesammelt worden, weil es eineRechtsvorschriftzur Registrierung dieser Fälle nicht gibt“ (TAGESSPIEGEL, 13.03.1976; gefunden in BStU MfS ZAIG 9845, 92) Die Berliner Morgenpost berichtet am 16.01.1976 von fünf Fällen, die der Bundesregierung bekannt seien. (BStU MfS ZAIG 9845, 123) Die „Gesellschaft für Menschenrechte“ Frankfurt/Main dokumentierte 1977 die Fälle von vier Familien in ausführlicher Form. 1991, nach der politischen Wende und der deutschen Wiedervereinigung wurden im Rathaus Berlin Mitte Akten gefunden, die auf mögliche Zwangsadoptionen in der DDR schließen ließen(vgl. Warnecke 2009, 1ff, Janitzki 2009, 89ff).Daraufhin wurde eine Clearing-Stelle gegründet, die sich mit diesem Thema befasste. Diese Stelle definierte den Begriff „Zwangsadoption“ folgendermaßen. „Als zwangsadoptiert betrachtet die Clearing-Stelle jene Kinder, die ihren Eltern wegen politischer Delikte wie ‚Republikflucht‘, ‚Staatshetze‘ oder ‚Staatsverleumdung‘ weggenommen wurden, ohne dass in der Vergangenheit ein gegen das Wohl des Kindes gerichtetes Versagen der Eltern nachweisbar war.“ (zitiert in: Warnecke 2009, 175f[15]) Eine Zwangsadoption nach dieser Definition liegt vor, wenn in politischer Gesinnung oder staatsfeindlichen Handlungen die alleinigen oder überwiegend ausschlaggebenden Gründe für einen Entzug des Erziehungsrechtes zu sehen sind. Die Clearingstelle bewertete insgesamt 7 Fälle von Adoptionen als Zwangsadoptionen (vgl. Warnecke 2009, 177, Fußnote 870; Janitzki 2009, 90). „In etwa 20-25 Fällen erklärte die Clearing-Stelle gegenüber den leiblichen Eltern, dass auch nach bundesdeutscher Rechtsprechung die Herausnahme der Kinder wegen gravierender Versorgungsmängel und Kindeswohlgefährdung berechtigt gewesen wäre.“ (Janitzki 2009, 90) Warnecke (2009) findet insgesamt 6 eindeutig zuzuordnende Fälle. Auch wenn die Zahl zunächst gering erscheint, zeigen sie doch unglaubliche Momente staatlichen Willkürhandelns, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Warneckes Schlussresümee ist diesbezüglich eindeutig und musswohlnicht weiter kommentiert werden: „In der DDR hat es Fälle politisch motivierter Kindesentziehungen gegeben. […] Ein System muss sich auch daran messen lassen, was in ihm möglich ist. Die Durchführung von Zwangsadoptionen war in der DDR möglich.“ (Warnecke 2009, 351ff)
Nach § 249 des Strafgesetzbuches der DDR war „asoziales Verhalten“ – was zum Beispiel durch ein fehlendes Arbeitsverhältnis begründet wurde – ein Grund, Müttern das Erziehungsrecht für ihre Kinder nach §§ 50/51 FGB der DDR[16]zu entziehen und diese dann anders unterzubringen. Dieser Paragraf war recht dehnbar, wurde allerdings von der Clearing-Stelle nicht als politisches Delikt in die Definition aufgenommen. „Diese Aussparung ist insofern erstaunlich, als gerade auch der Straftatbestand der ‚Asozialität‘ ein Delikt politischer Natur sein kann, geht es doch um die strafrechtliche Sanktionierung gesellschaftlich nonkonformen Verhaltens.“ (Warnecke 2009, 340) Es können politische Motive für den Erziehungsrechtsentzug nicht ausgeschlossen werden bzw. erscheinen stellenweise sogar wahrscheinlich.[17]Die Ersetzung der Einwilligung der Eltern nach § 70 FGB „auf Klage des Organs der Jugendhilfe“ und damit die zwangsweise Freigabe zur Adoption war in der DDR möglich und wurde etwa doppelt so oft ausgesprochen, wie in der alten Bundesrepublik (9% DDR, ca. 4,6% alte BRD, vgl. Janitzki 2009, 90). DieserParagrafwurde auch angewendet, wenn Eltern ohne ihre Kinder in die Bundesrepublik geflohen sind. „Der elterliche Aufenthalt galt u.a. dann als nicht ermittelbar, wenn Eltern die DDR verlassen hatten, ohne die polizeilichen Meldevorschriften zu beachten und trotz Nachforschungen nicht ausfindig gemacht werden konnten.“ (Warnecke 2009, 123) Politische Willkür konnte sich mit fürsorgerischem Handeln vermischen bzw. dieses bestimmen.
Exemplarisch sein auf einen Fall von politscher motivierter Zwangsadoption kurz eingegangen:[18]Frau F, eine 30-jährige studierte Naturwissenschaftlerin, versuchte 1974 mit ihrem damals 3-jährigem Kind in einem umgebauten Fluchtfahrzeug die DDR Richtung BRD zu verlassen. Ihrem Sohn verabreichte sie durch Injektion vorher ein Schlafmittel, um einer Entdeckung des Fluchtversuches vorzubeugen. Als Chemikerin wusste sie über die Zusammensetzung des Schlafmittels Bescheid, dennoch wurde ihr dieser Fakt später als schuldhafte Gefährdung der Gesundheit ihres Kindes unterstellt, was sie vehement zurückwies. An der innerdeutschen Grenze wird der Fluchtversuch entdeckt und Frau F schließlich zu einer Haftstrafe von 4 ½ Jahren verurteilt. Gleichzeitig wird ein Verfahren zum Entzug des Erziehungsrechtes angeschoben. In der Begründung dazu ist zu lesen: „Der Versuch des illegalen Verbringens des Kindes an sich sei schon ausreichend, eine schuldhafte Erziehungspflichtverletzung festzustellen.“ (BStU MfS ZKG 7759, 26) Der Leiter des Referates Jugendhilfe beantragt, Frau F das Erziehungsrecht zu entziehen. „Die Klage ist auf § 51 Abs. 1 Familiengesetzbuch gestützt. Danach kann bei schwerer schuldhafter Verletzung der elterlichen Pflichten […] als äußerste Maßnahme das Erziehungsrecht entzogen werden, wenn die Entwicklung des Kindes gefährdet ist.“ (BStU MfS ZKG 7759, 28) Als zusätzliche Begründungen wurden, neben dem „ungesetzlichen Grenzübertritt“, die Verabreichung des Schlafmittels sowie das einkalkulierte Risiko, bei Misslingen des Fluchtversuches eine Gefängnisstrafe zu bekommen, angeführt. In der Urteilsbegründung heißt es dazu: „Wenngleichgemäߧ 51 FGB und Richtlinie Nr. 25 des Obersten Gerichts davon sprechen, dass oft Maßnahmen der Organe der Jugendhilfe nach § 50 FGB einer solchen Sanktion vorangegangen sind und diese zu keiner Veränderung im Verhalten des Elternteils zu ihren Erziehungs- und Betreuungspflichten geführt haben, so schließt dies doch andererseits nicht aus, ‚dass bei besonders schwerwiegenden Versäumnissen, die auch in einer einmaligen Handlung gesehen werden können, ohne vorherige Maßnahme nach § 50 FGB der Entzug ausgesprochen werden kann‘. Der von der Verklagten mehrfach versuchte schwere ungesetzliche Grenzübertritt ist somit als schwerwiegende Pflichtverletzung im obengenannten Sinne zu würdigen. Die Verklagte selbst gibt zu, dass sie mit Zwischenfällen an der Staatsgrenze und mit einer Freiheitsstrafe von ein bis zwei Jahren rechnen musste. Sie hatte auch dabei die Vorstellung, dass das Kind mit ihr gemeinsam diese Freiheitsstrafe verbüßen würde. Ihre Risikobereitschaft zur Entwicklungsgefährdung des Jungen ist also zu bejahen, und tatsächlich hat die Verhaltensweise der Mutter zu einer Gefährdungssituation für das Kind geführt. […] Die Voraussetzungen für den Entzug des elterlichen Erziehungsrechtes entsprechend § 51 Absatz 1 FGB waren somit als erfüllt zu betrachten. Mit dieser Maßnahme wird zum Ausdruck gebracht, dass die sozialistische Gesellschaft das Vertrauen zum Erziehungsberechtigten, er werde für seine eigenen Kinder verantwortungsbewusst sorgen, verloren hat.“ (BStU MfS ZKG 7759, 29.31)
Frau F wurde in Untersuchungshaft und während des Gefängnisaufenthaltes kein Kontakt zu ihrem Kind gewährt. Es wurde eine systematische Entfremdung zwischen Mutter und Kind forciert. Sie wehrte sich jedoch mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die drohende dauerhafte Trennung. In einem Schreiben an das Referat Jugendhilfe im Januar 1975 brachte sie zum Ausdruck: „Ich bin niemals damit einverstanden, dass mir auf Grund dieser einmaligen Handlungsweise für immer mein Kind genommen werden soll. Ich möchte weiterhin als Mutter meines Kindes auch das Erziehungsrecht für dieses besitzen. Ich bitte herzlich, von Ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Sie würden mir damit viel Leid ersparen.“ (zitiert in Warnecke 2009, 265) Trotz Frau F‘s monatelangen intensiven Widerstandes, auch vom Gefängnis aus, verliert sie das Erziehungsrechtein Jahr nach ihrer Verhaftung.Als sie Berufung gegen das Urteil einlegt, wird auch diese zurückgewiesen. Die Aufnahme ihres Kindes bei einer von ihr benannten Person wurde ebenfalls abgelehnt. Das Kind sollte in eine fremde Familie zur Adoption gegeben werden. „Das zuständige Referat Jugendhilfe richtete bereits im Juli 1975 – und damit noch vor Abschluss des Berufungsverfahrens über den Erziehungsrechtsentzug – an die Arbeitgeber der als potentielle Adoptiveltern ausersehenen kinderlosen Eheleute ein jeweils gleichlautendes Schreiben mitder Bitte um eine […]‚umfassende Beurteilung über die politische und moralische Grundhaltung.‘“ (Warnecke 2009, 271) Der potentielle Adoptivvater ist Zirkelleiter im Parteilehrjahr der SED, Mitglied der Kampfgruppe und auch sonst scheinen in dieser Hinsicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt zu sein. Die Adoption wird schließlich gegen den Willen der Mutter, Frau F, im Jahr 1976 vollzogen. Ein letzter Hinweis findet sich in einem Informationsschreiben des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) vom 01. Juli 1977: „Nachdem die F für eine Übersiedlung nach der BRD vorgesehen war und sich bereits in Karl-Marx-Stadt befand [Von dort aus wurden Auslieferungen und Freikäufe durchgeführt. d.V.], wurde diese am gleichen Tag aus unbekannten Gründen in die Strafvollzugseinrichtung zurückgebracht.“ (BStU MfS ZKG 7759, 49) Im Februar 1978 berichtete „DIE WELT“[19]von dieser Zwangsadoption. Erst 1988 wird Frau F nach einer zweiten Haftstrafe in die Bundesrepublik freigekauft. In dieser Zeit schreibt sie einem Journalisten: „Jetzt könnte ich leben, aber ich stehe gebrochen da.“ (zitiert in:Noll 1991) 1989kannsienach 15 Jahrenerstmals ihren Sohn wiedertreffen(vgl. Griese 1991). Ihr Leben ist durch politisch motiviertesstaatlichesHandeln im Zusammenhang mit dem Zwangsadoptionsverfahrennachhaltig negativ beeinflusst worden.
In den Akten sind mehrere vergleichbare Fälle zu finden, die ebenfalls als überwiegend politisch motiviertes Handeln der Institutionen der Jugendhilfe (oder einzelner Akteure in diesen) im Zuge von Adoptionsvermittlung hinweisen. Dennoch muss wohl jeder Einzelfall nach politischen Motivationen (sei es, dass „staatstreue“ potenzielle Adoptiveltern ein Kind bekommen sollten, oder dass durch den Kindesentzug eine als staatsfeindlich gesinnt eingestufte Mutter/Familie getroffen werden sollte) untersucht werden. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern viele Graustufen zwischen jugendfürsorgerlich angemessenem Handeln und politisch motivierten Kindeswegnahmen sind erkennbar. Ja, es gab politisch motivierte Zwangsadoptionen in der DDR und jeder einzelne Fall ist moralisch, juristisch und politisch als himmelschreiendes Unrecht einzustufen. Im weiteren Sinne, besonders in Verbindung §249 StGB der DDR („Asoziales Verhalten“)[20]sind deutlich mehr Fälle anzunehmen, als die von der Clearing-Stelle bestätigten. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies auf einen übergroßen Anteil der in der DDR abgeschlossenenAdoptionen zutrifft. „Die Fallanalyse hat ergeben, dass kein durchgängiges bzw. überwiegend praktiziertes formell- und materiellrechtliches Verfahrensmuster von Behörden und Gerichten erkennbar ist. Daraus und aus dem Nichtvorhandensein einer allgemeinverbindlichen Weisung des Ministeriums für Volksbildung ist zu schließen, dass die Durchführung von Zwangsadoptionen kein üblicherweise, über vierzig Jahre lang angewandtes Instrumentarium war, um nonkonformistisch denkende Bürger der DDR zu sanktionieren.“ (Warnecke 2009, 341) Die bekannten Fälle von Zwangsadoptionen fanden in den späten 70er Jahren statt. Möglicherweise hat die Berichterstattung in bundesdeutschen Nachrichtenmagazinen ihren Teil dazu beigetragen, dass politisch motivierte Zwangsadoptionen nicht in größeren Zahlen auftraten. Nach momentanem Erkenntnisstand ist eine Teilmenge im unteren einstelligen Prozentbereichaller DDR-Adoptionenanzunehmen. Der übergroße Anteil der vollzogenen Adoptionen in der DDR geschah jedoch unter der Prämisse, für – aus welchen Gründen auch immer – elternlos gewordene Kinder geeignete Eltern zu finden. Dabei wurde die konkrete Definition der Eignung durch die vorherrschenden kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten und bestimmt.