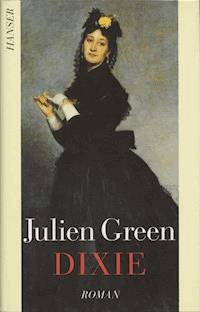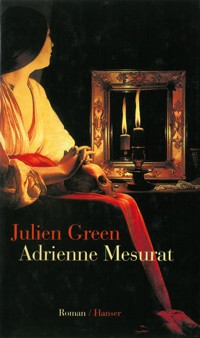
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine kleine Villa in der französischen Provinz, ein Vater und zwei erwachsene Töchter, die ältere kränklich, die jüngere achtzehn und lebenshungrig. Was äußerlich wohl geordnet scheint, wird für Adrienne Mesurat zu einer Hölle auf Erden. Vom Vater gegängelt und von der Schwester schikaniert, verliebt sie sich in den Arzt Maurecourt. Eine obsessive und fanatische Liebe, die jedoch unerwidert bleibt. Als die Schwester Germaine aus dem Haus des Vaters flieht, steht Adrienne dessen Willkür allein gegenüber. »Eines der allerbesten Bücher des Jahrhunderts« (Walter Benjamin) in der glanzvollen Neuübersetzung von Elisabeth Edl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine kleine Villa in der französischen Provinz, ein Vater und zwei erwachsene Töchter, die ältere kränklich, die jüngere achtzehn und lebenshungrig. Was äußerlich wohl geordnet scheint, wird für Adrienne Mesurat zu einer Hölle auf Erden. Vom Vater gegängelt und von der Schwester schikaniert, verliebt sie sich in den Arzt Maurecourt. Eine obsessive und fanatische Liebe, die jedoch unerwidert bleibt. Als die Schwester Germaine aus dem Haus des Vaters flieht, steht Adrienne dessen Willkür allein gegenüber. »Eines der allerbesten Bücher des Jahrhunderts« (Walter Benjamin) in der glanzvollen Neuübersetzung von Elisabeth Edl.
Julien Green
Adrienne Mesurat
Roman
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl
Mit einem Nachwort von Wolfgang Matz
Carl Hanser Verlag
Wie kommt es, daß wir in allem so beschränkt sind,
nur nicht in unserer Fähigkeit zu leiden?
Marivaux
Erster Teil
I
Aufrecht, die Hände hinter dem Rücken, stand Adrienne da und betrachtete den Friedhof.
So hieß bei den Mesurats eine Gruppe von zwölf Porträts, die im Eßzimmer über einer Anrichte hingen, so dicht beieinander, daß sie die ganze Wand bedeckten. Sie zeigten sieben Mesurats, drei Serres und zwei Lécuyers, Mitglieder von Familien, die mit den Mesurats verschwägert waren, alle tot. Mit Ausnahme eines Gemäldes, über das wir noch sprechen werden, handelte es sich um Photographien, wie man sie vor fünfundzwanzig Jahren machte, schonungslos und getreu, auf denen das Gesicht vor einem weißen Hintergrund steht, ohne daß ein nachsichtiger Schatten seine Mängel abschwächen würde, und wo allein die Wahrheit ihre unerbittliche Sprache führt.
Es war leicht, die Mesurats von den Serres und den Lécuyers zu unterscheiden. Wegen ihrer niedrigen Stirn, den markanten Zügen, etwas Entschlossenem in ihrem Gesicht pflegte man zu sagen, sie sähen aus wie Herrscher. Alle, Männer und Frauen, hatten jenen beinahe aggressiven Blick, aus dem ein gutes Gewissen spricht. »Und Ihr«, schienen sie zu sagen, »wißt Ihr, was ein ruhiges Herz ist, ein Herz, das niemals heftiger pocht, das weder Angst noch Erregung kennt, sondern seine Freude zügelt und seinen Schmerz mit Gelassenheit annimmt, weil es sich nichts vorzuwerfen hat?« Junge und Alte waren darunter. Das Mädchen, dessen Kopf ein Schleier umrahmte, mußte wohl vor seinem dreißigsten Jahr gestorben sein, als Nonne in einem tätigen Orden. Es hatte hagere Wangen und ein kantig geformtes Kinn wie jener Greis dort im Frack, und diese Frau war bestimmt seine Mutter, mit ihrem geizigen Mund und ihren wachsamen Augen, die zu zählen schienen.
Ganz im Gegensatz zu den Mesurats, die man unmöglich mit einer fremden Familie verwechseln konnte, unterschieden sich die Serres und die Lécuyers gar nicht voneinander, sie sahen sich sogar ähnlich, obwohl sie nicht dieselbe Abstammung hatten.
Unwillkürlich stellte man sich vor, sie wären fast wie Pflanzen entstanden, aufgewachsen und vergangen, in ihr Leben ebenso ergeben wie in den Tod, und nichts schimmerte in ihren Augen als jene zerstreute, unbeständige und gutmütige Seele, wie man sie hin und wieder in der Menge bemerkt. Es war eine verbreitete Ansicht, daß allein ihr Reichtum die Verbindung mit den Mesurats erklärte, und die gleichen Leute, die diese mit Herrschern verglichen, sagten auch, sie hätten sich auf die Lécuyers und Serres gestürzt wie Falken auf Lämmer.
Ob sie nun stark waren oder schwach, ob Mesurat, Serre oder Lécuyer, alle verblaßten sie doch neben der alten Antoinette Mesurat, die wie eine Königin sogar die stolzesten Mitglieder ihrer grimmigen Familie beherrschte, und ihr von sorgfältiger Hand gemaltes Porträt zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Sie mochte an die fünfzig Jahre alt sein, aber sie gehörte zu jenen Frauen, für die das Alter kaum von Bedeutung ist und die früh — so als habe die mit ihrem Werk zufriedene Natur beschlossen, nichts mehr daran zu verändern — das Gesicht bekommen, das sie ein Leben lang behalten. Die leicht ergrauten Haare waren straff nach hinten gekämmt und ließen die Rundung eines kleinen Schädels erkennen, in dem für Gedanken gewiß nicht viel Platz war, zumal die einmal hineingeratenen nur schwerlich neuen wichen, und beim Anblick der breiten, von keiner Falte durchzogenen Stirn drängte sich einem sogleich das Bild einer Mauer auf. Den schwarzen Augen fehlte der etwas einfältige Ausdruck der Serres und Lécuyers, die immer einen Punkt in weiter Ferne anzustarren schienen; es waren die weit geöffneten und kräftig gezeichneten Augen einer gesetzten Person, die genau hinsieht und das Hindernis abschätzt, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie trug eine schwarze Seidenkorsage, die sich eng einer mächtigen Brust und starken Schultern anschmiegte, und obwohl der Maler ihren schillernden Glanz mit offenkundigem Wohlgefallen wiedergegeben hatte, milderte das eitle Spiel des Künstlers keineswegs, was an diesem Körper mit seinen massigen Linien so energisch und streitbar wirkte.
Adrienne verharrte ein paar Minuten regungslos vor den Porträts, die sie nacheinander mit leicht zur Seite geneigtem Kopf musterte. Sie seufzte.
»Bist du da, Adrienne?« fragte eine Frauenstimme, die aus dem Nebenzimmer kam. »Was hast du?«
Adrienne wischte gedankenverloren mit einem Lappen, den sie in der Hand hielt, über die Marmorfläche der Anrichte.
»Nichts«, sagte sie. »Das Glas auf den Photographien ist so schmutzig. Man kann kaum erkennen, was darunter ist.«
»Du mußt es mit etwas Alkohol putzen und mit einem trokkenen Lappen polieren«, begann die Stimme nach einer Weile von neuem.
Dann war es einen Augenblick still.
»Sie werden immer gleich häßlich bleiben«, sagte Adrienne, als spräche sie mit sich selbst.
Auf einem der samtbezogenen Sessel sitzend, die aufgereiht an der Wand standen, betrachtete sie jetzt die beiden rechteckigen Flecke, die die Sonne auf den Teppich vor den Fenstern warf.
Sie ließ den Kopf hängen vor Langeweile, so wie andere Menschen vor Müdigkeit, ihre Schultern aber blieben gerade und ihr Oberkörper aufgerichtet. So wie sie dort saß, die Haare von einem Tuch umhüllt, eine blaue Schürze über dem Rock, hätte man sie zunächst für ein Dienstmädchen halten können, doch sie hatte einen gebieterischen Blick, der diesen Eindruck sogleich korrigierte. Sie war eine echte Mesurat, und trotz ihrer großen Jugend (sie war nicht älter als achtzehn) kündigte sich in ihrem Gesicht bereits jene Art von Herrschsucht an, deren Entfaltung man in den Zügen der Antoinette Mesurat, ihrer Großmutter, erkennen konnte. Zwischen den beiden Frauen bestand im übrigen eine so ungewöhnliche Ähnlichkeit, daß es beinahe zum Lachen war. Die Augen der Jüngeren waren jedoch heller, und der volle, schwellende Mund verriet eine Gesundheit, die man im weißen Gesicht der Ahnherrin vergebens gesucht hätte. Die noch rundlichen Wangen Adriennes hatten ihre kindliche Frische bewahrt und verliehen diesem Gesicht, in dem die innere Entschlossenheit doch so klar hervortrat, einen Anflug von Unschuld. Man mußte sie einige Zeit ansehen, bis man bemerkte, daß sie schön war.
Sie erhob sich und trat ans Fenster, um ihren Lappen auszuschütteln; dann stützte sie sich auf die Brüstung und warf einen Blick bis ans Ende der Straße. Bei dieser hochsommerlichen Hitze verließ kein Mensch das Haus, nur ganz selten ging jemand vorüber, im Schutz des spärlichen Schattens dicht an den Mauern. Eine Weile betrachtete sie die kümmerlichen Linden im Garten gegenüber, und fast gleichzeitig wanderten ihre Augen zur Villa Louise, einem Haus, das an der nächsten Straßenecke lag. Seine Fensterläden waren geschlossen. Es war ein Bau aus Kalksteinen, die durch schmale Klinkerstreifen unterteilt wurden, vom Stil her ziemlich pompös, mit einem kleinen Erkertürmchen und einem Dach aus bunten Ziegeln. Ihm gegenüber stand ein anderes, ganz weißes Haus mit Schieferdach, und als die junge Frau sich ein wenig vorneigte, sah sie, daß auch bei ihm die Fensterläden geschlossen waren. Schritte hallten über den Bürgersteig. Mit einer instinktiven Bewegung riß Adrienne sich das Tuch herunter, das ihr Haar verhüllte, und beugte sich hinaus; sie erkannte eine Nachbarin, die mit gesenktem Kopf, ein Einkaufsnetz am Arm, vorüberging, und schnell wich sie zurück, als fürchtete sie, gesehen zu werden, dann blieb sie, an den Fensterrahmen gelehnt, regungslos stehen, bis sich die Schritte entfernt hatten.
Abermals rief die Stimme nach ihr. Adrienne schlang sich das Tuch wieder um die Haare und verknotete die Zipfel im Nacken; dann ging sie in den Salon.
Ihr Blick wanderte durch den Raum und prüfte, ob alles in Ordnung war. Die in der Mitte des Zimmers kreisförmig angeordneten Lehnsessel und Stühle gaben diesem Teil des Hauses ein feierliches Aussehen. Zwischen den mittelmäßigen Bildern, mit denen die Wände bedeckt waren, schwärzliche Landschaften und sorgfältig durch Glas geschützte Porträts, kam eine granatfarbene und mit violetten Disteln übersäte Stofftapete zum Vorschein. Die dunklen Holzmöbel ahmten die geschwungenen Linien des Régence-Stils nach und gehorchten zugleich jenem Sinn für Bequemlichkeit, der das Second Empire kennzeichnete; die breiten Lehnen, die soliden Beine, der dicke Plüsch luden zum Ausruhen ein und weckten Vertrauen.
Ein langes Kanapee war so nahe wie möglich ans Fenster gerückt worden, so daß es unmöglich war, die Person zu erkennen, die darauf ausgestreckt lag, aber diese Person hatte die Beine angezogen, und man sah ihre kleine, magere Hand, die auf den Knien ruhte. Sie war es, die kurz zuvor mit Adrienne gesprochen hatte.
»Du solltest das Blumenwasser wechseln«, sagte sie, sobald sie die Schritte des jungen Mädchens hörte.
»Ja, später. Ist Désirée nicht da?«
»Auf den Markt gegangen.«
Adrienne ging zum Kamin, dessen hohe Bronzeleuchter sie stirnrunzelnd musterte.
»Sag mal«, begann sie nach einem Augenblick, »weißt du eigentlich, wann die neuen Mieter der Villa Louise kommen?«
»Die neuen Mieter der Villa Louise? Juni oder Anfang Juli, nehme ich an. Sie haben sich nicht schriftlich bei mir angemeldet. Auf jeden Fall werden sie gut daran tun, ihre Linden auszulichten und die Fensterläden neu zu streichen.«
Ein kurzes Schweigen trat ein, dann fuhr die Stimme fort:
»Außerdem sind es dieses Jahr keine Mieter, es ist eine Mieterin. Eine Madame Legras, und anscheinend allein.«
Adrienne wandte den Kopf zum Fenster.
»Ja«, sagte sie, »ich weiß. Papa hat es oft genug wiederholt.«
Sie nahm eine mit Geranien gefüllte Vase und ging zur Tür.
»Wo gehst du hin?« fragte die Stimme.
»Das Blumenwasser wechseln.«
Die Tür öffnete und schloß sich wieder. Eine tiefe Stille herrschte im Salon, jene Stille, die die Hitze der Sommertage genauso selbstverständlich zu begleiten scheint wie das Licht. Auf dem mit übertriebener Sorgfalt gebohnerten Parkett zog ein Sonnenstrahl einen metallenen Strich zwischen zwei Teppichen aus karmesinrotem Rips. Fliegen schwirrten geräuschlos vor dem Fenster. Man hörte Wasser in eine Vase fließen. Nach einer Minute öffnete die Tür sich wieder.
»Erinnerst du dich nicht mehr, wann sie letztes Jahr gekommen sind?« fragte Adrienne, als sie ins Zimmer trat.
»Wer? Immer noch die Mieter von gegenüber?«
»Ja, sicher.«
Die Antwort folgte erst nach einem Augenblick.
»Ende Mai.«
Adrienne hielt die Vase in ihrer Schürze, um die Tropfen aufzufangen. Sie stellte sie in die Mitte eines runden Tischchens und trat ein wenig näher an das Kanapee.
»Wie fühlst du dich heute?« fragte sie und blickte zum Fenster hinaus.
»Gut natürlich, Adrienne«, sagte die Stimme in etwas überraschtem Ton. »Wie immer.«
»Mhm!« machte Adrienne.
Ihr Gesicht nahm einen nachdenklichen und zugleich verlegenen Ausdruck an. Sie stemmte die Hände in die Hüften und warf den Kopf zurück, die Augen auf die Villa Louise gerichtet.
»Gegenüber hättest du mehr Sonne«, sagte sie kurz.
»Wir haben hier den ganzen Vormittag Sonne.«
»Drüben hättest du sie morgens und nachmittags …«
Sie schwieg einen Augenblick, dann erklärte sie mit leichter Ungeduld:
»…das Haus geht nämlich nach Westen und Süden. Deshalb hätte diese Madame Legras jetzt in der Rue du Président-Carnot Sonne, wenn sie schon hier wäre.«
Diese Worte hatte sie mit einer Mischung aus Traurigkeit und Empörung gesagt, die sie nur mit Mühe bezwang, und obwohl niemand sie sehen konnte, machte sie eine Handbewegung hin zu der Straße, von der sie sprach.
Einige Sekunden verstrichen in völliger Stille.
»Ja, das ist wahr«, sagte schließlich die Stimme. »Sie nützt es nicht aus … Würdest du mir beim Aufstehen behilflich sein, Adrienne? Wenn du das Kanapee zu dir ziehen könntest …«
Ohne zu antworten, legte Adrienne eine Hand auf die Rückenlehne des Kanapees und bewegte es ziemlich mühelos in ihre Richtung, denn sie war kräftig. Da erhob sich die Person, die vor dem Fenster lag, und machte, sich auf die Möbel stützend, ein paar Schritte durchs Zimmer. Es war eine Frau unbestimmten Alters, die durch Krankheit frühzeitig verbraucht wirkte, und schwerlich hätte man ihr fünfunddreißig Jahre gegeben. Ihr großer Körper, der so gebeugt war wie der einer Greisin, schien nicht imstande, aus eigener Kraft zu stehen, und sie ging, indem sie Adrienne die rechte Hand auf eine Art entgegenstreckte, die an eine Blinde denken ließ. Die Furcht vor einem Sturz verstärkte ihren von Natur aus zaghaften Gesichtsausdruck, und die Brauen, die sie vor Ängstlichkeit und Leiden ständig zusammenzog, hatten am Ende parallel verlaufende Falten in die Stirn gegraben. Sie hatte eine große Nase, die ihren Zügen ein trügerisches Aussehen von Kühnheit verlieh, und abgezehrte, von kleinen Furchen durchzogene Wangen.
Adrienne wich ein wenig zurück, um sie vorbeizulassen, doch sie setzte sich in einen Lehnsessel und seufzte, während sie mit halb geöffneten Lippen die Augen umherwandern ließ. Die Hände in die Hüften gestemmt, betrachtete die junge Frau sie eine Weile wortlos mit jenem Blick, der niemals milde zu werden schien.
»Bist du müde, Germaine?« fragte sie schließlich unwirsch.
Die Kranke hob den Kopf.
»Überhaupt nicht«, sagte sie. »Findest du, daß ich schlecht aussehe?«
Plötzliches Erschrecken weitete ihre Augen.
»Antworte doch«, befahl sie, als sie merkte, daß Adrienne den Mund nicht aufmachte.
Adrienne zuckte mit den Schultern.
»Ich habe nicht gesagt, daß du schlecht aussiehst«, sagte sie schnell.
»Ich habe fünf Stunden geschlafen«, fuhr Germaine fort mit der Redseligkeit einer Person, die sich verteidigen will. »Ich fühle mich gut, es geht mir wie gestern und die Tage davor.«
Doch Adrienne blickte zum Fenster hinaus und hörte ihr nicht zu.
II
Das Haus der Mesurats trug den Namen Villa des Charmes, weil in dem schmalen Gärtchen, das sich bis zur Straße hinzog, tatsächlich zwei Hainbuchen wuchsen. Monsieur Mesurat hatte es gekauft, als er in den Ruhestand getreten war und den Beschluß gefaßt hatte, von nun an auf dem Land zu leben. Es gefiel ihm so gut, als habe er eigenhändig den Bauplan gezeichnet, doch im Viertel hörte man oft, daß es einem schöneren Haus den Platz wegnehme und in einer so wichtigen Straße wie der Rue Thiers armselig wirke. Um die Wahrheit zu sagen, es war ziemlich verbaut. Sicher hatte man den Architekten gebeten, so viele Räume wie möglich darin unterzubringen, und das Ergebnis war ein schrecklicher Schönheitsfehler: Zwischen den Fenstern der Fassade gab es nicht genügend Abstand, und beinahe berührten sie einander, vier im zweiten Stock, sechs im ersten und vier im Erdgeschoß, jeweils zwei auf jeder Seite der Eingangstür. Aber konnte man sich darüber beklagen, daß das Mauerwerk nicht mehr Platz einnahm? Es war aus einem so häßlichen Material! Man hatte für den Bau jenen rauhen, mit kleinen Zacken gespickten Stein verwendet, dessen Farbe an eine bestimmte Sorte von braunem Nougat erinnert. Hat man solche Häuser nicht schon häufig in den Vororten von Paris gesehen? Mit seiner vorspringenden terrassenartigen Außentreppe und dem gläsernen Vordach in Muschelform scheint es das Ideal einer ganzen Schicht der französischen Gesellschaft gewesen zu sein, sonst hätte man das immer gleiche Modell wohl nicht mit so unermüdlichem Eifer vervielfältigt.
Wie dem auch sei, Monsieur Mesurat war nicht blind für die Unvollkommenheiten seines Hauses, und er beurteilte es mit jener Strenge, die man geliebten Menschen gegenüber zuweilen an den Tag legt. Vielleicht tat er dies, um sich nicht dafür schämen zu müssen. Wenn er mit Nachbarn über die Villa des Charmes sprach, hätte man meinen können, es handle sich um eine arme, aber ehrenwerte Verwandte. Gern hätte er es gesehen, daß man sie so bewunderte, wie er selbst sie bewunderte, und manchmal, am späten Nachmittag, wenn er seine Zeitung zu Ende gelesen und bis zur Abendessenszeit nichts mehr zu tun hatte, bedauerte er, keine Freunde zu haben, die er für einen Augenblick zu sich hereinbitten konnte, nur damit sie die Vorzüge seiner Villa würdigten, die Größe der Räume, die herrliche Aussicht auf den Garten der Villa Louise … Wer hätte von außen geglaubt, daß sie so wohlproportioniert war, so vollkommen? Würde man danach noch behaupten, ein Mesurat habe sich geirrt?
Zu Hause gutgelaunt und tyrannisch, zeigte er sich von kindlicher Schüchternheit, sobald er die Schwelle der Villa des Charmes überschritt, und der Bahnhofsvorsteher von La Tour-l’Evêque war bislang der einzige Mensch, mit dem er sich ein klein wenig angefreundet hatte, tausend winziger Umstände wegen, deren gleichgültigster gewiß nicht der Ankauf seiner Zeitung war, den er zweimal täglich in der kleinen Bahnhofsbuchhandlung tätigte. Sicher waren schon Gäste in die Villa des Charmes gekommen, doch seit einiger Zeit, und aus Gründen, die sich noch zeigen werden, hatten diese Besuche aufgehört.
Der auffällige Besitzerstolz Antoine Mesurats kam seinen Töchtern, die ihrerseits an der Villa des Charmes viel auszusetzen hatten, lächerlich vor, doch infolge einer Geistesverfassung, die ab einem gewissen Alter recht häufig auftritt, bemerkte er nichts, was ihn hätte verletzen oder in seinem Verhalten beeinflussen können.
Dieser alte Mann war die Ausgeglichenheit in Person. Untersetzt und kräftig, mit einer Brust, an die er sich gerne mit den Fäusten schlug, als wolle er Bewunderung für ihren stattlichen Umfang erheischen, hatte er das gelassene und energische Gesicht jener Menschen, die es dem Leben nicht erlauben, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen, und die in ihre gute Laune so verliebt sind wie der Geizige in seinen Schatz. Seine Augen verrieten niemals eine Regung, und man war überrascht durch die Leere dieses Blicks von so strahlendem Blau, daß er eine Art Licht über die roten Backen, über Schläfen und Stirn auszugießen schien. Ein gelblicher, an den Spitzen weißer Bart verbarg sein Kinn und fiel ihm fast bis auf die Krawatte. Wenn man ihn ansah, hatte er eine komische Art, die fleischige Nase zu rümpfen und gleichzeitig zu blinzeln, aber das war nur ein Tick, und diese Grimasse enthielt keinerlei absichtliche Ironie. Meist sprach er viel und lächelte bereitwillig.
Ganz zweifellos war er glücklich: Er führte ein sehr einfaches Leben, doch es bestand aus Gewohnheiten, die er eine nach der anderen angenommen hatte, so wie man auf einem langen Spaziergang Blumen oder seltene Steine aussucht, und er hing mit ganzem Herzen an ihnen. Die tägliche Runde durch die Stadt, das Eintreffen der Abendzeitungen, die Essenszeiten, das alles waren angenehme Augenblicke für diesen Mann, der den Eindruck erweckte, er werde diese Welt niemals verlassen müssen, soviel Freude und Energie legte er darein, seinen Platz in ihr zu behaupten.
Früher einmal Schönschreiblehrer an einer Pariser Schule, war er 1908, das heißt zu dem Zeitpunkt, an dem diese Erzählung beginnt, sechzig Jahre alt. Fünfzehn Jahre zuvor hatte er seine Frau verloren, eine Lécuyer ohne jede Ausstrahlung, von der er selten sprach und die er nicht vermißte. Später hatte er in der Lotterie eine recht ansehnliche Summe gewonnen, die es ihm erlaubte, sich ein paar Jahre eher, als er es sonst getan hätte, zur Ruhe zu setzen und in einem gewissen Wohlstand zu leben, um so mehr, als seine Ansprüche bescheiden waren. In der Villa des Charmes war alles aufs beste geordnet. Es gab drei Schlafzimmer, und der Zufall wollte es, daß sie zu dritt waren: er, Germaine und Adrienne, seine Töchter. Vortrefflich, wie er zu sagen pflegte, wonach er den Mund offenließ und sich mit der Rückseite des Daumens über den Bart strich.
An diesem Abend erschien Germaine nicht bei Tisch. Monsieur Mesurat runzelte die Stirn; ihm war alles zuwider, was vom Gewohnten abwich.
»Ißt sie nicht zu Abend?« fragte er, während er seinen Platz einnahm.
Adrienne stand noch und zog gerade eine wuchtige, kuppelförmige Hängelampe aus Milchglas so weit herab, bis sie den Blumenstrauß berührte, der den Tisch schmückte. Das schwere Ding bewegte sich mit Hilfe eines an Ketten hängenden Gewichts.
»Ißt Germaine nicht zu Abend?« fragte Monsieur Mesurat noch einmal.
Adrienne murmelte eine Antwort, die im Kettengerassel unterging. Endlich setzte sie sich und faltete ihre Serviette auseinander.
»Nun?« sagte der alte Mann ungeduldig. »Hast du nicht gehört?«
Die junge Frau blickte ihm in die Augen.
»Ich habe dir eine Antwort gegeben«, sagte sie schroff. »Germaine fühlt sich nicht wohl.«
»Sie ißt also nicht zu Abend?«
»Nein.«
Er schüttelte den Kopf, dann brockte er sich ein Stück Brot in die Suppe, ohne weitere Fragen zu stellen. Adrienne aß schweigend.
Als er seinen Teller ausgelöffelt hatte, wischte er sich über den Mund und strich seinen Bart glatt.
»Heute nachmittag habe ich meinen Rundgang durch die Stadt gemacht«, sagte er, während er die Hand nach der kleinen Weinkaraffe ausstreckte. »Es wird viel gebaut da, hinter dem Pfarrhaus.«
»Ah!«
»Ja, das Haus, dieses große, du weißt schon …«
Sie nickte.
»Sie sind schon beim dritten Stockwerk. Und vor Juli wird sicher noch Richtfest gefeiert.«
Er goß sein Glas voll, dann begann er, mit allen fünf Fingern, die er wie ein Klavierspieler spreizte, auf dem Tischtuch zu trommeln.
»Weißt du, wann die Mieter von gegenüber ankommen?« fragte Adrienne nach einer Weile.
»Hm, nein. Warum willst du das wissen?«
Er hörte mit dem Trommeln auf und sah sie an.
»Nur so.«
Monsieur Mesurat neigte den Kopf und kniff die Augen ein wenig zu.
»Die vom letzten Jahr …«
»Ach!« entfuhr es Adrienne ungewollt.
»Ich glaube, die sind im Juni gekommen. Willst du Madame Legras besuchen?«
»Ich? Nein, auf keinen Fall. Ohne sie sind wir ungestörter«, antwortete sie schnell.
Sie schob ihren Teller von sich und verschränkte die Arme auf dem Tisch.
»Bist du fertig?« fragte ihr Vater.
»Ja.«
Er läutete und begann, mit zufriedenem Gesicht zu trommeln. Während der übrigen Mahlzeit erzählte er seiner Tochter von den Veränderungen, die er in La Tour-l’Evêque beobachtet hatte, seit er hier wohnte, doch sie hörte nicht zu. Hin und wieder fuhr sie sich mit der Hand über das Haar, wie um zu prüfen, ob es ordentlich gekämmt sei, und obwohl sie ihrem Vater von Zeit zu Zeit zunickte, war ihr Blick abwesend, und man sah ihr an, daß sie Gedanken nachhing, die mit den langen Erklärungen Monsieur Mesurats nicht das geringste zu tun hatten. Das Licht der Lampe fiel auf sie und gab ihrem Gesicht eine Blässe, die es noch undurchdringlicher erscheinen ließ. Ein Schatten betonte die gerade Linie der Brauen und die etwas harte Kontur der Unterlippe, so wie ein Zeichner, der gewisse Züge verschärft, auf deren Kraft er den Blick lenken will.
Sobald das Abendessen beendet war, ließ sie ihren Vater, der es sich im Salon bequem gemacht hatte, allein und ging aus dem Haus. Sie hatte einen Schal um den Kopf geschlungen und lief die Rue Thiers entlang, vorbei an der Villa Louise, dann blieb sie an der Rue du Président-Carnot stehen, die schnurgerade vor ihr lag und zur großen Landstraße hinausführte. Einen Augenblick spitzte sie die Ohren, um dem Stimmengewirr zu lauschen, das aus einem ganz nahe gelegenen Garten kam, doch es war dunkel, und sie mußte nicht fürchten, gesehen zu werden. Sie lehnte sich an die Mauer und blickte empor. Vor ihr, nur wenige Meter entfernt, konnte sie an der Straßenecke ein stattliches quadratisches Haus sehen, dessen Dach sich in der Dunkelheit verlor, von dessen kalkverputzten Mauern jedoch eine Art Lichtschein auszugehen schien. Zwei schwarze Flecken, einer über dem anderen, ließen die Fenster mit ihren geschlossenen Läden erraten.
Ein paar Minuten verstrichen. Jemand näherte sich von der Landstraße und kam mit den langsamen Schritten eines Spaziergängers die Gasse herunter. Widerwillig verließ sie ihren Beobachtungsposten und schlenderte, mit einem Bogen um die Villa Louise, die Rue Thiers zurück bis zu einer anderen Gasse, die diese kreuzte, denn sie konnte sich nicht entschließen, nach Hause zu gehen. Hier wartete sie. Über ihr verströmten die Trauben einer Glyzinie auf der Mauerkrone jenen schweren Duft von Blüten, die ein allzu heißer Tag erschöpft hat. Einen Augenblick lang betrachtete sie die beiden erleuchteten Fenster der Villa des Charmes, im Erdgeschoß der Salon, im zweiten Stock das Zimmer ihrer Schwester; und während sie den Schritten lauschte, die gemächlich die Rue du Président-Carnot herunterkamen, versuchte sie, die Langeweile des endlosen Wartens zu überlisten, indem sie sich mit aller Kraft Antoine Mesurat in seinem Lehnsessel vorstellte, mit ausgestreckten Beinen vor sich hindösend, die Zeitung in den Händen; und dann Germaine, wie sie, von einem Berg Kissen gestützt, in ihrem Bett saß, das Gesicht von dem Fieberanfall gerötet, der sie jeden Abend packte, und die Augen auf einem Buch, das sie mit unaufmerksamem Blick in den Händen hielt.
Die Schritte wurden lauter, überquerten die Rue Thiers und gingen weiter die Rue du Président-Carnot hinunter. Ein wohliger Schauer durchrieselte Adrienne, und sie begann, auf Zehenspitzen den Weg, den sie eben erst gekommen war, in entgegengesetzter Richtung zurückzulaufen. Am Gartentor der Villa Louise blieb sie stehen und klammerte sich atemlos an einen Gitterstab. In ihren Gesichtszügen spiegelte sich etwas wie Glück. Die Erregung ließ ihre Augen leuchten, und aus den leicht geöffneten Lippen drang ein leises Keuchen, dessen Geräusch sie hinterherzuhorchen schien. Als die Schritte sich entfernt hatten, setzte sie ihren Weg fort und kehrte an die Stelle zurück, die sie kurz zuvor hatte verlassen müssen.
Wieder lehnte sie sich an die Villa Louise. Nun konnte sie den gesamten Umriß des gegenüberliegenden Hauses erkennen und sogar die Zierkanten aus dunklen Steinen, die sich in das Weiß der Mauern hineinfraßen. Hin und wieder brach ein Lichtstrahl durch die Wolken, die den Himmel überzogen, und glitt für einen kurzen Augenblick über die Schieferplatten des Daches; dann kniff die junge Frau angespannt die Augen zusammen, um das Spiel dieses flüchtigen Funkelns zu verfolgen. Plötzlich ging der Mond auf: Eine ganze Straßenseite schien emporzutauchen und sich im Glanz dieses toten Lichts in die Höhe zu recken. Das alles war so schnell geschehen, daß Adrienne überrascht aufschreckte. Sie ging bis zur Straßenmitte. Das Schieferdach glitzerte wie eine von gleißender Helligkeit beschienene Wasserfläche. Ein Baumwipfel zitterte schwarz zwischen den hohen Ziegelschornsteinen. Weit weg, irgendwo tief in einem Park, bellten zwei Hunde.
Sie lauschte, schaute, schien auf etwas zu warten. Als die Straße sich wieder verdunkelte, sog sie schließlich mehrere Male die frische Luft ein, und nachdem sie einen letzten Blick auf das Haus geworfen hatte, das in die Nacht zurückzuweichen schien, schlug sie die Augen nieder und machte sich auf den Heimweg.
Als sie durch den Salon ging, um sich ein Buch zu holen, weckte das Geräusch ihrer Schritte den Vater, der in seinem Lehnsessel schlief. Er streckte eine Faust zum Plafond hinauf und gähnte.
»Warst du draußen?« fragte er.
Sie blickte ihm gerade in die Augen.
»Nein«, sagte sie, »du hast geschlafen.«
»Das stimmt. Wie spät mag es sein?«
»Ich weiß nicht.«
Sie nahm ein Buch vom Sekretär und zog sich zurück.
Vor ihrer Türschwelle angelangt, blieb sie, entgegen ihrer Gewohnheit, kurz im Flur stehen und horchte auf die Geräusche im Haus. Unten vergewisserte sich der alte Mesurat, daß Tür und Fensterläden ordentlich geschlossen waren. Sein schwerer Schritt stampfte von einem Raum in den anderen und ließ die Dielenbretter erbeben. Er hustete. Bald schon hörte sie, wie er mit kräftigem Atem die beiden Lampen im Salon auspustete, und gleich darauf begann er, einen Opernmarsch zu summen. Sie wußte, daß er nun bald nach oben kommen würde, trat in ihr Zimmer, dessen Tür sie leise hinter sich schloß, und verharrte einen Augenblick in der Dunkelheit. Im gleichen Moment machte sich Mesurat daran, die Treppe heraufzusteigen. Seine Hand stützte sich energisch auf das Geländer, und die Holzstäbe gaben nach mit einem Knarren, das Adrienne nur allzugut kannte. Als er an der Tür seiner Tochter vorüberging, schlug er mit der Faust gegen die Füllung und rief:
»Gute Nacht!«
Sie zuckte zusammen, gab aber keine Antwort. Diese Stimme, auf deren Klang sie gewartet hatte, war ihr so unerträglich wie eine Berührung. »Ah!« entfuhr ihr ein ungeduldiger Seufzer, dann zündete sie die Lampe an. Die Schritte entfernten sich und stiegen bis zum letzten Stockwerk hinauf, wo Monsieur Mesurat sein Zimmer hatte.
III
Jetzt war im ganzen Haus nichts mehr zu hören. Von der Straße drang kein Laut mehr herauf. Adrienne mochte diese Stunde nicht. Sie hätte gern gehört, wie irgendwo eine Tür ins Schloß fiel, jemand ein Wort sagte, und sie hoffte immer, ihr Vater werde noch einmal in den Salon hinuntergehen, um seine Zeitung, seine Pfeife zu holen, die er vielleicht vergessen hatte. Als wäre es nun etwas Wünschenswertes, lauerte sie sogar auf das schauerliche Geräusch, das ihre Schwester beim Husten machte, dieses Geräusch, vor dem sie tagsüber Abscheu empfand, doch sie wußte, daß Germaine, wenn sie nachts husten mußte, den Kopf unter ihren Decken verbarg.
Langsam entkleidete sie sich, achtete auch ihrerseits darauf, keine Geräusche zu machen, so tyrannisch ist die Macht der Stille, und ging zu Bett, ohne die Lampe zu löschen, die sie am Kopfende auf einen Tisch gestellt hatte, denn sie wußte, daß sie noch stundenlang keinen Schlaf finden würde, und wollte nicht im Dunkeln liegen, ohne einschlafen zu können. Die Luft war schwül, die Lampe strahlte Wärme aus; sie schraubte den Docht ein wenig herunter. Einen Augenblick blätterte sie in dem gelb eingebundenen Buch, das sie mit heraufgenommen hatte, doch angesichts dieser vielen hundert Seiten wurde sie von Langeweile ergriffen. Sie schob das Buch unter ihr Kissen, und wie jeden Abend legte sie einen angewinkelten Arm unter ihren Kopf und verharrte reglos.
Ihr kam vor, als höre sie in der Stille ein feines, unausgesetztes Geräusch, wie das Summen eines winzigen Insekts, aber dieser Ton existierte nur in ihren Ohren. Ihr Blick wanderte umher, bemühte sich, an den Dingen, die sie so oft sah, eine neue Seite, irgendein Detail zu entdecken, das ihr bisher vielleicht entgangen war. Sie haßte ihr Zimmer, vor allem nachts, während dieser leeren Stunden, die dem Schlaf vorangingen. Diese Blümchentapete, die ihr Vater ausgesucht hatte und auf die er so stolz war, dieser Schrank aus einem großen Kaufhaus, den sie zu ihrem sechzehnten Geburtstag bekommen hatte, dieses Eisenbett, wieviele Erinnerungen das waren, wieviele unerträgliche Jahre, wieviele bange Nächte, die dieser hier glichen!
Nie dachte sie ohne einen gewissen Überdruß an ihre Kindheit und frühe Jugend, so öde dünkten sie diese Abschnitte ihres Lebens. Wann hatte sie sich glücklich gefühlt? Wo waren jene Augenblicke des Glücks, aus denen die Kindheit angeblich besteht, wo waren ihre Ferientage? Von einem Vater erzogen, der nur für seine eigene Behaglichkeit lebte, und einer Schwester, die nur an ihre Krankheit dachte, war sie schnell hart und gleichgültig geworden. Der Anblick von Germaines gerunzelter Stirn hatte sie gelehrt, nicht sehr häufig zu lachen und wenig zu sprechen, und sie wuchs heran in der ständigen Sorge, dem alten Mesurat zu mißfallen, der weder Tränen noch Schmollen duldete. In dieser Schule formte ihr Wille sich schnell, und was an Trübsinn und Hochnäsigkeit, oder kurz gesagt an Eigenschaften der Mesurats, in ihr war, gewann die Oberhand über alles andere, also die Lécuyersche Seite. Eine frühzeitige Strenge ließ ihren Mund schmal werden, zog die gerade Linie der Augenbrauen nach unten, gab dem Gesicht dieses angespannte und zugleich verschlossene Aussehen, das für ihre Familie offenbar kennzeichnend war.
Mit sechzehn Jahren erweckte sie den Eindruck, jene seelische und körperliche Physiognomie erreicht zu haben, die sie für immer behalten sollte. Ohne Freundinnen, ohne den erkennbaren Wunsch, sich mit irgendwem anzufreunden, besuchte sie die Volksschule Sainte-Cécile, in welche sie von ihrer Schwester geschickt wurde, antwortete ihren Lehrerinnen, die sie über den Unterrichtsstoff ausfragten, und kam nach Hause, um dann allein im Garten umherzuspazieren oder sich in ihrem Zimmer einzuschließen. Nichts machte Eindruck auf sie; sie fürchtete sich vor nichts, und nichts zog sie an. Nur Langeweile und eine Art unzufriedene Resignation waren in ihren Gesichtszügen zu lesen.
So vergingen die Jahre in tiefer Eintönigkeit. In der Villa des Charmes folgten die Stunden dem Rhythmus, den Germaine und Monsieur Mesurat ihnen gaben, und das Leben bestand nur noch aus einer Reihe von Gewohnheiten, von Bewegungen, die man zu einer bestimmten Tageszeit ausführte. Jede Veränderung wäre als anarchistisch empfunden worden. Zerstreuung war unmöglich, und als gehorche sie einem unausgesprochenen Befehl, verfügte auch Adrienne allmählich peinlich genau und so rigide wie in einem Kloster über ihre Zeit. Auch sie verspürte das Bedürfnis, ihre Aufgaben zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen, aber durch einen eigentümlichen Widerspruch mißfiel ihr dies zugleich, und sie glich einer Nonne, die zwar ihren Glauben verloren hat, sich für die Ordensregel jedoch eine Art mürrische Anhänglichkeit bewahrt, weil es nun einmal die Regel ist, für die sie sich einst entschieden hat.
Adrienne wurde achtzehn Jahre alt, ohne daß irgendein Ereignis, ob erfreulich oder schlimm, dem Lauf ihres Lebens eine andere Richtung gab. Wenn Besuch da war, rief ihr Vater sie oft herunter; dann behielt er sie ein paar Minuten bei sich, umfing sie mit einem glücklichen Blick, denn er war stolz auf sie und fand sie schön, und wenn er dann der Meinung war, sein Besucher wisse nun über das hübsche Aussehen seiner Tochter hinreichend Bescheid, schickte er Adrienne wieder weg, als wäre sie ein Kind. Es ist eine häufig zu beobachtende Tatsache, daß die Welt, die gesamte Menschheit, in den Augen der Alten aufhört, sich zu entwickeln und zu verändern. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens bleibt alles stehen und erstarrt, und Adrienne, die fünfzehn Jahre zählte, als Monsieur Mesurat siebenundfünfzig war, kam im Kopf ihres Vaters über dieses Alter nie hinaus.
Es mag recht verwunderlich scheinen, daß die Frage von Adriennes Heirat niemals angesprochen wurde, doch abgesehen von der Tatsache, daß Germaine sich keine Gedanken darüber machte und Monsieur Mesurat nichts davon wissen wollte, zeigte auch das junge Mädchen offenbar keinerlei Interesse. Verlief das Leben nicht auch so sehr gut? Wozu es unbedingt komplizierter machen?
Verschiedene Partien hatten sich angeboten, denn die Mesurats waren nicht unvermögend, aber diese Männer, deren ganzes Wesen den Stempel der Kleinstadt trug, Söhne von Notaren oder Kaufleuten, hatten schlechterdings unmöglich gewirkt und ihre Anträge so befremdlich wie die Anträge von Verrückten. Adrienne konnte sich gar nicht vorstellen, wie das Leben in Gesellschaft eines dieser Männer aussehen mochte, es reizte sie zum Lachen; Monsieur Mesurat verdrängte mit aller Kraft den Gedanken, seine Tochter, die er nun schon so lange um sich hatte, aus dem Haus gehen zu lassen, und lachte ebenfalls, als habe man ihm einen bodenlosen Unsinn vorgeschlagen, den man nun wirklich nicht ernst nehmen konnte. Was Germaine anging, so sagte sie nichts. Seither waren die Besuche angesichts von Monsieur Mesurats nahezu feindseliger Haltung immer seltener geworden, und irgendwann hatten sie ganz aufgehört.
Unter dem äußeren Schein einer eintönigen Existenz verbarg Adrienne jedoch eine Unruhe, die man bei ihr kaum vermutet hätte; sie war durch diese Umgebung zu einer Heimlichtuerin geworden und zeigte den Blicken ihres Vaters und ihrer Schwester ein Gesicht, in dem diese nicht die geringste Regung zu lesen vermocht hätten, vorausgesetzt, sie hätten sich diese Mühe überhaupt gemacht. Abends, in der Einsamkeit ihres Zimmers, tagsüber auf ihren Spaziergängen, wälzte sie Gedanken, die sie niemandem eingestanden hätte und die ihr selbst in gewisser Weise peinlich waren. Doch wieviel Vorsicht muß man nicht walten lassen, will man in die stolze Schüchternheit jener Seelen eindringen, die sich abkapseln und die Welt von sich weisen, und welche Worte hätte Adrienne selbst gebraucht, um von ihren Gefühlen zu sprechen? Wahrscheinlich wäre ihr der Ausdruck Gefühl eigenartig vorgekommen, und ihre Erinnerung hielt nur Bilder für sie bereit, mit denen sich weder Traurigkeit noch Freude verband, deren Kraft aber so groß war, daß sie an nichts anderes denken konnte.
Zuerst sah sie sich selbst, vierzehn Tage zuvor. Sie ging eine Straße in der näheren Umgebung der Stadt entlang, in einem Kleid aus blauem Perkal, die Arme voller Wiesenblumen. Kein Lufthauch regte sich. Am Himmel stieß eine Lerche ihren hellen Ruf aus, der die Stimme von Hitze und Sonne selbst zu sein schien. Der Schatten am Fuß der Bäume war nur noch ein schwarzer Strich. Adrienne spürte, wie ihr warme Tropfen langsam an Armen und Schläfen herabliefen. Auf einmal sah sie einen Wagen, der von der Stadt her in ihre Richtung gefahren kam. Es war eine dieser Droschken, die immer ein wenig verlottert wirken, mit quietschenden Federn und staubigen Sitzbänken. Der Kutscher trug eine Alpakajacke, und unter seinem Strohhut hatte er ein Taschentuch ausgebreitet. Ohne daß sie wußte warum, erschien ihr der Anblick dieser näherkommenden Droschke interessant, und sie blieb im Gras stehen, etwas abseits der Straße, um alles genau zu beobachten. Schon bald nahm sie die Person wahr, die im Wagen saß, und sie erkannte Doktor Maurecourt, der sich vor wenigen Monaten in La Tour-l’Evêque niedergelassen hatte. Monsieur Mesurat hatte nie daran gedacht, ihn auf ein Plauderstündchen einzuladen, obwohl sie Nachbarn waren und der alte Mann, was den Doktor betraf, von einer recht lebhaften Neugierde geplagt wurde. Doch Antoine Mesurats Schüchternheit hinderte ihn daran, den ersten Schritt zu tun, und außerdem wußte er nur zu gut, daß der Doktor keine Einladungen annahm, unter dem stets gleichen Vorwand, es eilig zu haben. Eilig? Womit denn? Die Stadt war nicht sehr groß, und folglich gab es auch nicht sehr viele Patienten, aber es stimmte schon, daß der Doktor nur Besuche abstattete, die sein Beruf erforderlich machte, und man sah ihn niemals durch den Park flanieren oder, wie es bei Spaziergängen üblich ist, an den Gartentoren für ein Gespräch unter Nachbarn stehenbleiben. Im Gegenteil, schnell und mit gesenktem Kopf ging er durch die Straße.
Der Wagen fuhr ganz nahe an Adrienne vorbei. Vielleicht war dem Doktor der durchdringende Blick, den das junge Mädchen ihm zuwarf, bewußt geworden. Auf jeden Fall schaute er auf von dem Buch, das er gerade las, und wandte den Kopf in Adriennes Richtung. Er war klein, noch jung, hatte aber eine ungesunde Gesichtsfarbe, die ihn älter machte. In diesem bleichen Antlitz fielen Adrienne die dunklen Augen auf, die mit einem Ausdruck der Neugierde an ihr hängenblieben. Er schien ganz kurz zu zögern, dann tippte er flüchtig an seinen Hut. Das ganze dauerte nur eine Sekunde, und schon war der Wagen vorüber.
Diese Erinnerung hatte in Adriennes Gemüt einen tiefen Eindruck hinterlassen, ähnlich einem Traum, den man wegen seiner Merkwürdigkeit nur schwer vergißt, und tatsächlich gemahnte sie dieser Spaziergang an eine Art Wachtraum. Als sie von der Straße ins Gras zurückgetreten war, hatte sie mit Gewißheit gespürt, daß diese Minute wichtig war und sie später noch oft daran denken würde. Aber ist das nicht bei allen Personen so, denen das Leben nichts gibt und die eine törichte und abergläubische Hoffnung in die nahe Zukunft setzen? Wie oft hatte sie nicht dieselbe Gewißheit verspürt! Wieviele Gefangene haben nicht vor freudiger Erregung gezittert beim täglichen Geräusch des sich umdrehenden Schlüssels!
Seither war durch eine Marotte, die Adrienne sofort angenommen hatte, die Straße jener ersten Begegnung mit Maurecourt zu ihrem gewohnten Spazierweg geworden, und sie versäumte es nie, einen Armvoll Margeriten und Wiesenköniginnen zu pflücken wie beim ersten Mal, denn wahrscheinlich rechnete sie durch ein zweifelhaftes Kalkül ihrer von Langeweile überreizten Seele damit, dieselben Umstände würden dieselben Folgen nach sich ziehen. Und obwohl der Doktor auf dieser Straße nicht wieder auftauchte, versteifte sie sich mit all der Energie, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, darauf, diesen Spaziergang eine Woche lang jeden Tag zu wiederholen.
Dieser Maurecourt, den man so selten zu Gesicht bekam und den gut zu kennen niemand sich schmeicheln konnte, wohnte nicht weit von der Villa des Charmes entfernt. Allerdings war eine gewisse Zeit vergangen, bis Adrienne davon erfuhr; sie war nämlich zerstreut und hörte fast nie zu, wenn der Vater ihr am Abend seine kleinen Neuigkeiten auftischte, erst von dem Tag an, als sie den Doktor im Wagen gesehen hatte, wurde sie neugieriger und hörte zu, jedoch ohne Fragen zu stellen. Da Monsieur Mesurat zu den Leuten zählte, für die eine Neuigkeit auch nach wochenlangem Gerede noch ihre lebendige Frische bewahrt, erfuhr sie nun, daß Doktor Maurecourt eben jenes Haus gemietet hatte, das der Villa Louise gegenüberlag. Zunächst wollte sie es einfach nicht glauben, so wie man sich weigert, an die Wirklichkeit von verheerenden oder sehr glücklichen Ereignissen zu glauben, und sie mußte ihren Vater ansehen, um sich davon zu überzeugen, daß er die Wahrheit sagte. Der alte Mann schnitt gerade mit der respektvollen Hingabe jener Menschen, die im Essen eine letzte Leidenschaft finden, sein Fleisch in winzige Stücke und merkte nichts von der Unruhe, die seine Tochter möglichst zu verbergen trachtete.
»Papa«, sagte sie nach einer Weile mit tonloser Stimme, »so ein Glück für Germaine!«
Germaine war mit ihrem Mittagsmahl bereits fertig und hatte sich im Salon ausgestreckt. Monsieur Mesurat runzelte die Stirn.
»Was hat Germaine denn? Sie ist nicht krank.«
»Nein«, verbesserte Adrienne sich sogleich. »Aber wenn sie krank würde …«
»Hm, ja«, brummte Monsieur Mesurat, »dann ist es für uns alle wahrscheinlich ganz praktisch, einen Doktor in der Nähe zu haben.«
»Ja.«
Sobald sie konnte, lief sie in ihr Zimmer, um sich zu verstecken, um ihre glänzenden Augen zu verstecken und ihre vor Aufregung glühenden Wangen. Sie beugte sich aus dem Fenster und erspähte das Dach des weißen Hauses und ein Stückchen von einem Fensterladen. Kannte sie dieses Haus nicht? War es ihr denn nie aufgefallen? Ihr schien, als wäre dieser kleine Bau, von dem sie nur einen Bruchteil erblickte, eben erst hier, an dieser Straßenecke, aufgetaucht, wie Paläste in arabischen Märchen, und sie sah sich lange an ihm satt. Sie beobachtete die zarte Krone eines jungen Baumes, der zwischen den Schornsteinen aus hellroten Ziegeln und den gleichmäßigen Linien der Zierkanten aus dunklen Steinen zitterte.
Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Sie verließ ihr Zimmer und blieb, an das Treppengeländer gelehnt, einen Augenblick im Flur stehen. Gesprächsfetzen drangen vom Salon zu ihr herauf, und sie erkannte die Stimme Germaines, die ihrem Vater Fragen stellte. Geräuschlos schlich sie nach oben zum Zimmer ihrer Schwester, ging hinein und trat an das offene Fenster. Und hier beugte sie sich noch einmal begierig hinaus. Die Straße erstreckte sich in ganzer Länge vor ihren Augen; nichts stand dem Blick im Wege wie im ersten Stock, und er konnte ungehindert durch den Garten der Villa Louise streifen, aber das interessierte sie gar nicht. Sie betrachtete das weiße Haus. Wie gut sie es sah, vom First bis zu der kleinen Kellerluke! Die beiden Fenster standen offen. Sie glaubte, einen roten Teppich und die Ecke eines Möbels, vielleicht eines Sekretärs, zu erkennen. Mit klopfendem Herzen drehte sie sich weg und setzte sich auf die Fensterbank. Mit einem langen, von Neid und plötzlicher Traurigkeit erfüllten Blick umfasste sie dieses Zimmer, in dem sie sich befand, das ihr aber nicht gehörte.
Von diesem Tag an träumte sie nur noch von Germaines Zimmer. Es wäre untertrieben zu sagen, daß sie den ganzen Tag daran dachte, denn laue Worte sind zu wenig, um von gewissen Seelen zu sprechen, in die die Einsamkeit ihre Spuren gegraben hat, und sie kippen übergangslos von einer leeren Existenz in eine Art innere Raserei, die sie völlig verstört. Deshalb ergriff der Wunsch, das Zimmer ihrer Schwester zu besitzen, plötzlich und vollkommen von Adrienne Besitz, und durch eine Ungereimtheit dieses Herzens, das in der Langeweile herangewachsen war und nun auf einmal wild pochte, war sie von diesem Wunsch so besessen, daß sie zuweilen aus den Augen verlor, was eigentlich ihr Verlangen nach diesem Zimmer ausgelöst hatte, und sie den ganzen Tag kein einziges Mal an Maurecourt dachte.
Nun ging sie umher, den Kopf mit verworrenen und widersprüchlichen Plänen erfüllt, von denen sie nichts verriet, denn ihre Vorsicht wuchs im gleichen Maße wie das, was zu ihrer Manie wurde, doch ein wenig Beobachtungsgabe hätte genügt, um zu verstehen, daß all ihre Worte auf ein einziges Ziel hinausliefen. Ein kompliziertes Vorhaben war in ihr gereift; Germaine brauchte das sonnigste Zimmer, nämlich jenes, das sie im Augenblick auch hatte und von dem aus man das weiße Haus so gut sah. Andererseits lag die Villa Louise günstiger als die Villa des Charmes, weil sie auf zwei Straßen ging. Warum sollte Germaine also nicht in der Villa Louise wohnen? Auf diese Weise würde ihr Zimmer frei, und Adrienne könnte es beziehen. Die Ungeheuerlichkeit dieser Lösung tritt noch deutlicher zutage, wenn man sich überlegt, daß Adrienne, genauso wie ihr Vater oder ihre Schwester, nicht die geringste Vorstellung hatte, wer die neue Mieterin sein mochte, diese Madame Legras, von der man gerade wußte, daß sie verheiratet war, aber allein kommen sollte. Würde sie einer so merkwürdige Vereinbarung überhaupt zustimmen? Dennoch fuhr Adrienne unbeirrt fort, ihrer Schwester einzuflüstern, auf der linken Seite der Rue Thiers wäre sie besser untergebracht als auf der rechten.
In Anbetracht des Widerstands von Germaine, die nichts begriff, wich diese Idee im Kopf des jungen Mädchens einer anderen. Warum sollte nicht sie selber, Adrienne, bei Madame Legras wohnen? Wenn sie ein Zimmer auf die Rue du Président-Carnot bekommen könnte, wäre dann der Blick, den sie auf das weiße Haus hätte, nicht unvergleichlich besser als der aus Germaines Zimmer? Aber so durchführbar das Vorhaben, unter einem fremden Dach zu wohnen, ihr auch erschien, solange es sich um ihre Schwester handelte, so anders kam ihr die Sache vor, wenn sie an sich selber dachte. Sie war schüchtern, und die Aussicht, mit einer Person verhandeln zu müssen, die sie nicht kannte, stimmte sie sogleich bedenklich. Sie erkannte, daß sie auf dem Holzweg war. Da stieg ein plötzlicher Haß gegen die zukünftige Mieterin der Villa in ihr auf, dieser Villa, die ihre Begehrlichkeit herausforderte und von der sie ihren Blick nicht losreißen konnte. All ihr Mißmut übertrug sich auf Madame Legras, und in einer kindischen Regung wünschte sie ihr alle möglichen Unannehmlichkeiten, etwas, was sie rächen würde, zum Beispiel schlechtes Wetter, das ihr die Ferien verderben sollte.
Als sie sich eines Morgens aus dem Fenster des Eßzimmers lehnte, sah sie einen Mann auf dem Bürgersteig der gegenüberliegenden Straßenseite. Trotz der Hitze war er von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und trug eine Art schlecht geschnittenen Gehrock. Er ging schnell. Eine Weile folgte sie ihm zerstreut mit den Augen. Er überquerte die Rue du Président-Carnot und setzte seinen Weg geradeaus fort, an der Mauer des weißen Hauses entlang. Dann sah sie, wie er vor einer Tür stehenblieb und sie aufschloß. Adrienne faßte sich mit der Hand an den Mund, um einen Schrei zu ersticken: Es war Maurecourt.
Die darauffolgende Woche war quälend. Man hätte meinen können, der Blick, den dieser Mann ihr am Straßenrand zugeworfen hatte, habe sie behext. Sie mußte ihn wiedersehen. Ihr schien, es würde genügen, daß er noch einmal an der Villa des Charmes vorüberginge, wenn sie am Fenster stand. Danach hätte sie ihre Ruhe wieder. Aber wann verließ er das Haus? Sehr früh oder sehr spät oder vielleicht zu den Essenszeiten. Wie war es möglich, daß sie ihn nicht erkannt hatte, als er vorüberging? Zwanzigmal am Tag blickte sie aus dem Fenster, sah ihn aber nicht wieder.
Ein anderes Mal stahl sie sich nach dem Abendessen fort und strich um das weiße Haus. Sie lief nicht Gefahr, gesehen zu werden, denn nach Sonnenuntergang setzt in La Tour-l’Evêque kaum jemand noch einen Fuß vor die Tür, doch was konnte sie schon erhoffen? Sie sah ein Licht im ersten Stock und spazierte durch die Straße, bis dieses Licht erlosch. Und ohne zu wissen warum, verspürte sie tiefe Zufriedenheit, als sie das Licht erlöschen sah, und sie kehrte erschöpft, aber voll Zuversicht nach Hause zurück.
Am nächsten Tag erwartete sie die Dunkelheit mit einer Ungeduld und einer Freude, die sie vor ihrem Vater und ihrer Schwester kaum zu zügeln vermochte, und bezog wieder ihren Beobachtungsposten an der Straßenecke, sobald sie unbemerkt verschwinden konnte. Vor diesem kleinen weißen Haus und seinem erleuchteten Fenster fühlte sie sich glücklich. »Er ist da«, dachte sie, »ich weiß es.« Und auf unerklärliche Weise war diese Gewißheit für sie wie ein Pfand, das ihr jemand überlassen, wie ein Versprechen, das Maurecourt selbst ihr gegeben hätte.
Nun hatte sie eine neue Gewohnheit angenommen, als Ersatz für die bisherige, den Spaziergang übers Land in der Hoffnung, einen Wagen auf der Straße auftauchen zu sehen. Von morgens bis abends dachte Adrienne einzig an den Augenblick, in dem sie sich wieder an die Villa Louise schmiegen würde, und sie beobachtete unentwegt den Himmel in der Furcht, eine Wolke könnte das Wetter verderben und ihr damit diese Stunde rauben, die von einem Tag auf den anderen zu ihrem Lebensinhalt geworden war.
IV
Im Sommer ging Adrienne jede Woche zweimal in den Garten, um unter den wachsamen Blicken ihres Vaters, der sie von der Außentreppe her beobachtete, und ihrer auf dem Kanapee ruhenden Schwester Blumen zu pflücken. Sie spazierte an den mit Ziegeln eingefaßten Beeten entlang, blieb hin und wieder stehen, zupfte an jenen feinen Gräsern, aus denen ein Milchtropfen quillt, wenn man sie knickt, und drohte den sonnenverbrannten Blumen mit ihrer quietschenden Schere. Wenn dieser Kontrollgang beendet war, schnitt sie fünf oder sechs Stengel von den roten Geranien ab, den einzigen Pflanzen, die gewillt schienen, in diesem kargen Boden zu wachsen, und kehrte in die Villa zurück, um sie in Vasen zu stellen. Während der übrigen Zeit beschränkte ihre Aufgabe sich darauf, durchs Haus zu laufen, nachdem das Dienstmädchen Besen und Staubwedel geschwungen hatte, und zu prüfen, ob alles in Ordnung war. Früher hatte sie diese kleinen Pflichten recht gerne erledigt, denn sie verkürzten die zähen Stunden der Langeweile zwischen den Mahlzeiten, doch nun kamen sie ihr stumpfsinnig vor. Sie hätte es vorgezogen, nichts zu tun und sich ihren Träumereien hinzugeben, mit dem Vergnügen, träge all den Gedanken nachhängen zu können, die ihr durch den Sinn gehen mochten. Manchmal setzte sie sich in einen großen Lehnsessel im Salon, und den Kopf zum Fenster gewandt, die Hände über den Knien ineinandergeschlungen, verharrte sie eine Stunde, als wäre sie ganz in etwas vertieft, das sie am Himmel sah. Sie genoß dieses Nichtstun und glitt, wobei die Hitze das ihre tat, in einen Zustand der Benommenheit, während sich in ihrem Kopf alles in wohlige Verworrenheit auflöste.
Dennoch war dies keine natürliche Veranlagung ihres Charakters. Ganz im Gegenteil, sie war lebhaft, aber diese Art Spiel, das darin bestand, ihr Denken nicht mehr zu steuern, sondern es frei um eine Erinnerung oder irgendein Vorhaben ranken und kreisen zu lassen, schien ihr nützlich, denn es hielt sie davon ab, in Traurigkeit zu verfallen, und erlaubte ihr, das Ende des Tages abzuwarten, ohne übermäßig zu leiden.
Das kleinste Geräusch auf der Straße ließ sie wieder zu sich kommen und lockte sie sogleich ans Fenster. Instinktiv wandte sie die Augen nach links, zu dem weißen Haus, dessen Fensterläden schon um acht Uhr morgens zugezogen wurden und sich erst abends um sechs wieder öffneten, wenn die Luft ein wenig abkühlte. Diesen Augenblick kannte Adrienne gut; sie lauerte auf sein Herannahen mit einer Unruhe, von der sie nicht hätte sagen können, ob sie ihr Freude oder Schmerz bereitete. Sie wagte noch nicht, durch die Rue du Président-Carnot zu spazieren, aus Angst, gesehen zu werden oder vielleicht die Person zu sehen, die sie so unbändig zu sehen wünschte, doch ab halb sechs konnte sie nicht mehr stillsitzen, und um Viertel vor sechs stieg sie leise in das Zimmer im zweiten Stock hinauf, das Germaine vor Einbruch der Nacht nicht aufsuchte, und nahm ihren Beobachtungsposten am Fenster ein. Sie setzte sich auf die Fensterbank, in die Öffnung, und um besser sehen zu können, klammerte sie sich mit einer Hand am Vorhang fest, stemmte sich mit der anderen gegen die Dachrinne und beugte den Körper zum Garten hinaus.
So wartete sie lange Minuten, lehnte sich nur kurz zurück, wenn sie müde war oder wenn sie fürchtete, Germaine, die um den Rasen herumspazierte, könnte den Kopf heben und sie erblicken. In der Stille dieser ausklingenden Nachmittage drang auch der feinste Laut an ihr Ohr. Sie hörte ihren Vater, der in einem knarrenden Korbstuhl auf der Außentreppe saß, immer wieder die großen, dicken Blätter des Temps auseinander- und zusammenfalten, und auf der Allee das Knirschen der Kieselsteine unter den regelmäßigen Schritten ihrer Schwester. Diese Geräusche gingen ihr auf die Nerven; sie erinnerten sie an die Langeweile ihres alltäglichen Lebens und schienen boshafte Stimmen zu sein, die ihr sagten, daß sie diesem Zauberkreis, den Germaine und Monsieur Mesurat um sie herum zogen, niemals entkommen werde. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten, doch sie wartete auf ein anderes, schwächeres, weil weiter entferntes Geräusch, das vom Ende der Straße zu ihr heraufklingen würde. Wenn sie manchmal das Schauen und Lauschen nicht mehr aushielt, packte sie ein jähes Verlangen zu schreien. Ein Unwohlsein überfiel sie in den letzten Sekunden dieses Wartens. Ihr schien, der Himmel werde ganz schwarz und das Schieferdach des Hauses hebe sich weiß ab von diesem plötzlich verfinsterten Hintergrund. Sie fragte sich, ob sie hierbleiben konnte, ob sie sich nicht genau in dem Augenblick, den sie so sehr herbeigesehnt hatte, auf einen Stuhl setzen müßte, aber immer, wenn sie sich gerade am allerschwächsten fühlte, schlug die Wanduhr im Eßzimmer sechs. Einige Sekunden verstrichen. Endlich hörte sie das Knarren der Läden, die aufgestoßen wurden und einer nach dem anderen gegen die Mauer klappten. Dann sah sie, wie sich eine ältere Frau, wahrscheinlich eine Hausangestellte, für einen Moment auf eine der Fensterbrüstungen im zweiten Stock des weißen Hauses stützte und die Straße hinauf- und hinunterblickte. Sobald diese Frau verschwand, nahm Adrienne, die den Kopf zurückgezogen hatte, um nicht gesehen zu werden, ihren Platz wieder ein, die Hand gegen die Dachrinne gestemmt. Und in diesem Augenblick konnte sie den karmesinroten Teppich und die glänzende Oberfläche eines mit Papieren überhäuften Möbels erkennen. Das Blut schoß ihr ins Gesicht und rauschte in ihren Ohren. Das ganze Gewicht ihres Körpers lastete auf ihrem Handgelenk. Sie hatte das merkwürdige Gefühl, sich im nächsten Augenblick in die Leere zu stürzen, hinüber zu diesem Raum, der ihr auf einmal so nahe schien. Endlich richtete sie sich wieder auf, mit schmerzendem Handgelenk, trat ins Zimmer zurück und ließ sich taumelnd in einen Lehnsessel fallen.
Eines Tages, als sie gerade die Tür schloß und die Treppe wieder hinuntergehen wollte, begegnete sie ihrer Schwester, die heraufkam. Germaine betrachtete sie mißtrauisch und neugierig.
»Was hast du da oben gemacht?« fragte sie.
Adrienne wurde knallrot.
»Nichts«, sagte sie.
Und dann fragte sie töricht:
»Und du, warum kommst du herauf?«
»Ich?« sagte Germaine mit der sanftmütigen Stimme einer Person, die schon im vorhinein über ihre Antwort zufrieden ist, »ich gehe in mein Zimmer, um mich auszuruhen.«