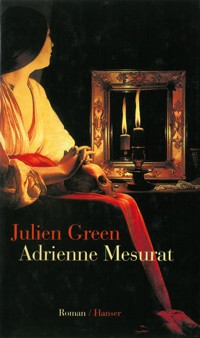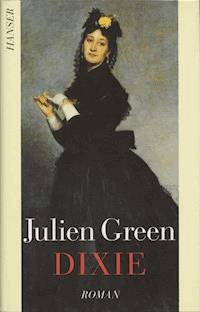Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der amerikanische Süden am Vorabend des Sezessionskrieges. 1861 bricht der Krieg aus. Im Mittelpunkt: Elizabeth, die schöne Engländerin, verwitwet und Mutter eines kleinen Jungen. Sie heiratet wieder, den stürmischen Billy, einen schneidigen Offizier, dessen mangelnde Sensibilität ihre alte romantische Sehnsucht jedoch bald wiederaufleben läßt. Wie viele ihrer Schicksalsgenossinnen kann sie das Leben nur ertragen, indem sie Zuflucht zu Schlaf- und Beruhigungsmitteln nimmt. Und auch die erlesenen Zerstreuungen dieser noblen Gesellschaft wirken wie eine Droge: die Droge des Vergessens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1330
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Gesellschaft kurz vor dem Untergang: der amerikanische Süden am Vorabend des Sezessionskrieges. Anhänger der Union und Sezessionisten bekämpfen einander erbittert, Buchanan zieht ins Weiße Haus ein, wird aber schon bald von Lincoln abgelöst, 1861 bricht der Krieg aus, der mit der vernichtenden Niederlage des Süden enden wird. Einstweilen aber willl die Aristokratie des Südens von der politischen Bedrohung noch nichts wissen: sie genießt ihre Privilegien, feiert rauschende Feste und spinnt ihre gesellschaftlichen Intrigen wie eh und je.
Im Mittelpunkt: Elizabeth. die schöne Engländerin, verwitwet und Mutter eines kleinen Jungen. Sie heiratet wieder - den stürmischen Billy, einen schneidigen Offizier, dessen mangelnde Sensibilität ihre alte romantische Sehnsucht jedoch bald wieder aufleben läßt. Wie viele ihrer Schicksalsgenossinnen kann sie das Leben nur ertragen, indem sie Zuflucht zu Schlaf- und Dämpfungsmitteln nimmt. Und auch die erlesenen Zerstreuungen dieser noblen Gesellschaft wirken wie eine Droge: die Droge des Vergessens.
Wir brauchen die Vorgeschichte nicht zu kennen, um uns von Julien Green unter Die Sterne des Südens entführen zu lassen, in eine längst versunkene Welt, die doch so viele Parallelen mit der unseren aufweist. In seinem jüngsten Werk vereinigt der fast neunzigjährige Erzähler noch einmal dramatische und poetische Elemente, romantische Sehnsucht und psychologisch genaue Wahrnehmung, historische Beschreibung und autobiographische Rückerinnerung zu einem epischen Gesellschaftspanorama, das wie ein Film an uns vorüberzieht.
Hanser E-Book
Julien Green
Die Sterne des Südens
Roman
Aus dem Französischen von Helmut Kossodo
Carl Hanser Verlag
Allen Soldaten des Südens
und des Nordens gewidmet,
die in einem brudermordenden
Krieg gefallen sind.
Inhalt
Der kleine Verschwörer
Die Liebe muß neu erfunden werden
Verwirrungen
Laura oder Das verlorene Paradies
Eine zitternde Freude
Es wird keinen Krieg geben
Der rote Flügel
Dixie
Die wichtigsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten zur Zeit der Sterne des Südens
Abbildungen und Karten
I
Der kleine Verschwörer
1
Der kleine Junge hockte auf allen Vieren zu Füßen seiner Mutter und tat, als pflückte er die Rosen vom Perserteppich. Wie er ganz leise einem unsichtbaren Gefährten erklärte, stellte er einen Strauß für die Person zusammen, die er am meisten auf der Welt liebte. Seine winzigen Finger, die mehr lebendigen Blumen glichen als die Blüten des farbigen Wollgartens, zeigten auf eine Rose, dann auf eine andere, dann hielten sie inne, um die schönsten auszuwählen.
Elizabeth bewachte ihn aus dem Augenwinkel, aber seit einem Augenblick richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes, auf die Tür des Salons. Eine Frau stand in zögernder Haltung auf der Schwelle des grün-goldenen Zimmers.
»Was ist«, sagte Elizabeth, »wollen Sie noch lange dort stehen und uns ansehen, ohne ein Wort zu sagen? Worauf warten Sie, Miss Llewelyn? Treten Sie doch ein und setzen Sie sich.«
Die Waliserin in ihrem grauen Kleid trug einen kleinen schwarzen Strohhut mit flacher Krempe, der ihr das trügerische Aussehen bürgerlicher Ehrbarkeit verlieh.
Sie trat ein und setzte sich auf den Rand eines Sessels.
»Ich verstehe«, sagte sie, »daß mein Besuch eine Überraschung für Sie ist … doch wohl keine freudige Überraschung, wie ich vermute.«
Einen Moment lang schien sie auf einen Protest zu hoffen, der jedoch nicht kam.
In den Augen Elizabeths tauchte sie wie eine Erscheinung aus der Vergangenheit auf, der eine Kugel ins Herz ein Ende gesetzt hatte … Die Besucherin schien sich dessen nicht bewußt zu sein.
»Nach mehr als vier langen Jahren des Schweigens …«, seufzte sie.
Ihre meergrünen Augen hefteten sich auf Elizabeths Gesicht, aber diese hielt ihrem Blick ungerührt stand. Die Waliserin fuhr fort:
»Ich habe Worte in meinem Herzen, die mir nicht über die Lippen kommen wollen.«
»Entschuldigen Sie«, sagte die junge Frau, »aber wenn es Ihnen so schwer fällt, sie auszusprechen, wäre es da nicht besser, sie dort zu lassen, wo sie sind, bis zu einem anderen Mal?«
Plötzlich erhob sie sich. Da sie den Blick Miss Llewelyns nicht länger ertrug, ging sie zum Fenster, als wollte sie nach den Spaziergängern sehen. Sie beneidete die Leute, die so frei unter den Bäumen schlendern konnten.
Beunruhigt richtete sich der kleine Junge vor ihr auf und zupfte sie am Rocksaum.
»Mamma«, sagte er.
»Laß mich, mein Liebes«, murmelte Elizabeth. »Ich spreche gerade mit dieser Dame.«
»Ich hab dich lieb«, sagte er.
Sie streichelte den Kopf des Kindes, wandte sich dann Miss Llewelyn zu und versuchte zu lächeln.
»Ich habe das nicht gesagt, um Sie zu verletzen«, sagte sie hastig. »Erzählen Sie mir lieber, was es Neues in Dimwood gibt, ich bin in all den Jahren nicht mehr dort gewesen. Mr. Charles Jones erwähnt es mir gegenüber fast nie. Offenbar will er es nicht.«
Der natürliche Ton, den sie absichtlich in ihre Worte legte, gab ihr die Ruhe zurück und ließ ihr die Gegenwart dieser in unerträgliche Erinnerungen gehüllten Frau weniger bedrohlich erscheinen.
Miss Llewelyn seufzte:
»Mr. Hargrove ist zu niemandem mehr wie früher, aber Dimwood hat sich nicht verändert. In Dimwood regt sich nichts. Miss Minnie hat geheiratet und lebt jetzt in New Orleans. Sie erinnern sich vielleicht, daß sie mit einem Herrn aus Louisiana verlobt war, bevor … vor dem Ereignis …«
»Ich weiß«, sagte Elizabeth ungeduldig, »das genügt.«
Sie nahm wieder in ihrem Sessel Platz.
»Schrecklich, schrecklich«, murmelte Miss Llewelyn.
Elizabeth drückte ihren kleinen Sohn an sich. Sie war ganz bleich geworden.
»Und Susanna?« fragte sie.
»Miss Susanna hat erklärt, daß sie nicht heiraten wird. Als man sie fragte, warum, sagte sie, sie habe ihre Gründe. Ich kenne diese Gründe.«
»Wirklich? Und Mildred? Und Hilda?«
»Beide sind mit jungen Offizieren verlobt, aber es schleppt sich hin und schleppt sich hin. Den anderen geht es gut, aber sie langweilen sich. Ja, Sie wären dort willkommen. Man vermißt Sie, man redet von Ihnen. Die Gärten duften stärker denn je. Blumen in Hülle und Fülle bis zum Waldrand.«
Eine Sekunde lang sah Elizabeth sich wieder bei den Magnolien am Fuß der Freitreppe, und sie schloß die Augen. Plötzlich schreckte sie auf, als hätte sie ein Schlag getroffen.
»Aber da ist noch jemand, von dem Sie nicht sprechen«, sagte sie.
»In der Tat, Mr. William Hargrove. Wußten Sie nicht, daß er krank ist?«
»Mr. Jones hat es mir erzählt, aber nur recht ungenau.«
Fast sah es so aus, als leuchtete ein triumphierender Glanz aus allen Falten des Gesichts, das sich ihr aufmerksam zuwandte.
»Vor drei Tagen hat der Arzt Mr. Hargrove gleich nach dem Erwachen eröffnet, daß er nur noch einen Monat zu leben habe.«
»Ach! Und wie hat er es aufgenommen?«
»Es hätte nicht schlimmer sein können. Er brüllte, beklagte sich, daß man ihn nicht richtig gepflegt habe, beschuldigte seinen Arzt der Gewissenlosigkeit und beschloß, sein Testament zu ändern. Mr. Charles Jones hat versucht, ihn zu beruhigen. Nichts zu machen.«
»Ich verstehe, daß es Sie erschüttert hat, Miss Llewelyn.«
»Wenn Sie da gewesen wären, wenn Sie eine Ahnung hätten, was ich gesehen und gehört habe …«
Auf einmal stand sie auf, schien zu wachsen, als ob eine innere Kraft ihr die Ausmaße einer Riesin gegeben hätte, und das Zimmer mit seinen zarten Vergoldungen verdunkelte sich. Das Blut ihrer Rasse sprach plötzlich aus dieser Frau, brach wie eine heftige Eingebung ihres Heimatlandes aus ihr hervor. Sie redete wie eine Seherin, ihr Blick war in die Ferne gerichtet, weit über die junge Engländerin hinaus, die ihr unwillkürlich zuhörte, als sei sie von dem Zauber einer Halluzination gebannt.
Das Kind starrte sie mit strahlenden Augen an, und sein von schwarzen, rötlich schimmernden Locken umrahmtes Gesicht war wie verzückt. Seine ganze Aufmerksamkeit schien in der kleinen Nase konzentriert, die es der Waliserin entgegenstreckte, die wie ein Denkmal vor ihm aufragte.
»Das Dimwood, das Sie gekannt haben, hat sich nicht verändert, denn in Dimwood regt sich nichts, außer in den Köpfen der Bewohner, und welch ein Tumult herrscht da! Erinnern Sie sich an den großen Speisesaal, wo sich alle zu den Mahlzeiten einfanden? Nun stellen Sie sich dort die lange Tafel ohne Tischtuch vor. Ganz am Ende hockt ein abgezehrter Greis auf einem Stuhl, dessen Rückenlehne seinen kahlen Schädel hoch überragt, denn die gräßliche Krankheit, die an ihm zehrt, hat ihm seine letzten weißen Haarsträhnen geraubt, und seine Gestalt ist zu der eines kleinen Jungen zusammengeschrumpft. Jetzt haben Sie Ihre Rache an diesem Mann, der Sie mit seiner Begierde gequält hat. William Hargrove, der gestern noch Herr des Hauses mit den weißen Säulen war, muß heute zusehen, wie es seinen spindeldürren Händen entgleitet.«
Elizabeth schrie auf: »Onkel Charlie hatte mir nicht gesagt, daß es so schlimm um Mr. Hargrove steht. Ich bedaure ihn von ganzem Herzen – trotz allem.«
»Er fürchtet den Tod und will nichts aus den Händen geben«, fuhr die Erzählerin in unnachgiebigem Tonfall fort. »Und all die Leute um ihn herum! Er hat nur noch eine ganz dünne Stimme, aber in die legt er seine ganze Wut, und er diskutiert schnaubend mit den Männern in schwarzen Anzügen, den Anwälten, Notaren und Bankiers. Rechts und links von ihm seine beiden ältesten Söhne. Die Enkelinnen und Schwiegertöchter scharen sich entsetzt am anderen Ende des Saals zusammen. Der Schrecken, den William Hargrove ihnen einflößte, war nur ein instinktives Zurückweichen vor dem Tod, dessen Gegenwart sie fühlten, denn diese Gegenwart herrschte überall, in jedem Winkel des Hauses, und wartete auf seine Stunde. Sie haben Charles Jones erwähnt. Er ist da, in seinem grauen Gehrock steht er direkt neben dem Kranken, und vor ihnen auf dem Tisch liegt zwischen Mengen von Papieren ein offenes Buch, ein in rotes Leinen gebundenes Heft. Und dieses Buch, Mrs. Jones, war ich selbst.«
Mit beiden Händen, zu Klauen gekrümmt, griff sie sich an die Brust, als wollte sie sie zerreißen. Gleich einer Wahnsinnigen flößte sie Elizabeth eine solche Angst ein, daß diese ihren kleinen Sohn an sich preßte.
»Beruhigen Sie sich, Miss Llewelyn«, rief sie ihr zu. »Sie können mir das alles später erzählen.«
Die Waliserin hörte sie nicht einmal:
»Mein Rechnungsbuch!« brüllte sie mit erneuter Wut. »Mehr als eine halbe Stunde wurde es geprüft, Seite für Seite, Zeile für Zeile, wurde auseinandergerupft, und ich stand dabei, schwitzend vor Wut und Empörung, auf die Folter gespannt …«
Elizabeth sprang auf, um die Tür des Salons zu schließen, ließ ihren kleinen Jungen für einen Augenblick allein, und er blieb reglos sitzen, fasziniert von dieser energiegeladenen Person, die er mit offenem Munde ansah, in einer Mischung aus Staunen und Neugier, jedoch ohne Furcht. Seine Mutter kam sogleich zurück und nahm ihn in die Arme.
»Auch sie machten die Tür zu«, spöttelte Miss Llewelyn, »aber das hinderte all die Schwarzen des Hauses nicht daran, am Schlüsselloch zu lauschen, um sich keine Silbe entgehen zu lassen, und ich war froh, sie dort zu wissen. Plötzlich schnitt der Oberbuchhalter dem alten Hargrove das Wort ab, als dieser beharrlich behauptete, das Rechnungsbuch sei nichts wert, beweise nichts, sage nichts über die Erpressungen aus: ›Im Namen meiner Kollegen erkläre ich, daß ich noch nie ein so peinlich genau geführtes Rechnungsbuch gesehen habe. Es ist vorbildlich in seiner Korrektheit.‹ Da brüllte Hargrove, so gut er konnte, denn seine Stimme trug nicht mehr. Man hörte nur ein Krächzen: ›Jahrelang hat mich diese Frau erpreßt …‹ Bei diesen Worten riß Mr. Charles Jones das Rechnungsbuch an sich und hielt es mit der einen Hand in die Höhe, während er mit der anderen auf die Seiten mit den Zahlenreihen klopfte. Oh! ich hätte diesem Mann um den Hals fallen mögen! Und er schrie ihn an: ›Wo sind die Erpressungen in diesem Buch, William? Sie haben es zwanzig Jahre lang jeden Abend begutachtet und nichts Regelwidriges entdeckt. Auf jeder Seite steht unten rechts Ihre Unterschrift zum Zeichen des Einverständnisses.‹ Die Stimme hallte in der stickigen Luft. Er war großartig mit seinen rosigen Wangen und dem wirr über die Stirn hängenden Haar. ›… Sie waren schon immer argwöhnisch, William Hargrove, aber das Gesetz verbietet Ihnen, die ergebenste Gouvernante, die es gibt, ohne Beweise zu beschuldigen.‹ Mr. Hargrove griff sich an den Kopf und begann zu stöhnen: ›Sie wissen es nicht, Sie wissen nichts. Diese Elende hätte mich beinahe ruiniert. Beweise, Beweise …‹, wiederholte er. ›Welche Beweise?‹ – ›Sie phantasieren ja, William Hargrove‹, rief ich ihm zu. Und da hat dieser einst so geachtete Herr wie ein Kind geweint. Er tat mir wirklich leid. ›Gott wird es Ihnen verzeihen‹, sagte ich sanftmütig. Mit einiger Mühe hob er den Kopf und blickte mich an. ›Gehen Sie‹, murmelte er. Dann trat ein großes Schweigen ein. Welch ein Augenblick für mich … Ich ging zur Tür. Aus Dimwood verjagt, aber dennoch fühlte ich im Vorübergehen die Wertschätzung fast aller, spürte sie wie den köstlichen Duft unserer Kamelien. Oh, wie süß ist es zu wissen, daß man allgemeines Ansehen genießt!«
Sie sprach diese Sätze mit einer fast religiösen Feierlichkeit, doch dann wechselte sie plötzlich den Ton:
»Als ich an der Tür war und sie mit einem kräftigen Ruck aufstieß, scheuchte ich etwa fünfzehn Schwarze auf, die eiligst in alle Richtungen davonstoben.«
Sie schwieg und setzte sich wieder.
»Was für ein schönes Kind Sie haben«, sagte sie nach einer Weile.
»Er heißt Charles Edward«, beeilte sich Elizabeth zu erwidern, um Bemerkungen, die sie vorausahnte, nicht aufkommen zu lassen. »Er sieht seinem Vater verblüffend ähnlich. Sie scheinen müde zu sein, Miss Llewelyn. Ihre Erzählung hat einen bedrückenden Eindruck auf mich gemacht.«
»Mamma!« rief der kleine Junge mit der enttäuschten Miene eines Zuschauers, der eine spannende Vorstellung zu früh zu Ende gehen sieht.
»Psst!« machte Elizabeth, die wieder in ihrem Sessel saß.
Mit der Behendigkeit eines Tieres sprang er auf ihren Schoß und versuchte, sie zu umarmen.
»Hast du mich lieb?« fragte er. »Sagt die Dame nichts mehr?«
»Sei still, Darling. Bleib bei mir und sei artig.«
Er schmiegte sich an sie, wandte Miss Llewelyn den Kopf zu und schenkte ihr ein Lächeln, das sie mit leicht geschürzter Lippe erwiderte.
Dann versank sie in ein von Seufzern unterbrochenes Schweigen, schien jedoch nicht bereit, sich von Elizabeth zu verabschieden, die vergeblich nach Worten suchte, um sie auf eine höfliche und menschliche Art zum Fortgehen zu bewegen.
Nach einigen Minuten, die ihr endlos schienen, fragte sie ein wenig linkisch:
»Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, aber warum erzählen Sie mir das alles?«
Für die Waliserin waren diese Worte wie ein Peitschenknall, der die Fortsetzung des Rennens ankündigte. Ohne ein Zeichen der Ermüdung hob sie den Kopf und fuhr ohne Übergang fort:
»Ich ging auf mein Zimmer, packte meine Koffer und suchte dann Azor auf – Sie erinnern sich doch an Azor, den Kutscher? Mit einigen Silbermünzen ließ er sich überreden, mich im Tilbury zum Kloster von Schwester Laura zu fahren. Sie empfing mich sofort und widmete mir eine ganze Stunde. Sie ermahnte mich zur Geduld und erteilte mir höchst praktische Ratschläge, um mir aus meiner peinlichen Lage zu helfen … Auf ihr Drängen hin faßte ich den Entschluß, bei Ihnen zu klingeln.«
»Und nun?« fragte Elizabeth beunruhigt.
»Die Worte, die ich vorhin in meinem Herzen zurückhielt …«
Die junge Frau konnte sich nicht mehr beherrschen:
»Miss Llewelyn, ich bitte Sie, kommen wir zur Sache.«
»Oh! Sie haben nichts zu befürchten, Mrs. Jones.«
Sie wird mich um Geld bitten, dachte die junge Frau.
Miss Llewelyn las den Gedanken auf Elizabeths Gesicht.
»Oh! keine Bange, Mrs. Jones. Die Vorsehung hat mich großzügig versorgt, und ich habe meine Ersparnisse, aber da ich nicht mehr die Gouvernante von Dimwood bin, habe ich die Freiheit, Ihnen meine Dienste anzubieten …«
Elizabeth wäre vor Schrecken fast in ihren Sitz zurückgefallen, und mit tonloser Stimme antwortete sie:
»Ich habe bereits eine Gouvernante, Miss Llewelyn.«
Die Worte fielen in ein bedrückendes Schweigen, dann kniff die Waliserin die Augen zusammen, und die Entgegnung kam leise, als verriete sie ein Geheimnis:
»Eine Gouvernante wie Maisie Llewelyn gibt es nicht noch einmal, Mrs. Jones.«
»Dessen bin ich sicher, glauben Sie mir, und ich bedaure es …«
»Ich auch«, sagte Miss Llewelyn und erhob sich, »ich bedaure es sehr, für Sie und für mich. Ich denke, wir werden uns wiedersehen.«
Ein breites Lächeln verzerrte ihr faltiges Gesicht, ohne es aufzuhellen, und sie ging zur Tür, die sie aus Gewohnheit mit einem Ruck öffnete, da ihr jede verschlossene Tür verdächtig erschien, aber es war niemand da.
Elizabeth begleitete sie nicht hinaus. Sie wartete, bis die Haustür sich öffnete und schloß. Dann legte sie den Arm um ihren kleinen Jungen und drückte ihn mit aller Kraft an sich.
»Ist die Dame nicht zufrieden?« fragte er.
»Doch! Ganz bestimmt. Sie ist immer so. Du darfst niemandem sagen, daß du sie gesehen hast. Versprochen?«
»Versprochen.«
Sie bedeckte ihn mit Küssen und flüsterte ihm ins Ohr:
»Mein Jonathan.«
»Sonathan, Sonathan!« wiederholte er lachend.
Elizabeth legte ihm den Finger auf den Mund.
2
Von einer Ecke des Fensters aus blickte sie nach allen Seiten, aber die Waliserin war bereits seit einer Weile verschwunden, und warum auch sollte sie ihr mit den Augen folgen? Sie nahm ihre guten oder bösen Absichten mit und ebenso ihr ärgerliches Geheimnis.
»Diese Frau haßt mich«, dachte sie.
Dann klingelte sie und stand da und wartete. Das Kind klammerte sich an ihren Rock, und sie streichelte ihm den Kopf.
Ein schwarzgekleideter Diener erschien, ein großer Bursche mit einem blaßgelben Mestizengesicht.
»Sam, sage Betty, ich möchte mit ihr sprechen.«
Als sie wieder allein mit ihrem Sohn war, nahm sie ihn bei den Schultern. In seinem weißen Leinenanzug mit dem offenen Kragen sah er ein bißchen wie ein Schiffsjunge aus, aber die kurzen Hosen und die gestreiften Strümpfe ließen den kleinen Städter erkennen. Sie schaute ihn an, küßte ihn, sah ihn noch einmal aufmerksam an. Glich er seinem Vater wirklich so sehr, wie man es in ihrer Umgebung behauptete? Vielleicht waren es die vollen Wangen und die auseinanderliegenden kastanienbraunen Augen. Doch was sie wirklich suchte, war das Abbild eines anderen Gesichts, an das sie immer wieder denken mußte, doch das war wohl nur die Eingebung einer krankhaften Phantasie. Wußte sie das nicht selbst? Welch seltsamem Spiel gab sie sich hin, wenn sie sich auf eine Komplizenschaft mit unentrinnbaren Erinnerungen einließ?
Fast flüsternd sagte sie zu ihm:
»Du bist mein Jonathan, hörst du? Aber das bleibt unter uns, und du darfst nie laut Jonathan sagen.«
Lachend warf er sich in ihre Arme:
»Ja, Mamma.«
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und Betty, die ein grün und rot gemustertes Kopftuch aufhatte, eilte ihnen entgegen.
»Ich wa’ mit Miss Celina inne Wäschekamma’«, entschuldigte sie sich.
»Schon gut, meine kleine Betty. Du wirst jetzt mit Charles Edward spazierengehen, jetzt ist es nicht mehr so heiß. Setz ihm seinen großen Strohhut auf und gib acht, daß du ihn nicht von der Hand läßt.«
»Nein, Miss Lisbeth, Massa Cha’leddy is’ doch mein Schatz.«
Sie stürzte sich auf den Schatz, der sich wehrte und ihr mit den Fingern liebkosend über die schwarze Maske fuhr, der die Zeit so unerbittlich zugesetzt hatte, als wollte sie ihr alle Menschenähnlichkeit nehmen. Nur die riesigen dunklen Pupillen waren verschont, sie schwammen in einer unergründlichen Zärtlichkeit.
Charles Edward hüpfte vor Freude, daß er gleich ausgehen sollte, und gab Betty die Hand. Als Elizabeth sie aus dem Salon gehen sah, konnte sie nicht umhin zu lächeln. Betty in ihrem roten Mieder brauchte sich nicht sehr tief zu bücken, um den jungen Herren bei der Hand zu halten, der ihrer Obhut anvertraut war.
Schon drang ein schwächeres Licht durch die Jalousien des Salons, warf große blaßgoldene Flecken auf die Wände und verwandelte das Zimmer, das sich plötzlich an einem Ort fern von Amerika zu befinden schien. Es war die Stunde, die die junge Frau fürchtete, weil sie sich dann von einer unwiderstehlichen Melancholie ergriffen fühlte und die Verbindung mit dem wirklichen Leben verlor. Der Zauber dieses Augenblicks machte ihr Angst, aber sie erwartete ihn wie eine Befreiung. Danach mußte sie sich anstrengen, ihre Träumereien abzuschütteln und den Faden der bedeutungslosen Ereignisse, aus denen sich ihr Leben zusammensetzte, wieder aufzunehmen.
Als sie den Salon verließ, begegnete sie Sam, der ihr mit einer Verbeugung eine Visitenkarte auf einem Silbertablett überreichte. Sie las: MAJOR ALEXANDER BROOKFIELD und runzelte die Stirn.
»Für diesen Herrn bin ich grundsätzlich nicht zu Hause.«
»Yes, M’am.«
Der junge Mestize schaute sie an. Sie warf ihm einen Blick zu, der ihn zwang, den seinen zu senken. Er verneigte sich und verschwand.
Eine Wendeltreppe führte zur ersten Etage. Auf einer der ersten Stufen blieb sie stehen, die Hand auf das polierte Holz des Geländers gestützt. Der Name, den sie soeben gelesen hatte, war durchaus nicht der, den sie auf dieser Karte mit der etwas zu großen Schrift zu finden gehofft hatte.
Mit raschen Schritten begab sie sich auf ihr Zimmer. Dieser im Halbdunkel liegende Raum mit seinen halbgeschlossenen Fensterläden bot der jungen Frau eine Art Zuflucht vor der Außenwelt, und sie streckte sich dort für eine Weile auf dem Kanapee aus Mahagoni aus. Ein großer geneigter Spiegel reflektierte das Bild der Möbel, die zu gleiten begannen, als befänden sie sich an Bord eines Schiffes bei hohem Seegang. Ganz gegen ihren Willen kam ihr immer wieder der Name Alexander Brookfield in den Sinn. Sie nannte ihn in der Tat ihre Plage Nummer eins. Er war ein schöner Mann von vierzig Jahren und Artilleriekommandant, der den ersten Rang unter ihren Bewunderern einnahm. Da er überall empfangen wurde, ließ er der jungen und allzu hübschen Witwe keine Chance, ihm zu entkommen. Dank seiner tückischen Strategie gelang es ihm früher oder später immer, sie in einer Ecke des Salons abzufangen, um sie mit seinen Komplimenten zu belästigen, von denen er ein beträchtliches Repertoire besaß. Und er bot sie ihr dar, wie man einer Person von bescheidener Intelligenz, auf die man ein Auge geworfen hat, Süßigkeiten anbieten würde. Dann ertönte seine besondere Stimme, die er den Frauen vorbehielt, mit ihren Modulationen, die sie, das Opfer, in eine solche Wut versetzten, daß sie plötzlich die Flucht ergriff. Das brachte ihr bei einem der nächsten Abendempfänge sanfte Vorwürfe ein, und so stellte sich allmählich eine Art kriegerischer Familiarität zwischen ihnen ein, aber er war in seiner Kühnheit noch nie so weit gegangen, sie in ihrem Hause aufzusuchen.
Ganz plötzlich mußte sie jedoch an jemand anderen denken.
Der Gedanke an Ned, der mit Betty spazierenging, riß sie plötzlich aus ihren Träumereien, und sie lief zum Fenster, stieß die Läden auf, blickte nach rechts und nach links, suchte die Allee nach ihm ab, die er nicht verlassen sollte, und da sie ihn nicht sah, wurde sie von panischer Angst erfaßt.
Sie klingelte. Sogleich ging die Tür auf, und eine junge weiße Frau erschien. Sie war groß und schlank und trug ein dunkelblaues Kleid mit langen Ärmeln, das ihr eine gewisse Eleganz verlieh. Ein gestärkter Kragen fügte dem Ganzen eine strenge Note hinzu, die zu dem ernsthaften und fein geschnittenen Gesicht paßte. Der ruhige Blick ihrer grauen Augen verriet eine natürliche Heiterkeit, die sofort vertrauenerweckend wirkte.
»Madame?« sagte sie.
»Miss Celina, ich mache mir Sorgen um Charles Edward.«
»Ich nicht, Madame. Er ist gerade nach Haus gekommen.«
»Aber er ist doch erst vor einer Viertelstunde ausgegangen.«
»Nein, Madame, Sie sind schon seit fast einer Stunde hier. Es wird bereits dunkel. Übrigens«, fügte sie hinzu, »höre ich ihn gerade mit Betty heraufkommen. Sie hätten sich nicht zu ängstigen brauchen.«
»Ich kann mir nicht helfen. Wenn er fort ist, bin ich so unruhig, daß ich nicht mehr zu leben glaube; ich wollte …«
Freudige Schreie unterbrachen diesen Satz. Charles Edward rannte auf sie zu und versuchte, ihr völlig außer Atem von seinem Spaziergang zu berichten, der zu einem Abenteuer voller Überraschungen geworden war. Er hatte seinen Hut noch auf dem Kopf, und die schwarzen Bänder flatterten bei jeder Geste des kleinen Erzählers.
Betty begleitete seine Erzählung mit lautem Lachen und gab ihren Kommentar dazu:
»Alle Damen wollten ihn küssen, aba’ Massa Cha’leddy wollte nich’ und hat sich gewehrt.«
In einer heftigen Aufwallung riß Elizabeth ihn in ihre Arme und drückte ihn fast zum Ersticken. Der kleine Hut rollte zu Boden. Miss Celina hob ihn lachend auf, und für einige Augenblicke war das Glück in diese vier Wände eingedrungen, in denen gewöhnlich das Schweigen herrschte. Immer wieder fuhr Elizabeth mit den Fingern durch die schwarzen Locken ihres Sohnes und flüsterte ihm Liebesworte ins Ohr, die fast ebenso wirr waren wie die des kleinen Jungen.
Betty unterbrach das geheimnisvolle Gespräch mit fester Stimme:
»Massa Cha’leddy, Betty will dich jetz’ baden.«
»Er ist ja wirklich patschnaß«, bemerkte Miss Celina. »Also nach dem Bad gibt’s eine Tasse Suppe und dann ins Bett. Nicht wahr, M’am?«
Elizabeth ließ ihn nur ungern los.
»Ich decke ihn dann selbst zu«, sagte sie. »Miss Celina, Sie werden mir beim Ankleiden helfen.«
Mit einem Ausdruck leidenschaftlicher Zärtlichkeit blickte sie dem Kind nach, das Betty an der Hand mit sich zog.
Als sie mit Miss Celina allein war, schaute sie sie ernsthaft an.
»Was meinen Sie, Miss Celina? Darf man sein Kind so anbeten wie ich es tue?«
»Was soll ich Ihnen darauf antworten, M’am? Da müßte ich schon selbst ein Kind haben, aber meine Mutter liebte mich auch so, bis zum Wahnsinn. Sie nannte mich ihre zitternde Freude. Das ist ein Ausdruck aus unserer Heimat.«
»Zitternde Freude«, sagte die junge Frau nachdenklich. »Habe ich je etwas anderes gekannt?«
»Welches Kleid möchten Sie heute abend anziehen, M’am?« fragte Miss Celina in einem gleichgültigen Ton.
»Mein lila Taftkleid.«
»Wenn M’am mir eine Bemerkung gestatten, ist es nicht ein wenig trist? Dauert die Trauer nicht ein bißchen lange?«
»Dann das veilchenblaue oder was Sie wollen. Heute abend ist mir das alles egal. Ich werde mich in allen Farben des Regenbogens gleich gut langweilen. Das Diner ist bei den Steers.«
Das Haus der Steers zählte zu den ältesten der Stadt und konnte sich auch rühmen, eines der einfachsten zu sein. Die hohen und schmalen Fenster verliehen ihm eine gewisse Strenge, die durch die Eleganz des Portals mit den feinen ionischen Säulen gemildert wurde.
Als Elizabeth eintraf, las sie sofort in allen Blicken, daß die Kleiderwahl ihrer Gouvernante richtig gewesen war. Ganz in Weiß und ohne ein einziges Schmuckstück sah die junge Engländerin blendend aus. Die Frische ihres Teints hatte dem Klima des Landes standgehalten und noch den Glanz der ersten Jahre in Dimwood bewahrt. Ein aufmerksamerer Betrachter hätte jedoch in ihren Augen eine Spur von Unruhe entdeckt, durch die sie zu einer anderen geworden war, nicht mehr das kleine Fräulein, das vor sechs Jahren die Freitreppe zum Herrenhaus hinaufgestiegen war. Jetzt verlieh ihr schon ihr Haar, das sich in kunstvoller Nachlässigkeit um ihr Gesicht wellte, einen Ausdruck von Überlegenheit. Nicht ohne ein etwas gereizt wirkendes Lächeln zu zeigen, erkannten die anwesenden Schönheiten an ihr den Charme ihres Heimatlandes wieder – »einen etwas bäuerischen Charme« –, wie sie hinter ihren Fächern flüsternd hinzufügten. Die Männer hatten keinerlei derartige Vorbehalte. Sie erweckte eher ihr Begehren, als daß sie jene Gefühle erregt hätte, die man für Herzenswallungen hält.
Sich als Gegenstand solcher Gelüste zu empfinden, schien ihr nicht mit der Vorstellung vereinbar, die sie von sich selbst hatte. Deshalb pflegte sie vor diesen Herren, von denen sie im Vorübergehen bedrängt wurde, eine höflich gleichgültige Haltung einzunehmen. Sie hatte den Eindruck, daß manch einer mit seinen lüsternen Blicken ihr Gesicht und das, was er von ihren Brüsten erraten konnte, besudelte. Vor allem die Älteren. Die in ihre Uniform geschnürten jungen Offiziere zeigten sich weniger zynisch und beschränkten sich darauf, ihr schmachtend und verstohlen in die Augen zu schauen, die stumm blieben wie Saphire.
Die Tyrannei der Gepflogenheiten verlangte, daß sie die Einladungen gewisser Familien annahm, und die Steers gehörten zu den ersten in der Rangordnung. In ihren Salons bewunderte man die Bilder berühmter Maler in goldenen Rahmen, in denen die barocke Kunst sich in ihren kühnsten Verschnörkelungen zeigte. Riesige Kronleuchter mit Kristallgehängen verbreiteten ein großzügig mildes Licht, das dem Teint schmeichelte und dem Edelsteingefunkel am Hals und an den Händen der Damen einen noch geheimnisvolleren Glanz verlieh. Mit aller Raffinesse und Hinterlist ihres Geschlechts umringten diese ihre gefährliche Rivalin und durchbrachen den Schutzwall aus Bewunderern, die vor der überlegenen Macht der Anmut zurückwichen. Eine Weile wurde Elizabeth mit Komplimenten und Fragen von durchtriebener Indiskretion bestürmt. Man sähe sie fast nie, und es wäre eine solche Freude, sie begrüßen zu können und wieder einmal ihren köstlichen englischen Akzent mit den so reinen Modulationen zu hören, nicht wahr … Sie antwortete mit der ihr verbliebenen – und übrigens reizenden – Unbeholfenheit, die sie seit ihrer Ankunft in Georgia nie ganz hatte ablegen können. Und war es nicht gerade das, was zuerst Jonathan und dann Ned so bezaubert hatte? Jetzt, da sie die Gefangene dieser mit Juwelen behängten Frauen war, deren Seidenkleider und Taftroben durch eine herausfordernde Eleganz bestachen, fühlte sie sich nackt und wütend. Plötzlich wurde ihr die Gesellschaft unausstehlich. Durch die großen Türen mit den dunklen Goldrahmen sah sie Gäste in Gruppen ankommen, und ihre innere Verwirrung erreichte den Höhepunkt, als Alexander Brookfield in Uniform erschien. Nicht ohne militärische Forschheit bahnte er sich den Weg zu ihr, womit er sich entrüstete Blicke zuzog. Trotzdem näherte er sich ihr, und sie sah deutlich seinen vor Unverfrorenheit leuchtenden Blick, der seine Beute ins Visier nahm.
Von Panik ergriffen, wich sie zurück und drängte sich unter Entschuldigungen gegen die Damen, die um sie herumstanden. Diese traten ein wenig schockiert beiseite und schafften ihr Raum, den sie ohne zu zögern durchquerte. Nicht ohne Grund floh sie in diese Richtung.
Sie hatte nämlich gerade die schöne Mrs. Harrison Edwards erblickt, die zwar auch dicht umringt war, sich jedoch wie eine Gebieterin im Kreise ihrer respektvollen Bewunderer bewegte, die sie mit ihrem Fächer auf Distanz hielt. Immer wieder erhob sie das stolze Haupt, als wolle sie ihre Macht über die Gesellschaft betonen, doch ebenso großmütig teilte sie jenes Lächeln aus, dessen undefinierbarer Charme berühmt war, weil es alles auszudrücken schien, was man darin sehen wollte, das Ja oder das Nein, das Vielleicht oder das Nie, und sie spielte damit wie ein Virtuose auf seinem Instrument. Von weitem bemerkte die junge Engländerin, dank der in solchen Fällen üblichen Scharfsicht des weiblichen Blicks, ass ihr einst zur Fülle neigendes Gesicht ein wenig schmäler geworden war.
Obgleich Elizabeth sich zu dieser Frau, deren majestätisches Gehabe sie störte, nicht sehr hingezogen fühlte, war ihr klar, ass in diesem schwierigen Augenblick nur sie allein ihr helfen konnte, und sie ging leichten Schrittes auf sie zu.
Als Mrs. Harrison Edwards sie erblickte, stieß sie einen künstlichen Schrei aus, einen sehr gesitteten Schrei, denn sie asse seit einer Viertelstunde, ass Elizabeth anwesend war, was ihr nur ein mäßiges Vergnügen bereitete.
»Elizabeth! Welch freudige Überraschung! Daß Sie hier sind! … Und schöner denn je.«
Mit einer eleganten Kehrtwendung ließ sie ihre enttäuschten Bewunderer zurück, eilte auf Elizabeth zu und küßte sie:
»Meine Liebste«, sagte sie, »wir sehen uns fast gar nicht mehr seit … seit dieser schrecklichen Sache.«
»Ich weiß, aber ich habe an den mondänen Abendempfängen wie diesem hier nie Geschmack gefunden.«
»Wie diesem hier! Aber in Savannah gibt es so etwas ständig. Wie sollten wir auch anders leben? Wir würden umkommen! Zu Hause zu bleiben ist doch ein Martyrium. Da ist es noch am besten, die Zeit in guter Gesellschaft totzuschlagen. Aber wer ist denn dieser forsche Kerl, der da anscheinend geradewegs auf Sie zusteuert?«
»Oh! Lucile, ein Graus! Dieser entsetzliche Offizier verfolgt mich mit seinen glühenden Liebeserklärungen. Tun Sie doch bitte etwas, um ihn von mir fernzuhalten.«
»Die Komplimente eines schönen Offiziers habe ich noch nie verschmäht, aber dieser da ist von einer entmutigenden Häßlichkeit.«
Als er sich mit siegesgewisser Miene näherte, wandte sie ihm plötzlich ein so gebieterisches Gesicht zu, daß er betreten stehenblieb. Noch nie war Elizabeth diese Frau, die ihr aus der Patsche half, verführerischer vorgekommen. Ihr üppiges Haar glänzte in dunklen Wellen um die kleine gewölbte Stirn und hob das samtene Weiß ihres Teints hervor. Die großen Augen von unergründlicher Tiefe schienen alle Geheimnisse der Nacht einzuschließen, und so stellte sie sich dar, wenn es ihr gefiel, einen Gegner zurückzuweisen. Dann war sie unwiderstehlich anziehend und fast ebenso abweisend.
In seiner Verblüffung blieb der Kommandant einen Augenblick stumm. Offenbar schwankte seine Bewunderung zwischen der jungen Engländerin und der herrlichen Kreatur, deren brennender Blick ihn bannte. Sie ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Kommandant«, sagte sie mit fester Stimme, »wir sind einander nicht vorgestellt worden, und ich bin im Gespräch mit Madame.«
Er verneigte sich.
»Oh! ich hätte mir nie erlaubt … ich wollte nur …«
»Warum gehen Sie nicht einstweilen zum Buffet? Es ist bereits von bezaubernden Damen belagert.«
Während sie diese Worte aussprach, schenkte sie ihm ein Lächeln, das sie insgeheim ihr Tigerinnenlächeln nannte; er gab sich geschlagen und trat den Rückzug an.
»Sehen Sie, Elizabeth«, sagte sie, als sie sich entfernt hatten, »so muß man die Männer dressieren.«
»Aber das habe ich nie versucht«, rief die junge Frau aus, »und habe es nicht einmal gewollt.«
»Ich fürchte, Sie überschätzen die Männer. Ich gebe gern zu, daß sie zuweilen willkommen sind, aber es ist eine große Genugtuung zu wissen, daß sie einem zu Füßen liegen.«
»Ehrlich gesagt, ich habe die Liebe nicht so gesehen, als ich noch meinen …«
»Liebe Elizabeth, trauern Sie niemandem nach, der nicht zurückkommen wird. Ich habe mein Witwentum mit heiterer Gelassenheit hingenommen. Genießen Sie die Gegenwart, Elizabeth. Das Leben, schauen Sie sich das Leben an …«
Sie wies mit einer Geste auf den Salon voller schwatzhafter Gäste. Das rauschende Murmeln der Gespräche wurde ohrenbetäubend.
»Hören Sie«, sagte sie geradezu verzückt, »welch eine Musik für die Ohren! Das ist das Leben, das köstliche Leben in einer Welt …«
Elizabeth nickte und versuchte, ihr zuzulächeln.
»Wissen Sie«, sagte sie mit lauter Stimme, um sich Gehör zu verschaffen, »ich glaube, ich werde jetzt gehen, aber ich danke Ihnen für vorhin.«
»Ich bin immer da, um Ihnen zu helfen, denn ich muß sagen, und Sie werden es mir hoffentlich nicht übelnehmen, daß Ihre Erziehung als junge Witwe noch viel zu wünschen übrigläßt, meine Liebste.«
Ein langes, einschmeichelndes Lächeln milderte die Schärfe dieser Bemerkung, aber Elizabeth fühlte sich dennoch verletzt.
In ihren Augen stieg ein plötzlicher Glanz auf, und Mrs. Harrison Edwards, die Tränen zu sehen glaubte, schloß sie in ihre Arme:
»Vergessen Sie, was ich eben gesagt habe«, flüsterte sie, »das war nicht recht von mir, und es tut mir leid.«
Sie streifte mit ihren Lippen Elizabeths Wange und drückte ihr beide Hände:
»Wir sind Freundinnen, nicht wahr?«
Einem Schatten gleich, glitt ein Lächeln über ihre Züge, ein Lächeln, das man in keine Kategorie einordnen konnte, das aber aus tiefstem Herzen kam.
3
Im Wagen, der sie nach Hause fuhr, gab Elizabeth sich ganz ihrer Enttäuschung hin … Jemand, den sie zu sehen gewünscht hatte, war nicht erschienen, oder sie hatte ihn inmitten dieser Menge nicht entdecken können, aber es schien ihr fast undenkbar, daß sie in ihrem weißen Kleid seine Aufmerksamkeit nicht auf sich gelenkt hätte. Vielleicht war er auch nicht gekommen, oder seine Schüchternheit, die er nur schwer ablegen konnte, hatte ihn daran gehindert, sich ihr zu nähern. Schließlich hatten sie noch nicht mehr als zehn Worte gewechselt, aber er hätte es wissen müssen, der linkische junge Mann, er hätte es erraten müssen. Sie seufzte vor Ungeduld, wenn nicht vor Wut, und warf sich in eine Ecke ihres Wagens.
Dieser Gesellschaftsempfang hatte einen Eindruck von Blendung und Langeweile bei ihr hinterlassen. Man erstickte in den hohen Sphären … Mrs. Harrison Edwards und ihre recht zynischen Ansichten verwirrten sie, trotz der freundschaftlichen Bekundungen am Schluß. Unter den Männern, von denen die große Dame mit einer solchen Geringschätzung sprach, war kein Gesicht, das zum Träumen anregte, denn das zählte noch für sie, ungeachtet der schmerzlichen Erinnerung.
Ihr Haus erwartete sie in einer Stille, die sie allmählich beruhigte. Dazu trug vor allem die vertraute Behaglichkeit des blaßblauen Salons bei, in dem sie angenehme Stunden mit Freundinnen zu verbringen pflegte, wenn diese sie besuchten und ihr die letzten Klatschgeschichten aus der Stadt erzählten. An diesem Abend erhellte eine Lampe auf einem niedrigen Tisch das gemütliche kleine Zimmer mit einer gewissen Zärtlichkeit. Sie kauerte sich in einen großen Sessel wie ein Vogel, der gerade einem Gewitter entronnen war, und überlegte, daß sie sich an diesem Abend äußerst dumm benommen hatte … Auszugehen, um sich zu zeigen, nur einige Augenblicke mit einer einzigen Person zu reden und dann die Flucht zu ergreifen, was sollte das bedeuten? Die Herrin des Hauses hatte sie nur von weitem gesehen, und sie hätte sie leicht aufsuchen können, aber auch sie war ständig von Gästen in Anspruch genommen und hatte ihr den Rücken zugekehrt. Warum sollte sie sich nicht ehrlich eingestehen, daß sie nur wegen eines jungen Mannes gekommen war, den sie kaum kannte? Ein Rotschopf. Nein, dunkelrot, korrigierte sie sich, als müßte sie sich entschuldigen, rötlich mit Bronzeschimmer. Und schüchtern dazu … Gewöhnlich sind die Rothaarigen doch …
Das Erscheinen der ruhigen Miss Celina riß sie aus ihren unruhigen Gedanken.
»Schon zurück?« fragte sie lächelnd.
»Ja, ich habe mich gelangweilt. Die Leute von Welt gehen mir auf die Nerven, Miss Celina.«
Miss Celina machte ein ernstes Gesicht.
»Der Kleine wollte einfach nicht einschlafen. Er sagte, sie hätten vergessen, ihm eine Geschichte zu erzählen, bevor das Licht gelöscht wurde. Ich hatte alle Mühe, ihn zu trösten, und er hat ein bißchen geweint.«
Elizabeth sprang mit einem Satz auf.
»Es ist wahr, Miss Celina, ich habe es zum erstenmal vergessen.«
»Jonathan vergessen«, dachte sie verärgert und beschämt, »ich habe vergessen, daß ich ihm jeden Abend ganz leise eine Geschichte erzähle, in der eine Person namens Jonathan vorkommt.« Dieser Augenblick zählte in ihrem täglichen Leben fast ebenso viel wie in dem ihres Sohnes. Das Ritual erlaubte keine Abweichung.
Das Ausziehen, Waschen und zu Bett bringen überließ Elizabeth stets Liza, der schwarzen Amme des Jungen, einer kräftigen und noch jungen Person. Sie war schwergewichtig und ziemlich rundlich, aber dennoch anziehend, und bewegte sich mit einem Wiegen in den Hüften; die großen und schönen Augen in ihrem kaffeebraunen Gesicht rollten im Rhythmus ihres Ganges bald nach rechts, bald nach links. Trotzdem genoß sie den Ruf einer unerschütterlichen Ehrbarkeit. Charlie Jones selbst hatte sie seiner Schwiegertochter empfohlen. Wie so viele Frauen ihrer Rasse strahlte sie Liebe aus und konzentrierte ihre Leidenschaft auf das kleine Wesen, welches sie so sehr als ihren Besitz betrachtete, daß sie es my baby nannte. Diese Liebe wurde erwidert. Das Kind war von der überschäumenden Zärtlichkeit seiner Mutter so sehr geprägt, daß es keinesfalls erschrak, wenn die riesige schwarze Masse sich mit dem wohligen Brummen einer verliebten Menschenfresserin über sein Gesicht beugte.
Elizabeth war bei diesen etwas monströsen Liebesbezeugungen nicht zugegen, aber wenn sie dann zu ihm kam, war es eine ganz andere Zuwendung.
Man mußte sie mit dem Liebling allein lassen, wenn sie ihn auch manchmal warten ließ. Dann lag er brav und geduldig in seinem Himmelbett und erzählte sich laut Geschichten, in denen seine Mutter immer wieder vorkam. Im schummerigen Licht der Nachtlampe erschien ihm das Zimmer größer, von großen Schattenräumen durchflutet, die seine Phantasie mit allerlei seltsamen, grimassierenden Gestalten bevölkerte, denen er jeder einen Namen gab; aber noch lieber schaute er zur Tür: bald würde sie aufgehen, und die wunderbare Person käme herein, um deren Kopf es vor lauter Gold so sanft schimmerte. Sie würde ihn lange mit Küssen liebkosen und ihn ihren Jonathan nennen. Darauf müßte er antworten: »Ja, Sonathan«, und dann würde sie ihn in ihre Arme schließen. Ihre Küsse verirrten sich überall hin auf seinem Gesicht, nicht auf die Lippen, aber oft in den Nacken, hinter das Ohr, was ihn kitzelte und zum Lachen brachte. War diese Fröhlichkeit verklungen, kam der Augenblick, den er mit einer fast schon überreizten Ungeduld erwartete, da sie ihm eine Geschichte erzählte, die er sich immer neu wünschte, unheimlich, voller Riesen und Räuber, voller Verfolgungen und Fluchten … Es folgte ein kurzes Schweigen, und mit einer Stimme, die anders war als gewohnt, ließ die Mutter den Sohn ein höchst vereinfachtes Gebet aufsagen, in welchem er den dear Lord bat, ihn zu einem good boy zu machen und seine Mom zu segnen.
An diesem Abend jedoch, dem Abend des Empfangs bei den Steers, hatte sie so lange auf sich warten lassen, daß ihm die Lider schwer wurden. Müde von seinem Spaziergang mit Betty glitt er unmerklich in den Schlaf.
4
Ein wenig später trat Miss Celina lautlos ein. Sie ging zu dem Bett und schaute das Kind lange und aufmerksam an, als versuchte sie, ein Geheimnis zu entdecken. Er schlief mit einer Hand auf der Brust, und seine üppigen Locken waren um seinen Kopf gebreitet wie ein schwarzer Fleck auf dem weißen Kissen.
Nachdem die Gouvernante das Nachtlicht ein wenig heruntergeschraubt hatte, bis das Zimmer im Halbdunkel lag, entfernte sie sich ebenso diskret, wie sie gekommen war.
Im Salon, den sie aufsuchte, um die Rückkehr ihrer Herrin zu erwarten, ließ sie sich in einen geräumigen Sessel voller Kissen sinken und hob eine Zeitung auf, die vor ihr auf dem Teppich lag. Eine wunderschöne französische Pendeluhr, die den hohen schmalen Kamin schmückte, läutete elf Uhr. Die schrille und geschäftige Glocke erinnerte an eine ungeduldige kleine Person.
Miss Celina las auf der ersten Seite: »Neue Unruhen zwischen Weißen und Schwarzen in Kansas.« Sie gähnte. Jeden Tag die gleichen Nachrichten aus Kansas. Warum griff die Regierung nicht ein? Reden, immer nur Reden … Sie verschränkte die Finger über ihrem Bauch und schlummerte ein, voller Würde bis in den Schlaf.
Ein Schrei schreckte sie auf. In weniger als einer Minute war sie im ersten Stock in Charles Edwards Zimmer.
Der Kleine war mitten in der Nacht aufgewacht.
Die Nachtlampe verbreitete ein zu schwaches Licht, um die Finsternis zu durchdringen, und der Schrecken bemächtigte sich seiner ganzen Person. Für ihn bedeutete das Erwachen den Tag oder das Licht einer Lampe. Noch nie im Laufe seines kurzen Lebens hatte er die Augen in völliger Dunkelheit geöffnet. Das Entsetzen war gleichzeitig überall. Mit all seinen Kräften rief er nach seiner Mutter, und als sie ihm nicht sofort zu Hilfe kam, schrie er aufs neue … Endlich ging die Tür auf, als er aber Miss Celina sah, wuchsen seine Ängste nur noch mehr. Es war nicht sie, die er sehen wollte. In seiner Not begann er zu schluchzen und nach seiner Mutter zu rufen. Die Heftigkeit seines Kummers beunruhigte schließlich die Gouvernante. Es war viel mehr noch als ein Ausbruch der Betrübnis, dieser kindliche Kummer gemahnte an den Schmerz eines Erwachsenen.
Sie tat ihr bestes, um den verwirrten Kleinen zu beruhigen:
»Deine Mutter kommt bald zurück, und dann wirst du sie sehen; sie mußte dringend fort.«
»Warum ist sie nicht vorher zu mir gekommen?«
»Sie war in Eile, verstehst du, sehr in Eile, und der Wagen wartete schon auf sie, und dann …«
Er hörte zu weinen auf, und sie fühlte in der Dunkelheit, daß er einen schrecklichen Blick, den Blick eines Mannes auf sie richtete.
»Und dann?« fragte er.
»Und dann hat sie es einfach vergessen … aber sie wird noch kommen.«
»Vergessen?«
»Nun ja, es ist ihr zu spät eingefallen.«
Das Kind hatte sich halb aufgerichtet und ließ sich wieder fallen, vergrub das Gesicht im Kopfkissen, und sie fürchtete, er könnte ersticken. Darum schob sie ihren Arm unter seine Schultern und wollte ihn anheben, aber er wehrte sich schluchzend, und sie bekam es mit der Angst zu tun. Erstickte Worte drangen an ihre Ohren; sie hörte immer wieder: »Mamma vergessen«, und plötzlich in einem fast unverständlich Gemurmel:
»Sonathan …«
Zuerst glaubte sie, sich getäuscht zu haben, aber irgend etwas sagte ihr, daß sie richtig gehört hatte. Einen Augenblick war sie versucht, ihn auszufragen, aber sogleich hatte sie das unwiderstehliche Gefühl, daß sie dazu nicht berechtigt sei und daß sie es sich später vorwerfen würde.
So beschloß sie, sich auf den Stuhl an seinem Bett zu setzen und zu warten, bis diese Krise, die sie bestürzte, vorüber war; um den Schrecken der Dunkelheit zu lindern, schraubte sie das Nachtlicht ein wenig höher, während der verzweifelte Kleine unter Weinen wieder einschlief.
Als Elizabeth in den Sinn kam, daß sie vergessen hatte, ihren Sohn zu küssen, bevor sie zu den Steers ging, verschlug es ihr die Sprache. Sie blickte Miss Celina an und stammelte immer wieder:
»Wie konnte ich das vergessen?«
»Aber das ist doch ganz natürlich, Sie mußten zu diesem Abendempfang.«
»… diesem Abendempfang …«
Sie wiederholte diese Worte, wie um besser zu verstehen.
»Sie sagen, er habe geweint …«
»Ja, M’am.«
Reglos standen sich die beiden Frauen in dem kleinen Salon gegenüber und beobachteten einander stumm.
»Geweint? Hat er etwas gesagt?«
»Er hat nach Ihnen gerufen.«
»Sonst nichts? Hat er sonst nichts gesagt?«
Miss Celina gehörte zu jenen Frauen, die leicht in Verlegenheit zu bringen sind, weil sie auf keinen Fall lügen wollen.
»Was hätte er denn anderes tun sollen, als nach seiner Mutter zu rufen?«
In diesem Augenblick wußte Elizabeth, daß Miss Celina ihr etwas verheimlichte. Sie wußte auch, daß nichts sie zum Reden bringen würde, aber sie las einen großen Teil der Wahrheit in diesen schwarzen Augen, die nicht mit der Wimper zuckten. Sie hatte das Kind in sich verliebt gemacht, und natürlich warf es ihr nun ihre Abwesenheit wie eine Untreue vor.
»Ich werde hinaufgehen und ihm seinen Gutenachtkuß geben.«
»Er schläft. Ich an Ihrer Stelle, M’am, würde ihn schlafen lassen. Er hatte Mühe, sich zu beruhigen.«
In ihrem Blick lag eine solche Ernsthaftigkeit, daß die junge Frau zögerte. Sie hatte das Gefühl, daß alles um sie her sich veränderte.
»Morgen wird alles wieder gut sein«, sagte Miss Celina, die ihren Gedanken zu erraten schien.
Und dann fügte sie hinzu:
»Wenn Sie wollen, gehen wir hinauf, und ich helfe Ihnen beim Auskleiden. Sie sehen müde aus.«
»Ja, ich bin müde.«
Sie gab nach. Es ist besser so, sagte sie sich. Sie wagte sich nicht einzugestehen, daß sie sich schuldig fühlte und daß sie es vorzog, dem enttäuschten Geliebten nicht gegenüberzutreten, der weder die gewohnte Zärtlichkeit, noch seine Geschichte, noch jenen geheimnisvollen und magischen Kosenamen Jonathan bekommen hatte, den sie ihm ins Ohr flüsterte und den er leise wiederholte, wodurch er auf einmal zu einem phantastischen Wesen aus einer Zauberwelt wurde.
Plötzlich kam ihr der Gedanke, daß ihr Leben auseinanderbrach und daß das Kind ihr nicht mehr glauben würde. Er wäre nie mehr der, den sie insgeheim ihren kleinen Verschwörer nannte.
Sie wandte Miss Celina ihr ausdrucksloses Gesicht zu.
»Gehen wir hinauf«, sagte sie mit müder Stimme. »Ich werde zu schlafen versuchen.«
Mit einer Gewandtheit, die Elizabeth einfach bewundern mußte, zog die Gouvernante sie in weniger als zehn Minuten aus und brachte sie zu Bett. Mit ihrer vernünftigen und besänftigenden Stimme gelang es ihr, ihre Herrin zu beruhigen, indem sie den kleinen Wutanfall von Charles Edward als eine ganz banale Wachstumskrise bezeichnete, und diese Worte, die so gut wie nichts besagten, erschienen der Mutter wie die Weisheit selbst.
Lautlos kam und ging Miss Celina, hängte die Kleider in den Schrank, löschte die Lampe, öffnete die Tür zum Nebenzimmer, wo das Kind schlief, bewegte sich wie eine Fee in der Dunkelheit und verschwand.
Als Elizabeth allein war, blieb sie mit offenen Augen liegen, fühlte sich erschöpft und wußte, daß sie eine lange schlaflose Nacht vor sich hatte. Das Kind schlief nebenan, und sie verbot sich selbst, auf Zehenspitzen zu ihm zu gehen, um wenigstens seinen Atem zu hören. Das kleine Wesen war so empfindsam, daß es ihre Anwesenheit sofort gespürt hätte, und würden die Tränen und Vorwürfe dann nicht erneut ausbrechen und eine neue Krise auslösen?
Aus der Dunkelheit, in der sie zuerst nichts erkennen konnte, tauchten allmählich die vertrauten Möbel auf, die ganze Szenerie ihrer Einsamkeit, die bauchige Kommode mit dem Spiegel, der Sekretär, auf dem englische Frauen zur Zeit der Königin Anne vermutlich ihre Liebesbriefe geschrieben hatten, der Schaukelstuhl, in dem man sich bis zur Betäubung in seine Träume wiegen konnte. Die Musselinvorhänge am halboffenen Fenster blähten sich leicht in der nächtlichen Brise, die vom Hafen herüberwehrte.
Von Zeit zu Zeit vernahm sie von der anderen Seite des Parks das ferne Rattern der Kutschen. Dort war Ned am Nachmittag mit der alten Betty spazierengegangen. In dem Moment hatte sie sich, wenn auch nicht sehr zufrieden mit ihrem Schicksal, so doch wenigstens im Frieden mit sich selbst gefühlt. Und jetzt diese Unruhe …
Zum Glück war Miss Celina bei ihr in diesem Haus, das für eine einzige Person eigentlich zu groß war.
5
Was Elizabeth von Miss Celina halten sollte, wußte sie nicht so genau, wie sie es sich gewünscht hätte. Gewiß, sie respektierte sie, aber diese Frau übte die Kunst des Schweigens in einem Maße aus, das ihre Gegenwart zuweilen bedrückend machte.
Charlie Jones kannte Celina schon seit Jahren. Lange vor Elizabeths Ankunft in Georgia pflegte er die ärmsten Viertel der Stadt zu durchforschen, ohne je davon zu reden. Es lag in seiner Natur, sich für jene zu interessieren, die man mit einer Geringschätzigkeit den Abschaum der armen Weißen nannte, die er aufs schärfste verurteilte. Sein Vermögen gestattete ihm, viele aus dem Elend zu retten. Celina war die Tochter eines kleinen Handwerkers, eines Spielzeugfabrikanten, der Bankrott gemacht hatte. Er war Protestant und stammte von jenen ab, die von dem sehr christlichen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs aus dessen Staaten vertrieben worden waren.
Charlie Jones hatte sich des Schicksals dieses Mannes und seiner Familie angenommen, hatte den Vater in einem seiner Büros angestellt und Celina auf ein Pensionat in Macon geschickt.
Mit ihren fünfzehn Jahren hatte sie oft hungern müssen, aber sie war viel zu klug, um nicht die Chance zu ergreifen, die ihr das Leben bot. Es glich einer Herausforderung. Ihre Gefährtinnen, die auch nicht der gehobenen Gesellschaft angehörten, waren doch besser gestellt als sie, so daß sie sich fragen konnten, aus welchem Milieu sie käme. Ihre ausländische Abstammung erleichterte die Sache. Wenn man aus der Fremde stammte, hatte man das Recht, nicht genau so zu sein wie die anderen. Weniger hübsch als angenehm im Umgang, machte sie ihr Manko durch ein Lächeln wett, das sie nicht übertrieb, das jedoch verführerisch sein konnte. Schon früh hatte sie beschlossen, nicht zu heiraten.
Als es an der Zeit war, einen Beruf für sie zu finden, schickte Charlie Jones sie als Gesellschafterin zu angesehenen Damen, die sich im Schoße einer luxuriösen Witwenschaft zu Tode langweilten. Sie las ganz entzückend vor, mit dem Gleichmaß eines Metronoms, das einschläfernd wirkte, was ihr durchaus Lob eintrug, aber wenn ihr das einmal gelungen war, hatte sie nichts mehr zu bieten. Es fehlte ihr der Stoff zur Konversation. So entließ man sie nach einem Jahr.
Dank Charlie Jones machte sie die Runde in der Gesellschaft von Macon, dann von Atlanta, und sie sparte sich insgeheim ein kleines Guthaben zusammen, mit dem sie hoffte, eines Tages zu materieller Unabhängigkeit zu gelangen, aber sie war noch weit davon entfernt.
Inzwischen war es zu dem tragischen Duell gekommen, bei dem Charlie Jones seinen Sohn verloren hatte, und seitdem verspürte er nicht mehr oft das Verlangen, Elizabeth zu besuchen. Obwohl er sie im Grunde seines Herzens bedauerte, hielt er sie insgeheim für verantwortlich. Wenn sie Ned treu geblieben wäre, hätte sie ihm das Leben bewahrt. Er sah sie auf schreckliche Weise gestraft, und erst allmählich nahm das Mitleid seinen Weg.
Eines Tages im Jahre 1855 hatte er an der Tür seiner Schwiegertochter geklingelt.
Es war das Kind, das die Partie für Elizabeth gewann. Man hätte meinen können, daß der Kleine es wußte, und daß er all die kleinen unfehlbaren Listen einer Eingebung verdankte. Als er diesen großen Mann im schwarzen Gehrock sah, der sich über ihn neigte, begann er sogleich, ihn mit einem strahlenden Lächeln am Backenbart zu zupfen. Da nahm ihn sein Großvater in die Arme und hielt ihn so schwindelerregend in die Höhe, daß der junge Charles Edward in unverständliche Freudenschreie ausbrach. Es bedurfte keiner weiteren Mühe; der Sieg war sicher. Nachdem Charlie Jones ihn seiner Mutter auf den Schoß gesetzt hatte, sagte er mit unsicherer Stimme:
»Er hat bereits den Frohsinn von unserem Ned … und auch die Augen.«
Elizabeth senkte den Kopf, damit er ihr Erröten nicht sah.
»Ja, die Augen«, sagte sie.
Nachdem die Versöhnung vollzogen war, kam er auf den Boden der Tatsachen zurück und wollte von Elizabeth wissen, ob sie einen guten Koch habe. Der Koch war ein Meister seines Fachs. Und eine fähige, ergebene Dienerschaft?
»Vier insgesamt, die sehr gewissenhaft sind, und dann noch den Diener, der Ihnen die Tür geöffnet hat.«
»Er schien mir recht geschickt. Und für den Kleinen?«
»Eine prächtige schwarze Nanny, die er anbetet – und natürlich auch meine liebe Betty.«
»Gut, dann bin ich diesbezüglich beruhigt. Und doch hoffentlich einen Hauswächter?«
»Einen Iren, größer als Sie, der gelegentlich auch als Gärtner arbeitet und hart zuschlagen kann, wenn es sein muß.«
»Das klingt ja alles sehr gut. Ordnung geht vor allem. Und die Gouvernante?«
»Ich habe keine Gouvernante.«
»Und warum nicht?«
»Aus Prinzip …«
Er las in ihren Gedanken die Erinnerung an die Waliserin.
»Vergessen wir das. Ich habe eine für dich. Sage bitte nicht nein, ohne sie gesehen zu haben.«
Es folgte eine lobende, wenn auch kurze Beschreibung von Celina.
»Sie ist in Verhältnissen aufgewachsen, die man elend nennen kann. Doch das soll dich nicht abschrecken.«
»Warum sollte es? Glauben Sie vielleicht, ich hätte die Wintermonate vergessen, die ich mit Mama in London verbracht habe? … Ich weiß noch sehr wohl, wie die Armut schmeckt.«
Und es war ihr, als sähe sie die schwarzen und roten Reihenhäuser im Nebel wieder, das dunkle und eiskalte Zimmer, das scheußliche kleine Restaurant …
Er schwieg eine Weile und fuhr dann fort:
»Für Celina haben sich die Umstände ähnlich wie bei dir zum besseren gewendet und haben sie aus dem Elend gezogen.«
In diesem Augenblick hüstelten die Umstände verlegen …
»Sie war bei sehr ehrbaren Damen in Pension, hat eine makellose Erziehung erhalten und ist heute mehr als präsentabel. Als Ausländerin …«
»Ausländerin?«
»Schau nicht so beunruhigt drein. Was nicht englisch ist, muß nicht unbedingt gleich verdächtig sein. Ihre Familie stammt aus Salzburg in Österreich, ist aber gut protestantisch.«
»Na und?«
»Ich sehe sie bereits hier als vorbildliche Gouvernante.«
»Sie haben bessere Augen als ich, denn ich sehe sie hier noch keinesfalls.«
»Ich bitte dich ja nur, sie zu empfangen.«
»Wie alt ist sie?«
»Um die vierzig, und gut erhalten.«
Schließlich gab Elizabeth einer instinktiven Eingebung nach und willigte ein.
»Schicken Sie mir die gute Frau, aber ich verspreche nichts …«
Er dankte ihr mit einem Lächeln, und sie schwiegen eine Weile.
»Du rettest sie«, sagte er dann ganz einfach.
Im milden Licht dieses Spätnachmittags war in seinen Zügen blitzartig der Mann mit dem schönen englischen Gesicht wiederzuerkennen, der sie vor fünf Jahren bei sich aufgenommen hatte. Elizabeth machte eine Handbewegung, wie um sich der moralischen Wendung zu erwehren, die das Gespräch zu nehmen drohte. Er verstand sofort und erklärte:
»Ich bewundere deinen Geschmack in der Wahl der Farben für diesen kleinen Salon. Dieses Hellblau wirkt wunderbar.«
»Finden Sie? Ich werde seiner mit der Zeit ein bißchen überdrüssig.«
»Es ist wahr, daß die Gewohnheit fast alles banal erscheinen läßt. Man sieht die Dinge nicht mehr in der Frische, wie wenn sie neu sind.«
Dieser gestelzte Ton erinnerte die junge Frau an den Charlie Jones vergangener Zeiten, aber was nun folgte, beunruhigte sie.
»Ich muß dir eine Frage stellen«, sagte er, »eine Frage, die dir vielleicht indiskret erscheinen wird, und deshalb steht es dir natürlich frei, sie nicht zu beantworten.«
»Ach was, überspringen wir die Vorreden. Es ist wie mit den Vorworten in den Büchern. Wer hat schon Lust, ein Vorwort zu lesen?«
»Da du mir so freundlich entgegenkommst … es handelt sich um folgendes: So oder so betrachte ich es als meine Pflicht, Celina eine ehrbare Zukunft zu sichern.«
»Schon wieder Celina?«
»Ja. Sie soll eines Tages all ihrer Sorgen und der quälenden Angst um das Morgen enthoben sein.«
»Und Sie zählen auf mich, um ihr diesen schönen Traum zu erfüllen?«
»Auf dich oder einen anderen, denn schließlich gibt es die göttliche Vorsehung, aber sie wird den köstlichen Moment erleben, da der Seufzer der Erleichterung sich löst und die Bürde vom Herzen fällt. Ohne ihr Schicksal mit dem deinen vergleichen zu wollen – du hast sicher auch einmal den großen Befreiungsseufzer ausgestoßen.«
»Onkel Charlie, ich finde Sie höchst seltsam.«
»Aber nein, aber nein, es gab einen Augenblick, da hast du dir sagen können: ich war arm, ich bin es nicht mehr; ich bin reich.«
»Pfui, wie vulgär! Ich habe noch nie in diesem Ton zu mir gesprochen.«
»So? Mein Fall liegt anders. Als junger Mann habe ich den Hunger der Armut in meiner Magengrube gespürt. Begreifst du das?«
»Ich bin ja nicht blöd.«
»Die Jahre sind wie der Wind vergangen. Amerika, die Jugend, die Arbeit, der Ehrgeiz, die Beziehungen, die Berechnungen, die sich als richtig erwiesen haben … Dann kam der Tag, als ich fünfunddreißig war und auf dem Gipfel des Lebens stand, da ich mir darüber klar wurde, daß ich bereits zu den reichsten Männern des Landes zählte. Ich war einer von denen, die mehr Geld hatten als die meisten anderen.«
Elizabeth blickte gleichgültig drein.
»Na und?« fragte sie.
»Und da bekam ich Angst. Das Geld macht Angst. Das Übermaß an Reichtum kann gewissermaßen eine Prüfung sein.«
»Ich habe Leute gekannt, die diese Prüfung mit wunderbarem Mut ertragen haben.«
»Spotte nur nach Herzenslust, du unverbesserliche Engländerin, aber wenn es dir gegeben wäre, einen riesigen Haufen Goldstücke zu besitzen, könntest du dich fragen, woher er kommt: von Gott oder vom Teufel.«
»Vielleicht von beiden.«
»Das ist fürwahr eine Antwort. Aber gehen wir ins Detail. Eines Tages, früher oder später, wirst du in deine alte Heimat reisen. Man wird dich in die schönsten Schlösser des Königreichs einladen. Ihr Luxus wird dich blenden.«
»Mich blenden? Halten Sie mich für eine Hinterwäldlerin?«
»Aber nein. Selbst ich, der ich mich auskenne, bin immer wieder beeindruckt. Der Haufen Gold ist zu einer Sammlung von Möbeln und Gemälden geworden, die einem den Atem verschlägt. Das ist, wenn ich so sagen darf, sein eigentliches Ziel. Die Lords auf den Portraits von Raeburn oder Gainsborough sehen dich mit der unbeschreiblichen Geringschätzung vorübergehen, die ihrem Rang entspricht und die dich in den Boden versinken läßt.«
»Trösten Sie sich, sie leiden fast alle an der Gicht.«
Er ignorierte diese giftige Bemerkung und fuhr fort:
»Durch die hohen Fenster sieht man draußen die endlosen Wiesen und Wälder, denn in den höheren Kreisen liebt man die Natur.«
»Ich wußte gar nicht, daß Sie ein Revolutionär sind, Onkel Charlie.«
»Nicht mehr als Mr. Dickens, der der Welt den Skandal der Kinderarbeit in den englischen Fabriken und Bergwerken enthüllt hat.«
Plötzlich stand sie auf, und ihr Gesicht war rot vor Zorn.
»Jetzt fangen wir an, uns zu verstehen«, sagte sie, »und Sie wissen so gut wie ich, daß sich auch der Norden an der Kinderarbeit bereichert.«
In ihrer Erregung ließ sie den kleinen Charles Edward zu Boden gleiten, und er rollte lachend über den Teppich. Da er das Ganze für ein Spiel hielt, versuchte er, die Beine seines sitzenden Großvaters zu erklimmen. Onkel Charlie hob ihn auf wie einen kostbaren Gegenstand und nahm ihn auf seine Knie. Doch nun sah er sich gezwungen, seinen Backenbart zu verteidigen, dessen Anblick den Jungen faszinierte. Es folgte ein stummer Kampf mit dem stürmischen Widersacher, und Charlie Jones brach schließlich in schallendes Gelächter aus.
»Meine liebe Elizabeth«, sagte er, »über diese Dinge, die der Norden nicht hat verbergen können, bin ich bestens informiert, aber es amüsiert mich, ganz abgesehen von einem persönlichen Konflikt mit deinem Sohn, daß wir beide, du und ich, in unseren Meinungen so völlig übereinstimmen, während unser Gespräch in einem solchen Mißklang zu dem köstlichen hellblauen Glanz deines kleinen Salons steht.«
Weit entfernt, sich seiner Fröhlichkeit anzuschließen, warf sie ihm einen zornigen Blick zu.
»Glauben Sie etwa, ich sei mir dessen nicht immer wieder bewußt? Alles hat an dem Tage begonnen, als ich zum erstenmal hier herkam und in einer Vorstadt von Savannah die zerlumpten Männer, Frauen und Kinder sah, die uns stumm in unserer Kutsche vorüberfahren sahen. Der Abschaum der armen Weißen!«
»Elizabeth, es gibt Hilfsorganisationen.«
Jetzt versuchte Charles Edward, sich auf den Schoß seines Großvaters zu stellen, um einen letzten Angriff auf den prächtigen Backenbart zu wagen. Charlie Jones packte den Gegner an beiden Händen und machte Miene, ihn Elizabeth zu reichen. Diese nahm verärgert das Kind in Empfang und setzte es in einen Sessel. Der Kleine blickte sie vorwurfsvoll an, und weder sie noch Charlie Jones hörten ihn vor sich hinsingen:
»Mamma … ich liebe meine Mamma … meine Mamma gehört mir …«