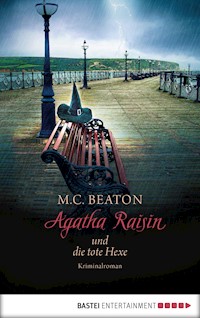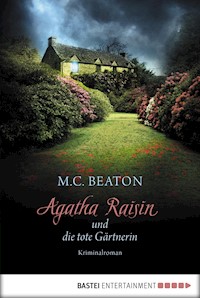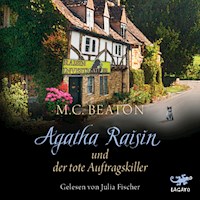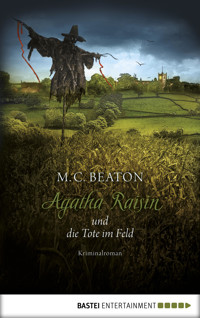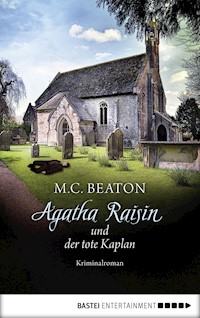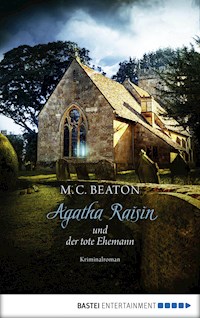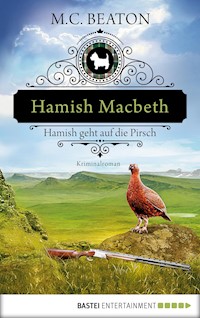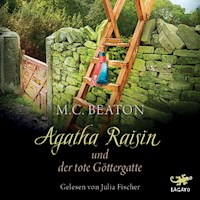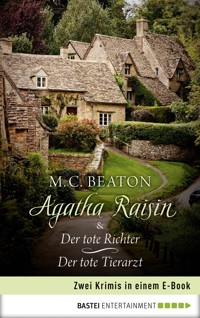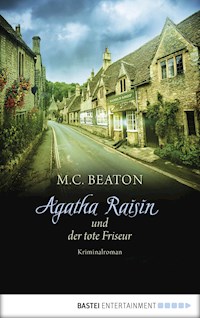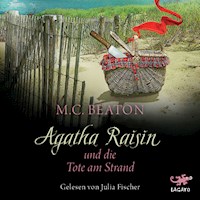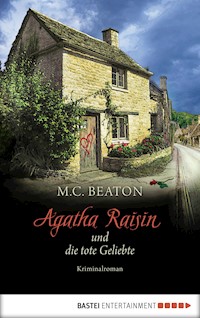
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Agatha Raisin Mysteries
- Sprache: Deutsch
Im kleinen Dorf Carsely ist die Freude groß: Agatha Raisin hat endlich James Lacey geheiratet! Doch rasch ziehen dunkle Wolken am Ehehimmel auf, und die Frischvermählten gehen sich aus dem Weg. Agatha unterstellt James sogar, ein Verhältnis zu haben. Als es darüber zu einem hässlichen Streit im Pub kommt, überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst verschwindet James und hinterlässt nichts als einen riesigen Blutfleck, dann wird dessen angebliche Geliebte ermordet. Die Polizei verdächtigt vor allem eine Person: die als herrisch und streitsüchtig geltende Ehefrau - Agatha Raisin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Epilog
Über das Buch
Im kleinen Dorf Carsely ist die Freude groß: Agatha Raisin hat endlich James Lacey geheiratet! Doch rasch ziehen dunkle Wolken am Ehehimmel auf, und die Frischvermählten gehen sich aus dem Weg. Agatha unterstellt James sogar, ein Verhältnis zu haben. Als es darüber zu einem hässlichen Streit im Pub kommt, überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst verschwindet James und hinterlässt nichts als einen riesigen Blutfleck, dann wird dessen angebliche Geliebte ermordet. Die Polizei verdächtigt vor allem eine Person: die als herrisch und streitsüchtig geltende Ehefrau – Agatha Raisin.
Über die Autorin
M. C. Beaton ist eines der zahlreichen Pseudonyme der schottischen Autorin Marion Chesney. Nachdem sie lange Zeit als Theaterkritikerin und Journalistin für verschiedene britische Zeitungen tätig war, beschloss sie, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Mit ihren Krimireihen um den schottischen Dorfpolizisten Hamish Macbeth und die englische Detektivin Agatha Raisin feiert sie bis heute große Erfolge in über siebzehn Ländern. M. C. Beaton lebt abwechselnd in Paris und in den Cotswolds.
M. C. BEATON
Agatha Raisin
und die tote Geliebte
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2001 by M. C. BeatonPublished by Arrangement with Marion Chesney GibbonsTitel der englischen Originalausgabe: »Agatha Raisin and the Love from Hell«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Anke Pregler, RösrathTitelillustration: © Arndt Drechsler, RegensburgUmschlaggestaltung: Kirstin OsenauE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5671-7
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Joan und John DewhurstIn Liebe
Eins
Sie sollte die Erfüllung eines Traums sein – die perfekte Ehe. Agatha Raisin war mit dem Mann verheiratet, nach dem sie sich so lange verzehrt, von dem sie so viel fantasiert hatte. Ihr Nachbar, James Lacey. Und dennoch war ihr elend zumute.
Alles hatte mit einem Zwischenfall zwei Wochen nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen begonnen. Die Hochzeitsreise nach Wien und Prag hatte größtenteils aus Sightseeing und Sex bestanden, sodass sie der wahre gemeinsame Alltag erst hinterher einholte. Agatha hatte ihr eigenes Cottage neben dem von James im Dorf Carsely in den englischen Cotswolds behalten. Der Plan war es, eine durch und durch moderne Ehe zu führen und einander Freiraum zu lassen.
Nun saß Agatha in ihrer Küche, umklammerte einen Becher schwarzen Kaffee und erinnerte sich an den Tag, an dem die Dinge schiefzugehen begannen.
In ihrem Bestreben, die ideale Ehefrau zu sein, hatte Agatha die komplette Schmutzwäsche zusammengerafft und die Tatsache ignoriert, dass James seine getrennt in einem Korb sammelte, weil er sie lieber selbst wusch. Es war ein frischer Frühlingstag gewesen, und der Wind trieb graue Schäfchenwolken stattlichen Galeonen gleich über den Himmel. Agatha sang, während sie die verschmutzte Wäsche in ihre große Maschine stopfte. Eine kleine Glocke schrillte irgendwo in ihrem Hinterkopf, um sie zu warnen, dass echte Hausfrauen Farbiges und Weißes trennten. Agatha aber füllte Waschpulver und Weichspüler ein und ging dann in den Garten, um ihren beiden Katern zuzusehen, wie sie auf dem Rasen herumtollten. Als sie hörte, dass die Waschmaschine den letzten Schleudergang beendete, stand sie auf, ging nach drinnen und zog die Sachen aus der Maschine in einen Korb, um sie im Garten aufzuhängen. Allerdings fand sie sich einer Ladung rosafarbener Wäsche gegenüber. Und es war kein Zartrosa, sondern eher ein schrilles Pink. Verzweifelt wühlte sie nach dem schuldigen Teil und fand es schließlich: ein pinkfarbener Pulli, den sie auf einem Markt in Prag gekauft hatte. Alle Sachen von James – seine Hemden, seine Unterwäsche – waren nun leuchtend pink.
Doch hätte ihr nicht im rosigen Licht ihrer jungen Ehe vergeben werden müssen? Oder sie schlimmstenfalls ausgelacht werden sollen?
Nein, James war außer sich gewesen. Hatte gekocht vor Wut. Wie könne sie es wagen, sich an seinen Sachen zu vergreifen? Sie sei dumm und unfähig. Die unverheiratete Agatha Raisin hätte ihm sehr deutlich gesagt, was er mit sich tun dürfe, doch die neue, demoralisierte Agatha flehte unterwürfig um Vergebung. Sie vergab ihm, weil sie wusste, dass er lange Zeit Junggeselle gewesen und mithin entsprechend eingefahren war.
Der nächste Zwischenfall ereignete sich, nachdem sie zwei Mikrowellengerichte bei Marks & Spencer gekauft hatte, zwei Portionen Lasagne. Er hatte in seinem Essen herumgestochert und säuerlich angemerkt, er sei durchaus imstande, eine richtige Lasagne zuzubereiten, und künftig sollte sie vielleicht lieber ihm das Kochen überlassen.
Dann war da die Sache mit ihrer Garderobe. Agatha kam sich trampelig vor, wenn sie keine hohen Absätze trug, doch James sagte, da sie auf dem Lande lebten, sollte sie lieber flache Schuhe tragen, um nicht mehr umherzustaksen wie ein Flittchen. Ihre Röcke seien zu eng, einige Oberteile zu tief ausgeschnitten. Und ihr Make-up? Musste sie es so dick auf ihr Gesicht kleistern?
Ja, nachts liebten sie sich, aber auch nur nachts. Tagsüber gab es keine spontanen Umarmungen oder Küsse. Verwirrt bewegte sich Agatha durch einen dichten Nebel maskuliner Ablehnung.
Und dennoch erzählte sie niemandem von dem Elend ihres Ehelebens, nicht einmal ihrer besten Freundin, Mrs. Bloxby, der Vikarsfrau. Hatte die sie nicht vor dieser Heirat gewarnt? Agatha ertrug es nicht, eine Niederlage einzugestehen.
Seufzend blickte sie aus dem Küchenfenster. Hier hockte sie in ihrem eigenen Cottage, versteckte sich wie eine Verbrecherin. Das Klingeln des Telefons ließ sie aufschrecken. Zögerlich nahm sie ab und fragte sich, ob es James war, der ihr wieder einen Vortrag halten wollte. Doch es war Roy Silver. Roy hatte früher für Agatha in deren Londoner PR-Agentur gearbeitet, und jetzt war er in der City für eine große PR-Firma tätig.
»Wie geht es der glücklich vermählten Mrs. Lacey?«, fragte er.
»Ich heiße immer noch Agatha Raisin«, antwortete sie spitz. Ihren eigenen Namen zu behalten, kam ihr wie das letzte Stück Unabhängigkeit vor, das sie sich bewahren konnte. Ihr war nicht recht bewusst, dass der Name ihres verstorbenen Ehemanns, den sie von ganzem Herzen verachtet hatte, nicht unbedingt für einen symbolischen Befreiungsschlag stand.
»Wie modern«, bemerkte Roy.
»Was ist los?«
»Nichts. Ich habe seit der Hochzeit nichts von dir gehört. Wie war Wien?«
»Nicht sehr aufregend. Nicht sonderlich viel Pepp. Prag war in Ordnung. Bist du sicher, dass du nur so anrufst? Ohne irgendwelche Hintergedanken?«
»Da gibt es etwas, was dich interessieren dürfte.«
»Dachte ich es mir doch. Was?«
»In Mircester macht eine neue Schuhfirma auf. Das sind unsere Klienten. Nicht groß, aber sie wollen jemanden, der vor Ort die PR für die neue Kollektion aus ihrer neuen Fabrik macht. Ihr Name ist Cotswolds Way.«
»Und was soll das sein?«
»Es geht um diese klobigen neuen Stiefel, die bei den jungen Leuten beliebt sind, von den ernsthaften Wanderern ganz zu schweigen, die zur neuen Plage in den ländlichen Gegenden werden. Kurze Vertragsdauer, also genau deine Abteilung.«
Agatha wollte schon sagen, sie sei eine verheiratete Frau und habe keine Zeit für anderes. Jedem im Dorf erzählte sie, wie glücklich sie sei. Doch plötzlich dachte sie, dass sie dringend etwas Identitätsstiftendes bräuchte. Sie war gut, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit ging. Als Hausfrau mochte sie versagen, aber was ihre Talente als Geschäftsfrau anging, machte ihr niemand etwas vor.
»Klingt wirklich interessant«, sagte sie langsam. »Wie heißt die Firma?«
»Delly Shoes.«
»Das hört sich eher an, als würden sie Leberwurst und belegte Sandwiches verkaufen.«
»Dann darf ich ein Gespräch mit dir vereinbaren?«
»Warum nicht? Je eher, desto besser.«
»Normalerweise brauche ich ewig, um dich wieder zu einem Auftrag zu überreden«, sagte Roy. »Ist die Ehe wirklich okay?«
»Sicher doch! Aber James schreibt tagsüber meistens und will mich dann nicht im Weg haben.«
»Mmm. Ich hatte bei ihm angerufen, und er sagte, dass du unter deiner alten Nummer zu erreichen bist.«
»Ich habe mein Cottage behalten. Diese kleinen Häuser können ziemlich erdrückend sein. Und so haben wir alles zweifach, zwei Küchen, zwei Bäder und so weiter.«
»Okay. Ich mache einen Termin und melde mich wieder.«
Als sie aufgelegt hatte, steckte Agatha sich eine Zigarette an – eine Angewohnheit, die James verabscheute – und blickte ins Leere. Wie würde er reagieren, wenn sie wieder arbeitete? Obwohl ihr ein wenig mulmig wurde, spürte sie, wie sie sich emotional wappnete. Ob es ihm passte oder nicht, Agatha Raisin war wieder im Geschäft!
Und dennoch hätte sie nicht gedacht, dass er tatsächlich dagegen sein würde. Kein Mann, nicht einmal James, konnte derart altmodisch sein. Als Roy ihr erzählte, dass er einen Termin für den nächsten Nachmittag um drei machen konnte, rief Agatha ihre beiden Kater und ging, gefolgt von Hodge und Boswell, zu James’ Cottage nach nebenan. Es wird niemals unser Cottage sein, dachte sie traurig, während sie die Tür öffnete und die Kater hineinscheuchte.
James saß vor seinem Computer und blickte mürrisch auf den Monitor. Er hatte es geschafft, ein Buch über Militärgeschichte zu veröffentlichen, und war sich sicher gewesen, dass ihm das nächste leichter fallen würde. Doch nun schien er Tage damit zu verbringen, wütend auf einen Monitor zu starren, auf dem nichts als Kapitel eins stand. Er hatte eine Hand an seine Stirn gelegt, als hätte er Kopfschmerzen.
»Ich habe einen Job«, sagte Agatha.
Er lächelte sie tatsächlich an. Die Winkel seiner blauen Augen kräuselten sich in seinem sonnengebräunten Gesicht auf eine Weise, bei der Agatha immer noch das Herz überging. »Und was für einen?«, fragte er und schaltete seinen Computer aus. »Ich mache uns einen Kaffee, und du kannst mir in Ruhe davon erzählen.« Er ging in die Küche.
Agathas Unglück über ihre Ehe schwand. Die alte Hoffnung, dass sie lediglich die üblichen Anpassungsschwierigkeiten der Jungverheirateten durchlebten, regte sich. Er kam mit zwei Kaffeebechern zurück. »Der ist koffeinfrei«, sagte er. »Du trinkst zu viel richtigen Kaffee. Und deine Sachen riechen nach Qualm. Ich dachte, du hättest aufgehört.«
»Ich hatte nur eine«, verteidigte sich Agatha, obwohl sie fünf Zigaretten geraucht hatte. Wann begriffen die Leute endlich, dass man andere nicht zum Aufhören bewegte, indem man an ihnen herummeckerte und ihnen Schuldgefühle einredete? Für den Umgang mit Alkoholikern wurde immer empfohlen, ihre Trinkerei nicht anzusprechen oder das Zeug einfach in die Spüle zu kippen. Raucher hingegen wurden gejagt und beschimpft, was einzig den Widerstand der Süchtigen befeuerte.
»Wie auch immer«, sagte James, reichte ihr einen Becher und setzte sich ihr gegenüber hin, »was ist das für ein Job? Für wen sollst du diesmal Spenden eintreiben?«
»Es geht nicht um das Dorf«, antwortete Agatha. »Ich übernehme einen PR-Klienten, um für neue Schuhe, na ja, eher Stiefel zu werben. Eine Firma in Mircester.«
»Ein richtiger Job, meinst du?«
»Ja, natürlich, ein richtiger Job.«
»Wir brauchen das Geld nicht«, sagte James ruhig.
»Geld ist immer praktisch«, erwiderte Agatha munter. Dann erstarb ihr Lächeln, denn James’ Gesichtsausdruck wurde eindeutig wütend.
»Was ist denn?«, fragte sie unsicher.
»Du brauchst keine Arbeit. So etwas solltest du den Leuten überlassen, die einen Job nötig haben.«
»Aber ich brauche diesen Job. Ich brauche eine Identität.«
»Erspar mir diesen Psycho-Jargon. Sprich bitte in klarem Englisch.«
Agatha verlor die Beherrschung. »In klarem Englisch«, heulte sie, »brauche ich etwas, um mein Ego zu stärken, das du dich ja nach Kräften zu zerstören bemühst. Den ganzen Tag nörgelst du an mir herum. Mecker, mecker, mecker. ›Mach dies nicht, tu das nicht.‹ Tja, vergiss es, Kumpel. Ich gehe wieder arbeiten.«
Abrupt stand James auf und ging zur Tür. »Wo willst du hin?«, rief Agatha ihm nach. Doch das Türknallen war alles, was sie zur Antwort bekam.
Am nächsten Tag warf sich Agatha in einen anthrazitfarbenen Hosenanzug und stellte erfreut fest, dass der Bund recht locker saß. Eine unglückliche Ehe hatte ihre Vorteile. James war den Rest des gestrigen Tages fortgeblieben und nicht mehr nach Hause gekommen, bevor Agatha schließlich in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Morgens beim Frühstück hatte beklemmendes Schweigen geherrscht, und ihr Selbstbewusstsein hatte merklich geschwächelt. Sie hatte das Frühstück gemacht, und dabei war alles schiefgegangen. Der Toast war verbrannt, das Rührei klumpig und hart geworden. Und die Atmosphäre setzte ihr zu. Zu gerne hätte sie gesagt: »Ist schon gut, du hast ja recht. Ich nehme den Job nicht an.« Doch von irgendwoher mobilisierte sie ein klein wenig Courage, die ihr half, James’ Laune nicht zu beachten.
Es war wieder ein schöner Frühlingstag, als sie die Fosse entlang nach Mircester fuhr. Roys Wegbeschreibung folgend, bog sie vor der Stadt in ein Gewerbegebiet ab. Es war neu, weshalb das Gelände vor den Fabriken noch nackt und roh wirkte.
Agatha hielt es für ein gutes Zeichen, dass man sie nicht warten ließ. Ihrer Erfahrung nach polierten nur erfolglose Geschäftsleute ihr Ego auf, indem sie Besucher erst mal am Empfang hocken ließen. Eine kompetent wirkende Sekretärin mittleren Alters führte sie direkt in einen Konferenzraum – Agathas Meinung nach war das ein weiteres gutes Zeichen. Sie wurde dem Geschäftsführer, dem Marketingchef, dem Verkaufsleiter und diversen anderen Führungskräften vorgestellt.
In der Mitte des Konferenztisches stand ein großer Lederstiefel. Der Geschäftsführer, Mr. Piercy, kam direkt zur Sache. »Also, Mrs. Raisin, dieser Stiefel auf dem Tisch ist unser Cotswolds-Way-Modell. Wir möchten für ihn werben. Mr. Hardy, unser Marketingchef, schlägt vor, dass wir eine der Wandergruppen hier mit ihm ausstatten.«
»Das würde ich nicht machen«, sagte Agatha sofort. »In dieser Gegend betrachtet man die Wanderer eher als zottelhaarige Militante. Wie viel kostet so ein Paar Stiefel?«
»Neunundneunzig Pfund neunundneunzig.«
»Das ist ziemlich teuer für den Jugendmarkt, und es sind junge Leute, die solche Stiefel mögen.«
»Wir haben eine Kostenkalkulation gemacht und können mit dem Preis nicht weiter runtergehen.«
»Was ist mit Fernsehwerbung?«
»Wir sind eine kleine Firma«, antwortete Mr. Piercy. »Wir möchten eine schlichte Markteinführung, und dann wird sich der Stiefel wegen seiner Qualität verkaufen.«
»Mit anderen Worten«, konstatierte Agatha brutal, »Sie können sich nicht viel PR leisten.«
»Wir können uns ein wenig PR leisten, aber keine landesweite Werbung.«
Agatha überlegte und sagte: »Es gibt eine neue Popgruppe in Gloucester: Stepping Out. Haben Sie von der gehört?«
Allgemeines Kopfschütteln.
»Ich habe in Midlands Today einen Beitrag über sie gesehen«, erklärte Agatha. »Es sind drei Jungen, drei Mädchen, alle sehr gepflegt, gutes Image. Kürzlich landeten sie mit einer ihrer Platten auf Platz zweiundsechzig der Charts, aber es zeichnet sich ab, dass sie groß rauskommen werden. Wenn wir die schnell buchen, sie mit den Stiefel ausstatten, sie überreden, einen Song übers Wandern zu schreiben – sie schreiben nämlich ihre eigenen Songs –, und sie dann ein Konzert geben, könnten Sie sie erwischen, bevor sie richtig berühmt sind. Dann wird man Ihre Stiefel später mit dem Erfolg der Gruppe assoziieren.«
Der Marketingmanager sagte: »Woher wissen Sie von dieser Gruppe, Mrs. Raisin?«
»Ist ein Hobby von mir. Ich achte einfach auf Leute, von denen ich glaube, dass sie berühmt werden. Und ich irre mich nie.«
Sie besprachen die Idee, und Agatha trieb sie in die richtige Richtung, wenn es aussah, als wollten die anderen sie verwerfen. Dabei wünschte sie sich insgeheim, sie würde für eine große Firma arbeiten und nicht für diese scheußlichen Stiefel werben müssen, die sie persönlich furchtbar fand. Hätte sie doch einen Klienten, mit dem sie James beeindrucken könnte! Aber James wäre so oder so von gar nichts beeindruckt, was ich tue, dachte sie traurig.
Schließlich wurde entschieden, Agathas Plan anzunehmen. »Nur eines noch, Mrs. Raisin«, sagte Mr. Piercy. »Als man Sie uns empfahl, wurde uns eine Mrs. Lacey angekündigt.«
»Die bin ich.«
»Doch den Namen benutzen Sie nicht?«
»Nein, ich bin seit Jahren unter dem Namen Raisin im Geschäft. Es ist einfacher, dabei zu bleiben.«
»Also gut, Mrs. Raisin. Hätten Sie gerne ein Büro hier?«
»Nein, ich werde von zu Hause aus arbeiten. Ich versuche, die Popgruppe zu fassen zu bekommen und ein Treffen für morgen zu arrangieren.«
Agatha fuhr aufgeregt nach Carsely zurück. Doch als ihr Wagen durch die grüne Allee gen Carsely rollte, verfinsterte sich ihre Stimmung. Sie ging in ihr eigenes Cottage, wo sie immer noch ihre Geschäftsunterlagen und den Computer hatte. Dort gab sie den Namen der Popgruppe ein und suchte nach deren Manager – ein PR-Reflex. Dann suchte sie aus dem Stapel Telefonbücher das von Gloucester heraus und schlug den Manager nach, Harry Best. Es gab mehrere H. Bests. Sie machte sich bereit, sie alle abzutelefonieren. Ein H. Best entpuppte sich als Vater des gesuchten Managers. Er gab ihr die richtige Nummer, und Agatha wählte sie. Munter erklärte sie ihren Plan für die Cotswold-Way-Werbung.
»Ich weiß nicht«, sagte Harry Best in diesem gekünstelten Londoner Englisch, das Agatha so deprimierend fand. »Wir sind heiß. Das würde Sie eine Menge kosten.«
Agatha holte tief Luft. »Am besten besprechen wir das persönlich«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich komme zu Ihnen nach Gloucester. Wie ist Ihre Adresse?«
Er nannte ihr eine Adresse in Churchdown, das außerhalb von Gloucester lag. Als Agatha wieder losfuhr, vorbei an James’ Cottage und seinem verschwommenen blassen Gesicht hinter dem Fenster, wurde ihr klar, dass sie nicht pünktlich zum Abendessen zurück wäre. Eine brave Ehefrau würde anrufen und Bescheid sagen, dass sie sich verspätete.
»Aber ich bin keine brave Ehefrau mehr«, sagte Agatha laut und umklammerte das Lenkrad fester.
Es herrschte dichter Verkehr, und das nicht bloß aufgrund der Straßenbauarbeiten auf der A40, sondern auch wegen der diversen lethargischen Traktorfahrer, die mit zehn Meilen die Stunde dahinkrochen. Bis sie Harrys Adresse gefunden hatte, fühlte Agatha sich müde und frustriert. Sie sehnte sich danach, alles abzublasen und zu James zurückzukehren, um sich mit ihm zu versöhnen und zu versuchen, diese höllische Ehe irgendwie zu retten. Doch vor dem schäbigen Einfamilienhaus stand ein dünner Mann, der sein weniges Resthaar zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und wartete auf sie.
Agatha musterte ihn, als sie auf ihn zuging. Er trug eine dieser kleinen Halbmondbrillen auf seiner Hakennase, die sich über einen kleinen, geschürzten Mund bog. Sie schätzte den Mann auf beinahe vierzig, auch wenn er sich in einem Look kleidete – Cowboystiefel, Jeans und schwarze Lederjacke –, wie es Leute tun, die sich verzweifelt an ihre Jugend klammern.
Mr. Harry Best war von Agatha so wenig angetan wie sie von ihm. Er sah eine mollige Frau mit schimmernd braunem Haar, das sie zu einer Banane aufgesteckt trug. Sie hatte ein rundes Gesicht mit einem anständigen Mund und einer guten Nase, doch ihre braunen Augen blickten misstrauisch wie die eines Bären.
»Ich bin Agatha Raisin.« Fest schüttelte sie seine schlaffe, klamme Hand. »Können wir das Geschäftliche drinnen besprechen?«
»Klar. Kommen Sie mit.«
Das Zimmer, in das er sie führte, sah aus, als sei es sehr hastig und nicht besonders gründlich aufgeräumt worden. Ein Papierkorb quoll über von leeren Coladosen. Unter einem Sesselkissen lag nur unvollständig verborgen ein Stapel Zeitungen und Zeitschriften.
Agatha kam direkt zur Sache. Sie schilderte ihm, wie die Werbung aussehen sollte, ihre Idee mit dem Song über die neuen Stiefel, und dann verhandelten sie über den Preis. Er versuchte, ihn nach oben zu treiben, indem er behauptete, alle würden die Gruppe für erfolglos halten, wenn sie Werbung machte. Agatha wies ihn darauf hin, dass viele erfolgreiche Popstars in Werbespots zu sehen waren. »Was ist zum Beispiel mit Michael Jackson?«, fragte sie gelassen.
Harry Best knickte merklich ein. Agatha erinnerte ihn an seine Großmutter, eine energische Frau, die ihm während seiner Kindheit Angst eingejagt hatte. Schließlich wurden sie sich handelseinig. Das richtig Gute, was Harry seiner Meinung nach herausgeholt hatte, war Agathas Zusage, ihnen einen Probenraum zu mieten, da sie demnächst aus der Garage seines Freundes geworfen würden, in der sie derzeit noch probten.
Als Agatha endlich ging, war es dunkel, spät, und sie hatte Hunger. Auf dem Rückweg hielt sie an einem Pub, wo sie sich ein schlichtes Essen und ein Glas Wasser gönnte. Danach würde sie sich um James kümmern.
Die Einwohner von Carsely, die ihre Hunde in der Lilac Lane ausführten, wo Agatha und James ihre Cottages hatten, sollten später beschreiben, dass sie Agatha schreien und dann klirrendes Geschirr gehört hatten. James hatte beschlossen, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und Agatha klipp und klar zu sagen, dass sie diesen blöden Job aufgeben und anfangen solle, sich wie eine verheiratete Frau zu benehmen.
Wäre er in diesem Moment wütend gewesen, hätte Agatha vielleicht, ganz vielleicht kapituliert. Doch da war diese ruhige Verachtung in seinem Ton, die sie auf die Palme brachte. Er sah gequält aus, als bekäme er Kopfschmerzen von ihr. Sie hatte sich nie für eine Frau gehalten, die Geschirr zerdepperte, doch der Streit fand in der Küche statt, und so kam es, dass Agatha eine ganze Regalladung zu Boden fegte und einen zornigen Tanz auf den Scherben aufführte.
»Du widerst mich an«, sagte James leise. Und dann war er rausgegangen und hatte Agatha mit hochrotem Kopf, keuchend und vollständig demoralisiert zurückgelassen.
Resigniert hatte sie ihre Sachen gepackt und sie nach nebenan in ihr Cottage getragen. Anschließend kehrte sie zurück, um die Scherben aufzufegen, sie in einen Karton zu schütten und ihn für die Müllabfuhr nach draußen zu stellen. Dann holte sie dieselbe Anzahl Teller, die sie zerbrochen hatte, aus ihrem Cottage und stellte sie auf James’ Küchenbord. Danach rief sie ihre Kater, die ihr nach drüben folgten. Ihr Fell, das sich vor Schreck gesträubt hatte, legte sich erst gerade wieder. Als sie bei sich zu Hause war, zwang sich Agatha, sich zu entspannen. Sie würde sich bei James für das zerbrochene Geschirr entschuldigen.
Am nächsten Tag war sie beschäftigt. Sie musste der Schuhfirma Bericht erstatten, einen Probenraum mieten und sich mit der Popgruppe treffen. Agatha hatte früher schon mit Bands zu tun gehabt und fand Stepping Out erfrischend angenehm. Die Gruppe bestand aus drei Männern und drei Frauen, alle knapp unter zwanzig. Sie wirkten gepflegt und gut gelaunt. Agatha hatte das Gefühl, aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Sie stürzte sich in die Arbeit, auch wenn in ihrem Hinterkopf eine schwarze Elendswolke allgegenwärtig blieb. Könnte sie sich doch nur jemandem anvertrauen. Aber niemand, niemand durfte wissen, dass Agatha Raisins Ehe gescheitert war.
Mehrmals überlegte sie, James anzurufen, um sich auszusprechen, sich zu entschuldigen. Doch jedes Mal zögerte sie. Wie in aller Welt konnte er so altmodisch sein? Und dennoch, dachte sie matt, hatte sie eine schreckliche Szene gemacht, sein Geschirr zertrümmert, sich wie ein Fischweib aufgeführt. Warum unterstellten die Leute Fischweibern eigentlich immer, gewalttätig zu sein und zu fluchen?, fragte sie sich. Welche Fischweiber überhaupt? Wahrscheinlich die, die in früheren Zeiten auf dem Fischmarkt in Billingsgate gestanden hatten.
Harry Best musterte sie. Sie ist ziemlich still, dachte er. Guck dir an, wie sie mitgeholfen hat, die ganze Ausrüstung in den Probenraum zu schleppen. Und wie schnell sie sich mit den jungen Leuten verstanden hat. Sie war nicht annähernd so abgebrüht, wie er sie sich anfangs vorgestellt hatte. Ja, manchmal sah sie fast so aus, als wäre sie den Tränen nah. Komische Frau.
Agatha bedauerte es, als der lange Tag zu Ende ging. Zwei der jungen Männer arbeiteten bereits an einer Art Wander-Popsong. »Scheut euch nicht, altmodisch zu sein«, hatte Agatha gesagt. »Und es muss fröhlich klingen, wie etwas, was die Leute pfeifen wollen, wenn sie einen Wanderweg entlangmarschieren.«
Auf der Rückfahrt nach Carsely wappnete sie sich für einen weiteren Streit mit James. Doch als sie sein Cottage betrat – sie betrachtete es nie als ihr gemeinsames –, war drinnen alles dunkel und still. Mit klopfendem Herzen lief sie nach oben ins Schlafzimmer und sah in den Wandschrank. Sämtliche Sachen von James waren noch da.
Sie setzte sich auf die Bettkante und fragte sich, was sie tun sollte. Wo könnte James sein? Wahrscheinlich im Pub.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, dorthin zu gehen. Vor allen Dorfbewohnern kann er mir schlecht eine Szene machen, dachte Agatha, die für einen Moment vergaß, dass sie gewöhnlich diejenige war, die die Szenen machte.
Sie ging in ihr eigenes Cottage, zog sich einen hellen Hosenanzug aus Seide an und wickelte sich eine bronzefarbene Lammwoll-Stola um die Schultern. Dann wanderte sie langsam zum Pub. Sie würde sich strahlend und heiter geben, als wäre nichts gewesen.
Allein die Tatsache, dass sie aktiv wurde, hellte ihre Stimmung auf, als sie unter den schweren Fliederblüten, die dem Weg seinen Namen gaben, entlangging. Agathas größte Schwäche war, dass sie sich keine Sekunde lang eingestehen würde, Angst vor James zu haben. Zwar würde sie ihre Furcht zugeben, ihn zu verlieren, doch dass sie sich vor ihm ängstigte, war etwas, was sie, die ihre Seele im Laufe der Jahre mit mehreren harten Schichten laminiert hatte, nicht einmal in Betracht ziehen würde. Ebenso wenig erkannte sie, dass die Liebe das Inakzeptable beinahe akzeptabel gemacht hatte – die Abweisungen, die Verachtung, das Schweigen, den Mangel an unbeschwerter, freundlicher Zuneigung.
Lächelnd betrat sie den Red Lion.
Und ihr Lächeln schwand sogleich.
James saß an einem Ecktisch beim Kamin, lachte und lächelte dann eine schlanke blonde Frau an, die Agatha als Melissa Sheppard erkannte. Während sie zu ihnen sah, beugte Melissa sich vor und drückte James’ Hand.
Wie Miss Simms, die Sekretärin des Frauenvereins, es später beschreiben sollte, »rastete« Agatha »komplett aus«. Säuerliche Eifersucht stieg in ihr auf. Innerhalb von Sekunden blitzte in ihrem Kopf all das Elend auf, das sie ertragen hatte. Sie schritt auf den Tisch zu und baute sich vor der erschrockenen Melissa auf. »Lassen Sie meinen Mann in Ruhe, Sie Schlampe!«
Melissa stand auf, griff nach ihrer Handtasche und huschte an Agatha vorbei zur Tür. Agatha beugte sich über den Tisch. »Du Mistkerl!«, schrie sie. »Ich bringe dich und diese ehebrechende Kuh um!«
James stand auf, sein Gesicht dunkelrot vor Zorn, und packte ihre Handgelenke. »Hör auf, eine Szene zu machen«, zischte er.
Agatha entwand sich ihm, nahm sein halb volles Bierglas auf, schüttete ihm den Inhalt über den Kopf und rannte nach draußen. Sie lief den ganzen Weg bis zu ihrem Cottage, wobei sie immer wieder auf dem Kopfsteinpflaster stolperte. Sobald sie sicher in ihrem Zuhause war, setzte sie sich in die Küche und weinte bitterlich.
Danach ging sie nach oben, wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser und legte frisches Make-up auf. James würde kommen, um den Streit fortzusetzen, und da wollte sie gerüstet sein.
Es läutete. Agatha strich sich übers Haar, straffte die Schultern und marschierte die Treppe hinunter.
»Na gut, hör zu …«, begann sie, während sie die Tür öffnete. Doch da stand nicht James, sondern ihr alter Freund, Sir Charles Fraith.
»Ich war nebenan, und James sagte mir, dass du hier bist«, sagte Charles. »Darf ich reinkommen?«
»Warum nicht?«, antwortete Agatha matt, drehte sich um und ging voraus in die Küche.
»Was ist los?«, fragte Charles, der ihr gefolgt war. »Sag nicht, dass deine Ehe schon im Eimer ist.«
»Sei nicht albern! Wir sind sagenhaft glücklich. Willst du etwas trinken?«
»Whisky, falls du welchen hast.«
Agatha war zwiegespalten. Einerseits wollte sie, dass Charles ging, für den Fall, dass James kommen sollte, andererseits wollte sie, dass er blieb, falls James es nicht tat. Sie ging ins Wohnzimmer, machte das Feuer an, das sie bereits vorbereitet hatte, und schenkte erst Charles großzügig ein, dann sich selbst.
Charles setzte sich aufs Sofa und betrachtete Agatha, die sich ihm gegenüber in einen Sessel fallen gelassen hatte.
»Hast du geweint?«
»Nein. Ich meine, ja. Ich hatte mich geschnitten.«
»Wo?«
»Wie, wo?«
»Aggie, lass den Quatsch. Die glücklich Verheiratete zu mimen, muss dich umbringen.«
Sie sah ihn schweigend an. Hier saß er, in ihrem Wohnzimmer, wo er schon so oft gesessen hatte, aalglatt, elegant und gelassen wie eine Katze.
Agatha zuckte mit den Schultern. »Okay, meinetwegen. Die Ehe ist ein Desaster.«
»Ich werde nicht sagen, ich habe es dir gleich gesagt.«
»Wag es ja nicht!«
»Ich schätze, das Problem ist, dass James einfach sein gewohntes Junggesellenleben weiterführen will, und da kommst du ihm mit deinen furchtbaren Kochkünsten und deinen ekligen Zigaretten in die Quere. Hat er schon an deiner Garderobe herumgemäkelt?«
»Macht er ständig. Woher weißt du das?«
»Es ist eine altbekannte Tatsache, dass verklemmte Männer, sobald sie das Objekt ihrer Begierde geheiratet haben, denselben Kleidungsstil kritisieren, der sie überhaupt erst angezogen hat. Ich wette, er hat dir gesagt, dass du keine hohen Absätze mehr tragen sollst und dein Make-up zu üppig ist.«
»Bin ich tatsächlich so blöd? Ich hätte es wissen müssen. Aber mir kam es vor, als hätten wir so vieles gemeinsam.«
Charles trank einen Schluck und schenkte ihr einen mitfühlenden Blick.
»Die Leute begreifen einfach nicht, dass Liebe tatsächlich blind macht. Sie halten sich für Seelenverwandte ihrer Angebeteten. Keine furchtbare Einsamkeit des Geistes mehr. Zwei gegen den Rest der Welt. Also wird geheiratet, und was passiert? Nach einer gewissen Zeit blicken beide über den Frühstückstisch und stellen fest, dass sie einen Fremden vor sich haben.«
»Aber es gibt glückliche Ehen. Das weißt du.«
»Einige sind glücklich. Doch die meisten Menschen gehen einen Kompromiss ein.«
»Heißt das, ich sollte mich so anziehen, wie James es will, und so leben, wie James es sich wünscht?«
»Wenn du verheiratet bleiben möchtest. Oder geh zu einem dieser Eheberater.«
»Ich verstehe nicht, wie ein Junggeselle wie du irgendetwas über die Ehe wissen kann.«
»Kluger Einwand.«
Agatha griff sich ins Haar. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe eine Szene im Pub gemacht. James hat mit dieser Melissa geflirtet, und zufällig weiß ich, dass er mal was mit ihr hatte.«
»James ist eigentlich kein übler Kerl. Wahrscheinlich geht ihm nur deine Art gegen den Strich. Du kannst einen schon ein bisschen überfahren.«
»Du kennst ja noch nicht die ganze Geschichte. Er will nicht, dass ich arbeite!«
»Und tust du das? Arbeiten, meine ich.«
»Ich habe einen kurzen, befristeten Vertrag mit einer Schuhfirma in Mircester. James ist an die Decke gegangen. Er hat gesagt, ich soll die Arbeit denen überlassen, die sie brauchen.«
»Vielleicht solltet ihr beide wieder getrennt leben und euch gelegentlich verabreden.«
»Ich bekomme das hin«, sagte Agatha plötzlich. »Ich liebe James. Er muss bloß zur Vernunft gebracht werden.«
»Redet er mit jemandem über seine Probleme?«
Agatha lachte. »James? Nie im Leben!«
In diesem Moment saß James im Wohnzimmer des Pfarrhauses der Vikarsfrau, Mrs. Bloxby, gegenüber.
»Ist es nicht zu spät für einen Besuch?«, fragte James.
»Nein, ganz und gar nicht«, sagte Mrs. Bloxby. Es amüsierte sie, dass James ihren Aufzug – Nachthemd und Morgenmantel – überhaupt nicht zu bemerken schien.
»Ich weiß ehrlich nicht, was ich wegen Agatha tun soll«, sagte James. »Ich mache mir große Sorgen.«
»Was ist denn los? Möchten Sie vielleicht einen Tee oder etwas Stärkeres?«
»Nein, ich habe nur das Gefühl, wenn ich nicht mit jemandem rede, platze ich. Und Sie sind eine Freundin von Agatha.«
»Eine gute, hoffe ich.«
»Hat sie Ihnen irgendwas über unsere Ehe erzählt?«
»Hätte sie sich bei mir beklagt, würde ich es Ihnen nicht erzählen. Allerdings hat sie das nicht. Worum ging es bei der Szene im Pub? Es ist schon im ganzen Dorf herum.«
»Ich ging in den Pub, und da war Melissa, also haben wir zusammen etwas getrunken. Agatha kam rein und machte eine Eifersuchtsszene.«
»Das ist verständlich. Es ist allgemein bekannt im Dorf, dass Sie vor Ihrer Heirat eine … ähm … Episode mit Melissa hatten.«
»Schon, aber es geht auch um all die anderen Sachen. Sie ist eine lausige Hausfrau.«
»Sie hat Doris Simpson, die für sie putzt, zumindest in ihrem eigenen Cottage. Warum lassen Sie Doris nicht auch bei sich putzen?«
»Aber das müsste Agatha machen.«
»Sie sind sehr altmodisch. Von einer Frau, die beruflich sehr erfolgreich war und immer jemanden bezahlt hat, der für sie Ordnung hält, können Sie nicht erwarten, dass sie auf einmal für Sie putzt.«
James fuhr fort, als hätte sie nichts gesagt: »Und dann weiß sie, dass ich Zigarettenqualm hasse, aber immerzu riecht sie danach.«
»Mrs. Raisin rauchte bereits, als Sie ihr zum ersten Mal begegnet sind und auch als Sie beide geheiratet haben.«
»Doch da hatte sie versprochen aufzuhören. Sie hat gesagt, dass sie es lassen würde. Und sie hat gesagt, dass sie nie in meinem Cottage rauchen würde. Aber sie pafft, sobald sie denkt, dass ich nicht hinsehe.«
»Sie sagen ›mein Cottage‹. Das ist eine eigenartige Ehe. Warum haben Sie Mrs. Raisin nicht überredet, ihr Cottage aufzugeben?«
»Weil meines zu klein ist.«
»Sie beide haben doch gewiss genug Geld, um Ihre Häuser zu verkaufen und in ein größeres zu ziehen.«
»Kann sein. Jetzt hat sie einen Job angenommen. Einen PR-Job für irgendeine Schuhfirma in Mircester.«
»Und was ist damit?«
»Agatha muss nicht arbeiten.«
»Ich denke, hin und wieder braucht Mrs. Raisin ihre Arbeit. Vielleicht haben Sie ihr das Gefühl gegeben, als Ehefrau gescheitert zu sein. Beschweren Sie sich oft?«
»Nur, wenn sie etwas falsch macht, und jedes Mal sieht sie mich dann wütend an und wird ausfallend.«
»Und macht sie oft etwas falsch?«
»Immerzu – mieses Essen, schlampige Hausarbeit, aufreizende Kleidung …«
Mrs. Bloxby hob eine Hand in die Höhe. »Moment mal. Mrs. Raisins Kleidung ist aufreizend? Nein, wirklich, das kann ich nicht hinnehmen. Sie ist immer sehr schick angezogen. Und mir scheint, dass Sie sich sehr viel beschweren und nicht bereit sind, irgendwelche Kompromisse zu machen. Ich weiß, dass Sie ein überzeugter Junggeselle waren, aber jetzt sind Sie verheiratet und müssen gewisse Zugeständnisse machen. Warum sind Sie so wütend und empfindlich?«
Für längere Zeit schwieg James, bis er seufzte und antwortete: »Da ist noch etwas anderes. Ich habe diese wiederkehrenden Kopfschmerzen, deshalb war ich zum Scan. Wie sich herausstellte, habe ich einen Hirntumor, und bald beginnt die Behandlung.«
»Oh, Sie armer Mann! Ist er operabel?«
»Sie wollen es zuerst mit Chemotherapie versuchen.«
»Mrs. Raisin muss verzweifelt sein.«
»Sie weiß es nicht, und Sie dürfen ihr auch nichts davon sagen.«
»Aber Sie müssen es ihr erzählen. Darum geht es doch in einer Ehe, dass man die guten wie die schlechten Zeiten teilt.«
»Ich habe das Gefühl, wenn ich es ihr erst erzähle, gibt es keine Hoffnung mehr für mich. Es würde den Tumor zur Realität machen. Ich muss das allein durchstehen.«
»Aber ich sehe doch, unter welchen Druck Sie das Ganze setzt. Genau genommen zerstören Sie Ihre Ehe, indem Sie es Mrs. Raisin nicht sagen.«
»Sie erzählen es ihr nicht! Das müssen Sie mir versprechen!«
»Na gut. Aber ich bitte Sie, überlegen Sie es sich noch mal. Mrs. Raisin verdient es nicht, so von Ihnen behandelt zu werden. Reden Sie mit ihr.«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist mein Kreuz, und das trage ich allein. Agatha ist sehr eigenständig. Sie benutzt ja sogar noch ihren alten Namen, als sei meiner nicht gut genug für sie. Sogar Sie nennen sie Mrs. Raisin.«
»Weil sie mich darum gebeten hat. Und sie hätte vielleicht auf Sie gehört, hätten Sie sich nur über diese eine Sache beschwert, aber Sie scheinen sie sehr viel zu kritisieren.«
»Es ist ihre Schuld«, sagte James trotzig. »Ich gehe dann mal lieber.«
»Bleiben Sie bitte noch einen Moment. Sie müssen entsetzlich besorgt und verängstigt sein.«
James, der sich schon halb aufgerichtet hatte, sank in seinen Sessel zurück und vergrub das Gesicht in den Händen.
»Mrs. Raisin wäre eine große Hilfe«, sagte Mrs. Bloxby sanft.
»Ich hätte sie niemals heiraten dürfen«, murmelte James.
»Vermutlich waren Sie in sie verliebt.«
»Oh ja, aber sie ist so chaotisch und schnell verärgert.«
»Ich glaube, dass Sie so hart mit ihr ins Gericht gehen, weil Sie krank sind und Angst haben.«
James stand auf. »Ich werde darüber nachdenken.«
Auf dem Heimweg wurde ihm beschämt bewusst, dass er wohl zu viel über Agathas Fehler geredet hatte. Er brauchte nichts weiter zu tun, als zu ihr zu gehen und ihr zu erzählen, was mit ihm war. Doch als er in die Lilac Lane einbog, erkannte er den Wagen vor Agathas Cottage. Er gehörte Sir Charles Fraith. Und der war immer noch bei ihr! Also war Agatha wieder in ihre alten Muster verfallen. Nun, das konnte er auch!
Zwei
Die Tatsache, dass Agatha und ihr Frischangetrauter in getrennten Cottages lebten und nicht miteinander sprachen, verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer. Mrs. Bloxby hielt den Mund, was James’ Hirntumor anging. Nicht mal ihrem Mann, dem Vikar Alf Bloxby, erzählte sie davon. Er hatte auf die Neuigkeit, dass Agathas Ehe gescheitert schien, lediglich angemerkt: »Ich verstehe sowieso nicht, wie irgendjemand mit dieser Frau zusammenleben kann.«
James wurde oft mit Melissa Sheppard gesehen, Agatha mit Charles.
Dieser elende Zustand hätte ewig anhalten können, wäre James nicht zu einem Sinneswandel gekommen. Er fürchtete, dass er sterben müsse, und er wollte nicht von dieser Welt scheiden und nichts als Verbitterung und Unglück hinterlassen. Man sollte ihn vermissen, um ihn trauern.
Daher kaufte er einen großen Strauß roter Rosen und erschien eine Woche nach dem, was im Dorf »Die große Szene im Pub« genannt wurde, vor Agathas Tür.
Agatha öffnete und stand für einen Moment nur da, sah erst ihn und dann den Blumenstrauß in seinen Händen an. »Komm rein«, sagte sie und ging voraus in die Küche, ohne abzuwarten, ob er ihr folgte oder nicht.
»Setz dich.« Sie lehnte sich an die Arbeitsplatte. »Warum bist du gekommen?«
Die richtige, die vernünftige Antwort wäre gewesen: »Agatha, ich habe einen Hirntumor, und ich glaube, dass ich sterben werde.« Stattdessen sagte James: »Du siehst furchtbar aus.«
Agatha hatte deutliche Tränensäcke unter den Augen, und ihr sonst schimmerndes Haar war stumpf. Noch dazu trug sie ein weites gemustertes Hauskleid und flache Sandalen.
»Ich habe sehr viel gearbeitet. Kaffee?«
»Ja, gerne.«
»Ist aber richtiger«, sagte Agatha und stöpselte die Kaffeemaschine ein. »In diesem Haus gibt es keinen bleifreien.«
»In Ordnung.« James streckte seine langen Beine aus.
Agatha setzte sich ihm gegenüber. Als hätten sie es wortlos verabredet, schwiegen beide, bis der Kaffee durchgelaufen war. Agatha schenkte zwei Becher ein und sah James an.
»Triffst du dich noch mit diesem Flittchen Melissa?«
»Ich hatte das Gefühl, dass ich Gesellschaft brauche, solange du dich mit Charles Fraith herumtreibst.«
»Charles ist nur ein Freund.«
»Das ist ja mal ganz was Neues«, sagte James säuerlich. »Auf Zypern hattest du eine Affäre mit ihm.«
»Das war, bevor wir geheiratet haben. Und du hattest eine Affäre mit Melissa.«
»Wir sind nur befreundet«, erwiderte James steif. »Du solltest nicht arbeiten. Du musst nicht arbeiten. Du siehst schrecklich aus.«
»Nun, du Inbegriff von Schönheit und Wohlbefinden, hast du nicht ewig genörgelt, weil ich mich schminke und hohe Schuhe trage? Du solltest glücklich sein. Warum bist du hergekommen? Um wieder an mir herumzumäkeln?«
»Ich dachte, dass wir unserer Ehe noch eine Chance geben sollten«, antwortete James.
»Warum?«
»Weil ich niemand bin, der schnell aufgibt, und du genauso wenig.«
»Hättest du nicht sagen können, weil du mich liebst?«
»Agatha, du weißt, wie ich bin. Ich war nie gut in so was.«
»Na schön, ich versuche es noch mal. Aber du musst aufhören, Melissa zu sehen.«
»Sie ist eine Freundin.«
»Ich werde aufhören, Charles oder irgendeinen anderen Mann zu treffen, wenn du das Gleiche mit Melissa tust.«
»Abgemacht.«
Plötzlich lächelte Agatha ihn an. »Was für Trottel wir sind«, sagte sie glücklich. »Warte hier, bis ich mich geschminkt habe. Auch wenn du so was nicht nötig hast, James. Was ich an dir so liebe, ist, dass du immer so fit und gesund aussiehst.« Sie verließ die Küche. Ich hätte es ihr sagen sollen, dachte James. Aber heute Abend werden wir zusammen essen. Dann erzähle ich es ihr.