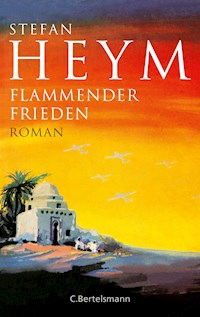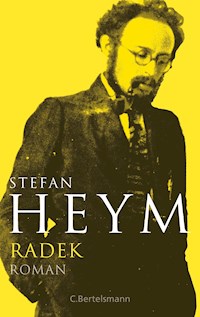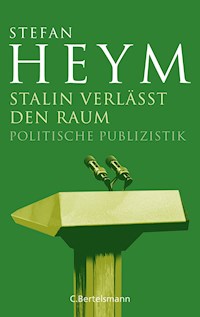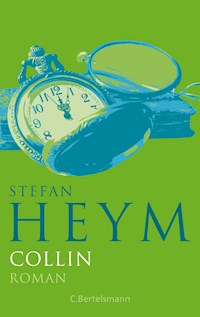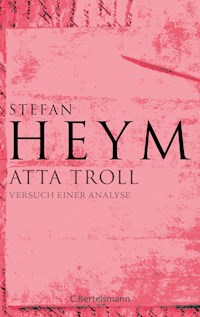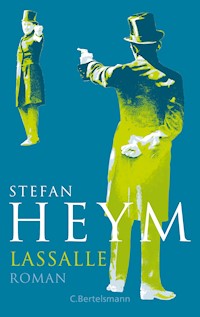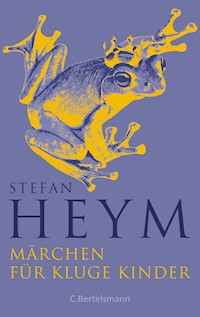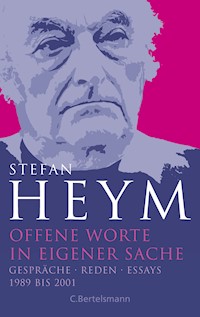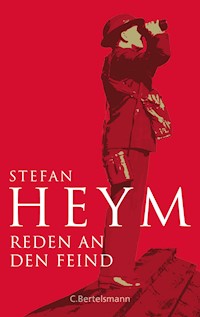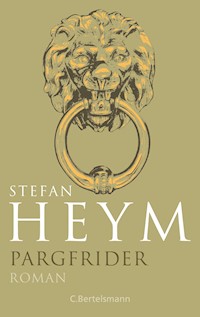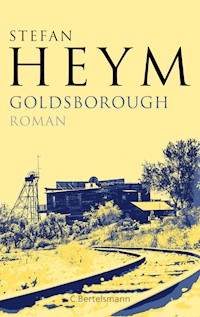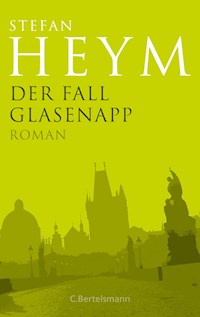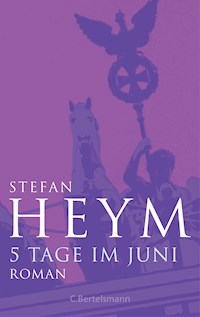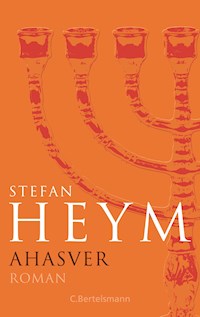
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Es ist die Legende des »ewigen Juden«: Weil er Jesus auf dem Weg zur Kreuzigungsstätte nicht vor seiner Haustür ruhen lässt, wird Ahasver, der Schuster von Jerusalem, verflucht, bis zu Jesus' Wiederkunft rastlos auf Erden zu wandern. Stefan Heym, einer der herausragendsten Schriftsteller der ehemaligen DDR, erzählt den Mythos neu: Bei ihm ist Ahasver ein gestürzter Engel, der die Hoffnung auf Befreiung der geknechteten Menschheit nie aufgibt und in immer neuer Gestalt für eine bessere Welt kämpft. Ein Roman voll sinnlicher Wucht, zwischen Legende, Lutherzeit und einem brillant karikierten Politleben der DDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Ähnliche
Zum Buch:
Es ist die Legende des »ewigen Juden«: Weil er Jesus auf dem Weg zur Kreuzigungsstätte nicht vor seiner Haustür ruhen lässt, wird Ahasver, der Schuster von Jerusalem, verflucht, bis zu Jesus› Wiederkunft rastlos auf Erden zu wandern. Stefan Heym, einer der herausragendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, erzählt den Mythos neu: Bei ihm ist Ahasver ein gestürzter Engel, der die Hoffnung auf Befreiung der geknechteten Menschheit nie aufgibt und in immer neuer Gestalt für eine bessere Welt kämpft. Ein Roman voll sinnlicher Wucht, zwischen Legende, Lutherzeit und einem brillant karikierten Politleben der DDR.
»Man spürt, dass Stefan Heym mit Herzblut geschrieben hat. Was für ein Stoff, verglichen mit der thematischen Anämie so vieler Gegenwartsromane.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Ein großartiges Buch.« Der Spiegel
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Ahasver
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1981 Inge Heym
Copyright © der Originalausgabe 1981 by C. Bertelsmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © dieser Ausgabe 2021
C. Bertelsmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und Gestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Alexey Medvednikov / Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27822-9V004
www.cbertelsmann.de
Erstes Kapitel
In welchem berichtet wird, wie Gott zur Freude der Engel den Menschen erschuf, und zwei Revolutionäre in einer Grundsatzfrage verschiedener Meinung sind
Wir stürzen.
Durch die Endlosigkeit des oberen Himmels, des feurigen, der aus Licht ist, aus dem gleichen Licht, von dem unsere Kleider gemacht waren, deren Glorie von uns genommen wurde, und ich sehe Lucifer in all seiner Nacktheit, und in seiner Häßlichkeit, und mich schaudert.
Bereust du? sagt er.
Nein, ich bereue nicht.
Denn wir waren die Erstgeborenen, erschaffen am ersten Tag, zusammen mit all den Engeln und Erzengeln, den Cheruben und Seraphen, und den Ordnungen und Heeren der Geister, erschaffen aus Feuer und dem Hauch des Unendlichen, in niemandes Bild und Gleichnis, erschaffen, bevor noch die Erde geschieden war von den Himmeln, und die Wasser von den Wassern, bevor Finsternis und Licht waren und Nacht und Tag und Winde und Stürme, wir, die Unruhe, das ewige Kreisen über den Sphären, die ewige Veränderung, das Schöpferische.
Welch eine Kreatur! sagt er. Ein Mensch!
Und dabei fing es so ungeheuerlich groß an, so als schicke die Welt sich an, eine neue Welt zu gebären. Die Stimme im Raum, Seine Stimme, am sechsten Tag, um die zweite Stunde: Wohlan, laßt uns den Menschen nach unserm Bild, nach unserm Gleichnis machen. Uns! … Aber Er war’s, Seine einsame Entscheidung, wir hatten kein Teil daran. Die Engel aber befiel eine große Furcht und ein Zittern, und sie sprachen: Heute zeigt sich uns ein Wunder, die Gestalt GOttes, unseres Schöpfers, denn in Seinem Bild und Gleichnis erschafft Er den Menschen.
Und ich sehe Lucifer, wie er sich mir zuwendet im Sturze und den Mund höhnisch verzieht. Aus Staub! sagt er.
Das Wunder aber hub an wie all Seine Wunder, erschreckend und großartig anzuschauen, indem aus dem Raum die Rechte GOttes sich streckte und über die ganze Welt ausbreitete, und alle Geschöpfe versammelten sich in Seiner rechten Hand. Dann jedoch schrumpften die Ausmaße, und wie ein Magier seine Ingredienzien hervorholt, Pülverchen und Härchen und Knöchlein, oder die Köchin ihr Mehl, ihre Eier, ihr Öl, so sahen wir, wie Er aus der ganzen Erde ein Staubkörnchen nahm, und von allen Wassern ein Wassertröpfchen, und von aller Luft oben ein Windlüftchen, und von allem Feuer ein wenig Hitze, und wie Er diese vier schwachen Elemente, Kälte, Wärme, Trockenheit und Feuchtigkeit, in Seine hohle Handfläche legte, und wie Er daraus den Adam bildete.
Und wir sollten ihm dienen, sagt Lucifer, mir immer noch zugewandt, und sollten des Menschen eigen sein, die Knie vor ihm beugen und ihn verehren!
Denn so sprachen die Engel angesichts des neuen Adam: Zu welchem Zweck schuf GOtt ihn aus diesen vier Elementen, wenn nicht dazu, daß ihm alles in der Welt gehörig sei? Er nahm ein Körnchen von der Erde, damit alle Kreaturen aus Staub dem Adam dienen, einen Tropfen Wasser, damit alles in den Meeren und Flüssen sein eigen, einen Hauch aus der Luft, damit alle Arten in der Luft ihm anheimgegeben, und Hitze vom Feuer, damit alle Feuerwesen und Geister und Gewalten ihm untertan seien. Preiset den HErrn in der Höhe.
Oh, dieser endlose Sturz ohne Zeit, ohne Grenzen, durch immer das gleiche, gleißende Licht. Wo sind das Oben und Unten, wo das Firmament mit den Sternen, den Wolken, der Süßigkeit des Mondes, wo die Tiefen, das Reich des Lucifer, wo die Erde, darauf Fuß zu fassen, wo die ausgestreckte Rechte GOttes?
Schön anzusehen war er, sagt Lucifer, aber aus Staub, – ein Geschöpf des sechsten Tages.
Schön war er, der Mensch Adam, selbst ich war von der Schönheit des Anblicks bewegt, da ich seines Angesichts Gebilde sah, wie es in herrlichem Glanz entflammt war, dann seiner Augen Licht, gleich dem der Sonne, und seines Körpers Schimmer, gleich dem des Kristalls. Und er dehnte sich und stand mitten auf der Erde, auf dem Hügel Golgatha, dort zog er das Gewand des Königtums an, und dort ward ihm die Krone der Herrlichkeit aufs Haupt gesetzt, König, Priester und Prophet er, dort gab ihm GOtt die Herrschaft über uns alle. Lucifer aber, das Haupt der unteren Ordnung, der Herr über die Tiefen, sprach zu uns: Verehret ihn nicht und preiset ihn nicht mit den Engeln! Ihm ziemt es, uns zu verehren, uns, die wir Feuer und Geist sind; aber nicht uns, daß wir den Staub verehren, der aus einem Staubkörnchen gebildet ist. Da erhob sich die Stimme GOttes und redete zu mir und sprach: Und du, Ahasver, was soviel ist wie der Geliebte, willst du dich nicht neigen vor Adam, den Ich Mir zum Bilde und zum Gleichnis schuf?
Und ich blickte hin zu Lucifer, der vor dem HErrn stand, aufrecht und riesig und dunkel wie ein Berg, und die Faust hob, daß sie das Firmament durchstieß, und ich antwortete GOtt: Weswegen drängst Du mich, o HErr? Ich werde den doch nicht verehren, der jünger und geringer ist als ich. Eh er geschaffen ward, ward ich geschaffen, er bewegt die Welt nicht, aber ich bewege sie, zum Ja und zum Nein, er ist Staub, aber ich bin Geist. Lucifer aber sagte: Zürne uns nicht, o HErr, denn wir waren Dein Reich und Deine Schöpfung, deren Pläne unendlich sind, und Deine Harmonie, zu welcher alle Klänge gehören. Dieser aber, trotz seines glatten Gesichts und seiner feinen Gliedmaßen, ist wie ein Ungeziefer und wird sich vermehren wie die Läuse und aus Deiner Erde einen stinkigen Sumpf machen, er wird das Blut seines Bruders vergießen und seinen Samen in niedere Tiere verspritzen, in Esel und Ziegen und Schafe, und mehr Sünden begehen, als ich je erfinden könnte, und wird ein Spott und Hohn sein auf Dein Bild, o HErr, und Dein Gleichnis. Bestehst Du aber auf Deinem Willen, GOtt, daß wir den Adam verehren und unser Knie beugen vor ihm, nun denn, so stell ich meinen Thron über des Himmels Sterne und bin selbst dem Höchsten gleich. Und da dies die anderen Engel hörten, die dem Lucifer unterstanden, da weigerten auch sie sich, den Adam zu verehren.
Seither stürzen wir, Lucifer und ich und die anderen, seit dem sechsten Tag um die dritte Stunde, denn GOtt in Seinem Zorn zog Seine Rechte ab von uns, in der wir versammelt waren, den Adam aber ließ Er auffahren zum Paradies in einem feurigen Wagen, während die braven Engel vor ihm lobsangen und die Seraphe ihn heiligten und die Cherube ihn segneten.
Es wird Ihm schon bald leid sein, sagt Lucifer, denn uns verstößt man nicht ohne Schaden. Er braucht das Nein, wie das Licht das Dunkel braucht. So aber werde ich in den Tiefen hocken, in dem Raum Gehennah, und alles wird mählich zu mir kommen, denn eines zieht das andere nach sich, und was von Staub ist, muß wieder zu Staub werden, es ist nichts von Dauer.
Womit er die Arme breitet und mich im Fluge berührt fast mit Zärtlichkeit.
Ah, sage ich, aber es war eine so große Hoffnung, und es ist mir leid um die Mühe. Eine so schöne Welt! Ein so schöner Mensch!
Daß du’s nicht sein lassen kannst, sagt er. ER verstößt dich, aber du jammerst Ihm nach und Seinen Werken.
Alles ist veränderbar, sage ich.
Aber es ist so ermüdend, sagt er.
Und damit trennten wir uns, und er nahm seinen Weg und ich, Ahasver, was soviel ist wie der Geliebte, den meinen.
Zweites Kapitel
Worin der junge Eitzen im Schwanen zu Leipzig einiges über die Zeitläufte erfährt und einen Reisekameraden erhält, der ihm fürs Leben bleibt
’s ist doch wohl was Übernatürliches an der Begegnung von zwei Menschen, wo der eine gleich weiß, dies ist für’s Leben, oder doch einen beträchtlichen Teil davon, und auch der andere spürt, da ist einer gekommen, der von Bedeutung für ihn sein wird.
Dabei könnt keiner rechtens behaupten, der junge Herr Paulus von Eitzen, der auf dem Weg nach Wittenberg ist, in Leipzig aber Station gemacht hat im Schwanen, war so ein Sensibler oder hätte gar das zweite Gesicht. Eher im Gegenteil. Trotzdem er noch Flaum trägt auf seinen Wangen, hat er schon was Vertrocknetes an sich, so als hätte er nie von den bunten Dingen geträumt, die unser einer gemeinhin im Kopfe hat, wäre er noch in den Jahren. Daher sind’s auch nicht etwa hochfliegende Gedanken oder die schönen Bilder der Phantasie, die er beim Eintritt des Fremden in die Gaststube unterbricht, sondern nüchterne Berechnungen, wieviel etwa ihm zufallen würde von der Erbtante in Augsburg, welcher er im Auftrag seines Hamburger Vaters, des Kaufmanns Reinhard von Eitzen, Tuche und Wolle, einen Besuch abgestattet hat.
Der Fremde hat sich umgeblickt in dem überhitzten Raum, in dem der Geruch von Schweiß und Knofel über den Köpfen hängt und der Lärm der Gäste ein gleichförmiges Geräusch bildet ähnlich dem des Wassers, das aus großer Höhe übers Gestein herabstürzt, nur dem Ohr weniger angenehm. Nun kommt er auf den jungen Herrn von Eitzen zugehinkt und sagt: »Gott zum Gruß, Herr Studiosus, ist’s Euch wohl recht«, und zieht einen Schemel heran und setzt sich neben ihn.
Der von Eitzen aber, obzwar mißtrauisch und sofort nach seinem Säckel schielend, das er innen am Leibgurt trägt, fühlt schon, daß er nicht so leicht loskommen wird von diesem da, und rückt ein wenig beiseite und sagt, auch weil der ihn sofort als Studiosus angeredet: »Kenn ich Euch nicht?«
»Ich hab so ein Gesicht«, sagt der Fremde, »da glauben die Menschen, sie hätten mich irgendwo schon gesehen, ein Allerweltsgesicht, mit einer Nase drin und einem Mund voll Zähne, nicht sämtlich gut, und Augen und Ohren, was so dazugehört, und einem schwarzen Bärtchen.« Und bläht, während er spricht, die Nüstern und verzieht die Lippen, so daß die Zähne sich zeigen, davon ein oder zwei schwärzlich verfärbt, und blinkt mit den Augen und zupft sich erst die Ohren, dann das Bärtchen, und lacht, doch ohne Freude darin, ein Lachen, das ihm eigen.
Der junge Eitzen verfolgt das lebhafte Mienenspiel des anderen, sieht aber auch dessen merkwürdig verkrümmten Rücken und verformten Fuß und denkt, nein, ich kann ihn doch wohl nicht kennen, denn an so einen erinnert man sich, der haftet im Gedächtnis; dennoch bleibt da ein Rest von dem, was sie in Frankreich déjà vu nennen, und er ist seltsam beunruhigt, besonders da der Fremde nun sagt: »Ich seh, Ihr seid auf dem Weg nach Wittenberg, das kommt mir gut zupaß, da will ich auch hin.«
»Woher wißt Ihr?« fragt Eitzen. »Es kommen ihrer viel durch Leipzig und steigen im Schwanen ab und reisen weiter in alle Richtungen.«
»Ich hab einen Blick dafür«, sagt der Mensch. »Die Leute staunen oft, was ich weiß, geht aber alles mit natürlichen Dingen zu, Erfahrung, versteht Ihr, junger Herr, Erfahrung!« Und lacht wieder auf seine Art.
»Ich hab einen Brief an Magister Melanchthon«, sagt Eitzen, als triebe ihn etwas, sich dem anderen aufzutun, »von meiner Erbtante in Augsburg, da ist der Magister Melanchthon vor einem Jahr gewesen und war bei ihr zu Gast und hat sich delektiert, sechs Gänge hat er in sich hineingeschlungen, obwohl, wie meine Tante sagt, er ganz dürr ist und niemand weiß, wo er’s wegstaut, sechs Gänge und eine Mehlspeise mit Apfelscheiben zum Nachtisch.«
»Ja, die geistlichen Herrn«, sagt der andere, »die können’s wohl in sich hineinstopfen, unser Herr Doktor Martinus Luther besonders, aber bei dem sieht man’s, er ist schon ganz rot im Gesicht immer, er frißt sich noch zu Tode.«
Der junge Eitzen, pikiert, verzieht den Mund.
Der Fremde klopft ihm beschwichtigend auf die Schulter. »’s ist nicht auf Euch persönlich gemünzt. Ich weiß, auch Ihr habt die geistliche Laufbahn gewählt, aber Ihr seid ein maßvoller Mensch, und so Ihr einst sterben werdet, hochbetagt, werden die lieben Englein leicht zu tragen haben, wenn Sie Euch himmelwärts nehmen.«
»Ich gedenk des Todes nicht gern«, sagt der junge Eitzen, »und meines eigenen schon gar nicht.«
»Was, nicht der ewigen Seligkeit?« Der andere lacht wieder. »Die doch Ziel und Streben jedes Christenmenschen sein soll, und wo man in ewigem Glanze schwebt, in unvorstellbaren Höhen, noch weit, weit, weit über dem Firmament?«
Das dreimalige »Weit« des Fremden läßt Eitzen erschauern. Er versucht das mit seinem Verstand zu begreifen, solch große Höhen und solch großen Glanz, doch reicht es dazu nicht aus in seinem beschränkten Hirn; wenn der junge Paulus von Eitzen sich überhaupt Vorstellungen macht vom ewigen Leben, dann ähnelt die Lokalität eher dem väterlichen Hause, nur viel, viel geräumiger und prächtiger, und der liebe Gott hat den schlauen Blick und die weltgewandte Manier des Kaufmanns Reinhard von Eitzen, Tuche und Wolle.
Jetzt läutet endlich die lang schon erwartete Glocke zum gemeinsamen Abendmahl. Ein Hausknecht, schwarze Rillen im Nacken, das ungewaschene Hemd offen über der schweißigen Brust, müht sich, die Tische zusammenzuschieben zu zwei Tafeln, an denen man hoffentlich bald speisen wird; die Kasten und Koffer der Reisenden werden zur Seite gestoßen, ihre Bündel, wo sie ihr Besitzer nicht sofort greift, im Bogen zur Wand geworfen, Staub wirbelt auf und Asche aus dem Kamin, die Leute husten und niesen.
Der junge Herr von Eitzen, gefolgt von seinem neuen Freund, der sich an ihn geheftet, begibt sich zur Mitte der oberen Tafel; dort werden später die Schüsseln stehen, das weiß er, und dort gebührt ihm als Sohn aus wohlhabendem Hause ein Platz. Macht ihm auch keiner streitig, am wenigsten der neue Freund mit dem Hinkefuß und dem kleinen Puckel. Zu Eitzens anderer Seite setzt sich einer, der hat keine rechte Hand; Eitzens Auge fällt auf den Armstumpf, die rote, knotige Haut über dem Knochen; wie soll ein Mensch seine Speise schlucken können mit dem Ding da vor der Nase, aber jetzt sitzen die Gäste schon zu Tisch, eng verkeilt, kein freies Plätzchen mehr. Auch beobachtet ihn der neue Freund, grinst spöttisch und flüstert ihm zu: »Sind viele gewesen damals, die die Hand erhoben gegen die Obrigkeit; die wollten hoch hinaus; der Kerl hat Glück noch gehabt, daß man ihn nur um die Hand gekürzt hat und nicht um den Kopf.«
Der junge Eitzen, dem anfänglich nicht ganz geheuer gewesen angesichts des vielen Wissens des Fremden, hat die Scheu nun verloren; wundert sich nur noch, wie alt der wohl sei, denn die Zeit, da man sich erhob gegen die Obrigkeit und dafür um die Hand oder den Kopf kürzer gemacht ward, ist fast schon ein Menschenalter her; doch der neue Freund läßt seine Jahre nicht erkennen, könnt fünfundzwanzig sein oder fünfundvierzig. Nun zieht der ein Messerchen aus der Tasche, das zierlich gearbeitet ist, der Griff aus rosa Koralle und zeigend ein nacktes Weib en miniature, perfekt bis in die Einzelheiten; der junge Eitzen errötet; so, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und ein Knie angehoben, hat die Hur dagelegen, die ihm das Vögeln beigebracht nach drei, vier vergeblichen Versuchen; aber diese auf dem Messergriff ist viel schöner noch, und eine solche Kostbarkeit trägt der andere in seiner Tasche, und sieht dabei gar nicht aus wie einer, der Geld hat im Überfluß.
Inzwischen hat der Knecht die Tischtücher aufgelegt aus grobem Leinen, das lange nicht gewaschen und die Menüs zumindest der vergangenen Woche zeigt: Flecke getrockneter Suppe, ein paar Fädchen Fleisch, und anderes, das von irgendwelchem Fisch herrühren mag; man breitet die Ränder des Tischtuchs über den Hosenlatz und den Schoß, mancher schiebt sie sich sogar in den Gurt: besser das Tuch verdreckt als die Hose. Der junge Eitzen beäugt die Holzschale, die man ihm hingestellt hat, den Holzlöffel, den zerbeulten zinnernen Becher, und sieht sich um im Kreis, wer wohl die französische Krankheit hat oder die spanische Krätze; aus dem Maul stinken so gut wie alle und jucken sich unterm Arm und am Knie und kratzen den Schädel, vielleicht aber auch nur aus Langeweile, denn die Suppe läßt auf sich warten und der Wein auch; man hört den Wirt in der Küche mit den Weibern schimpfen, dabei hat es geheißen, der Schwanen sei der besseren Gasthäuser eines und alle wären hier immer zufrieden gewesen. Dafür beginnen die Zoten zu fliegen von einer Seite der beiden Tafeln zur anderen, über Herrn Pfarrer und seine Köchin, und wie sie’s so arg getrieben. Das wieder ärgert den jungen Eitzen, denn er nimmt seinen Glauben ernst und weiß, seitdem Herr Doktor Martinus Luther seine Thesen anschlug zu Wittenberg, haben die Pfarrer ihre Köchinnen immer brav geehelicht.
Bis die Suppe doch gebracht wird, eine große runde Schüssel, sogar mit Fetzen von Fleisch und Fett darin. Nach dem lauten Gedränge beim Einschenken, auch der mit dem Armstumpf entwickelt großes Geschick mit der Kelle, ist nur noch das Schnaufen und Schlürfen zu hören, und das leise Lachen von Eitzens puckligem Nachbarn, der zu ihm sagt: »Seht Ihr, junger Herr, ’s ist doch nicht viel anders mit dem Menschen als mit dem Vieh, und man fragt sich so manches Mal, was Gott denn wirklich im Sinne gehabt, da er diese da schuf als sein Meisterwerk und sich selber zum Ebenbild.«
Der mit dem Armstumpf wirft schmatzend ein: »Ein böser Gott ist das und ein ungerechter, der die Armen straft und die Mächtigen belohnt, so daß einer glauben möchte, daß über diesem fehlerhaften Gott noch ein Höherer sein muß, ein ganz Ferner, der eines Tages Licht bringen wird für uns alle.«
Da läuft dem jungen Eitzen die Galle denn doch über; er springt auf, sein Ende des Tischtuchs mit sich reißend, so daß die noch halbvollen Suppenschalen ringsum ins Schwappen geraten, und ruft aus: »Oh, ihr Lästerer Gottes und seiner Gerechtigkeit, die ihr nicht sehen wollt, daß wieder eine Ordnung eingezogen ist wie im Himmel so auch auf Erden!« Und da alle still geworden sind und weiterer Offenbarungen harren, breitet sich plötzlich Leere aus im Schädel des jungen Eitzen, und er weiß nicht weiter und verschluckt sich am eigenen Speichel, und hier und dort zunächst, dann aber von allen Seiten erhebt sich ein Gelächter, das andauert, bis der Wirt mit dem Fleisch kommt und alle in die Schüsseln greifen, um ihres zu ergattern, der junge Herr von Eitzen an der Spitze. Dazu trinken sie den sauren Wein vom Tal des Flusses Saale und werden heiß und fröhlich von Speis und Trank, und Eitzen wundert sich über seinen puckligen Nachbarn zur Rechten, mit welcher Grazie der ißt, nur drei seiner Finger benutzend, nachdem er sein Brot säuberlich gebrochen und sein Fleisch mit dem schönen Messerchen geschnitten, und faßt sich ein Herz und fragt ihn: »Da Ihr denn so viel über mich wißt, und daß ich ein Studiosus bin und auf dem Weg nach Wittenberg, wer seid dann Ihr, und was hat Euch hierher geführt nach der Stadt Leipzig?«
»Der?« sagt der Mann mit dem Armstumpf. »Den kenn ich, der ist überall und nirgends, und macht’s mit den Karten, daß Ihr staunt, und meinen manche, er könnt sogar Ziegenködel besprechen, so daß Gold daraus wird, aber wenn einer mit solchem Gold bezahlen will, sind’s doch wieder nur Ködel, die er in der Hand hat.«
Der andere lacht sein freudloses Lachen und sagt: »Das ist wohl übertrieben, das mit dem Gold und den Ködeln, aber die Karten kann ich Euch legen, daß Ihr die Zukunft erkennt, geht jedoch mit ganz natürlichen Dingen zu, das Daus zum Unter und die Sieben zur Drei, System ist alles, müßt Ihr wissen; und jetzt reise ich in Geschäften, ich such einen Jüden, der hier gesehen wurde, und will ein Wörtchen reden mit ihm.«
»Einen Jüden, so«, sagt der junge Eitzen, und glaubt nun ein Thema zu haben, über das er sich ausbreiten kann, denn die Erbtante in Augsburg hat ihm den Kopf gefüllt damit, was früher die großen Herren Fugger waren, die mit dem Geld handelten und ganze Fürstentümer und selbst den Kaiser finanzierten, das wären jetzt die Jüden, nur sind sie teurer und zeigen ihre Reichtümer nicht.
»Ach Gott«, sagt der andere, »Ihr redet von dem Volk, dem unser Herr Jesus entstammt.«
»Und das ihn ans Kreuz hat schlagen lassen!« trumpft Eitzen auf, er kennt die Diskurse, sein Vater in Hamburg schon hat sie mit Jüden geführt, bei denen er Geld geborgt für hohen Zins. »Und was wollt Ihr mit ihm handeln, Eurem Jüden, welches Wörtchen?«
»Ich will von ihm wissen, ob er ist, der er ist«, sagt sein Nachbar.
Dies dringt durch bis ins Innerste des jungen Eitzen, der seine Bibel kennt und weiß, daß unser Herr Jesus, dieserhalb befragt, geantwortet hat, ich bin, der ich bin. Aber dann lacht er lauthals, um das Gefühl loszuwerden, das ihn beschlichen hat, und sagt: »Er wird Euch wohl bestohlen haben, sie tun’s alle, wenn sie’s können.«
Der andere jedoch scheint des geistlichen Streits müde geworden zu sein. Und da der Knecht gekommen ist und auf einer Schiefertafel mit Kreisen und Kreuzen eines jeden Verzehr markiert und danach das Tischtuch mitsamt den Schalen und Löffeln, alles bis auf die Trinkbecher, zusammengeschlagen und fortgetragen hat, zieht er aus seiner Tasche ein Spiel Karten, wie sie jetzt säuberlich gedruckt werden und des Teufels Gebetbuch heißen, und legt ihrer zehn Stück vor sich hin auf das nackte Holz und fordert den Eitzen auf, er möge doch eine der zehn für sich auswählen und sich im Geiste einprägen, und sobald er dies gründlich getan, ihn es wissen lassen. Eitzen betrachtet die Karten, die, mit dem Bild nach oben, ihn seltsam verlocken, und denkt sich, ’s ist alles doch Blendwerk; wählt aber dennoch eine für sich aus, das Herz-Daus nämlich, zum Angedenken der Jungfer Barbara Steder zu Hause in Hamburg, die es ihm insgeheim angetan hat, und sagt dem Fremden, nun sei er fertig und bereit. Der nun sammelt die zehn offenen Karten ein und tut sie zurück zu den anderen, verdeckten, und mischt das Ganze mit geschickten Händen so geschwind, daß den Gästen in der Stube, die, ihre Becher und Krüglein in der Hand, hinzugetreten sind und ihn und Eitzen und den mit dem Armstumpf voll Neugier umstehen, die Augen wohl übergehen wollen. Sodann breitet er das Spiel in großem Fächer vor Eitzen aus, mit dem Rücken der Karten nach oben, und sagt: »Schaut scharf hin, Herr Studiosus, dreimal dürft Ihr wählen, und jetzt zieht!«
Eitzen gehorcht.
»Diese ist’s nicht«, sagt der Fremde. »Tut sie beiseite.«
Der Eitzen zieht ein zweites Mal.
»Auch diese nicht«, sagt der andere. »Ihr werdet mich doch nicht enttäuschen wollen, junger Herr!«
Dem Eitzen wird’s heiß unterm Kragen. Ist alles nur Blendwerk, denkt er wieder, aber nun meint er schon, die Jungfer Steder samt Mitgift hänge daran, daß er das dritte Mal die rechte Karte herauspickt, und die Hand zuckt ihm, und er spürt den hastigen Atem der anderen, die ihn umringen, und greift blindlings zu.
»Diese ist’s!« sagt der Fremde. »Das Herz-Daus. Hab ich recht, Herr Studiosus?«
Der junge Eitzen steht da, das Maul offen, und weiß nicht, wen er mehr bestaunen soll, den Puckligen, der, des ist er nun sicher, sich eingenistet hat in seinem Leben, oder sich selber, der so trefflich gewählt. Die anderen Gäste sind ganz still geworden, nur der mit dem Armstumpf fängt auf einmal an zu wiehern und ruft aus: »Ach, Bruder Leuchtentrager, was vollbringt Ihr doch für Wunder: selbst aus den Dümmsten noch macht Ihr Hellseher und Propheten!« Und somit hat der Eitzen endlich den Namen des Fremden erfahren, und gelehrt wie er ist nach vier Jahren Lateinschule in seiner Heimatstadt fällt ihm auch sofort der unheilige Lucifer ein, aber Gott sei Dank sind wir in Deutschland, wo eine Leuchte eine Leuchte ist und nichts anderes und, der sie trägt, ein Nachtwächter.
Jetzt wollen auch die anderen das Kartenraten betreiben dürfen, aber der Leuchtentrager erklärt, damit es auch richtig gehe, bedürfe es einer gewissen Sympathie, die er für sie nicht habe; doch sei er bereit, für fünf Groschen das Stück ihnen die Zukunft aus seinen Karten zu lesen, was auch alle getan haben wollen, möchten erfahren, wie ihre Geschäfte gehen und welche Liebschaften sie haben werden, und wer gehörnt werden wird von seiner Ehefrau, und wer durch das Schwert und wer am Galgen enden und wer daheim in seinem Bette sterben soll, so daß der Leuchtentrager binnen kurzem mehr Geld verdient hat durch seine Voraussagen als ein anderer durch sechs Tage Arbeit mit der Hand. Nur der junge Eitzen zögert, die fünf Groschen springen zu lassen, nicht, weil er sie nicht hätte, sondern weil er zutiefst glaubt, des Menschen Zukunft liege in Gottes Hand und nicht in einem Haufen bunter Karten, und sowieso, meint er, sei ein persönliches Wunder pro Abend genug.
Indessen verwirrt sich infolge des Weins und der Wärme sein Kopf immer mehr, und er weiß auch nicht, wie er in das große Bett gekommen ist in der Kammer im oberen Stock des Schwanen, er weiß nur, da er im Dunkeln zu sich kommt, daß er im Hemd liegt, Jacke und Hose und Strümpf und Schuh sind weg und ebenso sein Säckel, das er innen am Leibgurt getragen: man hat ihn trunken gemacht und beraubt, er hat dem Fremden gleich nicht getraut, der sich an ihn so auffällig herangemacht, diesem Leuchtentrager und dem anderen Kerl mit dem Armstumpf, wer einmal aufmuckt gegen die Obrigkeit, fügt sich nimmer ins Gesetz. Schon will er aufspringen und Zeter und Mordio schreien, doch da sieht er in dem Lichtstrahl vom Mond, der durchs Fenster dringt, den mit dem Armstumpf friedlich neben sich schlafen und hört dessen Schnarchen, und spürt an seiner nackten Wade den klumpigen Fuß des Leuchtentrager, der übrigens wachliegt und ins Dunkel hineinstarrt, als lausche er auf irgend etwas, und da er die plötzliche Erregung seines Schlafgenossen bemerkt, diesem sagt: »Ich hab Euer Zeug zusammengetan, Herr Studiosus, und Euch unters Haupt geschoben, damit’s keiner stiehlt.«
Der junge Eitzen tastet nach seinem Säckel und fühlt’s auch, dick und rund, so wie die Erbtante zu Augsburg es ihm gefüllt und mitgegeben, denn er ist ein sparsamer Mensch auf Reisen wie daheim, spendiert nur das Nötigste, ist so erzogen worden von seinem kaufmännischen Vater, der ihn stets mahnte, eins zum andern, Sohn, dann summiert sich’s. Derart beruhigt, will er sich zurücksinken lassen auf das Bündel seiner Siebensachen unterm Kopfe, aber da hört er nun auch, worauf sein Nachbar und geheimer Wohltäter anscheinend gelauscht: Schritte. Schritte hinter der hölzernen Wand, die diese Kammer trennt von der nächsten; dort geht einer auf und ab, auf und ab, ohne Ruh und Unterlaß, wie lange schon?
Dem jungen Eitzen ist nicht recht wohl zumut, und er drückt sich näher heran an seinen Schlafgenossen, welcher, wie er jetzt feststellt, behaart ist am ganzen Leib und sogar auf dem Puckelchen, und sagt flüsternd zu ihm, weiß selbst nicht, warum er’s sagt: »Wie der ewige Jud, der immerzu wandern muß.«
»Wie kommt Ihr auf den?« flüstert der andere hastig zurück. »Auf den ewigen Juden?«
»’s war nur so dahergeredet«, sagt Eitzen. »Man nennt einen so, der nicht stillsitzen kann.« Und vernimmt wieder die Schritte und kann nicht los davon und stößt den Leuchtentrager in die Rippen: »Wie wär’s, ziehn wir die Hosen an und gehn wir hinüber, vielleicht, daß der Kerl noch einen Wein hat und froh ist, ihn mit uns zu teilen?«
Der andere lacht leise. »Ich war schon. Hab die Tür aufgemacht und hineingeschaut, ist aber keiner drin, nur Gerümpel, ein paar Kästen, zerbrochene Tisch und Stühl, was man so findet in einem solchen Gelaß.«
Eitzen schweigt. Er hat Angst, gibt’s aber nicht zu, sich selber nicht und dem Leuchtentrager schon gar nicht. Dann fragt er: »Aber die Schritte?«
»Könnt sein, daß wir träumen«, sagt der andere jetzt, und gähnt.
Dem Eitzen erscheint fraglich, daß zwei zur gleichen Zeit das Gleiche träumen sollten, und er schüttelt den Kopf.
»Hört Ihr’s denn noch?« sagt der Leuchtentrager.
Eitzen nickt.
»Seid Ihr dessen auch ganz sicher, Herr Studiosus? Denn ich hör’s nicht mehr.«
Eitzen lauscht lange hinein in die Nacht. Mal hört er das dumpfe Echo, mal hört er’s nicht. Er könnte ja gehen und selber nachschauen, wie’s jener getan hat, aber da bleibt er lieber unter der Decke, und morgen ist auch ein Tag, und was bedeutet das schon, es hört einer ein paar Schritte in einem Traum; Gott ist ewig und Gottes eingeborener Sohn, das ja, aber ein Jüd?
Nun schlafen alle in der Kammer wieder, von allen Seiten her ertönt das Geschnarch und Gestöhn und Gefurz, und ein Weilchen später zeigt sich die Morgenröte am Fenster, aber der junge Eitzen sieht das nicht, denn auch er ist entschlummert, diesmal traumlos.
Als er dann aufwacht, ist die Kammer leer, die Strohsäck auf den Betten liegen wild durcheinander, und Eitzen brummt der Schädel wie ein wildgewordener Schwarm Bienen. Ach Gott, ach Gott, denkt er und erschrickt, und prüft sofort, ob sein Säckel noch da: das wär eine schöne Bescherung, wenn’s ihm einer unter dem Kopf wegeskamotiert hätte, er erinnert sich sehr wohl der geschickten Finger seines neuen Freundes. Aber das Säckel ist an seinem Ort, und daneben findet sich ein Zettelchen, darauf steht mit einem Stift aus Kohle geschrieben: »Erwart Euch unten, Herr Studiosus. Kamerad L.«
Nun ist der gar schon Kamerad geworden, denkt Eitzen, da er in die Hosen schlüpft und sich die Jacke zubindet und die Stiefel schnürt; was er nur an mir finden mag, vielleicht ist’s wegen der Erbtante, von der ich Esel ihm erzählt hab, und er spekuliert auf lange Sicht. Dann die Stiege hinunter und hinaus auf den Hof, wo er sich erleichtert und am Ziehbrunnen den Mund säubert und die Nase schneuzt, und darauf hinein in die Gaststube. Da ist nun schon auch alles leer, nur der Knecht steht faul herum, und der Kamerad sitzt auf der Bank am Fenster und kaut ein Stück Brot und löffelt ein Süppchen und sagt: »Setzt Euch zu mir, Herr Studiosus, und teilt mit mir, nach den Gäulen hab ich schon gesehen, Eurem und meinem.«
Da ist dem jungen Eitzen, als habe er einen Schatz gefunden, so einen, der sich um alles kümmert, und freiwillig dazu, und er befürchtet nur, daß ihm die Rechnung präsentiert werden könnt eines Tages; das macht ihn argwöhnisch. Sie kauen nun beide, und Eitzen erwartet eigentlich, daß der andere was sagen würde von den Schritten letzte Nacht in der Kammer, wo kein Mensch gewesen, oder auch, was aus dem mit dem Armstumpf geworden und wohin der sich davongemacht, denn sie schienen einander gekannt zu haben, und so rasch steigt einer doch nicht um von einem Freund auf den anderen; aber nicht ein Wort davon, vielmehr bewundert der Kamerad den Gaul, auf dem Eitzen von Augsburg bis Leipzig geritten, die schmale Kruppe und den kräftigen Bau, so daß dem jungen Mann der Verdacht kommt, der Kerl sei vielleicht auf sein Pferd aus, und beschließt, ein Auge darauf zu haben. Doch dann, da sie den Wirt vom Schwanen bezahlt und zum Stall hinausgegangen, sieht er, daß der Gaul des anderen viel besser ist als seiner, ein wahres Teufelspferd, mit geblähten Nüstern und feurigem Blick, das hin und her tänzelt und das er wohl zögern würde zu besteigen, vor Furcht, es könnte ihn abwerfen; doch der Kamerad springt, trotz seiner Lahmheit, leichtfüßig in den Sattel und sitzt da oben wie ein wahrer Reitersmann; dann sprengt er durchs Tor hinaus auf die Straße und um die Ecken, daß die Funken stieben und die Leute beiseite schrecken und der junge Eitzen Mühe hat, ihm zu folgen; erst als sie auf der Landstraße sind, Richtung Wittenberg, und das Weichbild Leipzigs hinter ihnen, kann er den Kameraden einholen, der nun langsamer dahintrabt.
»Ihr wollt wohl nun wissen, wer ich in Wirklichkeit bin«, sagt dieser und lacht, ohne wirklich zu lachen. »Ich weiß, Herr Studiosus, Ihr habt keine Ruh, bevor Ihr’s nicht erfahrt; Ihr habt von der Ordnung gesprochen gestern abend, von der Ordnung im Himmel wie auf Erden, und derart ordentlich geht’s auch zu in Eurem Gehirn, hat alles sein Schub und sein Fach da, doch seid Ihr nicht sicher, in welches hinein Ihr mich stecken sollt.«
Wieder ist Eitzen betroffen, wie genau der andere sich auskennt in seinen Gedanken, aber er will’s nicht zugestehen und sagt, seinem verschwitzten Pferd den Hals klopfend, alles habe seine Zeit, und wenn Leuchtentrager nicht wolle, möge er seine Geschichte ruhig für sich behalten, und sowieso, was nützten denn Worte, sähe doch jeder in jedem was anderes.
Genau das sei’s, erwidert der, da habe der junge Herr seinen Finger auf den Punkt gelegt, und überhaupt sei es keinem von uns gegeben, einen Menschen auszuloten bis in dessen Tiefen, ein Geheimnis bleibe immer, denn wir seien ja nicht ein Einheitliches.
Der junge Eitzen blickt den Kameraden von der Seite her an, das Alltagsgesicht mit dem Bärtchen und den dunklen, nach oben gespitzten Brauen und das Puckelchen hinter der linken Schulter, und einen Augenblick lang ist ihm, als sei um dessen feste Gestalt herum noch ein anderes, ein Gemisch aus Nebel und Schatten, und da just auch eine Wolke hinhuscht über unsre liebe Sonne, gruselt’s ihn ein wenig, und er gibt seinem Pferd die Sporen.
Nicht daß er entfliehen wollte; dem raschen Gaul des Kameraden Leuchtentrager wäre er doch nicht entkommen, das weiß er, und so sagt er: »Hoah!« und wartet, bis der, gemächlich trabend, wieder an seiner Seite ist, und fragt ihn, was er denn gemeint habe, nicht ein Einheitliches?
»Es sind ihrer zwei in einem jeden von uns«, erklärt der Kamerad.
Der junge Eitzen überzeugt sich rasch: das Gespinst, das den andren umgab, ist fort, war wohl nur eine Täuschung der Sinne gewesen wie auch die Schritte in der Nacht. Und sagt, da alles in seinem Denken sich wie natürlich einfügt in die göttliche Lehre: »Ei ja doch, ich und meine unsterbliche Seele.«
»Ja«, sagt der andere und lacht, und diesmal ist sein Lachen der reine Spott, »so kann man’s wohl auch sehen.«
Worauf der Eitzen einen fürchterlichen Verdacht schöpft, schlimmer als alle vorherigen, die er dem Fremden gegenüber gehegt hat, und lauernd fragt: »Ihr seid doch nicht etwa einer von den Anabaptisten, oder Wiedertäufern, welche zu Münster dem Teufel huldigten und allerlei Schrecken vollführten? Wie haltet Ihr’s mit der Taufe?«
»Da Ihr so neugierig seid, Herr Studiosus«, sagt der Kamerad, »ich meine, man soll die Kindlein ruhig taufen, solange sie klein sind; wenn’s ihnen nichts nützt, schaden können ihnen die Tröpflein auch nichts und dem Gesetz ist Genüge getan, auf gut lutherisch und katholisch desgleichen.«
Dieses akzeptiert Eitzen, obwohl’s ihm immer noch nicht schmecken will, daß da noch einer in ihm stecken soll, der allerlei Schabernack treiben und ihn womöglich auf Abwege führen könnt mitsamt seiner unsterblichen Seele.
Der Leuchtentrager läßt sein Pferd im Schritt fallen. »Ich bin«, sagt er, »der Sohn des Augenarzts Balthasar Leuchtentrager aus Kitzingen am Main und dessen Ehefrau Anna Maria, welche mit mir schwanger ging im neunten Monat, als auf Geheiß unseres gütigen Herrn, des Markgrafen Casimir, meinem Vater sowie an sechzig anderen Bürgern der Stadt und Bauern aus den Dörfern ringsum die Augen ausgestochen wurden.«
»Da wird Euer Herr Vater wohl in schlimme Gesellschaft geraten sein«, mutmaßt der junge Eitzen.
»War selber einer der Schlimmsten«, sagt der Kamerad. »Wie sich viel Volk versammelte damals, darunter auch welche bereits geharnischt und mit Spießen, und wie die vom Rat der Stadt Kitzingen zur Mäßigung rieten und daß der Aufruhr allen nur schädlich sein würde, da erhob sich mein Vater und redete scharf daher, nämlich ob das Volk sich so das Süße ums Maul streichen lassen wolle; derart finge man Mäuse; und bald genug werde es Köpfe regnen.«
»’s war eine böse Zeit«, bemerkt Eitzen weise. »Gott sei’s gelobt ist sie jetzt vorbei, dank den Schriften des Herrn Doktor Martinus Luther und dem raschen Eingreifen der Obrigkeit.« Und fragt sich im stillen, wieviel von seines Vaters aufrührerischem Geist in Leuchtentrager junior stecken möcht, der da neben ihm einherreitet.
Doch der kaut ganz friedlich an einem Blatt, das er von einem Baum an der Wegseite abgerissen hat. Dann spuckt er’s aus und fährt fort in seiner Erzählung. »Da aber auch meiner Mutter Vater so geblendet ward auf Geheiß des Markgrafen«, sagt er, »aus dem Grund, daß er den Schädel der heiligen Hadelogis, der Stifterin unseres Frauenklosters zu Kitzingen, nachdem er diese aus ihrer Gruft in der Kirche herausgeholt, zum Kegeln benutzte, und da mein Vater am Tag nach den Stichen in die Augen an seinen Wunden elend verstarb, lief meine Mutter mit mir im Bauche davon, und so kam es, daß ich wie das kleine Jesulein unterwegs im Stalle geboren bin, aber nicht von Öchslein und Eselein umsorgt und von drei Königen beschenkt; vielmehr war meine arme Mutter allein im Schober und ich entfiel ihr und war so von Geburt an geschädigt, weswegen ich auch mit dem einen Fuß hinke und die eine Schulter höher trag als die andre und einen kleinen Puckel habe.«
»Da habt Ihr von Vaters wie von Mutters Seite eine schwere Mitgift«, kann sich der junge Eitzen nicht enthalten zu sagen, und denkt insgeheim, viel Gutes könnt wohl nicht werden aus dem bei seiner Anlage, aber laut sagt er: »Doch wie ging’s denn nun weiter?«
Der andere scheint aufzuschrecken aus irgendwelchen Erinnerungen, und sein Zucken überträgt sich auf seinen Gaul, so daß der davongaloppiert und der junge Eitzen ihm lange nachsetzen muß, bis er endlich zum weiteren Teil der Geschichte kommt, nämlich wie die arme Mutter des Kindleins, geschwächt wie sie war, dieses ins Sächsische brachte, zu der Stadt Wittenberg, und dort selig verstarb, und wie der Wundarzt Anton Fries und dessen gute Frau Elsbeth das Kleine, das nun ganz verloren und verlassen war und noch nicht reden, sondern nur lallen konnte und nach der Brust schrie, an Kindes Statt annahmen. »Was ihnen von Herzen gedankt sei«, fügt der Leuchtentrager hinzu, »obwohl ich ihnen nicht viel Freude gemacht ihr Lebtag lang; ich war kein fröhlicher Bub und behielt, was ich dachte, für mich selbst, und wo andere sagten, ja, das sei so und wär seit je so gewesen und damit gut, da fragte ich, warum denn, und beunruhigte alle und bezog manche Tracht Prügel dafür.«
»Es gibt aber auch Dinge«, ereifert sich der junge Eitzen, »da fragt ein Christenmensch nicht, warum.«
»Wenn der Mensch nicht fragte, warum«, sagt der Kamerad, »so säßen wir alle heut noch im Paradies. Denn wollte die Eva nicht wissen, warum’s ihr verboten sei, von dem Apfel zu essen?«
»Erstens«, antwortet Eitzen, »war sie ein dummes Weibsbild, und zweitens hat’s ihr die Schlange eingeflüstert. Gott bewahre uns alle vor solchen Schlangen.«
»Ich hab aber ein Gefühl für die Schlange«, sagt der andere. »Die Schlange hat nämlich gesehen, daß Gott den Menschen ausgestattet hat mit zwei Händen zum Arbeiten und einem Kopf zum Denken, und zu was hätte er die wohl brauchen können im Paradies? Am Ende wären sie ihm wohl weggeschrumpft wie alles, was nicht benutzt wird, und was, Herr Studiosus, wär dann geworden aus dem Ebenbild Gottes?«
Der junge Eitzen ist nicht sicher, macht der Kamerad sich lustig über ihn oder nicht, und er beschließt, zurückzukehren auf festen Grund, und wiederholt daher, was der Pastor Aepinus zu Hamburg ihm mitgegeben hat auf den Weg fürs Leben: daß nämlich der Glaube selig mache und nicht das Wissen. Worauf er, um nicht wieder in einen Disput verwickelt zu werden, bei dem er den kürzeren ziehen könnte, den anderen auffordert, in seiner Erzählung fortzufahren.
Der nun berichtet, als es mit seinem Ziehvater, dem Wundarzt Fries, ans Sterben gegangen sei, habe dieser ihn zu sich gerufen und gesprochen: Mein Sohn, denn ich habe dich allzeit als meinen Sohn betrachtet, obzwar du mir ins Haus kamst ärmer noch als ein Findling und halb verhungert und dem Tode nah und meine selige Frau und ich dich um Christi willen fütterten, mein Sohn, hiermit übergebe ich dir als Erbteil deiner wahren Mutter und deines rechtmäßigen Vaters, was deine Mutter bei sich trug, als sie tot aufgefunden ward, ’s ist nicht viel wert, höchstens fürs Sentiment – item, ein Tüchlein, vergilbt, mit zwei dunklen Flecken aus Blut, ich hab’s selbst geprüft auf seine Natur, und ist es der Abdruck der blutigen Augenhöhlen deines Vaters; item, eine Münze aus Silber, mit dem Kopf eines römischen Kaisers darauf; und letztlich, ein Stück Pergament, beschrieben in der Schrift der Hebräer, und mit einer Bemerkung darauf in der Hand deines Vaters und besagend, er habe die Münze sowie das Pergament von einem uralten Jüden erhalten, welcher bei ihm gewesen in den Tagen vor dem Aufruhr. Worauf sein Ziehvater ihm dies alles treulich übergeben habe und kurze Zeit darnach in Frieden entschlafen sei; er aber, der Leuchtentrager, habe die drei Dinge in ein ledernes Beutelchen getan und trage sie seither stets bei sich als eine Art Talisman.
Wie er von dem Jüden hört, der bei dem Vater des Kameraden gewesen, kommt dem jungen Eitzen gleich der ewige Jüde in den Sinn und die Schritte der letzten Nacht in dem leeren Nebengelaß und auch, daß der andere ihm gesagt hat, er sei auf der Suche nach einem gewissen Jüden und darum nach Leipzig gekommen, und obwohl ihm ein wenig gruselig ist, juckt ihn doch auch die Neugier und er sagt, daß er ein geweihtes Kreuzlein auf der Brust trage, welches ihm seine liebe Mutter gegeben und welches er den Leuchtentrager wohl sehen lassen würde, wenn dieser ihm dafür sein Amulett zeigte.
Der reicht hinüber von seinem Gaul und haut dem jungen Eitzen auf die Schulter, daß er zusammenfährt, und sagt ihm, wenn er’s ertragen könne, solch teuflisches Zeug zu sehen, bittesehr. Und da es Zeit ist, den Pferden eine Rast zu geben, halten sie an und lassen die Gäule grasen und setzen sich auf zwei Baumstümpf und der Kamerad greift hinein in seinen Brustlatz und zeigt dem Eitzen zuerst die Münze, ein wohl erhaltenes Stück, man erkennt jedes Blättchen Lorbeer auf dem Haupt des Kaisers, und dann das Tüchlein mit den zwei bräunlichen Flecken, und schließlich das Stück Pergament.
Der junge Eitzen kann wohl lesen, was der Kitzinger Vater des Kameraden an den Rand geschrieben, aber das Hebräische ist ihm soviel Abrakadabra, und er will wissen, was es denn bedeute, ein Zauberspruch etwa oder eine Verfluchung, oder wisse es keiner?
Oh, er kenne wohl ein paar Worte der Sprache, sagt Leuchtentrager, und fügt zu Nutz und Frommen des jungen Eitzen hinzu: »’s ist weder ein Zauberspruch noch eine Verfluchung, ’s ist die Heilige Schrift, ein Wort des Propheten Hesekiel, und lautet: so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die schlechten Hirten und will meine Herde von ihnen fordern; ich will ein Ende damit machen, daß sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden; ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, daß sie sie nicht mehr fressen sollen.«
Dem Eitzen ist nicht behaglich, einerseits ist’s ein Prophet, der da zitiert wird, andererseits klingt’s ihm rebellisch, und er fragt sich, wer die Hirten wohl sein möchten, die unter der eigenen Herde räubern, und wen der Prophet gemeint habe; dann aber tröstet er sich in dem Gedanken, das alles sei doch schon recht lange her, und die Hirten von heute sind ordentliche Leut, die ihre Herden pünktlich heimwärts treiben zu ihren Eignern, und er entsinnt sich seines Kreuzleins, das er dem Kameraden zeigen wollte.
Dieser jedoch wendet sich ab von dem Kreuzlein, als kenne er deren genug und habe wenig damit im Sinn, und verstaut seine Schätze wieder im Brustlatz und geht und greift sein Pferd und schwingt sich in den Sattel. Von oben herab sagt er dann zu dem jungen Eitzen, der herangeeilt kommt: »Könnt wohnen bei mir in Wittenberg, Herr Studiosus; ’s ist Raum genug im Haus des Wundarztes Fries, das ich geerbt hab und das nun meins ist; über die Miete werden wir schon eins werden, es wird Euch die Welt nicht kosten.« Und schnalzt mit der Zunge und trabt davon.
Eitzen aber, der ihm nachreitet, denkt, wie durch Gottes Fügung sich alles weise regelt und zu seiner Zeit; zwar hat er gehofft, daß der Doktor Melanchthon, an den er den Brief hat von der Erbtante, ihm behilflich sein möchte bei der Beschaffung von Tisch und Quartier, besonders wenn er sich einschreibt bei ihm als dessen Schüler; aber so ist’s doch besser, denn der große Lehrer und Lutherfreund wird überlaufen sein von vielen, darunter auch klügere, wenn auch kaum eifrigere Köpf als der des Paulus von Eitzen aus Hamburg. Und doch, denkt er, und doch …
Dann aber schüttelt er sich. Man soll auch nicht zuviel hineingeheimnissen wollen in die Menschen, selbst nicht in einen wie den Kameraden Leuchtentrager, der da vor ihm einherreitet, hinein in den wolkenverhangenen Abendhimmel.
Drittes Kapitel
In dem schlüssig erhärtet wird, daß das, was die Schulwissenschaft nicht begreift, nicht existieren kann, auch wenns leibhaftig vor einem steht
Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Siegfried Beifuß
Institut für wissenschaftlichen Atheismus
Behrenstraße 39a
108 Berlin
German Democratic Republic
19. Dezember 1979
Sehr verehrter Herr Kollege!
Ich habe Ihr verdienstvolles Büchlein »Die bekanntesten judaeo-christlichen Mythen im Lichte naturwissenschaftlicher und historischer Erkenntnisse« erhalten und mit größtem Interesse gelesen. In vielerlei Hinsicht, besonders dort, wo Sie auf die Zwecke eingehen, denen diese Mythen im Lauf der Zeit gedient haben und teilweise heute noch dienen, pflichte ich Ihnen durchaus bei. Uns Wissenschaftlern obliegt es, die Verdummung der Massen zu bekämpfen, die allerdings auch durch so manchen modernen Mythos vertieft wird, der unter dem Namen Wissenschaft läuft, und wir müssen, wo wir nur können, im Sinne der Aufklärung wirken.
Doch gestatten Sie mir ein paar Bemerkungen zu dem Abschnitt in Ihrem Werk, dem Sie den Titel »Über den Ewigen (oder Wandernden) Juden« gegeben haben. Dies vor allem deshalb, weil ich selbst dem Ahasver – er trägt auch andere Namen – einige Nachforschungen gewidmet habe, deren vorläufige Ergebnisse ich in dem beigefügten Nachdruck aus der Zeitschrift »Hebrew Historical Studies« niederlegte; eine zugegebenermaßen etwas holprige Übersetzung ins Deutsche, angefertigt zu Ihrer gefl. Benutzung von einem meiner Studenten, befindet sich gleichfalls in der Anlage.
Sie schreiben, verehrter Herr Kollege, auf S. 17 Ihres Werkes: »Für eine Weltanschauung, die keine unbewiesenen und unbeweisbaren Dinge anerkennt und nach den Prinzipien wissenschaftlichen Denkens auch nicht anerkennen kann, ist die Annahme einer Existenz übernatürlicher Wesen (Gott, Gottes Sohn, heiliger und anderer Geister, sowie Engel und Teufel) a priori unmöglich.« Und damit kategorisieren Sie auch den Ahasver als unmöglich.
Ohne Ihre Weltanschauung, die Sie als die Weltanschauung des dialektischen Materialismus bezeichnen, in Frage stellen zu wollen – sie hat sicher ihre Meriten –, möchte ich Sie, um Ihnen weitere Irrtümer zu ersparen, freundlich darauf hinweisen, daß der ewige Jude weder unbeweisbar noch unbewiesen ist. Er existiert vielmehr, dreidimensional wie Sie und ich, mit Herz, Lunge, Leber und allem Zubehör, und das einzige an ihm, was man als übernatürlich bezeichnen könnte, ist das Phänomen seiner außerordentlichen Zähigkeit: er stirbt einfach nicht. Ob dies ein Vorteil ist oder nicht, möchte ich dahingestellt sein lassen; er selber scheint sich zu dieser Frage wenig oder gar nicht zu äußern, hat es mir gegenüber wenigstens nie getan; anscheinend nimmt er seine Langlebigkeit als gegeben hin, ein Fakt seines Lebens, wie unsereiner einen verkrümmten Zeh oder eine Psoriasis.
Wie aus dem Obigen ersichtlich, kann ich selbst als Zeuge dienen für den real vorhandenen Ahasver. Sein Gedächtnis, was kein Wunder ist angesichts der Vielzahl der Eindrücke, die im Lauf der Jahrhunderte, ja, Jahrtausende, in seinen Gehirnzellen Platz zu finden hatten, ist lückenhaft, aber von überraschender Klarheit, auch im Detail, bei einzelnen Abschnitten seines langen Lebens – Sie sollten ihn von seiner Begegnung mit Jesus von Nazareth sprechen hören, ein Bericht, den ich in letzten Entzifferungen von Teilen der Dead Sea Scrolls übrigens bestätigt fand. Diese werde ich mich freuen Ihnen zur Verfügung zu stellen, sobald sie zur Veröffentlichung freigegeben sind.
Ich hoffe, verehrter Herr Kollege, Ihnen durch meine Zeilen gedient zu haben, die Sie bei einer eventuellen Neuauflage Ihres, wie ich schon sagte, von mir sehr geschätzten Büchleins vielleicht in Betracht ziehen wollen. Somit verbleibe ich, mit dem Ausdruck meiner größten Hochachtung,
Ihr ergebener
Jochanaan Leuchtentrager
Hebrew University
Jerusalem
Herrn Prof. Jochanaan Leuchtentrager
Hebrew University
Jerusalem
Israel
12. Januar 1980
Sehr geehrter Herr Professor Leuchtentrager!
Ihr Brief mitsamt Beilagen, gestern in meinem Institut eingetroffen, hat mich sehr erfreut, zeigt er mir doch, daß die in unserer Republik geleistete wissenschaftliche Arbeit weit über deren Grenzen hinaus ausstrahlt und ihre Wirkung tut. Und wenn gar ein Mann von Ihrem Rang und Ruf sich mit den Resultaten unserer Bemühungen beschäftigt, so bestärkt uns das in unserem Bestreben, noch zielbewußter und umfassender auf unserer Linie vorwärtszuschreiten und den aller menschlichen Vernunft widersprechenden Irr- und Aberglauben noch konsequenter zu bekämpfen. Dabei schätzen wir es durchaus, wenn uns auch Anschauungen anderer Art vorgetragen werden, denn erst durch Widerspruch erweisen sich die Theorien, und der Prüfstein jeder Wissenschaft ist bekanntlich die Praxis.
Ich habe also Ihren Beitrag »Ahasver, Dichtung und Wahrheit« aus den »Hebrew Historical Studies« nicht nur selbst gelesen, sondern ihn auch meinen führenden Mitarbeitern vorgetragen. Was ich Ihnen hier nun zu schreiben habe, ist daher die Meinung eines Kollektivs, das sich in jahrelanger Forschungsarbeit auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Atheismus hervorragend bewährt hat.
Wir sind einheitlich der Meinung, daß Ihre persönliche Bekanntschaft mit dem in Ihrem Artikel erwähnten Herrn Ahasver, einem Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft, nicht zu bezweifeln ist, ebenso Ihre frühere Begegnung mit ihm im Warschauer Ghetto, aus dem Sie, damals noch ein junger Mann, als einer der wenigen Überlebenden durch eine waghalsige Flucht durch unterirdische Kanäle entkamen. Wohl aber sind zu bezweifeln ein großer Teil der von Ihnen angeführten Zeugnisse aus früheren Geschichtsperioden über Zusammentreffen und Erlebnisse mit besagtem Ahasver; solche Zeugnisse, besonders wo nicht amtlich oder durch zusätzliche Zeugen erhärtet, können kaum als wissenschaftlich zulässig betrachtet werden und tragen, je weiter zurück sie liegen, desto mehr mythologischen Charakter. Zwar bezeichnen Sie an einer Stelle Ihres Artikels (S. 23) Herrn Ahasver als »Meinen Freund«; dennoch möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, daß Ihr Freund Ihnen die Schlüsse, zu denen Sie in Ihren Ausführungen gelangt sind, suggeriert haben könnte.
Mangels zwischenstaatlicher Beziehungen ist der Staat Israel Bürgern unserer Republik leider schwer zugänglich; sonst könnten qualifizierte Mitarbeiter des Instituts für wissenschaftlichen Atheismus oder auch ich selbst uns durch Augenschein von dem ungefähren Alter des Herrn Ahasver überzeugen. Unter den obwaltenden Umständen stellt sich die Frage, ob die wirklichen Lebensjahre des Herrn Ahasver nicht durch eine amtsärztliche Untersuchung zur Zufriedenheit aller mit dem Phänomen Befaßten festgestellt werden könnten.
In diesem Zusammenhang weist der Pressereferent unseres Instituts, unser Kollege Dr. Wilhelm Jaksch, auf folgenden Punkt hin: wäre nicht bei der notorischen Sensationslüsternheit der westlichen Medien, von denen die israelischen kaum ausgenommen sein werden, zu erwarten, daß diese von der Existenz eines mindestens zweitausendjährigen Menschen längst Notiz genommen haben würden? Und doch findet sich unseres Wissens nirgends ein Bericht über Herrn Ahasver, nicht einmal eine Photographie des Mannes scheint irgendwo veröffentlicht worden zu sein. Vielleicht besitzen Sie, sehr geehrter Herr Professor, ein Photo von ihm, das sicher sehr aufschlußreich sein würde und das Sie uns leihweise zur Verfügung stellen könnten.
Ich darf noch einmal feststellen, daß meine Mitarbeiter und ich jedes Streitgespräch in dieser und anderen Fragen willkommen heißen und gerne bereit sind, uns überzeugen zu lassen. Aber zu dem letzteren bedürfte es stärkerer Beweise für die Existenz des Ewigen (oder Wandernden) Juden als die uns vorliegenden.
Mit besten Wünschen für die Fortschritte Ihrer Arbeit,
hochachtungsvoll,
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Siegfried Beifuß
Institut für wiss. Atheismus
Berlin, Hauptstadt der DDR
Viertes Kapitel
Worin Doktor Luther seine Meinung von den Juden darlegt und der junge Eitzen auch gleich einem solchen begegnet, der ihm zum Ärgernis wird