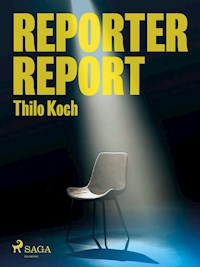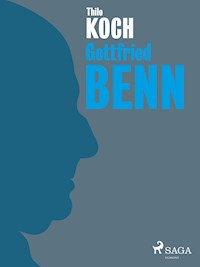9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wenn Thilo Koch sich all der persönlichen Begegnungen und faszinierenden Abenteuer aus 25 bewegten Reporterjahren erinnert, so entsteht ein aufregendes Stück Autobiographie und ein pulsierendes Kapitel Zeitgeschichte. Eine illustre Galerie von Politikern, Schriftstellern, Schauspielern und Philosophen (Thomas Mann, Herbert Marcuse, Jackie Kennedy-Onassis, Chruschtschow, Adenauer, Martin Luther King, «Che» Guevara, Henry Miller und viele andere) wird vom Autor aus nächster Nähe porträtiert – oft mit Ironie und Witz, mitunter romantisch verklärt, aber immer voller intimer Einsichten in die Welt der Prominenten seiner Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Thilo Koch
Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist beabsichtigt
Begegnungen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wenn Thilo Koch sich all der persönlichen Begegnungen und faszinierenden Abenteuer aus 25 bewegten Reporterjahren erinnert, so entsteht ein aufregendes Stück Autobiographie und ein pulsierendes Kapitel Zeitgeschichte. Eine illustre Galerie von Politikern, Schriftstellern, Schauspielern und Philosophen (Thomas Mann, Herbert Marcuse, Jackie Kennedy-Onassis, Chruschtschow, Adenauer, Martin Luther King, «Che» Guevara, Henry Miller und viele andere) wird vom Autor aus nächster Nähe porträtiert – oft mit Ironie und Witz, mitunter romantisch verklärt, aber immer voller intimer Einsichten in die Welt der Prominenten seiner Zeit.
Über Thilo Koch
Thilo Koch, geboren am 20. September 1920 in Canena bei Halle an der Saale, studierte in Berlin Geschichte, Philosophie und Germanistik. Ab 1946 arbeitete er für den Rundfunk. Später war er Korrespondent in Berlin und Washington für namhafte Zeitungen und von 1960 bis 1964 Amerika-Korrespondent des Deutschen Fernsehens. Neben seiner vielseitigen journalistischen Tätigkeit drehte er zahlreiche Fernsehserien und Dokumentationen und veröffentlichte viele Bücher.
Inhaltsübersicht
Wie die Würfel fielen
Eine Art Vorwort
Sie hatte einen wundervollen dicken, langen, schwarzen Zopf, den eindrucksvollsten der ganzen Schule, war klein und wohlproportioniert, putzmunter, ungeheuer hübsch, kokett und umschwärmt. Sie war fünfzehn und ich achtzehn. Ich durfte sie ein paarmal nach Hause bringen und leidenschaftlich küssen. Das geschah am zweckmäßigsten in dem sehr schönen Wald, durch den man fuhr, wenn man von der Schule in Elsterwerda heimwärts nach Bad Liebenwerda strebte. Der Duft nach Harz und Moos, das Rauschen der Kiefern, das frische Grün der Farne, das alles ist mir ganz gegenwärtig. Und natürlich ihr Zopf, ihre Augen. Was sie gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Wir tanzten gern miteinander. Sie stärkte mein Selbstbewußtsein, es lag recht bös darnieder, weil ich in jenen Jahren sonst eher erfolglos und unglücklich verliebt war.
Leider wurde ich auf dieses Mädchen erst kurz vor meinem Abitur, vor dem Abschied von der platanenumrauschten Elsterschloßschule, aufmerksam. Kurz danach mußte ich in den ›Reichsarbeitsdienst‹. Sie war nicht der Typ, der lange trauert. War ihr der Beste gerade nicht der Nächste, so nahm sie den Nächsten als den immerhin Besten. Wir verloren uns aus den Augen. Sie war die Tochter des Besitzers der einzigen Zeitung weit und breit, des ›Liebenwerdaer Kreisblattes‹. Man sieht: meine erste Beziehung zum Journalismus war von sinnlicher Art, flüchtig und nur recht indirekt.
»Wie wurden Sie Journalist?«
Ich bin das so oft gefragt worden, daß es mich allmählich selbst zu interessieren begann. Nie fand ich Zeit, gebührend aufrichtig und konkret darüber nachzudenken. Dies scheint mir der notwendige Zeitpunkt und der rechte Ort zu sein, Rechenschaft zu geben. Die Schilderung kann relativ übersichtlich ausfallen, da sich alles um ein Roman-Manuskript dreht. Sie trägt notwendigerweise autobiographische Züge. Für den Fall, daß ich nie dazu komme, die Geschichte meines Lebens zu schreiben – hier ist wenigstens ein Abschnitt skizziert. Die Striche der Skizze werden am Ende des Buches ergänzt durch die unglaubliche Geschichte mit dem Schutzengel. Er hatte weibliche Gestalt, und ich erfuhr nie seinen Namen. Aber seltsamerweise stand auch am Beginn meiner Schriftstellerlaufbahn ein Schutzengel. Er war Unteroffizier der ›Großdeutschen Wehrmacht‹ und hieß mit Nachnamen Wutz. Auch die Geschichte mit ihm klingt ziemlich unglaublich. Ich kann – im Gegensatz zu der am Schluß des Buches – nicht beweisen, daß sie wahr ist.
Es war 1944 in Italien. Die Amerikaner trieben uns gemächlich vor sich her, immer nordwärts, Richtung Alpen. Bei Bologna gingen wir für längere Zeit in Stellung. Der Stab meiner Einheit belegte eines der vielen kleinen halbverwahrlosten italienischen Schlößchen; ich stand mit dem Funkwagen in der Nähe, gut getarnt unter Bäumen.
Abends trank ich gern mit dem Wachtmeister Hoffmann und dem Unteroffizier Wutz in der Schreibstube des Stabes ein Gläschen. Sie waren die »Schreibstubenbullen« und hatten stets einen Zwanzig-Liter-Kanister mit gutem Wein zur Verfügung; sie saßen an der Quelle. An einem dieser Abende sagte Wutz: »Der Alte ist zum Ritterkreuz eingereicht. Das hat ihn auf die Idee gebracht, eine Regiments-Chronik schreiben zu lassen. Wir können das nicht und haben auch keine Lust dazu. Wenn du willst, schlagen wir dich vor. Vielleicht springt ein Sonderurlaub dabei heraus.«
Mir war das recht. Aber wie wollten sie dem Chef klarmachen, daß ich so etwas können würde?
»Wir legen ihm dein Gedicht aus der DAZ vor. Es ist zwar das Gegenteil von heroischer Geschichtsschreibung, aber immerhin bist du damit ein gedruckter Autor.«
Wenig später wurde ich zum Kommandeur befohlen. »Hören Sie zu, Koch, es wird höchste Zeit, daß jemand die Geschichte unseres Regiments schreibt. Mir ist da empfohlen worden, Sie mit dieser Aufgabe zu betrauen. Ich will einen Versuch mit Ihnen machen. In der ›Deutschen Allgemeinen Zeitung‹ ist da einmal ein lyrisches Gedicht von Ihnen erschienen. Nicht übel, gute Zeitung. Sie sollen mir nun um Gottes willen keine Chronik dichten, sondern nur die harten Tatsachen zusammenstellen. Aber schreiben können Sie offenbar. Also lassen Sie sich von Hoffmann und Wutz die Unterlagen geben, und gehen Sie an die Arbeit. In vierzehn Tagen möchte ich die ersten Probeseiten sehen.«
»Jawoll, Herr Oberst.«
Das Gedicht, dem ich meinen ersten schriftstellerischen Auftrag verdanke, erschien später in einer Sammlung mit dem Titel ›Stille und Klang‹ bei dem heute vergessenen Pontes-Verlag in Berlin. Ich habe nie geglaubt, daß meine Lyrik in die deutsche Literaturgeschichte eingehen wird, aber das kleine gelbe Heft, mit einer Kordel zusammengehalten und in blauer Postantiqua gesetzt, sah sehr rührend aus. Es enthielt sogar einige bessere Verse als jenes Sonett, das Wutz dem Kommandeur als Talentprobe vorgelegt hatte. Wie wunderlich und verschlungen die Wege sein können, auf denen man in einen Beruf findet! Gerade dieses Gedicht konnte wohl kaum als Gewähr dafür gelten, daß sein Autor befähigt sein würde, das Heldenepos vom Kriegseinsatz eines Regiments der ›Großdeutschen Wehrmacht‹ zu schreiben. Dies ist es:
Da hebt es leise an und schreitet hin,
So sinnend wie ein Herbst durch weites Land,
Und webt aus Tiefen sich das klare Band
Der Melodie und lauscht in seinen Sinn.
So ruhevoll und bis ins Dunkel rein –
Ein Lächeln, ferne und noch schwer vom Traum,
Voll Sehnsucht, immer nahe bei dem Saum,
Da weit vom Wunderbaren weht ein Schein.
Zart wie der Glanz von unbegriffner
Stille Entfaltet singend sich die ganze Fülle:
Der Jubel, das Gebet und auch das Leid.
So hebt es an, und sanft gibt es sich hin,
Verschwebt und lauscht noch lange auf den Sinn.
Das ist der Friede. Ihm sind wir bereit.
Das Herstellen von Gedichten während der Kriegsjahre war für mich eine Art autogenes Training. In Lazaretten, am Funkgerät, in den ödesten Kasernenstunden, auf Wache – ich hatte immer etwas zu tun. Ich bosselte an Texten, die mich über meine eigene miserable persönliche Existenz, ihre Zwänge und Verdrängungen, hinausführte. Allmählich stellte sich ein Gefühl für das Gewicht von Worten ein. Ich trainierte die Präzision der Aussage, die Balance einer Zeile, suchte nach Synonymen, übte mich in der Genauigkeit von Beobachtungen, erprobte die Übereinstimmung von Eindruck und Ausdruck – immer aufs neue. Man kann eigentlich gar nicht strenger schreiben lernen, als wenn man sich zum Ziselieren von Sonetten oder Terzinen zwingt, auch wenn die Produkte selbst dann keinen Anspruch auf literarische Bedeutung erheben können.
Die ersten Seiten der Regiments-Chronik gefielen dem Kommandeur durchaus nicht besonders, aber da er keinen anderen hatte, der ihm das machte, befahl er mir, mit verstärktem Eifer fortzufahren. Ich ließ mir Zeit, denn ich dachte, dieses Werk wird nie fertig werden, dafür sorgen schon die Amis. Außerdem wollte ich mich auch aus einem anderen Grunde recht lange damit beschäftigen. Während ich nämlich so tippte und den heldenhaften Einsatz unseres Regiments beim Brückenkopf von Nettuno schilderte, kam mir ein Gedanke. Sollte ich nicht zweierlei nebeneinander schreiben? Neben der Chronik über den Kampf eines Regiments etwas Eigenes, Privates und ganz anderes? Warum nicht die Geschichte eines Einzelgängers, der inmitten des »Aufstandes der Massen«, des »Aufbruchs eines Volkes«, seinen eigenen Weg suchte? Sollte ich es nicht mit einem Roman versuchen, der autobiographische Züge tragen würde und, wenn er glückte, ein Stück Geschichte meiner Generation darstellen würde?
So entstand ein Manuskript, dem ich später dann tatsächlich meinen Beruf verdankte.
Alles hätte aber eines Nachts doch um ein Haar mit einer Katastrophe enden können. Ich saß mit Hoffmann und Wutz beim Wein, und – wie es in den letzten Kriegsmonaten meistens ging – sehr bald redeten wir über die politische und militärische Lage. Ich hörte regelmäßig BBC ab und die Weltchronik des I.R. von Salis über Radio Beromünster. Ich war also einigermaßen informiert. Hoffmann und Wutz gehörten zu den wenigen Kameraden, denen ich vertraute. So wußten auch sie, was los war.
Etwa um Mitternacht herum gerieten wir ziemlich in Fahrt. An der Wand der Schreibstube hingen drei Fotos von Hitler, Göring, Himmler. »Das ist der schlimmste«, sagte Hoffmann und deutete auf das Bild, aus dem uns der Mann mit dem Zwicker anblickte. Ich warf eine leere Flasche in die Richtung der Bilder, es klirrte, und Himmler ging zu Boden. Wir lachten, und ich äußerte dazu Passendes.
Am anderen Morgen werde ich wachgerüttelt. Ich erkenne verschwommen das Gesicht von Wutz. »Hör genau zu. Du warst letzte Nacht nicht mit uns zusammen. Denk dir was aus, wenn jemand fragt. Auf keinen Fall mit uns, verstehst du? Alles andere später.« Der Tag verlief normal. Natürlich war ich beunruhigt. Ich hütete mich, Hoffmann und Wutz aufzusuchen. Spät abends, als ich Dienst am Funkgerät hatte, rief mich Wutz über unser direktes Feldtelefon in der Funkstelle an und bestellte mich nach Ende der Wache in eine entlegene Ecke der Stellung.
Wutz berichtete: »Wir hatten einen Lauscher vorm Fenster diese Nacht: den Alten. Heute früh kommt er wie gewöhnlich in die Schreibstube, Hoffmann meldet wie immer, aber er läßt uns strammstehen. Und dann ging’s los: Er habe etwa um Mitternacht in der Schreibstube zersetzende Äußerungen vernommen. Er hätte unsere Stimmen erkannt, aber da sei noch ein Dritter dabei gewesen. Wir sollten den Namen nennen. Zum Glück sprichst du ja leise. Wir haben gesagt, nur wir zwei hätten gesoffen. Wo das Himmler-Bild wäre, fragte er dann. Wir sagten, es sei runtergefallen, und wir hätten es wegwerfen müssen. Er sah, daß er mit uns nicht weiterkam, wollte auch kein Drama daraus machen, denn schließlich braucht er uns für seinen Kram, und wir wissen auch zuviel. Also ist alles glimpflich abgelaufen. Mach dir keine Sorgen, die Sache ist erledigt. Aber paß auf, daß niemand dein privates Manuskript erwischt. Dann bist du dran. Der Alte ist kein Unmensch, aber er glaubt an den Endsieg. Jedenfalls behauptet er es.« Mit der Chronik kam ich schleppend voran. Um so schneller ging es mit dem Roman. Als unsere Einheit auf der italienischen Seite der Ötztaler Alpen endgültig zum Stehen kam und die Amis uns von Süden und Norden her in der Zange hatten, umfaßte mein Romanmanuskript wohl über hundert enggetippte Seiten, und ich steckte es in zwei Exemplaren zu mir, als ich beschloß, mich nach der Kapitulation seitwärts in die Büsche zu schlagen. Ich hatte keine Lust, darauf zu warten, daß wir in die Kriegsgefangenschaft getrieben wurden, und stieg eines Nachts ohne Waffen mit einem Rucksack voll Dauerwurst, Schmalzkonserven, Brot und eben jenem Manuskript in die Berge.
Vierzehn Tage konnte ich mich halten, schlief am Tage und marschierte in der Nacht. Ich kam über einen Gletscher bis hinüber auf die österreichische Seite, wurde aber doch noch eines Nachts von den Amis gefaßt. Zuvor hatte ich eines der Manuskripte in eine leere Konservendose gepreßt und die Dose unter einem Baum bei einem Dorf vergraben. Ich weiß den Namen des Dorfes nicht mehr und würde wohl auch kaum den Baum wiederfinden. Das Manuskript mag noch heute dort liegen, wahrscheinlich vermodert.
Ich kann nicht erklären, wie ich das Originalmanuskript durch alle Leibesvisitationen hindurchrettete. Die Amis behandelten mich anständig, aber ich benutzte doch eine Chance, zu fliehen, und war bald wieder auf eigene Faust unterwegs Richtung Heimat. Ich hörte von einem kleinen Lager in Prutz am Inn, wo man Entlassungen vornahm. Dort konnte ich mich hineinschmuggeln und wurde tatsächlich kurz darauf mit Entlassungspapieren versehen.
Sehr bald, es war ein Junitag im Jahre 1945, stand ich vor der Tür einer kleinen Wohnung, in der meine Mutter untergekommen war. Nach dem Tode des Vaters war sie in dem kleinen Dorf Plessa bei Elsterwerda in der Provinz Sachsen geblieben. Dort hatte sie auch den Einmarsch der Russen erlebt. Nichts war übrig geblieben als eben ihre kleine Notwohnung und ein paar Einrichtungsgegenstände. Aber sie hatte wenigstens Kohle für den Winter von dem Braunkohlenwerk, das mein Vater geleitet hatte. Und da sie im Dorf bekannt und beliebt war, bekam sie etwas mehr als die Ration auf Lebensmittelkarten.
Nach einem abenteuerlichen Versuch meine Frau wiederzufinden – dessen glücklichen Ausgang ich am Schluß dieses Buches schildere –, lebten wir zunächst in Plessa: meine Mutter, meine Frau und ich. Jeder mußte arbeiten, sonst bekam man keine Lebensmittelkarten. Die Besatzungsmacht und ihre deutschen Helfer suchten NS-unbelastete junge Leute für die verschiedensten Funktionen. Mir wurde das Amt eines Volksrichters in der Kreisstadt Bad Liebenwerda angeboten. Es war schon in den ersten Nachkriegswochen ersichtlich, daß die Russen eine politische Justiz ausüben wollten. Ich sagte nein. Aber was sollte ich tun?
Ich schickte einige Gedichte an das Volksbildungsamt in Halle an der Saale, unserer Provinzhauptstadt, mit der Bitte, mich als Schriftsteller anzuerkennen. Die Papiere kamen in die Hand eines wohlmeinenden Mannes. Ich verdanke ihm viel. Sein Name ist Heinrich Kaestner. Er arrangierte eine Dichterlesung in der Moritzburg, bei der der Intendant des Stadttheaters Halle, Herr Kendzia, einige meiner Gedichte sprach. Die Sache wurde ein passabler Erfolg, und ich bekam die erbetene Bescheinigung.
Nun machte ich mich an die Fertigstellung meines Romanmanuskripts. Wir blieben bis zum Frühjahr 1946 in Plessa, weil wir es hier wärmer hatten. Längst war uns klar, daß wir nach Westberlin mußten. Ich wollte mein Studium in Westberlin fortsetzen, denn zu der Karriere eines von den Kommunisten geförderten Nachwuchsschriftstellers hatte ich keine Lust. Man konnte schon 1946 beobachten, wie gemäßigte Liberale in den Verwaltungen durch Ulbricht-Leute ersetzt wurden. Auch Heinrich Kaestner, mein getreuer Mentor in Halle, konnte sich nicht lange halten.
So verließen wir das sowjetische Besatzungsgebiet und gingen nach Westberlin, wo die Eltern meiner Frau Susanne lebten, genauer: zu überleben versuchten. Alles war ungewiß, nur eines stand fest: im Juni 46 würden wir unser erstes Kind bekommen. Wir trafen also in der deutschen Hauptstadt ein mit einem ungeborenen Kind und einem noch nicht veröffentlichten Roman. Wie man ein Kind kriegt, war uns theoretisch klar. Wie man einen Roman publiziert, wußten wir überhaupt nicht. Grenzenlos jedoch war unser Optimismus, denn wir hatten alles überlebt, waren beieinander – es konnte alles nur noch besser werden.
Ich zeigte mein Romanmanuskript, mit dem ich nichts anzufangen wußte, eines Tages meinem Onkel Thilo Krumbach, dem Bruder meiner Mutter, Professor für Zoologie, ehemals Direktor des Museums für Meereskunde in Berlin, nun bereits emeritiert. Er betrachtete das Werk, schüttelte behutsam sein weißes Gelehrtenhaupt, schob seine Brille hin und her und sagte: »Das kann ja niemand lesen.« Susanne hatte die neue Fassung wunderbar getippt, zugegebenermaßen sehr engzeilig und auch auf beiden Seiten der Bögen, denn wir hatten wenig Papier, und das Farbband ihrer alten Reise-Remington schlug etwas blaß durch, ein neues war nicht aufzutreiben.
Onkel Thilo hatte einen Bekannten, der hieß Friedrich Schultze. Herr Schultze vertrat den Desch-Verlag in Berlin, las das Manuskript und nahm es an.
Man war damals gleichmütig geworden im Ertragen von Leid und auch von Freude. So glaube ich nicht, daß wir die freudige Botschaft besonders feierten. Es wäre auch verfrüht gewesen, denn der Verlag in München schickte das Manuskript an seinen Berliner Lektor zurück. Es gefiel ihm nicht. Heute kann ich die Desch-Leute gut verstehen. Die Arbeit taugte nicht viel, sie war politisch mit großem Risiko geschrieben und auch aus leidenschaftlichem Engagement, aber das Manuskript trug alle Zeichen eines naiven Erstlings.
Dennoch waren die Würfel über meinen künftigen Lebensweg gefallen, ohne daß ich es ahnen konnte. Dieser Weg gabelte sich zunächst, und wieder gab das Manuskript den Ausschlag. Erstens, Friedrich Schultze wurde von den Engländern zum Sendeleiter ihrer Rundfunknebenstelle in Westberlin ernannt. Herr Schultze brauchte einen Assistenten und dachte an mich. Am Heidelberger Platz in Berlin-Wilmersdorf unterschrieb ich einen Anstellungsvertrag beim NWDR, der mir ein Monatsgehalt von 280 Reichsmark (in Worten: zweihundertachtzig) sicherte. Mit Büroarbeit keineswegs vertraut, brachte ich zunächst einmal die Ablage des Sendeleiters Schultze vollkommen durcheinander. Nach dieser ersten Talentprobe wurde ich beauftragt, telefonisch Wasserstandsmeldungen entgegenzunehmen und in ein anderes Büro zu tragen. Das tat ich zuverlässig. Außerdem versuchte ich, mein Studium der Geschichte, der Philosophie und der deutschen Literatur fortzusetzen. Das hatte freilich objektive und subjektive Schwierigkeiten, die kaum überbrückbar waren. Es fehlte an Universitätsräumen und Universitätslehrern, an Büchern und Heizung, und alle Welt war immerfort unterwegs, um Kalorien zu beschaffen, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Brot kann er gar nicht leben.
Ich sagte, mein Lebensweg gabelte sich, und während die eine Richtung zum Rundfunk führte, wies die andere zur Zeitung.
Im Ostsektor Berlins erschien unter russischer Lizenz die ›Neue Zeit‹. Sie wurde von Professor Dovifat geleitet, stand der CDU nahe und war in der ersten Nachkriegszeit das einzige lesbare Blatt in der von vier Besatzungsmächten regierten deutschen Hauptstadt. Die ›Neue Zeit‹ wurde im berühmten alten, fast völlig ausgebombten Berliner Zeitungsviertel um die Kochstraße herum gemacht. Der Feuilletonchef, Dr. Wilfert, wollte und sollte junge, unbelastete deutsche Schriftsteller fördern. So etwas war ich. Und er suchte einen Roman. Den hatte ich. Wilfert war bereit, das etwas schlecht zu entziffernde Manuskript zu lesen. Nicht nur nahm er das Opus zum Fortsetzungsabdruck an, er ermunterte mich auch, Buchbesprechungen für sein Blatt zu schreiben. Meine erste Rezension galt den ›Moabiter Sonetten‹ von Albrecht Haushofer. Susanne hatte bei Haushofer an der Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Berliner Universität während des Krieges studiert. So hatte auch ich ihn einmal privat kennen und schätzen gelernt. Er gehörte zur Widerstandsbewegung gegen Hitler vom 20. Juli 1944. Wenige Tage vor der Kapitulation haben ihn die Nazis noch im Moabiter Gefängnis erschossen.
Dr. Wilfert schrieb mir, daß die russische Zensur mein Manuskript zurückhalte, und der zuständige Sowjetbeamte wolle mich persönlich sprechen. Zur genannten Stunde betrat ich ein schrecklich zerbombtes Haus in der Nähe der Kochstraße. Hinter einer baufälligen Tür fand ich einen Russen in Zivil. Er sprach leise und bescheiden und war sehr klein. Sein Arbeitszimmer war ein langer dunkler Schlauch. Er fragte mich in vorzüglichem Deutsch gründlich über meinen Lebensweg aus. Dann begann er, mit mir das Manuskript zu diskutieren. Er hatte sich ausführliche Notizen gemacht. Wahrscheinlich war er der einzige, der es Zeile für Zeile wirklich gelesen hatte.
Ich merkte, es gefiel ihm nicht recht, obwohl er die »antifaschistische Gesinnung« des Buches lobte. Wir besprachen Einwand für Einwand. Obwohl mir natürlich sehr daran lag, die Arbeit veröffentlicht zu sehen, machte ich dem Zensor keine politischen Zugeständnisse. Viele literarische Einwände dagegen fand ich berechtigt. Mein höflicher, aber hartnäckiger Widerstand schien dem Russen zu gefallen. Während er sich zunächst sehr reserviert verhalten hatte, sah er mich allmählich etwas teilnahmsvoller an.
Als wir etwa das erste Fünftel des Textes durchgesprochen hatten, klappte er plötzlich den Schnellhefter zu, in den die enggetippten Seiten eingeheftet waren. Er legte eine Hand darauf und blickte ein Weilchen schweigend vor sich hin. Dann nahm er einen Stift, malte ein Zeichen, oder war es sein Name, rechts unten in die Ecke, stand auf, griff nach dem Stempel, drückte ihn neben das Zeichen, sah mich an, gab mir die Mappe mit dem Manuskript und sagte: »Ich genehmige den Abdruck. Auf Wiedersehen. Alles Gute.« Er gab mir die Hand, was er bei der Begrüßung nicht getan hatte, und öffnete mir sogar die Tür.
Ich lief zu Wilfert; der sah den Stempel und sagte: »Erste Fortsetzung kommt in die Pfingstnummer. Honorar dreitausend Mark. Ist Ihnen das recht?« Ich ging zur Kasse und bekam die erste Hälfte ausgezahlt. Alles in bar. Reichsmark ja noch immer.
Ich lief damals in einem unten abgeschnittenen grünen Fallschirmjägerhemd herum. Es hatte große Taschen mit Reißverschlüssen. In die eine steckte ich das Bündel Scheine, zog den Reißverschluß sorgfältig zu, stieg in die U-Bahn Kochstraße Richtung Neuwestend und dachte die ganze Zeit: Mensch, wenn du das verlierst … Wir schrieben Sonnabend, den 8. Juni 1946. Am 23. Juni 1946 wurde unsere Tochter Bettina geboren, mit dem Kopf voraus, wie es sich gehört. Wir hatten ein Kind, wir hatten Geld, ich hatte einen Beruf.
Erstes Kapitel Ausgangspunkt Berlin
In diesem ersten Kapitel erzähle ich von Menschen, die mir in den vierziger Jahren begegneten – genauer, in der zweiten Hälfte dieses explosiven Jahrzehnts, zwischen dem Kriegsende 1945 und einer ersten Amerikareise 1951. Ich traf einige dieser Menschen dann auch später wieder, lernte sie näher kennen; andere verlor ich aus den Augen. Es waren zugleich persönliche und journalistische Begegnungen. In meinem Beruf läßt sich das kaum auseinanderhalten.
Ich mache den Leser bekannt mit einem mutmaßlichen Mörder und einem Bischof, einer Organistin, die ich gut leiden mochte, und einer Schauspielerin, die ich bewundere. Ich schreibe über mein sensibelstes Leseerlebnis, die Reise in ein anderes Land, über einen großen Lyriker und zwei andere Autoren. Zunächst aber berichte ich von der Begegnung mit einem Mann, der zugleich Expressionist, Minister und Verfasser einer Nationalhymne war.
1 Das gab zu denken
Der Dichter der Nationalhymne der DDR (»Auferstanden aus Ruinen …, Deutschland einig Vaterland …«) wohnte in Dahlem. So erstaunlich wir in Westberlin es fanden, ich durfte mich selbst davon überzeugen. Eines Tages besuchte ich Johannes R. Becher in seiner Villa. Es mag 1947 oder auch schon 1946 gewesen sein. Der Anlaß war eine meiner ersten Rezensionen. Sie galt einer Auswahl seiner Gedichte aus den Jahren zwischen 1933 und 1945, die der Ostberliner Aufbau-Verlag unter dem Titel ›Die hohe Warte‹ herausgebracht hatte.
Der Name Becher wurde damals in Berlin mit allen Anzeichen eines mißtrauischen Respekts genannt. Der Altkommunist und KPD-Reichstagsabgeordnete der Weimarer Zeit hatte die NS-Epoche in Rußland verbracht und kam im großen Stab der sowjet-deutschen Umerzieher bald nach Ulbricht aus Moskau nach Berlin. Es war klar, daß die Russen ihm wichtige Aufträge zugedacht hatten. Becher gründete denn auch bald den »Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands«, eine höchst clever (oder wie clever auf russisch heißen mag) erdachte Organisation. Der Kulturbund köderte »Geistesschaffende« aus allen Lagern, sofern sie nicht NS-belastet waren. Becher ging bewußt darauf aus, auch bürgerliche Literaten, Schauspieler, Architekten, Künstler, Wissenschaftler an sich heranzuziehen, denn die Russen wußten, daß sie mit ihren kommunistischen Importen allein das deutsche Volk nicht für sich gewinnen konnten.
Becher, würde man heute sagen, baute mit erheblichen Mitteln und Vollmachten einen großen Public-Relations-Apparat auf. Sein Hauptquartier lag in der Jägerstraße in Ostberlin. Dort konnten sich Kulturbundmitglieder und ihre Freunde auch im Club »Die Möwe« treffen. Prominente Mitglieder waren die Schriftsteller Arnold Zweig, Fritz Erpenbeck, Anna Seghers, Professor Henselmann, der Architekt der Ostberliner Stalin-Allee, Ludwig Renn, Peter Huchel, Theaterintendant Ernst Legal, Kritiker Herbert Ihering und viele andere.
Einige dieser Mitglieder wohnten in Westberlin. Kulturbund-Präsident Becher hatte wohl auch deshalb eine Villa im amerikanischen Sektor von Berlin bezogen, um für westlich orientierte oder einfach in Westberlin wohnende »Geistesschaffende« gesellschaftsfähiger zu erscheinen und einfacher erreichbar zu sein. Jedenfalls lud er zum Beispiel mich unter seiner Dahlemer Adresse zu einer Rücksprache ein. Er hatte seinen Brief an die Redaktion der ›Neuen Zeit‹ (im Ostsektor) gerichtet, die ihn an mich weiterleitete. In der ›Neuen Zeit‹ war meine Besprechung seiner Gedichte erschienen. Diese Zeitung war das Organ der CDU in Berlin, die damals noch vor der Spaltung stand. Emil Dovifat, ihr erster Chefredakteur, durfte sich allerlei leisten. Auch das fügte sich ein in die Konzeption Semjonows, Tulpanows, Dymschitz’, die es für falsch hielten, den Deutschen einfach die marxistisch-leninistisch-stalinistische Zwangsjacke anzuziehen. Sie rechneten mit längeren Zeiträumen. Und innerhalb dieser Zeiträume sollte ein sozialistisches Deutschland entstehen, das mit der Sowjetunion ehrlich verbündet und verbrüdert sein konnte. Vorläufig war die Kandare der Militärregierung zuverlässig angelegt, und so durfte man den Gaul am langen Zügel führen. Wenn es ernst wurde – bei Wahlen zum Beispiel –, gab man ihm die Sporen. Zwischendurch durfte er bürgerlich weiden, auch einmal bocken – CDU und LDP waren zugelassen –, oder man verabreichte ihm bereitwillig den Kulturbundzucker.
›Expressionismus – ein Irrtum?‹ stand über meiner Becher-Kritik. Und Becher begann das Gespräch mit der Erklärung: »Ganz freimütig, Herr Koch, jawohl, der Expressionismus war ein Irrtum; er war es speziell in meinem Leben. Bestenfalls war er, wie Sie in Ihrer Rezension ganz zutreffend sagen, eine ›kurzlebige Wahrheit‹.«
Und dann erklärte er mir, warum ein humanistisch denkender Schriftsteller sich dem »sozialistischen Realismus« verschreiben müsse. »Ich habe einige Fortsetzungen Ihres Romans in der ›Neuen Zeit‹ gelesen. Sie sind begabt. Aber Sie haben noch nicht erkannt, worauf es ankommt. Übrigens, waren Sie in der Hitlerjugend?«
Als ich ja sagte, fragte er offenbar tatsächlich interessiert: »Sagen Sie mir, stimmt es, daß man automatisch Mitglied wurde, daß man sich nicht entziehen konnte, das Abitur sonst nicht bekam?«
Ich erklärte ihm, diese Frage hätte sich für uns kaum gestellt. Ein Gesetz, das uns gewissermaßen einberief zur Hitlerjugend, sei mir nicht bekannt, aber man »kam einfach« zum Jungvolk, und von da wurde man in die HJ übernommen, und in meiner Klasse hätten alle dazugehört. Es habe freilich ganz von einem selber abgehangen, wie aktiv man mitmachte, ob man Führerpositionen anstrebte und wie man sie ausübte, mehr militaristisch-zackig oder mehr sportlichjugendbewegt.
Solche Auskünfte aus erster Hand suchte er offenbar dringend. Dann sprach er von seinem ›Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands‹. Ich solle doch Mitglied werden. Mir fehle offensichtlich das kollegiale Gespräch mit anderen Autoren. Nur so könne ich ein »richtiges Bewußtsein« erlangen.
Ich hatte gerade die erste Sprosse einer schwankenden Leiter erklommen, und der Präsident Becher, damals im besten Alter von fünfundfünfzig Jahren, war aus meiner Perspektive ein Gott, ein Bewohner des Olymps der Besatzungsmächte. Dennoch wagte ich zu sagen, mir läge zunächst an völliger Unabhängigkeit, und nach den NS-Jahren hätte ich nicht die Absicht, noch irgendwo »Mitglied« zu werden.
»Leider typisch«, sagte er, und sein rundes Gesicht mit dem weichen Mund und den tiefen pessimistischen Falten von der Nase abwärts bis zum Kinn sah richtig bekümmert aus.
Es war ein Gespräch unter vier Augen, und ich hatte nicht den Eindruck, daß er mir übelwollte, obwohl ich seinen Gedichten aus der Emigrationszeit zahmen Ton, konventionelle Formen, Sentimentalität, krampfhaft volkstümliches Geplauder und anderes mehr vorgeworfen hatte. Das immerhin war alles unter sowjetischer Lizenz in der ›Neuen Zeit‹ erschienen.
Als Becher nachdenklich schwieg, fuhr ich fort: »Sie haben mich hier freundlich zu einem Gespräch eingeladen, Herr Becher, und ich fühle mich Ihnen gegenüber verpflichtet, ehrlich zu reden. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, daß meine Generation den Expressionismus nicht kennenlernen durfte, denn in unserem NS-Deutschunterricht wurde er als eine moralische Entgleisung und volksfremde Verirrung dargestellt. In Ihnen sehe ich einen namhaften Vertreter des Expressionismus vor mir, den ersten, den ich persönlich kennenlernen darf. Und nun verurteilen Sie selber diesen geistigen Aufbruch aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum. Aber war der Weltekel und der rebellische Aufschrei der expressionistischen Dichtung nicht eine hellsichtige Vorahnung? Hätte sich das öffentliche Bewußtsein, hätte sich die Bourgeoisie jener Jahre von dieser Dichtung erreichen und erschüttern lassen, dann wäre vielleicht dem deutschen Volke und der Welt viel erspart geblieben.« »Das mißverstehen Sie alles. Sie mißverstehen es völlig«, sagte Becher kopfschüttelnd.
Ich fuhr fort: »Das mag sein, Herr Becher, und ich bin ja auch hier, um zu lernen. Aber, um wiederum ehrlich zu sein, der rebellische junge Becher hat mir mehr gesagt als der etablierte ältere. Ich ahne, welch geistige Belastung die Emigration bedeutet. Aber Ihre domestizierten Verse – seien Sie bitte nicht böse –, ich finde, das ist ein imitierter Volkston, und vieles klingt auf sozialistische Manier bourgeois.«
Ich hatte das bescheiden und unbeholfen vorgebracht und hoffte wirklich, daß er mich verstehen würde. Aber er war nun offensichtlich doch verstimmt, stand auf, ging zum Fenster und schwieg eine Weile. War er Kritik dieser Art nicht mehr gewöhnt, weil er sich andressiert hatte, immer »ein richtiges Bewußtsein« zu haben? Mich erregte die Sache, und so machte ich es schlimmer. Ich sagte ihm, daß ich zur Zeit Arthur Koestler läse. Ich hätte durchaus meine Vorbehalte gegen das fanatische Anti der Exkommunisten. Aber wenn ich auch nur einen Bruchteil aus ›Darkness at Noon‹ zum Beispiel für wahr halten dürfte, dann ginge es in meinen Kopf nicht hinein, wie man zugleich Antifaschist und Kommunist sein könne. Kein Zweck, auch nicht der Zweck der Revolution, heilige nach meiner Überzeugung solche Mittel, wie Koestler sie da als die Mittel des Stalinismus schildere.
Nun drehte er sich um und sagte recht ungnädig vom Fenster her und von oben herab: »Sie reden da von vielerlei Dingen, die Sie nicht verstehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht alles erklären. Zu diesem Herrn Koestler nur so viel: Ich habe ihn kennengelernt. In Moskau hatte er nichts Besseres zu tun, als sich sofort eine Syphilis zu holen. So, da haben Sie Ihren Kronzeugen gegen die Sowjetunion.«
Ich war völlig verblüfft und wußte nicht, was ich mieser finden sollte, die Böswilligkeit oder die Primitivität seiner Anschuldigung. Ich sah mich ohnehin deutlich entlassen und verabschiedete mich. Mir fiel noch auf, daß sein riesiger Schreibtisch, der einen imposanten Aufbau hatte, vollkommen leer war. Der ganze große (bourgeoise) Haushalt wirkte unbewohnt, requiriert eben, und vermutlich kam der Literaturpräsident nur für bestimmte Tage herüber. Die Villa glich dem Domizil für ein Trojanisches Pferd der Sowjets, das ihnen die Amerikaner unter der Flagge ›Viermächteverwaltung Berlins‹ abvermietet hatten. Noch heute, wenn ich durch die Straße in Dahlem komme und dieses Haus sehe, denke ich an meine einzige Audienz bei einem Spitzenfunktionär der SED. Später wurde Becher Kulturminister Ulbrichts und, da Heinrich Mann vorzeitig starb, Präsident der Ostberliner Akademie der Künste. Ich habe ihn nie wieder gesprochen.
Becher veranstaltete später als DDR-Minister für Kultur gelegentlich stark beachtete Diskussionsabende in Westberlin. Damals war Ulbricht insgeheim schon auf Mauerkurs, aber Becher hatte seine eigenen russischen Hintermänner und durfte mit deren Unterstützung seine Taktik fortsetzen: hinein in den Westen mit dem Trojanischen Kulturpferd. Bestes Paradepferd, um im Bilde zu bleiben, war bei diesen Diskussionen ein junger marxistischer Philosoph namens Wolfgang Harich. Ich hatte ihn schon in den ersten Berliner Nachkriegsjahren gelegentlich gesehen. Er galt als Wunderkind, schrieb glänzende Theaterkritiken im westberliner ›Kurier‹, zog dann aber mit zunehmender Spaltung der Stadt ganz ins östliche Lager. Harich hatte einen guten Kopf, auch äußerlich. Er sah immer bleich aus und zu allem entschlossen. Er hatte eine eckige Stirn und sprach stets engagiert. Sicherlich wäre er auch ein guter Schauspieler geworden. Die Flamme des Fanatismus loderte in ihm, und er erschien mir stets wie von Tragik umwittert. Er hätte in einem Drama über die Französische Revolution auftreten können – entweder die Guillotine bedienend oder unter ihr sterbend oder vielleicht auch beides. An seinen letzten Auftritt mit Becher in Westberlin 1954 erinnere ich mich. Es ging um die westliche Forderung nach freien Wahlen in Ostberlin und in der Sowjetzone. Harich erklärte uns, warum freie Wahlen in Wahrheit unfreie Wahlen seien. Hingegen seien die Wahlen zum ›Block der Nationalen Front‹ in der Deutschen Demokratischen Republik wirklich freie Wahlen, denn recht verstandene Freiheit, das sei Einsicht in das Notwendige und Jasagen zu diesem Notwendigen.
»Notwendig aber ist der Sieg der Arbeiterklasse.«
Ich hatte kalte Hände vor Aufregung und Empörung. So konnte man uns nicht im Ernst ›dialektisch‹ für dumm verkaufen wollen. Jetzt würde doch wohl einer der Westler unter den Anwesenden dem Harich Saures geben. Aber was kam, war ein trauriges Gewäsch: Propagandathesen gegen Propagandathesen. Ich meldete mich zu Worte, aber anscheinend so schüchtern, daß Becher, der den Abend persönlich leitete, meine Hand nicht sah. Ich war’s zufrieden, traute mich auch nicht recht heraus. Dem Harich fühlte ich mich absolut nicht gewachsen. Mein Gott, wie gut waren diese Burschen geschult. Ein Arthur Koestler hätte man sein müssen …
Koestler war einmal im Titania-Palast in Westberlin aufgetreten bei einem ›Kongreß für die Freiheit der Kultur‹. Er sprach mit einer tiefen, etwas traurigen Stimme verachtungsvoll von den »Halbjungfrauen der Demokratie«. Damit meinte er, so verstand ich es, Menschen, die nur mit halbem Herzen für die demokratischen Freiheiten eintreten. Koestler wirkte ungeheuer auf uns. Später kamen mir Zweifel über ihn, als ich ›Gottes Thron steht leer‹ gelesen hatte. Da entpuppte er sich dann doch als Nihilist, der in schaudernder Bewunderung an den Götzen des Kommunismus denkt, der auch für ihn einmal Gottes Thron eingenommen hatte.
Wir schrieben das Jahr 1956, und Chruschtschow knüppelte die Ungarn nieder. Georg Lukacs, der führende marxistische Literarhistoriker, war verschleppt, hieß es; Wolfgang Harich hatte ihn stets als seinen verehrten Lehrer bezeichnet. Da kam Anfang 1956 die Nachricht: Wolfgang Harich in Ostberlin verhaftet. Man warf ihm Kontakte zum Petöfi-Club in Ungarn vor, sowie konspirative Verbindungen zu einem amerikanischen Nachrichtenoffizier namens Josselson. Ferner auch seine Artikel zehn Jahre früher in »Westberliner Hetzblättern« wie ›Kurier‹ und ›Tagesspiegel‹.
Einige Zeit vorher war bekanntgeworden, daß eine Schwester Wolfgang Harichs, Susanne Kerckhoff, sich das Leben genommen hatte. Frau Kerckhoff, eine überzeugte Kommunistin und Redakteurin der ›Berliner Zeitung‹, hatte Schwierigkeiten mit der Generallinie der SED bekommen und war wohl nicht zuletzt auch wegen dieser Schwierigkeiten freiwillig aus dem Leben geschieden.
Johannes R. Becher rückte in seiner Kulturbundzeitung ›Sonntag‹ sofort demonstrativ von Harich ab. Bis gestern war Wolfgang Harich ein gehätschelter Star jenes Kulturbundes gewesen, der angeblich Deutschland demokratisch erneuern sollte. Der ›Sonntag‹ beendete hastig eine interessante öffentliche Diskussion zwischen Harich und Professor Havemann über die Rolle der Philosophie in der marxistischen Gesellschaft. Der Austausch der Argumente war wieder einmal durch das Argument der Gewalt abgewürgt worden.
Harich war ein maßgeblicher Lektor des Aufbau-Verlages gewesen und hatte viele Klassikerausgaben durch marxistische Vorworte umfunktioniert. Harichs Theaterkritiken schmückten die Spalten der langweiligsten Zeitung der Welt, des Blattes der Besatzungsmacht, »Tägliche Rundschau‹. Harich war der gesuchte Satiriker der ›Weltbühne‹, die in gleichgeschalteter Form und wie eine Parodie auf die Absichten ihrer Gründer Ossietzky und Tucholsky neu erschien. Harich war schließlich sogar Professor der Gesellschaftswissenschaften an der Ostberliner Universität geworden. Und nun, von einem Tag auf den anderen, sollte er schon lange versucht haben, »die verfassungsmäßige Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben und zu beseitigen«.
Das waren wohlbekannte Vorwürfe. So hatte auch Stalin stets die Ketzer für die Scheiterhaufen seiner Inquisition vorbereiten lassen. Ich erinnerte mich an mein Gespräch mit Becher über Koestlers ›Darkness at Noon‹. Er war nicht auf den Inhalt der furchtbaren Anklagen in diesem Buch eingegangen. Er hatte Harich mit aufgebaut, mochte auch wohl getan haben, was in seiner Macht lag, um ihn abzudecken. Als aber Harich dann in einem Anfall von Größenwahn oder weil er als Theoretiker der Macht die Praxis der Machtausübung aus den Augen verloren hatte, Ulbricht zu stürzen versuchte – im Zuge des Aufbruchs in Ungarn und Polen –, da schlug die Macht ihn nieder.
1957 wurde Harich zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 1964 hörte man über das einstige intellektuelle Paradepferd der SED lediglich, daß er seine Mutter besucht habe, Interviews ablehne und sich seinen Jean-Paul-Studien widmen wolle. »Die Partei, die Partei, die hat immer recht«, singt noch heute die ›Freie Deutsche Jugend‹ in der DDR – vierzehn Jahre nach Budapest und Harich, zwei Jahre nach Prag und Dubček. Die Partei und ihre Revolution, die immer wieder ihre Kinder frißt. Koestlers Hauptfigur, der von der GPU gefolterte konterrevolutionäre Volkskommissar Rubaschow, klopft Zeichen an seine Zellenwand. Sie werden nur noch von seinen Leidensgefährten gehört. Rubaschow wird ermordet, und Koestlers Buch schließt mit dem Satz: »Eine Welle hob ihn langsam hoch. Sie kam von ferne und reiste gemächlich weiter, ein Achselzucken der Unendlichkeit.«
2 Der Satyr von Nordhausen
Die Wellen leckten lauwarm den anthrazitfarbenen Sandstrand. Wir genossen Positano, nachdem wir eine lange Reise im VW von Berlin über die Alpen hinter uns hatten. Susi einmal ohne Kinder, ich einmal ohne Rundfunk – es war an der Zeit gewesen.
»Sieh da, sieh da, Thilone«, vernahm ich plötzlich auf deutsch. Dem Meer entstieg wie Zeus als Stier ein brauner Mann und lachte. Fehlte nur Europa auf seinem Rücken. So gemütlich-breit kann nur Rudolf Hagelstange lachen. Er war etwas oberhalb unseres Platzes ins Wasser gegangen, parallel zum Strand geschwommen und kam nun zufällig da an Land, wo wir auf unseren Handtüchern hockten. Ich habe Rudolf ziemlich oft getroffen, es machte sich so. Oft, wenn man bedenkt, daß wir im Nachkriegsdeutschland alle in der Provinz leben. Ein Zentrum, eine Hauptstadt, wo sich tout le monde trifft, gibt es nicht mehr. Immerhin, der Autor Hagelstange, ohnehin ständig auf Reisen, kam viel nach Berlin. Im Funk hatte ich seine ›Ballade vom verschütteten Leben‹ durchsetzen können gegen Widerstände der damaligen Programmdirektion. Willy Schmidt inszenierte das Epos, Wilhelm Borchert sprach den Haupttext so eindrucksvoll, daß es einer der stärksten Radioerfolge Rudolf Hagelstanges wurde. Es ist eine unheimliche Geschichte: Einige Landser waren bei Kriegsende verschüttet worden, konnten sich aber jahrelang in ihrem unterirdischen Verlies am Leben erhalten, da es ein Verpflegungslager der Wehrmacht war. Ob erfunden oder wahr, Hagelstange machte daraus ein langes Vers-Epos von eindringlicher Wirkung.
An einem heißen Sommertag eines Jahres in den Fünfzigern spürten wir ihn in einer kargen Behausung am Gardasee auf. Die Aussicht vom Fenster war so intensiv südlich, daß ein deutscher Romantiker oder genauer: ein romantischer Deutscher, wie wir beide es doch wohl sind, hingerissen sein mußte. Er übersetzte gerade einen alten Italiener in deutsche Verse. Tat sich offensichtlich schwer damit. Wir gingen in die nächste Trattoria, bestellten pasta asciutta und einen Orvieto. Nach dem Espresso höre ich ihn noch heute schallend singend die Wirtin rufen: »Signora, il conto.« Sie eilte herbei und strahlte ihn an. »Sùbito, sùbito, signore Rodolfo.«
Er war vielleicht von allen Schriftstellern, die ich persönlich kennenlernte, der ungebundenste, ein später Wandervogel und sicher oft von der Hand in den Mund lebend. Darum und um sein Talent habe ich ihn vielleicht zehn Jahre lang beneidet. Als ich dann endgültig nicht mehr »Schriftsteller und Journalist« angab, wenn man meinen Beruf wissen wollte, sondern »Journalist und Schriftsteller«, fühlte ich mich besser neben ihm. Auf eigenen Füßen, anderen Füßen, aber eben eigenen.
1965 oder so besuchte uns in Hausen ob Verena einmal der Landesvater von Baden-Württemberg, und ich lud Hagelstange mit Frau und Tochter dazu ein. Es entstand ein bemerkenswertes Streitgespräch zwischen Kiesinger und Rudolf über die Oder-Neiße-Grenze. Rudolf kam gerade aus Polen. Es war eine von beiden Seiten sehr sympathisch geführte Diskussion. Kiesingers Standpunkt ist bekannt. Und Rudolf? Ich wunderte mich, wie »links« er geworden war, der doch eigentlich immer eher konservativ auftrat, wenn er sich politisch äußerte. Er plädierte hier ohne Einschränkung für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, und das tat er so ruhig und begründet, daß auch der spätere Bundeskanzler aufmerksam und ohne einzuschnappen zuhörte.
Ich mag einige seiner lyrischen Gedichte besonders gern und auch den Roman ›Spielball der Götter‹. Hagelstange hat meistens sehr gute Titel – ›Zeit für ein Lächeln‹ zum Beispiel. Ich weiß, er wird heute vielfach abgelehnt, von den Jüngeren sowieso. Aber sein ›Altherrensommer‹ hat gerade wieder die Spitze der deutschen Bestsellerlisten erreicht. Es ist nicht seine beste Arbeit, denke ich, aber ich freue mich für ihn. Er war sehr ernsthaft krank, trägt ein Stück künstliche Aorta mit sich herum. Nun hat er ein doppeltes Comeback mit dem Buch – und mit einer schönen, sanften jungen Frau, die ihn begleitet.
Damals, in Positano, wirkte er auf mich wie ein ins zwanzigste Jahrhundert verschlagener griechischer Halbgott. Er hauste sehr einfach in einem weiß gekalkten Raum ohne Fenster. Kerze auf dem wackeligen Tisch, Chiantiflasche am primitiven Deckenlager, Käse und Weintrauben. Es ging immer etwas Dionysisches von ihm aus. Wenn wir in die untergehende Sonne hinein plauderten, er in seinem breiten Nordhäuser Thüringisch, das mich an meine Mutter erinnert, die aus Eisleben stammte, und die Nacht uns allmählich einhüllte, dann glich sein Gesicht mehr und mehr dem eines lächelnden Satyrs.
Von Positano aus machten wir einen unvergeßlichen Autoausflug nach Paestum. Rudolf hat eine Affinität zu dorischen Säulen, korinthischen Kapitälen, zum Griechischen, Archaischen überhaupt. Vielleicht kommt seine Seele direkt aus hellenistischen Jahrhunderten daher und wundert sich über ihre deutsche Inkarnation in dieser Zeit. Eine blonde, schlanke junge Dame war damals mit ihm: also hatte der Zeus-Stier doch die Europa am Gestade getroffen? Wir liefen ins Meer, nahmen die Frauen auf die Schultern und rangen in den Wellen miteinander wie Zentauren. Später fanden wir eine Kneipe – Rudolf findet überall und immer eine Kneipe –, und es ist ein großer Spaß, ihn das Menü zusammenstellen zu sehen. Am liebsten ginge er in die Küche, um alles zu beaufsichtigen, und immer hat er schnell Kontakt zum Personal. Seine ruhige, unerschütterliche Gutmütigkeit überträgt sich schnell, besonders auf einfache Leute.
Dennoch ist er selber keineswegs eine einfache Natur. Ich werde mich hüten, ihn zu analysieren, könnte es auch nicht. Immer wieder fasziniert mich sein kräftiges Äußeres – er wäre unter Fischern, Hirten, Jägern nicht aufgefallen – im Kontrast zu seinen ästhetischen Neigungen. Kein mir bekannter Autor legt so viel Wert auf kostbare Ausstattung und bibliophile Ausgaben seiner Bücher. Er war bald nach 1945 mit seinem berühmten ›Venezianischen Credo‹ da – gedruckt von Mardersteig in Verona, einem europäischen Meister unter den Büchermachern.
Zu Hause (zu Hause?) am Bodensee, in seiner Wohnung in Unteruhldingen, zeigte er uns köstliche Mappen mit Büttenblättern, und man sah, wie er das alles immer wieder mit den Augen begrüßte, ja liebkoste. Ein Feinschmecker in vielerlei Hinsicht. Ein Lebenskünstler auch? Doch wohl. Einmal traf ich ihn, als Hans-Egon Holthusen ihn auch gerade in Unteruhldingen besuchte – Holthusen, Autor des Buches ›Der unbehauste Mensch‹. Dieser Titel paßt genau zu Hagelstange. In der Tat, er ist und war und wird bleiben: unbehaust. Und so hat er viel von der Welt gesehen. Aber Rudolf, du warst dabei auch oft sehr einsam, dein ›Altherrensommer‹ bekennt es. Und alternde Halbgötter sollten nur noch in der Sonne liegen und sich verehren lassen. Oder unter reifen Trauben, die vom Vordach ihrer Hütte am Meer herabhängen.
3 Joana ist 4000 Jahre alt
Zum ersten Mal sah ich sie in Thornton Wilders ›Wir sind noch einmal davongekommen‹. Es mag 1947 gewesen sein. Das Hebbel-Theater in Berlin war elend kalt. Wir hatten mehrere Pullover übereinander gezogen, den Mantel anbehalten und Decken für die Füße mitgebracht. Joana Maria Gorvin spielte die Kammerzofe, und eine Dialog-Stelle ist mir in Erinnerung. Sie muß, in ziemlich leichtem Kostüm, zum Fenster hinausgucken und rufen: »Der Herr kommt nicht – oh, oh, oh, diese große Kälte.« Es gab einen langen ungeplanten situationsbezogenen Lacher.
In diesem und auch in anderen Stücken gab sie Sex-Schlangen, aufregend, lauernd, gefährlich, der Kleopatra-Typ – sie fixiert dich, und eh du was denken kannst, bist du verschlungen. Anders im Leben. Zwar hat die Gorvin auch in ihren Vierzigern eine erotische Ausstrahlung, eine intelligent-erotische. Aber Sex, das paßt weder als Wort noch als Ereignis zu ihr, schon deshalb nicht, weil sie immer eine Spur balkanesisch oder – um mit Rezzori zu reden – maghrebinisch erscheint und diese Spur sogar bewußt kultiviert.
Macht es ihre eiserne Selbstdisziplin, ihre künstlerische Besessenheit – selbst das Weibchenhafte, das sie durchaus auch überzeugend spielen kann, kommt bei ihr stilisiert und sublimiert heraus. Sie kann trinken wie ein Bauer, länger als routinierte Männer, besser zum Beispiel als Werner Höfer, der sie bei mir in Berlin eines Tages kennenlernte – obwohl der Großkollege aus Köln gern wacker mithält. Aber ihre Zunge rollt auch nach der dritten Flasche das »R« noch sicher; höchstens daß sie dann plötzlich mal kichert, hoch im Diskant und eine Spur irre.
Manchmal ist sie unheimlich in ihrer schlanken Alterslosigkeit, ihrer unwandelbaren Heiterkeit, der Sicherheit der Gesten, des Wortes. Hat sie Güte? Ein zu gemütlicher Begriff für sie. Kunstvoll macht sie sich rar. Sie nimmt Einladungen an, aber sie kommt gern spät. Schenkt nie einem einzelnen Gesprächspartner allzu lange ihre Gunst. Starallüren verabscheut sie und hat natürlich doch ein paar. In jeder Gesellschaft ist sie sehr bald Mittelpunkt, Star des Abends; sie braucht es gar nicht darauf anzulegen.
Ihre Stimme kann ganz tief gurren und ganz hell schneiden. Sie kommt mir manchmal vor, als wäre sie aus feinädrigem rosa Marmor. Aber auch die Göttin in ihr ist nur eine von mehreren Seiten. Ich habe sie kokett und weich wie eine junge Katze gesehen, fraulich und sogar weise – mit sehr blauen Augen unter dem echt schlohweißen Haar. Falls sie Depressionen hat, so verdrängt oder überspielt sie sie meisterhaft. Manchmal ist ihr keine Nacht lang genug; sie steckt die Lebenskerze gern an beiden Enden an.
Sie ist auf der Bühne groß – groß aber auch in der Society der bundesrepublikanischen Städte, in denen sie lebte. Heute in Hamburg, früher in Düsseldorf – nachdem sie aus Berlin wegging. Man sieht sie mit »Männern des öffentlichen Lebens« in den ›Vier-Jahreszeiten‹ speisen. Dennoch gab es nie Klatsch um sie. Sie ist eine Frau ohne Affären, ohne Schatten – scheint es wenigstens zu sein.
Der Regisseur Jürgen Fehling hat sie als junge Schauspielerin in Berlin entdeckt, hat sie gemacht – das war ihr Leben, bis er in die Nervenheilanstalt mußte. Seinetwegen ging sie nach Hamburg, wo er acht Jahre von Bürger-Prinz behandelt wurde. Jeden Tag, wenn irgend möglich, besuchte sie ihn, verreiste nach Möglichkeit nicht weiter als nach Sylt, um jederzeit zu ihm fliegen zu können. Sie hielt ihm die Treue, bis er 1968 mit 82 Jahren starb. Diese Liebe ist Theatergeschichte. Joana Maria Gorvin selbst ist ein Stück Theatergeschichte. Aber ihre persönliche Menschengeschichte ist interessanter. Wahrscheinlich wird sie nie bekannt werden. Ist Joana eine schöne Frau? Sie kann plötzlich wunderschön werden, und das bedeutet mehr als: es immer sein. Es gibt ein herrliches Porträt von ihr – viertausend Jahre ist es alt – die sogenannte ›Pariserin‹ an der Wand des Palastes von Knossos auf Kreta.
4 Die Lust, zu fabulieren
Alkohol in jeder Form spielt eine große Rolle ›Am grünen Strand der Spree‹, dem Roman, von dem man Mitte der fünfziger Jahre in Deutschland sprach. Ich war damals als Jurymitglied gern mitschuldig daran, daß Hans Scholz dafür den Fontane-Preis der Stadt Berlin erhielt.
Alkohol in jeder Form pflegte auch der Autor gern zu sich zu nehmen, ob in der »Vollen Pulle« oder im Old Fashioned, auf städtischen Empfängen oder privat. Letzteres am liebsten. Im trauten Kreise entfaltete Scholz unter seinen zahlreichen Talenten das überzeugendste – das Talent, aus dem Stegreif zu fabulieren, so daß kein Auge trocken blieb. Es mischten sich Heiteres und Ernstes in seinen Erzählungen meisterhaft. Vielerlei Gebildetes floß ein. Das alles gilt auch für sein Geschriebenes. Aber ihn selber zu hören, war das Größte. Scholzi-Polzi nannte man ihn.
Kriegserinnerungen können jede Geselligkeit töten. Nicht so bei Scholz. Eines Nachts kam er wie stets vom Hundertsten ins Tausendste und endlich auf die Geschichte, wie er 1945 auf der Flucht vor den Russen schwimmend die Elbe überquerte. Er schilderte, wie er sich mit einigen Kameraden auszog, wie Beschuß einsetzte, wie sie ins Wasser gingen, das noch recht kühl war, wie einer von ihnen getroffen in der Mitte des Flusses unterging, wie sie »bei den Amis« am anderen Ufer ankamen, total erschöpft, wie sie zum nächsten Dorf marschierten, nackte Männer in der Mai-Nacht.
Ich kann das nicht nacherzählen. Er demonstrierte alles und mußte selbst so sehr lachen über die komische Seite dieser todernsten Aktion, daß wir alle am Schluß atemlos waren vor Lachen.
Wenn ich behaupte, sein Fabulieren im geselligen Kreise sei sein stärkstes Talent, dann würdige ich durchaus, daß er besonders stolz auf sein Saxophon- und Klarinettenspiel war. In der ersten schlechten Zeit gastierte er »bei den Amis«, kassierte Zigaretten dafür, lebte und ließ leben.
Ich lasse auch nicht außer acht, daß er ausgebildeter Kunstmaler ist. »In Ostberlin bedeckte ich viele Quadratmeter mit geeigneten Farben. Keine Figur unter Lebensgröße, gegenständlich, versteht sich – schweigen wir darüber.«
Dann machte er mit Hello Weber Werbefilme, erfolgreiche. Und schließlich schrieb er ›Am grünen Strand der Spree‹. Einen Roman dieser Art gibt es in unserer Literatur selten. Er liest sich unterhaltend. Seine Thematik ist oft bitterernst. Der NS-Alpdruck auf uns wird nirgends verniedlicht. Aber Scholz sieht nicht nur die übermenschliche Tragödie, er sieht auch die menschliche Komödie – und in ihr wiederum das nationale Drama. Er trifft Situationen, ihren Jargon, so naturalistisch, daß man oft glaubt, ähnliche Szenen selber erlebt zu haben.
»Das ist ein Buch mit roten Streifen an der Hosennaht«, sagte der Stabsarzt außer Dienst, Dr. Gottfried Benn, als er es gelesen hatte. Er meinte mit den roten Streifen weniger den Generalstab als ein literarisches Qualitätsmerkmal und spielte damit auch auf Kapitel an, in denen Scholz deutsche Offiziere schildert, die keine SS-Bestien waren, sondern sich sogar in der Rolle des Besatzers – in diesem Fall in Norwegen – anständig benahmen. Das hat es ja auch gegeben.
Hans Scholz ist ein Kavalier, betont und natürlich, mit Selbstironie, »alte Schule«. So verehrte er Susanne Ericksen, das legendäre erste deutsche Starmannequin nach dem Kriege. Sie ist das geheime Vorbild einer Frauenfigur im ›Grünen Strand‹. Als Kavalier pflegt er auch zu zechen. Ich habe selbst nach der letzten Flasche nie unkontrollierte oder aggressive Handlungen bei ihm gesehen. Er gehörte in einige Berliner Lokale so sehr, daß man, wenn er nicht da war, das Gefühl hatte, sie wären eigentlich leer und es wäre nichts los.
Er hat volles weißes Haar, neigt zur Korpulenz, zwei sehr treublaue Augen blicken offen aus einem gesunden, fast quadratischen Gesicht. Er könnte in einem historischen Film sofort als gutmütiger friderizianischer Feldwebel auftreten, würde auch dessen Jargon sprechen. Er ist so echt ein Berliner, daß er nicht nur mit Spreewasser getauft wurde – der Vater, ein Rechtsanwalt, kam aus Schlesien und die Mutter, wie es sich gehört, aus Ostpreußen nach Berlin. Waschechter geht’s nicht. Sein Typ stirbt aus.
5 Ein verzweifeltes Zeitstück
Das letzte Mal sah ich ihn auf der Anklagebank. Er war beschuldigt, seinen Vater und dessen Geliebte ermordet zu haben. Er war mein »Stubenkamerad« gewesen. Seit achtzehn Jahren sitzt er, wurde damals zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Er hat nie ein Geständnis abgelegt. Er war nicht der Typ, der gesteht. Sie verurteilten ihn aufgrund von Indizien. Ein Gasschlauch und eine Zange spielten dabei belastende Rollen. Wenn es ein Mord war, dann war es ein perfekter Mord. Aber Dietrich Derz kämpft noch immer um die Wiederaufnahme seines Verfahrens. Im März 1970 brachte der ›Stern‹ einen großen Bericht über den »Gasmörder« im Zuchthaus Berlin-Tegel.
Eines Tages meldete sich am Telefon jemand so: »Dieter Derz hier. Kannst du dich erinnern?« Mich haben im Laufe der Zeit viele Kriegs- und Schulkameraden angerufen. Sie sahen oder hörten mich oder lasen von mir. Die meisten Namen sagten mir nichts mehr. An den aufsässigen Dieter Derz erinnerte ich mich sofort. Wir waren zusammen Rekruten gewesen in Aschersleben, 1940. Tatsächlich »lagen« wir – beim Militär »liegt« man seltsamerweise immer – auf derselben Stube. Der Kanonier Derz fiel schon in den ersten fünf Minuten auf. Und so blieb es. Ich war kein strammer Soldat, aber mein Widerstand war eher passiv. Anders Derz, ein kesser Berliner, keiner der Ausbilder war seinem Mundwerk gewachsen.
Ich erinnere mich an zwei Vorfälle unter mehreren anderen. Es war einer jener sinnlosen Kleiderappelle. Derz stand im selben Glied wie ich, ein paar Meter weiter unten, denn er war etwas kleiner, dafür aber auch stämmiger als ich. Wir hatten den Ausgehanzug überm Arm, mußten ihn vorzeigen. Bei Derz klopfte der Wachtmeister kurz auf den Rock. »Sehen Sie mich noch?« brüllte er. Das sollte bedeuten, da sei so viel Staub drin, daß durch das Klopfen eine ganze Staubwolke aufgestiegen wäre. Die Antwort hatte in so einem Fall zu lauten: »Nein, Herr Wachtmeister« oder auch »Jawoll, Herr Wachtmeister«. Derz dagegen sagte seelenruhig, aber in seinem provozierenden Berliner Tonfall und mit frischfröhlich-freier Stimme: »Natürlich sehe ich Sie, Sie stehen ja dicht genug vor mir.«
Der Wachtmeister war ein relativ ruhiger Vertreter. Er lief langsam an. Scheinbar beherrscht, trat er auf Derz zu. »Ihre Halsbinde sitzt schief, Derz.« Derz sagte nichts. »Darf ich Sie anfassen?« Diese Frage mußte laut Dienstvorschrift der Vorgesetzte stellen, aber es wurde erwartet, daß der Untergebene darauf mit »jawoll« reagierte. Nicht so Kamerad Derz. Er sagte schlicht »nein«. Dann ging es los: »Derz, links raus, marsch, marsch.« Er wurde geschliffen. So ging es weiter. Ich machte mir Sorgen um ihn, denn irgendwie imponierte er mir. Bei einem Schnaps in der Kantine erzählte er mir einmal von zu Hause. Er kam aus einer wohlhabenden, gutbürgerlichen Familie im Berliner Westen. So berlinerte er auch nicht ordinär, sondern arrogant. Mir wurde klar, daß er seine Mutter sehr liebte. Wir waren beide 19 Jahre alt. Ich versuchte, ihn von sinnlosen Provokationen abzubringen, denn die Ausbilder hatten sich natürlich vorgenommen, ihn »zur Minna« zu machen. Strafexerzieren, den Unteroffizieren die Stiefel putzen, Strafwachen, Latrine scheuern, es gab da ja viele Möglichkeiten.
»Betten bauen« war eine besonders sinnlose und beim deutschen Barras schikanös betriebene Idiotie. Ich hatte das im Arbeitsdienst lernen müssen. Die blau-weiß gewürfelten Laken mußten geometrisch abgezirkelt über die Wolldecken gezogen werden. Dem Dieter Derz warfen sie fast jeden Morgen sein Bett durcheinander, so daß er kaum zum Frühstücken kam. Ich und auch andere halfen ihm. Er hatte einen eisernen Willen und war auch ganz schön sportlich. Er blieb so rotzfrech wie am ersten Tage, aber lange konnte er das nicht mehr durchhalten. Es steuerte einem Knall zu, denn er ließ sich auch von mir nicht davon abhalten, Sturheit gegen Sturheit zu setzen.
Dann kam der Knall, aber er kam unheimlich lautlos. Wir hatten unseren ersten Ausgang; gemeinschaftlich noch, aber endlich konnten wir nach Wochen einmal das Kasernentor, die Mauern und den Stacheldraht hinter uns lassen. Im Gleichschritt wurde nach Aschersleben hineinmarschiert. Wir mußten einige dieser sinnvollen Soldatenlieder schmettern. Aschersleben war, wie jede Garnisonstadt, damals stolz auf sein Militär, und so lachte und lächelte und grüßte so mancher Bürger und manche Bürgerin zu unserer Marschkolonne freundlich herüber. Nun ja, das tat sogar wohl.
Irgendwann, irgendwo durften wir »wegtreten« für zwei Stunden und auf eigene Faust durchs Städtchen trampeln, mit den eleganten Nagelstiefelchen. Ich fand mich bald in einer sehr schönen Buchhandlung schnuppernd und blätternd, genoß rasch noch einen Kaffee mit Torte und Schlagsahne, und dann hieß es auch schon wieder »sammeln«. Uns fiel sofort auf, daß Derz fehlte, aber wir sagten nichts. Der Stubenälteste merkte es schließlich, meldete es. Rechts um, im Gleichschritt marsch, ein Lied ›Es ist so schön, Soldat zu sein, Ro-o-se-ma-rie, drei, vier …‹
Am anderen Morgen brachten sie ihn, als wir unseren Muckefuck mit Bemme und Kunsthonig verschlangen. Der UvD und ein Posten, in ihrer Mitte der Kanonier Derz. Er grinste wie immer. »Los, beeilen Sie sich«, sagte der UvD, und zu uns: »Weitermachen«. Dieter blinzelte mir zu, ich schnitt eine Grimasse, wagte aber nicht zu fragen. Er ging an seinen Spind, packte ein paar Sachen. Wir schnallten um, da pfiff es auch schon »raustreten«. »Auf Wiedersehen«, rief er uns nach, aber da herrschte ihn der UvD sofort an: »Maul halten, Derz«.
Es sprach sich bald rum, daß sie ihm vierzehn Tage »Bau« verpaßt hatten, weil er vom ersten Ausgang nicht rechtzeitig zurückgekommen war und dann auch noch »den Zapfen gewichst« hatte, wie es hieß, wenn man über den Zapfenstreich hinaus nachts nicht in der Kaserne erschien. Was war wirklich passiert? Er hatte seine Mutter, die er oft in Berlin anrief, darüber informiert, daß wir an jenem Tage unseren ersten Ausgang hatten. Sie war nach Aschersleben gekommen, um ihn zu sehen. Er hatte sie im besten Gasthof der Stadt getroffen, ihr gesagt, wir hätten Ausgang bis zum Wecken, hatte mit ihr in diesem Gasthof übernachtet und war erst am Morgen wieder in die Kaserne gekommen.
Er benahm sich von nun an diplomatischer. Ich war froh. Bis er eines Abends sagte: »Ich haue ab. Muß die Sache nur erst organisieren. Die sollen nicht denken, mich können sie fertigmachen.« Ich erzählte ihm, daß ich einen ähnlichen Fall im RAD-Lager Dippoldiswalde erlebt hatte. Da war auch einer getürmt, der es nicht mehr aushielt. Er kam sogar bis zur Schweizer Grenze. Sie schnappten ihn, er kam in unser Lager zurück, und bei der ersten Gelegenheit hängte er sich in der Zelle auf. Derz lachte: »So verrückt bin ich nicht. Ich will die ja überleben. Außerdem habe ich jemanden, der mir hilft.« »Deine Mutter?« Er nickte.
Unsere Rekrutenzeit ging vorüber. Wir kamen zu verschiedenen Einheiten, verloren uns aus den Augen.
Jener Telefonanruf in Berlin – es mag Ende der vierziger Jahre gewesen sein, wohl noch während der Blockade – war dann das erste, was ich wieder von ihm hörte. Wir trafen uns natürlich. Er lud mich zu sich ein. »Es wird dir schon gefallen bei uns«, sagte er. In einem riesigen roten Backsteingebäude hatten die Derz’ eine geräumige, weitläufige Wohnung. Dieters Vater war Leiter des Wohnungsamtes in Steglitz, eine gute Stellung in jenen von Not und Trümmerelend gezeichneten Jahren.
Es war gemütlich warm im Wohnzimmer. Er fragte mit seiner frischen, immer leicht ironischen Stimme: »Was darf es sein, Herr Kamerad. Wodka oder Whisky? Nach deinen Radiosendungen zu schließen, Whisky, was?«
Er hatte alles, was es damals nicht gab, und erzählte mir bruchstückhaft sein Schicksal. Soweit ich verstand, war er irgendwann tatsächlich fahnenflüchtig geworden, hatte zunächst Zuchthaus und Strafkompanie bekommen und zuletzt in einem KZ Untertage in Rüstungsbetrieben arbeiten müssen. Dort organisierte er Sabotage und Widerstand, so sagte er, hatte aber wunderbarerweise alles überlebt und genoß nun die Vorzüge eines anerkannten Opfers des Faschismus. Einen rechten Beruf übte er anscheinend nicht aus.
Der Abend dauerte lange. Es gab auch noch einen zweiten Abend, da erschien ein sympathisches Mädchen, das er mir als seine Frau vorstellte. Wir gingen zusammen noch wohin, in ein ziemlich wüstes Tanzlokal mitten unter Trümmern. Dieter war da zu Hause, hatte jede Menge Kredit, lud alle Leute ein. Auf einer bestimmten Ebene verstand ich mich mit ihm ganz gut, nur sein ewiger Zynismus gefiel mir nicht. Wie schon damals in Aschersleben versuchte ich, ihn zu beeinflussen, irgendwie sogar zu bekehren. »Ein Mann mit deinem Schicksal«, mag ich wohl gesagt haben, »sollte am Wiederaufbau mitwirken. Wofür hast du denn so gelitten und warum? Jetzt müssen wir sehen, daß so etwas wie die Nazis und ihr Kommiß nicht wiederkommen. Tu doch was Positives.«
»Tu ich ja«, grinste er dann, »oder nicht, Puppe?»
Wir verloren uns ein zweites Mal aus den Augen.
Bis ich in der Zeitung las: »Dietrich Derz wegen Doppelmord angeklagt.« War das mein Derz?
Ich informierte mich. Dieters Vater und dessen langjährige Freundin waren eines Morgens tot in ihren Betten aufgefunden worden: Gasvergiftung. Es war in jener Wohnung in dem roten Backsteingebäude passiert, die ich kannte. Vom Gasherd im Bad war das Gas ins Schlafzimmer gedrungen.
Dann las ich noch, Dieters Mutter habe kurze Zeit zuvor Selbstmord begangen …