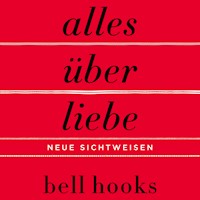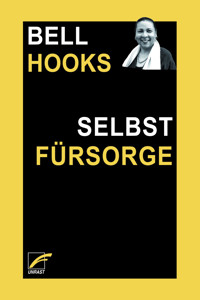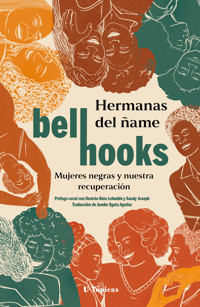13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ain’t I a Woman" – "Bin ich etwa keine Frau?" – ist ein feministischer und antirassistischer Klassiker. Der Titel nimmt Bezug auf Sojourner Truth, die bereits 1851 die Teilhabe Schwarzer Frauen an der von Weißen initiierten und dominierten Frauenbewegung in den USA eingefordert hatte. bell hooks zeigt in diesem Buch, das sie 1981 als junge Autorin verfasste, dass auch die Neue Frauenbewegung in den USA kaum daran interessiert war, für die Belange Schwarzer Frauen zu kämpfen. Sie erinnert an die von extremem Rassismus und Sexismus geprägten, herzzerreißenden Erfahrungen Schwarzer Frauen während der Sklaverei, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Bilder und Stereotype über Schwarze Frauen hatten und mit einer nachhaltigen Entwertung Schwarzer Weiblichkeit einhergingen. Darüber hinaus analysiert sie den Sexismus weißer und Schwarzer Männer sowohl in den Zeiten der Bürgerrechtsbewegung als auch in der Gegenwart und wirft einen kapitalismuskritischen Blick auf die geschlechterspezifische Arbeitsteilung in der Gesellschaft, die sich insbesondere in Schwarzen Familien auswirkt. In diesem Buch zeigt sich bereits ein Anliegen, das sich durch ihr Werk und ihr Leben wie ein roter Faden zieht: aufzuzeigen und sichtbar zu machen, wie sich Schwarze Frauen aller Hürden und Widerstände zum Trotz in der feministischen Bewegung engagiert haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman ? Black Women and Feminism einen Namen weit über wissenschaftliche Kreise hinaus. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.
bell hooks
Ain’t I a Woman?
Schwarze Frauen und Feminismus
Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
bell hooks: Ain’t I a Woman?:
1. Auflage, April 2023
eBook UNRAST Verlag, Juni 2023
ISBN 978-3-95405-156-4
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Titel der Originalausgabe:
Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, 2nd Edition 2015
Erstveröffentlichung South End Press, 1981
Copyright © 2015 Gloria Watkins
Alle Rechte vorbehalten
Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe,
herausgegeben von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Unrast Verlag, Münster
Satz: Unrast Verlag, Münster
Für Rosa Bell, meine Mutter – die mir als Kind erzählte, dass sie einst Gedichte geschrieben hatte. Meine Liebe zum Lesen und meine Leidenschaft für das Schreiben habe ich von ihr geerbt.
Anmerkung des Verlags
Für die deutsche Übersetzung haben wir die englische Originalausgabe von 1981 bzw. 2015 rassismuskritisch und gendersensibel bearbeitet. Wie in Unrast-Büchern üblich haben wir ›Schwarz‹ als politischen Kampfbegriff konsequent groß geschrieben. Zudem wurde insbesondere das ›N-Wort‹ mit ›N*‹ übersetzt. Den verharmlosenden Begriff Sklav:innen haben wir durch Versklavte ersetzt. Hiervon ausgenommen sind Zitate explizit rassistischer Autor:innen, die wir bis auf das N-Wort in ihrem unsäglichen Vokabular belassen haben. Der Begriff race wurde nicht übersetzt, weil er nicht das gleiche bedeutet wie das deutsche Wort ›Rasse‹. Der deutsche Begriff ist biologistisch und so konnotiert, dass er fälschlicherweise die Existenz von ›Menschenrassen‹ behauptet. Beim englischen Begriff race hingegen wird deutlich, dass es sich um ein ideologisches Konstrukt handelt, das überwiegend kulturell und soziopolitisch konnotiert ist und sich zunehmend auch zu einem emanzipatorischen Begriff entwickelt.
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage (2015)
Danksagung (1981)
Einleitung
1 Sexismus und die Erfahrungen Schwarzer Frauen während der Sklaverei
2 Die anhaltende Abwertung Schwarzer Frauen
3 Die imperiale Herrschaft des Patriarchats
4 Rassismus und Feminismus
5 Schwarze Frauen und Feminismus
Bibliografie
Anmerkungen
Vorwort zur Neuauflage (2015)
Schon als Kind wusste ich, dass ich Schriftstellerin werden wollte. Von klein auf boten mir Bücher Visionen von neuen Welten, die sich von der mir vertrauten Welt unterschieden. Wie exotische und fremde neue Länder versprachen Bücher Abenteuer und zeigten mir neue Wege zu denken und zu leben auf. Vor allem aber eröffneten sie mir andere Perspektiven, die mich fast immer aus meiner Komfortzone herausführten. Ich war beeindruckt davon, dass Bücher einen anderen Blickwinkel bieten konnten, dass Worte auf einer Buchseite mich verwandeln und verändern, meine Meinung ändern konnten. Während meiner Studienzeit an der Universität stellte die zeitgenössische feministische Bewegung sexistisch definierte Geschlechterrollen infrage und forderte ein Ende des Patriarchats. In jenen aufregenden Tagen war women’s liberation, Frauenbefreiung, die Bezeichnung, die man dieser erstaunlichen neuen Denkweise über die Beziehungen zwischen den Geschlechtern gab. Da ich nie das Gefühl hatte, in den traditionellen sexistischen Vorstellungen davon, was eine Frau sein und tun sollte, einen Platz zu haben, wollte ich unbedingt in der Frauenbewegung mitwirken und einen Raum der Freiheit für mich selbst, für die Frauen, die ich liebte, für alle Frauen schaffen.
Meine intensive Beschäftigung mit feministischer Bewusstseinsbildung zwang mich, mich mit der Realität rassistischer, klassistischer und sexistischer Differenz auseinanderzusetzen. Aber genauso wie ich gegen sexistische Vorstellungen über die Stellung der Frau rebelliert hatte, stellte ich auch die in den Kreisen der Frauenbewegung kursierenden Vorstellungen über die Stellung der Frau und ihre Identität infrage, weshalb ich innerhalb der Bewegung keinen rechten Platz für mich fand. Meine Erfahrungen als junge Schwarze Frau wurden dort nicht anerkannt. Meine Stimme und die Stimmen von Frauen wie mir wurden nicht gehört. Vor allem aber hatte die Bewegung mir vor Augen geführt, wie wenig ich über mich selbst und meinen Platz in der Gesellschaft wusste.
Ich konnte nicht wirklich zur Bewegung gehören, solange meine Stimme nicht gehört wurde. Bevor ich verlangen konnte, dass andere mir zuhörten, musste ich allerdings mir selbst zuhören, um meine Identität zu entdecken. Durch den Besuch vieler Kurse in Women’s Studies wurde mir bewusst, welche Erwartungen die Gesellschaft an Frauen stellt. Ich hatte viel Neues über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gelernt, über Sexismus und Patriarchat und die Art und Weise, wie diese Systeme die weiblichen Genderrollen und die weibliche Identität prägen, aber ich hatte wenig über die Rolle gelernt, die Schwarzen Frauen in unserer Kultur zugewiesen wird. Um mich selbst als Schwarze Frau zu verstehen, um zu verstehen, welcher Platz Schwarzen Frauen in dieser Gesellschaft zugedacht ist, musste ich über den Hörsaal hinausgehen, musste über die vielen Abhandlungen und Bücher hinausschauen, die meine weißen Mitstreiterinnen verfasst hatten, um die Frauenbewegung zu erklären und um neue, alternative, radikale Denkweisen über Gender und die Stellung von Frauen zu entwickeln.
Damit in dieser revolutionären Bewegung für Geschlechtergerechtigkeit auch Schwarze Frauen einen Platz erhalten konnten, musste ich mein Verständnis für unsere Stellung in der Gesellschaft als Ganzes vertiefen. Ich lernte so viel über Sexismus und über die Art und Weise, wie sexistisches Denken die weibliche Identität prägt, aber mir wurde nicht vermittelt, wie Rassismus die weibliche Identität prägt. Wenn ich in Kursen und bewusstseinsbildenden Frauengruppen auf die Unterschiede aufmerksam machte, die durch ›unterschiedliche Hautfarben‹ und den Rassismus in unserem Leben geschaffen werden, wurde ich von weißen Mitstreiterinnen, die eifrig bemüht waren, sich auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses von Schwesterlichkeit zusammenzuschließen, oft mit Geringschätzung behandelt. Und da war ich nun, diese unerschrockene junge Schwarze aus dem ländlichen Kentucky, die darauf bestand, dass es große Differenzen zwischen den Erfahrungen von Schwarzen und weißen Frauen gab. Meine Bemühungen, diese Unterschiede zu verstehen, ihre Bedeutung zu erklären und zu vermitteln, waren der Ausgangspunkt für das Schreiben von Ain’t I a Woman? Schwarze Frauen und Feminismus.
Mit dem Forschen und Schreiben hatte ich bereits während meines Studiums angefangen. Es erstaunt mich immer wieder, dass schon mehr als vierzig Jahre vergangen sind, seit ich mit der Arbeit an diesem Buch begann. Zunächst suchte ich vergeblich nach einem Verlag. Damals konnte sich noch niemand wirklich vorstellen, dass es ein Publikum für eine Arbeit über Schwarze Frauen gäbe. Im Allgemeinen tendierten Schwarze zu dieser Zeit eher dazu, women’s liberation als ein weißes Frauending abzulehnen. Das führte dazu, dass einzelne Schwarze Frauen, die sich der Bewegung begeistert anschlossen, sich von anderen Schwarzen isolierten und entfremdeten. Für gewöhnlich waren wir die einzigen Schwarzen Personen in mehrheitlich weißen Zirkeln. Und jedes Sprechen über race wurde als Ablenkung vom Fokus der Genderpolitik wahrgenommen. Kein Wunder also, dass Schwarze Frauen eigene, gesonderte Texte schreiben mussten, die unser Verständnis von race, Klasse und Gender zusammendachten.
Indem ich radikale feministische Politik mit meinem Drang zu schreiben verband, beschloss ich schon früh, dass ich Bücher schreiben wollte, die über Klassengrenzen hinweg gelesen und verstanden werden konnten. Damals rangen feministische Denkerinnen mit der Frage nach der Zielgruppe: Wen wollten wir mit unserer Arbeit erreichen? Um ein breiteres Publikum zu erreichen, mussten wir klare und prägnante Texte schreiben, die auch von Menschen gelesen werden konnten, die nie eine Hochschule besucht oder auch nur die High School abgeschlossen hatten. Ich stellte mir meine Mutter als die idealtypische Leserin vor, die ich zu erreichen suchte. Sie war die Leserin, die ich am ehesten zu feministischem Denken bekehren wollte, und so entwickelte ich eine Schreibweise, die von Lesenden mit unterschiedlichem Klassenhintergrund verstanden werden konnte.
Der Abschluss des Schreibens von Ain’t I a Woman und Jahre später die Veröffentlichung des Werks in meinen späten Zwanzigern markierten den Höhepunkt meines eigenen Kampfes um vollständige Selbstverwirklichung, darum, eine freie und unabhängige Frau zu sein. Als ich meinen ersten Kurs in Women’s Studies bei der weißen Schriftstellerin Tillie Olson besuchte und ihr zuhörte, wie sie über die Welt der Frauen sprach, die sich abmühen, erwerbstätig und gleichzeitig Mütter zu sein, Frauen, die oft durch männliche Dominanz eingeschränkt werden, da weinte ich, so wie sie weinte. Wir lasen ihr bahnbrechendes Werk Ich steh hier und bügle, und ich begann, meine Mutter und Frauen wie sie, die alle in den fünfziger Jahren aufgewachsen waren, in einem neuen Licht zu sehen. Mama hatte jung geheiratet, als sie noch nicht einmal zwanzig Jahre alt war, bekam früh Kinder, und obwohl sie sich selbst nie als Emanze bezeichnet hätte, hatte sie sehr wohl den Schmerz sexistischer Herrschaft erfahren. Und das veranlasste sie dazu, alle ihre Töchter, alle sechs von uns, zu ermutigen, uns zu bilden und zu qualifizieren, damit wir in der Lage sein würden, für unsere materiellen und wirtschaftlichen Bedürfnisse selbst zu sorgen und niemals von einem Mann abhängig sein würden. Natürlich sollten wir einen Mann finden und heiraten, aber nicht bevor wir gelernt hätten, für uns selbst zu sorgen. Mama, die selbst von den Fesseln des Patriarchats gefangen gehalten wurde, ermutigte uns, uns zu befreien.
Wie bei keinem anderen Buch, das ich geschrieben habe, hat mich die Beziehung zu meiner Mutter beim Schreiben von Ain’t I a Woman beeinflusst und inspiriert. Es wurde geschrieben, als die zeitgenössische feministische Bewegung noch jung war, als ich jung war. Dieses frühe Werk mag manche Schwächen und Mängel aufweisen, doch es gibt Lesenden, die die Grundlagen der Erfahrungen Schwarzer Frauen und des Feminismus erforschen wollen, weiterhin wertvolle Impulse. Auch wenn Mama verstorben ist, vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie und all die Schwarzen Frauen wie sie denke, die ohne politische Bewegung im Rücken und ohne jede Theorie darüber, wie man feministisch sein kann, praktische Modelle für die Emanzipation lieferten und den Generationen, die nach ihnen kamen, das Geschenk der Wahlmöglichkeit, der Freiheit, der Integrität von Körper, Geist und Seele machten.
Danksagung (1981)
Vor acht Jahren, als ich mit den Recherchen für dieses Buch begann, waren Diskussionen über »Schwarze Frauen und Feminismus« oder »Rassismus und Feminismus« unüblich. Bekannte wie auch Fremde waren sehr schnell geneigt, meine Beschäftigung mit dem Schicksal Schwarzer Frauen in den Vereinigten Staaten infrage zu stellen und lächerlich zu machen. Ich erinnere mich an ein Abendessen, bei dem ich über das Buch sprach und eine Person mit lauter, dröhnender und vor Lachen erstickter Stimme ausrief: »Was gibt es schon über Schwarze Frauen zu sagen?« Andere stimmten in das Gelächter ein. Ich hatte in meinem Manuskript geschrieben, dass die Existenz Schwarzer Frauen oft vergessen wird, dass wir oft ignoriert oder übergangen werden, und die Erfahrungen, die ich bei der Vermittlung der in diesem Buch dargelegten Ideen machen musste, waren der Beweis, dass ich mit meiner Behauptung Recht hatte.
In den meisten Phasen meiner Arbeit hatte ich die Hilfe und Unterstützung von Nate, meinem Freund und Begleiter. Er war es, der, als ich zum ersten Mal aus den Bibliotheken nach Hause kam, wütend und enttäuscht darüber, dass es so wenige Bücher über Schwarze Frauen gab, zu mir sagte, dass ich eines schreiben sollte. Er recherchierte auch Hintergrundinformationen und unterstützte mich in vielerlei Hinsicht. Eine enorme Quelle der Ermutigung und Unterstützung für meine Arbeit waren meine Schwarzen Kolleginnen im Berkeley Telephone Office in den Jahren 1973/74. Als ich von dort wegging, um in Wisconsin zu studieren, verlor ich den Kontakt zu diesen Frauen. Aber ihre Energie, ihr Gespür dafür, dass es viel über Schwarze Frauen zu sagen gibt, und ihr Glaube daran, dass ›ich‹ es sagen kann, haben mich bestärkt. Bei der Veröffentlichung war Ellen Herman von South End Press eine große Hilfe. Unsere Beziehung war eine politische; wir haben daran gearbeitet, die Kluft zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten zu überbrücken und den Kontakt zwischen Autorin und Verlegerin zu einer positiven menschlichen und nicht zu einer rein funktionalen Erfahrung zu machen.
Dieses Buch ist Rosa Bell Watkins gewidmet, die mich und all ihre Töchter lehrte, dass Schwesterlichkeit und Frauensolidarität uns stark machen, indem wir uns gegenseitig respektieren, beschützen, ermutigen und lieben.
Einleitung
Es gab einen Zeitpunkt in der US-amerikanischen Geschichte, an dem sich Schwarze Frauen aus allen Teilen des Landes hätten zusammenschließen können, um ihre soziale Gleichstellung zu fordern und zu verlangen, dass die Auswirkungen des Sexismus auf ihren sozialen Status anerkannt werden. Doch wir haben im Großen und Ganzen geschwiegen. Unser Schweigen war keine Abwehrreaktion gegen die weiße Frauenbewegung oder eine Geste der Solidarität mit Schwarzen männlichen Patriarchen. Vielmehr war es das Schweigen der Unterdrückten – jenes tiefe Schweigen, das durch Resignation und Ergebung in das eigene Schicksal entsteht. Schwarzen Frauen von heute fällt es schwer, sich zusammenzuschließen, um für Frauenrechte zu kämpfen, weil wir ›Frausein‹ nicht als einen wichtigen Aspekt unserer Identität ansehen. Durch unsere rassistische und sexistische Sozialisation sind wir darauf konditioniert, unsere Weiblichkeit weniger wichtig zu nehmen und race als das einzig relevante Merkmal unserer Identität zu betrachten. Mit anderen Worten, wir wurden gedrängt, einen Teil von uns selbst zu verleugnen – und wir taten es. Folglich erklärten wir, als die Frauenbewegung das Problem der sexistischen Unterdrückung adressierte, dass Sexismus angesichts der härteren, brutaleren Realität des Rassismus unbedeutend sei. Wir hatten Angst, uns einzugestehen, dass Sexismus genauso unterdrückerisch sein kann wie Rassismus. Wir klammerten uns an die Hoffnung, dass die Befreiung von rassistischer Unterdrückung alles sei, was wir bräuchten, um frei zu sein. Wir waren eine neue Generation Schwarzer Frauen, aber es war uns beigebracht worden, uns unterzuordnen und die Unterlegenheit aufgrund unseres Geschlechts stillschweigend zu akzeptieren.
Anders die Schwarzen Frauen in den USA im 19. Jahrhundert: Sie waren sich der Tatsache bewusst, dass wahre Freiheit nicht nur die Befreiung von einer sexistischen Gesellschaftsordnung bedeutete, die dem weiblichen Geschlecht systematisch die vollen Menschenrechte verweigerte. Die Schwarzen Frauen damals beteiligten sich sowohl am Kampf für die Gleichstellung der Schwarzen als auch an der Frauenrechtsbewegung. Auf die Frage, ob ihre Beteiligung an der Frauenrechtsbewegung dem Kampf für die Gleichheit aller rassifizierten Gruppen schade, antworteten sie, dass jede Verbesserung ihres sozialen Status allen Schwarzen zugutekäme. In ihrer Rede vor dem World’s Congress of Representative Women im Jahr 1893 sprach Anna Cooper über den Status der Schwarzen Frauen:
»Die Höherentwicklung der Zivilisation kann nicht aus dem Stegreif erfolgen, und sie kann auch nicht in der kurzen Zeitspanne von dreißig Jahren erreicht werden. Sie bedarf des langen und schmerzhaften Wachsens über Generationen hinweg. Doch während der gesamten dunkelsten Periode der Unterdrückung von Frauen of Color in diesem Land ist ihre noch ungeschriebene Geschichte voll von heroischem Kampf, einem Kampf gegen furchtbare und überwältigende Widrigkeiten, der oft mit einem grausamen Tod endete, um das zu erhalten und zu schützen, was der Frau wichtiger ist als das eigene Leben. Das leidvolle, geduldige und stille Bemühen von Müttern, für ihre Töchter das Recht an ihren eigenen Körpern zu erlangen, der verzweifelte Kampf, wie der einer gefangenen Tigerin, um die Unverletzlichkeit und Ehrbarkeit der eigenen Person zu bewahren, würde Stoff für Dramen liefern. Dass mehr Frauen in der Flut untergingen als den Strom aufhielten, ist nicht außergewöhnlich. Die Mehrheit unserer Frauen sind keine Heldinnen – aber ich weiß nicht, ob die Frauen irgendeiner race mehrheitlich Heldinnen sind. Es genügt mir zu wissen, dass die afroamerikanische Frau, während sie in den Augen des höchsten Gerichts in den USA nur als Vieh betrachtet wurde, als ein unmündiges Objekt, ein stumpfer Klotz, der nach dem Willen des Besitzers hin- und hergestoßen werden konnte, an Idealen der Weiblichkeit festhielt, die den Idealen Anderer in nichts nachstanden. In ungelehrten Köpfen schlummern oder gären solche Ideale, ohne dass sie vor der Nation Gehör finden könnten. Die weiße Frau konnte zumindest für ihre eigene Emanzipation eintreten; die doppelt versklavten Schwarzen Frauen hingegen konnten nur leiden und im Stillen kämpfen.«
Zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte durchbrachen Schwarze Frauen wie Mary Church Terrell, Sojourner Truth, Anna Cooper, Amanda Berry Smith und andere die lange Zeit des Schweigens und begannen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sie aufzuzeichnen. Dabei betonten sie insbesondere den ›weiblichen‹ Aspekt ihres Wesens, der dazu führte, dass sich ihr Schicksal von dem der Schwarzen Männer unterschied. Diese Tatsache wurde offensichtlich, als weiße Männer dafür eintraten, dass Schwarzen Männern das Wahlrecht gewährt wurde, alle Frauen aber davon ausgeschlossen bleiben sollten. Horace Greeley und Wendell Phillips sprachen von der »Stunde des N*«, aber in Wirklichkeit war das, was als Schwarzes Wahlrecht bezeichnet wurde, nur das Wahlrecht für Schwarze Männer. Indem sie dies befürworteten und die weißen Frauenwahlrechtsaktivistinnen schlechtmachten, offenbarten die weißen Männer die Abgründe ihres Sexismus – eines Sexismus, der in diesem kurzen Moment der US-amerikanischen Geschichte größer war als ihr Rassismus. Bevor weiße Männer das Wahlrecht für Schwarze Männer unterstützten, hatten weiße Frauenrechtlerinnen geglaubt, dass es ihrer Sache dienlich wäre, sich mit Schwarzen politischen Aktivisten zu verbünden. Als es jedoch so aussah, als könnten Schwarze Männer das Wahlrecht erhalten, während Frauen weiterhin entrechtet blieben, geriet die politische Solidarität mit den Schwarzen in Vergessenheit, und sie drängten weiße Männer dazu, rassistische Solidarität über ihre Pläne zur Unterstützung des Wahlrechts für Schwarze Männer zu stellen.
Als der Rassismus der weißen Frauenrechtlerinnen offen zutage trat, war das fragile Band zwischen ihnen und den Schwarzen Aktivistinnen zerrissen. Obwohl Elizabeth Stanton in ihrem Artikel »Women and Black Men«, der in der Ausgabe der Zeitschrift Revolution von 1869 veröffentlicht wurde, zu zeigen versuchte, dass der republikanische Ruf nach dem ›Männerwahlrecht‹ darauf abzielte, einen Antagonismus zwischen Schwarzen Männern und allen Frauen zu schaffen, konnte der Bruch zwischen den beiden Gruppen nicht mehr überwunden werden. Viele Schwarze politische Aktivisten sympathisierten zwar mit der Sache der Frauenrechtlerinnen, waren aber nicht bereit, ihre eigene Chance auf das Wahlrecht zu verspielen. Schwarze Frauen befanden sich in einer Zwickmühle: Die Unterstützung des Frauenwahlrechts würde bedeuten, sich mit weißen Aktivistinnen zu verbünden, die öffentlich ihren Rassismus offenbart hatten, aber die Unterstützung des Wahlrechts nur für Schwarze Männer käme der Bestätigung der patriarchalen Gesellschaftsordnung gleich, die ihnen keinerlei politische Stimme zubilligte. Die radikaleren Schwarzen Aktivistinnen forderten das Wahlrecht sowohl für Schwarze Männer als auch für alle Frauen. Sojourner Truth war die Schwarze Frau, die sich in dieser Frage am deutlichsten positionierte. Sie sprach sich öffentlich für das Frauenwahlrecht aus und betonte, dass sich Schwarze Frauen ohne dieses Recht dem Willen Schwarzer Männer unterwerfen müssten. Berühmt ist ihre Aussage: »Es gibt viel Diskussion darüber, dass Männer of Color ihre Rechte bekommen, aber kein Wort über die Frau of Color; und wenn Männer of Color ihre Rechte bekommen und Frauen of Color nicht, werden die Männer of Color Herren über die Frauen sein, und es wird genauso schlimm sein wie vorher.« Damit erinnerte sie die US-amerikanische Öffentlichkeit daran, dass die sexistische Unterdrückung eine ebenso reale Bedrohung für die Freiheit der Schwarzen Frauen war wie die rassistische. Doch trotz der Proteste weißer und Schwarzer Feministinnen setzte sich der Sexismus durch und nur Schwarze Männer erhielten das Wahlrecht.
Obwohl Schwarze Frauen und Männer während der Sklaverei und in der Zeit danach, in weiten Teilen der Reconstruction-Ära, gleichermaßen für ihre Befreiung gekämpft hatten, hielten Schwarze politische Anführer an patriarchalen Werten fest. Während Schwarze Männer in allen Bereichen der US-amerikanischen Gesellschaft aufstiegen, drängten sie Schwarze Frauen dazu, eine untergeordnete Rolle einzunehmen. Und so wurde der radikale revolutionäre Geist, der dem intellektuellen und politischen Gestaltungsanspruch der Schwarzen Frauen im 19. Jahrhundert eigen gewesen war, allmählich erstickt. Im 20. Jahrhundert änderte sich ihre Rolle in den politischen und sozialen Kämpfen der Schwarzen Bevölkerung grundlegend. Dieser Wandel war Ausdruck eines allgemeinen Nachlassens der Bemühungen aller US-amerikanischen Frauen, radikale soziale Reformen durchzusetzen. Als die Frauenrechtsbewegung in den 1920er-Jahren endete, verstummten auch die Stimmen der Schwarzen Frauenrechtsaktivistinnen. Der Krieg hatte die Bewegung ihres früheren Elans beraubt. Schwarze Frauen nahmen zwar ebenso wie Schwarze Männer am Überlebenskampf teil, indem sie, wann immer möglich, in den Arbeitsmarkt eintraten, aber sie engagierten sich nicht für ein Ende des Sexismus. Schwarze Frauen des 20. Jahrhunderts hatten gelernt, Sexismus als etwas vermeintlich Naturgegebenes, als eine unabänderliche Tatsache des Lebens zu akzeptieren. Hätte man in den 1930er- und 1940er-Jahren Umfragen unter ihnen durchgeführt und sie gebeten, die bedrückendste Kraft in ihrem Leben zu nennen, so hätte Rassismus ganz oben auf der Liste gestanden und nicht Sexismus.
Als in den 1950er-Jahren die Bürger:innenrechtsbewegung begann, kämpften Schwarze Frauen und Männer wieder gemeinsam für ihre Rechte, doch erhielten Schwarze Aktivistinnen nicht die öffentliche Anerkennung, die Schwarzen Männern zuteilwurde. Sexistische Rollenmuster waren in den Schwarzen Communitys ebenso die Norm wie in jeder anderen Gruppe der US-amerikanischen Gesellschaft. Es war unter Schwarzen eine akzeptierte Tatsache, dass die am meisten verehrten und respektierten Köpfe der Bewegung Männer waren. Diese Männer definierten Freiheit als das Recht auf volle, gleichberechtigte Teilhabe an der US-amerikanischen Kultur; das Wertesystem dieser Kultur lehnten sie nicht ab. Folglich stellten sie auch die Rechtmäßigkeit des Patriarchats nicht infrage. Die Schwarze Befreiungsbewegung der 1960er-Jahre war das erste Mal, dass Schwarze einen Kampf gegen den Rassismus führten, in dem klare Grenzen zwischen männlicher und weiblicher Rolle gezogen wurden. Die Schwarzen männlichen Aktivisten gaben öffentlich zu, dass sie von Schwarzen Frauen, die sich an der Bewegung beteiligten, erwarteten, dem sexistischen Rollenmuster zu entsprechen. Es wurde verlangt, dass sie sich unterordneten. Ihnen wurde gesagt, dass sie sich um den Haushalt kümmern und Krieger für die Revolution heranziehen sollten. Toni Cades Artikel »On the Issue of Roles« setzt sich mit den sexistischen Einstellungen, die in den 1960er-Jahren in Schwarzen Organisationen vorherrschten, auseinander:
»Es scheint, dass jede erdenkliche Organisation schon einmal mit scheinbar meuternden Frauenkadern zu kämpfen hatte, die sich darüber aufregten, dass sie die Telefone bedienen oder den Kaffee kochen mussten, während die Männer die Strategiepapiere schrieben und über die politische Vorgehensweise entschieden. Einige Gruppen wiesen den Frauen gönnerhaft zwei oder drei Posten in der Geschäftsführung zu. Andere ermutigten die Schwestern, eine eigene Fraktion zu bilden und etwas auszuarbeiten, das die Organisation nicht spaltete. Wieder andere wurden böse und zwangen die Frauen hinauszugehen, um separate Workshops zu organisieren. Im Laufe der Jahre haben sich die Wogen etwas geglättet. Aber mir ist noch keine nüchterne Analyse darüber zu Ohren gekommen, welchen Standpunkt eine bestimmte Gruppe in dieser Frage einnimmt. Immer wieder höre ich von irgendwelchen Typen, dass Schwarze Frauen unterstützend und geduldig sein müssen, damit Schwarze Männer ihre Männlichkeit wiedererlangen können. Über den Begriff Weiblichkeit denken sie nur nach, wenn sie dazu gedrängt werden, und dann erklären sie, er hänge davon ab, wie der Mann seine Männlichkeit definiert. Die Scheiße geht also weiter.«
Einige Schwarze Frauenrechtsaktivistinnen stellten sich den Versuchen der Schwarzen Männer entgegen, sie in eine untergeordnete Rolle in der Bewegung zu zwingen, andere wiederum kapitulierten vor den männlichen Forderungen nach Unterwerfung. Was als Bewegung zur Befreiung aller Schwarzen Menschen aus rassistischer Unterdrückung begonnen hatte, mutierte zu einer Bewegung, deren Hauptziel die Errichtung des Schwarzen männlichen Patriarchats war. Es überrascht nicht, dass eine solche Bewegung, die sich so sehr auf die Interessen der Schwarzen Männer konzentrierte, es nicht schaffte, die doppelte Auswirkung der sexistischen und rassistischen Unterdrückung auf den sozialen Status der Schwarzen Frauen in den Blick zu nehmen. Sie wurden aufgefordert, in den Hintergrund zu treten, damit das Rampenlicht ausschließlich auf Schwarze Männer gerichtet werden konnte. Die Tatsache, dass sie Opfer sexistischer und gleichzeitig rassistischer Unterdrückung sind, wurde als unbedeutend angesehen, denn das Leid der Frauen, so groß es auch sein mochte, konnte keinen Vorrang vor dem Schmerz der Männer haben.
Die neuere Frauenbewegung stellte zwar heraus, dass Schwarze Frauen durch rassistische und sexistische Unterdrückung in doppelter Weise zu Opfern werden, doch merkwürdigerweise tendierten weiße Feministinnen dazu, die Schwarze weibliche Erfahrung zu romantisieren, anstatt die negativen Folgen dieser Unterdrückung zu diskutieren. Wenn Feministinnen in einem Atemzug anerkennen, dass Schwarze Frauen viktimisiert werden und zugleich ihre Stärke betonen, gehen sie davon aus, dass sie, obwohl sie unterdrückt werden, es irgendwie schaffen, die zerstörerischen Auswirkungen dieser Unterdrückung durch ihre Stärke zu umgehen – und das stimmt einfach nicht. Wenn Leute über die ›Stärke‹ Schwarzer Frauen reden, meinen sie für gewöhnlich die Art und Weise, wie diese augenscheinlich mit Unterdrückung zurechtkommen. Dabei wird ignoriert, dass Starksein angesichts von Unterdrückung nicht dasselbe ist wie die Überwindung der Unterdrückung, dass Aushalten nicht zu verwechseln ist mit Veränderung. Solche Sachverhalte werden häufig durcheinandergebracht von Menschen, die die weibliche Schwarze Erfahrung nur aus der Ferne betrachten. Diese Erfahrung wird häufig romantisiert, eine Tendenz, die ihren Anfang in der feministischen Bewegung nahm, sich mittlerweile jedoch überall in Kultur und Gesellschaft zeigt. Das stereotype Bild der ›starken‹ Schwarzen Frau wurde nicht mehr als menschenverachtend angesehen, sondern avancierte zum neuen Markenzeichen erhabener Schwarzer Weiblichkeit. Als die Frauenbewegung auf ihrem Höhepunkt war und weiße Frauen die Rolle der Gebärenden und Lastenträgerin sowie des Sexualobjekts ablehnten, wurden Schwarze Frauen für ihre einzigartige Hingabe an die Aufgabe der Mutterschaft, für ihre ›angeborene‹ Fähigkeit, gewaltige Lasten zu tragen, und für ihre ständig wachsende Verfügbarkeit als Sexualobjekt gefeiert. Wir schienen auserkoren zu sein, um dort weiterzumachen, wo die weißen Frauen aufgehört hatten. Sie bekamen die Zeitschrift Ms., wir bekamen Essence. Sie bekamen Bücher, in denen die negativen Auswirkungen des Sexismus auf ihr Leben erörtert wurden; wir bekamen Bücher, in denen argumentiert wurde, dass Schwarze Frauen nichts von der Frauenemanzipation zu gewinnen hätten.
Uns wurde gesagt, dass wir unsere Würde nicht durch die Befreiung von sexistischer Unterdrückung zurückgewinnen würden, sondern dadurch, wie gut wir uns anpassen und mit den Gegebenheiten abfinden könnten. Wir sollten aufstehen und uns beglückwünschen lassen, weil wir »gute kleine Frauen« sind, und dann sollten wir uns wieder hinsetzen und den Mund halten. Niemand hat sich darum gekümmert zu analysieren, wie der Sexismus sowohl unabhängig vom Rassismus als auch gleichzeitig mit dem Rassismus wirkt, um uns zu unterdrücken.
Keine andere Gruppe in den USA hat eine so extreme Verleugnung der eigenen Identität erlebt wie Schwarze Frauen. Wir werden in dieser Kultur nur sehr selten als eine von Schwarzen Männern getrennte und eigenständige Gruppe oder als Teil der größeren Gruppe ›Frauen‹ anerkannt. Wenn über Schwarze gesprochen wird, steht der Sexismus der Anerkennung ihrer Interessen entgegen, und wenn über Frauen gesprochen wird, steht der Rassismus der Anerkennung ihrer Interessen entgegen. Wenn über Schwarze gesprochen wird, liegt der Schwerpunkt meist auf Schwarzen Männern, und wenn über Frauen gesprochen wird, liegt der Schwerpunkt meist auf weißen Frauen. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der umfangreichen feministischen Literatur. Ein Beispiel dafür ist die folgende Passage aus William O’Neills Buch Everyone Was Brave, in der die Reaktionen weißer Frauen auf die Unterstützung weißer Männer für das Wahlrecht Schwarzer Männer im 19. Jahrhundert beschrieben werden:
»Sie waren schockiert und fassungslos, dass die Männer sie so demütigen konnten, indem sie das Wahlrecht für N*, aber nicht für Frauen unterstützten, was die Grenzen ihrer Sympathie für Schwarze Männer aufzeigte und diese ehemaligen Verbündeten noch weiter auseinander trieb.«
Diese Passage zeigt deutlich, dass die verschiedenen Ebenen sexistischer und rassistischer Diskriminierung, die zusammen für den Ausschluss Schwarzer Frauen verantwortlich sind, nicht richtig erfasst werden. In der Aussage »Sie waren schockiert und fassungslos, dass die Männer sie so demütigen konnten, indem sie das Wahlrecht für N*, aber nicht für Frauen unterstützten«, bezieht sich das Wort Männer tatsächlich nur auf weiße Männer, das N*-Wort nur auf Schwarze Männer und das Wort Frauen nur auf weiße Frauen. Welche rassistischen und sexistischen Denkweisen die Bezugnahmen im Einzelnen widerspiegeln, wird bequemerweise nicht zur Kenntnis genommen oder sogar absichtlich unterdrückt. Ein weiteres Beispiel stammt aus einem neueren Werk der Historikerin Barbara Berg, The Remembered Gate: Origins of American Feminism. Berg führt darin aus:
»In ihrem Kampf um das Wahlrecht haben die Frauen die Prinzipien des Feminismus sowohl ignoriert als auch kompromittiert. Die Komplexität der US-amerikanischen Gesellschaft um die Jahrhundertwende veranlasste die Frauenrechtlerinnen, die Begründung für ihre Forderung nach dem Wahlrecht zu ändern.«
Die Frauen, auf die sich Berg bezieht, sind weiße, was sie jedoch nie erwähnt. In der gesamten US-amerikanischen Geschichte hat der rassistische Imperialismus der Weißen dazu geführt, dass Gelehrte regelmäßig von ›Frauen‹ sprechen, auch wenn sie sich ausschließlich auf die Erfahrungen weißer Frauen beziehen. Ein solcher Sprachgebrauch, ob bewusst oder unbewusst praktiziert, festigt den Rassismus, da er die Existenz nicht-weißer Frauen in den USA leugnet. Zudem verfestigt er den Sexismus, da er davon ausgeht, dass Gender[1] das einzige selbstdefinierende Merkmal weißer Frauen ist, und ihre ethnische Identität leugnet. Weiße Vertreterinnen der feministischen Bewegung haben diese sexistisch-rassistische Praxis nicht infrage gestellt, sondern fortgeführt.
Das eklatanteste Beispiel für ihre Unterstützung der Ausgrenzung Schwarzer Frauen war der Vergleich zwischen Frauen und Schwarzen, mit dem sie in Wirklichkeit den sozialen Status weißer Frauen mit dem Schwarzer Männer verglichen. Wie viele andere in unserer rassistischen Gesellschaft fanden es auch weiße Feministinnen völlig in Ordnung, Bücher oder Artikel über die ›Frauenfrage‹ zu schreiben, in denen sie Analogien zwischen Frauen und Schwarzen herstellten. Da Analogien ihre Kraft, ihren Reiz und ihre Daseinsberechtigung daraus beziehen, dass zwei unterschiedliche Phänomene einander angenähert werden, wäre diese Analogie für weiße Frauen überflüssig, wenn sie die Überschneidung zwischen den Begriffen ›Schwarze‹ und ›Frauen‹ (d. h. die Existenz von Schwarzen Frauen) anerkennen würden. Indem sie diese Analogie immer wieder herstellen, suggerieren sie unbewusst, dass für sie der Begriff ›Frau‹ gleichbedeutend mit ›weißen Frauen‹ und der Begriff ›Schwarze‹ gleichbedeutend mit ›Schwarzen Männern‹ ist. Dies deutet darauf hin, dass sich in der Sprache eben jener Bewegung, die sich angeblich für die Beseitigung der sexistischen Unterdrückung einsetzt, eine sexistisch-rassistische Haltung gegenüber Schwarzen Frauen ausdrückt. Sexistisch-rassistische Einstellungen sind nicht nur im Bewusstsein der Männer in der US-amerikanischen Gesellschaft präsent, sondern treten in all unseren Denk- und Lebensweisen zutage. In der Frauenbewegung wurde allzu oft angenommen, man könne sich von sexistischem Denken befreien, indem man sich einfach die entsprechende feministische Rhetorik zu eigen macht. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass die Selbstidentifikation als Unterdrückte davon befreit, selbst eine Unterdrückerin zu sein. Es war insbesondere dieses Denken, das weiße Feministinnen daran hinderte, ihre eigenen sexistisch-rassistischen Einstellungen gegenüber Schwarzen Frauen zu verstehen und zu überwinden. Sie konnten Lippenbekenntnisse zur Idee von Schwesterlichkeit und weiblicher Solidarität ablegen, aber Schwarzen Frauen gleichzeitig ablehnend gegenüberstehen.
Im 19. Jahrhundert hatte der Streit zwischen denen, die das Wahlrecht für Schwarze Männer befürworteten und den Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht die Schwarzen Frauen in eine schwierige Lage gebracht. In einer ähnlichen Zwickmühle sahen sie sich Jahrzehnte später wieder, als sie nur die Wahl hatten zwischen einer Schwarzen Bewegung, die in erster Linie den Interessen Schwarzer Patriarchen diente, und einer Frauenbewegung, die in erster Linie den Interessen rassistischer weißer Frauen diente. Ihre Antwort bestand nicht darin, eine Neuausrichtung dieser beiden Bewegungen und die Anerkennung der Interessen Schwarzer Frauen zu fordern. Stattdessen verbündeten sie sich mehrheitlich mit dem Schwarzen Patriarchat, von dem sie glaubten, es würde ihre Interessen eher schützen. Lediglich einige wenige Schwarze Frauen beschlossen, sich der feministischen Bewegung anzuschließen. Doch diejenigen, die es wagten, sich öffentlich für Frauenrechte einzusetzen, wurden angegriffen und kritisiert. Andere saßen zwischen allen Stühlen, weil sie sich weder mit sexistischen Schwarzen Männern noch mit rassistischen weißen Frauen verbünden wollten. Die Tatsache, dass sich Schwarze Frauen nicht kollektiv gegen die Missachtung unserer Interessen durch beide Gruppen auflehnten, war ein Indiz für die Gehirnwäsche unserer sexistisch-rassistischen Sozialisation. Diese suggerierte uns, dass unsere Interessen es nicht wert waren, für sie zu kämpfen, und machte uns glauben, dass die einzige Möglichkeit, die sich uns bot, die Unterwerfung unter die von anderen vorgegebenen Bedingungen sei. Wir haben weder etwas gefordert noch infrage gestellt oder kritisiert, wir haben nur reagiert. Viele Schwarze Frauen verurteilten die feministische Bewegung als »geistige Verwirrung weißer Frauen«. Andere reagierten auf den Rassismus der weißen Frauen, indem sie Schwarze feministische Gruppen gründeten. Wir prangerten zwar männliche Vorstellungen vom Schwarzen Macho als ekelhaft und beleidigend an, aber wir sprachen nicht über uns selbst, darüber, dass wir Schwarze Frauen sind, darüber, was es bedeutet, Opfer sexistisch-rassistischer Unterdrückung zu sein.
Der bemerkenswerteste Versuch, die Erfahrungen Schwarzer Frauen, ihre Einstellung zur weiblichen Rolle in der Gesellschaft und die Auswirkungen des Sexismus auf ihr Leben zu artikulieren, war die von Toni Cade herausgegebene Anthologie The Black Woman. Damit war der Dialog aber auch schon beendet. Die wachsende Nachfrage nach Literatur über Frauen schuf dann jedoch einen Markt, auf dem sich fast alles verkaufen oder zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit erregen konnte. Dies galt insbesondere für die wegen der hohen Nachfrage auf den Markt gekommene Literatur über Schwarze Frauen, die zum großen Teil von sexistisch-rassistischen Vorurteilen durchdrungen war. Schwarze Männer, die sich entschieden, über Schwarze Frauen zu schreiben, taten dies in einer vorhersehbar sexistischen Weise. Daneben erschienen zahlreiche Sammelbände mit Material aus den Schriften Schwarzer Frauen des 19. Jahrhunderts, die in der Regel von Weißen herausgegeben wurden. Gerda Lerner, eine in Österreich geborene Weiße, gab Black Women in White America, A Documentary History heraus, nachdem sie ein großzügiges Forschungsstipendium zur Unterstützung ihrer Arbeit erhalten hatte. Ich halte die Sammlung zwar für ein wichtiges Werk, aber es ist bezeichnend, dass in unserer Gesellschaft weiße Frauen Zuschüsse erhalten, um über Schwarze Frauen zu forschen, ich aber keinen Fall kenne, in dem Schwarze Frauen Mittel zur Erforschung der Geschichte weißer Frauen erhalten hätten. Da ein erheblicher Teil der in Anthologien zusammengefassten Literatur über Schwarze Frauen aus akademischen Kreisen stammt, in denen der Druck, etwas zu veröffentlichen, allgegenwärtig ist, bin ich geneigt, mich zu fragen, ob die Forschenden durch ein aufrichtiges Interesse an deren Geschichte motiviert sind oder lediglich auf einen aufnahmebereiten Markt reagieren. Die Tendenz, Schriften Schwarzer Frauen, die bereits in anderen Veröffentlichungen vorliegen, in Sammelbänden zusammenzufassen, ist so sehr verbreitet, dass ich mich darüber hinaus frage, ob dieser Trend nicht auch Ausdruck einer mangelnden Bereitschaft der Forschenden ist, sich ernsthaft, kritisch und wissenschaftlich mit der Schwarzen weiblichen Erfahrung auseinanderzusetzen. In den Einleitungen zu diesen Werken wird so oft erklärt, dass umfassende Studien über den sozialen Status Schwarzer Frauen notwendig seien, die aber leider noch nicht geschrieben wurden. Ich habe mich oft gefragt, warum niemand daran interessiert war, solche Bücher zu schreiben. Joyce Ladners Tomorrow’s Tomorrow ist nach wie vor die einzige ernstzunehmende Studie über die Erfahrungen Schwarzer Frauen aus der Feder einer einzigen Autorin, die in den Frauenliteraturregalen der Buchhandlungen zu finden ist. Gelegentlich habe Schwarze Frauen in Fachzeitschriften Artikel über Rassismus und Sexismus veröffentlicht, doch sie scheinen sich nur ungern mit den Auswirkungen des Sexismus auf den sozialen Status der Schwarzen Frau zu befassen. Noch am ehesten waren bislang die Schwarzen Schriftstellerinnen Alice Walker, Audre Lorde, Barbara Smith und Cellestine Ware bereit, ihre Texte in einen feministischen Kontext zu stellen.
Als Michele Wallace’ Buch Black Macho and the Myth of the Superwoman erschien, wurde es als das feministische Standardwerk über Schwarze Frauen schlechthin gepriesen. Gloria Steinem wird auf dem Umschlag mit den Worten zitiert: »Was Sexus und Herrschaft für die siebziger Jahre war, könnte Michele Wallace’ Buch für die achtziger Jahre sein. Sie überwindet die Barriere zwischen Gender und race, um allen Leser:innen nahezubringen, was es wirklich heißt, als Schwarze und als Frau in den USA geboren zu sein – politisch wie privat.«
Ein solches Zitat wirkt beinahe komisch, wenn man bedenkt, dass Wallace nicht einmal den sozialen Status Schwarzer Frauen erörtern konnte, ohne sich vorher in einer langen Schimpftirade über Schwarze Männer und weiße Frauen auszulassen. Seltsamerweise bezeichnet sich Wallace selbst als Feministin, obwohl sie nur sehr wenig über die Auswirkungen von sexistischer Diskriminierung und Unterdrückung auf das Leben Schwarzer Frauen sagt und auch nicht auf die Bedeutung des Feminismus für sie eingeht. Das Buch ist zwar ein interessanter, provokanter Bericht über Wallace’ persönliches Leben, der eine sehr scharfe und geistreiche Analyse der patriarchalen Impulse Schwarzer männlicher Aktivisten enthält, aber es ist weder ein wichtiges feministisches Werk noch ein wichtiges Werk über Schwarze Frauen. Es ist wichtig als die Geschichte einer Schwarzen Frau. Allzu oft wird in unserer Gesellschaft davon ausgegangen, dass man schon alles über Schwarze Menschen weiß, wenn man nur die Lebensgeschichte und die Meinungen einer einzigen Schwarzen Person hört. Steinem vertritt eine solche engstirnige und rassistische Auffassung, wenn sie behauptet, Wallace’ Buch habe einen ähnlichen Stellenwert wie Kate Milletts Sexus und Herrschaft. Milletts Buch ist eine theoretische, analytische Untersuchung der Genderpolitik in den Vereinigten Staaten; es umfasst eine Analyse der Muster von Genderrollen und ihrer historischen Hintergründe sowie eine Diskussion über die Allgegenwart patriarchaler Werte in der Literatur. Das mehr als fünfhundert Seiten lange Buch ist nicht autobiografisch und in vielerlei Hinsicht äußerst akribisch. Vermutlich glaubt Steinem, dass die US-amerikanische Öffentlichkeit über die Geschlechterverhältnisse der Schwarzen informiert werden kann, wenn sie lediglich eine Diskussion über die Schwarze Bewegung der 1960er-Jahre, eine kursorische Untersuchung der Rolle der Schwarzen Frauen während der Sklaverei und einen Bericht über das Leben von Michele Wallace liest. Ich möchte den Wert von Wallace‹ Werk nicht schmälern, bin aber der Meinung, dass es in einem angemessenen Gesamtzusammenhang gesehen werden sollte. Normalerweise konzentriert sich ein Buch, das als feministisch bezeichnet wird, in erster Linie auf einen Aspekt der ›Frauenfrage‹. Die Leser:innen von Black Macho and the Myth of the Superwoman waren jedoch vor allem an den Ausführungen der Autorin zur Schwarzen männlichen Sexualität interessiert, die den Hauptteil ihres Buches ausmachen. Ihre kurze Kritik an der Erfahrung der versklavten Schwarzen Frauen und ihrer charakteristischen passiven Akzeptanz des Sexismus wurde hingegen weitgehend ignoriert.
Obwohl die feministische Bewegung Hunderte von Frauen dazu veranlasste, über die ›Frauenfrage‹ zu schreiben, gelang es ihr nicht, fundierte kritische Analysen der Erfahrungen Schwarzer Frauen hervorzubringen. Die meisten Feministinnen gingen davon aus, dass deren Probleme durch Rassismus und nicht durch Sexismus verursacht wurden. Die Annahme, dass wir race von Gender oder Gender von race trennen könnten, hat die Sicht US-amerikanischer Wissenschaftler:innen und Schriftsteller:innen auf die ›Frauenfrage‹ so sehr getrübt, dass die meisten Diskussionen über Sexismus und sexistische Unterdrückung oder die Stellung von Frauen in der Gesellschaft verzerrt und voreingenommen sind – und einfach nicht präzise genug. Wir können uns kein genaues Bild von der Situation der Frauen machen, wenn wir nur die Rolle untersuchen, die ihnen im Patriarchat zugewiesen ist. Ebenso wenig können wir uns ein genaues Bild vom Status Schwarzer Frauen machen, wenn wir uns einfach nur auf die rassistischen Hierarchien konzentrieren.
Schon zu Beginn meines Engagements in der Frauenbewegung störte mich das Beharren weißer Frauenrechtlerinnen darauf, dass race und Gender zwei voneinander zu trennende Themen seien. Meine Lebenserfahrung hatte mir gezeigt, dass die beiden Themen untrennbar miteinander verbunden waren, dass seit meiner Geburt zwei Faktoren mein Schicksal bestimmt haben: die Tatsache, dass ich als Schwarze geboren wurde und die Tatsache, dass ich als Frau geboren wurde. Als ich Anfang der 1970er-Jahre mein erstes Seminar in Women’s Studies an der Stanford University besuchte, das von einer weißen Frau geleitet wurde, führte ich das Fehlen von Werken von Schwarzen Frauen bzw. über sie darauf zurück, dass die Professorin als Weiße in einer rassistischen Gesellschaft darauf konditioniert worden war, die Existenz Schwarzer Frauen zu ignorieren, und nicht darauf, dass sie als Frau geboren worden war. In dieser Zeit äußerte ich gegenüber weißen Feministinnen mein Bedauern darüber, dass so wenige Schwarze Frauen bereit waren, den Feminismus zu unterstützen. Sie antworteten mir, dass sie deren Weigerung, sich am feministischen Kampf zu beteiligen, verstehen könnten, da sie bereits am Kampf gegen den Rassismus beteiligt seien. Als ich Schwarze Frauen ermutigte, aktive Feministinnen zu werden, wurde mir gesagt, dass wir keine ›Frauenrechtlerinnen‹ werden sollten, weil der Rassismus die entscheidende unterdrückende Kraft in unserem Leben sei – und nicht der Sexismus. Gegenüber beiden Gruppen brachte ich meine Überzeugung zum Ausdruck, dass der Kampf gegen Rassismus und der Kampf gegen Sexismus selbstverständlich miteinander verwoben sind und dass ihre Trennung eine grundlegende Wahrheit unserer Existenz verleugnen würde, nämlich dass race und Gender beide unveränderliche Facetten der menschlichen Identität sind.
Als ich mit den Recherchen für Ain’t I A Woman begann, verfolgte ich in erster Linie das Ziel, die Auswirkungen des Sexismus auf den sozialen Status Schwarzer Frauen zu dokumentieren. Ich wollte konkrete Beweise liefern, um die Argumente der Antifeministen zu widerlegen, die so lautstark verkündeten, dass Schwarze Frauen keine Opfer sexistischer Unterdrückung seien und keiner Befreiung bedürften. Im Laufe der Arbeit wurde mir immer klarer, dass ich nur dann zu einem umfassenden Verständnis der Erfahrung Schwarzer Frauen und unserer Beziehung zur Gesellschaft als Ganzes gelangen konnte, wenn ich sowohl die Politik des Rassismus als auch des Sexismus aus einer feministischen Perspektive untersuchte. Das Buch entwickelte sich dann zu einer Untersuchung der Auswirkungen des Sexismus auf Schwarze Frauen während der Sklaverei, der Abwertung Schwarzer Weiblichkeit, des Sexismus Schwarzer Männer, des Rassismus innerhalb der neueren feministischen Bewegung und der Beteiligung Schwarzer Frauen am Feminismus. Es wird versucht, den Diskurs über die Schwarze weibliche Erfahrung weiterzuführen, der im 19. Jahrhundert in den USA begann, um rassistische und sexistische Annahmen über das Wesen der Schwarzen Frau zu überwinden und zur Wahrheit über unsere Erfahrung zu gelangen. Obwohl der Schwerpunkt auf der Schwarzen Frau liegt, ist unser Kampf für die Befreiung nur dann von Bedeutung, wenn er innerhalb einer feministischen Bewegung stattfindet, deren grundlegendes Ziel die Befreiung aller Menschen sein muss.
1 Sexismus und die Erfahrungen Schwarzer Frauen während der Sklaverei
Bei einer rückblickenden Betrachtung der Erfahrungen Schwarzer weiblicher Versklavter kommt der Sexismus als unterdrückende Kraft in ihrem Leben ebenso deutlich zum Vorschein wie der Rassismus. Der institutionalisierte Sexismus, d. h. das Patriarchat, bildete zusammen mit dem rassistischen Imperialismus die Grundlage der US-amerikanischen Gesellschaftsstruktur. Der Sexismus war integraler Bestandteil der sozialen und politischen Ordnung, die die weißen Kolonisatoren aus ihren europäischen Heimatländern mitbrachten, und er sollte sich gravierend auf das Schicksal der versklavten Schwarzen Frauen auswirken. In seinen Anfängen konzentrierte sich der Handel mit Versklavten in erster Linie auf die Einfuhr von Arbeitskräften, wobei der Schwerpunkt zu dieser Zeit auf Schwarzen Männern lag. Als Versklavte waren Schwarze Frauen nicht so wertvoll wie Schwarze Männer. Im Durchschnitt kostete es mehr Geld, einen versklavten Mann zu kaufen als eine versklavte Frau. Der Mangel an Arbeitskräften und die relativ geringe Zahl Schwarzer Frauen in den US-amerikanischen Kolonien veranlasste einige weiße Plantagenbesitzer, eingewanderte weiße Frauen zu drängen, zu überreden und zu zwingen, sexuelle Beziehungen mit Schwarzen männlichen Versklavten einzugehen, um so neue Arbeitskräfte zu ›produzieren‹. Doch bald wurden überall im Land sogenannte Anti-Amalgamation-Gesetze verabschiedet, das erste im Jahr 1664 in Maryland. Sie zielten darauf ab, sexuelle Beziehungen zwischen weißen Frauen und versklavten Schwarzen Männern zu unterbinden. In der Präambel des Gesetzes in Maryland heißt es: »Jede frei geborene Frau, die sich mit einem Versklavten vermählt, muss ab dem letzten Tag dieser Versammlung den Herren dieser Versklavten dienen, solange ihr Mann lebt, und alle Nachkommen solcher frei geborenen Frauen, die so verheiratet sind, müssen Versklavte sein, wie es ihre Väter waren.«
Der berühmteste Fall dieser Zeit war der von Irish Nell, einer unter Vertragsknechtschaft stehenden Frau,[2] die von Lord Baltimore an einen Plantagenbesitzer im Süden verkauft wurde, der sie drängte, einen Schwarzen namens Butler zu heiraten. Als Lord Baltimore von Nells Schicksal erfuhr, war er so entsetzt darüber, dass weiße Frauen – entweder freiwillig oder gezwungenermaßen – mit Schwarzen männlichen Versklavten sexuelle Beziehungen eingingen, dass er das Gesetz aufheben ließ. Das neue Gesetz besagte, dass die Nachkommen aus Beziehungen zwischen weißen Frauen und Schwarzen Männern frei sein sollten. Die weißen Männer reagierten empört und es gelang ihnen letztlich, Beziehungen zwischen Schwarzen Männern und weißen Frauen einzuschränken, wodurch sich jedoch der Status Schwarzer Frauen grundlegend änderte. Die Plantagenbesitzer erkannten den wirtschaftlichen Gewinn, den sie durch deren Fortpflanzung erzielen konnten. Auch die heftigen Proteste gegen den weiteren Import versklavter Menschen führten dazu, dass ein größeres Augenmerk auf die Reproduktion der Versklavten gerichtet wurde. Anders als die Nachkommen aus einer Beziehung zwischen einem Schwarzen Mann und einer weißen Frau waren die Nachkommen einer Schwarzen Versklavten unabhängig von der Hautfarbe ihres Partners rechtlich gesehen Versklavte und damit Eigentum des Besitzers, dem die Versklavte gehörte. Dadurch stieg der Marktwert versklavter Schwarzer Frauen, sodass immer mehr von ihnen geraubt oder von weißen Menschenhändlern gekauft wurden.
Weiße männliche Beobachter der afrikanischen Kultur im 18. und 19. Jahrhundert waren erstaunt und beeindruckt, wie sehr afrikanische Frauen den afrikanischen Männern untergeordnet waren. An eine solche patriarchale Gesellschaftsordnung, die den Frauen nicht nur einen minderwertigen Status zubilligte, sondern von ihnen auch eine aktive Beteiligung an der Arbeit innerhalb der Gemeinschaft verlangte, waren sie nicht gewöhnt. Amanda Berry Smith, eine Schwarze Missionarin des 19. Jahrhunderts, besuchte afrikanische Gemeinden und berichtete über die Lage der Frauen dort:
»Die armen Frauen Afrikas haben es, wie die indischen, schwer. In der Regel haben sie die ganze schwere Arbeit zu erledigen. Sie müssen das ganze Holz schlagen und tragen, das ganze Wasser auf dem Kopf tragen und den ganzen Reis pflanzen. Die Männer und Jungen beschneiden und verbrennen das Buschwerk gemeinsam mit den Frauen; aber das Reis- und Maniokpflanzen, das müssen die Frauen alleine machen.
Oft sieht man einen großen Mann vorausgehen, der nichts in der Hand hat als ein Buschmesser (das tragen sie immer, oder einen Speer), und eine Frau, seine Frau, die mit einem großen Kind auf dem Rücken und einer Last auf dem Kopf hinter ihm hergeht. Egal wie müde sie ist, ihr Herr würde nicht daran denken, ihr einen Krug Wasser zu bringen, um damit sein Abendessen zu kochen, oder den Reis zu schlagen, nein, das muss sie tun.«