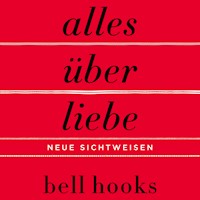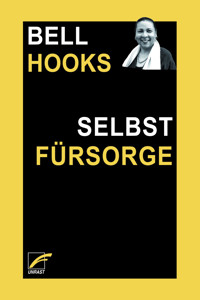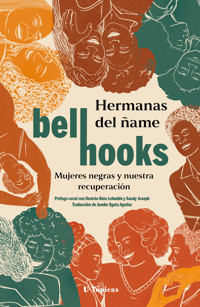15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre lang hatte bell hooks mit der Essaysammlung Die Welt verändern lernen schon für Begeisterung gesorgt, als endlich der zweite Band ihrer ›pädagogischen Trilogie‹ in den USA erschien. Jetzt liegt auch dieser Band erstmals in deutscher Übersetzung vor. Die hierin versammelten Texte sind voller Leidenschaft, visionärer Kraft und werden begleitet von Erzählungen aus hooks’ eigener Schul- und Lehrzeit. Wie das Sprechen über Rassismus, Gender und Klasse, wie Critical Whiteness und Demokratieerziehung über den Unterricht hinaus in alltägliche Lernsituationen einfließen können, zeigt hooks anhand zahlreicher praxisnaher Beispiele. Dabei geht sie ungezwungen auch ›heikle‹ Themen an: Spiritualität im Unterricht, Burnout im Erziehungswesen, erotische Beziehungen zwischen Lehrkräften und Studierenden … Glasklar führt uns bell hooks vor Augen, dass wir es letztlich selbst in der Hand haben, Rassismus, Sexismus und Klassismus zu beenden und ›liebevolle Gemeinschaften‹ zu gestalten: Wir müssen uns nur dafür entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman ? einen Namen weit über wissenschaftliche Kreise hinaus. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.
bell hooks
Gemeinschaft leben lernen
Bildung als Praxis der Hoffnung
Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
bell hooks:
Gemeinschaft leben lernen
1. Auflage, Mai 2024
eBook UNRAST Verlag, Oktober 2024
ISBN 978-3-95405-196-0
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titel der Originalausgabe:
Teaching Community, A Pedagogy of Hope, New York 2003
Copyright © 2003 Gloria Watkins
Alle Rechte vorbehalten
Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe,
herausgegeben von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort Hoffnung lehren und leben
1 Der Wille zum Lernen Die Welt als Schule
2 Auszeit Lehre ohne Grenzen
3 Über Rassismus sprechen
4 Demokratische Bildung
5 Wenn weiße Menschen sich ändern
6 Standards
7 Wie wir dienen können
8 Die Scham überwinden
9 Die Hoffnung bewahren Gemeinschaft stärken
10 Progressives Lernen Eine Familienangelegenheit
11 Von Herz zu Herz Mit Liebe unterrichten
12 Guter Sex Leidenschaftliche Pädagogik
13 Spiritualität in Bildung und Erziehung
14 Dies ist unser Leben Lehren im Angesicht des Todes
15 Spirituelle Themen im Unterricht
16 Erkenntnisse aus der Praxis
Anmerkungen
»Es ist unerlässlich,die Hoffnung aufrechtzuerhalten,auch wenn die raue Wirklichkeitdas Gegenteil nahelegen mag.«
Paulo Freire
Vorbemerkung des Verlags zum Sprachgebrauch:
Sprache als Kulturgut unterliegt beständigem Wandel, ebenso wie fortschreitende sozialwissenschaftliche Diskurse, in denen Standpunkte auch über sich verändernde Sprache vertreten werden. Dies ist in einer modernen Übersetzung eines 2003 geschriebenen Textes nicht immer unproblematisch und soll deshalb an dieser Stelle kurz erklärt werden.
In diesem Buch benutzen wir
· gendersensible Sprache, die mit dem eingefügten Doppelpunkt möglichst barrierearm alle biologischen und sozialen Geschlechter ansprechen soll. Begriffe, die im Kontext der 1990er-Jahre ausschließlich cis Frauen (und Lesben) bezeichnen, werden hier im generischen Femininum belassen und nicht gegendert.
· ›Schwarz‹ als identitätsstiftenden und selbstgewählten Begriff von Menschen und Communitys in Großschreibweise, weil er nicht als adjektivische Zuschreibung zu verstehen ist – und schon gar nicht als Farbe.
· den englischen Begriff race unübersetzt. Im Gegensatz zum deutschen Wort ›Rasse‹, das biologistisch und auch historisch äußerst problematisch konnotiert ist, wird Race heute auch im deutschen Sprachraum zunehmend als emanzipatorischer Begriff verwendet.
Vorwort
Hoffnung lehren und leben
Vor zehn Jahren begann ich, eine Sammlung von Aufsätzen über das Unterrichten zu schreiben – das Endergebnis war Die Welt verändern lernen – Bildung als Praxis der Freiheit (engl.: Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom). Als ich dieses Projekt in der Anfangsphase mit meinem sehr geschätzten weißen Lektor Bill Germano diskutierte, kam immer wieder die Frage nach dem möglichen Publikum für ein solches Buch auf. Gab es wirklich ein Publikum von Lehrenden und Lernenden[1], das an Diskussionen über Diversität im Unterricht, über Probleme und Hürden beim Lehren und Lernen, die den Kern dieses Textes bilden, interessiert war? Würden Professor:innen dieses Werk lesen wollen? Waren die Themen wirklich von allgemeiner Relevanz? Ich war damals sehr zuversichtlich, dass es viele Menschen im Lehrbetrieb gab, die sich, wie ich selbst, auf einen Austausch über all diese Themen einlassen wollten. Nachdem die Grundsatzfragen geklärt waren, machten wir uns an die Veröffentlichung. Die unmittelbare Reaktion des Publikums bewies dem Verlag, dass das Werk zur rechten Zeit kam. Aufgrund seines lockeren Tons war es leicht zu lesen und bot den Leser:innen die Möglichkeit, zu den einzelnen Kapiteln zurückzukehren und mit Ideen zu arbeiten, die sie neu fanden und schwierig, aufwühlende Ideen oder ganz einfach Ideen, mit denen sie nicht einverstanden waren und die sie noch einmal überdenken wollten. Mehr als jedes andere Buch, das ich geschrieben habe, hat Die Welt verändern lernen die unterschiedlichen Zielgruppen erreicht, die ich mir als Lesepublikum vorgestellt habe. Die Aufsätze schlagen einen Bogen zwischen den Lehrkräften an öffentlichen Schulen und denjenigen von uns, die größtenteils, wenn nicht sogar ausschließlich, an Colleges und Universitäten lehren. Sie befassen sich mit allgemeinen Problemen, mit denen alle Lehrenden konfrontiert sind, unabhängig davon, in welcher Unterrichtsumgebung sie arbeiten.
Sicherlich war es die Veröffentlichung von Die Welt verändern lernen, die einen Raum schuf, in dem ich mit Lehrenden und Lernenden in öffentlichen Schulen ins Gespräch kam, mich mit angehenden Lehrer:innen unterhielt und ihnen zuhörte, wenn sie mit mir über das Unterrichten sprechen wollten. Der unglaubliche Erfolg von Die Welt verändern lernen veranlasste meinen Verleger, mich kurz nach der Veröffentlichung dieses ersten Buches zu drängen, ein weiteres Buch über das Unterrichten zu schreiben. Ich war aber fest entschlossen, kein weiteres Buch in dieser Art zu schreiben, es sei denn, ich verspürte dazu eine innere Notwendigkeit, die mich oft zum leidenschaftlichen Schreiben antreibt.
In den vergangenen zehn Jahren habe ich mehr Zeit damit verbracht, Professor:innen und Studierenden etwas über das Unterrichten beizubringen, als in den regulären Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Englisch, der Feminist Studies oder der African American Studies. Es war nicht nur die große Resonanz auf mein Buch Die Welt verändern lernen, die mir diese neuen Räume für den Diskurs eröffnete. Hinzu kam etwas anderes: als ich in die Öffentlichkeit trat, um als Dozentin zu arbeiten, war ich von Anfang an bestrebt, Leidenschaft, Kompetenz und Würde in die Kunst des Unterrichtens einzubringen: Daher war meinem Publikum klar, dass ich das praktizierte, was ich predigte. Diese Verbindung von Theorie und Praxis war ein lebendiges Beispiel für alle Lehrpersonen, die auf der Suche nach praxisorientierter Erkenntnis sind. Ich will nicht unbescheiden sein, wenn ich die Qualität meiner Lehrtätigkeit und meines Schreibens über das Unterrichten anspreche, sondern ich möchte mit meinem Beispiel lediglich der vorherrschenden Meinung entgegentreten, dass es einfach zu schwierig sei, theoretische Erkenntnisse umzusetzen – dem ist nicht so. Diejenigen von uns, die Verbindungen herstellen und Grenzen überschreiten wollen, tun dies auch. Ich wünsche mir, dass alle, die mit Leidenschaft unterrichten und sich darüber freuen, wenn sie ihre Arbeit gut gemacht haben, ein inspirierendes Beispiel abgeben, gerade auch, um junge Menschen für den Lehrberuf zu begeistern.
Es gibt sicherlich Momente im Unterrichtsalltag, in denen ich in der Kunst des Lehrens nicht überragend bin. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass wir uns dem Gefühl der Scham oder Verlegenheit widersetzen, dem Lehrpersonen, die ihre Arbeit gut machen, möglicherweise erliegen, wenn sie sich selbst loben oder von anderen für ihre hervorragende Leistung gelobt werden. Denn wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen, tragen wir zur allgemeinen kulturellen Abwertung unseres Lehrberufs bei. Als großer Basketballfan sage ich den Menschen, die mir zuhören, oft: »Glauben Sie wirklich, dass Michael Jordan nicht weiß, dass er ein unglaublicher Ballkünstler ist? Dass er während seiner gesamten Karriere wie kein anderer außergewöhnliche Fähigkeiten bewiesen und großartige Leistungen vollbracht hat?«
In den letzten zehn Jahren habe ich viele Stunden damit verbracht, abseits des normalen Hochschulbetriebs zu unterrichten. Durch die Veröffentlichung von Kinderbüchern habe ich mehr Zeit als ich jemals gedacht hätte damit verbracht, Kinder zu unterrichten und mit ihnen zu sprechen, insbesondere mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Dieser Unterricht findet in unterschiedlichen Umgebungen statt – in Kirchen, Buchläden, Privathäusern, in denen Menschen zusammenkommen, und in verschiedenen Klassenräumen in öffentlichen Schulen, an Colleges und Universitäten. Der aufregendste Aspekt des Unterrichtens außerhalb konventioneller bzw. universitärer Strukturen besteht darin, dass wir die Theorie, die wir in der Welt der Wissenschaft entwickeln, mit einem nicht-akademischen Publikum teilen und, was am wichtigsten ist, dass wir den Hunger dieser Menschen nach neuen Erkenntnissen und ihren Wunsch, dieses Wissen auf sinnvolle Weise zu nutzen, um ihr tägliches Leben zu bereichern, miterleben.
Als ich anfing, feministische Theorie zu entwickeln und mich mit anderen feministischen Wissenschaftlerinnen über ihre Ideen auszutauschen, wollten wir auf keinen Fall nur an der Herausbildung einer neuen Elite mitwirken, bestehend aus der Gruppe von Frauen mit Hochschulbildung, die am meisten von feministischem Denken und feministischer Praxis profitieren würden. Unser Bewusstsein und unser Leben war durch das feministische Denken und die feministische Praxis grundlegend verändert worden, und wir glaubten damals wie heute, dass der Erfolg der feministischen Bewegung im Wesentlichen davon bestimmt ist, inwieweit sie die gleiche Wirkung auf die ›normale‹ Bevölkerung haben würde. Mit dieser politischen Hoffnung verbanden wir die Verpflichtung, eine Theorie zu entwickeln, die sich direkt und inklusiv an ein breites Publikum wendet. Mit der Verwissenschaftlichung des Feminismus und seinem Niedergang als politische Massenbewegung war es schwierig, dieses Ziel in einem akademischen Arbeitsumfeld zu erreichen, weil hier Theorien, um gut genug für eine Beförderung und eine feste Anstellung zu sein, oft in einer schwer verständlichen Wissenschaftssprache formuliert werden mussten. Viele faszinierende feministische Ideen erreichen so nie ein Publikum außerhalb der akademischen Welt, weil sie einfach nicht verständlich sind. Paradoxerweise geschieht dies oft in Bereichen wie Soziologie und Psychologie, in denen die Themen eigentlich unmittelbar mit den Entscheidungen verbunden sind, die Menschen im Alltag treffen. Ein Beispiel sind feministische Arbeiten über Elternschaft, insbesondere über den Wert männlicher Elternschaft. Ein großer Teil dieser Arbeiten ist jedoch in einem komplizierten akademischen Jargon verfasst. Selbst schwere Wälzer, in denen es nicht so sehr von Fremdwörtern wimmelt, sind für müde Berufstätige nur schwer durchzuackern, um etwas für sie Relevantes daraus ziehen zu können.
Je weiter ich in meiner akademischen Karriere vorankam, desto mehr sehnte ich mich danach, meine intellektuelle Arbeit für einen breiteren Kreis nutzbar zu machen und Foren zu finden, in denen über klassistische, rassistische und andere Barrieren hinweg ein Austausch über mein Praxiswissen erfolgen kann. Ich habe Theorien entwickelt, die für viele Menschen außerhalb der akademischen Welt schwer zu lesen sind, aber was sie verstehen, bringt sie oft dazu, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig habe ich eine Reihe von populären Schriften verfasst, die viele verschiedene Menschen auf der Ebene ihrer unterschiedlichen Lernfähigkeiten ansprechen. Ich finde das nicht nur aufregend, sondern es bestätigt auch, dass die massenwirksamen Ziele feministischer Politik, die viele von uns vertreten, erreicht werden können. Wir können in der Tat eine Arbeit leisten, die mit allen geteilt werden kann. Und diese Arbeit kann dazu dienen, all unsere widerständigen Communitys zu erweitern, so dass sie nicht nur aus Hochschullehrenden, Studierenden oder versierten Politprofis bestehen.
In den letzten Jahren haben die Massenmedien der Öffentlichkeit weisgemacht, dass die Frauenbewegung nicht funktioniert hat, dass Frauenförderung ein Fehler war und dass alle im Rahmen der Kulturwissenschaften entwickelten alternativen Studiengänge und Fachbereiche bei der Ausbildung von Studierenden versagen. Um diesen öffentlichen Narrativen entgegenzuwirken, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle diese Fehlinformationen infrage stellen, und zwar nicht nur so, dass wir die Behauptungen abstreiten. Wir müssen auch wahrhaftig und gründlich Rechenschaft über die konkreten Maßnahmen ablegen, die als Folge unserer Bemühungen um Gerechtigkeit in der Bildung durchgeführt wurden. Vor allem müssen wir all die positiven, lebensverändernden Ergebnisse hervorheben, die aus den kollektiven Bemühungen erwachsen sind, unsere Gesellschaft und insbesondere das Bildungswesen so zu verändern, dass es nicht länger ein Ort der Ausübung von Herrschaft ist, in welcher Form auch immer.
Wir brauchen politische Massenbewegungen, die die Menschen in diesem Land dazu aufrufen, für die Demokratie und das Recht aller auf Bildung einzutreten und sich für die Beendigung von Herrschaft in all ihren Formen einzusetzen. Wir brauchen Menschen, die für Gerechtigkeit kämpfen und unser Bildungssystem verändern, damit Lernende dort nicht in einer Weise indoktriniert werden, dass sie das imperialistische, kapitalistische Patriarchat weißer Vorherrschaft oder irgendeine Ideologie unterstützen, sondern lernen, ihren Geist zu öffnen, sich ernsthaft Wissen anzueignen und kritisch zu denken. Lehrende wie Studierende haben sich dafür eingesetzt, die akademische Welt so zu verändern, dass der Unterricht nicht zu einem Ort wird, an dem Vorherrschaft (auf der Grundlage von Race, Klasse, Gender, Nationalität, sexueller Präferenz, Religion) aufrechterhalten wird, und sie haben positive Entwicklungen im Denken und Handeln miterlebt. Sie haben gesehen, wie weiße Vorherrschaft, rassistisch begründeter Kolonialismus, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit auf breiter Front infrage gestellt wurden.
Mittlerweile gibt es eine unglaubliche Fülle von Texten, die konkret dokumentieren, dass einzelne Wissenschaftler:innen es nicht nur gewagt haben, frühere parteiische Arbeiten zu revidieren, sondern auch mutig neue Beiträge geliefert haben, um uns allen zu helfen, besser zu verstehen, wie Herrschaftssysteme funktionieren – sowohl eigenständig als auch in wechselseitiger Abhängigkeit –, um Ausbeutung und Unterdrückung dauerhaft aufrechtzuerhalten. Indem sie das Private zum Politischen machten, erlebten viele Menschen einen tiefgreifenden Wandel in ihrem Denken, der ihr Leben veränderte: Weiße, die sich gegen Rassismus engagierten; Männer, die Sexismus und Patriarchat infrage stellten; Heterosexuelle, die begannen, sich ernsthaft für sexuelle Freiheit einzusetzen. Es hat viele stille Momente gegeben, in denen es zu unglaublichen Veränderungen im Denken und Handeln kam, die radikal und revolutionär waren. Um diese Momente richtig zu würdigen und wertzuschätzen, müssen wir sie benennen, auch wenn wir weiterhin rigoros Kritik äußern. Beides, die Benennung der Probleme und die klare Formulierung dessen, was wir tun, um sie anzugehen und zu lösen, sind notwendig, um einen neuen Geist des Widerstands zu wecken und zu inspirieren. Wenn wir das Problem nur benennen, wenn wir uns bloß beschweren, ohne uns konstruktiv auf eine Lösung zu konzentrieren, nehmen wir uns die Hoffnung. Kritik kann so leicht zu einem bloßen Ausdruck von tiefem Zynismus werden, der dann sogar noch zur Aufrechterhaltung der Herrschaftskultur beiträgt.
In den letzten zwanzig Jahren haben Pädagog:innen es immer öfter gewagt, neue Wege des Denkens und Lehrens zu erforschen und zu erlernen. Um zu verhindern, dass pädagogische Arbeit dazu beiträgt, bestehende Herrschaftssysteme, Imperialismus, Rassismus, Sexismus oder Klassenelitismus zu verstärken, haben sie eine Pädagogik der Hoffnung entwickelt. Der brasilianische Pädagoge Paulo Freire erinnert uns an die Notwendigkeit, die Hoffnung nicht aufzugeben: »Der Kampf für die Hoffnung bedeutet, jegliche Missstände in aller Deutlichkeit anzuprangern. (…) Indem wir sie anprangern, wecken wir in anderen und in uns selbst das Verlangen nach Hoffnung und auch den Geschmack daran.« Die Hoffnung befähigt uns, unseren Kampf für Gerechtigkeit fortzusetzen, auch wenn die Kräfte der Ungerechtigkeit eine Zeit lang an Macht gewinnen mögen. Als Lehrende gehen wir mit Hoffnung in den Unterricht. Freire stellt fest: »Aus welcher Perspektive auch immer wir die authentische pädagogische Praxis betrachten – sie ist stets mit Hoffnung verbunden.«
Meine Hoffnung wächst, wenn ich Menschen erlebe, die darum ringen, ihr Leben und die Welt um sie herum positiv zu verändern. Unterrichten ist immer eine Berufung, die in der Hoffnung wurzelt. Als Lehrende glauben wir, dass Lernen möglich ist, dass nichts einen offenen Geist davon abhalten kann, nach Wissen zu streben und einen Weg zur Erkenntnis zu finden. In ihrem Buch The Outrageous Pursuit of Hope. Prophetic Dreams for the Twenty-First Century erinnert uns Mary Grey daran, dass wir alle von der Hoffnung leben. Sie verkündet: »Hoffnung erweitert die Grenzen des Möglichen. Sie ist mit jenem Grundvertrauen in das Leben verbunden, ohne das wir keinen Tag überleben könnten (…) Von der Hoffnung zu leben, bedeutet, zu glauben, dass es sich lohnt, den nächsten Schritt zu wagen: dass unser Tun einen Sinn hat, dass unsere Familie, unsere Kultur und Gesellschaft es wert sind, dafür zu leben und zu sterben. In der Hoffnung zu leben, heißt für uns: ›Es gibt einen Ausweg‹, selbst aus den gefährlichsten und verzweifeltesten Situationen.« Eine der Gefahren, denen wir in unseren Bildungssystemen begegnen, ist der Verlust des Gemeinschaftsgefühls; nicht nur die Nähe zu unseren Kolleg:innen und unseren Lernenden geht verloren, sondern auch das Gefühl der Verbundenheit und des engen Kontakts mit der Welt jenseits von Schule und Universität.
Progressive Bildung – Bildung als Praxis der Freiheit – ermöglicht es uns, Gefühle des Verlustes zu bewältigen und unser Gefühl der Verbundenheit wiederherzustellen. Sie lehrt uns, wie wir Gemeinschaft schaffen können. In diesem Buch weise ich auf vieles hin, was der Verbundenheit im Wege steht, und gleichzeitig verdeutliche ich, was wir bereits alles tun, um Gemeinschaft aufzubauen und zu erhalten. Gemeinschaft leben lernen – Pädagogik als Praxis der Hoffnung [oder: Eine Pädagogik der Hoffnung] bietet konkretes Praxiswissen darüber, was schon getan wird und was wir noch tun können, um den Unterricht zu einem Ort zu machen, der lebensdienlich und bewusstseinserweiternd ist, zu einem Ort der befreienden Gegenseitigkeit, an dem Lehrende und Lernende partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ob ich nun über Liebe und Gerechtigkeit schreibe, über weiße Menschen, die ihr Leben so verändern, dass sie im Kern ihres Wesens antirassistisch werden, oder über die Frage von Sex und Macht zwischen Lehrenden und Lernenden, oder über die Art und Weise, wie wir das Wissen über Tod und Sterben nutzen können, um unseren Lernprozess zu fördern – dieses Buch soll ein Zeugnis der Hoffnung sein. Es Buch soll dazu beitragen, unser kollektives Bewusstsein für Gemeinschaft wiederzuerlangen, das immer vorhanden ist, wenn wir wahrhaftig lehren und lernen.
Die hier versammelten Texte gehören nicht mir allein. Sie sind das Ergebnis vieler Stunden, die ich im Gespräch mit Weggefährt:innen, Studierenden, Kolleg:innen und Fremden verbracht habe. Sie sind das Ergebnis von lebensverändernden Diskussionen, die im Kontext von Gemeinschaftsbildung stattgefunden haben. Der vietnamesische buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh lehrt: »In einem echten Dialog sind beide Seiten bereit, sich zu verändern. Wir müssen anerkennen, dass die Wahrheit auch außerhalb – und nicht nur innerhalb – unserer eigenen Gruppe zu finden ist. Wir müssen wirklich daran glauben, dass wir durch den Dialog mit einer anderen Person die Möglichkeit haben, uns selbst zu verändern, dass wir dadurch eine tiefere Ebene erreichen können.« Indem ich in diesen Aufsätzen offen und ehrlich darüber spreche, wie wir uns für den Wandel einsetzen und wie wir dabei selbst verändert werden können, hoffe ich, den Möglichkeitsraum zu erhellen, in dem wir daran arbeiten können, unsere Hoffnung aufrechtzuerhalten und eine Gemeinschaft zu bilden, in der Gerechtigkeit die zentrale Grundlage ist.
Parker Palmer glaubt, dass aufgeklärter Unterricht Gemeinschaft schafft und fördert. Viele von uns wissen, dass dies so ist, weil wir in der lebensbejahenden Atmosphäre verschiedener widerständiger Communitys lehren und leben. Sie sind die Quelle unserer Hoffnung, der Ort, an dem unsere Leidenschaft, sich zu verbinden und zu lernen, ständig erfüllt wird. Palmer erklärt: »Diese Gemeinschaft geht weit über unsere persönliche Beziehung zueinander als menschliche Wesen hinaus. Besonders in der Bildung verbindet uns diese Gemeinschaft mit dem (…) ›großen Ganzen‹ dieser Welt und mit seiner ›Erhabenheit‹. (…) Wir sind gemeinschaftlich mit diesem großen Ganzen verbunden, und großartiges Unterrichten bedeutet, diese Gemeinschaft zu kennen, zu spüren und dann die Lernenden darin einzubinden.« Ich hoffe, dass Gemeinschaft leben lernen – Pädagogik als Praxis der Hoffnung euch auch in dieser Weise anspricht und euren Geist erneuert.
1
Der Wille zum Lernen
Die Welt als Schule
Seit den Anfängen des öffentlichen Schulwesens wurde Bildung dazu benutzt, die Werte der Herrschenden zu fördern und institutionalisierte Systeme der Dominanz über andere (Rassismus, Sexismus, nationalistischer Imperialismus) zu stärken. Als fortschrittliche Lehrende im ganzen Land begannen, dies infrage zu stellen, kam es in den Colleges zu einer pädagogischen Revolution. Mehr und mehr konnten wir die versteckte konservative politische Ausrichtung der Unterrichtsinhalte und -materialien aufdecken und zeigen, wie Ideologien der Herrschaft beeinflussen, auf welche Art und Weise unterrichtet und agiert wird. Dadurch eröffnete sich ein Raum, in dem Lehrende begannen, ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, wie ein Unterricht aussehen könnte, in dem Studierende frei denken können anstatt indoktriniert zu werden. In den Schwarzen Schulen meiner Kindheit in den Südstaaten wurden imperialistische, weiß-suprematistische, kapitalistische und patriarchale Werte gelehrt, auch wenn diese Werte zuweilen kritisiert wurden. In jenen Tagen wurden ›hellhäutigere‹ Schüler:innen von Schwarzen Lehrpersonen bevorzugt, waren diese in der Regel doch selbst meist ›hellhäutig‹, da die Hierarchie unter den Menschen of Color es ihnen eher ermöglicht hatte, eine bessere Bildung zu erhalten und aufzusteigen. Indem sie diesen Schüler:innen mehr Respekt und Achtung entgegenbrachten, vermittelten sie das Gedankengut der weißen Vorherrschaft, auch wenn sie möglicherweise lehrten, dass die Versklavung der Schwarzen durch die Weißen grausam und ungerecht war, und selbst dann, wenn sie antirassistische Rebellion und Widerstand priesen.
In diesem – wenn auch begrenzten – Freiraum der alternativen Denkangebote konnten sich die Lernenden an der Auflehnung gegen die Unterdrückung bestimmter Wissensbestände beteiligen. So war es möglich, befreiende Ideen selbst in einem Kontext der Unfreiheit kennenzulernen, auch wenn dieser Kontext eigens geschaffen worden war, um uns dazu zu erziehen, Herrschaft zu akzeptieren, unseren Platz innerhalb der rassistischen, sexistischen und klassistischen Hierarchien zu akzeptieren. Natürlich war diese Praxis in allen Bildungseinrichtungen anzutreffen. Als Frauen, zumeist Weiße, zum ersten Mal Schulen und Hochschulen betraten und dort über das Patriarchat lernten, war ihre bloße Anwesenheit selbst ein Moment des Aufruhrs, eine Herausforderung. Im patriarchalen Wissenschafts- und Lehrbetrieb haben Frauen seither beständig gelernt, sexistische Verzerrungen des Wissens, die geschlechterspezifische Herrschaft festschreiben, zu erkennen und Wissensformen zu entdecken, die das Bewusstsein für Geschlechtergleichheit und weibliche Selbstbestimmung stärken.
Sicherlich hat die Institutionalisierung der Black Studies afroamerikanischen Menschen einen Raum eröffnet, in dem die vorherrschende imperialistische Ideologie der weißen Überlegenheit infrage gestellt werden konnte. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren radikalisierten sich die Studierenden, mich eingeschlossen, weil sie ein kritisches Bewusstsein dafür entwickelten, wie das Denken der Herrschenden unser Wissen geprägt hatte. Als junges Mädchen hatte ich den weißen Lehrkräften noch geglaubt, wenn sie mir sagten, wir würden keine Bücher von Schwarzen lesen, weil es keine gäbe, oder jedenfalls keine guten. Als kritisch denkende Studierende lernte ich dann aber, die Quellen von Informationen zu hinterfragen. Im Jahr 1969 veröffentlichte June Jordan den Aufsatz »Black Studies: Bringing Back the Person«. Sie argumentierte hier, dass Black Studies ein gegenhegemonialer Ort für dekolonisierte Schwarze sei, und schrieb: »Schwarze Studierende, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, verlangen nach Lehrpersonen, die am wenigsten lügen, die am wenigsten die Traditionen der Lüge aufrechterhalten; Lügen, die den Vater aus dem Gedächtnis des Kindes tilgen. Wir fordern Schwarze Dozent:innen in Black Studies. Wir glauben zwar nicht, dass nur Schwarze Menschen die Schwarze Erfahrung verstehen können (…) Für uns gibt es jedoch keine Alternative zur ›Schwarzen Erfahrung‹ und auch nicht zu den ›Black Studies‹: Wir müssen uns selbst kennen (…) Wir suchen nach Gemeinschaft. Wir haben bereits viel zu lange unter dem Gegenteil von Gemeinschaft, von Menschlichkeit gelitten. Wir haben die Peitschenhiebe der ›white studies‹ ertragen (…) und deshalb können wir unmöglich die Potenziale der ›Black Studies‹ ungenutzt lassen. Wir müssen die Schwarzen Menschen erforschen – die einzigen Menschen, die der Rettung dieser Menschen verpflichtet sind.« Dies war eine eindringliche Botschaft über die Dekolonisierung der Wissensformen und die Befreiung des Wissens aus dem Würgegriff weiß-suprematistischer Interpretationen und Gedanken. In diesem Essay warf Jordan die entscheidende Frage auf: »Ist die Universität bereit, uns etwas Neues zu lehren?« Von Anfang an schuf die Präsenz der Black Studies einen Kontext für eine Gegenerzählung, in der ein Lernen stattfinden konnte, das die weiße Vorherrschaft nicht verstärkte.
Mit dem Erfolg der militanten antirassistischen Arbeit der Schwarzen nahm auch die feministische Bewegung an Fahrt auf. Da gut ausgebildete weiße Frauen mit Klassenprivilegien in der einzigartigen Lage waren, durch Gleichstellungs- bzw. Fördermaßnahmen in weitaus größerer Zahl als Schwarze in die akademische Welt einzutreten, gelang es ihnen selbst wiederum, durch diese Politik der Affirmative Action den Frauenanteil zu erhöhen. Da sie die unmittelbarsten Nutznießerinnen der Fördermaßnahmen waren, diente ihre Einbeziehung letztlich dazu, »weiße Macht und Privilegien« zu stärken, ob sie nun antirassistisch eingestellt waren oder nicht. Wenn Stellen in der Wissenschaft, die durch die bürgerrechtlich inspirierte Antidiskriminierungspolitik geschaffen wurden, an weiße Bewerberinnen gingen, konnten weiße Männer an der Macht sich selbst als Kämpfer gegen Diskriminierung darstellen, ohne wirklich Platz für ethnische Diversität oder für die Einbeziehung größerer Gruppen von Menschen of Color zu machen. Feministische, größtenteils weiße Frauen, die ab den späten 1960er-Jahren und bis in die 1980er-Jahre hinein in großer Zahl in die Wissenschaft eintraten und durch feministische Bewusstseinsbildung radikalisiert wurden, stellten das Patriarchat infrage und begannen tatsächlich, Änderungen in den Curricula zu fordern, damit diese nicht länger geschlechterspezifische Vorurteile widerspiegeln würden. Weiße Akademiker waren viel eher bereit, sich auf die Gleichstellung der Geschlechter einzulassen als auf eine Gleichstellung rassifizierter Gruppen.
Feministische Interventionen waren erstaunlich erfolgreich, wenn es darum ging, akademische Lehrpläne zu verändern. So waren es beispielsweise nicht die Black Studies, die zur Wiederentdeckung von zuvor nicht anerkannten Schwarzen Schriftstellerinnen wie Zora Neale Hurston führten, sondern feministische Wissenschaftlerinnen. Dazu gehörten auch Schwarze Frauen, die die »Herstory« neu aufleben ließen, indem sie auf die patriarchale Ausgrenzung von Frauen aufmerksam machten und so das Bewusstsein schufen, das zu ihrer stärkeren Einbeziehung führte. Obwohl ich meine Lehrtätigkeit im Bereich der Black Studies begann, beschäftigten sich die Kurse, die immer am besten besucht waren (ich musste sogar Studierende abweisen) mit schreibenden Frauen. Mittlerweile hat die feministische Infragestellung patriarchaler Lehrpläne und Lehrmethoden den Unterricht insgesamt völlig verändert. Immer mehr Studierende strömten in diese Kurse, in denen es keine einseitigen und voreingenommenen Unterrichtsmethoden und -inhalte gab, wo Bildung als Praxis der Freiheit eher die Norm war. Und da Colleges und Universitäten um zu überleben, darauf angewiesen sind, dass die Studierenden die Ware »Kurs« »kaufen«, führte dies dazu, dass die Autorität der traditionellen weißen männlichen Machtstruktur erfolgreich untergraben werden konnte.
Nur indem sie sich der Kampagne zur Änderung der Curricula anschlossen, waren weiße Männer in der Lage, ihre Machtpositionen zu behaupten. Wenn beispielsweise ein rassistischer, patriarchaler Englischprofessor, der einen Kurs über William Faulkner unterrichtete, der für viele Studierende obligatorisch war, mit einem ähnlichen Kurs konkurrieren musste, der von einer feministischen, antirassistischen Professorin unterrichtet wurde, konnte es passieren, dass am Ende niemand an seinem Kurs teilnehmen wollte. Daher lag es im Interesse seines Überlebens, dass er seine Sichtweise revidierte und zumindest einmal eine Diskussion über die Genderfrage oder eine feministische Analyse einbezog.
In der Auflehnung gegen die Unterdrückung bestimmten Wissens hatten feministische Interventionen in der akademischen Welt eine größere Wirkung als die Black Studies, da weiße Frauen die größere Gruppe der weißen weiblichen Studierenden ansprechen konnten. Die Black Studies richteten sich von Beginn an hauptsächlich an Schwarze Studierende, während Women’s Studies von Beginn an weiße Studierende ansprachen, in der Regel Frauen mit einem gewissen Grad an radikalem Bewusstsein. Doch mit der zunehmenden Akzeptanz der Geschlechtergleichstellung wurden feministische Kurse immer größer und zogen diverse Gruppen weißer Studierender und Studierender of Color an. Es fällt auf, dass feministische weibliche Professor:innen im Gegensatz zu den meisten nicht-feministischen Black-Studies-Professor:innen viel innovativer und progressiver in ihrem Lehrstil waren. Und so strömten die Studierenden oft in Scharen in die feministischen Lehrveranstaltungen, weil der Unterricht dort herausfordernder und einfach interessanter war. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten es konservative weiße Akademiker:innen aus dem Mainstream nicht nötig gehabt, zum Gegenangriff überzugehen und die Women’s Studies zu verunglimpfen. Fälschlicherweise behaupteten sie, dass die Studierenden in diesen Kursen keinerlei Wissen von weißen Männern zu lernen bräuchten, und dort auch nicht wirklich viel tun müssten. Indem sie die feministischen Lehrveranstaltungen abwerteten, gaben sie den Studierenden das Gefühl, dass sie akademisch suspekt erscheinen würden, wenn sie diese alternativen Disziplinen als Hauptfach wählten. Dabei war gerade der feministische Kurs ein anspruchsvoller Ort des Lernens, und als Bonus war der Unterrichtsstil in solchen Kursen oft weniger konventionell.
Ungeachtet der Intensität der antifeministischen Gegenreaktionen oder der konservativen Bemühungen um die Abschaffung der Black Studies und Women’s Studies hatten die fortschrittlichen Interventionen nun einmal stattgefunden und enorme Veränderungen bewirkt. Einzelne Schwarze Frauen und Frauen of Color brachten zusammen mit einzelnen weißen Frauen, die sich dem antirassistischen Kampf angeschlossen hatten, eine Rassismuskritik in das feministische Denken ein, die die feministische Wissenschaft grundlegend veränderte, so dass viele der Anliegen der Black Studies nun durch eine Kooperation mit den Women’s Studies und durch die feministische Wissenschaft aufgegriffen wurden. Im Laufe der Zeit, als sich die akademische Welt mehr und mehr veränderte und die notwendigen inklusiven Reformen – Gleichstellung der Geschlechter und mehr Diversität – durchgeführt wurden, waren feministische und/oder Schwarze Wissenschaftler:innen nicht mehr nur in alternativen Studiengängen zu finden. Progressive feministische weibliche Professor:innen und/oder Schwarze Professor:innen bzw. Professor:innen of Color wurden in den akademischen Betrieb eingebunden – mit anderen Worten, sie wurden aus dem ›Ghetto‹ der Women’s Studies oder der Ethnic Studies herausgeholt. Dies geschah, weil weiße Männer ihre Kontrolle über diese Disziplinen zurückgewinnen wollten, aber es bedeutete auch, dass abweichende Stimmen in die konventionellen Disziplinen Einzug hielten. Diese Stimmen veränderten den Charakter des akademischen Diskurses nachhaltig.
Die erstaunlichen Veränderungen, die die Women’s Studies und die Black Studies bzw. Ethnic Studies in der Hochschulbildung bewirkt haben, werden nur selten gewürdigt. Als fortschrittliche weiße Männer die alternative Disziplin der Kulturwissenschaften schufen, die von progressiven Standpunkten aus gelehrt wurde, tendierte der Erfolg dieser Studiengänge dazu, die kraftvollen Interventionen von Frauen und von Männern of Color zu überschatten. Das lag einfach an der Art und Weise, wie das Denken und die Praxis der weißen Vorherrschaft die Interventionen weißer Männer honoriert, während der Anschein erweckt wird, dass die progressiven Interventionen von Frauen und von Männern of Color nicht so wichtig sind. Da die Kulturwissenschaften – ungeachtet der Aufrechterhaltung der hegemonialen weißen männlichen Präsenz – häufig die Anerkennung von Race und Gender mit einschlossen, wurden sie unwissentlich zu einer der Kräfte, die Colleges und Universitäten dazu brachten, Studiengänge für Ethnic Studies und Women’s Studies abzuschaffen, mit dem Argument, dass sie einfach nicht mehr gebraucht würden. Das allgemeine Mainstreaming alternativer Disziplinen und Perspektiven war eine Taktik, die eingesetzt wurde, um die konkreten Orte der Macht zu beseitigen, an denen sich eine andere Politik und eine andere Bildungsstrategie durchsetzen ließen, denn die Leute mussten sich nicht mehr auf den konservativen Mainstream verlassen, wenn es um Beförderung und Festanstellung ging. Nun, das hat sich alles geändert. Durch den erfolgreichen Backlash wurden die progressiven Veränderungen untergraben, und alles ist wieder so, wie es war. Die Herrschaft der weißen Männer bleibt ungebrochen. Überall in unserem Land wurden die Programme für Women’s Studies und Ethnic Studies rücksichtslos zusammengestrichen.
Die konservative Manipulation der Massenmedien hat Eltern und Studierende erfolgreich darin bestärkt, sich vor alternativen Denkweisen zu fürchten und zu glauben, dass die Belegung eines Kurses in Women’s Studies oder Ethnic Studies zum Scheitern führt und dazu, dass man später keinen Job bekommt. Diese Taktiken haben der Bewegung für progressive Bildung als Praxis der Freiheit geschadet, aber sie haben nichts an der Tatsache geändert, dass unglaubliche Fortschritte gemacht wurden. In Teaching Values erinnert uns Ron Scapp daran: »Die Feindseligkeit denen gegenüber, die ›Fragen stellen‹, und die Angst vor ihnen haben eine lange (und gewalttätige) Geschichte. Dass diejenigen, die heute Fragen stellen und sich gegen die scheinbar selbstverständlichen ›Gewissheiten‹ unserer Kulturgeschichte auflehnen, als Parias angesehen und angegriffen werden, sollte ebenfalls nicht überraschen.« Scapp macht darauf aufmerksam, dass die Leute, die sich gegen progressive Bildungsreformen wehren, »schnell dabei sind, sie abzutun oder zu diskreditieren (und manchmal ganz zunichte zu machen)«, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einen mächtigen, bedeutsamen Aufstand des unterdrückten Wissens gegeben hat, der befreiend und lebenserhaltend ist.
Die Kämpfe für Gendergleichstellung und ethnische Diversität verknüpften Fragen der Beendigung von Herrschaft und der sozialen Gerechtigkeit mit Pädagogik. Der Unterricht wurde verändert. Die Kritik am herkömmlichen Kanon ermöglichte es den Stimmen visionärer Intellektueller, Gehör zu finden. So hat etwa Gayatri Spivak die Vorstellung, dass nur die Bürger:innen dieses Landes die Bedeutung des traditionellen Kanons kennen und verstehen können, auf brillante Weise hinterfragt. Kühn stellt sie fest: »Die Frage des literarischen Kanons ist in Wirklichkeit eine politische Frage: Es geht um die Sicherstellung von Autorität.« In Outside in the Teaching Machine erklärt sie, wie wichtig eine »transnationale Literalität« ist, und zwar bereits im Unterricht an der Highschool. Wenn Spivak über die Auswahl der Lerngegenstände schreibt, erklärt sie, dass sie sich aus postkolonialer Perspektive »in die Debatte über den Unterrichtskanon einbringen muss«, aus der heraus es notwendig ist, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen:
»Es kann keine allgemeine Theorie des Kanons geben. Der Kanon ist die Bedingung von Institutionen und die Wirkung von Institutionen. Der Kanon sichert die Institutionen, wie die Institutionen den Kanon sichern (…). Da es unzweifelhaft ist, dass es keine Expansion ohne Kontraktion gibt (…), [müssen wir] im Unterricht die neu in den Kanon aufgenommenen Werke verbindlich machen. Immer wenn ich dies anspreche, höre ich Geschichten von Studierenden, die ihren Lehrenden erzählt haben, dass ein ganzes Semester Shakespeare oder Milton oder Chaucer ihr Leben verändert hat. Ich bezweifle diese Geschichten nicht, aber wir müssen eine qualitative/quantitative Verschiebung vornehmen, wenn wir die neuen Werke kanonisieren wollen. (…) Das Leben der Studierenden wird sich vielleicht auch dadurch verändern lassen, dass sie ein Gefühl für die Diversität des neuen Kanons und für das unausgesprochene Machtspiel bekommen, das mit der Sicherung des alten Kanons verbunden ist.«
Spivaks Werk ist aus einer transnationalen, feministischen, antirassistischen und linken Kulturkritik hervorgegangen und verkörpert die außergewöhnliche Genialität und Macht der intellektuellen Interventionen, die die alte akademische Welt verändert haben.
Offensichtlich hat sich trotz der bildungspolitischen Interventionen nichts Grundlegendes geändert. Das macht die Veränderungen, die trotz allem stattgefunden haben, jedoch nicht weniger relevant oder beeindruckend. Während der konventionelle herrschaftsorientierte Frontalunterricht nach wie vor ein Ort war, an dem die Schüler:innen bzw. Studierenden einfach nur den Stoff auswendig lernen und wiederkäuen mussten, lernten sie im progressiven Unterricht, kritisch zu denken und offen zu werden. Und je mehr sie ihr kritisches Bewusstsein erweiterten, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass sie Ideologien der Vorherrschaft unterstützten. Progressive Lehrende brauchten die Lernenden nicht zu indoktrinieren und ihnen beizubringen, dass sie sich der Herrschaft widersetzen sollten. Die jungen Menschen entwickelten diese Positionen von allein – durch ihre eigene Fähigkeit, kritisch zu denken und die Welt, in der sie leben, zu verstehen. Indem nun Fragen von Imperialismus und Rassismus, von Gender, Klasse und Sexualität erörtert wurden, schärfte sich das Bewusstsein aller für die Bedeutung dieser Anliegen (auch derjenigen, die nicht mit unserer Perspektive übereinstimmten). Dieses Bewusstsein hat die Voraussetzungen für konkrete Veränderungen geschaffen, auch wenn diese Voraussetzungen noch nicht allen bekannt sind. In den letzten zwanzig Jahren haben sich fortschrittliche Lehrende und Lernende für soziale Gerechtigkeit eingesetzt und damit die demokratischen Grundsätze auf beeindruckende Weise verwirklicht. Entsprechend heftig fiel auch die Gegenreaktion aus.
Bezeichnenderweise kamen die heftigsten Angriffe auf fortschrittliche Lehrende und neue Formen des Wissens nicht von Pädagog:innen, sondern von politischen Entscheidungsträger:innen und ihren konservativen Verbündeten, die die Massenmedien kontrollieren. Auf der ganzen Welt wurde diese konkurrierende Pädagogik, die Stimme der Herrschenden, durch die Lektionen der imperialistischen, weiß-suprematistischen, kapitalistischen und patriarchalen Massenmedien verbreitet. Während sich das Bildungswesen zu einem Ort entwickelte, an dem humanitäre Träume durch Bildung als Praxis der Freiheit mittels einer Pädagogik der Hoffnung verwirklicht werden konnten, war die Welt draußen damit beschäftigt, den Menschen die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Ungerechtigkeit, der Angst, der Gewalt und des Terrors zu vermitteln. Die von progressiven Pädagog:innen vorgebrachte Sichtweise auf das ›Anderssein‹ war nicht so stark wie das Beharren der konservativen Massenmedien darauf, dass das ›Anderssein‹ benannt, gejagt und zerstört werden muss. In ihrem Buch Hatreds. Racialized and Sexualized Conflicts in the Twenty-First Century erklärt Zillah Eisenstein in dem Kapitel »Writing Hatred on the Body«:
»An der Schwelle zum 21. Jahrhundert explodiert der Hass an Orten wie Sarajevo, Argentinien, Tschetschenien, Ruanda, Los Angeles und Oklahoma City. Der Hass ist Ausdruck eines komplexen Bündels von Ängsten vor Differenz und ›Anderssein‹. Er offenbart das, was manche Menschen an sich selbst fürchten, ihre eigene ›Verschiedenheit‹. Der Hass richtet sich gegen das Unbekannte, gegen die Andersartigkeit der ›Anderen‹. Und wir haben die Differenz, die wir fürchten, durch rassifizierte und sexualisierte Markierungen vermittelt bekommen. Weil Menschen durch ihre rassifizierten, sexualisierten und geschlechtlich definierten Körper zu ›Anderen‹ werden, sind Körper wichtig für die Geschichtsschreibung des Hasses.«
Die akademische Auseinandersetzung mit diesem Hass ist zwar sinnvoll, erreicht aber leider nicht genügend Menschen in diesem Land.
Als sich die tragischen Ereignisse des 9/11 ereigneten, war es, als ob in wenigen Augenblicken all unsere Arbeit zur Beendigung der Herrschaft in jeglicher Form, all unsere Pädagogik der Hoffnung, bedeutungslos geworden wären. Die amerikanische Öffentlichkeit reagierte auf die Berichterstattung über die Tragödie mit einer Welle von imperialistischer, weiß-suprematistischer, nationalistischer, kapitalistischer, patriarchaler Wut gegen Terroristen, die als dunkelhäutig definiert wurden, auch wenn es keine Bilder, keine konkreten Beweise gab. Diese Wut schwappte über in den alltäglichen Hass auf Menschen of Color in diesem Land, da Muslime, egal mit welchem Hintergrund, fortan geächtet waren und zu Objekten einer willkürlichen und rücksichtslosen Gewalttätigkeit wurden. Eine überwältigende Mehrheit der Opfer, die am 11. September auf tragische Weise ums Leben kamen, waren Menschen of Color, und unter den Opfern waren mehr als sechzig Länder und jede Religion der Welt vertreten. Unschuldige jeglicher Gestalt, Größe und Hautfarbe, Neugeborene und Alte starben – doch der grausame westliche Kulturimperialismus reduzierte dieses brutale Massaker auf die einfache Dualität von ›wir gegen sie‹, von Bürger:innen der Vereinigten Staaten als ›das auserwählte Volk‹ gegen eine Welt voller ›nicht auserwählter‹ Menschen. Zum Glück gab es Kolleg:innen und Mitstreiter:innen, die es besser wussten, vereinzelte Menschen of Color, die hofften, dass sie zunächst trauern und dann von Gerechtigkeit sprechen konnten. Wann immer wir für Gerechtigkeit eintreten und uns auf die Seite der Gerechtigkeit stellen, verweigern wir uns einfachem Schubladendenken. Wir weigern uns, zuzulassen, dass ein schlichtes Entweder-oder-Denken unser Urteilsvermögen vernebelt. Wir machen uns die Logik des Sowohl-als-auch zu eigen. Wir erkennen die Grenzen dessen an, was wir wissen.
Obwohl ich zu den Schauplätzen der Tragödie vom 11. September 2001 gehen konnte, war ich eine Zeit lang nicht in der Lage, über diese Ereignisse zu sprechen, weil ich mit den Grenzen meines Wissens konfrontiert wurde. Denn ich konnte nicht auf der einen Seite eine Kritikerin der imperialistischen, weiß-suprematistischen, kapitalistischen, patriarchalen Massenmedien sein und mich dann auf der anderen Seite darauf verlassen, dass diese Medien mich über das Geschehene richtig informieren würden. Das, was ich wusste – und das, was ich nicht wusste – wurde durch die Informationen in den alternativen Massenmedien und durch mein beschränktes unmittelbares Erleben als Zeitzeugin bestimmt. Das war alles, was ich erklären konnte. Alles andere wären Interpretationen von Interpretationen gewesen, die mir von Medien angeboten wurden, deren Absichten mir suspekt sind.
Vom Zeitpunkt der Anschläge an und auch in den Tagen und Wochen danach waren unsere Stadtteile abgeriegelt. Nur die Geräusche der Flugzeuge waren zu hören. Nur die staatlichen Ordnungskräfte, die Polizei, liefen frei herum. Überall waren Männer, hauptsächlich Weiße, mit Gewehren. Überall wurden willkürlich Menschen of Color ins Visier genommen. Sobald sie konnten, machten sich die privilegierten Leute in unseren Vierteln (hauptsächlich Weiße) auf den Weg in ihre Landhäuser. Nachbar:innen riefen mich aus ihren Häusern an, die Stunden entfernt waren, um mir die Neuigkeiten mitzuteilen. Freund:innen und Weggefährt:innen aus der ganzen Welt riefen an, um mit mir zu trauern und zu wehklagen. Ich fühlte mich von fürsorglicher Gemeinschaft umgeben. Doch der rassistische Hass, der nun auch von Leuten ausging, die bisher immer ein kritisches Bewusstsein an den Tag gelegt hatten, war genauso intensiv wie der von den Gruppen, die sich noch nie um Gerechtigkeit geschert hatten und die nicht einmal in der Lage waren, anzuerkennen, dass unser Land ein imperialistisches, kapitalistisches Patriarchat weißer Vorherrschaft ist. Es war ein Moment des totalen Chaos, in dem die Saat der faschistischen Ideologie überall Früchte trug. In allen Nationen, in all unseren Schulen und Hochschulen musste die Redefreiheit der Zensur weichen. Einzelne verloren ihren Arbeitsplatz oder wurden nicht mehr befördert, weil sie es wagten, ihre abweichende Meinung zu äußern, was in einer demokratischen Gesellschaft ein zentrales Bürgerrecht ist. Überall in unserem Land erklärten die Menschen, dass sie bereit seien, ihre Bürgerrechte aufzugeben, um sicherzustellen, dass dieses Land den Krieg gegen den Terrorismus gewinnen würde.
Innerhalb weniger Monate hörten viele auf, an den Wert des Lebens in diversen Communitys, der antirassistischen Arbeit und der Suche nach Frieden zu glauben. Sie gaben ihren Glauben an die heilende Kraft der Gerechtigkeit auf. Der Hardcore-Nationalismus derjenigen, die an der weißen Vorherrschaft festhalten wollten, erhob seine hässliche Stimme und sprach ganz offen, überall. Einzelne, die es wagten, zu widersprechen, Kritik zu üben und Fehlinformationen infrage zu stellen, wurden und werden als Verräter:innen abgestempelt. Im Laufe der Zeit erlebten wir einen immer stärkeren Backlash, eine zunehmende Hetze gegen jede Einzelperson oder Gruppe, die es wagte, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und sich der Herrschaft in all ihren Formen zu widersetzen.
Die Dominanzkultur,[2]