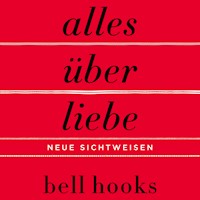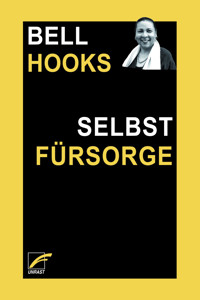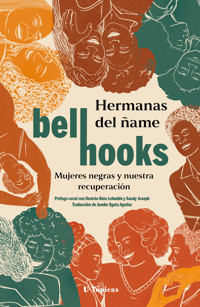15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
bell hooks (1952–2021) war nicht nur als Schriftstellerin und Kulturkritikerin bekannt, die sich in zahlreichen Werken mit dem Zusammenwirken von Sexismus, Rassismus und Klassismus auseinandergesetzt hat, sondern auch als Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und Lehrende, der eine besonders gewinnende Art in Vorlesungen, Reden und öffentlichen Auftritten nachgesagt wurde. In »Die Welt verändern lernen« plädiert bell hooks – wie immer voller Leidenschaft und mit persönlichem Engagement – für eine neue Pädagogik, in deren Mittelpunkt die Veränderung der Dynamik im Unterricht steht und die weder Trauer und Wut noch Eros und Versöhnung ausblendet. Ihre praxisnahen Antworten auf immer noch ungelöste Fragen verändern unsere Vorstellungen davon, was Schulen oder Universitäten sein und tun sollten. »Teaching to Transgress« hat bell hooks ihr Buch im Original genannt. Es ist der gesammelte Erfahrungsschatz einer kompetenten Lehrperson und Dozentin, die sich mit ganzem Herzen dafür einsetzt, dass Lernen funktioniert. Ihr Hauptanliegen ist es, Bildung als Praxis der Freiheit zu begreifen, als eine Art des Lernens und Lehrens, die jungen Menschen die Möglichkeit eröffnet, rassistische, sexistische und klassistische Barrieren zu durchbrechen und Grenzen zu ›überschreiten‹ – für die Autorin die wichtigste Aufgabe, das vorrangige Ziel des Lehrens. Die ›Teaching‹-Trilogie zählt schon seit Langem zu den meistgelesenen Kultbüchern von bell hooks. Mit »Die Welt verändern lernen« ist der Eröffnungsband endlich auch auf Deutsch zu lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman ? einen Namen weit über wissenschaftliche Kreise hinaus. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.
bell hooks
Die Welt verändern lernen
Bildung als Praxis der Freiheit
Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
bell hooks: Die Welt verändern lernen
1. Auflage, Oktober 2023
eBook UNRAST Verlag, Januar 2024
ISBN 978-3-95405-178-6
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titel der Originalausgabe:
Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, New York 1994
Copyright © 1994 Gloria Watkins
Alle Rechte vorbehalten
Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe,
herausgegeben von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC
Umschlag: Unrast Verlag, Münster
Satz: Unrast Verlag, Münster
Allen meinen Studierenden gewidmet,
besonders LaRon, der mit Engeln tanzt
in Dankbarkeit für all die Zeiten,
in denen wir immer wieder neu beginnen,
unsere Freude am Lernen erneuern.
Vorbemerkung des Verlags zum Sprachgebrauch:
Sprache als Kulturgut unterliegt beständigem Wandel, ebenso wie fortschreitende sozialwissenschaftliche Diskurse, in denen Standpunkte auch über sich verändernde Sprache vertreten werden. Dies ist in einer modernen Übersetzung eines 1994 geschrieben Textes nicht immer unproblematisch und soll deshalb an dieser Stelle kurz erklärt werden.
In diesem Buch benutzen wir
• gendersensible Sprache, die mit dem eingefügten Doppelpunkt möglichst barrierearm alle biologischen und sozialen Geschlechter ansprechen soll. Begriffe, die im Kontext der 1990er-Jahre ausschließlich cis Frauen (und Lesben) bezeichnen, werden hier im generischen Femininum belassen und nicht gegendert.
• ›Schwarz‹ als identitätsstiftenden und selbstgewählten Begriff von Menschen und Communitys in Großschreibweise, weil er nicht als adjektivische Zuschreibung zu verstehen ist – und schon gar nicht als Farbe.
• den englischen Begriff race unübersetzt. Im Gegensatz zum deutschen Wort ›Rasse‹, das biologistisch und auch historisch äußerst problematisch konnotiert ist, wird race heute auch im deutschen Sprachraum zunehmend als emanzipatorischer Begriff verwendet.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung Grenzen überschreiten und die Welt verändern lernen
1 Engagierte Pädagogik
2 Eine Revolution der Werte Das Versprechen multikulturellen Wandels
3 Mut zur VeränderungUnterrichten in einer multikulturellen Welt
4 Paulo Freire
5 Theorie als befreiende Praxis
6 Essentialismus und Erfahrung
7 Die Hand meiner Schwester haltenFeministische Solidarität
8 Feminismus im Unterricht
9 Feministische WissenschaftSchwarze Wissenschaftlerinnen
10 Pädagogische Gemeinschaftsbildung Ein Dialog
11 SpracheNeue Worte / Neue Welten lehren
12 Klassismus im Unterricht
13 Eros und Erotismus im pädagogischen Prozess
14 Begeisterung Lehren und Lernen ohne Grenzen
»… immer wieder neu zu beginnen, zu schaffen,
wieder aufzubauen und nicht zu zerstören, sich zu weigern,
den Geist zu bürokratisieren, das Leben als Prozess
zu verstehen und zu leben – zu leben, um zu werden …«
Paulo Freire
Einleitung
Grenzen überschreiten und die Welt verändern lernen
Als die Entscheidung am Fachbereich Englisch des Oberlin College anstand, ob mir eine Festanstellung bewilligt würde oder nicht, wurde ich wochenlang von Albträumen heimgesucht, in denen ich davonlief, einfach verschwand, ja, sogar starb. Diese Träume rührten nicht etwa daher, dass ich mich gesorgt hätte, mir würde keine feste Stelle an der Uni gewährt. Im Gegenteil: Sie resultierten daraus, dass ich die Stelle tatsächlich erhalten sollte. Ich hatte Angst, dass ich dann für immer im Lehrbetrieb gefangen sei.
Anstatt mich zu freuen, als ich meine Professur in Festanstellung erhielt, verfiel ich in eine tiefe, lebensbedrohliche Depression. Da alle um mich herum meinten, dass ich eigentlich froh, überglücklich und stolz sein sollte, fühlte ich mich ›schuldig‹ wegen meiner ›wahren‹ Gefühle und konnte sie mit niemandem teilen. Dann führte mich eine Vortragsreise ins sonnige Kalifornien und in die New-Age-Welt des Hauses meiner Schwester in Laguna Beach, wo ich mich einen Monat lang entspannen konnte. Als ich meiner Schwester (sie ist Therapeutin) von meinen Gefühlen erzählte, versicherte sie mir, dass das völlig normal sei, denn, so sagte sie: »Du wolltest nie unterrichten. Seit wir klein waren, wolltest du immer nur schreiben.« Sie hatte Recht. Für alle anderen war es immer klar, dass ich Lehrerin werden würde.* In den von Apartheid geprägten Südstaaten der USA hatten Schwarze Mädchen aus dem Arbeitermilieu nur drei Möglichkeiten, was ihre berufliche Laufbahn anging: Wir konnten heiraten. Wir konnten als Dienstmädchen arbeiten. Wir konnten Lehrerinnen werden. Und da im sexistischen Denken der damaligen Zeit verhaftet Männer nicht wirklich ›kluge‹ Frauen begehrten, ging man davon aus, dass Anzeichen von Intelligenz das Schicksal besiegelten. Von der Grundschule an war ich dazu bestimmt, Lehrerin zu werden.
Doch der Traum, Schriftstellerin zu werden, war immer irgendwie da. Von Kindheit an war ich überzeugt, dass ich lehren und schreiben würde. Das Schreiben wäre die ernsthafte Arbeit, das Unterrichten wäre der nicht so ernsthaft verfolgte ›Job‹ zur Sicherung des Lebensunterhalts. Schreiben, so glaubte ich damals, hatte mit privatem Streben und persönlichem Ruhm zu tun, das Unterrichten hingegen mit dem Dienen, damit, der eigenen Community etwas zurückzugeben. Für Schwarze waren Unterricht und Bildung etwas fundamental Politisches, weil beides als Teil des antirassistischen Kampfes verstanden wurde. Und tatsächlich erlebte ich in den Schwarzen Schulen, die ich besuchte, Lernen als Revolution.
Fast alle unsere Lehrpersonen an der Booker-T.-Washington-Schule waren Schwarze Frauen. Sie setzten sich für die Förderung des Intellekts ein, damit wir Gelehrte, Freigeister und Kulturschaffende werden konnten, – Schwarze, die ihren ›Verstand‹ einsetzten. Wir lernten früh, dass unsere Hingabe an das Lernen, an ein Leben des Geistes, ein gegenhegemonialer Akt war, ein grundlegender Weg, um jedweder Strategie weißer rassistischer Kolonialisierung zu widerstehen. Obwohl sie diese Praktiken nicht in theoretischen Begriffen definierten oder artikulierten, setzten unsere Lehrkräfte eine revolutionäre Pädagogik des Widerstands um, die zutiefst antikolonial war. In diesen segregierten Schulen wurden Schwarze Kinder, die als außergewöhnlich und begabt galten, besonders gefördert. Die Lehrenden arbeiteten mit uns und für uns, um sicherzustellen, dass wir unser intellektuelles Schicksal erfüllen und dadurch die Schwarzen in ihrer Gesamtheit voranbringen würden. Sie waren also von einer Mission beseelt.
Um diese Mission zu erfüllen, stellten sie sicher, dass sie uns ›kannten‹. So waren ihnen unsere Eltern bekannt, genau wie unser wirtschaftlicher Status, wo wir zur Kirche gingen, wie unser Zuhause aussah und wie wir in der Familie behandelt wurden. Als ich zur Schule ging, wurde ich von denselben Lehrkräften unterrichtet, die schon meine Mutter, ihre Schwestern und Brüder unterrichtet hatten. Mein Bemühen und meine Fähigkeit zu lernen wurden immer im Rahmen der generationenübergreifenden Familienerfahrungen gesehen. Bestimmte Verhaltensweisen, Gesten und Lebensgewohnheiten wurden auf die Familie zurückgeführt.
Der Schulbesuch war damals eine reine Freude. Ich war gerne Schülerin. Ich liebte das Lernen. Die Schule war für mich ein Ort der Begeisterung, der Freude, aber auch der Gefahr. Durch Ideen verändert zu werden, war pures Vergnügen. Aber Ideen kennenzulernen, die den zu Hause gelernten Werten und Überzeugungen zuwiderliefen, war ein Risiko; es bedeutete, sich in die Gefahrenzone zu begeben. Das Elternhaus war der Ort, an dem ich gezwungen war, mich an das Bild anzupassen, das jemand anderes von mir hatte, davon, wer und was ich sein sollte. Die Schule war der Ort, an dem ich dieses Selbst vergessen und mich durch Ideen neu erfinden konnte.
Mit der sogenannten ›Rassen‹-Integration veränderte sich die Schule grundlegend. Vorbei war der messianische Eifer, unseren Geist und unser Wesen zu verändern, der die Lehrenden und ihre pädagogischen Praktiken in unseren komplett Schwarzen Schulen geprägt hatte. Bei Wissen ging es plötzlich nur noch um Informationen. Es hatte nichts mehr damit zu tun, wie man lebte und sich verhielt. Es war nicht mehr mit dem antirassistischen Kampf verbunden. Mit dem Bus in weiße Schulen gebracht, lernten wir bald, dass Gehorsam und nicht eifriger Lernwille das war, was von uns erwartet wurde. Ein zu großer Lerneifer konnte leicht als Bedrohung der weißen Autorität angesehen werden.
Als wir in die rassistischen, de-segregierten, weißen Schulen eintraten, verließen wir eine Welt, in der die Lehrenden noch die Überzeugung hatten, dass eine gute Erziehung Schwarzer Kinder politisches Engagement voraussetzte. Nun wurden wir hauptsächlich von Weißen unterrichtet, in einer Weise, die rassistische Stereotype noch verstärkte. Für Schwarze Kinder ging es bei der Erziehung fortan also nicht mehr um die Praxis der Freiheit. Als ich dies erkannte, verlor ich meine Liebe zur Schule.
Das Klassenzimmer war nicht länger ein Ort des Vergnügens oder der Begeisterung. Die Schule war immer noch ein politischer Ort, da wir uns ständig gegen die rassistischen Ansichten der Weißen wehren mussten, dass wir genetisch minderwertig und niemals so leistungsstark wie gleichaltrige Weiße sein würden, ja, dass wir sogar unfähig seien zu lernen. Doch das Politische am Ort Schule war nicht mehr gegenhegemonial. Wir haben nur noch auf die Weißen reagiert.
Dieser Wechsel von unseren geliebten Schwarzen Schulen an die weißen Schulen, in denen Schwarze immer als Eindringlinge betrachtet wurden, die nicht wirklich dazugehörten, lehrte mich den Unterschied zwischen einer Bildung als Praxis der Freiheit und einer Bildung, die lediglich danach strebt, Herrschaft zu verfestigen. Die wenigen weißen Lehrkräfte, die es wagten, Widerstand zu leisten, die nicht zuließen, dass rassistische Vorurteile unseren Unterricht bestimmten, bestärkten mich in dem Glauben, dass Bildung in ihrer kraftvollsten Form tatsächlich befreiend wirken kann. Auch einige wenige Schwarze Lehrpersonen hatten sich uns im De-Segregationsprozess angeschlossen. Es wurde schwieriger für sie, doch trotzdem förderten sie weiterhin Schwarze Kinder und Jugendliche, auch wenn ihre Bemühungen durch den Verdacht eingeschränkt wurden, dass sie ihre eigene ›Rasse‹ bevorzugten.
Trotz meiner schlimmen Erfahrungen habe ich die Schule in dem Glauben abgeschlossen, dass Bildung etwas bewirken kann, dass sie unsere Fähigkeit, frei zu sein, stärkt. Als ich mein Grundstudium an der Stanford University begann, war ich ganz beseelt von meinem Vorhaben, eine rebellische Schwarze Intellektuelle zu werden. Ich war dann überrascht und schockiert, in Seminaren zu sitzen, in denen sich die Lehrenden nicht für das Unterrichten begeisterten, in denen sie keine Ahnung davon zu haben schienen, dass Bildung eine Praxis der Freiheit sein kann. Im College wurde die wichtigste Lektion wiederholt: Wir sollten Gehorsam gegenüber Autoritäten lernen.
An der Universität wurde der Kursraum zu einem Ort, den ich hasste, an dem ich jedoch darum kämpfte, das Recht auf ein unabhängiges Denken einzufordern und zu wahren. Die Universität fühlte sich immer mehr wie ein Gefängnis an, ein Ort der Bestrafung und des Eingesperrtseins, anstatt ein Ort der Verheißung und der Möglichkeiten. Ich schrieb mein erstes Buch während meines Grundstudiums, auch wenn es erst Jahre später veröffentlicht wurde. Ich schrieb, aber noch wichtiger war, dass ich mich darauf vorbereitete, Lehrerin zu werden.
Obwohl ich den Lehrberuf als meine Bestimmung annahm, quälte mich die Realität des universitären Lehrbetriebs, die ich sowohl als Studienanfängerin als auch als Masterstudentin kennengelernt hatte. Der überwiegenden Mehrheit unserer Lehrenden mangelte es an grundlegenden kommunikativen Kompetenzen. Sie waren wenig selbstreflexiv und nutzten die Lehrveranstaltungen häufig, um Rituale der Kontrolle, der Beherrschung und der ungerechten Machtausübung zu praktizieren. In diesem Umfeld lernte ich viel über die Art von Lehrperson, die ich nicht werden wollte.
Während meines Studiums stellte ich fest, dass ich mich in den Lehrveranstaltungen oft langweilte. Das herkömmliche Bildungssystem (das auf der Annahme beruht, dass Auswendiglernen und Wiederkäuen von Informationen gleichbedeutend ist mit dem Erwerb von Wissen, das dann abgelegt, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden kann) interessierte mich nicht. Ich wollte eine kritische Denkerin werden. Doch diese Sehnsucht wurde oft als Bedrohung der Autorität angesehen. Einzelne weiße männliche Studenten, die als ›außergewöhnlich‹ galten, durften zwar oft ihren eigenen intellektuellen Weg gehen, aber von uns anderen (und insbesondere von den Angehörigen marginalisierter Gruppen) wurde immer erwartet, dass wir uns anpassten. Nonkonformität unsererseits wurde mit Misstrauen betrachtet, als leere Geste des Trotzes, die darauf abzielte, Minderwertigkeit oder mangelhafte Leistungen zu kaschieren. Damals wurde denjenigen von uns, die aus marginalisierten Gruppen stammten und an angesehenen, überwiegend weißen Colleges studieren durften, das Gefühl vermittelt, dass wir nicht dort waren, um zu lernen, sondern um zu beweisen, dass wir den Weißen ebenbürtig waren. Wir sollten dies beweisen, indem wir zeigten, wie perfekt wir zu Klonen unserer Gleichaltrigen werden konnten. Da wir ständig mit Vorurteilen konfrontiert waren, wurde unsere Lernerfahrung durch eine Unterströmung von Stress beeinträchtigt.
Meine Reaktion auf diesen Stress und die allgegenwärtige Langeweile und Apathie in meinen Seminaren bestand darin, mir vorzustellen, wie das Lehren und die Lernerfahrung anders sein könnten. Als ich das Werk des brasilianischen Wissenschaftlers Paulo Freire entdeckte und damit meine erste Einführung in die kritische Pädagogik erhielt, fand ich einen Mentor und einen Wegweiser, jemanden, der verstand, dass Lernen befreiend sein kann. Mit seinen Lehren wuchs mein Verständnis dafür, wie ermächtigend die Bildung, die ich an den Schwarzen Schulen in den Südstaaten erhalten hatte, gewesen war, und ich begann, Leitlinien für meine eigene pädagogische Praxis zu entwickeln. Da ich mich bereits intensiv mit feministischem Denken beschäftigt hatte, fiel es mir nicht schwer, mich Freires Werk mit meiner eigenen kritischen Sichtweise zu nähern. Bezeichnenderweise hatte ich das Gefühl, dass dieser Mentor und Wegweiser, den ich noch nie persönlich gesehen hatte, mich ermutigen und unterstützen würde, seine Ideen zu hinterfragen, wenn er sich wirklich der Erziehung als Praxis der Freiheit verpflichtet fühlte. Gleichzeitig nutzte ich seine pädagogischen Paradigmen, um die Grenzen des feministischen Lehrens und Lernens kritisch zu reflektieren.
Als ich studierte, waren es nur weiße Professorinnen, die sich an der Entwicklung von Studiengängen in Women’s Studies beteiligten. Mein erstes Seminar als Doktorandin über Schwarze Schriftstellerinnen aus feministischer Sicht hielt ich denn auch nicht im Rahmen der Women’s Studies, sondern der Black Studies. Damals musste ich feststellen, dass weiße Professorinnen nicht gerade eifrig bemüht waren, das Interesse Schwarzer Studentinnen an feministischem Denken und wissenschaftlicher Arbeit zu fördern, wenn dieses Interesse dazu führte, auch kritische Fragen aufzuwerfen. Doch ihr Desinteresse hielt mich nicht davon ab, mich mit feministischen Ideen zu beschäftigen oder an feministischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Denn diese Kurse waren der einzige Ort, an dem immerhin pädagogische Praktiken hinterfragt wurden und an dem davon ausgegangen wurde, dass das vermittelte Wissen die Studierenden befähigen würde, bessere Wissenschaftler:innen zu werden und auch in der Welt jenseits der Hochschule besser zu leben. Der feministische Seminarraum war der einzige Raum, in dem die Studierenden kritische Fragen zum pädagogischen Prozess stellen durften. Diese Kritik war nicht immer gerne gesehen und wurde nicht immer gut aufgenommen, aber sie war erlaubt. Mag die Akzeptanz des kritischen Hinterfragens auch noch so begrenzt gewesen sein, so wurden wir Studierende doch dadurch angeregt, ernsthaft über Pädagogik als Praxis der Freiheit nachzudenken.
Als ich zum ersten Mal als Dozentin einen Kursraum betrat, schöpfte ich aus dem Beispiel der inspirierten Schwarzen Lehrerinnen in meiner Grundschule, aber ebenso aus Freires Werk und aus feministischen Denkansätzen über radikale Pädagogik. Ich sehnte mich leidenschaftlich danach, anders zu unterrichten, als ich es selbst seit der High School erlebt hatte. Mein erster pädagogischer Grundsatz beruhte auf der Vorstellung, dass der Kursraum ein spannender Ort sein sollte, der niemals langweilig ist. Und sollte dennoch Langeweile herrschen, dann bräuchte es pädagogische Methoden, die in die Lernatmosphäre eingreifen, sie verändern, ja sogar stören würden. Weder Freires Werk noch die feministische Pädagogik erforschten das Konzept des Sichwohlfühlens in einer universitären Lehrveranstaltung. Die Idee, dass Lernen aufregend sein sollte, manchmal sogar ›Spaß‹ machen sollte, war hin und wieder wohl Gegenstand einer kritischen erziehungswissenschaftlichen Diskussion über pädagogische Praktiken an Grundschulen und manchmal sogar an weiterführenden Schulen. Jedoch schien es weder bei traditionellen noch bei radikalen Erziehungswissenschaftler:innen ein Interesse daran zu geben, die Rolle der Begeisterung in der Hochschulbildung zu diskutieren.
Begeisterung zu wecken, konnte laut allgemeiner Auffassung in der Hochschulbildung die Atmosphäre der Ernsthaftigkeit stören, die als wesentlich für den Lernprozess angesehen wurde. Wer an Colleges und Universitäten lehrte und dabei den Wunsch verspürte, Begeisterung bei den Studierenden zu wecken, musste Grenzen überschreiten. Dies erforderte nicht nur, sich über die akzeptierten Regeln hinauszubewegen, sondern auch, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass es niemals eine absolut festgelegte Agenda für die Lehrpraxis geben kann. Die Agenda musste flexibel sein, musste spontane Richtungsänderungen zulassen. Die Studierenden mussten in ihrer Besonderheit als Individuen wahrgenommen werden (ich griff auf die Strategien zurück, die meine Grundschullehrkräfte anwandten, um uns kennenzulernen). Zudem musste mit ihnen entsprechend ihren Bedürfnissen interagiert werden (hier war Freire hilfreich). Die kritische Reflexion meiner Erfahrungen als Lernende in langweiligen Lernsettings ermöglichte es mir nicht nur, mir vorzustellen, dass der Unterricht aufregend sein könnte, sondern auch, dass diese Spannung mit ernsthaftem intellektuellen bzw. wissenschaftlichen Interesse einhergehen und dieses sogar anregen könnte.
Dennoch reichte die Begeisterung für Ideen nicht aus, um einen spannenden Lehr-Lernprozess zu schaffen. Als Lernende sind wir eine Gruppe, und unsere Fähigkeit, Spannung zu erzeugen, ist stark davon abhängig, wie sehr wir uns füreinander interessieren, wie sehr wir die Stimmen der anderen hören und deren Präsenz anerkennen. Da die überwiegende Mehrheit der Studierenden durch konservative, traditionelle Bildungspraktiken lernt und nur auf die Lehrperson achtet, muss jede radikale Pädagogik darauf bestehen, dass die Anwesenheit aller anerkannt wird. Diese Forderung darf kein bloßes Lippenbekenntnis bleiben, sondern sie muss durch pädagogische Praktiken konkret umgesetzt werden. Zunächst ist es unabdingbar, dass die Lehrkraft die Anwesenheit aller Einzelnen wirklich wertschätzt. Es muss ständig deutlich gemacht werden, dass alle Teilnehmenden einen Einfluss auf die Dynamik im Kursraum haben, dass alle einen Beitrag leisten. Diese Beiträge sind Ressourcen. Konstruktiv eingesetzt verbessern sie das Potenzial eines jeden Kurses, eine offene Lerngemeinschaft zu werden. Bevor dieser Prozess beginnen kann, muss die traditionelle Vorstellung, dass nur die Lehrperson für die Dynamik im Kurs verantwortlich ist, oft erst einmal überwunden werden. Nichtsdestotrotz ist die Verantwortung abhängig vom jeweiligen Status. In der Tat wird die Lehrperson in gewisser Weise immer die Hauptverantwortung für das, was in der Lehrveranstaltung geschieht, tragen, denn die institutionellen Strukturen sind und bleiben entsprechend angelegt. Es ist jedoch selten, dass eine Lehrperson, und sei sie noch so eloquent, durch ihre Handlungen alleine so viel Begeisterung erzeugen kann, dass ein spannender Unterricht entsteht. Spannung wird durch kollektive Anstrengung erzeugt.
Den Kursraum sollten wir immer als einen gemeinschaftlichen Ort begreifen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit kollektiver Anstrengungen zur Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lerngemeinschaft. In einem Semester hatte ich eine sehr schwierige Lerngruppe, die auf der gemeinschaftlichen Ebene völlig versagte. Während des gesamten Semesters war ich der Meinung, dass der größte Nachteil, der die Entwicklung einer Lerngemeinschaft behinderte, darin bestand, dass der Kurs am frühen Morgen, vor neun Uhr, angesetzt war. Fast immer war es so, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der Studierenden noch nicht ganz wach war. Dieses Problem zu lösen, war schier unmöglich, und auch mit den Spannungen im Zusammenhang mit der Diversität der Studierenden umzugehen, war schwer. Ab und zu hatten wir eine spannende Sitzung, aber meistens war es langweilig. Ich begann, diesen Kurs so sehr zu hassen, dass ich große Angst hatte, am Morgen davor nicht rechtzeitig aufzuwachen. Die ganze Nacht konnte ich kaum schlafen – und das trotz meines Weckers, des telefonischen Weckdienstes und der Gewissheit, dass ich noch nie eine Sitzung verschlafen hatte. Und trotz allem kam ich dann im Gegensatz zu den meisten Studierenden nicht schläfrig, sondern hellwach und voller Energie im Kurs an.
Aber die frühe Uhrzeit war nur einer der Faktoren, die verhinderten, dass dieser Kurs zu einer Lerngemeinschaft wurde. Aus Gründen, die ich nicht erklären kann, war er auch voller ›unwilliger‹ Studierender, die keine neuen pädagogischen Prozesse lernen wollten, die nicht in einer Lehrveranstaltung sein wollten, die sich in irgendeiner Weise von der Norm unterschied. Diese Studierenden hatten Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Und obwohl sie nicht die Mehrheit waren, schien ihr sturer Widerstandsgeist immer stärker zu sein als jeder Wille zu intellektueller Offenheit und Freude am Lernen. Mehr als jeder andere Kurs, den ich abgehalten hatte, zwang mich dieser Kurs dazu, mich von der Vorstellung zu verabschieden, dass die Lehrperson durch bloße Willensstärke und nur, weil sie es gerne hätte, eine Lehrveranstaltung zu einer spannenden, lernenden Gemeinschaft machen kann.
Vor diesem Kurs war ich der Meinung, dass dieses Buch, Die Welt verändern lernen – Bildung als Praxis der Freiheit, eine Aufsatzsammlung sein würde, die sich hauptsächlich an Lehrende richtet. Als ich nach dem Kurs mit dem Schreiben begann, war mir klar, dass ich sowohl zu Studierenden als auch zu Lehrenden sprechen würde. Das wissenschaftliche Feld der kritischen Pädagogik und / oder der feministischen Pädagogik ist nach wie vor davon geprägt, dass der Diskurs hauptsächlich von weißen Frauen und Männern geführt wird. Auch Freire hat im Gespräch mit mir, wie in vielen seiner schriftlichen Arbeiten, immer eingeräumt, dass er die Position der weißen Männlichkeit repräsentiert, insbesondere in diesem Land. Nichtsdestotrotz hat die Arbeit verschiedener Vordenker:innen der radikalen Pädagogik (ich verwende diesen Begriff, um kritische und / oder feministische Perspektiven einzuschließen) in den letzten Jahren tatsächlich zu einer Anerkennung von Verschiedenheit geführt – von Unterschieden, die durch Klasse, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Nationalität usw. bestimmt werden. Doch scheint dieser Schritt nach vorn nicht damit einherzugehen, dass sich Schwarze oder andere nicht-weiße Stimmen stärker an den Diskussionen über radikale pädagogische Praktiken beteiligen.
Meine pädagogische Praxis ist aus dem sich gegenseitig befruchtenden Zusammenspiel von antikolonialer, kritischer und feministischer Pädagogik hervorgegangen. Diese komplexe und einzigartige Verschmelzung verschiedener Perspektiven ist ein faszinierender und kraftvoller Ausgangspunkt für meine Arbeit. Über die jeweiligen fachlichen Grenzen hinauszugehen hat mir ermöglicht, mir neue pädagogische Praktiken vorzustellen und diese auch umzusetzen. Sie zielen ganz konkret darauf ab, curriculare Vorurteile und Einseitigkeiten zu hinterfragen, die Herrschaftssysteme (wie Rassismus und Sexismus) fortschreiben, und gleichzeitig neue Wege zu finden, um diverse Gruppen von Studierenden zu unterrichten.
In diesem Buch möchte ich Einsichten, Strategien und kritische Überlegungen zur pädagogischen Praxis vermitteln. Die hier versammelten Aufsätze sollen eine Intervention gegen die Abwertung der Lehre sein. Auch wenn Veränderungen in der Unterrichtspraxis dringend notwendig sind, schmälert das nicht die Bedeutung der Lehre. Die Texte hier sollen als konstruktive Kommentare dienen. Sie sind hoffnungsvoll und überschwänglich und vermitteln das Vergnügen und die Freude, die ich beim Unterrichten empfinde; diese Aufsätze sollen ein Fest sein! Sie feiern die Freude am Lehren als einen Akt des Widerstands gegen die überwältigende Langeweile, das Desinteresse und die Apathie, die so oft die Gefühle von Dozent:innen wie Studierenden in Bezug auf das Lehren und Lernen, auf die Erfahrung im Unterricht prägen.
Jeder Aufsatz befasst sich mit zentralen Themen, die in Diskussionen über Pädagogik immer wieder auftauchen, und bietet Möglichkeiten zum Überdenken der Lehr-Lern-Methoden und konstruktive Strategien zur Verbesserung des Lernens. Da sie für unterschiedliche Kontexte geschrieben wurden, gibt es zwangsläufig ein gewisses Maß an Überschneidungen; Ideen werden wiederholt, Schlüsselsätze wieder und wieder verwendet. Auch wenn ich Strategien vermittle, bieten diese Texte keine Patentrezepte dafür, wie man den Kursraum zu einem spannenden Ort des Lernens machen kann. Dies würde der Forderung zuwiderlaufen, dass eine engagierte Pädagogik jede Lerngruppe als anders anerkennt, dass Strategien ständig geändert, erfunden und neu konzipiert werden müssen, um jeder neuen Unterrichtserfahrung gerecht zu werden.
Unterrichten ist ein performativer Akt. Und es ist dieser Aspekt unserer Arbeit, der den Raum für Veränderungen, Entdeckungen und spontane Richtungswechsel bietet, der als Katalysator dienen kann, der die einzigartigen Elemente in jedem Klassenzimmer, in jedem Kursraum hervorbringt. Wenn wir uns dem performativen Aspekt des Unterrichtens stellen wollen, sind wir gezwungen, das ›Publikum‹ einzubeziehen und Fragen der Wechselseitigkeit in Betracht zu ziehen. Lehrkräfte sind zwar keine Performancekünstler:innen, da unsere Arbeit nicht als Spektakel gedacht ist, sehr wohl aber geben wir Impulse, die alle Beteiligten dazu auffordern, sich stärker und aktiver am Unterricht zu beteiligen.
So wie sich unsere ›Performance‹ je nach Situation verändert, sollte sich auch unser Gefühl für die Art unserer ›Stimme‹ bzw. unsere Sprechweise verändern. In unserem täglichen Leben sprechen wir unterschiedlich zu verschiedenen Personenkreisen. Wir kommunizieren am besten, wenn wir die Art des Sprechens wählen, die von der Besonderheit und Einzigartigkeit derjenigen, zu denen und mit denen wir sprechen, geprägt ist. Entsprechend dieser Logik klingen auch diese Aufsätze nicht alle gleich. Sie spiegeln mein Bemühen wider, die Sprache in einer Weise zu verwenden, die auf spezifische Kontexte eingeht, und meinen Wunsch, mit einem diversen Publikum zu kommunizieren. Um in unterschiedlichen Zusammenhängen zu unterrichten, müssen wir nicht nur unsere eigenen Paradigmen jeweils ändern, sondern auch die Art und Weise, wie wir denken, schreiben und sprechen. Die engagierte Stimme darf nie starr und absolut sein, sondern muss sich stets verändern und sich im Dialog mit einer Welt jenseits ihrer selbst weiterentwickeln.
Die in diesem Band versammelten Aufsätze spiegeln meine Erfahrungen aus kritischen Diskussionen mit Lehrenden und Lernenden wider, ebenso wie mit Personen, die meinen Unterricht beobachtet haben. In ihrer Vielschichtigkeit sollen diese Texte also davon Zeugnis ablegen, dass Bildung eine Praxis der Freiheit ist. Lange bevor ich in der Öffentlichkeit als Wissenschaftlerin oder Schriftstellerin wahrgenommen wurde, wurde ich in Kursen von Studierenden wahrgenommen – als Lehrende, die hart daran arbeitete, eine dynamische Lernerfahrung für uns alle zu schaffen. Heutzutage bin ich eher für meine rebellische intellektuelle Praxis bekannt. Und tatsächlich zeigt sich das akademische Publikum, das ich bei meinen Vorträgen treffe, immer wieder überrascht, wenn es merkt, wie vertraut ich mit dem Lehrbetrieb bin. Dieses Publikum schien besonders überrascht zu sein, als ich sagte, dass ich an einer Sammlung von Aufsätzen über das Unterrichten arbeite. Die erstaunten Reaktionen erinnern traurigerweise daran, dass die Lehre als ein langweiliger, weniger wertvoller Aspekt der akademischen Profession angesehen wird. Eine solche Sichtweise auf die Lehre ist weit verbreitet. Sie muss jedoch infrage gestellt werden, wenn wir den Bedürfnissen unserer Lernenden gerecht werden wollen, wenn wir in den Bildungseinrichtungen und im Unterricht wieder Begeisterung für Ideen und den Willen zum Lernen wecken wollen.
Wir erleben gerade eine ernste Bildungskrise. Häufig wollen junge Menschen nicht lernen und Lehrpersonen nicht unterrichten. Mehr als je zuvor in der jüngeren Geschichte dieses Landes sind Pädagog:innen gezwungen, sich mit den Vorurteilen auseinanderzusetzen, die die Lehrmethoden in unserer Gesellschaft geprägt haben, und neue Wege des Lernens und andere Strategien für die Vermittlung von Wissen zu entwickeln. Wir können diese Krise nicht bewältigen, wenn fortschrittliche, kritisch denkende Wissenschaftler:innen und Kulturkritiker:innen so tun, als sei die Lehre kein Thema, das unserer Aufmerksamkeit wert ist.
Unterricht ist nach wie vor der radikalste Möglichkeitsraum in unserer Bildungslandschaft. Von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen werden Bildung und Lehre seit Jahren unterminiert; beide Gruppen wollen den Unterricht eher als Plattform für die Durchsetzung ihrer Interessen denn als Ort des Lernens nutzen. Mit diesen Aufsätzen schließe ich mich dem kollektiven Ruf nach Erneuerung und Veränderung unserer Lehrmethoden an. Wir alle sind aufgefordert, unseren Verstand und unser Herz zu öffnen, um – weit über die Grenzen des herkömmlich Akzeptierten hinaus – Wissen zu erwerben und Erkenntnis zu erlangen, um denken zu lernen und umzudenken, um neue Visionen zu schaffen. Ich begeistere mich für einen Unterricht, der das Überschreiten von Grenzen, Transgression, ermöglicht, der eine Bewegung gegen und über Grenzen hinaus erlaubt. Es ist diese Bewegung, die Bildung zu einer Praxis der Freiheit werden lässt.
_______
* Anm. d. Ü.: In diesem Buch schreibt bell hooks über das Lehren an Schulen, Colleges und Universitäten. Für ihre pädagogischen Reflexionen nimmt sie ihre eigenen Erfahrungen als Schülerin, als Studentin an der Universität und als Lehrerin bzw. Dozentin am College als Ausgangspunkt. Im englischen Original ist von »students«, »classroom«, »teacher«, »professor« usw. die Rede, ohne dass immer klar zwischen Schulen, Colleges und Universitäten unterschieden wird, was nicht zuletzt auf das völlig unterschiedliche Bildungssystem in den USA verweist. Da ihre pädagogischen Konzepte sowohl für die Schule als auch für die Hochschulbildung relevant sind, wird im Folgenden oft allgemein von Lehrenden und Lernenden gesprochen und nur da von Schüler:innen, Studierenden, Lehrer:innen und Professor:innen bzw. Dozent:innen, wo sie ausdrücklich differenziert.
1
Engagierte Pädagogik
Pädagogik als Praxis der Freiheit bedeutet einen Unterricht, der für alle zugänglich ist. Einen solchen Lehr-Lern-Prozess zu gestalten, fällt denjenigen von uns am leichtesten, die davon überzeugt sind, dass unsere Berufung in gewissem Sinne heilig ist, die glauben, dass unsere Arbeit nicht nur darin besteht, Informationen zu vermitteln, sondern am intellektuellen und spirituellen Wachstum der Lernenden teilzuhaben. Eine Lehrtätigkeit, die die Seele unserer Studierenden respektiert und sich um sie kümmert, ist unerlässlich, wenn wir die notwendigen Bedingungen schaffen wollen, unter denen wirkliches und tiefgründiges Lernen stattfinden kann.
Als Studentin und Dozentin haben mich vor allem jene Lehrenden inspiriert, die den Mut hatten, die Grenzen zu überschreiten, die die Lernenden auf reines Auswendiglernen und bloßes Reproduzieren von Wissen beschränken würden. Solche Lehrpersonen gehen mit dem Willen und dem Wunsch an die Lernenden heran, auf unser aller Einzigartigkeit einzugehen, auch wenn die Situation es oft nicht zulässt, dass eine auf gegenseitiger Anerkennung beruhende Beziehung zustande kommt. Doch die Möglichkeit einer solchen Anerkennung ist immer gegeben.
Paulo Freire und der vietnamesische buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh sind zwei der ›Lehrer‹, die mich mit ihrer Arbeit tief berührt haben. Als ich mit dem Studium begann, gaben mir Freires Gedanken die Unterstützung, die ich brauchte, um die im Bildungssystem vorherrschende »Bankiers-Erziehung« infrage zu stellen, diesen Ansatz des Lernens, der in der Vorstellung wurzelt, dass alles, was Lernende tun müssen, darin bestehe, die ihnen von einer Lehrperson zugeführten Informationen zu konsumieren und in der Lage zu sein, sie abzuspeichern und für später anzulegen. Schon früh beharrte Freire darauf, dass Bildung eine Praxis der Freiheit sein kann, was mich dazu ermutigte, Strategien dafür zu entwickeln, was er »Bewusstseinsbildung« im Unterricht nannte. Ich übersetzte diesen Begriff als kritische Achtsamkeit bzw. kritisches Engagement und ging mit der Überzeugung in die Lehrveranstaltungen, dass es für mich und alle anderen Lernenden entscheidend war, aktiv teilzunehmen anstatt nur passiv zu konsumieren. Bildung als Praxis der Freiheit wurde immer wieder von solchen Lehrenden unterminiert, die der Idee der Studierendenbeteiligung dezidiert feindlich gegenüberstanden. Freires Werk hingegen bekräftigte, dass Bildung nur dann befreiend sein kann, wenn alle Beteiligten das Wissen als ein Feld beanspruchen, in dem sich alle gemeinsam abmühen. Dieser Begriff der gemeinsamen Anstrengung wurde von Thich Nhat Hanhs Philosophie des engagierten Buddhismus bestätigt, die sich auf die Praxis in Verbindung mit der Kontemplation konzentriert. Seine Philosophie ähnelt Freires Betonung der »Praxis« – der Aktion und Reflexion, um die Welt zu verändern.
In seinem Werk spricht Thich Nhat Hanh immer wieder von Lehrenden als Heilende. Wie Freire forderte er die Lernenden auf, sich aktiv zu beteiligen und achtsames Bewusstsein mit Praxis zu verbinden. Während Freire sich in erster Linie mit dem Verstand beschäftigte, bot Thich Nhat Hanh eine Denkweise für die Pädagogik an, die die Ganzheitlichkeit, die Einheit von Geist, Körper und Seele betont. Sein Fokus auf einen ganzheitlichen Ansatz für das Lernen und die spirituelle Praxis ermöglichte es mir, meine jahrelange Sozialisation zu überwinden, die mich gelehrt hatte, dass Unterricht beeinträchtigt wird, wenn Lernende und Lehrende sich gegenseitig als Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit betrachten und nicht nur nach Wissen aus Büchern streben, sondern nach Wissen darüber, wie man in der Welt lebt.
In den zwanzig Jahren meiner Lehrtätigkeit habe ich erlebt, dass sich die Lehrenden, unabhängig von ihrer politischen Orientierung, sehr unwohl fühlen, wenn die Studierenden von uns ganzheitlich wahrgenommen werden wollen, als Menschen mit komplexen Lebenszusammenhängen und Erfahrungen und nicht einfach nur als Suchende nach isoliertem Fachwissen. Als ich studierte, waren die Women’s Studies gerade dabei, ihren Platz in der akademischen Welt zu finden. Diese Lehrveranstaltungen waren der einzige Raum, in dem die Unterrichtenden bereit waren, eine Verbindung zwischen den an der Universität gelernten Ideen und den in der Lebenspraxis erworbenen Kenntnissen anzuerkennen. Und trotz der Momente, in denen Studierende diese Freiheit im Seminarraum missbrauchten, indem sie nur über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen wollten, waren feministische Seminare im Großen und Ganzen ein Ort, an dem ich beobachten konnte, wie sich Professorinnen bemühten, partizipative Räume für den Austausch von Wissen zu schaffen. Heutzutage sind die meisten Dozentinnen für Women’s Studies nicht mehr so engagiert bei der Erforschung neuer pädagogischer Strategien. Trotz dieses Wandels gehen viele Studierende immer noch in feministische Lehrveranstaltungen, weil sie nach wie vor glauben, dass sie dort mehr als irgendwo sonst an der Hochschule die Möglichkeit haben, Bildung als Praxis der Freiheit zu erfahren.
Progressive, ganzheitliche Bildung, ›engagierte Pädagogik‹ ist anspruchsvoller als die herkömmliche kritische oder feministische Pädagogik. Denn im Gegensatz zu diesen beiden Lehrpraktiken legt sie den Schwerpunkt auf das Wohlbefinden. Das bedeutet, dass Lehrende sich aktiv für einen Prozess inneren Wachstums* einsetzen müssen, der ihr eigenes Wohlbefinden fördert, wenn sie auf eine Art und Weise unterrichten wollen, die Lernende befähigen kann. Thich Nhat Hanh betonte, dass »die Praxis eines Heilers, Therapeuten, Lehrers oder einer anderen helfenden Person zuerst auf sich selbst gerichtet sein sollte, denn wenn der Helfer unglücklich ist, kann er kaum anderen Menschen helfen.« In den Vereinigten Staaten ist es selten, dass jemand über Lehrende an Universitäten als Heilende spricht. Und noch seltener hört man jemanden sagen, dass Lehrkräfte Verantwortung für ihr seelisches Gleichgewicht, ihr eigenes psychisches Wohlbefinden, übernehmen müssen.
Vor meinem Studium hatte ich mich intensiv mit der Arbeit von Intellektuellen und Gelehrten in Romanen und nicht-fiktionaler Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigt, was mich davon überzeugte, dass alle, die sich für den Lehrberuf entscheiden, ganzheitlich nach ihrer eigenen persönlichen seelisch-psychischen Weiterentwicklung streben sollten. Es war dann die tatsächliche Erfahrung am College, die dieses Bild erschütterte. Dort wurde mir das Gefühl vermittelt, dass ich in Bezug auf den Lehrberuf furchtbar naiv sei. Ich lernte, dass die Universität alles andere als ein Ort des persönlichen Wachstums war, sondern eher ein Zufluchtsort für diejenigen, die zwar über ein gutes Buchwissen verfügten, aber ansonsten im sozialen Umgang möglicherweise nicht so kompetent waren. Glücklicherweise begann ich während meiner Studienzeit zu unterscheiden zwischen der wissenschaftlichen bzw. unterrichtlichen Tätigkeit selbst und der Rolle als Angehörige einer akademischen Profession.
In einem Kontext, in dem das geistige Wohlbefinden, die Pflege der Seele, wenig im Vordergrund stand, war es schwierig, an der Vorstellung festzuhalten, eine intellektuelle Person sei per se ein nach Ganzheitlichkeit strebender Mensch. Tatsächlich schien die Objektivierung der Lehrenden innerhalb der bürgerlichen Bildungsstrukturen der Vorstellung von Ganzheitlichkeit entgegenzustehen und die Idee einer Trennung von Geist und Körper aufrechtzuerhalten, wodurch Abschottung und Segmentierung gefördert und unterstützt wurden.
Dadurch wird die dualistische Trennung von öffentlich und privat verfestigt, und Lehrende wie Lernende werden darin bestärkt, keinen Zusammenhang zwischen der Lebensführung, dem Habitus und der Rolle von Dozent:innen zu sehen. Die Idee des intellektuellen Strebens nach einer Einheit von Geist, Körper und Seele ist durch die Vorstellung ersetzt worden, klug zu sein bedeute, dass man von Natur aus emotional instabil sei und dass das Beste in einem selbst in der akademischen Arbeit zum Vorschein komme. Das hieß auch, dass unabhängig davon, ob Akademiker:innen drogenabhängig, alkoholabhängig und gewalttätig waren oder sexualisierte Gewalt ausübten, der einzige wichtige Aspekt unserer Identität darin bestand, ob unser Verstand funktionierte oder nicht, ob wir in der Lage waren, unsere Aufgaben im Unterricht zu erfüllen. Das Ich war dieser Auffassung nach wie ausgelöscht, sobald die Schwelle zum Kursraum überschritten wurde, so dass nur noch ein objektiver Verstand übrig blieb, der frei von Erfahrungen und Vorurteilen war. Denn schließlich bestand die Befürchtung, dass die Bedingungen dieses Ichs den Unterrichtsprozess ansonsten beeinträchtigen würden. Ein Teil des Luxus und des Privilegs der Rolle von Lehrer:innen bzw. Professor:innen besteht heute darin, dass von uns nicht verlangt wird, dass wir uns um unser seelisches Gleichgewicht kümmern. Es überrascht nicht, dass Lehrende, die sich nicht um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, sich am ehesten von der Forderung der Studierenden nach einer befreienden Bildung bedroht fühlen, nach pädagogischen Prozessen, die sie in ihrem eigenen Ringen, mit sich selbst ins Reine zu kommen, unterstützen können.
Sicherlich war es naiv von mir, mir während meiner Schulzeit vorzustellen, dass ich an einer Universität geistige und intellektuelle Führung durch Schriftsteller:innen, Wissenschaftler:innen und Intellektuelle finden würde. Wenn ich dies gefunden hätte, wäre ich über einen seltenen Schatz gestolpert. Zusammen mit anderen Studierenden lernte ich, mich glücklich zu schätzen, wenn ich eine interessante Lehrperson fand, die auf eine fesselnde Weise sprach. Die meisten meiner Dozent:innen waren nicht im Geringsten an Aufklärung interessiert. Mehr als alles andere schienen sie von der Ausübung von Macht und Autorität in ihrem Mini-Reich, dem Kursraum, fasziniert zu sein.
Das soll nicht heißen, dass es nicht auch mitreißende, wohlwollende Diktator:innen gab, aber meiner Erinnerung nach war es selten – und zwar erstaunlich selten –, Lehrenden zu begegnen, die sich ernsthaft um fortschrittliche pädagogische Praktiken bemühten. Darüber war ich bestürzt; die meisten meiner Kursleiter:innen waren keine Personen, deren Unterrichtsstil ich nachahmen wollte.
Meine Begeisterung für das Lernen veranlasste mich, trotzdem weiterhin Kurse zu besuchen. Und doch behandelten mich einige Dozent:innen mit Verachtung, weil ich mich nicht anpasste, weil ich keine unkritische, passive Studentin sein wollte. Nach und nach entfremdete ich mich von der universitären Bildung. Dass ich inmitten dieser Entfremdung auf Freire stieß, war entscheidend für mein Überleben als Studentin. Sein Werk bot mir sowohl die Möglichkeit, die Grenzen der Art von Bildung zu verstehen, die ich erhielt, als auch alternative Strategien für das Lernen und Lehren zu entdecken. Besonders enttäuschend war es, auf weiße männliche Professoren zu treffen, die behaupteten, Freires Modell zu folgen, obwohl ihre pädagogische Praxis in Herrschaftsstrukturen verhaftet war und den Stil konservativer Lehrender widerspiegelte, auch wenn sie die Themen von einem progressiveren Standpunkt aus behandelten.
Als ich Paulo Freire zum ersten Mal begegnete, war ich sehr gespannt darauf, ob sein Unterrichtsstil jene pädagogische Praxis auch verkörpern würde, die er in seinem Werk so eloquent beschrieben hat. Während der kurzen Zeit, in der ich bei ihm studierte, war ich tief berührt von seiner Präsenz, davon, wie seine Art zu unterrichten seine pädagogische Theorie veranschaulichte. (Nicht alle Studierenden, die sich für Freire interessieren, konnten eine ähnliche Erfahrung machen.) Meine Erfahrung mit ihm hat meinen Glauben an eine befreiende Pädagogik wiederhergestellt. Ich wollte mich nie von der Überzeugung verabschieden, dass ein Unterricht möglich ist, ohne dass er bestehende Herrschaftssysteme verstärkt. Es war mir wichtig zu wissen, dass Lehrende im Seminar keine Diktator:innen sein müssen.
Obwohl ich den Lehrberuf anstrebte, glaubte ich, dass persönlicher Erfolg eng mit der Selbstsorge für das eigene psychische Wohlbefinden verbunden ist. Meine Leidenschaft für dieses Streben führte dazu, dass ich die Trennung zwischen Körper und Geist, die so oft als gegeben angesehen wurde, ständig hinterfragte. Die meisten Professor:innen lehnten alle Konzepte des Lehrens und Lernens ab, die von einem philosophischen Standpunkt ausgingen, der die Einheit von Körper, Geist und Seele und nicht die Trennung dieser Elemente betonte, ja sie verachteten sie sogar. Wie viele der Studierenden, die ich heute unterrichte, hörte ich von einflussreichen Dozent:innen oft, dass ich fehlgeleitet sei, wenn ich solche Ansätze an der Universität suchte. Dabei fühlte ich während meiner gesamten Studienzeit tiefe innere Not. Die Erinnerung an diesen Schmerz kehrt zurück, wenn ich von Studierenden höre, die befürchten, dass sie in akademischen Berufen keinen Erfolg haben werden, wenn sie sich gut fühlen wollen, wenn sie keine Lust auf gestörtes Verhalten oder Zwangshierarchien hatten. Diese Studierenden haben oft die gleiche Angst wie ich damals, nämlich, dass es in der Wissenschaft keine Räume gibt, in denen der Wille zur psychischen Selbstsorge bekräftigt wird.
Diese Angst ist vorhanden, weil viele Professor:innen der Vision einer befreienden Bildung, die den Willen zum Wissen mit dem Willen zum Werden verbindet, sehr feindselig gegenüberstehen. In Universitätskreisen wird oft bitterlich beklagt, dass die Studierenden erwarten, dass ihre Kurse zu »Selbsthilfegruppen« werden. Es ist zwar völlig abwegig, wenn Studierende erwarten, dass Lehrveranstaltungen zu Therapiesitzungen werden, aber ihre Hoffnung, dass das Wissen, das ihnen dort vermittelt wird, sie bereichert und voranbringt, ist sehr wohl berechtigt.