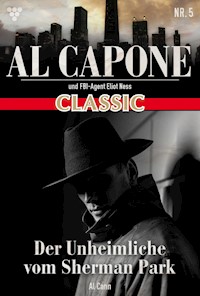Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
FBI-Agent Eliot Ness, der große Gegenspieler von Al Capone Aufregende Action-Krimis aus Chicago um Bandenkriege und Frauenmörder, erzählt von einem Schriftsteller, der sich wie kein anderer in der großen, alten Gangster-Metropole auskennt: Al Cann weiß alles über den unbestechlichen FBI-Agenten Eliot Ness und den berüchtigtsten aller Gangster, den Italo-Amerikaner Al Capone, der nicht nur Chicago, sondern das ganze Land in Atem hielt. Die beiden großen Gegenspieler Eliot Ness und Alfonso Capone haben wirklich gelebt! Authentische Kriminalfälle halten unsere Leser in Atem, fesselnd, fast magisch beschrieben, daß es unter die Haut geht. Diese Krimiserie wird alle Krimifans begeistern und nachhaltig binden. Den fintenreichen und spannungsgeladenen Romanen mit wahrem Hintergrund kann niemand widerstehen. Das Duell zwischen Eliot Ness und Al Capone schreitet unaufhaltsam seinem Höhepunkt entgegen... Seit Tagen hatte der Regen zum erstenmal ausgesetzt. Er schien in Chicago zum Winter zu gehören. Da, wo sich der Tinley Creek unter der Straße am Howell Airport entlangzog, stand im tiefen Schlagschatten der Bäume ein Wagen. Es war ein Chevrolet mittlerer Qualität und nicht allerneuester Bauart. Hinter seinem Lenkrad saß ein Mann, der angestrengt quer über die Brücke zur anderen Straßenseite hinübersah. Er war mittelgroß, hatte schütteres aschblondes Haar und ein blasses Gesicht. Die dunklen Augen standen etwas vor und waren nun dünn mit Wimpern besetzt. Das Gesicht wirkte irgendwie schlaff und wies verweichlichte Züge auf. Der Mann trug einen dunkelgrauen Anzug, ein weißes Hemd und eine korrekt gebundene dunkelgraue Krawatte. Mit seinen kurzen, knotigen Fingern umspannte er das Lenkrad und blickte unverwandt auf das Liebespaar, das sich nicht eben zurückhaltend miteinander beschäftigte. Scharf und deutlich konnte er alles gegen den hellen Nachthimmel erkennen. Robson Finder hatte schon eine Stunde hier gewartet. Es war sicher das fünfte oder sechste Mal, daß er hier herausgefahren war, um die Stelle drüben an der Brücke zu beobachten, wo er schon zweimal das Paar gesehen hatte. Einunddreißig Jahre alt war Finder. Er stammte aus Plymouth im Staate Indiana. Seit einiger Zeit lebte er hier in Chicago bei der jüngeren Schwester seines verstorbenen Vaters, die ihn in ihrem Haus in den Hickory Hills aufgenommen hatte. Finder war eine Zeitlang drüben in Indiana Fotograf auf einem Flugplatz gewesen, wo man ihn jedoch wegen der schlechten Bilder nicht mehr länger beschäftigen wollte. Dann war er in eine große Firma eingetreten, bei der er in der Registratur gearbeitet hatte. Hier in Chicago hatte er auch rasch eine neue Stelle in einer Registratur gefunden. Es gehörte zu den Seltsamkeiten im Leben des einzigartigen Verbrechers Robson Finder, daß er in seiner Stellung durch den Tod eines älteren Kollegen aufgerückt und Abteilungsleiter geworden war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Al Capone Classic – 2 –
Der Serienkiller von Chicago
Al Cann
Seit Tagen hatte der Regen zum erstenmal ausgesetzt. Er schien in Chicago zum Winter zu gehören.
Da, wo sich der Tinley Creek unter der Straße am Howell Airport entlangzog, stand im tiefen Schlagschatten der Bäume ein Wagen. Es war ein Chevrolet mittlerer Qualität und nicht allerneuester Bauart. Hinter seinem Lenkrad saß ein Mann, der angestrengt quer über die Brücke zur anderen Straßenseite hinübersah. Er war mittelgroß, hatte schütteres aschblondes Haar und ein blasses Gesicht. Die dunklen Augen standen etwas vor und waren nun dünn mit Wimpern besetzt. Das Gesicht wirkte irgendwie schlaff und wies verweichlichte Züge auf. Der Mann trug einen dunkelgrauen Anzug, ein weißes Hemd und eine korrekt gebundene dunkelgraue Krawatte. Mit seinen kurzen, knotigen Fingern umspannte er das Lenkrad und blickte unverwandt auf das Liebespaar, das sich nicht eben zurückhaltend miteinander beschäftigte. Scharf und deutlich konnte er alles gegen den hellen Nachthimmel erkennen.
Robson Finder hatte schon eine Stunde hier gewartet. Es war sicher das fünfte oder sechste Mal, daß er hier herausgefahren war, um die Stelle drüben an der Brücke zu beobachten, wo er schon zweimal das Paar gesehen hatte.
Einunddreißig Jahre alt war Finder. Er stammte aus Plymouth im Staate Indiana. Seit einiger Zeit lebte er hier in Chicago bei der jüngeren Schwester seines verstorbenen Vaters, die ihn in ihrem Haus in den Hickory Hills aufgenommen hatte. Finder war eine Zeitlang drüben in Indiana Fotograf auf einem Flugplatz gewesen, wo man ihn jedoch wegen der schlechten Bilder nicht mehr länger beschäftigen wollte. Dann war er in eine große Firma eingetreten, bei der er in der Registratur gearbeitet hatte. Hier in Chicago hatte er auch rasch eine neue Stelle in einer Registratur gefunden. Es gehörte zu den Seltsamkeiten im Leben des einzigartigen Verbrechers Robson Finder, daß er in seiner Stellung durch den Tod eines älteren Kollegen aufgerückt und Abteilungsleiter geworden war. Er galt in seiner Firma als ein korrekter, ordentlicher, stets sauber gekleideter »junger Mann« – bei dem nur das Attribut jung nicht mehr ganz zu passen schien. Sein blasses Gesicht wirkte ältlich. Er sah aus wie ein Mann in den späten Vierzigern, wozu auch seine etwas steifen Bewegungen paßten. Er war an diesem Tag genau dreißig Jahre und elf Monate alt! Und was sehr viel wesentlicher war, als daß man ihn für einen korrekten Angestellten hielt, war die Tatsache, daß er bis zu diesem Tag als unbescholten galt.
Aber noch in dieser Stunde würde Robson Finder einen Doppelmord verüben!
Was ihn wirklich veranlaßt hatte, zu der einsamen Stelle an dem wenig benutzten Flugplatz hinauszufahren, ist niemals ermittelt worden. Man irrt auch, wenn man annimmt, daß er einer jener abartigen Typen war, denen es ein Bedürfnis ist, Liebespaare zu beobachten; nein, darum ging es Finder absolut nicht. Er hatte etwas ganz anderes vor…
Fast eine halbe Stunde verharrte er auf dem dunklen Flur hinterm Steuerrad und belauerte das Paar drüben, das sich völlig unbeobachtet fühlte.
Da ertönte in der Ferne das unverkennbare Signal eines Überlandbusses. Gleich darauf blitzten auch die Scheinwerfer durch die Bäume; die dünnen Strahlenfinger tasteten zu dem Paar hinüber, das sich von der Brücke gelöst und langsam an die Haltestelle gegangen war.
Mit einem ächzenden Rattern kam der uralte Bus heran und hielt. Noch einmal verabschiedete sich der junge Mann mit einem Kuß von der Frau, winkte ihr nach und blickte dem Bus nach.
Er stand noch einen Augenblick da, griff dann in die Taschen seines
Dufflecoats, nahm seine Zigaretten heraus, und gleich darauf blitzte das Feuerzeug vor seinem Gesicht auf. Dabei sah der Beobachter drüben, daß es gar kein so sehr junger Mann mehr war. Er wirkte etwas dicklich, war nicht sonderlich gut gekleidet und trug trotz der kühlen Witterung weder Hut, noch Schal, noch Handschuhe.
Als die Zigarette brannte, setzte er sich mit schleppendem Schritt in Bewegung.
Ohne ihn aus den Augen zu lassen, hatte Finder neben sich auf die Sitzbank gegriffen, seine braune viereckige Tasche herangezogen und einen Gegenstand aus ihr herausgeholt, der fortan das Symbol seines furchtbaren Lebens sein sollte. Es war ein Messer. Erst bei näherer Betrachtung konnte man feststellen, daß es kein gewöhnliches Messer war, sondern ein Skalpell, wie es Chirurgen für ihre Operationen benötigen.
Immer noch hatte Finder den Mann scharf im Auge. Mit der Linken griff er nach der Tür, öffnete sie und verließ den Wagen auf der Seite, die der Straße abgekehrt war. Er rechnete damit, daß der Mann drüben auf der anderen Brückenseite bliebe.
Aber das war ein Irrtum. Er kam herüber, und plötzlich sah er den Wagen. Er schien zu stutzen, ging dann aber weiter.
Mit eisiger Ruhe verharrte Finder hinter dem Fahrzeug und wartete, bis der Mann vorüber war. Dann machte er plötzlich einen Schritt nach vorn.
Der einundvierzigjährige Donald Lester hatte das Geräusch gehört und fuhr erschrocken herum.
»He, wohl übergeschnappt, was?« entfuhr es ihm.
Finder verharrte reglos auf der Stelle.
Lester, der in einer Fabrik drüben am Westrand der Stadt als Falzer arbeitete, riß die Augen weit auf, um die Gestalt des anderen besser erkennen zu können. Aber Finders Gesicht war im Dunkeln – und wenn der Arbeiter es jetzt gesehen hätte, würde er wahrscheinlich sehr erschrocken sein.
Tage, Wochen, ja, vielleicht Monate hatte Robson Finder auf diese Minute gewartet. Ein geradezu dämonischer Trieb hatte ihn dazu gebracht, die Tat, die nun vor ihm lag, zu planen und auch auszuführen. Es war eine so irrsinnige Tat, daß niemand sie zu begreifen vermochte. Seine Augen schienen aus ihren Höhlen treten zu wollen, und seine etwas vorstehende Unterlippe hing herunter. Sein Atem ging stoßweise.
Finder war aufs höchste erregt. Er hielt die Linke, für Lester unsichtbar, dicht neben dem Oberschenkel, die Hand um den Griff des Messers gekrampft. Kein Muskel rührte sich an ihm.
Da sagte Lester mit heiserer Stimme:
»Was wollen Sie, Mensch?!«
Finder rührte sich auch jetzt noch nicht.
In dem Arbeiter stieg Angst auf, die mit Wut gemischt zum Ausbruch kam. Er krächzte:
»Mann, sehen Sie bloß zu, daß Sie weiterkommen.« Dabei machte er den Fehler, auf Finder zuzugehen.
Der Mann aus den Hickory Hills hatte in eisiger Ruhe bis zu diesem Augenblick gewartet. Dann stieß er zu. Die Spitze der Klinge traf auf den Oberschenkel des anderen auf, und mit einem Ruck riß der Verbrecher das teuflisch scharfe Instrument hoch.
Lester taumelte zurück und stieß einen markerschütternden Schrei aus. Dann brach er zusammen, schrie stöhnend weiter, schlug mit dem Kopf auf den harten Boden und rutschte schließlich zur Seite, wo er nur noch röchelte.
Wie versteinert stand Finder da und blickte aus harten Augen auf den Unglücklichen nieder, der hier am Straßenrand vor ihm sein Leben aushauchte.
Finder rührte sich immer noch nicht. Da drang plötzlich ein Geräusch an sein Ohr, das ihn aus seiner Erstarrung riß. Fast hätte er das Auto überhört, das herankam. Die Scheinwerfer tasteten sich durch das Unterholz und geisterten über die nächste Kurve auf dem Asphalt bis zur Brücke hinüber. Noch war der Wagen etliche hundert Yards entfernt und hatte die Kurve nicht erreicht.
Eine wilde Panik erfaßte den Verbrecher. Er bückte sich nieder, packte den Reglosen, zerrte ihn von der Straße weg um den Wagen herum, stieß den Kofferraumdeckel auf und hob den Mann von der Erde auf. Der Körper des Reglosen schien Bleigewicht zu haben. Aber die Angst gab Finder doppelte Kräfte. Er zwängte den Toten in den Kofferraum und wollte den Deckel zuschlagen. Aber es ging nicht. Irgend etwas klemmte. Finder riß den Deckel noch einmal hoch, um ihn mit aller Wucht nach unten zu schlagen. Wieder ohne Erfolg.
Jetzt hatte der Wagen drüben die Kurve erreicht. Mit ratterndem Motor kam er näher. Sein Scheinwerferlicht fraß sich grell über die Straße, erfaßte auch diese Seite der Brücke und das Auto.
Schweiß stand dem Verbrecher in großen Tropfen auf der Stirn. Er hatte den Atem angehalten und preßte beide Hände auf den Kofferraumdeckel, der sich nicht schließen lassen wollte.
Jetzt war der schwere Wagen herangekommen. Ein Diesel, der mit tuckerndem, asthmatischem Motor bis auf die Höhe des Chevrolets fuhr und dann plötzlich mit quietschenden Bremsen und dröhnendem Aufbau anhielt. Aus dem Fahrerfenster blickte der Schädel eines Mannes hervor.
»Was passiert?«
»Ja«, entfuhr es Finder. Und im nächsten Augenblick hätte er sich für diese idiotische Antwort selbst ohrfeigen mögen.
»Nein, nein, es ist alles in Ordnung.«
»Geht der Deckel nicht zu?« fragte der Mann oben vom Fahrersitz her.
»Doch, doch, schon.«
»Warten Sie, ich werde helfen.«
Finder hatte das Gefühl, daß er tausend Klafter tief in den Boden versinken müßte. In diesen Sekunden, in denen der Lkw-Fahrer Eddie Jackson, ein siebenundzwanzigjähriger bulliger Mensch, vom Fahrerhaus stieg und die wenigen Yards bis zu dem Chevrolet hinüberging, war eisige Leere im Gehirn des Mörders. Er begriff weder, was geschehen war, noch, was jetzt geschehen würde.
Da war Jackson neben ihm. Groß, breit, etwas plump. Er meinte mit gutmütiger Stimme:
»Na, dann lassen Sie mich mal ran.«
Er riß den Deckel hoch – und hielt wie versteinert inne.
Der Verbrecher war einen halben Schritt zurückgetreten und hatte den Atem angehalten. In seiner linken Hand war immer noch das Skalpell.
»He!« stieß der Lkw-Fahrer da mit heiserer Stimme tödlich erschrocken hervor, »was ist denn das?!«
Finder verharrte wie angewachsen dicht hinter ihm.
Da ließ der andere den Deckel los und wandte sich um.
»Aber – das ist doch…« Er wischte sich mit seiner schweren Rechten durch das plötzlich heiß gewordene Gesicht. Zu grausig war das, was er da gesehen hatte. Zu grausig, als daß er es so rasch zu begreifen vermochte.
»Mann…«
Da fiel der Krampf wie eine zersprungene Eisenklammer von Finder. Mit einer blitzschnellen Bewegung stieß er die Linke vor und riß das Skalpell hoch.
Jackson schrie auf wie ein weidwund geschossenes Tier. Die mörderisch scharfe Klinge hatte das starke Leder seiner Hose wie Papier zerschnitten. Fast millimetergenau an der gleichen Stelle wie sein Leib aufgerissen – wie vor Minuten der des Arbeiters Lester. Die Klinge war jedoch diesmal nicht so tief gedrungen wie vorhin bei Lester und riß die Schlagader nur an.
Jackson drang mit einem wilden, unartikulierten Schrei auf den gespenstischen Mann ein, schlug ihm die Faust gegen den Schädel, daß er zurücktorkelte. Finder wich aus, tastete sich an dem kühlen Blech des Wagens entlang und sah plötzlich, daß der andere, der ihm folgte, in das linke Knie einbrach und versuchte, sich an der hinteren Wagentür festzuklammern – den Kopf ins Genick warf, um noch einmal markerschütternd aufzuschreien. Dann fiel er nach vorn, schlug mit einem dumpfen Geräusch aufs Gesicht, und blieb reglos neben dem Wagen liegen.
Sofort kam Leben in Finders Gestalt. Er lief um den Wagen herum, setzte sich hinters Steuerrad und startete den Motor. In panischer Hast preschte er davon. Er hatte schon einige hundert Yards zwischen sich und den Tatort gebracht, als ihm plötzlich der Tote im Kofferraum einfiel. Er stieg so scharf in die Bremsen, daß sie blockierten und der Wagen sich fast überschlagen hätte.
Er sprang heraus, lief nach hinten und hob den Deckel etwas an. Im fahlen Schein einer Straßenlaterne sah er ein grauenhaftes Bild: das entsetzlich verzerrte Gesicht des Toten.
Sekundenlang starrte Finder es an. Dann beugte er sich nach vorn und zerrte dem Ersatzreifen unter den Körper des Toten weg. Damit rutschte die Leiche zur Seite – und jetzt ließ sich der Kofferraum schließen.
Finder fuhr weiter. Ohne Eile und Ziel ließ er den Wagen durch die Straßen rollen, bis er vor sich das Wasser des Calumet Lake in der Ferne schimmern sah. Aber die Straßen waren noch zu belebt. Plötzlich sah er eine düstere Seitenstraße, lenkte hinein und stellte am Ende fest, daß es eine Sackgasse war. Hier unten gab es keine Häuser mehr, nur noch Gesträuch, durch das man zum Ufer kommen konnte. Er ging zum Kofferraum, zerrte die Leiche heraus und schleppte sie zu den Büschen hinüber. Nur etwa sechs oder sieben Schritt zog er den Körper des Toten hinein, ließ ihn dann los und ging zum Wagen zurück.
Die 74th Street im Stadtteil Hickory Hills war eine stille Straße, in der Mrs. Finder ein kleines Haus gemietet hatte, das an die Häuser der Pionierzeit erinnerte. Fenster, Türrahmen und die Stützbalken des Balkons waren leuchtend weiß lackiert, ebenso die Gartenpforte und die Zaunpfähle. Alles war sauber und ordentlich, wie es sich für die Finders seit eh und je gehört hatte.
Das Toben und Heulen, das Robson Finder bis zu dieser Stunde seit Tagen in sich verspürt hatte, war zur Ruhe gekommen – zu einer seltsamen, krankhaften Ruhe. Völlig kraftlos fühlte er sich, als er jetzt nach Nordwesten durch die Stadt fuhr, um zu den Hickory Hills zu kommen.
Als er den Wagen verlassen hatte, sah er oben im Wohnzimmer Licht. Er blieb einen Augenblick im Schein der Laterne stehen und blickte an sich hinunter. Dann erst ging er auf das Haus zu, zog seinen Schlüssel, öffnete und trat ein. Wie immer schlug ihm auch diesmal ein Geruch von Äpfeln und Küchendünsten entgegen, der diesem Haus und vor allem seiner Besitzerin, Mrs. Dorothy Finder, eigen war.
Der Mann hatte den Trenchcoat im Wagen liegen gehabt, trug ihn jetzt überm Arm und hängte ihn an die Garderobe. Mit der Linken fuhr er sich über das schüttere Haar, warf noch einen prüfenden Blick in den Garderobenspiegel und wollte durch den unteren Korridor auf die Toilette zugehen. Da aber hörte er Schritte auf der Treppe, und gleich darauf drang ihm die Stimme einer Frau ans Ohr.
»Robby, bist du da?«
»Ja«, entgegnete er ungehaltener als er es sonst tat.
Wie sie ihm mit ihren ewigen Fragen auf die Nerven ging! Wer sollte es denn sonst schon sein? Ihr Mann war seit fünfzehn Jahren tot. Kinder hatte sie keine gehabt, und seit der Hund im vergangenen Jahr auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen war, gab es ja außer ihm niemanden mehr, den man im Haus erwarten könnte.
Dorothy Finder kam die Treppe hinunter. Sie war eine ziemlich große Frau mit schmalen, hängenden Schultern, graubraunem Haar und grauen Augen, die allein verrieten, daß die Frau noch nicht so alt sein konnte, wie ihre übrige Erscheinung Glauben machen konnte. Sie hatte kein allzu schweres Leben hinter sich, aber nachdem ihr Mann nach fünfjähriger Ehe schon gestorben war, war ihr Dasein in recht einseitigen Bahnen verlaufen.
Sie bezog eine mäßige Rente, von der sie einigermaßen leben konnte, und als dann vor einiger Zeit der Neffe aus Indiana gekommen war, hatte sie nichts dagegen gehabt.
Er war ein ordentlicher, ruhiger Mensch, und wenn er auch nicht allzu gesellig war, so hatte sie doch bisher niemals Grund gehabt, sich über ihn zu beklagen.
»Ich werde dir das Essen fertigmachen, Robby«, meinte sie.
»Ziemlich spät kommst du heute. Hast du wieder Überstunden gemacht? Wozu denn? Du verdienst doch so schlecht gar nicht. Du solltest dir das abgewöhnen. Wie wäre es eigentlich, wenn du dir endlich einmal eine feste Braut anschaffen würdest? Wie ist es? Sag mal, ich habe das Gefühl, daß sich da schon längst etwas tut. Ich glaube, du bist ein Heimlicher, du solltest ruhig die Karten auf den Tisch legen…«
Und so redete sie weiter, während sie in die Küche ging und dort mit den Töpfen herumhantierte, den Eisschrank öffnete, die Milch herausnahm, das Brot und die Butter.
Währenddessen stand Robson Finder auf dem dünnen Haargarnläufer in der Mitte des Korridors unter der alten Lampe, die noch aus den Zwanziger Jahren stammte, und hatte die Augen geschlossen. Die Linke hatte er geballt und die Zähne zusammengepreßt.
Vor einer Dreiviertelstunde hatte er am Südwestrand der Stadt zwei Menschen umgebracht.
Mit dem Skalpell hatte er ihre Leiber aufgeschlitzt.
Ein Schauder rann bei dem Gedanken an die Tat über seinen Rücken.
Graute ihm vor sich selbst? Vor seiner fürchterlichen Tat?
Wer wollte diese Frage beantworten? Es hatte ihn dazu getrieben, das zu tun, was er getan hatte – und wenn er nicht geistesgestört war, dann bereute er es auch nicht.
Jahre später haben zwei New Yorker Mediziner versucht, das »Phänomen« Finder zu ergründen. Aber auch ihnen glückte es nicht restlos. Unter den Gangstern Amerikas nimmt er heute noch eine düstere Sonderstellung ein.
Leider sollte die Zahl seiner Opfer noch größer werden…
Am Morgen des nächsten Tages fand der Abteilungsleiter Rob Finder auf seinem Scheibtisch die Chicago-Post. Er blickte auf die Titelseite, sah sich dann um und spürte, wie ihn die ältliche Miß Goddram neugierig betrachtete.
»Was gibt’s, Miß Goddram?« fragte er mit seiner dünnen, wenig klangvollen Stimme.
»Nichts, Mr. Finder, ich wollte nur fragen, ob Sie eine Tasse Kaffee möchten?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ich dachte nur, vielleicht fühlen Sie sich nicht gut.«
»Wieso denn das?!« Argwohn stieg ihm auf: Ob man mir etwas ansieht?
»Soll ich Ihnen einen Kaffee machen?«
»Ja, ja«, entgegnete er, nahm die Zeitung auf, ging damit zum Fenster und blätterte sie durch. Ja, da stand es – groß und deutlich:
Auf der Landstraße am Howell Airport wurde die Leiche des siebenundzwanzigjährigen Kraftfahrers Edward Jackson gefunden. Der Körper des Toten befand sich in einem entsetzlichen Zustand. Sein Leib war vom rechten Oberschenkel an bis über den Nabel aufgeschlitzt. Der Mann ist verblutet. Es wird vermutet, daß er von einem Unbekannten überfallen wurde.
Am Abend dieses Tages, als Finder von der Arbeit nach Hause kam, fand er seine Tante unten in der Wohnstube neben der Küche vor, wo sie in ihrem alten grünen Plüschsessel saß und im Schein der Tischlampe ihre Zeitung las. Ohne den Neffen besonders zu begrüßen, sagte sie: