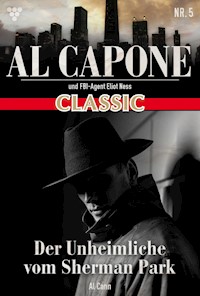Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
FBI-Agent Eliot Ness, der große Gegenspieler von Al Capone Aufregende Action-Krimis aus Chicago um Bandenkriege und Frauenmörder, erzählt von einem Schriftsteller, der sich wie kein anderer in der großen, alten Gangster-Metropole auskennt: Al Cann weiß alles über den unbestechlichen FBI-Agenten Eliot Ness und den berüchtigtsten aller Gangster, den Italo-Amerikaner Al Capone, der nicht nur Chicago, sondern das ganze Land in Atem hielt. Die beiden großen Gegenspieler Eliot Ness und Alfonso Capone haben wirklich gelebt! Authentische Kriminalfälle halten unsere Leser in Atem, fesselnd, fast magisch beschrieben, daß es unter die Haut geht. Diese Krimiserie wird alle Krimifans begeistern und nachhaltig binden. Den fintenreichen und spannungsgeladenen Romanen mit wahrem Hintergrund kann niemand widerstehen. Das Duell zwischen Eliot Ness und Al Capone schreitet unaufhaltsam seinem Höhepunkt entgegen... Es war ein ganz feines, nadelspitzes Gerät, das der Fremde ihm vors Gesicht hielt. Bernie Tucker spürte, daß ihm der Schweiß aus allen Poren trat. Er hielt den Atem an und starrte auf die winzige Kanüle. Er spürte förmlich, daß in ihr der Tod lauerte. Wie war das eigentlich alles gekommen? Es war kurz nach zwei gewesen, die Zeit, um die er die Bar meistens schloß. Er hatte zusammen mit Viola die Stühle auf die Tische gestellt und war dann zum Eingang gegangen, um abzuschließen. In diesem Augenblick hatte sich der Mann in ihm vorbeigedrängt. Es war ein untersetzter Mensch in den Dreißigern, mit einem breiten Gesicht und tiefliegenden Augen. Als er sich an dem Wirt vorbeischob, schlug diesem ein merkwürdiger Geruch entgegen, der ihn an Heu erinnerte. Tucker war so verblüfft, daß er erst, als der Mann schon hinter ihm im Schankraum war, die Tür wieder aufriß und auf die Straße deutete. »Es tut mir leid, wir haben nicht mehr geöffnet.« »Schließen Sie die Tür!« Wie ein Befehl war es aus dem schmallippigen Mund des Fremden gekommen. Als Tucker dieser Aufforderung nicht gleich nachkam, schob der andere die Tür mit dem Fuß zu. Achtundvierzig Jahre alt war Bernard Tucker. Vor sieben Jahren hatte er zusammen mit Viola, seiner fünfzehn Jahre jüngeren Frau, die Hold in-Bar in der 30. Straße in Cicero gekauft. Der ehemals sehr verrufene Stadtteil inmitten Chicagos hatte in den letzten Jahren durch die vielen Häuserabrisse und Neubauten ein völlig neues Gesicht bekommen. Unweit der großen Odgen-Avenue, ganz in der Nähe des Bahnhofs, lag die Hold in-Bar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Al Capone Classic – 3 –
Boss Drenkhan
Al Cann
Es war ein ganz feines, nadelspitzes Gerät, das der Fremde ihm vors Gesicht hielt. Bernie Tucker spürte, daß ihm der Schweiß aus allen Poren trat. Er hielt den Atem an und starrte auf die winzige Kanüle. Er spürte förmlich, daß in ihr der Tod lauerte.
Wie war das eigentlich alles gekommen?
Es war kurz nach zwei gewesen, die Zeit, um die er die Bar meistens schloß. Er hatte zusammen mit Viola die Stühle auf die Tische gestellt und war dann zum Eingang gegangen, um abzuschließen. In diesem Augenblick hatte sich der Mann in ihm vorbeigedrängt.
Es war ein untersetzter Mensch in den Dreißigern, mit einem breiten Gesicht und tiefliegenden Augen. Als er sich an dem Wirt vorbeischob, schlug diesem ein merkwürdiger Geruch entgegen, der ihn an Heu erinnerte.
Tucker war so verblüfft, daß er erst, als der Mann schon hinter ihm im Schankraum war, die Tür wieder aufriß und auf die Straße deutete.
»Es tut mir leid, wir haben nicht mehr geöffnet.«
»Schließen Sie die Tür!« Wie ein Befehl war es aus dem schmallippigen Mund des Fremden gekommen. Als Tucker dieser Aufforderung nicht gleich nachkam, schob der andere die Tür mit dem Fuß zu.
Achtundvierzig Jahre alt war Bernard Tucker. Vor sieben Jahren hatte er zusammen mit Viola, seiner fünfzehn Jahre jüngeren Frau, die Hold in-Bar in der 30. Straße in Cicero gekauft. Der ehemals sehr verrufene Stadtteil inmitten Chicagos hatte in den letzten Jahren durch die vielen Häuserabrisse und Neubauten ein völlig neues Gesicht bekommen. Unweit der großen Odgen-Avenue, ganz in der Nähe des Bahnhofs, lag die Hold in-Bar. Sie hatte früher einem Boxer gehört, einem Mittelgewichtsmeister, der sich zu Tode getrunken und die Bar einer alten Frau vermacht hatte, von der es hieß, daß sie einmal seine Freundin gewesen sei. Von dieser Mrs. Snyder hatte Tucker die Bar erworben. Es waren ausschließlich seine Ersparnisse aus dreiundzwanzig harten Jahren, in denen er sich quer durch die Stadt gekellnert hatte. Die blondhaarige Viola hatte er ein paar Jahre vorher kennengelernt. Sie arbeitete an der Theke einer Bar drüben in Stickney, in der auch er in Nachtschicht beschäftigt gewesen war. Well, man hätte auch eine Bar mieten können. Aber es war seit eh und je Bernies Traum gewesen, eines Tages einmal etwas Eigenes zu haben. Und das hatte er an einem Januartag vor sieben Jahren dann ja auch geschafft. Aber die Bar des Boxers erwies sich als nicht besonders zugkräftig, und Tucker hatte sehr viel hineinstecken müssen, um überhaupt das Existenzminimum zu schaffen. Mit der Zeit hatte er dann einen Kundenkreis geworben und konnte heute auf eine gewisse kleine Rücklage zurückblicken. Dennoch, ein reicher Mann war er nicht und würde er hier wohl auch nicht werden.
Pulvertrocken war sein Mund. Seine Zunge klebte wie ein ausgedörrtes Blatt an seinem Gaumen. Aus weit aufgerissenen Augen starrte er in die flimmernden gelben Lichter des Fremden, der jetzt dicht vor ihm stand. Wieder schlug ihm der merkwürdige Geruch von Heu entgegen.
Da bückte sich der andere blitzschnell und schob mit der rechten Hand einen der Türriegel vor.
»Wo ist Ihre Frau?«
Viola war nicht seine Frau. Zum Heiraten gehörte nach Meinung Tuckers eine Menge Geld; und seit er nach ein paar Jahren die Scheidung gegen Mary durchgebracht hatte, dachte er nicht mehr ans Heiraten.
Ob Viola vielleicht doch daran dachte?
Merkwürdig, daß ihm jetzt plötzlich dieser Gedanke durch den Kopf zuckte.
Was ging es den anderen an, ob Viola seine Frau war oder seine Freundin.
»Sie ist schon gegangen.«
»Ich habe nicht gefragt, ob sie schon gegangen ist, sondern wo sie ist«, schnarrte der andere.
Tucker deutete mit dem Kopf zur Zimmerdecke. »Oben – wird sie sein.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja. Was sollte sie auch hier noch? Sie hat schließlich von zwei Uhr nachmittags hier hinter der Theke gestanden. Eine lange Zeit, wie Sie zugeben werden müssen.«
»Los, kommen Sie mit.«
Nachdem sich der Fremde mit einem raschen Blick davon überzeugt hatte, daß die schweren roten Vorhänge alle zugezogen waren und man von draußen keinerlei Einblick haben konnte, schob er Tucker vor sich her der Theke entgegen.
Der Wirt schluckte schwer. Er glaubte, begriffen zu haben. Es war ein Überfall!
Blitzartig fiel ihm Joe Bladford ein, ein Schankwirt drüben aus der 28. Straße, bei dem vor zwei Wochen um die gleiche Stunde eingebrochen worden war. Nicht nur, daß die Gangster oder der Gangster die gesamte Kasse hatten mitgehen lassen, Bladford war auch noch von einem Schuß am Kopf verletzt worden, der ihn zwar glücklicherweise nicht getötet, seinen Sehnerv aber so empfindlich getroffen hatte, daß er zeitlebens an einer Augenschwäche leiden würde. Bladford war ein junger Mann von dreißig Jahren, der den größten Teil des Lebens noch vor sich hatte.
Und nun war ihm das passiert. Wie oft hatten Bekannte ihm geraten, sich einen Revolver zu kaufen.
»Jeder in Amerika besitzt einen Revolver«, pflegte sein Freund Armstrong zu sagen. Auch Doc Braddock, der hier immer seinen Apéritif trank, hatte ihn darauf hingewiesen, daß es in Chicago notwendig für einen Barwirt wäre, eine Waffe zu besitzen.
Aber was hätte ihm jetzt die Waffe genützt? Der Mann stand vor ihm und fixierte ihn aus kalten, bernsteinfarbenen Lichtern. Vielleicht hätte man es sich zur Gewohnheit machen sollen, abends, wenn die Schenke geschlossen wurde, mit der Waffe zur Tür zu gehen.
Aber was brachte das ein? Was hätte er, Bernard Tucker, gegen diesen Gangster machen sollen? Man braucht sich diese Type doch bloß anzusehen. Der Kerl war wahrscheinlich zu allem entschlossen.
Merkwürdig, von welcher Eiseskälte man plötzlich erfüllt war, wenn man wußte, daß es womöglich zu Ende ging. Wie anders hatte Tucker sich das doch immer vorgestellt.
Es war sein größtes Grauen. Schon seit Ende seiner Zwanziger Jahre hegte er eine unabwendbare Furcht vor dem Tod im Altersbett. Es graute ihm vor dem Gedanken, eines Tages irgendwo in einem gardinenlosen Raum mit kahlen, hohen Wänden neben anderen Sterbenden liegen zu müssen, neben Männern in den Siebzigern, die verbraucht waren und den Tod erwarteten. Er würde dann da liegen, vielleicht noch nicht so zerschlagen wie die anderen, aber doch ebenso unfähig, sich von seinem Lager zu erheben. Es war dann nichts weiter als ein Warten auf das Ende. Die letzte Station! So nannte er es bei sich. Es waren die trübsten Gedanken des Bernie Tucker. Erst Viola hatte diese dunklen Gespenster seit vielen Jahren aus seinem Hirn vertrieben. Sie hatte mit ihrer Jugend sehr viel Frische in das Leben des alternden Barbesitzers gebracht und ihn unbewußt damit verjüngt.
Aber plötzlich war der Gedanke an den Tod wieder da. Glashart und deutlich stand er vor ihm. Der Mann wird seinen Revolver ziehen und mich niederknallen.
Aber was nützt ihm das? Er muß an die Kasse. Die ist automatisch gesperrt, und wenn er das Geld haben will, dann braucht er mich dazu. Meine Kenntnis von dem Schloßmechanismus. Ein Gangster dieses Schlages weiß so etwas.
Also habe ich noch eine Chance – wenn es auch nur eine winzige ist.
Da stieß der andere ihn derb in die Seite.
»Öffnen Sie die Kasse!«
»Was soll das heißen?«
Plötzlich hatte der Eindringling einen Gegenstand in der Hand, den er blitzartig hochriß. Dicht vor den Augen des Barbesitzers gähnte das schwarze winzige Loch der Kanüle – und dahinter war ein metallener Ring, der eine kurze Glaskammer abschloß.
Eine Injektionsspritze – und ohne Zweifel mit einem tödlichen Gift gefüllt.
Tucker schluckte schwer. Er warf einen verzweifelten Blick gegen die Decke. Da verspürte er plötzlich einen stechenden Schmerz in seinem linken Fuß.
Der Verbrecher hatte ihm einen seiner schweren Schuhe auf den Fuß gesetzt.
»Keine Blicke zur Decke, Tucker, von da kommt dir keine Hilfe. Mach dir keine Hoffnungen! Los, öffne die Kasse!«
Der Barwirt stierte wie ein hypnotisiertes Kaninchen die Schlange an, die ein winziges, nadelfeines Auge hatte. Und dahinter warteten zwei Kubikzentimeter eines tödlichen Gifts.
»Wird’s bald!«
Da fiel der Bann von Bernie Tucker ab. Er nickte, wandte sich zur Seite und ging auf steifen, gefühllosen Beinen um die Theke herum. Als er die Kasse erreicht hatte, blieb er einen Augenblick stehen und warf einen Blick über die linke Schulter in das Gesicht des Banditen.
»Wer sind Sie?«
Der zischte ihn an:
»Sind Sie verrückt? Glauben Sie vielleicht, daß ich Ihnen meinen Ausweis zeigen werde? Öffnen Sie die Kasse!«
Tucker nickte wieder, und während er die Rechte nach dem Patentgriff ausstreckte, sagte er wie zu sich selbst:
»Also tatsächlich ein Überfall!«
Da nahm der Gangster den Kopf zurück und zugleich auch die Nadel, die nur um Millimeter über dem linken Wangenknochen des Barwirts geschwebt hatte.
»Sind Sie verrückt? Was fällt Ihnen ein, Mensch? Mein Name ist Tadden. Ich komme lediglich, um Sie als neues Mitglied in unser Syndikat aufzunehmen.«
Syndikat! Wie ein Faustschlag traf ihn dieses Wort. Mit einem Schlag hatte er begriffen. Das, was sich da jetzt in seinem Schankraum abspielte, war schlimmer als ein gewöhnlicher Überfall, bei dem er vielleicht sein Leben riskierte und seine heutige Tageskasse verlor. Denn »das Syndikat« war nichts anderes als der übliche Deckname für eine skrupellose Verbrecherbande, die sich das Ziel gesetzt hatte, die Schenken eines bestimmten Distrikts in gewissen Zeitabständen aufzusuchen, um da ihre Prozente zu kassieren.
Diesmal irrte Bernie Tucker sich nicht.
»Wieviel haben Sie heute eingenommen?« schnarrte Tadden, und es sah so aus, als ob er die Lippen dabei gar nicht bewegte. Tucker bemerkte, daß er die Injektionsspritze immer noch in der rechten Hand hielt. Wenn er sie jetzt auch nicht mehr neben dem Gesicht des von ihm Bedrohten schweben ließ, so befand sie sich doch immer noch in so bedrohlicher Nähe, daß neue Schweißperlen auf die Stirn des Wirtes traten.
»Ich weiß es nicht genau.«
»Sie wissen es schon genau. Bei diesen Patentkassen weiß man nach dem letzten Knopfdruck genau die Summe.«
»Ich habe sie ganz sicher gewußt, es aber nicht für wichtig genug gehalten, sie mir zu merken.«
»Öffnen!«
Die Kasse sprang auf; unten im letzten Feld leuchtete eine rote Ziffer auf: 391,60 Dollar.
Der Gangster nickte. Dann murmelte er etwas vor sich hin und schnarrte:
»Macht achtzig Dollar!«
»Wie soll ich das verstehen?« entgegnete Tucker.
»Ganz einfach. Das Syndikat verlangt zwanzig Prozent.«
»Zwanzig Prozent?«
Wieder waren die flimmernden Lichter des Gangsters vor ihm.
»Haben Sie etwas dagegen?«
»Das ist ja ungeheuer viel.«
»Finden Sie? Wir nicht. Dafür gehören Sie zum Syndikat und haben allen Nutzen, den Ihnen das Syndikat zu bieten hat.«
»Welchen – Nutzen?« wagte der Schankwirt zu fragen.
»Sie werden durch das Syndikat geschützt.«
»Vor wem?«
»Es gibt immer Dinge, vor denen man geschützt werden muß. Zum Beispiel der Staat – oder ein anderes Syndikat.«
»Aha, well, wenn es also zwanzig sind, dann haben Sie sich trotzdem geirrt, denn zwanzig Prozent von dreihunderteinund…«
»Halt’s Maul! Beim Syndikat wird immer nach oben abgerundet.«
Tucker nickte. Unsägliche Furcht hatte seine linke Körperseite regelrecht paralysiert. Er spürte förmlich die Injektionsspritze, die der andere immer noch in der angehobenen Rechten hielt.
»Los, raus mit den Bucks! Aber ein bißchen dalli!«
Tucker ließ die Kasse aufspringen, und ehe er hineingreifen konnte, hatte der andere mit der Linken einen raschen Griff hineingetan.
»Fünfzig, siebzig, achtzig. So, stimmt genau.« Mit zwei Schritten trat er zurück. »Von heute an wirst du alle vierzehn Tage mit den zwanzig Prozent um die gleiche Zeit bereit sein. Und nun noch eine Kleinigkeit«, fügte er mit plötzlich süßlicher Stimme, sehr viel leiser und fast freundlich hinzu: »Wenn es dir einfallen sollte, irgendeine Dummheit zu machen, die dem Syndikat nicht gefallen könnte, dann – du weißt ja Bescheid.« Er hob die Injektionsspritze bis über den Kragen des Barwirts. »Alles rollt ohne jeglichen Ärger ab, wenn du keinen Verrat versuchst. Zu deiner Information will ich dir noch sagen, daß deine Telefonleitung abgehört wird und daß du sowie deine Frau bewacht werden. Es hat also absolut keinen Zweck, daß du irgend etwas unternimmst; es wäre in jedem Fall dein eigenes Unglück. Vergiß nicht: heute in vierzehn Tagen. So long.« Nach diesen Worten verließ der Mann, der sich Tadden nannte, mit raschen Schritten die Schenke.
Sekundenlang stand Tucker wie versteinert da. Dann packte er plötzlich den großen bleiernen Zettelaufspießer, rannte zur Tür und riß sie auf.
Aber die Straße war leer. Bis zur Ecke war niemand zu sehen. Eine große schwarze Limousine bog vorn in die Odgen-Avenue ein und surrte lautlos über den regennassen Asphalt vorüber.
*
Drei Monate waren seit diesem Ereignis vergangen. Mit unheimlicher Pünktlichkeit stellte sich der Abgesandte des Syndikats alle vierzehn Tage ein und kassierte.
Bernie Tucker war zu dem Schluß gekommen, zu dem die meisten anderen bedrohten Schankwirte in Chicago schon längst gekommen waren: daß es keinen Zweck hatte, irgend etwas gegen das Syndikat zu unternehmen. Es hatte keinen Sinn, sich dagegen aufzulehnen oder gar zur Polizei zu rennen, denn das Syndikat hatte etliche Wirte derart bestraft, daß den anderen die Lust zu irgendwelchem Aufbegehren schnell vergangen war.
Ob das Telefon wirklich bewacht wurde, wußte Tucker nicht, aber er hatte auch keine Möglichkeit und keinen Mut, sich davon zu überzeugen.
Heute war Samstag. Es waren wegen des schlechten Wetters nicht allzu viele Gäste da, und Tucker konnte schon kurz nach eins schließen. Viola stand noch an der Theke und blickte ihn aus müden Augen an.
»Geh schon hinauf, ich komme gleich nach«, forderte er sie auf.
Die Frau blickte ihn nachdenklich an und meinte dann:
»Ich weiß, du willst bestimmt noch an der Buchhaltung arbeiten. Aber laß doch, du kannst morgen früh damit anfangen. Wir sind lange genug auf den Beinen, Bernie.«
Der Mann nickte.
»Ist gut. Geh nur, ich komme gleich. Ich will nur noch abschließen.«
Er machte sich allein daran, die Stühle auf die Tische zu stellen, weil er es sich seit einiger Zeit angewöhnt hatte, Viola so schnell wie möglich hinaufzuschicken, denn sie sah in letzter Zeit sehr blaß aus.
In dem Augenblick, in dem er auf die Tür zugehen wollte, wurde sie aufgestoßen, und ein Mann drängte sich herein.
Tadden!
Tucker erschrak bis ins Mark.
»Sie? Was wollen Sie denn?« entfuhr es ihm.
»Halt’s Maul!« herrschte ihn der Gangster an.
Wie immer schlug dem Wirt, als sich der andere an ihm vorbeigezwängt hatte, der scharfe, aufdringliche Geruch von altem Heu entgegen.
Tadden blieb gleich hinter ihm stehen, und Tucker wußte, daß er die Injektionsspritze in der rechten Hand hatte.
»Was wollen Sie?« keuchte der Wirt. »Die Zeit ist noch nicht um.«
»Doch! Sie ist um!« hechelte ihm der Gangster dicht vorm Gesicht entgegen.
Tucker schluckte.
»Was soll das heißen? Sie sind erst vor einer Woche hiergewesen.«
»Das hat sich jetzt geändert.«
»Wieso?« forschte der Wirt, wobei Angst in ihm aufstieg. Dennoch hegte er die winzige Hoffnung, daß das Syndikat den Zeitpunkt des Kassierens jetzt verlegt hatte. Aber er sollte bitter enttäuscht werden.
Der Gangster schnarrt:
»Jetzt wird wöchentlich kassiert.«
»Wöchentlich?«
»Ja, wöchentlich.«
»Aber das ist doch unmöglich.«
»Halt’s Maul! Los, zur Kasse!«
Auf müden, weichen Knien ging Tucker zur Kasse und löste die Endsummem aus.
Hundertzweiundsiebzig Dollar.
Zwanzig Prozent davon wanderten in Taddens Tasche.
Der Wirt stotterte:
»Aber das ist doch unmöglich. Sie sehen selbst, welch eine schlechte Einnahme ich trotz des Wochenendes gehabt habe. Wenn Sie jetzt jede Woche kommen, um zu kassieren, dann kann ich einpacken.«
»Was soll das heißen?«
»Bedenken Sie doch die hohe Steuer, die auf uns lastet. Die Nachtbars werden seit dem vergangenen Jahr um drei Prozent höher besteuert als vorher.«
»Uninteressant. Ich komme jetzt wie gewohnt, nur eben jede Woche.«
»Da ist unmöglich.«
Da zuckte die Spritze hoch. Ein winziger Tropfen drang aus der Kanüle. Ganz dicht vor Tuckers Gesicht. Er schluckte. Pulvertrocken war seine Kehle wieder. Scharf drang ihm der Heugeruch in die Nase.
»Was ist das?« keuchte er.
Der Verbrecher nahm die Spritze etwas herunter und hatte plötzlich wieder seinen unangenehm jovialen Ton:
»Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn du das weißt. Das ist nämlich Cupadin. Eine ziemlich unangenehme Sache.« Nach diesen Worten ging er zur Tür, blieb dann noch einmal stehen, wandte sich um und meinte:
»Also, du weißt Bescheid: in einer Woche! Und keine Dummheiten!« Nach diesen Worten fiel die Tür hinter ihm ins Schloß.
In dieser Nacht fand Bernard Tucker keinen Schlaf. Unruhig wälzte er sich von einer Seite auf die andere, starrte an die Decke, und immer wieder folgten seine Augen den scharfen Lichtstreifen, die die vorüberirrenden Autos über seine Zimmerdecke zeichneten. Gegen vier Uhr stand er auf, ging ins Bad, putzte sich die Zähne und schleppte sich dann hinunter. Er nahm einen roten Fire-Point aus einer dickglasigen vierkantigen Flasche, zog dann die Unterlagen für seine Buchhaltung aus einer Lade und machte sich beim Schein einer kleinen, grün abgeschirmten Lampe an die Arbeit.
Als Viola am anderen Morgen gegen neun aufstand, fand sie ihn noch über den Büchern.
»Bernie! Wie siehst du aus?«
»Wieso?« fragte er und nahm die Brille ab, die er seit einiger Zeit tragen mußte, um die Zahlen deutlich erkennen zu können.
»Ganz blaß! Du solltest zum Arzt gehen.«
Er erhob sich und trat an einen der kleinen Spiegel, die zwischen zwei Fenstern in die Wand eingelassen waren. Tatsächlich, bleierne Blässe bedeckte sein Gesicht. Er fuhr sich erschrocken durch den schweißnassen Kragen und wandte sich nach Viola um.
»Weißt du was, ich rufe sofort Doc Braddock an und frage ihn, ob du kommen könntest. Er hat bestimmt nichts dagegen«, erklärte sie besorgt.
»Nein, nein, nicht anrufen. Ich kann ja so zu ihm gehen.«
»Gut, wie du willst. Soll ich mitkommen?«
»Nein, bleib nur hier.«
Eine halbe Stunde später verließ er das Haus, ging die Straße hinunter, und als er die Ecke der Odgen-Avenue erreicht hatte, wandte er sich um.
Nicht ganz dreißig Schritt hinter ihm stand ein Mann vor der Etalage einer Bijouterie. Ein hochgewachsener Mann im Regenmantel, etwas füllig, nicht mehr der Jüngste.
War das einer vom Syndikat?
Schon gleich in der Woche nach dem ersten Besuch Taddens hatte er die Probe aufs Exempel gemacht. Er war hinausgegangen und hatte bald bemerkt, daß er tatsächlich verfolgt wurde. Wohin er auch ging, er wurde immer beschattet. Wie war das möglich? Wie konnte sich eine Bande so etwas leisten? Entweder verfügte das Syndikat über eine solche Unmenge von Leuten, daß es jedem einen Schatten nachschicken konnte, oder aber die Zahl der Opfer war so gering, daß man sie mühelos überwachen konnte.
Als er ein Stück die Odgen-Avenue hinuntergegangen war, verschwand er plötzlich in einem Hauseingang. Hastig eilte er zwei Etagen hinauf, blieb dann stehen und lauschte in den Treppengang.
Es rührte sich nichts.