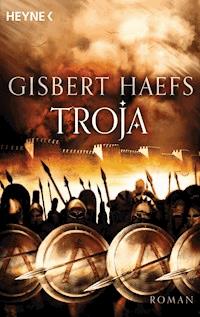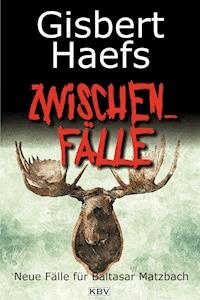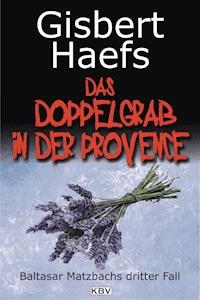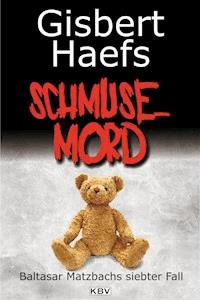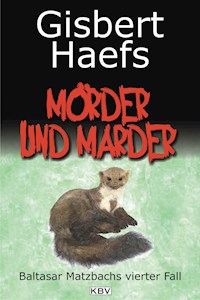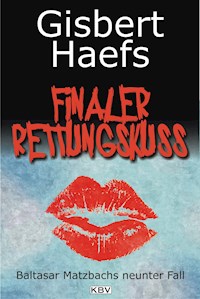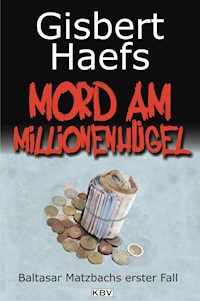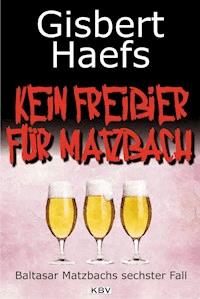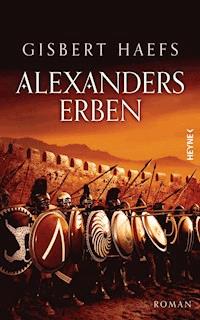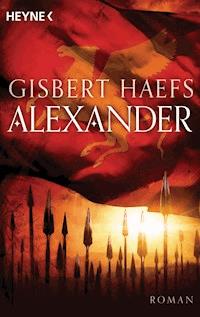
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander der Große – ein unsterblicher Mythos
Er war der mächtigste Herrscher seiner Zeit: Mit seinem ersten Alexander-Roman schildert Gisbert Haefs die frühen Jahre im Leben Alexanders des Großen auf dem Weg zu Ruhm und Heldentum. Auf faszinierende Weise werden in diesem farbenprächtigen Romanepos die schillernden Figuren der Antike wieder lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Gisbert Haefs, der mit seinem gefeierten Karthago-Roman Hannibal das Genre des historischen Romans für sich eroberte, zeichnet hier das Heldenleben des göttlichen Alexander. Aber, und das versteht sich bei Haefs von selbst, auf höchstmenschlicher Ebene. Er haucht der Antike, die oft genug durch mythische Verklärung verstellt ist, vielfarbiges Alltagstreiben ein. Das Buch beginnt mit dem Besuch des Makedoniers Peukestes beim sterbenden Aristoteles. Peukestes hat den Plan gefaßt, das Leben Alexanders zu schreiben. Er begehrt von dem ehrwürdigen Helden-Erzieher alles über dessen ehemaligen Zögling zu erfahren, über den Vater Philipp, die Mutter Olympias und über alle, die mit ihm auszogen, die Welt zu erobern. Der vom nahen Tod gezeichnete größte aller Philosophen läßt sich zögernd auf das Anliegen ein: »Vielleicht vielleicht ist es eher Stoff für ein Satyrspiel oder eine Komödie, ein Epos, eine Tragödie. Weniger für eine wahrheitsgetreue Darstellung. Vielleicht solltest du, statt trockener Wahrheiten zu schreiben, die Geschichte auf erfundene und wirkliche Charaktere aufteilen und sie reden und handeln lassen. Es wäre eine kunstfertige Form der Lüge. Aber vielleicht ist für diese Belange eine ordentlich gearbeitete Lüge die einzig mögliche Wahrheit.«
»Alexander ist ein veritabler Spionageroman, ein Politthriller, Schlachtengemälde, Helden-Epos und Schelmenstück, Parodie auf antike Chroniken, selbst antike Chronik, wundersames Mysterienspiel, philosophischer Diskurs, Reisebeschreibung und anderes, oft ironisch gebrochen, mit Anspielungen von Schiller bis Asterix durchsetzt. Aber beileibe kein unernster Bilderbogen für kindliche Gemüter.«Frankfurter Rundschau
Der Autor
Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, lebt und schreibt in Bonn. Als Übersetzer und Herausgeber ist er unter anderem für die neuen Werkausgaben von Ambrose Bierce, Rudyard Kipling, Jorge Luis Borges und zuletzt Bob Dylan zuständig.
Zu schriftstellerischem Ruhm gelangte er nicht nur durch seine Kriminalromane, sondern auch durch seine farbenprächtigen historischen Werke Hannibal, Alexander und Troja. Im Heyne Verlag erschien zuletzt Die Mörder von Karthago und Alexanders Erben.
GISBERTHAEFS
ALEXANDER
Der Roman der
Einigung Griechenlands
»HELLAS«
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
HEYNE ALLGEMEINE REIHE
Nr 01/9321
Vollständige Taschenbuchausgabe 03/2013
Der Titel erschien bereits in der Allgemeinen Reihe und liegt hier in neuer Ausstattung vor
Copyright © 1992 by Gisbert Haefs
Copyright © 1992 by Haffmans Verlag AG, Zürich
Copyright © der Taschenbuchausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © 2013 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: © Nele Schütz Design, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-08656-5V003
www.heyne.de
Für Material, Rat, Hilfe und Belehrung Dank an: Gabriele Beer, Daniela Edelburg, Ralph Korf, Stephan Opitz, Thomas Schühly, Oliver Stone, Ernst Voggenreiter, Gerhard Wirth und besonders Wolfgang Will– chaire.
»Wie ich vernahm, ließ Alexander sich auf all seinen Wegen von sechs Gruppen von Menschen begleiten: Eisenkauende Schwertkämpfer, von denen er einige Tausend um sich hatte; Beschwörer, die mit ihrem Zauber selbst den Bann Haruts zu lösen vermochten; Sprecher und Dolmetscher, die mit dem Glanz ihrer Beredsamkeit der Sonne ihre Röte raubten; Weise, deren Scharfsinn so fein war, daß ich mich nicht damit plagen mag, darüber nachzudenken; asketische Greise von rechter Gesinnung, die nachts Gottes Hilfe erflehten; und schließlich Gottesboten, zu denen er seine Zuflucht nahm.«
Nizami, Iskandar-Namah
»Es hat der Autor, wenn er schreibt,
So was Gewisses, das ihn treibt.
Der Trieb zog auch den Alexander
Und alle Helden miteinander. Drum schreib ich auch allhier mich ein:
Ich möcht nicht gern vergessen sein.«
Goethe, In das Stammbuch
von F. W. Moors
1.
Die Lüge des Aristoteles
Östlich der Acharnai-Straße, am Rand des Berghangs, schoben und zerrten Sklaven den Abfall Athens zu einer Senke zwischen Felsen. Nächtlicher Regen hatte den Boden aufgeweicht; einige der Männer waren so verdreckt, daß weder ihre helle Haut noch die in die Schultern eingebrannten Eulen zu erkennen waren. Vier skythische Bogenschützen, angekaufte Ordner der Stadt, bewachten sie.
Noch immer trieb die träge Masse dunkler Wolken nach Norden; über den Gemüsefeldern und den Hütten der nördlichen Vorstadt zeigten sich erste Risse. Bis der letzte der zwanzig einachsigen Kastenwagen den Platz zwischen den Felsen erreichte, war auch dort der Boden aufgewühlt und tief. Einer der Skythen hob den angewinkelten Unterschenkel und betrachtete seine grüne, mit schwarzweißen Rhomben besetzte Tuchhose; unterhalb des Knies war alles ein nasser finsterer Schlammstiefel. Er rümpfte die Nase, zupfte an der Ohrenklappe seines spitzen Helms und pfiff auf zwei Fingern.
Die Sklaven begannen mit dem Abladen: Dreck, Kot, Abfälle, Knochen, Tierkadaver, teils zu Haufen aufgeschüttet, teils in Bottichen und Flechtkörben. Die Behälter wurden von den Karren gehoben und zum Rand der weiten Senke geschleppt. Leere Körbe trug man zu den Karren zurück, auf denen andere Männer mit groben Schaufeln, dreizinkigen Gabeln und Reisigbesen warteten. Der Skythe kratzte sich den Bart; als ein Mann– sein Oberkörper ein verdrecktes Flechtwerk aus Narben und Muskelwülsten– den aufgedunsenen Kadaver eines Hundes zur Felskante schleifte, wandte er sich ab und ging langsam zu den drei übrigen Bognern. Aus der Pfeiltasche an der Hüfte holte er eine Lederflasche, einen Brotfladen und ein paar Zwiebeln. An den Felsen neben der Straße gelehnt, wo der Gestank nicht so gewaltig war und sie gleichzeitig die Sklaven, das Land und den Weg beobachten konnten, verzehrten die Skythen ihr Morgenmahl.
Plötzlich rissen die Wolken auf; Sonnenvorhänge fielen blendend über die Welt. Jenseits der Straße leuchtete etwas auf: Metall an der Wand einer schiefen Bretterhütte, neben der zwei Bauern in schmierigbraunen Chitonen arbeiteten.
Weiter nördlich flatterten kreischend einige Vögel auf; dann kamen Jungen die Straße herabgerannt. Sie hatten Früchte aufgelesen, die vom Unwetter der Nacht abgeschlagen worden waren. Aber sie liefen ohne Körbe.
»Makedonen! Die Makedonen kommen!«
Überall auf den Feldern brachen Leute ihre Arbeiten ab, ließen Karren und Gerät zurück und flohen zur Stadt. Die Sklaven standen starr, blickten die Straße hinauf und begannen zu tuscheln.
Langsam und ruhig nahmen drei der Skythen die Bogen von den Schultern, zogen Pfeile aus den Köchertaschen und legten auf die Sklaven an. Der vierte entrollte ebenso gelassen eine lange Peitsche.
»Ihr weiter Scheiße schippen.« Seine Stimme war tief und heiser. »Makedonen nix euch wollen. Los.« Er zog das lange Leder durch die Luft, ließ die Peitsche knallen. Mit steifen Bewegungen machten die Sklaven weiter.
Die Truppe kam schnell näher. Sie bestand aus etwa vierhundert Fußkämpfern– zur Hälfte Leichtbewaffnete, zur Hälfte Hopliten dazu je sechzig schwere thessalische und leichte thrakische Reiter, alle mehr oder minder unbewaffnet. Sie redeten, lachten, aßen im Gehen; nicht einmal die Panzer waren verschnürt. Nur die beiden Flügelleute mit den Feldzeichen– Makedoniens goldene Sonnenscheibe, des Großkönigs liegender Adler auf goldenem Grund– waren voll bekleidet und bewaffnet. Am Schluß kam der Troß: Pferde- und Maultierkarren mit Waffen, Rüstungsteilen, Zelten, gebündelten Sarissen und Kampfspeeren, Vorräten, Werkzeug, Weibern und Heilern.
Hinter der ersten Reitergruppe, wie von den anderen geleitet, ritten fünf Männer. Drei von ihnen trugen verzierte Brustpanzer und Helme mit rotem Busch, die beiden anderen nur den hellen Chiton und Reiseumhang. Als sie an der Senke vorbeikamen, hielt einer der Offiziere sich die Nase zu.
»Das muß die Akademie sein.« Er lachte wiehernd.
Der jüngere der beiden Helmlosen lächelte. »Kaum. Philosophen riechen anders.«
»Bist du sicher? In welchem Ruch stehen Philosophen denn bei dir?« Der Ältere zupfte an seiner Nase. Er hatte als einziger der gesamten Truppe einen gestutzten dunklen Vollbart.
»Also, mit Scheiße oder toten Hunden hat ein Philosoph in Athen keinen Umgang. Der riecht eher…« Der Jüngere streckte den Arm aus und schnippte mit den Fingern. »Na ja, nach Staub, nach Papyros, allenfalls nach Maden. Übrigens auch nur selten nach redlichem Schweiß.«
Der vor ihm reitende Offizier drehte sich halb um. »Und egal wonach sie sonst riechen, Peukestas– sobald wir in Athen sind, hört der Spott auf, klar?«
Der junge Mann legte die flache Hand auf die Brust. »Götter und Feldherren finden mich allezeit gehorsam, o Kleitarchos.«
Die Hütten und Häuser der Vorstadt waren verlassen und versperrt; überall lagen und standen Geräte, Karren und andere Dinge herum. Auf dem Platz vor dem Acharnischen Tor, wo fünf Straßen zusammentrafen, hatten Bauern und Händler eilig einen Markt abgebrochen; was nicht weggeräumt worden war, hatten die Fliehenden zertrampelt. Kleitarchos ließ die Truppe haltmachen; mit den beiden Feldzeichenträgern ritt er zum Tor.
Die schweren, eisenbeschlagenen Flügel waren geschlossen. Auf der Mauer blinkten Helme und Speerspitzen. Ein junger Führer der Stadtwache, mit Muskelpanzer und wallendem Helmbusch, beugte sich über den Mauerrand.
Kleitarchos schob den Helm zurück, legte den Kopf in den Nacken und rief hinauf: »Im Namen des göttlichen Alexander, macht auf.«
Der Athener fuchtelte mit einer Hand. »Der Name eines toten Tyrannen ist kein Schlüssel.«
Kleitarchos bleckte die Zähne. »Soll ich fortreiten und zehntausend Krieger mit zehntausend scharfen Schlüsseln herbeiholen? Fein herausgeputzt hast du dich aber, Fürst der attischen Nachtwächter.«
Der Athener räusperte sich und deutete auf die wartenden Kämpfer. »Zehntausend? Ich zittere. Ist das da alles, was du mitgebracht hast, um Athen zu zertrümmern?«
Der Makedone lachte. »Wozu sollen wir Waffen benutzen, wenn ein paar Worte ausreichen?«
»Der Rat entscheidet, ob geöffnet wird. Was wollt ihr?«
»Wir bringen eine Botschaft von Antipatros und Krateros.«
Der Athener wiegte den Kopf. »Seit wann schicken Sieger eine Gesandtschaft? Unsere Boten sind doch längst zu euch unterwegs.«
»Das wissen wir; wir haben Demades und seine Leute getroffen. Aber wir haben besondere Aufträge.«
»Und zwar?«
Der Makedone seufzte. »Kannst du nicht wenigstens runterkommen, damit ich nicht so brüllen muß? Mein Nacken wird schon steif.«
Der Athener verschwand; bald öffnete sich das Tor halb. Dahinter sah man Fußkämpfer und dichtgedrängtes Volk. Der Hauptmann kam auf den Platz; hinter ihm wurde das Tor wieder geschlossen.
»Also sprich leiser. Und steig von deinem hohen Roß.«
Der Makedone glitt von der Reitdecke und legte den rechten Arm um den Hals des Pferdes. »So ist es besser.– Also, sag deinem Rat dieses. So sprechen Antipatros und Krateros. Vor sechsundzwanzig Jahren hat Demosthenes der Schlammwerfer Athen und andere Städte zum Krieg gegen unseren Herrn Philipp getrieben. Philipp hat gesiegt und Demosthenes geschont. Vor zwanzig Jahren hat Demosthenes die Viper euch wieder mit Worten gebissen und zum Krieg gehetzt, und er hat persisches Gold genommen, damit Hellenen gegen Hellenen kämpfen. Unser König Philipp hat gesiegt, sechzehn Jahre ist es her, und Demosthenes geschont, ebenso wie die Stadt Athen. Vor vierzehn Jahren wurde Philipp ermordet, und Demosthenes die Tarantel wußte so früh von diesem Tod, daß… nun ja. Und er hat sofort den nächsten Krieg angestiftet, gegen Alexander. Der König hat die Stadt Theben, die auf Demosthenes hörte, ausgetilgt; aber er hat die Stadt Athen verschont, und auch Demosthenes. Und vor einem Jahr, als Alexander zu den übrigen Göttern entrückt wurde, war es wiederum Demosthenes der Skorpion, der mit seinem Gift Hellenen gegen Hellenen ins Feld hetzte. Ihr habt Antipatros belagert, in der Stadt Lamia eingeschlossen; Antipatros und Krateros haben eure Heere bei Krannon aufgerieben. Vor der Insel Amorgos haben wir eure Flotte vernichtet. Und nun befehlen Antipatros und Krateros dies.« Der Makedone holte Luft und zog die Brauen zusammen. »Bedenke, Athener– sie bitten nicht, sie fragen nicht, sie befehlen: Ehe ein Friede geschlossen werden kann, hat die Stadt Athen Demosthenes auszuliefern. Alle, die von ihm und seinen Genossen aus Athen vertrieben wurden, sind sofort in Ehren wieder aufzunehmen. Dies gilt auch für den großen Aristoteles.– Sag dies deinem Rat. Und sag auch, daß der Gesandte von Antipatros und Krateros weitere bedenkenswerte Anregungen für die künftigen Dinge auszusprechen weiß.«
Der Athener kaute einen Moment auf der Unterlippe. »Du erlaubst sicherlich, daß ich bei der Weitergabe dieser Dinge an den Rat all das Kleingetier weglasse, die Vipern und derlei, ja? Braucht ihr etwas?«
»Brot, Wein, Wasser, Fleisch.« Der Makedone grinste. »Es schadet nicht, wenn hübsche Mädchen dies bringen. Und schick uns einen, der uns sagt, wo wir lagern können.«
Der Athener hob die Hand und ging zum Tor; diesmal blieb es offen. Nach und nach kamen die geflüchteten Bauern und Vorstädter heraus. Karren und Lastträger verließen die Stadt, und die Wachtruppen zogen sich ein wenig zurück, ohne das Tor ganz freizugeben. Händler schleppten ihre Tische und Waren wieder hinaus, um den unterbrochenen Tor-Markt fortzusetzen; junge Frauen mit bemalten Lippen und bunten Hüftschärpen gingen zu den Makedonen, gefolgt von Verkäufern mit Wein, ein paar Männern mit Eseln und Wasserschläuchen, Bäckerburschen und Obstbauern.
Peukestas und der ältere Chitonträger ließen ihre Pferde an der Mauer grasen und hockten im Schatten einer Pinie. Der Ältere holte Nüsse aus seinem Beutel; schweigend kauten sie eine Weile und betrachteten die Dinge und Menschen.
»Glaubst du, sie geben Demosthenes heraus?« sagte Peukestas.
»Sie müssen. Es wird ihnen nicht gefallen. Andererseits– bei allem Unheil, das er angerichtet hat, sind bestimmt einige froh, ihn loszuwerden.«
»Und du? Ich meine, du wirst ihn zu Antipatros bringen müssen. Bist du sicher, daß er dir nicht unterwegs mit seinem Gerede das Gehirn verklebt?«
»Ah, Demosthenes war nie ein wirklich guter Redner; er war nur dann brauchbar, wenn er sich lange vorbereiten konnte. Unvorbereitet hat er meistens nur gestottert. Aber selbst wenn…« Der Ältere langte hinter sich und zog etwas aus der Gürteltasche, hielt es hoch, ließ es vor Peukestas’ Gesicht baumeln. Es war ein lederner Maulkorb.
Die engen, ungepflasterten Straßen waren aufgeweicht vom Regen und starrten vor Schmutz. Immer wieder bogen sich die Makedonen auf ihren Pferden zur Seite, wenn aus Fenstern Nachttöpfe geleert wurden oder Abfall auf die Straße stürzte. Auf einem kleinen Platz zertrümmerte der Huf eines Pferdes ein Ölgefäß; einer der Offiziere warf dem geschädigten Bauern eine Münze zu. Johlende Kinder, von der Politik unberührt, machten sich einen Spaß daraus, möglichst dicht vor den Pferden herumzutanzen und erst im letzten Moment wegzuspringen. Hinter einer Biegung, von Kot und Schlamm verdreckt bis zu den Hüften, saß ein weißbärtiger Greis und redete für vier oder fünf Zuhörer. »So also verhält es sich mit diesen Dingen. Nun sagt aber Sokrates, daß alles Heilige…« Er brach ab und ballte die Faust, als die Makedonen vorüberritten.
Die schäbigen, halbverfallenen Lehmziegelhäuser wurden von festeren zweigeschossigen Gebäuden aus Stein abgelöst; dann blieben die Gassen und die wimmelnden Massen zurück. Die Makedonen erreichten die Stelle nördlich der Agora, wo die vom Acharnischen Tor nach Süden verlaufende Straße auf die Straße zum westlichen Dipylon-Tor traf. Der Platz, auf den auch kleinere Wege mündeten, war nach Norden zu von Tempeln, Handelshäusern, Verwaltungsgebäuden und der Getreidebörse gesäumt. Die Reiter hielten einen Moment an. Rechts vor ihnen, auf dem Agora-Hügel, leuchteten die bunten Giebelfelder des Hephaistos-Tempels; links, nach Südosten, führte der Panathenaia-Weg zur Akropolis, vorbei an Münze und Brunnenhaus. Genau vor ihnen lag der große Platz, die Agora, das Herz von Athen: Tempel, Säulen, Standbilder, Bauten mit weiß-rot-blauen Säulenköpfen und bunten Mauerflächen, und auf dem Platz zahllose Menschen, die meisten in Weiß, in Gruppen, an Tischen oder auf und ab gehend.
»Das also ist das Herz all dessen, was Hellas ausmacht.« Der Ältere sah sich gierig um.
Peukestas blickte hinüber und hinauf zur Akropolis. »Ich habe Babylon gesehen. Persepolis. Ekbatana. Und Memphis. Das hier…« Er winkte– oder warf die Wörter– mit der flachen Hand über die Schulter nach hinten.
Sie ritten weiter, zwischen dem Amtssitz der Archonten, der Königlichen Stoa, und dem Leokoreion nach Süden, vorbei an den Tempeln für Zeus und Apollon, zum doppelten Ratsgebäude, dem alten und dahinter, am Berg, dem neuen Bouleutherion, und warfen einen eher gleichgültigen Blick auf die Reihe der Statuen der attischen Helden auf ihrem Mauersockel zwischen Gebäuden und Platz.
Auf ein Zeichen des Atheners, der ihnen zu Fuß vorangegangen war, stiegen sie vor dem kreisrunden Gebäude am südwestlichen Ende des Platzes ab: der Tholos, in der die Ratsvorsitzenden gemeinsam aßen und in der immer einige der wichtigen Ratsherren schliefen, damit die Stadt auch bei Nacht handlungsfähig sei.
Peukestas blieb noch einen Moment neben seinem Pferd stehen. Aus dem kastenförmigen alten Gerichtsgebäude, das neben der langen Wandelhalle mit ihren Geschäfts- und Verhandlungsräumen den Platz zum Areopag im Süden hin abschloß, traten einige Männer; ihre Gesichter verdüsterten sich, als sie die Makedonen sahen. Einer sagte halblaut etwas über die Schändung der Agora durch Barbaren und Pferde; ein anderer legte die Finger an die Lippen. Auch aus dem Gebäude der Strategen, am Weg zur kaum noch für Volksversammlungen genutzten Pnyx, näherten sich Männer, vermutlich Vertreter der nach der Schlacht von Krannon gefangenen Feldherren. Zusammen mit ihnen betraten die Makedonen die Tholos. Die Marmorstufen des rot und ockerfarben bemalten Kalksteingebäudes starrten vor Taubendreck.
In einem kühlen, dämmerigen Raum nahmen alle Platz auf Steinbänken; Sklaven brachten Becher, Weinkrüge, Wasser und Oliven. Nach kurzem Austausch von Höflichkeiten wiederholte Kleitarchos den Ratsherren und Beamten gegenüber die Botschaft, die er am Tor verkündet hatte. Im Schweigen der Athener war etwas beinahe greifbar, was Peukestas dennoch nicht völlig erfassen konnte– furchtsame Verachtung, geringschätziger Haß?
»Ihr mögt die Tore versperren und bewaffnete Sklaven auf die Mauern stellen, aber eure Hände sind leer. Dies sagen Antipatros und Krateros: Ehe ein einziges Wort über Frieden gesagt werden kann, wird Athen die Viper Demosthenes und seinen Helfer Hypereides ausliefern.
Wir werden Demosthenes am Hals aufhängen, damit er feststellen kann, wie schwer sein Arsch wiegt. Über Hypereides ist noch nicht entschieden. Und– alle Athener, die wegen ihrer Haltung zu Alexander aus der Stadt gejagt wurden, werden in Ehren wieder aufgenommen. Dies gilt vor allem für den großen Aristoteles.«
Die Ratsherren wechselten lange Blicke. Einer räusperte sich. »Es ist unüblich, hier derlei anmaßende Reden zu halten.«
Kleitarchos entblößte die Zähne. »Ich will gern mit zehntausend sittsam schweigenden Kämpfern zurückkommen. Ihr werdet dann aber keine Ohren mehr haben, zu hören, und keine Köpfe, das Gehörte zu bedenken.«
Die Athener tuschelten miteinander; dann lächelte der Vorsitzer des Prytaneions den Makedonen beflissen an.
»Eure Männer vor der Stadt sind natürlich unsere Gäste. Sie sollen alles erhalten, was sie brauchen. Habt ihr besondere Wünsche? Braucht ihr Decken? Brot? Feuerholz?«
»Den Kopf des Demosthenes«, sagte der Makedone ruhig.
Peukestas hob die Hand. »Auskunft über ihn, Hypereides und Aristoteles.«
»Hypereides? Niemand weiß, wo er sich aufhält. Und, ah, Demosthenes? Ich glaube, er hat sich vor ein paar Tagen zum Piräus begeben, für eine kleine Seereise. Bevor eure Schiffe erschienen.«
Kleitarchos runzelte die Stirn und wandte sich an den älteren Helmlosen. »Du weißt, was zu tun ist? Deine Aufgabe. Zum Hafen; nimm zwei Schiffe mit Kämpfern und bring Demosthenes zurück.«
Der Unbewaffnete stand auf, senkte den Kopf, legte die Hand auf Peukestas’ Schulter und ging.
»Was nun Aristoteles angeht«, sagte der Athener müde, »so lebt er in einem Haus außerhalb von Chalkis, auf der Insel Euboia. Zuletzt hieß es, er liege im Sterben.«
»Aber wir haben doch Truppen in Chalkis«, sagte Peukestas beinahe empört. »Warum melden die so etwas nicht?«
Kleitarchos hob die Schultern. »Wen kümmert ein Philosoph, wenn er einen nicht kümmert? Nimm ein paar Reiter, Peukestas. Heil und hurtigen Weg.«
Die hölzerne Zugbrücke an der engsten Stelle des Euripos zwischen Boiotien und Euboia war zerstört, ebenso ein Teil des aufgeschütteten Damms. Ein paar Bausklaven hockten im Schatten eines Uferbaums, neben Werkzeug und Steinhaufen; sie würfelten und redeten leise. Nicht weit von ihnen schnarchte der Aufseher und Baumeister. In den Haaren auf seiner Brust badete ein gleißend roter Schmetterling in einem Strahlenbündel, das durchs Laub fiel. Die Luft war süß und schwer von Stauden, Geißblatt und dem Gesang der Zikaden; keine Brise rührte Salz aus der öligen Wasserfläche, die unter der Nachmittagssonne glitzerte.
Auf der anderen Seite der Brücke hatte man Pfosten in den Uferboden gerammt, an denen dicke Taue befestigt waren. Die breite flache Zugfähre zwischen dem Festland und Euboia füllte sich mit heimkehrenden Bauern und Händlern. In der Mitte der Fähre standen drei Ochsenkarren; zwei waren leer, der dritte überladen mit leeren Körben und Amphoren. Auf der linken Seite war noch ein wenig Platz; rechts von den Wagen drängten sich die Leute. Jemand reichte eine lederne Feldflasche herum.
»Guter Tag«, sagte einer der Bauern. »Ich bin alle Vögel und Eier losgeworden. Wie war’s bei euch?«
Der Händler, der sich gegen den beladenen Karren lehnte, gluckste laut. »Ich hab meine Eier noch, zum Glück. Aber seit der Krieg zu Ende ist, geben die Leute wieder mehr Geld aus. Gut für uns– alle.«
Ein Reiter trieb sein Pferd die Rampe hinauf. Es tänzelte nervös, scheute mehrmals, und bis er das Tier rechts neben die Karren gelenkt hatte, verging einige Zeit. Die Männer sahen ihm neugierig zu, als hofften sie auf einen ansehnlichen Sturz; ihre Spötteleien wurden leiser, als hinter ihm Peukestas erschien, gefolgt von sechs schweren makedonischen Reitern. Sie ritten nach links, auf die andere Seite der Wagen.
»He, Gorgias, lang nicht gesehen«, sagte einer der Bauern. »Wo warst du? Hattest du nicht was von Aulis gesagt?«
Gorgias nickte; er grinste breit. »Aulis und ein bißchen weiter. Es gibt da ein paar athenische Handelsherren.«
»Das hochmögende Pack. Anmaßende Dreckschleudern.« Einer der anderen Händler spuckte über die Bordwand. »Sind jetzt ein bißchen weniger vorlaut, was?«
»Hm. Brauchen ganz dringend alles Getreide, das sie nur kriegen können. Ah, wie die zahlen müssen!« Er kicherte und tätschelte den Hals des Pferdes.
Die anderen lachten; einer sagte: »Wie schön für uns. Und denen geschieht’s recht, mit ihrem Scheißkrieg. Hast du alles verkauft?«
Gorgias nestelte an seinem Umhang, den er vor sich über die Reitdecke gelegt hatte. »Alles, was die Gilde rausrückt– was wir nicht selber brauchen; und was übrigbleibt, nachdem die makedonischen Lümmel ihren Teil eingefordert haben.«
Ein Bauer räusperte sich und blickte zu Peukestas und seinen Männern, die abgestiegen waren. Der reitende Händler achtete nicht darauf.
»Und zweieinhalbmal so teuer wie vor einem Jahr. Außerdem müssen wir nicht liefern; die holen ab. In vier Tagen kommen die Karren hierher.« Er wies mit dem Daumen über die Schulter, an Land.
Die Fähre war voll; der Fährmeister klatschte in die Hände und trieb die Sklaven an, die zur linken Bugwand gingen. Das dicke Tau lief über Rollen an Bug und Heck; es hielt die Fähre auf Kurs. Zwei weitere Taue dienten zur Fortbewegung; der Fährmeister löste die hintere Winde, und die Sklaven griffen in die Speichen der vorderen. Langsam glitt das schwere Fahrzeug vom Ufer weg.
»Immer noch nicht weiter mit der blöden Brücke?« Gorgias deutete mit dem Kinn zu den würfelnden Bausklaven hinüber.
»Ah, du weißt doch, wie das ist«, sagte der Geflügelzüchter. »Wenn du langsame Arbeit willst, laß den Staat ran.« Die Männer lachten gedämpft, blickten zu Peukestas’ Makedonen. Gorgias, den Rücken zu den Karren, redete weiter.
»Scheißmadekonen. Warum haben sie auch die Brücke zerstört? Wenn sie verloren hätten, wären die Athener auch ohne Brücke schnell in Chalkis gewesen. Aber die müssen böse fertiggemacht worden sein, da oben. Ein Glück, daß wir besetzt waren. Ein paar Leute in Chalkis hätten sich ja glatt auf das Geschwätz von Demosthenes eingelassen, dann wären wir jetzt auch dran. Und diesmal lassen sie das Schwein bestimmt nicht weitergrunzen. Das war der vierte Krieg, den er angezettelt hat. Jetzt kostet es ihn den Kopf. Ah, überhaupt– einer von den Athenern hat mir was erzählt.« Er kicherte. »Als Alexander tot war und die Nachricht kam, hat einer im Rat von Athen das nicht glauben wollen. Warum? Na, er hat gesagt, Alexander hat doch fast die ganze bewohnbare Erde geschluckt; wenn er wirklich tot wäre, müßte jetzt die ganze Oikumene nach seinem Kadaver stinken.« Er grölte vor Lachen.
Die anderen lachten nur sehr schwach; sie beobachteten besorgt die Makedonen, die Gorgias noch immer nicht gesehen hatte. Peukestas grinste leicht. Mit Grimassen versuchten einige der Bauern, Gorgias zu bremsen, aber er achtete wieder nicht darauf.
»Jedenfalls gehen Alexanders Feldherren jetzt einander an die Kehle, nehm ich an; von wegen, wer kriegt was von dem ganzen Haufen, den er erobert hat. Wird ein böses Gemetzel werden. Geschieht denen aber recht.«
Peukestas hustete. Gorgias wandte sich um und wurde blaß. »Ich… ich«, stammelte er.
»Ach ja– du?« sagte Peukestas. »Könnte einer von euch Herren mir sagen, wo ich in Chalkis Aristoteles finde?«
Die Fähre näherte sich der Landerampe südlich des Hafens von Chalkis. Einer der Bauern kratzte sich den Kopf.
»Aristoteles? Welcher Aristoteles? Der Weinhändler? Der Verschneider? Oder der mit der riesigen Ölpresse?«
»Der Philosoph.«
»Ach, der Alte, den die Athener rausgeschmissen haben, weil er ein halber Makedone ist? Uh, war nicht so gemeint. Der wohnt da oben.« Er deutete auf einen niedrigen Küstenhügel im Süden, mit einem kleinen weißen Haus.
Unterhalb des Hügels weideten einige Schafe und Ziegen, bewacht von einem uralten Sklaven, der unter einer Eiche döste. Neben dem mit Feldsteinen eingefaßten Brunnen erstreckte sich ein kleiner Gemüsegarten, ebenfalls lose ummauert. Zwei der Kataphrakten waren zur Burg von Chalkis geritten, um festzustellen, ob es bei der makedonischen Besatzung Unterkunft gab; die übrigen ließ Peukestas am Brunnen lagern.
Zu Fuß stieg er den Hügel hinauf, nur mit seinem Umhang und dem schweren Tuchbeutel.
Aus der Nähe wirkte das Haus ärmlich. Der Bewurf der Wände war aufgeplatzt; vor dem Eingang lag neben einem umgestürzten Altarstein ein geborstener Dionysoskopf. Der Hauch einer Brise ließ die Tonperlenschnüre des Durchgangs kaum merklich beben.
Dumpfe Schläge hallten aus dem kahlen Innenhof. Dort kauerte eine Sklavin, die in einem Bronzetiegel Körner zerstieß. Sie blickte flüchtig auf, als Peukestas sich räusperte. Aus den Schnüren in der Tür zum Wohnhaus erschien eine Frau; sie mochte etwas jünger sein als Peukestas, vielleicht achtzehn. Sie ging barfuß; das weiße Gewand war sauber, aber ebenso schmucklos wie Hände, Hals und dunkles Haar. Um die Augen lagen Schatten; das ovale Gesicht war müde.
»Ist dies das Haus, in dem der große Aristoteles lebt?«
Ehe die Frau antworten konnte, klang die mürbe Stimme eines Greises durch den Schnurvorhang. »Dies ist das Haus, indem der alte Aristoteles stirbt. Frag ihn, was er will, Pythias.«
Sie blickte Peukestas an. »Also?«
Er neigte knapp den Kopf und versuchte ein Lächeln. »Peukestas, Unterführer der Hetairenreiter, zuletzt Schreiber des Eumenes. Ich war in Babylon, als Alexander starb. Nun schicken mich Antipatros und Krateros mit Geschenken und Fragen.«
Pythias blickte zum Vorhang. Die alte Stimme sagte: »Bring ihn herein, Tochter.«
Peukestas folgte ihr in einen hellen Raum mit einer verhängten Fensteröffnung. Um den niedrigen Tisch waren im Halbkreis Schemel angeordnet. Hinter dem Tisch, auf einer Liege, unter Decken und Fellen, sah Peukestas den Größten der Philosophen. Das Gesicht war fahl unter dem grauen Haupthaar, der Bart noch immer fast schwarz. Wie die Augen, die noch sehr durchdringend waren und durchdrungen von Leben. Auf dem Tisch standen ein Wasserkrug, ein Tonbecher und eine flache Schale mit Wasser, Kräutern und Blütenblättern. Der Duft war herb und frisch.
An einer Wand gab es eine Feuerstelle mit eisernem Rost unter einem gemauerten, trichterförmigen Rauchabzug. An den Wänden standen Regale aus Holz und Bastgeflecht, angefüllt mit Papyrosrollen, einige in Tonröhren, die meisten ungeschützt.
Peukestas legte die rechte Hand auf sein Herz, nahm den Beutel von der Schulter, setzte ihn auf den Tisch und löste die Verschnürung. Er zog einen kleinen Lederbeutel heraus, öffnete ihn und ließ einen Strom von Goldmünzen herausfließen: Dareiken, und Statere mit dem Kopf Alexanders. Wieder langte er in den großen Beutel und holte mehrere verknotete Tücher hervor, die er langsam öffnete. Sie enthielten Ringe mit glitzernden Steinen, Broschen, indische Perlen, einen schweren goldenen Halsschmuck, zuletzt einen mit feinsten erhabenen Verzierungen bedeckten Goldkelch, besetzt mit einem Kranz von Rubinen. Pythias war im Durchgang zur Küche stehengeblieben und ächzte. Aristoteles hatte sich aufgerichtet, auf einen dürren Ellenbogen gestützt.
»Geschenke von Königen.« Mit einem schiefen Lächeln ließ er sich wieder auf die Liege sinken. Pythias seufzte und verschwand in der Küche.
»Nicht ganz königlich, Aristoteles. Diese Gaben senden dir Antipatros und Krateros.«
»Herren von Makedonien und Hellas, aber keine Könige; ja. Sie würden mir diese nichtigen Kostbarkeiten niemals umsonst schicken. So großzügig war nur Alexander, und er ist tot. Was verlangen sie als Gegenleistung?«
Peukestas lächelte. »Wissen und Rat.«
Pythias kam aus der Küche zurück. Sie trug eine Holzplatte mit einem Weinkrug, einem Becher, Brot, kaltem Fleisch und Früchten. Vorsichtig, die Augen auf die Schätze gerichtet, setzte sie die Platte auf den Tisch. Sie deutete auf einen Schemel; dann ging sie wieder. Peukestas setzte sich und goß Wasser und Wein in den Becher.
Aristoteles kicherte heiser. »Wissen und Rat? Mein Wissen ist nicht zu kaufen, mein Rat ist kostenlos. Was wollen sie erfahren?«
Peukestas blickte ihn über den Becher hinweg an. »Als Alexander starb, gab es keinen Erben. Die Regelungen, die nach seinem Tod getroffen wurden, waren nur vorläufig. Er selbst hat ja nichts angeordnet. Jetzt, nachdem die Unruhen in Hellas niedergeschlagen sind, fürchten wir alle, daß seine alten Gefährten und Krieger gegeneinander kämpfen werden, um das Reich und die Reichtümer.«
»Eine nicht ganz ferne Annahme. Es gehört lediglich ein wenig Kenntnis der Menschen dazu.«
Peukestas leerte den Becher, füllte ihn erneut. »Ich habe in den letzten Jahren unter Eumenes als Schreiber gearbeitet– Aufseher der Schreiber in den königlichen Archiven, die Eumenes so vortrefflich geleitet hat. Wir wissen, daß alle Briefe Alexanders zweimal geschrieben wurden: ein Brief für den Empfänger, ein Brief für die Archive. Alle Briefe des Königs, außer den wenigen, die er bis zuletzt mit eigener Hand geschrieben hat. Briefe an seine Mutter; ein paar Briefe an Antipatros; Aufträge für Krateros, der die alten Krieger heimbringen sollte; und Briefe an seinen ehrwürdigen Lehrer Aristoteles.«
Der alte Philosoph hustete rasselnd. »Nun wollt ihr wissen, ob in einem dieser Briefe an mich zu lesen steht, wer die Bürde des Reichs tragen soll.«
Peukestas bohrte seinen Blick in die halbgeöffneten Augen des Greises. »Als Alexander starb, hat er vielleicht gesagt, der Beste solle sein Nachfolger werden. Der Stärkste, der Tüchtigste. Sein schwachsinniger Halbbruder. Sein ungeborener Sohn von Roxane. Vielleicht hat er auch etwas anderes gesagt, aber das wissen wir nicht. Du weißt, wie es in Asien aussieht. Wenn nicht etwas Großes geschieht, wird es zu langen Bruderkriegen um die Nachfolge kommen. Um das größte Erbe, das je ein Mensch hinterlassen hat. Die Feldherren und Fürsten werden einander zerfleischen, das Reich wird zerbrechen.«
»Wäre das schlimm?«
»Es wäre ein furchtbares Morden, Aristoteles. Deshalb bitten die Fürsten um deinen Rat. Steht in einem von Alexanders Briefen der Name eines Nachfolgers?«
Aristoteles bewegte eine knochige Hand. »Mir ist kalt«, murmelte er. »Ruf Pythias. Es ist ungerecht, daß ein Sterbender friere.«
Peukestas stand auf, ging zum Küchendurchgang und winkte der Frau, die mit Gefäßen hantierte und nichts gehört hatte. Sie kam sehr schnell, warf einen Blick auf das eingefallene Gesicht des Vaters, schob die Unterlippe vor und ging zur Feuerstelle, neben der ein Haufen Scheite lag.
»Nimm Rollen zum Entzünden.« Die Stimme des Philosophen klang wie schwarze Kreide, die unter einem Schuh zerquetscht wird. »Was nützen sie noch?– Also das ist die Frage, die Krateros stellt?«
»Ja. Und von ihrer Beantwortung hängt vielleicht die Welt ab.«
Aristoteles richtete sich mühsam halb auf. Er sah zur Feuerstelle, wo Pythias vier Rollen Papyros aus einem der Regale zurechtlegte. Sie entzündete einen Span an dem Öllämpchen und türmte Scheite auf die Rollen, als sie zu brennen begannen.
»Die Welt wird fortdauern. Sie besteht aus dem Willen der Götter, dem Zufall, und aus tugendhaften Taten der Menschen. Nicht aus Fragen und Antworten.«
Peukestas beugte sich vor und sagte eindringlich: »Jeder der ruhmreichen Gefährten des Königs kann heute sagen, Alexander hat dich oder mich oder jenen dort ernannt, aber die anderen werden ihm nicht glauben. Ein Brief von Alexanders Hand, an dich gerichtet und von dir bezeugt, wäre ein Beweis, den keiner bezweifeln könnte. Ein Beweis, den Krieg abzuwenden und das Reich zu festigen.«
Aristoteles lächelte Pythias zu, die wieder in die Küche ging. »Mehr nicht? Nur die Oikumene soll ich retten– die bewohnbare Welt, deren größten Teil ihr mit dem Schwert erobert habt? Sie wird durch Schwerter zerstückelt werden. Was tut das Wort eines toten Greises dazu? Es wird verhallen wie die Worte lebendiger Könige. Und wer zweifeln will, weil der Zweifel ihm zu einem Teil der Macht verhilft, während die Gewißheit die ganze Macht einem anderen gäbe, der wird auch an einem Brief zweifeln.« Aristoteles deutete auf den leeren Becher.
Peukestas setzte seinen ab, kniete neben der lederbespannten Bettstatt nieder, füllte den Becher mit Wasser und Wein und stützte den alten Mann, damit er trinken konnte.
»So viele Fragen.« Es klang bitter; Peukestas versuchte nicht, um das Wissen des Greises zu flehen. »Ich war in Pella und habe mit vielen gesprochen. Ich will das Leben des Königs schreiben. Teile habe ich selbst gesehen, über andere Teile gibt es Papyros und die Worte vieler, die dabei waren. Aber manche Dinge… Wer war Alexander wirklich? Was hast du ihn gelehrt? Wo hat sein langer Weg begonnen? Was war sein Ziel? Gab es ein Ziel?«
Aristoteles lächelte. »Der Weg ist das Ziel. Wenn du genug weißt, um eine Frage richtig zu stellen, dann weißt du auch genug, um selbst die Antwort zu geben.«
Peukestas kniete noch immer neben der Liege. »Dann hilf mir, die Fragen richtig zu stellen, Aristoteles!«
»Warum sollte ich? Wegen dieser Stückchen aus bunten Steinen und albernen Metallen?«
Scheinbar zögernd murmelte Peukestas: »So vieles, was ich nie erfahren werde, Aristoteles. Ich hatte auf dich gehofft. Dein Neffe Kallisthenes hat dir geschrieben, bis er… starb. Ihn kann ich nicht fragen. Parmenion, der große Parmenion ist so lange tot; er hätte vieles gewußt. Und auch mein Vater, der lange dabei war, ist gestorben, ehe ich wußte, was ich ihn fragen sollte…«
Aristoteles kniff die Augen zusammen. »Dein Vater, eh? Du sagst, du warst Unterführer der Hetairenreiter? Jung wie du bist… Dann hast du vorher zu den Knaben des Königs gehört. Dein Vater muß also einer der Edlen gewesen sein. Oder enger Freund des Königs. Vielleicht seines Vaters Philipp. Hm. Dein Gesicht– es ist da etwas.«
Peukestas fischte eines der Blütenblätter aus der Schale auf dem Tisch, zeigte die Zähne und kaute auf dem Blatt. Aristoteles begann zu lachen, brach dann in einem würgenden Husten ab.
»Drakon der Heiler«, keuchte er. »Du Sohn eines alten Freundes.« Er streckte die Hand aus und legte sie einen Moment auf Peukestas’ Kopf. Der junge Makedone schwieg und wartete.
»Nun ja.« Aristoteles zog die Hand zurück, unter die Decken. »Wer war Alexander? Dazu ist nicht viel zu sagen. Alexander mußte immer wissen, was auf der anderen Seite des Hügels liegt. Dieses gewaltige Sehnen– an den Rand der Welt gehen und darüber hinaus. Aber«– er versuchte sich aufzurichten– »die Welt hat nur einen Rand, nur eine Kante, und diese dunkle Grenze ist der Tod. Tod und Leben sind aber nichts als die beiden Seiten jener einen Münze, die keiner ausgeben, prägen oder begleichen kann.«
In der Küche klapperte Pythias mit Geschirr. »Das kann doch nicht alles sein«, sagte Peukestas leise. »Ich habe selbst mehr gesehen als dies. Ich will es dir sagen, wenn du magst– erzählen, was ich gesehen habe.«
Aristoteles zuckte mit den Schultern. »Meine Füße sind eisig«, sagte er, als spräche er über einen belanglosen Gegenstand. »Die Nieren, verstehst du, und das Herz. Ich sterbe von unten nach oben. Vor mir liegt die lange Nacht, in der niemand mehr arbeiten oder reden kann. Mein Leben lang habe ich gelauscht und gefragt, Wissensstückchen gesammelt, nur um jetzt zu begreifen, daß es gleich ist, ob man als Narr oder als Weiser stirbt. Aber… wir könnten trotzdem reden. Besser redend sterben als gar nicht. Oder stumm. Was willst du wissen?«
»Alles. Über Alexander, über Philipp, über Olympias– über dich, Aristoteles. Hat er dir geschrieben, wer die Macht haben soll? Weißt du, ob wirklich jemand aus Hellas Gift geschickt hat? Hast du jemals…«
Aristoteles kicherte. »Langsam, Peukestas, langsam. Was am Ende geerntet wird, wurde am Anfang gesät.«
»Wo ist der Anfang?«
»Vor der Geburt, wie bei jedem von uns. Ah– Ägypten ist ein guter Beginn für jede gute Lügengeschichte. Die Sterne, und die Lebern von Opfertieren, und die Weissagungen trunkener Priester. Die Lehrer…« Er hustete wieder. »Zuviel, viel zuviel, ehe meine Stimme bricht.«
»Warum hat Philipp dich gewählt, um Alexander zu lehren? Weil du der größte Philosoph bist?«
»Den gibt es nicht, Junge. Außerdem war ich damals nur einer von tausend. Aber wir haben uns gekannt, Philipp und ich; mein Vater war der Arzt seines Vaters. Philipp und ich haben als Kinder miteinander gespielt. Und ich bin aus dem Norden, aus Stageira. Mich hat es nie beschäftigt, ob die Makedonen barbarisierte Hellenen sind oder hellenisierte Barbaren; einer der Großen aus Athen wäre vielleicht gar nicht nach Pella gegangen.« Leiser und mit einer kleinen Grimasse setzte er hinzu: »Dann gab es da noch einen politischen Grund… Aber wir sind schon viel zu weit hinten in deiner Geschichte, Sohn Drakons.«
»Noch einmal– wo ist der Anfang, Aristoteles?« Peukestas kniete noch immer neben der Liege.
Aristoteles keckerte; seine Hand kroch in seltsamen Schlangenlinien über die Decken. »Eine Prophezeiung. Prophezeiungen sagen Ereignisse voraus, die dann eintreffen, weil alle sich bemühen, die Prophezeiung wahr zu machen. Aber…«
Er richtete sich langsam auf, mühevoll. Von seinem hageren Hals löste er eine feine Kette, an der ein etwas mehr als münzengroßes Amulett hing: ein ägyptisches ankh aus Gold, mit einem dämonischen Horos-Auge aus dunklen Steinen in der Schlaufe.
»Schau her, Junge.« Plötzlich war seine Stimme nicht mehr die eines Sterbenden, sondern die eines Herren, der befiehlt und weiß, daß man ihm gehorchen muß. »Ich will dich Bilder sehen lassen, die besser sind als Worte– Bilder von Dingen, die nicht in Worte passen. Sie sind auch schneller als Worte; mein Leben rinnt dahin. Schau in dieses Auge.«
Peukestas öffnete den Mund, schloß ihn wieder und schüttelte langsam den Kopf, wie über einen seltsamen Anblick. Er lehnte sich gegen die Liege und starrte ins Auge des Horos.
Aristoteles streckte den Arm aus. »Auch wenn man nichts davon hält– in einem langen Leben lernt man viele nützliche Formen von Unfug.« Mit kaum sichtbaren Bewegungen des Handgelenks ließ er das Amulett pendeln, gemessen, stetig. Peukestas folgte den Schwingungen mit den Augen; sein Gesicht erschlaffte. Hinter dem Amulett, sechs oder sieben Schritte entfernt, barst ein Scheit auf dem Rost; eine Flammenkugel stieg zum Rauchfang empor. Feuer und Rauch wurden zu Schlieren, zu Nebel; dann formten sich Bilder vor der rußigen Wand.
Der sinkende Feuerball im Westen überzieht fern im Osten die Spitzen kaum noch sichtbarer Pyramiden mit Glut. Die Dämmerung über der Wüste ist kurz; nur wenige Momente glitzert der Sand. Von Osten nähert sich ein einachsiger Wagen mit zwei Männern. In der Nähe lacht eine Hyäne; das Gelächter bricht ab, als weiter fort ein Löwe brüllt. Eine kleine Schlange gleitet von einem Steinhaufen und verschwindet zwischen Flechten. Der Steinhaufen ist die Spitze einer fast versunkenen Tempelpyramide. Bis die beiden Männer mit dem Wagen sie erreichen, sind die ersten Sterne zu sehen. Im knisternden Schweigen der Nacht sind nur die leisen Stimmen zu hören, als die Männer vom Wagen steigen und zur Pyramide gehen: ein Ägypter und ein Hellene. Mit harten Vokalen sagt der Ägypter, der Priesterkleidung trägt:
»Der Ehrwürdigste ist weit hergekommen, aus dem Heiligtum in Siwah. Er wird nicht erfreut sein, statt eines Priesters nur einen Händler zu sehen– auch wenn du in die Mysterien eingeweiht bist. Sag möglichst wenig.«
Der Hellene macht eine Handbewegung, als ob er ein aufgerafftes Gewand fallen ließe; sie gehen zur anderen Seite der Pyramide. Dort führen halbverfallene Stufen in den Boden. Im ersten Raum lodern Fackeln zwischen geborstenen Säulen und verwitterten Götterstatuen. Die Schatten scheinen zu tanzen; eine Ratte verbirgt sich zu Füßen des Horosköpfigen.
Der zweite Raum ist heller: mehr Fackeln, dazu Lampen und ein großes Feuer. Auch hier taumelnde Säulen und wankende Götter: Isis, Thoth, Hathor, Horos, ein Apisstier ohne Kopf (der Kopf liegt halb verborgen zwischen den Vorderhufen), ein geköpfter Ammonswidder (der Kopf liegt zu Füßen einer Herrscherstatue); ringsum an den Wänden Glyphen und Darstellungen aus den Totenbüchern. Jenseits des Feuers die Statue eines hockenden Greises unter einer großen Tafel der Sternzeichen.
Die Statue bewegt sich; der Greis hebt den Kopf und starrt den Eintretenden entgegen. Er ist uralt. Den kahlen Kopf bedeckt eine schwarze Priestermütze nur zum Teil; der lange weiße Bart vermengt sich mit den Falten des weißen Gewands. Die tiefliegenden Augen versprühen schwarzes Feuer.
Der Greis öffnet den beinahe zahnlosen Mund; er spricht sehr tief. Ägyptisch, schnell, hart und hörbar zornig. Der andere Priester verneigt sich mehrmals, antwortet betont demütig, wendet sich schließlich an den Hellenen.
»Wie ich sagte«, flüstert er; dann, lauter: »Der Ehrwürdigste ist aus Siwah gekommen, um die wichtigste Botschaft seit Jahrhunderten zu überbringen. Was weißt du vom Großen Jahr?«
Der Hellene hebt die Schultern. »So viel und so wenig wie jeder. Die kleinen Sterne rennen, die großen, die unsere Zeichen bilden, stehen scheinbar still, aber auch sie bewegen sich. Nach etwas mehr als fünfundzwanzigtausend Jahren stehen sie dann wieder so wie zu Beginn. Dann fängt ein Neues Zeitalter an– ein neues Großes Jahr. Ist es das?«
Der Uralte blinzelt; langsam steht er auf. Er beginnt mit schwarzer, knarrender Stimme zu sprechen. Während er redet, berührt er auf der Zodiak-Tafel die einzelnen Sternbilder.
»Unser kleines Jahr endet, wenn der Winter endet, im Zeichen der Fische. Das neue Jahr beginnt mit dem Widder, es ist die Zeit des Säens und des Aufbruchs, wenn die Reiher fliegen und die Schiffe segeln. Dann kommt der Stier, dann all die anderen Zeichen. Im Großen Jahr läuft der Kreis anders herum. Die letzten Weltenmonde im Großen Jahr sind Stier, dann Widder; das Neue Zeitalter beginnt im Zeichen der Fische.«
Er macht eine Pause, scheint aber keineswegs erschöpft. Der jüngere Ägypter blickt den Hellenen von der Seite an. »Hast du verstanden?«
Der Hellene grinst plötzlich. »Ich bin ja nur ein Händler und Seefahrer, aber mit den Sternen muß ich mich ein wenig auskennen, sonst komm ich nicht an mein Ziel. Ja, ich hab das verstanden. Ist ja nicht so schwer. Ich weiß nur nicht, was daran so unendlich wichtig ist.«
Der Alte macht ein kratzendes Geräusch tief in der Kehle. »Du wirst hören, Hellene. Jeder Weltenmond wird beherrscht von dem Gott, in dessen Zeichen er steht.« Die Hand geht wieder zur Karte des Zodiak. »Es sind immer etwa zweitausendeinhundert unserer kleinen Jahre. Als Die Fruchtbare endete und das milde Atlantis versank, begann der Mond des Löwen, des Herrn über Feuer und Krieg; an ihn und seine Einheit mit den großen Fürsten erinnert der Sphinx. Er wurde am Ende des Großen Löwen-Monds errichtet. Dann kamen die Monde des Gepanzerten und der Göttlichen Brüder, dann der des Stiers.« Der Alte deutet auf den geköpften Apisbullen. »Nun leben wir vor dem Ende des Großen Widder-Monds, unter der Herrschaft Amûns, dessen Sohn und Gefäß der Pharao ist. In etwa zweihundertfünfzig kleinen Jahren ist das Ende der Zeit, und es beginnt ein neues Großes Jahr. Wir wissen nicht, wer der Herr der Fische sein wird. Aber wir wissen, daß der Herr des Widders bis dahin herrschen muß, wenn nicht Maats ewige Waage kippen soll.«
Der jüngere Priester legt beide Hände flach an die Stirn. »Die Ordnung von Himmel und Erde«, murmelt er. »Und das ist der Grund, aus dem du hier bist– aus dem der Ehrwürdigste Siwah verlassen hat.«
Der Hellene blickt zwischen beiden hin und her; insgeheim scheint er zu zweifeln, zu staunen, vielleicht zu spotten.
Der Uralte wendet sich nun ganz dem Hellenen zu. »Seit jener, den ihr Kambyses nennt, König der Könige Persiens, Amûns heiliges Land eroberte, hat Amûn kein würdiges Gefäß mehr gefunden. Die Priester haben es gewußt; um nicht das Volk zu verwirren, haben sie die Herrscher, die nach den Persern kamen, als Söhne Amûns begrüßt. Ein wenig war der Gott immer anwesend. Nun hat er sich ganz von uns zurückgezogen.«
Der Hellene blinzelt. »Ammon, der Zeus ist? Er hat Ägypten verlassen? Auch Siwah?«
»Wir ergründen seinen Willen– wir ertasten sein ka. Aber er hat kein Gefäß mehr im Reich. Sein Wille hat sich nach Norden gewandt, nach Hellas. Dort wird sein neues Gefäß geboren, sein nächster Sohn, ein Herrscher. Er wird geboren im Zeichen von Feuer und Krieg, im Zeichen des Löwen.« Der Alte streckt die Arme aus und intoniert die letzten Sätze beinahe singend. »Dann wird er kommen, die Waage zu stützen, die Perser zu werfen, Amûn zu erfüllen.« Er bricht ab, starrt den Hellenen an. »Alles muß bereitet werden. Geh, Bruder; zeig es ihm.« Er richtet noch ein paar Worte in Ägyptisch an den anderen Priester; dann sinkt er wieder zu einer sitzenden Figur zusammen.
Der jüngere Ägypter berührt den Ellenbogen des Hellenen. »Komm.«
Sie gehen hinaus in die Nacht. Der Himmel ist ein gleißendes Sternenmeer. Der Ägypter deutet auf das Sternbild des Widders.
»Ammon und Zeus.« Er nestelt unter seinem Umhang und holt ein Amulett hervor: das Horos-Auge in der Schlaufe des ankh. Der Hellene hält die offene Hand hin und nimmt es entgegen.
»Geh nach Dodona und nach Samothrake. Sie müssen wissen– wenn sie es nicht schon selbst erkannt haben. Sag, was du gehört hast, und zeig ihnen das Auge.«
Der Hellene hängt sich das Amulett um den Hals. Zögernd sagt er: »Aber– werden sie das Gefäß des Gottes erkennen? Und werden sie mir glauben?«
»Sie werden glauben, weil sie wissen. Sie werden erkennen, weil sie wissen.– Schau!«
Ein Komet rast über den Sternenhimmel. Er durchquert das Sternbild des Widders.
Der Ägypter hebt beide Hände. »Das Zeichen– nach Norden!«
Der Komet wird zu einem langen Blitz im Dunkel, das er zerfetzt. Krachender Donner folgt, Woge um Woge, als wollte er nie enden. Dann weitere Blitze, die sich langsam entfernen; der Donner wird leiser. Unter dem trüben Himmel eines späten Nachmittags knien vier Frauen vor einem weißen Altar. Er ist bedeckt mit Taubenkot. Dahinter und seitlich stehen knotige Eichen. Auf den Ästen und in den Zweigen hocken Tauben; einige flattern fort, andere landen.
Eine der Frauen ist schwarz; sie trägt ein ägyptisches Priestergewand und kostbaren Kopfschmuck. Die zweite Frau ist gelb und in ein fast durchscheinendes, eng anliegendes Gewand aus gelber Seide gehüllt; ihre Augen sind wie Schlitze, die Wangenknochen hoch. Die dritte Frau ist weiß und hellblond; sie hat blaue Augen und trägt ein ledernes Jagdgewand. Die vierte Frau, die jüngste der vier, ist nackt bis auf einen knappen weißen Chiton; ihr Haar ist wie brennende Kastanie. Sie ist üppig; das Gesicht strahlt Sinnlichkeit aus, aber auch dämonische Willenskraft.
Der Donner kommt leiser, aus größerer Ferne. Der Wind wird stärker, raschelt in den Eichen, reißt einen der um kleine Zweige gewickelten Papyrosstreifen ab. Die Tauben gurren und seufzen. Die drei Frauen scheinen zu lauschen, die jüngste blickt zwischen ihnen und dem Altar hin und her. Die schwarze Ägypterin bewegt den Oberkörper rhythmisch vor und zurück. Zunächst murmelt sie etwas, dann singt sie monoton, immer lauter:
»Ammon– Ammon– Ammon…«
Wieder und wieder sagt sie den Namen, schrill und tief, lauter und leiser, bis der Platz um den Altar vom Namen des Gottes widerhallt.
Die Frau in gelber Seide nimmt ein Eichenstöckchen und malt in den Staub einen Kreis, halbiert ihn durch eine Wellenlinie, bringt in beiden Hälften je einen augenartigen dicken Punkt an, schraffiert eine Hälfte.
Die Hellblonde wirft den Kopf hin und her, bis ihr Haar das Gesicht bedeckt.
Die Schwarze beendet die Anrufung des Gottes und blickt die jüngste der Frauen an. »Die Götter haben deinen Vater, den König, früh zu sich gerufen, Olympias.«
Die Weiße spricht durch den Haarvorhang. »Er war ein guter Mann, aber zu früh hat er den Nabelstrang durchtrennt, der Menschen an den Himmel bindet. Dein Oheim ist eingeweiht.«
Die Gelbe: »Er ist Herrscher und Priester. Er hat dich zu uns gebracht. Es ist sein Wille, daß der Wille der Götter geschehe.«
Die Ägypterin: »Olympias, du wirst den Heiligen Hain von Dodona verlassen. Du wirst zum Tempel des Zeus reisen, der auch Ammon ist und Bel-Marduk. Der Tempel auf der Insel Samothrake. Dort wirst du in die übrigen Mysterien eingeweiht, und für eine Zeit wirst du hetaira sein im Tempel.«
Der Wind nimmt zu, weht das Haar aus dem Gesicht der Weißen, als sie weiterspricht. »Olympias, ein großer dunkler Krieger und Herrscher wird nach Samothrake kommen. Er wird sich dort von Blut reinigen, das er vergossen hat. Du wirst ihn sehen, er wird dich sehen. Du wirst seinen Sohn gebären, das neue Gefäß, das Ammon auserwählt hat. Er wird die Welt verwandeln.«
Der Wind ist nun beinahe zum Sturm geworden und verweht ein Teil dessen, was die Gelbe sagt. Sie hält den Kopf gebeugt; beim Sprechen betrachtet sie den Wellenkreis auf dem Boden. »Dein Sohn, Olympias, Gefäß des Gottes, auserwählter Sohn des Ammon, der Zeus ist und Bel-Marduk und… wird er sein Alles für Alle, Gott und Mensch, Vater und Sohn, Mann und Frau, Feind und Freund… die Welt zerstören und heilen. Er wird zweifeln und glauben, den Glauben bezweifeln und an den Zweifel glauben… den Ungläubigen Glaube sein. Er wird jung sterben und unsterblich leben. Alle Gaben sind sein, mehr als je ein Sterblicher besaß, und er wird alles verschenken. Alle Gewalt, gut und schlecht, Demut und Anmaßung, und…«
Ein Kugelblitz birst vielfarbig neben den Frauen und dem Altar; er tilgt das kreisförmige Zeichen auf dem Boden. Donner, Regen und rauschende Eichen übertönen alles. Die Frauen stehen auf; schrilles Gelächter schneidet durch die anderen Geräusche. Die drei Priesterinnen fassen einander bei den Händen. Für Momente wird der Sturm leiser; die Weiße sagt: »Wir Drei sehen uns wieder.« Ihre Gesichter altern jäh; dann lösen sich die drei Frauen auf und werden zu Nebel, den der Sturm verweht.
Olympias wendet sich vom Altar fort. Sie ist durchnäßt und bebt. Sie hebt die Arme zum dunklen Himmel; in ihrem Gesicht mischen sich Angst und Grauen mit Lust und Triumph.
Die Farben des Hintergrunds ändern sich von Grau zu trübem Rotgelb. Olympias, noch immer in der gleichen Haltung, steht in einem erleuchteten Tempel. Die Farben und Lichter schwanken; ein großes Feuer und flackernde Fackeln lassen die Umrisse und Schatten tanzen. Olympias trägt einen weißen Chiton und eine leuchtend hellrote Hüftschärpe. Neben ihr, die Arme vor der Brust verschränkt, bewegt ein ägyptischer Priester in langem schwarzen Gewand mit feurig goldenen Bildern und Zeichen den Oberkörper langsam vor und zurück. Seine tiefe Stimme füllt den riesigen Tempel aus.
»Ammon– AMmon– ammON– AAAmon– aaaMUN…« Er singt den Namen wieder und wieder, mit kleinen Abwandlungen; die Anrufung endet mit einem dröhnenden, beinahe ekstatischen »Om«.
Vor ihnen, auf einem weißen Altarstein, liegt ein Widder. Blut aus der zerschnittenen Kehle und dem aufgerissenen Bauch rinnt hinab zu den milchig grauen Steinplatten des Bodens. Aus dem Schlangennest der Eingeweide steigt Dampf.
Hinter dem Altar, erst nach und nach zu erfassen in seiner ungeheuren Größe, sitzt Zeus-Ammon auf einem Thron aus Gold und schwarzem Holz. Der Thron ruht auf einem breiten, weißen, viereckigen Sockel mit schwarzen und roten Symbolen: hellenischen Zeichen, ägyptischen Glyphen und kantigen Schriftkeilen. Die Statue des Gottes– Elfenbein und Gold– berührt im oberen Zwielicht die von massiven Säulen getragene Decke. Auf einem der goldenen Widderhörner des Gottes glüht der Widerschein des Feuers. Weihrauchschwaden treiben durch den Tempel. Beim letzten dröhnenden »Om« scheint ein tückisches Lächeln um die Lippen des Gottes zu spielen. Er hat einen schwarzen Bart; seine Ohren sind riesig.
Der Ägypter läßt die Arme sinken und wendet sich zur Seite. »Komm, Aristandros.« Seine Stimme ist heiser und wie geschrumpft.
Ein hellenischer Priester hat vor dem Gott ausgestreckt auf dem Boden gelegen. Nun steht er auf. Er geht zum Altar, berührt eines der Hörner des geopferten Widders, wühlt in den Eingeweiden und untersucht die Leber. Der Ägypter und Olympias treten neben ihn.
»Es ist gut«, sagt Aristandros.
Der Ägypter nickt, dann schaut er Olympias an. »Bist du bereit, die Bürde zu tragen?«
»Habe ich eine Wahl?« Ihre Stimme klingt traurig und einsam.
Der Ägypter schweigt; Aristandros seufzt leise. »Wie können wir das wissen? Die Götter haben die Dinge so angeordnet. Vielleicht haben sie auch vorherbestimmt, ob wir gehorchen oder uns weigern. Aber ich werde bei dir sein– wenn das ein Trost ist.«
Der Ägypter öffnet sein bis zum Hals verschlossenes Gewand. Er streift die feine Goldkette über den Kopf, kniet vor Aristandros und hebt die zum Teller geformten Hände.
Der Hellene nimmt das Amulett entgegen: ein goldenes ankh mit dem Auge des Horos in der Schlaufe. Er führt es an die Lippen, dann taucht er es in das Blut des Opfertiers und reicht es Olympias. Sie hängt das Amulett um ihren Hals und schiebt es unter den weißen Stoff. Über ihren Brüsten verfärbt sich der Chiton.
Peukestas zuckte zusammen; wie einer, der im Einschlafen noch einmal jäh geweckt wird. Seine Knie schmerzten ein wenig. Aristoteles ließ sich in die Decken und Kissen sinken; die Hand mit dem Amulett verschwand unter einem Fell.
»Das ist untauglich.« Die Stimme des Philosophen war heiser und erschöpft. »Und es ist zu sehr wie Platon.«
Peukestas rieb sich die Augen und blinzelte. »Wie lang hat es gedauert?«
Aristoteles grunzte leise. »Vielleicht zehn Atemzüge. Aber es taugt nicht.«
Peukestas erhob sich und tastete nach seinem Schemel. »Auf diese Weise könntest du in einer Stunde ein Leben wiedergeben.« Seine Stimme war flach von Staunen, aber auch Entsetzen darüber, Spielball einer unheimlichen Macht gewesen zu sein.
Aristoteles verzog das Gesicht; etwas wie Geringschätzung schwang in seiner Stimme mit. »Wie gesagt: Langes Leben lehrt vielerlei Unfug. Aber ich habe die Kraft nicht mehr, die eine Stunde davon kosten würde. Und…«
»Wieso ist es zu sehr wie Platon und taugt nicht?«
Der Greis runzelte die Stirn. »Erworbenes Wissen ist Besitz, eingeflößtes Wissen ist Traum von Besitz. Münze, mit der du nicht zahlen kannst. Sie hat nur eine Seite.«
»Gibt es das– eine Münze mit einer Seite?«
Aristoteles betrachtete ihn; die Augen des alten Mannes glühten. »Wörter, die nicht oft genug von allen Seiten beschaut und befragt werden, verlieren für den, der sie verwendet, am Ende ihre Vielfalt. Sie zeigen ihm nur noch die eine Seite, die er sehen will, und schließlich glaubt er selbst, sie hätten nie eine oder mehrere andere gehabt. So hat sich Platon in einem Wortlabyrinth eingemauert– ärmliche Steine, die von außen keinerlei Form, Farbe und Verstand zeigen. Nur dem, der ins Labyrinth geht, zeigen sie ihre Prägung; aber diese Prägung war nicht in den Dingen, sondern sie stammt von Platon. Sie ist unnütz, sie mehrt das Wissen nicht, und es ist sehr schwierig, das Labyrinth wieder zu verlassen. Viele sehen nie wieder Sonne, spüren nie wieder frischen Wind. Nein, es taugt nicht. Es ist wie Nahrung, die ein anderer für dich gekaut hat.«
Peukestas schwieg; er starrte den alten Mann an.
Aristoteles schloß die Augen. Leise, fast murmelnd sagte er: »Sokrates hat den Platz, auf dem wir alle stehen und vergehen, mit gewaltigem Besen von Gerümpel und Trümmern gereinigt. Damit das gleißende Licht der Mittagssonne alles erhellt, ohne Schatten, ohne Ritzen, in denen man sich vor dem Verstand verbergen kann. Er hat Mittagsfragen gesprochen, blendend hell und stechend. Fragen ohne Schatten, ohne Versteck. Er hat Wörter gesprochen, die Steine mit tausend Seiten waren, und er hat diese Steine von allen Seiten betrachtet, hat sie gedreht, daß alle alles sehen konnten. Dann hat er die Steine in die Luft geworfen, und sie sind Teil des gnadenlosen Mittagslichts geworden.«
»Und Platon?« sagte Peukestas halblaut.
»Platon? Platon hat vieles von dem alten Schutt wieder auf den Platz geholt. Und er hat neue Steine gesprochen– Ziegel, mit sechs Seiten statt tausend. Fünf Seiten hat er verwischt, bis nur auf einer Seite Sinn blieb. Aus diesen Steinen hat er sein Labyrinth errichtet, in dem es Schatten gibt und Winkel, um sich zu verkriechen. Dort staut sich die Luft, und das Mittagslicht wird verdunkelt.«
»Und was hat Aristoteles mit seinen Steinen gemacht?«
»Ah, es gab einmal einen Mann, der so hieß. Nur eine leere Hülle ist geblieben. Als er noch Steine sprechen und heben konnte, hat er sie umgedreht und von allen Seiten betrachtet. Er hat sie nach Größe, Beschaffenheit und Eigenschaften geordnet und sie aufgestapelt an einer Stelle, wo sie niemanden stören können. Er hat bis zuletzt nicht gewußt, ob es den Menschen möglich ist, ungeschützt auf dem gleißenden Platz zu stehen, die Wucht der Mittagssonne zu ertragen und das Licht zu sehen. Wenn Aristoteles klüger gewesen wäre, wenn er länger gelebt hätte, hätte er vielleicht die gestapelten Steine in den Himmel geworfen– wie Sokrates. Oder er hätte am Ende beschlossen, daß ein lichtes Gebäude mit sehr wenig Schatten dem Menschen zuträglich wäre. Ein Gebäude aus beweglichen Steinen, die auf jeder Seite unverwischten Sinn tragen.« Er stützte sich auf einen Ellenbogen. »Aber er war nicht klug genug, oder er ist zu früh gestorben. Vielleicht war er auch nur nicht genügend verzweifelt, um ein solches Schutzgebäude gegen das Licht zu errichten. Deshalb, Sohn Drakons, mag ich dir keine fertigen Bilder einflößen, selbst wenn ich die Kraft noch hätte. Laß uns reden– laß uns Steine sprechen und umdrehen. Wenn du meinst, du müßtest daraus ein Gebäude errichten, einen Tempel, in dem du deine Erinnerung an Alexander unterbringen und die Welt vergessen kannst, mußt du es selbst tun, allein, nachdem ich nicht mehr da bin. Steine, die ich selbst gesehen und gewendet oder von denen ich gehört habe. Sobald alles getan ist, bleiben nur Wörter. Sie sind ohne Bedeutung, wenn du sie nicht wägst.«
»Wie soll ich sie wägen, wenn ich ihre Bedeutung nicht kenne? Wie kann ich vermeiden, die Schale zu zerbrechen, wenn der eiförmige Stein auch ein Ei sein könnte?«
Aristoteles schwieg ein paar Atemzüge lang; dann lächelte er beinahe tückisch. »In diesem Fall muß ich hier und da von meinen Grundsätzen lassen, fürchte ich. Ich sehe ein, daß du nicht nur wissen mußt, was Stein und was Ei, sondern auch, welches Ei gut und welches faul ist. Vielleicht stimmt das, was ich sage, aber nur für mich– nicht für dich, nicht für andere. Vielleicht habe ich eine Vorliebe für faule Rebhuhneier, die ich somit für gut erkläre, während sie dich zum Erbrechen reizen, da du frische Hühnereier vorziehst. Glaubst du, damit umgehen zu können?«
Peukestas nickte stumm.
»Dann werden wir auch von Männern reden müssen, über die wenig bekannt ist. Wir werden Mutmaßungen darüber anstellen müssen, wie bestimmte Dinge gewesen sein könnten, damit wir andere Vorgänge erklären können. Vielleicht– vielleicht ist es eher Stoff für ein Satyrspiel oder eine Komödie, ein Epos, eine Tragödie. Weniger für eine wahrheitsgetreue Darstellung. Vielleicht solltest du, statt trockene Wahrheiten zu schreiben, die Geschichte auf erfundene und wirkliche Charaktere aufteilen und sie reden und handeln lassen. Es wäre eine kunstfertige Form der Lüge. Aber vielleicht ist für diese Belange eine ordentlich gearbeitete Lüge die einzig mögliche Wahrheit.«
2.
Parmenions Traum
Im Morgengrauen ging der leichte Schneefall in Nieselregen über, der aber auch bald endete. Eine Stunde nach Sonnenaufgang war der Schnee geschmolzen; nur im Paß und an einigen schattigen Stellen des Tals hielten sich noch Reste. Auf der Nordseite des Passes, wo die Handelsstraße– ein holpriger Karrenweg