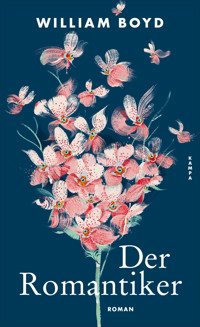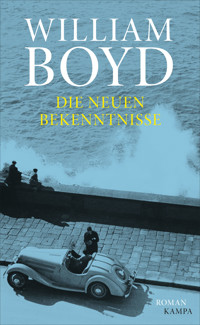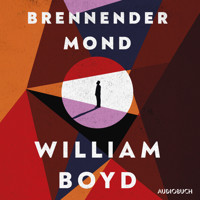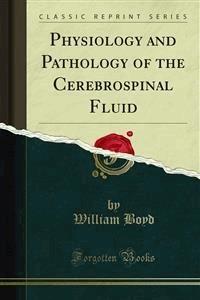Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gatsby
- Sprache: Deutsch
Bethany Mellmoth hat sich ein großes Ziel gesetzt. Sie will Schriftstellerin werden. Oder vielleicht doch Fotografin? Oder Schauspielerin? So schnell sie einen Plan fasst, so schnell ist er wieder passé. Irgendetwas kommt eben immer dazwischen. Und auch in der Liebe hat Bethany kein glückliches Händchen. An Verehrern ist kein Mangel, nur taugt leider keiner von ihnen. Und als wäre das alles nicht genug, muss Bethany sich auch noch mit den Liebeswirren ihrer Eltern befassen. So stolpert sie durch ihr Leben in London - von Job zu Job, von Mann zu Mann, von Pleite zu Pleite - und lässt doch nie den Kopf hängen: »Dinge gehen eben schief.« Schwungvoll und mit leichter Hand zeichnet William Boyd das Bild einer jungen Frau, der viele Türen offenstehen, die aber trotzdem ständig mit dem Kopf gegen die Wand rennt, und er erzählt von all den kleinen Entscheidungen und Zufällen, die unser Leben formen - ob wir wollen oder nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
All die Wege, die wir nicht gegangen sind
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer
Gatsby
EINS . . .
Bethany hält die Dauerbeschallung mit Bob Dylan nicht mehr aus. Sholto, ihr Freund, lässt ununterbrochen Songs von Dylan laufen, während er bei abgeschaltetem Ton Nachrichtensender schaut – Sky News oder CNN oder BBC News 24. Zwischen diesen Programmen schaltet er ständig hin und her, immer auf der Suche nach dem neuesten Bildmaterial des aktuellen Nachrichtengeschehens. Er scheint sämtliche Songs zu haben, die Dylan jemals veröffentlicht hat, inklusive Raubpressungen, und er lässt sie eine Spur lauter laufen, als gerade noch erträglich wäre – als Soundtrack zu den tonlosen Bildern von großen und kleinen Kriegen, sportlichen Triumphen und Niederlagen, Pressekonferenzen, Promi-Auftritten und einer Naturkatastrophe nach der anderen. Es sei ein einzigartiger, nie langweilig werdender Film von 365 Tagen Laufzeit, behauptet er, eine neue Kunstform, die er erfunden habe und die jedem zugänglich sei, der einen Fernseher besitze und dazu die Möglichkeit, Musik abzuspielen. Der Kontrast zwischen den ständig wechselnden Bildern und den zufällig dazu laufenden Songs von Bob Dylan sei der Hammer, sagt er, stimulierend ohne Ende, tragisch oder erhebend, witzig oder surreal, rund um die Uhr, solange es Nachrichtenmaterial und Dylans Begleitmusik dazu gibt.
Davon hast du bald genug, denkt Bethany, als sie ihren Mantel anzieht und die dröhnende Wohnung verlässt – Sholto verfolgt gerade eine Szene mit Kühen in einem Schneesturm, irgendwo in Nordengland, während dazu Like a Rolling Stone läuft. Draußen ist es kalt, ein dünner Eisregen fällt. Sie legt einen Schritt zu, um möglichst schnell zu ihrer Stamm-Sushi-Bar in der Meard Street zu kommen, wo sie Sushi mit Jakobsmuscheln und Thunfisch-Sashimi bestellt, dazu ein Glas Leitungswasser. Sie isst das ganze Jahr hindurch Sushi, auch im Winter: Reis enthält kein Cholesterin, und der rohe Fisch schmeckt so gruselig und jenseitig, dass einem der Appetit auf alles andere vergeht.
In der hell erleuchteten, chromblinkenden Küche arbeitet neben den japanischen Köchen auch eine junge Engländerin mit einer Art schwarzem Stoffschiffchen auf dem Kopf. Sie wirkt ernst und streng, mit dichten, dunklen Augenbrauen. Auf einmal hat Bethany ihre Zukunft klar vor Augen: Auch sie wird Sushi-Köchin, sie wird wunderschöne, saubere, gesunde Speisen zubereiten und eine Sushi-Bar in London eröffnen.
Als sie nach dem Essen das Restaurant verlässt, sieht sie die junge Engländerin mit einer Zigarette notdürftig untergestellt am Hinterausgang, der kaum Schutz vor dem Regen bietet. Bethany nimmt eine Zigarette heraus und bittet das Mädchen um Feuer. Sie rauchen zusammen und unterhalten sich. Wie lange dauert so eine Ausbildung zur Sushi-Köchin? Man absolviert eine zweijährige Lehrzeit, erklärt das Mädchen mit den Augenbrauen.
»Cool«, sagt Bethany. »Muss man dazu nach Japan?«
»Wenn es einem ernst damit ist, schon.«
Noch besser, überlegt Bethany, während sie sich bereits ihr neues Leben in Tokio ausmalt. In Tokio ist es eher warm, oder? Der Gedanke an eine Stadt, in der es ganzjährig warm ist, gefällt ihr.
»Und was macht man da genau?«, fragt sie.
»Nun«, sagt die junge Köchin, »die ersten beiden Jahre sieht man nur zu.«
»Man sieht zu?«
»Ja. Man steht einfach dabei und sieht einem Sushi-Meister bei der Arbeit zu, und nach zwei Jahren Zuschauen bekommt man ein Messer ausgehändigt und darf zum ersten Mal Fisch schneiden.«
Bethany kehrt nach Hause zurück.
»Ist arschkalt draußen«, ruft sie und sieht bei einem raschen Blick ins Wohnzimmer, dass Sholto vom Sofa auf den Boden gewechselt ist. Er blickt gebannt zum Fernseher, wo gerade Angehörige der Bangladesh Air Force Säcke mit Reis aus einem schwebenden Hubschrauber an die Opfer einer Überschwemmung verteilen, die sich dicht an dicht darunter drängeln. Er reagiert nicht auf ihre Worte. Soeben singt Bob Dylan It’s all over now, Baby Blue.
ZWEI . . .
Bethany überquert die Piccadilly Road und at- met tief durch, als sie den Park betritt. Sie verspürt dabei dieselbe Freude und Erleichterung wie jedes Mal, wenn sie die laute, hektische Stadt hinter sich lässt und ihr Blick auf die grüne, wohlgeordnete, in sich geschlossene Landschaft trifft, mit dem sauber getrimmten Rasen und den hochaufragenden, dicht belaubten Platanen, die sich bis hinauf zur Hyde Park Corner erstrecken. Sie macht sich auf den Weg zur »Stierkampfarena« und muss dabei dem Drang widerstehen, ihre Mittagszigarette jetzt gleich zu rauchen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt sie sich.
Bei der Stierkampfarena handelt es sich um ein großes, asphaltiertes Rondell am östlichen Parkende, mit einem Laternenpfahl in der Mitte und vier Bänken, die gleichmäßig ringsherum angeordnet sind, als markierten sie die Quadranten auf einem Kompass. Sie hatte mit Sholto auf der Bank im Nordwesten gesessen, als er ihr eröffnete, dass ihre Beziehung beendet sei und er auf Reisen gehen werde – nach Namibia, nach Laos und Alaska –, und zwar allein. Jetzt steht sie am Laternenpfahl und kann die Sholto-Schwingungen in der Stierkampfarena am heutigen Tag sehr stark spüren – manchmal sind es gute Schwingungen; und manchmal fühlt sie sich davon so überwältigt, dass sie weinen muss. Sie entscheidet sich für die Bank im Südwesten und nimmt dort ihre Schreibkladde aus der Tasche.
Nach dem Abbruch ihres Studiums (Englische und Amerikanische Literatur) und dem Scheitern ihrer Bemühungen, einen Platz an einer Schauspielschule zu ergattern (insgesamt sechs Vorsprechtermine waren es), ist Bethany zu dem Entschluss gelangt, dass ihr nichts anderes übrigbleibt, als Schriftstellerin zu werden. Wohl wissend, dass sie einen Job braucht, um sich beim Schreiben über Wasser zu halten, hat sie sich widerwillig an ihre Mutter gewandt und sie um Hilfe gebeten. Bethany weiß, dass ihre Mutter fast alles arrangiert, worum man sie bittet – es ist nur eine Frage der Zeit. Folglich arbeitet Bethany nun in einem kleinen, schmalen Lädchen in der Royal Arcade namens Pergamena, in dem es antike Füllfederhalter und erlesene Sorten von Papier zu kaufen gibt. Die Inhaberin Mrs Donatella Brazzi (die auf rätselhafte Weise um mehrere Ecken mit Bethanys Mutter bekannt ist) schaut hin und wieder mal vorbei und zieht sich dann immer nach hinten in das winzige Büro zurück, um stundenlang lautstark mit ihrer Familie in Italien zu telefonieren. Mitunter kommt es vor, dass sich drei Tage lang kein einziger Kunde in den Laden verirrt. Was Bethany nicht weiter stört, schließlich verdient sie auch so ihr Geld und hat obendrein reichlich Zeit, um über ihren Roman nachzudenken.
Bethany nutzt jede Mittagspause – sofern das Wetter mitspielt –, um im Park an ihrem Roman zu schreiben, da sie das Gefühl hat, dass ihr das Schreiben an der frischen Luft leichter von der Hand geht. Und natürlich ist die Stierkampfarena, in Anbetracht ihres letzten, quälenden Gesprächs mit Sholto, einer der besonderen Orte in ihrer persönlichen Geographie, ein ganz zentraler Punkt auf der Landkarte ihres Lebens. Der Green Park, so viel steht schon jetzt fest, wird für immer eine ganz eigene Saite in ihr zum Klingen bringen. Dieser Park, das weitläufige, asphaltierte Rondell der Stierkampfarena mit der Laterne in der Mitte und jene so harmlos wirkende Holzbank, all das wird ihr bis ins hohe Alter auf einzigartige, unvergessliche Weise präsent bleiben.
Bethany fehlt noch die Inspiration, deshalb gönnt sie sich ihre Mittagszigarette heute früher, wenn auch mit schlechtem Gewissen. Der Tag ist sonnig und windig, mit dicken weißen Wolken hie und da, die schnell am Himmel vorbeiziehen. Sie sieht den alten Mann auf seiner üblichen Bank sitzen, in seinem üblichen Tweedmantel und mit seiner Baskenmütze, das Notizbuch aufgeschlagen auf den Knien, den Kopf hochgereckt, als wollte er die Luft selbst erschnuppern. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie diesem alten Mann nicht hier begegnet. Einmal, an einem sehr verregneten Samstag, als sie über Pfützen hinweg die Piccadilly Road entlanghastete, unterwegs zu einem Coffee-Shop, hat sie ihn von der Straße aus gesehen, hier an seinem Stammplatz in der Stierkampfarena, unter einem aufgespannten Regenschirm.
Sie schlägt ihre Kladde auf, hält bei der Titelseite kurz inne: KÖNIGIN IN EINEM KLEINEN LAND – Roman von Bethany Mellmoth. Sie genießt jedes Mal den wohligen Schauer, den diese schlichten Worte in ihr auslösen. Weil sie alles so wirklich erscheinen lassen, ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
Die Protagonistin von Königin in einem kleinen Land trägt den Namen Meredith Crowe. Sie ist ungefähr in Bethanys Alter, und der Roman zeichnet den leichten Nervenzusammenbruch nach, den sie nach der Trennung von ihrem Freund erleidet – Mungo, Cosmo, Aldo (der Name ändert sich laufend). Aldo und Meredith haben sich eines Abends im Green Park getrennt, unter Tränen und bitteren Vorwürfen auf beiden Seiten, nachdem Aldo gestanden hat, dass er zu einer früheren Freundin zurückkehren werde, seiner Sandkastenliebe.
Die unglückliche Meredith zieht es immer wieder in den Park zurück – sie kann einfach nicht anders –, und um sich zu trösten, verwandelt sie den Park in ihrer Phantasie in ein kleines Königreich mitten in London, über das sie selbst als milde Regentin herrscht. Meredith kennt jeden Winkel ihres kleinen, nur wenige Morgen Land umfassenden Reiches, kennt seine Straßen und Monumente (die Kriegerdenkmäler, den Zierbrunnen), die beiden Imbissbuden aus Holz, seine grünen Alleen, die sanften Hügel und Täler, die Tore an seinen verschiedenen Zugängen (manche prächtig-barock, andere schlicht funktional) und seine kleinen, gepflegten Wäldchen. Die Parkwächter mit ihrer Livree in Olive- und Forstgrün sind ihr treues Gefolge. Sie hat nichts gegen fremde Besucher und gewährt ihnen gern sicheres Geleit, während sie kreuz und quer durch ihr Reich ziehen, dessen Grenzen sie frühmorgens um fünf öffnet und um Punkt Mitternacht wieder gut verschließt. Wenn die Kehrfahrzeuge vorüberdröhnen, die mit ihren schnell rotierenden Bürsten zuverlässig für Sauberkeit auf ihren Straßen sorgen, neigt sie in stiller Anerkennung schweigend ihr Haupt, und bisweilen sinnt sie darüber nach, ob ihre Nachbarin, die Königin eines viel größeren Landes, die in ihrem Palast auf der anderen Seite von Constitution Hill residiert, sie wohl eines Tages einmal besuchen kommt.
Mit dem Anfang ihres Romans ist Bethany bislang sehr zufrieden: Der Rahmen ist abgesteckt – der Park und seine Traumexistenz in Königin Merediths Kopf sind so weit eingeführt und anschaulich beschrieben –, und damit ist der Kontext für Merediths Wahnvorstellungen und ihre sich anbahnende psychische Krise klar … Bethany weiß bloß noch nicht so ganz, wie es nun weitergehen soll.
Am Montag darauf setzt Bethany sich an ihren gewohnten Platz auf der Sholto-Bank und schlägt ihren Roman auf. Es ist warm: ein heißer, windstiller Tag. Die Wiese ist voller Leute, Touristen und Büroangestellte; viele liegen ausgestreckt im Gras und sonnen sich, andere lesen oder picknicken. Von ferne hört sie das gleichförmige dumpfe Schlagen von Trommeln, während die Soldaten der Palastgarde, unterwegs zum Wachwechsel am Buckingham Palace, die Mall hinaufmarschieren. Vielleicht sollte Meredith einen Soldaten kennenlernen, überlegt sie, und ihn in ihrem Wahn für einen lange verschollenen Prinzen halten …
Ihr fällt auf, dass die Bank, wo der alte Mann sonst immer zu sitzen pflegt, heute verwaist ist, aber schon wenig später entdeckt sie ihn, drüben im sogenannten Hain – bestehend aus etwa einem Dutzend uralter, kreisförmig angepflanzter Bäume jenseits des breiten, an der östlichen Seite des Parks entlang verlaufenden Hauptwegs, gegenüber der Stierkampfarena. Er steht auf der Lichtung inmitten der Bäume und blickt konzentriert zu den Blättern empor, als hätte er dazwischen irgendetwas entdeckt. Er schreibt etwas in sein Notizbuch.
»Hätten Sie vielleicht Feuer für mich?«
Ganz versunken in ihren Plot, sieht Bethany auf. Meredith Crowe meinte soeben, Aldo in einer Touristengruppe entdeckt zu haben, ist hingelaufen, hat ihm eine Ohrfeige verpasst und damit einen wildfremden Mann erschreckt und verärgert.
Der alte Mann steht direkt vor ihr, zwischen den knochigen Fingern eine nicht angezündete Zigarette in einer kurzen Spitze. Bethany kramt Streichhölzer aus ihrer Tasche und reicht sie ihm.
»Darf ich?« Mit diesen Worten setzt er sich neben sie, zündet sich die Zigarette an und nimmt einen übertrieben tiefen Zug. Beim Ausatmen streckt er die Hand mit der Zigarettenspitze weit von sich weg und beobachtet sehr aufmerksam, wie der ausgestoßene Rauch von einer sanften Brise auseinandergetrieben wird. Er zückt sein Notizbuch und schreibt etwas hinein. Sein hageres Gesicht ist tief gefurcht, er hat weißes Haar, das im Nacken länger ist und auf seinem Hemdkragen aufliegt.
»Mir ist nicht entgangen, dass Sie ständig schreiben«, sagt er, und Bethany erzählt ihm von ihrem Roman.
»Wie außerordentlich«, sagt er. »Ich bin nämlich auch Romanautor. Gestatten, Yves Hill.« Er streckt ihr die Hand entgegen. »Y, V, E, S – französisch. Yves.«
Sie geben sich die Hand – sein Händedruck ist fest –, und Bethany stellt sich ihrerseits vor, ganz fasziniert davon, zum ersten Mal im Leben einem anderen Schriftsteller zu begegnen, einem Kollegen sozusagen.
»Was für Romane haben Sie denn geschrieben?«, erkundigt sie sich.
»Oh, eine ganze Menge.« Er zählt einige Titel auf: »Der Petersilienbaum; Rechteck; Eine Stimme, rufend; Die erstaunte Seele; Zitternde Nadel …« Dann verstummt er kurz. »Dieser Tage fast unmöglich aufzutreiben. Alle längst vergriffen. Höchstens noch bei einem der besseren Antiquariate zu finden.« Er sieht sie freundlich an, voller Anteilnahme. »Ist kein leichtes Geschäft, Romane zu schreiben, reich wird man nicht dabei. Man muss schon einen sehr langen Atem haben.«
Jetzt, da sie und Yves Hill einander kennen, rauchen sie gegen Ende von Bethanys Mittagspause oft eine Zigarette zusammen und plaudern ein wenig. Yves Hill raucht eine französische Sorte namens Gitanes, die ziemlich streng riecht. Unter seinem Mantel trägt er stets einen Anzug, mit Hemd und Krawatte. Die Anzüge sind abgetragen und speckig und weisen etliche kleine, sehr sorgfältig ausgebesserte Stellen auf. Eines Tages fragt er sie, wie alt er ihrer Meinung nach sei.
Bethany sieht ihn an. »Keine Ahnung. Sechzig?«
»Ich bin siebenundachtzig.« Er erlaubt sich ein triumphierendes Lächeln.
»Wie siebenundachtzig sehen Sie wirklich nicht aus«, sagt sie. Dann erzählt sie ihm spontan von Sholto und ihrer Trennung und warum sie zum Schreiben immer hierherkommt, in diesen Park.
»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf«, sagt Yves Hill. »Ich war viermal verheiratet und hatte eine Vielzahl weiterer, sagen wir mal, Liebschaften. Wenn ich von einer Geliebten oder Ehefrau verlassen werde, konzentriere ich mich immer auf eine der Angewohnheiten, die ich besonders lästig an ihr fand. Dann dauert es meist nicht lange, bis Trauer und Selbstmitleid einem Gefühl von Erleichterung gewichen sind.«
Sholto hatte viele nervtötende Angewohnheiten. Nach kurzem Nachdenken kommt Bethany zu dem Schluss, dass sie es am schlimmsten fand, wenn er den ganzen Tag vor der Glotze hing und dabei viel zu laut Bob Dylan lief. Schwer erträglich war allerdings auch, wie eitel er ständig an seinen Haaren herumfummelte – wie er sich mit den Fingern durch den dichten Schopf furchte, immer wieder, ihn mal hierhin, mal dorthin strich, zu immer neuen Frisuren formte und wuschelte. Außerdem pfiff er ständig vor sich hin: und Leute, die vor sich hin pfeifen, kann sie auf den Tod nicht leiden.
Bethany stellt fest, dass das mit der selbsterzeugten virtuellen Verärgerung über Sholto funktioniert. Obwohl sie ihn seit Wochen nicht gesehen hat, findet sie ihn immer nerviger, wie einen juckenden Mückenstich, der einem keine Ruhe lässt, sooft man auch daran herumkratzt. Was leider nicht ohne literarische Nebenwirkungen bleibt, denn auch Meredith Crowe hört auf, sich nach Aldo zu verzehren, und ohne diesen narrativen Antrieb gerät die Arbeit an Königin in einem kleinen Land böse ins Stocken. Sie fragt Yves Hill um Rat.
»Lassen Sie etwas Überraschendes geschehen, etwas, das wie aus heiterem Himmel kommt«, sagt Yves Hill wie aus der Pistole geschossen. »So habe ich mir immer beholfen, wenn ich nicht mehr weiterwusste oder mir die Ideen ausgingen.« Er denkt kurz nach. »Königin Meredith wird von einem Kehrfahrzeug überfahren und verliert dabei ein Bein. Oder ein Flugzeug stürzt über dem Park ab – Dutzende Tote und Verstümmelte.« Er lächelt. »Sie werden feststellen, dass Sie dann wieder in den Erzählfluss finden, im Handumdrehen.«
Sie lässt sich seinen Rat durch den Kopf gehen. Wirklich überzeugt ist sie nicht davon. Um das Thema zu wechseln, fragt sie Yves Hill, ob er gerade an einem Roman arbeitet.
»Nein, nein«, sagt er. »Es ist eher ein Sachbuch. Eine kleine Monographie, könnte man sagen. Es wird mein letztes Buch, aber ich könnte mir denken, dass es mich berühmt macht.«
Nachts liegt Bethany in ihrer Wohnung allein im Bett und versucht sich einzureden, dass sie froh ist, Sholto los zu sein, sie es als Erlösung empfindet, dass der flackernde, immerzu wechselnde Lichtschein des stummgeschalteten Fernsehers nicht mehr durch den Spalt unter der Wohnzimmertür dringt. Yves Hill hat sie gefragt, warum Sholto sich gerade Namibia als Reiseziel ausgesucht hat, und sie hat ihm berichtet, dass diese Entscheidung auf die Bilder einer TV-Dokumentation über Namibia zurückgeht, die Sholto zufällig mal gesehen hat, während dazu The Dark Side of the Moon von Pink Floyd erklang. »Eine sehr schlechte Lüge«, stellte Yves Hill streng fest. »Ich möchte wetten, dass er noch nicht einmal abgereist ist.« Eine Vorstellung, die Bethany aus dem Gleichgewicht bringt und zugleich heftig erbost: der Gedanke, dass Sholto noch hier sein könnte, in England, und sie in dem Glauben belässt, er wäre auf Reisen … Sie verdrängt das Thema mit aller Macht und grübelt stattdessen darüber nach, was Meredith Crowe zustoßen könnte, irgendeine überraschende Wendung, um ihren Roman wieder in Schwung zu bringen, der nun seit über einer Woche auf Seite 43 ins Stocken geraten ist.
Tags darauf ist die aktuelle Hitzewelle Thema Nummer eins der Schlagzeilen. London schmort und schwitzt, London schmilzt in der Sonne. Die Touristen und Sonnenanbeter im Green Park wirken schier erschlagen von der brütenden Mittagshitze, sie liegen reglos im Gras, wie plattgewalzt. Bethany und Yves Hill sitzen zusammen auf ihrer Bank und rauchen.
»Spüren Sie das?«, fragt Yves Hill unvermittelt.
»Was soll ich spüren?«
Yves Hill deutet auf den grauen Rauchfaden, der von seiner Zigarette aufsteigt und nun auf einmal erzittert, sich kräuselt und krümmt und dann abreißt. Bethany spürt, wie sich ihr langes Haar an ihren nackten, schweißfeuchten Schultern leicht bewegt.
»Wie würden Sie das beschreiben?«, fragt er.
»Als sehr sanfte Brise? Eine ganz zarte Luftbewegung?«
»Wie unzulänglich ist das? Wie vage? Wie ungenau?« Yves Hill ist hörbar frustriert, seine Stimme klingt ganz hoch und dünn. Er deutet hinauf zu den milchigen Wolkenschlieren, die über ihnen reglos am verwaschen blauen Himmel hängen. »Noch die unerheblichste Wolke hat ihren eigenen Namen – Cumulo-cirrus-nimbus oder dergleichen.« Er wendet sich ihr zu und blickt sie scharf an. »Warum fällt uns nichts Treffenderes ein als ›eine sehr sanfte Brise‹?«
»Ich kann gerade so spüren, wie sich mein Haar dabei bewegt«, sagt Bethany.
Yves Hill zückt sein Notizbuch und schreibt etwas auf.
Bei Bethanys nächstem Treffen mit Yves Hill hat sich das Wetter geändert: Es ist kühl und bewölkt, mit stürmisch-böigem Wind, eher herbstlich als sommerlich. Bethany sitzt mittags in einer Fleecejacke an ihrem gewohnten Platz, ihren Roman vor sich auf den Knien. Es ist ihr letzter Arbeitstag, weil Donatella Brazzi den August daheim in Brescia verbringt und Pergamena für einen Monat schließt. Bethany hat noch keinen rechten Plan, was sie mit all der freien Zeit anstellen soll.