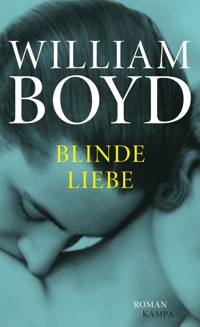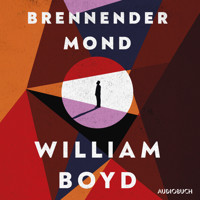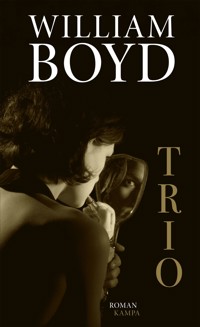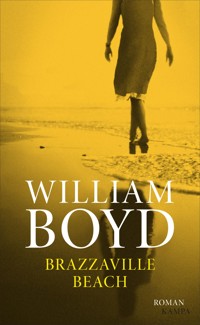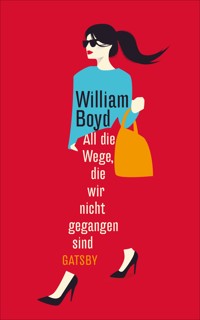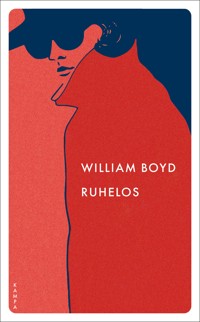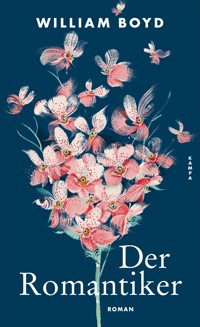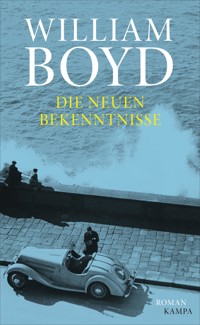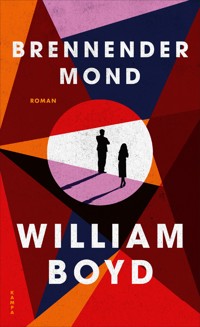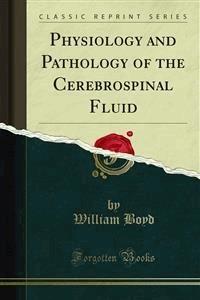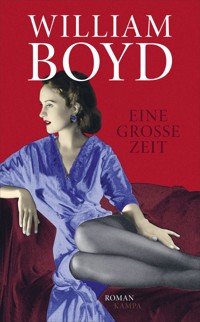
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien, 1913. Der junge englische Schau- spieler Lysander Rief reist in die Stadt Sigmund Freuds - denn der frisch Verlobte hat ein delikates Problem. Abhilfe schaffen soll die Psychoanalyse. Aber es kommt anders: Im Wartezimmer des Analytikers trifft Lysander auf die betörende Bildhauerin Hettie, der er sofort verfällt. Im Rausch der hitzigen Affäre sind alle Potenzprobleme schnell vergessen. Und Lysander genießt das ausschweifende Leben in Wiener Künstlerkreisen. Dann wird Hettie schwanger - und wieder wendet sich das Blatt. Als sie ihn der Vergewaltigung beschuldigt, muss Lysander Hals über Kopf aus Österreich fliehen und gerät in die Fänge des britischen Geheimdienstes. Plötzlich findet sich der Schauspieler auf der Bühne des Ersten Weltkriegs wieder und soll in die Rolle des Spions schlüpfen. Doch damit betritt er auch eine Welt, in der die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge jeden Tag mehr verwischen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
William Boyd
Eine große Zeit
Roman
Aus dem Englischen von Patricia Klobusiczky
Kampa
Für Susan
Im Morgenlicht wahr und mittags eine Lüge …
Ernest Hemingway
Lügen sind nicht ehrenhaft; doch wenn die Wahrheit große Zerstörung nach sich zieht, ist es statthaft, gegen die Ehre zu verstoßen.
Sophokles
Teil eins Wien 1913–1914
1Ein auf konventionelle Weise geradezu gut aussehender junger Mann
Es ist ein strahlend klarer Sommertag in Wien. Du stehst in einem verzogenen Pentagramm aus zitronengelbem Sonnenlicht an der scharfen Ecke Augustinerstraße und Augustinerbastei, gleich gegenüber der Oper, und beobachtest gleichgültig, wie alle Welt an dir vorüberzieht, während du auf irgendjemanden oder irgendetwas wartest, das deine Aufmerksamkeit weckt und fesselt, ein stärkeres Interesse aufkommen lässt. In der Atmosphäre dieser Stadt ist heute ein eigenartiges Prickeln zu spüren, beinah wie Frühling, obwohl der schon lange vorbei ist, aber dir fällt an den Passanten diese leichte Unruhe auf, die der Lenz mit sich bringt, ein Hauch von Ausgelassenheit, das Gefühl ungeahnter Möglichkeiten, ein Anflug von Verwegenheit – wer weiß, um welche Art von Verwegenheit es sich hier in Wien wohl handeln könnte? Doch du hältst die Augen offen, bist außergewöhnlich ruhig, bereit, alles – jede Krume, jedes Münzlein – aufzufangen, das die Welt dir beiläufig in die Hände spielen mag.
Und dann siehst du – zu deiner Rechten – einen jungen Mann aus dem Hofgarten schlendern. Er ist Ende zwanzig, auf konventionelle Weise geradezu gut aussehend, aber dir springt er ins Auge, weil er keinen Hut trägt, eine Ausnahmeerscheinung in der Menge geschäftiger Wiener, die alle einen Hut aufhaben, Männer wie Frauen. Und während dieser auf konventionelle Weise geradezu gut aussehende junge Mann zielstrebig an dir vorbeigeht, bemerkst du seine feinen braunen, vom Wind zerzausten Haare, seinen hellgrauen Anzug und die auf Hochglanz polierten, ochsenblutroten Schuhe. Er ist mittelgroß, aber breitschultrig, Körperbau und Haltung haben etwas von einem Sportler an sich, stellst du fest, als er dich nur wenige Schritte entfernt passiert. Er ist glatt rasiert – auch das ist hier, in dieser Hochburg der Gesichtsbehaarung, ungewöhnlich –, und du bemerkst, dass sein tailliertes Jackett gut geschnitten ist. Ein eisblaues Seidentaschentuch quillt in lockeren Lagen aus seiner Brusttasche. Sein Kleidungsstil wirkt durchaus gesucht – er ist nicht nur auf konventionelle Weise geradezu gut aussehend, er ist auch geradezu ein Dandy. Du beschließt, ihm ein Weilchen zu folgen, da du eine leise Neugier verspürst und ohnehin nichts Besseres vorhast.
Vor dem Michaelerplatz bleibt er unvermittelt stehen, hält inne, starrt auf irgendeinen Aushang und setzt dann seinen Weg zügig fort, als hätte er einen Termin und wollte sich nicht allzu sehr verspäten. Du folgst ihm rund um den Platz bis in die Herrengasse – die schräg einfallenden Sonnenstrahlen heben Details der mächtigen, prachtvollen Gebäude hervor, werfen scharfe, dunkle Schatten auf die Friese und Karyatiden, die Giebel und Gesimse, die Baluster und Architrave. Vor dem Kiosk mit den ausländischen Zeitungen und Zeitschriften bleibt er stehen. Er sucht den Graphic aus, bezahlt, faltet ihn auf und wirft einen Blick auf die Schlagzeilen. Ein Engländer also – wie langweilig –, deine Neugier schwindet dahin. Du kehrst um und läufst zum fünfeckigen Fleckchen Sonne zurück, das du an der Ecke verlassen hattest, in der Hoffnung, dass du dort auf Anregenderes stoßen wirst, und lässt den jungen Engländer seines Weges ziehen, wohin und zu wem auch immer er so entschlossen eilte …
Lysander Rief bezahlte seinen drei Tage alten Graphic (Auslandsausgabe), warf einen Blick auf eine der Schlagzeilen – »Friedensvertrag in Bukarest unterschrieben – Zweiter Balkankrieg beendet« – und fuhr sich unwillkürlich mit der Hand durch die glatten feinen Haare. Sein Hut! Verdammt. Wo hatte er seinen Hut gelassen? Auf der Bank im Hofgarten – natürlich –, auf der er geschlagene zehn Minuten gesessen und in einem Anfall rasender Unentschlossenheit ein Blumenbeet angestarrt hatte, während er sich beunruhigt fragte, ob er wirklich das Richtige tat, plötzlich war er unsicher, zog die Wienreise in Zweifel sowie all ihre Verheißungen. Und wenn es ein Fehler war, seine Hoffnung enttäuscht und sich am Ende alles als sinnlos erweisen würde? Er sah auf die Armbanduhr. Verdammt noch mal. Wenn er zurückginge, würde er zu spät zu seinem Termin erscheinen. Er mochte diesen Hut, die Kreissäge mit der schmalen Krempe und dem kastanienbraunen Seidenband, die er bei Lockett’s in der Jermyn Street gekauft hatte. Bestimmt war sie im Nu gestohlen worden – ein weiterer Grund, nicht zurückzugehen –, und wieder verfluchte er seine Zerstreutheit, während er die Herrengasse entlanglief. Das zeigte doch ganz deutlich, wie angespannt, wie aufgewühlt er war. Wie konnte man von einer Parkbank aufstehen und weggehen, ohne sich automatisch den Hut aufzusetzen … Offenbar machte ihm dieser dräuende Termin sogar noch mehr zu schaffen, als seine vordergründige, vollkommen verständliche Nervosität vermuten ließ. Ganz ruhig, sagte er sich und lauschte dem rhythmischen Klappern der Metallhalbmonde, die in seinen Lederabsätzen eingelassen waren, wenn sie auf das Steinpflaster trafen – ganz ruhig. Das ist doch nur der erste Termin – du kannst jederzeit gehen, nach London zurückfahren –, niemand hält dir deswegen eine geladene Pistole an den Kopf.
Er atmete tief durch. »Es war ein schöner Augusttag im Jahr 1913«, sprach er vor sich hin, wenn auch mit gedämpfter Stimme, gerade laut genug, um auf ein anderes Thema zu kommen und seine Stimmung zu heben. »Es war ein schöner Augusttag des Jahres … ach, 1913«, wiederholte er auf Deutsch und fügte die Jahreszahl auf Englisch hinzu. Zahlen fielen ihm schwer – lange Nummern und Jahreszahlen. Seine Deutschkenntnisse wurden rasch besser, aber er würde Herrn Barth, seinen Sprachlehrer, wohl darum bitten, eine Stunde lang nur Zahlen zu üben, um sie sich endlich einzuprägen. »Ein schöner Augusttag –«. An einer Mauer fiel ihm ein weiteres verunstaltetes Plakat auf, wie dasjenige, das er am Michaelerplatz erblickt hatte – inzwischen das dritte, seit er am Morgen seine Pension verlassen hatte. Man hatte einige Fetzen abgerissen, überall dort, wo der Leim nicht stark genug klebte. Beim ersten Plakat – das gleich neben der Tramhaltestelle hing, unweit der Pension – war sein Auge am Körper der spärlich bekleideten Maid hängengeblieben, die dort abgebildet war (der Kopf fehlte). Sie war fast nackt, geduckt, presste die Hände wie zum Schutz an ihre üppigen Brüste, während zwischen ihren runden Schenkeln ein beinah unsichtbarer, hauchdünner loser Schleier die Scham verdeckte. Die Zeichnung trug ungeachtet ihrer Stilisierung (der duftige, frei schwebende Schleier) realistische Züge, die besonders ansprechend waren, und so hatte er innegehalten, um sich das genauer anzusehen. Er hatte nicht die geringste Vorstellung von dem Hintergrund dieses Bildes, weil alles drum herum abgerissen worden war. Allerdings hatte auf dem zweiten verschandelten Plakat die Spitze eines schuppigen, gezähnten Reptilienschwanzes einen Anhaltspunkt dafür geliefert, warum die Nymphe oder Göttin, oder wer auch immer die Maid war, sich derart zu grausen schien. Und auf diesem dritten Plakat war immerhin noch ein Teil der Beschriftung erhalten geblieben: PERS-, darunter und, eine Zeile weiter schließlich Eine Oper von Gottlieb Toll-.
Er dachte: Pers … Persephone? Eine Oper über Persephone? Hatte man sie nicht in die Unterwelt verschleppt, sodass Narziss – oder wer? – sie dort herausholen musste, ohne sich ein einziges Mal umzuwenden? Oder war das Eurydike gewesen? Oder vielmehr … Orpheus? Nicht zum ersten Mal ärgerte er sich über seine eklektische Bildung. Es gab einige wenige Dinge, über die er sehr viel, und viele Dinge, über die er kaum etwas wusste. Er tat einiges, um dem abzuhelfen – er las alles Mögliche, arbeitete an seinen Gedichten –, doch hin und wieder wurde er aus heiterem Himmel mit seiner Unwissenheit konfrontiert. Das gehörte nun mal zu den Risiken seines Berufs. Gerade die klassischen Mythen und Bezüge stellten für ihn ein undurchdringliches Durcheinander dar, um nicht zu sagen eine entscheidende Lücke.
Wieder betrachtete er das Plakat. Diesmal hatte die obere Kopfhälfte dem Vandalismus standgehalten. Arabesken aus wild wehenden Haarsträhnen und weit aufgerissene Augen, die über den zerfetzten Längsstreifen spähten, als würde die Maid voller Entsetzen hinter einem Bettlaken hervorlugen. Als er die Fragmente der drei Plakate in Gedanken zusammensetzte, um sich ein möglichst umfassendes Bild von der Göttin zu machen, spürte er eine flüchtige Erregung. Eine nackte Frau, jung, schön, schutzlos einem schuppigen, eindeutig phallischen Ungeheuer ausgeliefert, das sich an ihr zu vergehen drohte … Eindeutig war auch die Erregungsabsicht dieser Plakate, und ebenso eindeutig stand fest, dass sie gegen die allgemeine Prüderie verstießen und einen wohlanständigen Bürger dazu verleitet hatten, die Aushänge zu schänden. Alles wahrscheinlich sehr modern – sehr wienerisch.
Lysander ging weiter und unterzog seine Gefühle einer gewissenhaften Prüfung. Warum löste ein Plakat, das die anstehende Vergewaltigung irgendeiner mythologischen Gestalt zeigte, bei ihm Erregung aus? War das normal? Lag es, genauer gefragt, vielleicht an der Pose – die Hände, die sich schützend um die Brüste wölbten, sie hielten, aufreizend und abwehrend zugleich? Er seufzte: Wer könnte diese Fragen schon beantworten? Der menschliche Geist war unendlich rätselhaft, vielschichtig und abgründig. Ja, ja, ja. Genau deswegen war er schließlich nach Wien gekommen.
Er überquerte den Schottenring und die ausgedehnte Grünfläche vor dem riesigen grauen Universitätsgebäude. Dort sollte er hingehen, um mehr über Persephone zu erfahren – er könnte jemanden fragen, der Latein und Griechisch studierte –, doch etwas ließ ihm keine Ruhe, ihm wollte partout kein Ungeheuer einfallen, das in Persephones Geschichte eine Rolle spielte … Im Gehen achtete er auf die Straßenschilder – bald wäre er am Ziel. Er blieb stehen, um eine Trambahn vorbeifahren zu lassen, danach bog er nach rechts in die Berggasse und dann links in die Wasagasse. Nummer 42.
Er schluckte, plötzlich hatte er einen trockenen Mund, und dachte: Vielleicht sollte ich einfach umkehren, meine Koffer packen, nach London zurückfahren und mein überaus bequemes Leben wieder aufnehmen. Aber damit wäre, wie er sich vor Augen führte, sein eigentümliches Problem nach wie vor ungelöst … Das breite Tor zur Nr. 42 stand offen, und er trat in die Einfahrt. Kein Pförtner oder Hauswart in Sicht. Er hätte mit einem Aufzug aus Stahlgeflecht nach oben fahren können, aber er nahm lieber die Treppe. Erster Stock. Zweiter. Schmiedeeisernes Geländer, die Handleiste aus lackiertem Holz, gesprenkelter Granit für die Stufen, die Wandmitte vertäfelt, darunter grüne Kacheln, darüber weiße Tünche. Auf solche Details konzentrierte er sich, um nicht an die Dutzenden – womöglich Hunderten – Menschen zu denken, die vor ihm diese Stufen hinaufgegangen waren.
Im zweiten Stock erwarteten ihn Seite an Seite zwei massiv getäfelte Türen mit Kämpferfenstern. Auf der einen stand Privat. Die andere war über der separaten Klingel mit einem kleinen Messingschild versehen, das dringend einer Politur bedurfte: Dr. J. Bensimon. Lysander zählte bis drei und drückte auf die Klingel, mit einem Mal hatte er die Gewissheit, das Richtige zu tun, vertraute auf die neue, bessere Zukunft, die er sich hiermit sichern wollte.
2Miss Bull
Dr. Bensimons Sprechstundenhilfe (eine schlanke Brillenträgerin von strengem Äußeren) hatte Lysander in ein kleines Wartezimmer geführt und ihn höflich auf die Tatsache hingewiesen, dass er rund vierzig Minuten zu früh erschienen war. Ob er sich noch so lange gedulden …? Mein Fehler – zu dumm. Kaffee? Nein danke.
Lysander setzte sich in einen niedrigen schwarzen Ledersessel ohne Armlehnen, einen von vier Sesseln in diesem Raum, die vor einem leeren Kamin mit Gipssims zu einem lockeren Halbkreis angeordnet waren, und unternahm einen weiteren Versuch, sich zu sammeln und seiner Aufregung Herr zu werden. Wie hatte er sich derart in der Uhrzeit irren können? Man hätte doch annehmen dürfen, dass dieser Konsultationstermin seinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt war. Als er sich umsah, fiel ihm eine schwarze Melone auf, die an dem Garderobenständer in der Ecke hing. Sie gehörte wohl dem Patienten vor ihm. Bei diesem Anblick wurde ihm bewusst, dass er doch in den Park hätte zurückgehen können, um seinen Hut zu holen. Verdammt, dachte er. Leck mich am Arsch, dachte er ferner, aus Spaß an der Unflätigkeit. Immerhin hatte ihn die Kreissäge eine Goldguinea gekostet.
Er stand auf und betrachtete die Bilder an der Wand, allesamt Stiche von stattlichen Ruinen – moosbedeckt, von Unkraut und jungen Bäumen überwuchert –, lauter gestürzte Schlusssteine, zerbrochene Giebel und umgekippte Säulen, die vage vertraut wirkten. Kein einziger Künstler wollte ihm einfallen – eine weitere Bildungslücke. Er ging zum Fenster, das auf den kleinen Innenhof des Wohngebäudes hinausging. Dort wuchs ein Baum – eine Platane, wenigstens konnte er ein paar Bäume bestimmen – inmitten eines Rasenstücks mit zertrampeltem, welkem Gras, eingehegt vom ehemaligen Kutschhaus und den Stallboxen; daraus trat nun eine alte Frau mit Schürze hervor, die an einem randvollen Kohleneimer schwer zu schleppen hatte. Er wandte sich ab und lief im Kreis, wobei er eine umgedrehte Ecke des verschlissenen Perserteppichs mit der Schuhspitze behutsam auf den Parkettboden zurückschlug.
Aus dem Vorzimmer drangen einige – auffallend laute, scharfe – Stimmen zu ihm, die Tür sprang auf, eine junge Frau kam herein und machte sie mit einem kräftigen Knall hinter sich zu.
»Entschuldigung«, sagte sie ungnädig, ohne ihn richtig anzusehen, dann setzte sie sich in einen der Sessel und wühlte energisch in ihrer Handtasche, bevor sie schließlich ein winziges Taschentuch herauszog und sich die Nase putzte.
Lysander trat leise wieder ans Fenster; er konnte das Unbehagen dieser Frau förmlich spüren, die Anspannung, die in Wellen von ihr ausging, als erzeugte ein innerer Dynamo dieses Fieber, diese Angst – das deutsche Wort war ihm erfreulich spontan in den Sinn gekommen.
Er drehte sich um, und ihre Blicke trafen sich. Solche Augen hatte er noch nie gesehen, durchscheinend helle braungrüne Augen. Und sie waren groß und weit – das Weiße, das die Iris umgab, deutlich erkennbar –, als betrachtete die junge Frau alles mit starker Intensität oder als stünde sie noch unter einem wie auch immer gearteten Schock. Ein hübsches Gesicht, dachte er – wohlgeformte Nase, spitzes, markantes Kinn. Olivbraune Haut. Ausländerin? Die Haare unter der ausladenden blutroten Baskenmütze waren hochgesteckt, und sie trug eine taubengraue Samtjacke zu einem schwarzen Rock. Am Revers prangte eine große Brosche aus rotem und gelbem Schellack in plumper Papageienform. Irgendwie künstlerisch, dachte Lysander. Schnürhalbstiefel, kleine Füße. Die junge Frau war tatsächlich sehr klein, sehr zierlich. Und sichtlich aufgeregt.
Er lächelte und wandte sich wieder dem Hof zu. Die stämmige alte Haushälterin stapfte nun mit ihrem leeren Kohleneimer zu den Ställen zurück. Wozu benötigte sie im Hochsommer so viel Kohle? Das konnte doch –
»Sprechen Sie Englisch?«
Lysander drehte sich um. »Ja, ich bin Engländer«, sagte er leicht argwöhnisch. »Wie sind Sie darauf gekommen?« Es ärgerte ihn, dass man ihm seine Nationalität offenbar an der Nasenspitze ansehen konnte.
»In Ihrer Tasche steckt eine Ausgabe des Graphic«, sagte sie und deutete auf die gefaltete Zeitung. »Das verrät einiges. Außerdem sind die meisten Patienten von Dr. Bensimon Engländer.« Ihre Sprechweise war kultiviert, offensichtlich war sie selbst Engländerin, ungeachtet ihres recht exotischen Teints.
»Haben Sie vielleicht eine Zigarette übrig?«, fragte sie. »Rein zufällig?«
»Zufällig ja, aber –« Lysander deutete auf ein Hinweisschild auf dem Kaminsims: Bitte nicht rauchen.
»Na klar. Darf ich Ihnen für später eine mopsen?«
Lysander zog sein Zigarettenetui aus der Jackentasche, klappte es auf und bot es der jungen Frau an. Sie nahm sich eine Zigarette, fragte: »Darf ich?«, und griff erneut zu, ohne seine Erlaubnis abzuwarten. Sie steckte beide Zigaretten in ihre Handtasche.
»Ich muss wirklich ganz dringend mit Dr. Bensimon sprechen«, sagte sie bestimmt, sachlich und nüchtern. »Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, wenn ich mich so einfach vordrängle.« Nun lächelte sie ihn an, so strahlend unschuldig, dass Lysander beinah geblinzelt hätte.
Genau genommen machte es ihm durchaus etwas aus, aber er sagte: »Keineswegs«, und erwiderte ihr Lächeln, etwas verunsichert. Wieder wandte er sich dem Fenster zu, berührte seinen Krawattenknoten und räusperte sich.
»Setzen Sie sich doch«, sagte die junge Frau.
»Ich möchte gern stehen. Diese niedrigen Sessel ohne Armlehne sind recht unbequem.«
»Ja, das sind sie in der Tat.«
Lysander überlegte, ob er sich vorstellen sollte, aber dann kam ihm der Gedanke, dass das Wartezimmer eines Arztes zu den Orten zählte, an denen die Menschen – lauter Fremde – vermutlich lieber anonym bleiben wollten; schließlich waren sie sich nicht in einer Galerie oder einem Theaterfoyer begegnet.
Er hörte ein leises Geräusch und sah sich um. Die Frau war aufgestanden und zu einem der Ruinen-Stiche gegangen (wie hieß der Künstler nur?), sie benutzte das Glas als Spiegel, um lose Haarsträhnen unter die Mütze zu stecken und ein paar flaumige Löckchen vor die Ohren zu ziehen. Lysander fiel auf, dass ihre kurze Samtjacke die Rundung von Hüften und Hintern unter dem schwarzen Rock zur Geltung brachte. Trotz ihrer fast acht Zentimeter hohen Absätze war sie sehr klein.
»Was starren Sie so?«, fragte sie abrupt, als sie seinen Blick in der Spiegelung auffing.
»Ich habe Ihre Stiefel bewundert«, reagierte Lysander schlagfertig. »Haben Sie sie hier in Wien gekauft?«
Er sollte keine Antwort bekommen, da im selben Moment die Tür zu Dr. Bensimons Sprechzimmer aufging und zwei Männer plaudernd und lachend heraustraten. Lysander wusste auf Anhieb, welcher der beiden Dr. Bensimon war, ein Mann Ende vierzig, fast kahl mit braungrau meliertem Stutzbart. Der andere konnte Lysanders Ansicht nach nur beim Militär sein. Marineblauer Zweireiher, Querbinder unterm steifen Kragen, schmale Hose mit Aufschlägen, die Schuhe so blank poliert, dass es nach Lackleder aussah. Hochgewachsen, asketisch hager, mit einem gepflegten schmalen dunklen Schnurrbart.
Die junge Frau geriet sofort außer sich, fiel den Männern ins Wort, rief lautstark Dr. Bensimons Namen, bat ihn um Entschuldigung und bestand zugleich darauf, umgehend mit ihm zu sprechen, es sei wirklich dringend, ein Notfall. Der soldatisch anmutende Mann wich zurück, als Dr. Bensimon – mit einem Seitenblick zu Lysander – die quengelnde Patientin in sein Sprechzimmer schob; Lysander hörte ihn mit leiser strenger Stimme zu ihr sagen: »Das darf unter keinen Umständen wieder vorkommen, Miss Bull«, bevor die Tür hinter ihnen zufiel.
»Gütiger Himmel«, sagte der mutmaßliche Soldat trocken. Er war ebenfalls Engländer. »Was ist denn hier los?«
»Sie schien in der Tat ein wenig verstört zu sein«, sagte Lysander. »Hat zwei Zigaretten bei mir geschnorrt.«
»Was sind das nur für Zeiten?«, bemerkte der Mann und nahm seine Melone vom Haken. Mit dem Hut in der Hand sah er Lysander offen an.
»Kennen wir uns nicht?«, fragte er.
»Nein, ich denke nicht.«
»Sie kommen mir so merkwürdig bekannt vor.«
»Vielleicht ähnele ich einem Ihrer Bekannten.«
»Kann gut sein.« Er streckte die Hand aus. »Ich heiße Alwyn Munro.«
»Lysander Rief.«
»Diesen Namen habe ich aber bestimmt schon mal gehört.« Er zuckte die Achseln, neigte den Kopf zur Seite, kniff die Augen zusammen, als versuchte er, sich zu erinnern, dann gab er lächelnd auf und ging zur Tür. »An Ihrer Stelle würde ich die junge Dame nicht mehr mit Zigaretten füttern. Ich halte sie für nicht ganz ungefährlich.«
Als er weg war, setzte Lysander seine eingehende Betrachtung des trostlosen kleinen Hofs fort. Er sog jede erdenkliche Einzelheit in sich auf – das Würfelmuster der Pflastersteine, den Zahnfries im Bogen über der Stalltür, einen feuchten Streifen auf der Backsteinmauer, unterhalb eines tropfenden Wasserhahns. Darauf richtete er seine ganze Konzentration. Ein paar Minuten später kam die junge Frau wieder aus Dr. Bensimons Sprechzimmer, deutlich ruhiger und gefasster. Sie nahm ihre Handtasche.
»Danke, dass ich mich vordrängeln durfte«, sagte sie munter. »Und für die Glimmstängel. Sie sind sehr nett.«
»Nicht der Rede wert.«
Sie verabschiedete sich und trottete mit wehendem langem Rock von dannen. Bevor sie die Tür hinter sich schloss, warf sie ihm noch einen Blick zu, sodass Lysander einen letzten Eindruck dieser eigenartigen, durchscheinend braungrünen Augen bekam. Die Augen eines Löwen, dachte er. Im Namen trug sie aber den Bullen.
3Das afrikanische Flachrelief
Lysander saß in Dr. Bensimons Sprechzimmer und sah sich um, während der Arzt seine Personalien in ein Patientenverzeichnis eintrug. Das Zimmer war geräumig, mit drei Fenstern auf einer Seite, schlicht möbliert und fast ausschließlich in Weißtönen gehalten. Weiß gestrichene Wände, weiße Wollgardinen, auf dem hellen Parkett lag ein weißer Teppich und über dem Kamin hing ein primitives Flachrelief aus gehämmertem Silber. In einer Ecke stand Dr. Bensimons Mahagonischreibtisch, dahinter verglaste Bücherregale, die bis zur Decke reichten. Neben dem Kamin befand sich auf einer Seite ein Sessel mit hoher Lehne und einem cremeweißen Überwurf aus grobem Leinen, auf der anderen ein Diwan mit einer dicken gefransten Wolldecke und zwei bestickten Kissen. Beide Möbel standen mit dem Rücken zum Schreibtisch, sodass Lysander, der den Sessel gewählt hatte, sich schier den Nacken verrenken musste, wollte er Dr. Bensimon sehen. Im Zimmer war es sehr still – wegen der Doppelfenster –, und Lysander hörte nicht das Geringste vom Straßenlärm, der unten herrschte – weder das Rattern der Tram noch das Klappern der Kutschen und Pferdewagen oder irgendwelche Automobile. Die Ruhe war vollkommen.
Lysander betrachtete das silberne Flachrelief. Afrikanische Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier, mit bizarrem Kopfputz, filigrane Muster aus winzigen Löchern, in das weiche Silber getrieben. Es war kurios und wunderschön – und wimmelte bestimmt von einschlägiger Symbolik, dachte Lysander.
»Mr L.U. Rief«, sagte Bensimon. Es war so still, dass Lysander den Füller kratzen hörte. Der Stimme war ein leichter Akzent anzuhören, vielleicht aus Nordengland, dachte Lysander, Yorkshire oder Lancashire, aber so verschliffen, dass man ihn nicht genau zuordnen konnte. Mit Akzenten kannte Lysander sich aus, was ihn stolz machte – zum Entschlüsseln benötigte er in der Regel keine zwei Minuten.
»Wofür stehen die Initialen?«
»Lysander Ulrich Rief.«
»Ein großartiger Name.«
Manchester, dachte Lysander – dieser typische a-Laut.
»Rief – ist das schottisch?«
»Altenglisch. Angeblich heißt das ›gründlich‹. Ich habe allerdings auch gehört, es sei ein angelsächsischer Dialektausdruck für ›Wolf‹. Ziemlich verwirrend.«
»Ein gründlicher Wolf. Von wölfischer Gründlichkeit. Und was hat es mit ›Ulrich‹ auf sich? Sie sind teils deutscher Abstammung?«
»Meine Mutter ist Österreicherin.«
»Aus Wien?«
»Linz, um genau zu sein. Ursprünglich.«
»Geburtsdatum?«
»Meins?«
»Das Alter Ihrer Mutter dürfte wohl kaum eine Rolle spielen.«
»Verzeihen Sie. 7. März 1886.«
Wieder verdrehte Lysander den Kopf. Bensimon saß bequem zurückgelehnt, er lächelte, die Hände hinter der glänzenden Glatze verschränkt.
»Sie müssen sich nicht ständig umdrehen. Stellen Sie sich einfach vor, ich sei nichts weiter als eine Stimme.«
4Wiener Kunstmaterialien
Lysander ging langsam die Treppe hinunter, völlig in Gedanken versunken, die teils angenehm, teils unbefriedigend und teils beunruhigend waren. Das Gespräch hatte nur eine knappe Viertelstunde gedauert. Bensimon hatte seine Personalien notiert, die Zahlungsmodalitäten geklärt (Abrechnung alle vierzehn Tage, Barzahlung) und ihn schließlich gefragt, ob er bereit wäre, sein »Problem« darzulegen.
Draußen auf der Straße hielt Lysander inne und zündete sich eine Zigarette an; er fragte sich, ob die Therapie, die er soeben begonnen hatte, ihm wirklich helfen würde oder ob er es nicht lieber mit einer Pilgerfahrt nach Lourdes hätte probieren sollen? Oder mit dem Heilmittel irgendeines Quacksalbers? Oder hätte er wie George Bernard Shaw Vegetarier werden und Jäger-Unterwäsche tragen sollen? Er runzelte die Stirn, weil er auf einmal so unsicher war – und das war seinem Anliegen alles andere als zuträglich. Greville Varley, sein bester Freund, hatte eine Psychoanalyse angeregt – Greville war der Einzige, der von seinem Problem wusste (und auch das nur andeutungsweise) –, und Lysander hatte sich diesem Vorschlag mit Leib und Seele verschrieben, wie ihm nun bewusst wurde, hatte sämtliche Zukunftspläne über den Haufen geworfen, seine Ersparnisse abgehoben, war nach Wien gezogen und hatte nach dem richtigen Arzt gesucht. War das nun sträflicher Leichtsinn oder nur ein Anzeichen von Verzweiflung?
Biegen Sie links in die Berggasse, hatte Bensimon erklärt, dann gehen Sie immer geradeaus bis zur kleinen Grünfläche an der großen Kreuzung. Der Laden ist direkt gegenüber – WKM –, nicht zu übersehen. Lysander machte sich auf den Weg, in Gedanken immer noch bei der entscheidenden Frage.
BENSIMON: Wie würden Sie das Problem beschreiben?
LYSANDER: Es … es ist sexueller Natur.
BENSIMON: Ja. Das ist es fast immer. Im Kern.
LYSANDER: Wenn ich dem Liebesspiel fröne … ich meine, dem Beischlaf –
BENSIMON: Reden Sie bitte nicht um den heißen Brei herum, Mr Rief. Hier ist Offenheit gefragt. Sie können sich so derb und unverblümt ausdrücken, wie Sie möchten. Selbst Gossensprache kann mich nicht schrecken.
LYSANDER: Also gut. Beim Ficken habe ich Schwierigkeiten.
BENSIMON: Sie bekommen keine Erektion?
LYSANDER: Im Gegenteil, in dieser Hinsicht steht alles zum Besten. Mein Problem ist vielmehr der … der Ausstoß.
BENSIMON: Ach. Das ist ungemein verbreitet. Sie leiden unter vorzeitigem Samenerguss. Ejaculatio praecox.
LYSANDER: Nein. Ich habe gar keinen Samenerguss.
Lysander schlenderte die leicht abschüssige Berggasse hinunter. Irgendwo in der Nähe befand sich die Praxis von Dr. Freud – vielleicht hätte er es lieber bei ihm versuchen sollen? Wie lautete noch diese französische Redensart? »Warum mit den Aposteln sprechen, wenn man sich direkt an Gott wenden kann?« Aber es gab da diese Sprachbarriere. Bensimon war Engländer, ein immenser Vorzug – wenn nicht sogar Segen –, das konnte man nicht leugnen. Lysander erinnerte sich an die lange Pause, die eingetreten war, nachdem er Bensimon von seiner merkwürdigen sexuellen Funktionsstörung erzählt hatte.
BENSIMON: Das heißt, Sie haben Geschlechtsverkehr, aber keinen Orgasmus?
LYSANDER: Genau.
BENSIMON: Wie spielt sich das ab?
LYSANDER: Nun ja, ich halte eine ganze Weile durch, aber da ich weiß, dass es zu nichts führen wird, erschlaffe ich schließlich.
BENSIMON: Detumeszenz.
LYSANDER: Damit endet es.
BENSIMON: Das muss ich erst einmal überdenken. Höchst ungewöhnlich. Anorgasmie – Sie sind der erste Fall, der mir begegnet. Faszinierend.
LYSANDER: Anorgasmie?
BENSIMON: So nennt man das, was Ihnen fehlt. So heißt Ihr Problem.
Und dabei ließ der Arzt es bewenden, abgesehen von einem weiteren Ratschlag. Bensimon hatte ihn gefragt, ob er ein Tage- oder Notizbuch führe. Lysander verneinte. Er schreibe ziemlich regelmäßig Gedichte, einige seien schon in Zeitungen und Zeitschriften erschienen, er sei aber nur ein Amateurdichter – hier zuckte Lysander bescheiden die Achseln –, der zum Spaß Verse schmiede und keinerlei Anspruch damit verbinde, und nein, er führe kein Tagebuch.
»Ich möchte, dass Sie sich von nun an Notizen machen«, hatte Bensimon erklärt. »Schreiben Sie Ihre Träume auf, Ihre Gedanken, was immer Ihnen auffällt. Jede Kleinigkeit. Was immer Ihre Sinne anspricht – Erotisches, Gerüche, Klänge, Berührungen –, einfach alles. Bringen Sie Ihre Notizen beim nächsten Mal mit und lesen Sie sie mir vor. Sparen Sie nichts aus, egal, wie schockierend oder banal es sein mag. So bekomme ich einen unmittelbaren Zugang zu Ihrer Persönlichkeit, zu Ihrem Wesen – zu Ihrem Unbewussten.«
»Meinem ›Es‹, meinen Sie.«
»Wie ich sehe, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, Mr Rief. Ich bin beeindruckt.«
Bensimon hatte ihm aufgetragen, seine Eindrücke und Beobachtungen stets so zeitnah wie möglich festzuhalten, ohne sie in irgendeiner Weise zu verändern oder zu bearbeiten. Außerdem durften sie keinesfalls auf lose Zettel notiert werden. Lysander sollte sich ein anständiges Notizbuch kaufen – in Leder gebunden, gutes Papier – und es als richtiges Dokument anlegen, in sich geschlossen und von Dauer, keine Sammlung beliebiger Kritzeleien.
»Und geben Sie dem Kind einen Namen«, hatte Bensimon angeregt. »Sie wissen schon – ›Mein Innenleben‹ oder ›Persönliche Betrachtungen‹. Geben Sie dem Ganzen eine Form. Ihr Traumtagebuch, Ihr Seelenjournal – es sollte etwas sein, das Sie auch später wertschätzen. Eine Chronik Ihres Erlebens in den kommenden Wochen, bewusst und unbewusst.«
Wenigstens wäre das etwas Konkretes, dachte Lysander, während er die Straße überquerte, um zum Geschäft für Künstlerbedarf zu gelangen, das Bensimon ihm empfohlen hatte – die Wiener Kunstmaterialien –, eine Art ausführlicher Aufenthaltsbericht. All dieses Gerede – insbesondere das, was er demnächst von sich geben würde – verpuffte doch in der Luft. Als er durch die Schwingtüren in den Laden eintrat, hatte er sich mit dem Gedanken schon angefreundet, Bensimon hatte recht, vielleicht würde ihm das tatsächlich helfen.
Der Laden war geräumig und hell erleuchtet – von der Decke hingen an modernen Kronleuchtern mit Aluminiumspeichen traubenweise Glühbirnen, deren Aureolen sich im glänzenden rotbraunen Linoleumboden spiegelten. Der Geruch von Terpentin, Ölfarbe, unbehandeltem Holz und Leinwand sorgte dafür, dass Lysander sich auf Anhieb wohlfühlte. Solche Warenhäuser liebte er – kreuz und quer verliefen die Gänge, die Füllhörnern gleich voller Material steckten: Regale, in denen verschiedenste Papiersorten geschichtet, Gläser, die mit spitzen Buntstiften gefüllt waren, ein Wäldchen aus großen und kleinen Staffeleien, reihenweise Ölfarbentuben in chromatischer Reihenfolge, bauchige, funkelnde Flaschen mit Leinöl und Farbverdünner, Leinenkittel, Klappstühle, Stapel von Farbpaletten, ein Haufen Deckfarbkasten, Pastellkreiden in flachen Schachteln mit offenem Deckel, die den schillernden Inhalt zur Schau stellten, regenbogenbunten Zigarillos gleich. Wenn er an solche Orte kam, nahm Lysander sich jedes Mal wieder vor, endlich mit dem Zeichnen als ernsthaftem Hobby anzufangen, mit Aquarellmalerei oder Linolschnitt – egal was, solange er Gelegenheit hätte, einen Teil dieser verlockenden Ausrüstung zu erwerben.
Er bog um die nächste Ecke und stieß auf eine kleine Sammlung von Zeichenblöcken und Notizbüchern. Nachdem er eine Weile gestöbert hatte, nahm er eine mehrere hundert Seiten starke Kladde in die Hand, fast so dick wie ein Lexikon. Nein, die nicht – zu entmutigend, gefragt war ein bescheidenerer Umfang, den er auch wirklich zu füllen vermochte. Er entschied sich für ein Notizbuch mit einem biegsamen schwarzen Ledereinband, feines Papier, unliniert, 150 Blätter. Es lag gut in der Hand und würde in die Jackentasche passen, wie ein Reiseführer – ein Reiseführer zu seiner Seele. Perfekt. Ihm fiel gleich ein Titel ein: Autobiographische Untersuchungen von Lysander Rief … Das klang doch genau nach dem, was Bensimon –
»Und schon sehen wir uns wieder.«
Lysander drehte sich um und erblickte Miss Bull. Eine liebenswürdige, lächelnde Miss Bull.
»Sie kaufen wohl Ihr Notizbuch?«, stellte sie wissend fest. »Bensimon sollte hier Provision bekommen.«
»Wollen Sie auch eins kaufen?«
»Nein. Meins habe ich nach wenigen Wochen aufgegeben. Worte liegen mir nicht besonders. Ich bin ein visueller Mensch, sehe alles in Bildern, nicht in Sprache. Ich würde lieber zeichnen als schreiben.« Sie zeigte ihm, was sie kaufen wollte: einen kleinen Satz seltsam geformter stumpfer Messer, einige mit konischer Spitze, andere mit dreieckiger Klinge, wie Miniatur-Maurerkellen.
»Damit können Sie aber nicht zeichnen«, sagte Lysander.
»Bildhauerei«, erklärte sie. »Ich will bloß mehr Ton und Gips bestellen. Es gibt in dieser Stadt keinen besseren Laden als WKM.«
»Eine Bildhauerin – das ist ja interessant.«
»Nein. Bildhauer.«
Lysander nickte verlegen. »Natürlich.«
Miss Bull trat auf ihn zu und sprach mit leiserer Stimme.
»Ich möchte mich gern für mein Verhalten von heute Morgen entschuldigen …«
»Dazu besteht doch kein Anlass.«
»Ich war ein bisschen … überreizt. Ich hatte nämlich keine Medizin mehr. Darum musste ich Dr. Bensimon so dringend sehen – wegen meiner Medizin.«
»Sicher. Dr. Bensimon gibt also auch Medizin aus?«
»Eigentlich nicht. Aber er hat mir eine Spritze gegeben. Und mich mit Nachschub versorgt.« Sie tätschelte ihre Handtasche. »Das Zeug wirkt Wunder – Sie sollten es ausprobieren, falls Sie mal ein kleines Tief haben.«
Bei ihr hatte Dr. Bensimons Medizin offensichtlich einiges bewirkt, sie kam Lysander viel ausgeglichener und selbstbewusster vor. Sie schien irgendwie alles im Griff –
»Sie haben ein ausgesprochen interessantes Gesicht«, sagte Miss Bull.
»Danke.«
»Ich würde Sie gern porträtieren.«
»Tja, ich bin etwas in –«
»Es muss ja nicht sofort sein.« Sie wühlte in ihrer Tasche und zog eine Visitenkarte hervor. Lysander las: Miss Esther Bull, Künstler und Bildhauer. Unterricht auf Anfrage. Darunter stand eine Adresse in Bayswater, London.
»Nicht mehr ganz aktuell«, sagte sie. »Jetzt bin ich schon seit zwei Jahren in Wien. Meine Telefonnummer steht auf der Rückseite. Wir haben uns gerade ein Telefon installieren lassen.« Sie blickte ihn herausfordernd an. Lysander war der Plural nicht entgangen. »Ich lebe mit Udo Hoff zusammen«, sagte sie.
»Udo Hoff?«
»Der Maler.«
»Ach. Jetzt, wo Sie es sagen – ja. Udo Hoff.«
»Haben Sie ein Telefon? Wohnen Sie im Hotel?«
»Weder noch. Ich wohne in einer Pension. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde.«
»Sie müssen unbedingt im Atelier vorbeischauen. Schreiben Sie mir Ihre Adresse auf. Dann schicke ich Ihnen eine Einladung zu einem unserer Feste.«
Sie reichte ihm einen Zettel aus ihrer Handtasche und Lysander notierte seine Adresse. Etwas widerwillig, wie er sich eingestehen musste, weil er in Wien allein sein wollte: um sein Problem zu lösen – seine Anorgasmie, wie es nun hieß. Er ganz allein. Im Grunde hatte er weder das Bedürfnis noch den Wunsch nach Gesellschaft. Er gab ihr den Zettel zurück.
»Lysander Rief«, las sie laut. »Habe ich schon mal von Ihnen gehört?«
»Wohl kaum.«
»Und ich heiße übrigens Hettie«, sagte sie, »Hettie Bull«, und streckte ihm die Hand entgegen. Lysander schüttelte sie. Hettie Bull hatte einen bemerkenswert festen Griff.
5Der Strom der Lust
»Warum hat mich die Begegnung mit HB so aufgewühlt? Und warum verspüre ich diese leichte Erregung? Sie ist überhaupt nicht mein Typ, dennoch habe ich jetzt schon das Gefühl, in ihr Leben, in ihre Umlaufbahn hineingezogen zu werden, ob ich will oder nicht. Warum? Und wenn wir uns bei einem Konzert oder einer privaten Feier kennengelernt hätten? Dann hätten wir sicher nicht das geringste Interesse füreinander aufgebracht. Weil wir uns aber im Wartezimmer von Dr. Bensimon begegnet sind, haben wir bereits etwas sehr Intimes übereinander erfahren. Könnte das die Erklärung sein? Die Verletzten, Unvollendeten, Unausgeglichenen, Gestörten, Kranken finden zueinander: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Sie wird mich nicht in Ruhe lassen, das weiß ich. Aber ich will gar nicht zu Udo Hoff ins Atelier, wer immer das sein mag. Ich bin nach Wien gekommen, um meinen Mitmenschen aus dem Weg zu gehen, und habe fast niemandem gesagt, wohin ich fahre, auf Nachfragen hin immer nur ›ins Ausland‹ geantwortet. Mutter weiß Bescheid, Blanche, Greville natürlich, und eine Handvoll anderer. Für mich soll Wien eine Art schönes Sanatorium mit lauter Fremden sein – als litte ich an Schwindsucht und wäre bis zur erfolgreichen Heilung einfach untergetaucht. Blanche würde HB wohl nicht mögen. Ganz und gar nicht.«
Lysander hörte ein unmerkliches Klopfen an seiner Tür – eher ein Kratzen. Er legte den Füller aus der Hand, klappte das Notizbuch zu – seine Autobiographischen Untersuchungen – und verstaute es in der Schreibtischschublade.
»Kommen Sie hinein, Herr Barth«, sagte er.
Herr Barth trat auf Zehenspitzen ein und schloss die Tür, so leise es nur ging. Trotz seiner Leibesfülle versuchte er stets, sich möglichst still und unauffällig zu verhalten.
»Nein, Herr Rief. Nicht hinein, sondern herein.«
»Verzeihung«, sagte Lysander und stellte einen weiteren Stuhl an den Schreibtisch.
Herr Barth war Musiklehrer und stammte überdies von einer langen Ahnenreihe von Musiklehrern ab. Sein Vater hatte 1836 Paganini spielen sehen, und als einige Jahre später sein erster Sohn zur Welt kam, nannte er ihn Nikolas zum Gedenken an das Ereignis. Als junger Mann hatte sich Herr Barth voll und ganz mit dem Vorbild identifiziert, ließ sich lange Haare und einen Backenbart wachsen wie Paganini, ohne diesen Stil jemals aufzugeben. Sogar jetzt, mit bald siebzig, färbte er sich die langen grauen Haare und den Backenbart einfach schwarz und trug nach wie vor altmodische Vatermörderkragen und Gehröcke mit Silberknöpfen. Sein Instrument war allerdings nicht die Geige, sondern der Kontrabass, den er etliche Jahre im Orchester des Wiener Lustspieltheaters gespielt hatte, bevor er die Familientradition wieder aufnahm und Musiklehrer wurde. Seinen alten Kontrabass bewahrte er im rissigen Lederkasten am Fußende des Bettes auf, an die Wand seines kleinen Zimmers ganz hinten im Flur gelehnt, das kleinste der drei Zimmer, die in der Pension Kriwanek zu mieten waren. Er behauptete, bei ihm könne man bis zu einem gewissen Leistungsniveau das Spielen sämtlicher »tragbaren sowie handlichen« Instrumente lernen – ob Streich-, Holzblas- oder Blechblasinstrumente. Lysander wusste nicht, ob es Schüler gab, die das Angebot nutzten, aber er nahm Herrn Barths zaghaften Vorschlag, den dieser ihm am Tag nach seinem Einzug in die Pension unterbreitete, dankend an – fünf Kronen sollte eine Stunde Deutsch kosten.
Herr Barth nahm behäbig Platz, wischte sich mit beiden Händen ein paar Haarsträhnen vom Kragen und drohte Lysander lächelnd mit dem Finger.
»Achten Sie auf die Vorsilben, Herr Rief. Nur so werden Sie unsere wunderschöne Sprache eines Tages beherrschen.«
»Heute möchte ich gern Zahlen üben«, antwortete Lysander in fehlerfreiem Deutsch.
»Ach ja, die Zahlen – die haben es in sich.«
Eine Stunde lang spielten sie pflichteifrig alles durch – das Zählen an sich, Jahreszahlen, Preise, Wechselgeld, Addition und Subtraktion –, bis Lysander von lauter babylonischem Zahlengewirr der Kopf schwirrte und die Essensglocke läutete. Da Herr Barth nur für Frühstück und Logis bezahlte, zog er sich zurück, während Lysander den getäfelten Speiseraum am anderen Ende des Flurs ansteuerte, wo ihn Frau Kriwanek höchstpersönlich erwartete.
Frau K, wie sie insgeheim von ihren drei Pensionsgästen genannt wurde, war der Inbegriff von Anstand und Frömmigkeit. Eine Witwe in den Vierzigern, die traditionelle österreichische Kleidung trug – in erster Linie moosgrüne Dirndl mit bestickten Blusen und Schürzen sowie klobige Schnallenschuhe – und sich einer derart überzogenen Höflichkeit befleißigte, dass sie höchstens für die Dauer einer Mahlzeit zu ertragen war, wie Lysander rasch festgestellt hatte. In ihrer Welt waren ausschließlich Menschen, Ereignisse und Dinge enthalten beziehungsweise zugelassen, die entweder angenehm oder erfreulich waren. So lauteten ihre Lieblingsattribute, die sie bei jeder erdenklichen Gelegenheit verwendete. Der Käse war angenehm, das Wetter erfreulich. Die junge Gemahlin des Kronprinzen machte einen angenehmen Eindruck, das neue Postamt war erfreulich gelungen. Und so weiter.
Lysander lächelte ihr unverbindlich zu, als er an der Tafel seinen Stammplatz einnahm. Er spürte förmlich, wie die Jahre von ihm abfielen: Frau K gab ihm das Gefühl, wieder ein Halbwüchsiger zu sein – jünger sogar, präpubertär. Ihre Anwesenheit entmannte ihn, wirkte seltsam einschüchternd und ehrfurchtgebietend; er erkannte sich dann selbst nicht wieder – wurde zu einem Mann ohne eigene Meinung.
Er sah noch ein drittes Gedeck – für den anderen Pensionsgast, Leutnant Wolfram Rozman, der offenbar nicht da oder spät dran war. Das Abendessen begann um Punkt acht Uhr. Frau K schätzte Lysander sehr – er war angenehm und erfreulich und noch dazu Engländer (angenehme Leute) –, doch den Leutnant schätzte sie wohl weniger, wie Lysander intuitiv erfasste. Er war nicht sehr angenehm, geschweige denn erfreulich.
Leutnant Wolfram Rozman hatte sich etwas zuschulden kommen lassen. Was genau, wusste niemand, aber sein Aufenthalt in der Pension Kriwanek deutete darauf hin, dass er in Ungnade gefallen war. Irgendeine Regimentsangelegenheit, hatte Lysander von Herrn Barth gehört. Man habe den Leutnant wegen des wie auch immer gearteten Skandals zwar nicht unehrenhaft entlassen, aber vorläufig aus der Kaserne verwiesen, sodass er gezwungen war, so lange hier zu wohnen, bis ein Urteil gefällt und über seinen Verbleib in der Armee entschieden wurde. Das schien den Leutnant nicht übermäßig zu stören, soweit Lysander beurteilen konnte – offenbar weilte er bereits seit fast sechs Monaten in der Pension –, aber je länger er blieb, desto unangenehmer wurde er in den Augen von Frau K. Auch wenn Lysander dem Austausch zwischen beiden erst seit zwei Wochen beiwohnte, war ihm aufgefallen, wie der Ton sich deutlich verschärfte, die Förmlichkeit zunehmend frostiger wurde.
Lysander mochte Wolfram – wie er ihn fast umgehend nennen durfte und sollte –, wohlweislich gab er das Frau K gegenüber aber nicht zu erkennen. Nun bedachte sie ihn mit ihrem dünnen Lächeln und läutete nach dem Dienstmädchen. Gleich darauf tauchte das Mädchen namens Traudl mit einer Suppenterrine auf, die klare Kohlsuppe mit Croûtons enthielt. Das war stets der erste Gang in der Pension Kriwanek, sommers wie winters. Traudl, eine Achtzehnjährige mit rundem Gesicht, die jedes Mal errötete, wenn sie sprach oder angesprochen wurde, setzte die Terrine so abrupt auf dem Tisch ab, dass die Suppe zweimal überschwappte und ein Teil auf der blütenweißen Decke landete.
»Für die Reinigung dieser Decke wirst du selbst aufkommen, Traudl«, sagte Frau K, ohne die Stimme zu erheben.
»Aber gern doch, gnädige Frau«, antwortete Traudl, errötete, machte einen Knicks und ging.
Frau K sprach das Tischgebet, mit geschlossenen Augen und erhobenem Kopf – Lysander senkte seinen –, und teilte für sie beide klare Kohlsuppe mit Croûtons aus.
»Der Leutnant ist spät dran«, bemerkte Lysander.
»Er hat für das Essen bezahlt, es liegt an ihm, ob er es auch einnimmt.« Wieder lächelte sie Lysander an. »Hatten Sie einen angenehmen Tag, Herr Rief?«
»Äußerst angenehm.«
Nach dem Essen (Paprikahuhn) war es Brauch, dass Frau K den Speiseraum verließ und die Herren rauchen durften. Lysander zündete sich eine Zigarette an; nun, da Frau K gegangen war, wurde er wieder er selbst und fragte sich wie jedes Mal, wenn er ihre Gesellschaft genossen hatte, ob er in ein Hotel oder in eine andere Pension ziehen sollte, doch als er das Für und Wider erwog, wurde ihm klar, dass er sich in der Pension Kriwanek eigentlich sehr wohl fühlte und – abgesehen von der täglichen Mahlzeit mit Frau K – alles nach seinen Wünschen verlief.
Tatsächlich war die Pension eine große Wohnung im dritten Stock eines recht neuen Gebäudes, auf der Südseite eines Hofes jenseits der Mariahilfer Straße gelegen, etwa 800 Meter vom Ring entfernt. Sie war mit einer Warmwasserheizung und elektrischem Licht ausgestattet; das großzügige Badezimmer, das von allen Gästen genutzt wurde, war modern (Toilette mit Wasserspülung) und sauber. In einer Agentur hatte Lysander sich eine Liste von Pensionen geben lassen, die ihm ein komfortables Schlafzimmer mit geräumigem Kleiderschrank sowie einen zuverlässigen Wäschedienst boten (er hatte sehr genaue Vorstellungen, was die Stärkung seiner Hemden anging), außerdem sollte eine Tramhaltestelle in der Nähe sein. Die Pension Kriwanek war die erste auf seiner Besichtigungstour, und als er sah, dass das Zimmer aus einem Salon, einem durch Vorhänge abgetrennten Alkoven samt Doppelbett und einer kleinen Schrankkammer bestand, die als Ankleidezimmer diente, mit ausreichend Regalen und Stauraum für seine Garderobe, machte er sich nicht die Mühe weiterzusuchen. Und das hatte ihn vermutlich dazu bewogen, nach dem Essen über einen Umzug nachzudenken – hätte er nicht erkunden sollen, was in Wien sonst noch möglich war? Doch hier hatte er immerhin einen Hauslehrer, das durfte er nicht außer Acht lassen.
Betrat man die Wohnung im dritten Stock, gelangte man durch die Flügeltüren zunächst in eine große Diele – groß genug für zwei Bergères mit Rohrlehnen und einen runden Tisch, in dessen Mitte eine ausgestopfte Eule unter einer Glasglocke thronte. Von der Diele führte ein langer Flur zum Speiseraum, zu den drei Gästezimmern – in denen Lysander, Wolfram und Herr Barth untergebracht waren – und zum gemeinsamen Bad. Am Ende des Flurs befand sich eine Tür mit dem Schild »Privat«; dahinter vermutete Lysander den Küchenbereich und die Gemächer von Frau K. Nie hatte er gewagt, durch diese Tür zu gehen. Da auch Traudl in der Pension wohnte, musste sie dort irgendwo ein Eckchen für sich haben. Allem Anschein nach verlief parallel zum Flur noch ein schmaler Dienstbotengang von der Küche zum Speiseraum – der mit zwei Türen ausgestattet war –, doch davon abgesehen, hatte Lysander nur eine vage Vorstellung vom Grundriss der Pension – wer wusste schon, was sich hinter dem Privat-Schild verbarg? Die Räume waren komfortabel, man hatte seine Ruhe. Das Frühstück wurde einem aufs Zimmer serviert, Abendessen gab es gegen Aufpreis, Lunchpakete konnte man einen Tag im Voraus bestellen. Ihm wurde bewusst, dass er sich hier auf seltsame Art heimisch fühlte.
Traudl kam herein und räumte die Dessertteller ab.
»Wie geht’s, Traudl?«, fragte Lysander. Sie war ein kräftiges, dralles Mädchen, ziemlich unbeholfen dazu.
Wie aufs Stichwort ließ sie einen Dessertlöffel fallen.
»Nicht so gut, mein Herr«, sagte sie, hob den Löffel auf und rieb den Vanillesoßenfleck mit einer Serviette weg.
»Warum denn?«
»Ich schulde Frau Kriwanek so viel Strafgeld, dass mir in diesem Monat kein Lohn bleibt.«
»Das tut mir leid. Du musst besser aufpassen.«
»Traudl? Traudl soll aufpassen? Völlig undenkbar!«, ertönte eine männliche Stimme.
»Guten Abend, Herr Leutnant«, sagte Traudl errötend.
Wolfram Rozman zog einen Stuhl vom Tisch und ließ sich darauf fallen.
»Traudl, mein kleines Flauschküken, bring mir doch ein bisschen Brot und Käse.«
»Aber gern, Herr Leutnant.«
Wolfram lehnte sich über den Tisch und klopfte Lysander auf die Schulter. Er trug einen hellblauen Anzug und eine fliederfarbene Fliege. Er war sehr groß, um einiges größer als Lysander, und bewegte sich mit dieser lockeren, schlaksigen Trägheit, die für hochgewachsene Männer typisch ist. So fläzte er sich hin, den Arm über die Lehne des Nachbarstuhls geworfen, und streckte die Beine unter dem Tisch aus. Seine hellblauen Hosenaufschläge und Gamaschen ragten neben Lysanders Platz unter dem Tisch hervor. Wolfram hatte einen verhangenen, müden Blick und einen dichten blonden Schnurrbart mit gewachsten Enden, die über seine vollen weichen Lippen gezwirbelt waren.
Lysander bot ihm eine Zigarette an, Wolfram nahm sie und zündete sie, nachdem er seine Taschen vergeblich nach Streichhölzern durchforstet hatte, mit Lysanders Feuerzeug an.
»Ich stehe wohl auf ihrer allerschwärzesten Liste«, sagte Wolfram und blies formvollendete Rauchringe in die Luft. »Schwarz wie die Nacht.«
»Sagen wir einfach, du bist nicht besonders ›erfreulich‹.«
»Ich bin den ganzen Weg hierher gerannt, weil ich nicht zu spät kommen wollte, und dann dachte ich – Herrgott sakra, nein, das halte ich nicht aus. Und so bin ich stattdessen ins Café gegangen und habe Schnaps getrunken.«
»Warum verzichtest du nicht ganz aufs Abendessen, so wie Barth? Dann würdest du sie gar nicht zu Gesicht bekommen.«
»Das Regiment kommt für alle Kosten auf. Nicht ich.«
Traudl brachte einen Teller mit mehreren Scheiben Schwarzbrot und etwas Streichkäse.
»Danke, mein Äffchen.«
Traudl schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich jedoch anders, knickste und ging durch die Hintertür.
Wolfram beugte sich vor.
»Lysander – du weißt doch, dass du Traudl besteigen kannst, wenn du ihr zwanzig Kronen gibst?«
»Besteigen?«
»Flachlegen.«
»Im Ernst?« Lysander rechnete schnell nach: Zwanzig Kronen waren nicht einmal ein Pfund.
»Ich mache es mehrmals wöchentlich. Das Mädchen braucht Geld – und eigentlich ist es ganz nett mit ihr.« Wolfram drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus, bestrich eine Brotscheibe mit Käse und fing an zu essen. »Diese süßen großen Landeier haben einige erstaunliche Tricks auf Lager – ich wollte dir bloß Bescheid geben, falls dir mal danach ist.«
»Danke. Ich behalte es im Hinterkopf«, sagte Lysander etwas perplex. Wie würde Frau K wohl reagieren, wenn sie von diesen Machenschaften erführe? Er würde Traudl jedenfalls von nun an mit anderen Augen sehen.
»Du wirkst so überrascht«, sagte Wolfram, sein Käsebrot kauend.
»Das bin ich auch. Ich hatte ja keine Ahnung. Ausgerechnet hier – in dieser Pension. Wie sehr der Schein doch trügt.«
Wolfram richtete sein Messer auf Lysander.
»Diese Pension – die Pension Kriwanek – ist genau wie Wien. An der Oberfläche befindet sich die Welt von Frau K. So angenehm und erfreulich, alle lächeln höflich, niemand furzt oder popelt in der Nase. Aber darunter fließt ein dunkler, reißender Strom.«
»Was für ein Strom?«
»Der Strom der Lust.«
6Der Sohn von Halifax Rief
»Ich bin im Foyer des Majestic Theatre an der Strand. Ich bewege mich durch einen Pulk elegant gekleideter Damen – jüngere und ältere. Sie plaudern und tratschen, ab und an wirft mir eine von ihnen einen Blick zu. Die Damen schenken mir nicht die geringste Beachtung – obwohl ich splitternackt bin.«
Lysander hielt inne. Gerade las er Dr. Bensimon aus seinen Autobiographischen Untersuchungen vor.
»Jaaaa …«, sagte Dr. Bensimon bedächtig. »Das ist interessant. Haben Sie das gestern Nacht geträumt?«
»Ja. Ich habe es umgehend aufgeschrieben.«
»Aber was hat es mit dem Theater auf sich?«
»Das liegt auf der Hand«, sagte Lysander. »Es wäre noch viel interessanter, wenn es sich nicht um ein Theater handeln würde.«
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Ich bin Schauspieler«, erklärte Lysander.
»Von Beruf?«
»Ich verdiene meinen Lebensunterhalt auf der Bühne, meistens im Londoner West End.«
Er hörte Bensimon aufstehen und das Zimmer durchqueren, um sich am Fußende des Diwans zu setzen. Lysander drehte sich im Sessel zur Seite – Bensimon musterte ihn aufmerksam.
»Rief«, sagte er. »Der Name kam mir gleich so bekannt vor. Sind Sie zufällig mit Halifax Rief verwandt?«
»Er war mein Vater.«
»Mein Gott!« Bensimon schien aufrichtig überrascht. »Ich habe ihn als King Lear gesehen, im … Wo war das noch mal?«
»Im Apollo.«
»Stimmt, im Apollo … Er ist doch gestorben, nicht wahr? Mitten in der Spielzeit.«
»’99. Ich war dreizehn.«
»Gütiger Himmel. Sie sind der Sohn von Halifax Rief. Nicht zu fassen.« Bensimon starrte Lysander an, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Ich meine, eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Und Sie sind auch noch Schauspieler.«
»Nicht so erfolgreich wie mein Vater – aber ich kann ganz gut davon leben.«
»Ich liebe das Theater. In welchem Stück haben Sie zuletzt mitgespielt?«
»Ein romantisches Ultimatum.«
»Sagt mir nichts.«
»Eine Salonkomödie von Kendrick Balston – wurde nach vier Monaten Laufzeit im Shaftesbury abgesetzt. Dann bin ich gleich hierhergekommen.«
»Gütiger Himmel …«, wiederholte Bensimon und nickte unmerklich, als hätte er gerade eine Offenbarung erlebt. Er ging zu seinem Schreibtisch zurück, und Lysander betrachtete das silberne Flachrelief. Allmählich hatte er das Gefühl, es in- und auswendig zu kennen, obwohl das erst seine zweite Sitzung bei Bensimon war.
»Sie stehen also nackt im Foyer des Majestic. Sind Sie erregt?«
»Offenbar fühle ich mich dort ganz wohl. Ich schäme mich nicht, vor diesen Leuten nackt zu sein. Es ist mir nicht peinlich.«
»Niemand lacht oder kichert, niemand zeigt mit dem Finger auf Sie oder verspottet Sie?«
»Nein. Die anderen scheinen das völlig normal zu finden. Wenn es überhaupt eine Reaktion gibt, dann höchstens vage Neugier. Sie blicken mich flüchtig an und setzen ihr Gespräch fort.«
»Erntet Ihr Penis auch ›flüchtige Blicke‹?«
»Wenn Sie mich so fragen, ja. Tatsächlich.«
Daraufhin setzte Stille ein. Lysander schloss die Augen, er konnte das Kratzen von Bensimons Füller hören. Um zwischendurch auf andere Gedanken zu kommen, besann er sich auf die Freuden des vergangenen Wochenendes. Er hatte den Zug nach Puchberg genommen und dort die Nacht im Bahnhofshotel verbracht. Dann war er mit der Zahnradbahn auf den Hochschneeberg gefahren und den ganzen Weg zum Alpengipfel hin- und wieder zurückgelaufen (seine Wanderstiefel hatte er mitgebracht). Wie immer, wenn er in den Bergen oder auf dem Land wandern ging, fielen alle Sorgen und Bedenken von ihm ab. Vielleicht war das der beste Grund gewesen, nach Österreich zu fahren, dachte er – neue Wege, neue Landschaften. Am Wochenende konnte er immer den Zug nehmen und in den Bergen wandern, um den Kopf freizubekommen, seine Probleme zu vergessen. Die Wanderkur …
»Träumen Sie das häufiger?«, fragte Bensimon.
»Ja. Mit kleinen Abweichungen. Manchmal sind weniger Leute da.«
»Aber Sie stehen im Vordergrund – nackt, inmitten vollständig bekleideter Frauen.«
»Ja. Allerdings nicht immer im Theater.«
»Warum träumen Sie das, was glauben Sie?«
»Eigentlich hatte ich gehofft, Sie würden mir das verraten.«
»Lassen Sie uns beim nächsten Mal fortfahren.« Mit diesen Worten beendete Bensimon die Sitzung. Lysander stand auf und streckte sich – es war anstrengend, sich derart konzentrieren zu müssen.
»Schreiben Sie weiterhin alles auf«, sagte Bensimon, als er ihn zur Tür brachte. »Wir machen Fortschritte.« Er schüttelte ihm die Hand.
»Bis nächsten Mittwoch«, sagte Lysander.
»Der Sohn von Halifax Rief, wer hätte das gedacht.«
Lysander saß im Café Central, trank einen Kapuziner und dachte an seinen Vater. Sein Versuch, ihn heraufzubeschwören, scheiterte wieder einmal. Er hatte nur das Bild eines großen massigen Mannes vor sich, dazu ein feistes vierschrötiges Gesicht, von dickem ergrautem Haar gekrönt. Die berühmte Stimme hatte er natürlich noch im Ohr, den klangvollen grollenden Bass, aber was ihm vor allem in Erinnerung geblieben war, war der Geruch seines Vaters – der Duft der Brillantine, die er sich in die Haare rieb und sein Barbier eigens für ihn zubereitete. Ein beißender Hauch von Lavendel als anfängliche Note, unterlegt vom reichhaltigeren Aroma des Lorbeers. Ziemlich stark parfümiert, mein Vater, dachte Lysander. Und dann starb er.
Lysander sah sich im weitläufigen Café mit den hohen Decken und der Glaskuppel um. Es war ruhig. Ein paar Zeitung lesende Gäste, eine Mutter, die mit ihren zwei kleinen Töchtern den Kuchenwagen in Augenschein nahm. Die Sonne fiel schräg durch die großen Fenster und ließ die rubinroten und bernsteingelben Buntglasrauten aufleuchten. Lysander winkte dem Kellner und bestellte einen Cognac, er wollte die beschauliche Stimmung noch ein wenig auskosten. Als ihm der Cognac serviert wurde, kippte er ihn in den Kapuziner und zog Blanches Brief hervor. Ihr erster, seit er nach Wien gekommen war – er hatte ihr vier Mal geschrieben … Er strich die Blätter glatt. Königsblaue Tinte, ihre schwungvolle zackige Handschrift, die sich über die ganze Seite erstreckte, bis zum Rand.
Liebster Lysander,
Du bist mir sicher böse, aber ich vermisse Dich wirklich sehr, und ich wollte Dir auch die ganze Zeit schreiben, aber Du kennst mich, und Du weißt ja, wie furchtbar hektisch es hier zugeht. Wir haben die Probelesung von »June in Flammen« abgehalten, aber es ist wohl nicht so gut gelaufen, zwei Tage später mussten wir wieder geschlossen antreten. Für mich ist das eine wunderbare Rolle, und es kommt auch ein junger Gardeoffizier vor, für den Du in meinen Augen die Idealbesetzung wärst. Soll ich unserem guten Manley sagen, dass es Dich interessiert? Er würde mir einfach jeden Wunsch erfüllen, der liebe alte Narr. Aber dann müsstest Du schleunigst nach Hause zurückkommen, mein Schatz. Es wäre zu schön, wieder mit Dir zu arbeiten. Schlägt Deine mysteriöse Kur an? Dauert sie noch lange? Nimmst Du Salzbäder und duschst kalt und trinkst Eselsmilch und all das Zeug? Wenn mich Leute fragen, sage ich, dass Du »unpässlich« bist, und dann antworten sie »Ach. Ja. Verstehe«, und hasten mit todernster Miene davon. Morgen fahre ich nach Boreham Wood, um »kinematographische Testaufnahmen« machen zu lassen. Dougie meint, ich hätte genau das richtige Gesicht fürs »Kintopp«, wir werden ja sehen. Von Deiner Mutter habe ich eine reizende Nachricht bekommen, sie wollte wissen, ob wir schon einen Termin für den »großen Tag« ins Auge gefasst haben. Lass es Dir bitte durch den Kopf gehen, Liebling. Ich zeige allen meinen Ring, und dann fragen sie »Wann?«, und ich lache – glockenhell, Du weißt schon – und sage, dass wir es nicht so eilig haben. Aber ich habe tatsächlich an eine Winterhochzeit gedacht, das wäre mal etwas Besonderes. Ich könnte in Pelz gehen –
Er faltete den Brief und steckte ihn mit einem Gefühl leichten Unwohlseins wieder ein. Ihm war, als hörte er ihre Stimme, sie erinnerte ihn an das, was ihn nach Wien geführt hatte, konfrontierte ihn mit den Auswirkungen seines speziellen Problems. Unter diesen Umständen konnte er Blanche wohl kaum heiraten. Man stelle sich nur die Hochzeitsnacht vor …
Er zündete sich eine Zigarette an. Blanche hatte vor ihm schon mehrere Liebhaber gehabt, wie er wusste. Sie hatte ihn quasi eingeladen, das Bett mit ihr zu teilen, aber er hatte darauf beharrt, den Anstand zu wahren – nun waren sie offiziell verlobt. Er zog sein Notizbuch aus der Tasche und rechnete schnell nach. Sein letzter Versuch, geschlechtlich mit einer Frau zu verkehren, war mit dieser jungen Dirne gewesen, die er in Piccadilly aufgegabelt hatte. Er rechnete zurück: vor drei Monaten und zehn Tagen. Kurz nachdem er Blanche den Heiratsantrag gemacht hatte, und auch nur als ein notwendiges Experiment. Er erinnerte sich an das muffige kleine Zimmer in der Dover Street, eine einzige Gaslampe, einigermaßen saubere Laken auf dem schmalen Bett. Das Mädchen war eigentlich recht hübsch gewesen, auf eine grelle Art, denn sie war stark geschminkt, aber wenn sie lächelte, kam ein schwarzer Zahn zum Vorschein. Es fing gut an, doch dann stellte sich das Unvermeidliche ein. Nichts. Wir können es noch mal versuchen, hatte das Mädchen gesagt, als er ihr Geld gab, ist ja nichts passiert, und das zählt nicht so richtig, oder? Aber bezahlen müssen Sie trotzdem – knallen tut auch die Platzpatrone.
Lysander bequemte sich zu einem bitteren Lächeln – das hatte sie vermutlich von einem Soldaten-Freier aufgeschnappt und nicht wieder vergessen. Er drückte seine Zigarette aus. Vielleicht sollte er Bensimon erzählen, dass er mit Blanche Blondel verlobt war – das könnte ihn ähnlich beeindrucken wie Halifax Rief.
Er zahlte – dachte daran, den Hut aufzusetzen – und trat in den warmen sonnigen Nachmittag hinaus; er blieb auf den Kaffeehausstufen stehen, überlegte, ob er zu Fuß in die Pension Kriwanek zurückkehren, unter Umständen das Abendessen schwänzen sollte, fragte sich außerdem, wohin er am nächsten Wochenende fahren könnte – Baden vielleicht, oder sogar Salzburg, eine kleine Reise unternehmen, nach Tirol –
»Mr Rief?«
Lysander zuckte unwillkürlich zusammen. Ein hochgewachsener Mann, hageres strenges Gesicht, makelloser dunkler Schnurrbart.
»Wollte Sie nicht erschrecken. Wie geht’s? Alwyn Munro.«
»Tut mir leid – ich war in Gedanken gerade woanders.« Er gab ihm die Hand. »Natürlich! Wir sind uns in Dr. Bensimons Praxis begegnet. Welch ein Zufall«, sagte Lysander.
»Im Café Central treffen Sie früher oder später alle, die sich in Wien tummeln«, erwiderte Munro. »Wie gefällt es Ihnen hier?«
Lysander war nicht nach belangloser Konversation zumute.
»Sind Sie Patient bei Dr. Bensimon?«, fragte er.
»Bei John? Nein. Wir sind befreundet. Haben zusammen studiert. Manchmal löchre ich ihn mit Fragen. Ist ein kluger Mann.« Munro merkte offenbar, dass Lysander das Gespräch nicht unbedingt fortsetzen wollte. »Sie haben es sicher eilig. Gehen Sie ruhig.« Er angelte eine Visitenkarte aus seiner Tasche und überreichte sie ihm. »Ich bin hier an der Botschaft tätig, falls Sie mich mal brauchen sollten. Hat mich gefreut.«
Er tippte mit dem Zeigefinger an die Melonenkrempe und ging in das Café hinein.
Lysander schlenderte zur Mariahilfer Straße zurück, die Sonne genießend. Er zog die Jacke aus und warf sie sich über die Schulter. Tirol, ja, dachte er – richtige Berge. Er wollte gerade den Opernring überqueren, als er ein weiteres zerfetztes Plakat erblickte. Bei diesem hatte das Ungeheuer seinen Kopf behalten – eine wüste Mischung aus Drache und Krokodil –, und der Name des Komponisten war vollständig: Gottlieb Toller. Lysander fiel ein, dass er Herrn Barth nach diesem Toller fragen könnte. Er hörte eine Kapelle, sie spielte die militärisch angehauchte Version eines Strauss’schen Walzers, und er passte seinen Schritt dem Takt der Trommelschläge an. Dabei dachte er an Blanches schönes längliches Gesicht, ihre dünnen knochigen Handgelenke mit den klirrenden Armreifen, ihre hohe schmale Gestalt. Er liebte sie wirklich, dachte er, darum wollte er sie heiraten – nicht, um den Schein zu wahren oder den Konventionen zu genügen. Um ihretwillen musste er sich bemühen, wieder gesund zu werden, ein normaler Mann, der mit einer wundervollen Frau eine glückliche Ehe führen konnte.
Er überquerte den Ring mit aller gebotenen Vorsicht, unterdessen stimmte die Kapelle eine Art Schnellmarsch oder Polka an. Der Rhythmus beflügelte ihn, als er die Mariahilfer Straße entlangbummelte, hinter ihm wurde die Musik immer leiser, ging im Verkehrslärm unter, während die Kapelle in Richtung Kaserne zurückmarschierte, sie hatte ihre Pflicht erfüllt und die biederen Wiener Bürger ein Stündchen lang bespaßt. Lysander spürte die Sonne auf seinen Schultern brennen, eine Fülle seltsam widersprüchlicher Gefühle befiel ihn – Stolz darüber, dass er sich aus freien Stücken für eine Therapie entschieden hatte, Genuss am Bummel durch die inzwischen vertrauten Straßen dieser fremden Stadt, beides unterlegt von einer verhaltenen melancholischen Freude, weil Blanche mit den allwissenden, verständnisvollen Augen weit, weit weg war.
7Die primäre Sucht
»Wie ist es beim Masturbieren?«, fragte Bensimon.
»Da klappt es fast immer. In neun von zehn Fällen, würde ich sagen. Das ist nicht das Problem.«
»Aha. Die primäre Sucht.«
»Wie bitte?«
»Ein Ausdruck von Dr. Freud …« Bensimon hielt den Füller bereit. »Was stimuliert Sie?«
»Es kommt darauf an.« Lysander räusperte sich. »Ich denke meist an Personen – Frauen –, die ich früher begehrt habe, und dann stelle ich mir eine –« Er verstummte. Nun erkannte er, wie hilfreich es war, dass er seinem Gesprächspartner nicht gegenübersaß. »Ich stelle mir eine Situation vor, bei der alles nach Wunsch verläuft.«
»Natürlich rein hypothetisch. Die Hypothese einer perfekten Welt. Die Wirklichkeit ist weitaus komplizierter.«
»Ja, mir ist schon bewusst, dass das reine Phantasie ist.« Lysander versuchte, seine Gereiztheit nicht anklingen zu lassen. Bensimon nahm das Gesagte manchmal allzu wörtlich.
»Aber das ist durchaus von Nutzen«, sagte Bensimon. »Ist Ihnen ›Parallelismus‹ ein Begriff?«
»Nein. Ist das schlimm?«
»Keineswegs. Es handelt sich um eine Theorie, die ich selbst entwickelt habe, gewissermaßen als Ergänzung zum zentralen Ansatz von Dr. Freuds Psychoanalyse. Vielleicht kommen wir später einmal darauf zurück.«
Stille. Lysander hörte Dr. Bensimons Plopplaute. Ploppploppplopp machten seine Lippen. Nervtötend.
»Lebt Ihre Mutter noch?«
»Sie erfreut sich bester Gesundheit.«
»Erzählen Sie mir mehr. Wie alt ist sie?«
»Neunundvierzig.«
»Beschreiben Sie Ihre Mutter.«
»Sie ist Österreicherin. Spricht fließend Englisch, praktisch akzentfrei. Sie ist sehr elegant. Immer auf der Höhe der Zeit.«
»Ist sie schön?«
»Ich denke schon. Als junge Frau war sie sehr schön. Ich habe Fotos gesehen.«
»Wie heißt sie?«
»Anneliese. Meistens wird sie Anna gerufen.«
»Mrs Anneliese Rief.«
»Nein. Lady Faulkner. Nach dem Tod meines Vaters hat sie einen Lord Faulkner geheiratet.«
»Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Stiefvater?«
»Sehr gut. Crickmay Faulkner ist älter als meine Mutter – deutlich älter. Er ist über siebzig.«
»Aha.« Lysander hörte den Füller kratzen.
»Denken Sie auch in sexueller Hinsicht an Ihre Mutter?«
Lysander unterdrückte ein müdes Stöhnen. Er hatte wirklich Besseres von Bensimon erwartet.
»Nein«, sagte er. »Bestimmt nicht. Nie. Niemals.«
8Ein schneidiger Kavallerieoffizier
Lysander staunte, als er Wolfram sah. In voller militärischer Uniform stand er in der Diele, sein Säbel schleifte am Boden, den Tschako trug er unterm Arm, die schwarzen Stiefel waren gespornt und mit Knieschonern versehen. Er wirkte ungeheuer imposant.
»Großer Gott«, rief Lysander bewundernd aus. »Steht eine Parade an?«
»Nein«, sagte Wolfram ein wenig bedrückt. »Heute findet meine Gerichtsverhandlung statt.«
Lysander betrachtete ihn von allen Seiten. Die Uniform war schwarz mit schwerem goldenem Schnurbesatz, der sich schlangenartig über die Brust zog. Eine Überjacke aus Pelz war über die Dolmanschulter gehängt. Der Tschako war passend zu den roten Kragenspiegeln und Hosentressen mit einer roten Feder geschmückt.
»Dragoner?«, mutmaßte Lysander.
»Husar. Hast du vielleicht etwas zu trinken da? Etwas Hochprozentiges? Ich gestehe, dass ich leicht nervös bin.«
»Ich kann dir Scotch anbieten, wenn du magst.«
»Perfekt.«
Wolfram folgte ihm in sein Zimmer und setzte sich mit rasselndem Säbel. Lysander schenkte den Whisky in einen Zahnputzbecher ein, den Wolfram in einem Zug leerte und ihm sogleich zum Nachfüllen hinhielt.
»Sehr guter Tropfen – finde ich.«
»Du kannst doch nicht mit einer Whiskyfahne vor Gericht erscheinen.«
»Zuvor rauche ich noch eine Zigarre.«