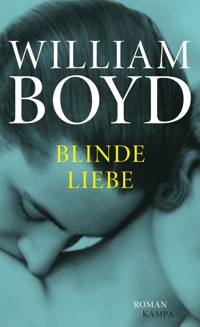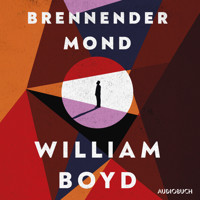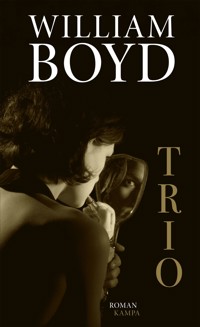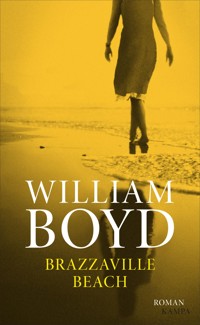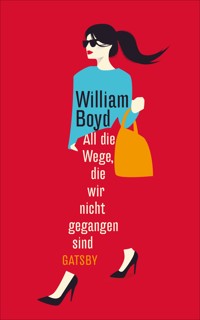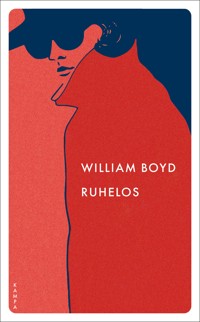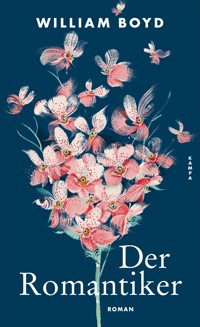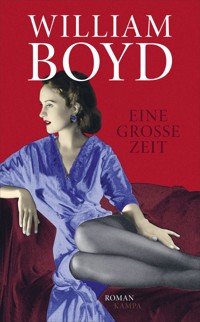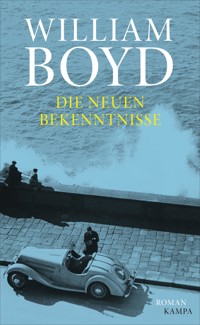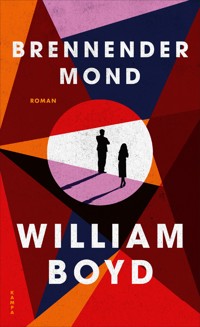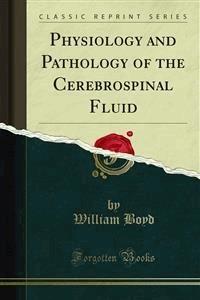Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 1914, in Deutsch- und Britisch-Ostafrika gehen Deutsche und Engländer in dieselben Bars. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus, hält Einzug in den Alltag, und aus Freunden werden Feinde. Der Krieg verändert das Leben aller: Der Amerikaner Temple Smith verliert von einem Tag auf den anderen seine Farm an einen Nachbarn und schwört Rache. Gabriel und Felix Cobb stammen aus einer alten britischen Offiziersfamilie. Während Gabriel pflichtbewusst in den Krieg zieht, will Felix in Oxford bleiben, doch die Wirren des Krieges holen auch ihn ein. Alle Beteiligten versuchen einen Sinn in die Kampfhandlungen hinein- zulesen - vergeblich. Ein tragikomischer Antikriegsroman vor der exotischen Kulisse Ostafrikas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Wie Schnee in der Sonne
Roman
Aus dem Englischen von Hermann Stiehl
Kampa
Für Susan
»… er eilte verzweifelt dahin, und die Inseln schlüpften und glitten unter seinen Füßen fort, die Meerengen taten sich auf und wurden weiter, bis er sich völlig in der vierten Dimension der Welt verloren sah, ohne Hoffnung auf eine Wiederkehr. Und doch konnte er, gar nicht so weit entfernt, die alte Welt sehen mit den Flüssen und Bergketten gemäß den Sandhurst-Regeln der Kartographie.«
Rudyard Kipling, The Brushwood Boy
Prolog
Ein Brief von Francis Harold Burgess, East African Railway Volunteer Force, an seine Schwester, Mrs Arthur Lamont.
Nairobi, Britisch-Ostafrika
10. Oktober 1914
Liebe Cecily,
… Wir sind hier alle in Sicherheit in dem gegenwärtigen schrecklichen Durcheinander. Freilich, als der Krieg erklärt wurde, da hätte man uns im Schlaf überraschen können, wenn die »Quadratköpfe« in Deutsch-Ostafrika sogleich einmarschiert wären.
Ich kann Dir ja jetzt schon das große Geheimnis verraten, da Du doch schon alles weißt, wenn Dich dieser Brief erreicht: Wir werden Deutsch-Ostafrika einnehmen. Acht Bataillone kommen samt Artillerie aus Indien herüber und gehen wahrscheinlich bei Voi zum Angriff vor.
Irgendwie ist es aber doch zum Lachen. Da springen sich alle Völker Europas an die Kehle, während wir hier in aller Ruhe die dem gemeinsamen Feind gehörenden Kolonien einheimsen. Man wird grässlich blutrünstig in diesen Zeiten und wünscht, ganz Deutschland könnte ausgelöscht und nur ein paar Exemplare könnten gerettet werden, so wie nach Sodom und Gomorrha. Ich wollte, die britische Flotte könnte die deutsche auf den Meeresgrund befördern.
Solange meine Erinnerung zurückreicht, gibt es noch einen anderen Burgess hierzulande (der Teufel soll ihn holen). Er ist Lieutenant bei einem der indischen Regimenter, bei den 29. Punjabis, glaube ich. Ich empfinde ihn als Störenfried, denn ich bekomme ständig Briefe für ihn, obwohl sie an Lieutenant Burgess adressiert sind. Militärische Titel gibt es hier zurzeit so häufig wie Sand am Meer. Sogar der gute alte Stordy ist Lieutenant Colonel und spaziert in Stabsuniform herum, ist aber nach wie vor ein grässliches Ekel. Lt. Col. Stordy sagt, der Krieg hier dauert nur zwei Monate. Es ist viel zu heiß für ausgedehnte Kampfhandlungen, sagt er, wir werden alle schmelzen wie Eis in der Sonne!
Dein Dich liebender Bruder
P.H. Burgess
PS: Ich vergaß Dir mitzuteilen, dass es mir Gott sei Dank gut geht. Auch findest Du eine sehr nützliche Karte von Britisch-Ostafrika im Jahresbericht der Uganda Railway, von dem ich eine Kopie in der Bibliothek zurückgelassen habe.
IVor dem Krieg
1
6. Juni 1914
Daressalam, Deutsch-Ostafrika
»Was würde wohl passieren«, fragte Colonel Theodore Roosevelt seinen Sohn Kermit, »wenn ich einem Elefanten in die Eier ballerte?«
»Vater«, sagte Kermit, ohne die Miene zu verziehen, »es würde bestimmt sehr wehtun.«
Der Colonel lachte schallend.
Temple Smith, der das Ausladen der Pferde und der Ausrüstung überwachte, lächelte über diesen Wortwechsel. Der Colonel und sein Sohn saßen auf der Bank über dem Schienenräumer ganz vorn an der Spitze des Zuges. Temple konnte sie nicht sehen, aber er hörte sie so deutlich sprechen, als stünden sie neben ihm. Es musste, so sagte er sich, irgendwie mit der Atmosphäre zusammenhängen, mit der Stille und Trockenheit der Luft.
Der Zug hatte mitten auf einer weiten afrikanischen Ebene angehalten. Ein hoher Himmel, ein paar müßige Wolken. Hohes gelbes Gras, da und dort unterbrochen von Dornbäumen und Felsbrocken, erstreckte sich bis hin zu einem purpurroten Berghorizont, Mr Loring, der Naturforscher, glaubte einen männlichen Springbock von einer Spezies gesehen zu haben, welche die Jagdgesellschaft noch nicht erlegt hatte, und so war ein Halt angeordnet worden.
Temple wies die somalischen Stallburschen an, vier Araberponys zu satteln. Die Roosevelts, der weiße Jäger Mr Tarlton und der Naturforscher, Mr Loring, würden losreiten und sich auf die Suche nach dem Tier machen. Die Seitenwand der langen Pferdebox wurde zum Boden heruntergelassen und das erste der kleinen Ponys herausgeführt. Es tänzelte vorsichtig umher, als prüfe es den Boden, und schnickte verärgert Kopf und Ohren nach den Schwärmen von summenden Fliegen, die es belästigten.
Temple nahm den Tropenhelm ab und wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die Hitze knallte auf den in der Sonne stehenden Zug herunter, und nicht die leiseste Brise rührte die weite Graslandschaft auf.
Er hörte, wiederum erstaunlich deutlich, wie Colonel Roosevelt knurrte, als er von dem Schienenräumer herunterkletterte, sich streckte und über die Gleisschwellen stapfte. Er schien ihn fast wie in einer Vision vor sich zu sehen. Die untersetzte und zerknautscht wirkende Gestalt trug eine bauschige Militärbluse, schlecht sitzende kakifarbene Reithosen, die von den Knien bis zu den Knöcheln zugeknöpft waren und am Gesäß herunterhingen, und schwere Stiefel. Er sah das bebrillte Onkelgesicht mit dem herabhängenden Walrossschnauzbart in die grelle Sonne blinzeln. Der Colonel schlug mit den Armen Räder und ließ die Fingerknöchel knacken. »Guter Tag zum Jagen«, sagte er und ging steifen Schrittes ein paar Meter die Bahnstrecke entlang.
Doch dann sah Temple auf wundersame Weise plötzlich zu Kermit hinüber. Er sah Kermits schönes schmales, von einem leichten Lächeln überzogenes Gesicht. Sah ihn nach seiner doppelläufigen Rigby-Schrotflinte greifen. Hörte das geölte Klicken, als die Zwillingshähne gespannt wurden. Sah, wie sich der Doppellauf langsam hob und auf den Rücken des Colonels zeigte.
»Nein!«, sagte Temple entsetzt zu sich selbst und ließ die Zügel des Ponys fallen, die er gerade in der Hand hielt. Er drehte sich jäh herum und blickte den Zug entlang nach vorn zur Lokomotive. Ja, da stand der Colonel auf dem Gleis, etwa fünfzehn Meter vor der Lokomotive und dieser den Rücken zukehrend, und starrte in die Landschaft hinaus. Aber Temple sah Kermit nicht. Noch im ersten Erstaunen über seine hellseherische Vision ahnte er, dass sie ihm eingegeben worden war, um die Ermordung dieses hochgeschätzten militärischen Helden und ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu verhindern.
»Nein!«, rief Temple abermals, wodurch er die erstaunten Blicke Mr Lorings und der schwarzen Pferdeburschen auf sich zog. »Nein, Mr Roosevelt – um Gottes willen, tun Sie’s nicht!«
Er rannte los zur Lokomotive, rutschte jedoch ständig auf der Erde und den Steinen des Bahndamms aus. Wieder sah er in einer kurzen hellseherischen Vision, wie Kermit auf eine Stelle zwischen den Schulterblättern seines Vaters zielte und wie sein Zeigefinger weiß wurde, als er den Abzug zu drücken begann.
»Nein!«, schrie Temple. »Nein! Er ist doch Ihr Vater, um Gottes willen!«
Bumm!, dröhnte der Doppellauf. Die Bluse des Colonels zerplatzte in einem Gespritz von Blut und zerrissenem Kakistoff, als die Schrotladung den Mann vornüber zu Boden warf.
Temple schlug das Moskitonetz hoch und setzte sich auf den Bettrand. Dann stand er auf und streckte sich. Er war nackt. Er rieb sich Schultern und Brust, klatschte sich auf die Hinterbacken und fasste sich ans Glied.
Temple war Anfang vierzig, klein und untersetzt, etwa eins siebzig groß und hatte eine breite Brust und kräftige, muskulöse Beine. Seine einst kompakte Statur war noch unter dem Speck zu erkennen, den sie inzwischen mit sich herumtragen musste. Er hatte einen beträchtlichen Bauch, und auf seinem Rücken führten zwei Fleischfalten vom Genick bis in die Nierengegend hinunter. Die Brust und die breiten Schultern bedeckte dichtes, drahtiges, ins Graue spielendes Haar. Die Form seines Unterkiefers war seit Langem in einem seiner Kinne untergegangen. Das Pfeffer-und-Salz-farbene Haar war kurz geschoren und in der Mitte gescheitelt, und er hatte einen buschigen, herabhängenden Schnurrbart auf der Oberlippe. Dieser Schnurrbart war ein so auffälliges Kennzeichen, dass man sich oft nur seinetwegen an ihn erinnerte. Seine Nase war klein, fast eine Stupsnase, und die Augen blickten blass und unschuldig.
Er trat ans Fenster und öffnete die Läden ein wenig. Von seinem Zimmer im obersten Geschoss des Hotel Kaiserhof aus hatte er einen guten Blick über Daressalams geräumigen natürlichen Hafen. Dort, etwa eine Viertelmeile vor der Küste, lag der Kreuzer Königsberg vor Anker. Seine 4,1-Zoll-Geschütze feuerten gerade die letzten Salutschüsse ab. Am Kai drängten sich Zuschauer, und Fahnenschmuck flatterte von allen Telefonstangen, Fenstersimsen und Balkonen. Mit Beckenklängen stimmte die Kapelle der Schutztruppe die deutsche Nationalhymne an, und ihr Kommandeur, Oberst Paul von Lettow-Vorbeck, schritt die Ehrenwache ab.
Temple wandte sich lächelnd ab und dachte an seinen Traum. Seit Jahren hatte er nicht mehr von Roosevelt geträumt. Er gähnte. Eigentlich sollte er dem alten Knacker sogar dankbar sein. Denn schließlich wäre er ohne Roosevelt nie nach Afrika gekommen. Im Jahr 1909 hatte Temple als Geschäftsführer einer kleinen Eisengießerei in Sturgis, South Dakota, einen Punkt in seinem Leben erreicht, der außer Langeweile keine weiteren Aussichten mehr bot. Da hatte er eine Anzeige der Smithsonian Institution gelesen, die jemanden suchte, der einen Jagdausflug nebst Beutetransport in Afrika organisieren konnte. Er hatte sich beworben, den Posten bekommen und sich zwei Monate später mit den Roosevelts und ihren Tonnen von Gepäck auf den Weg gemacht. Es hatte nicht lange gedauert. Die Roosevelts schossen alles, was sich bewegte. Bekümmert über die große Zahl verstümmelter und angeschossener Tiere, die auf ihrem Weg zurückblieben, hatte Temple sehr vorsichtig protestiert. Worauf Kermit ihn prompt entlassen hatte.
Temple kniff das Gesicht zusammen. Der alte Herr war in Ordnung. Kermit war es, mit dem er nie auskam. Doch als das Buch des Colonels – African Game Trails – erschien, wurde Temple mit keinem einzigen Wort darin erwähnt. Eine Art Bestrafung, nahm er an. Er fragte sich, ob sich wohl irgendein Leser Gedanken darüber machte, wie die große Jagdgesellschaft mit allem Drum und Dran von Punkt A nach Punkt B gelangt war und wie die Züge beladen und entladen worden waren. Doch er sagte sich: Ärgere dich nicht. Auf lange Sicht gesehen hatten die Roosevelts ihm einen Gefallen getan, und auf die lange Sicht kam es an, wenn man ihn fragte.
Temple erlaubte sich den Luxus eines Bades und schlüpfte dann in seine frisch gewaschenen Kleider. Der Kaiserhof war nach seiner Ansicht das beste Hotel in ganz Ostafrika. Besser als das Norfolk in Nairobi und das Grand in Mombasa. Heißes und kaltes fließendes Wasser, auf teutonische Tüchtigkeit gedrilltes Personal – und bis zu einem ausgezeichneten Brauereiausschank waren es nur für Minuten mit der Rikscha.
Nach dem Frühstück trat Temple auf die Arabstraße hinaus. Der Kaiserhof war eigentlich das Bahnhofshotel, erbaut einige Jahre zuvor beim Beginn des Baus der zentralen Eisenbahnlinie von Daressalam zum Tanganjikasee. Es war ein recht großes steinernes Gebäude, mit künstlichen Zinnen versehen, und stand an der Ecke Arabstraße und Bahnhofstraße. Hinter Temple lag die Hafenlagune mit ihrer jüngst errichteten Pier, den Hafenbüros und dem Zollschuppen. Vor ihm erstreckte sich das schwärende Inderviertel – abblätternde, in einem engen Gewirr von übel riechenden schmalen Gassen zusammengedrängte Lehmhütten. Wäre er der Arabstraße weiter nach Osten gefolgt, wäre er auf die Straße Unter den Akazien gestoßen, die Hauptgeschäftsstraße, wo deutsche Sauberkeit und Ordnung deutlicher zu erkennen waren. Unter den Akazien, eine schmale, von prunkvollen Bauten gesäumte Allee, führte zum eigentlichen Wohnviertel von Dar. Dort gab es viel Grün, breite Straßen, zwei- und dreigeschossige Häuser im Kolonialstil mit roten Ziegeldächern – und einen großen und schön angelegten Botanischen Garten.
Dieses letztgenannte Attribut der Stadt war es, das Temple nach Dar gelockt hatte – er wollte Kaffeesämlinge kaufen. Er hatte die Kaufverhandlungen mit dem für die Landwirtschaft der Kolonie zuständigen Beamten, dem Chef der Abteilung für Landeskultur und Landvermessung, wie der Titel lautete, ebenso rasch wie erfolgreich abgeschlossen. Zu einem angemessenen Preis wurden Kisten mit Kaffeesämlingen gefüllt, sodass er sie am nächsten Tag auf seine Farm schaffen konnte.
Die Rückreise zu Temples Farm, die am Fuß des Kilimandscharo in B.O.A., in Britisch-Ostafrika lag, dauerte lang. Da waren zunächst der Dampfer die Küste entlang von Dar nach Tanga, dann eine Tagesreise von Tanga nach Moshi auf der Nord-Eisenbahn und schließlich eine weitere Tagesreise im Wagen über die Grenze nach B.O.A. bis zu seiner Farm in der Nähe der kleinen Siedlung und früheren Missionsstation Taveta.
Er hatte das Geschäft am Tag zuvor erledigt und noch ein wenig Geld übrig, daher beschloss er, die fröhliche Stimmung zu genießen, die zurzeit die Stadt erfüllte. Die deutsche Kolonie blühte, die zentrale Bahnlinie war gerade fertiggestellt worden. Sie sollte offiziell im August eröffnet werden, und gleichzeitig sollte eine große Daressalam-Ausstellung stattfinden. Deshalb, so nahm Temple an, war auch die deutsche Flottille eingetroffen – die Königsberg, mehrere Zerstörer und Wachboote sowie ein Versorgungsschiff.
Temple machte kehrt und schritt die Bahnhofstraße hinunter, an dem prächtigen neuen Stationsgebäude vorüber und weiter zu den Docks hin. Eine nach mehreren Hunderten zählende Menge hatte sich dort eingefunden, um die Königsberg willkommen zu heißen und zu bewundern. In der Morgensonne stachen die schnittigen Linien des Schiffs und seine drei hohen Schornsteine deutlich hervor. Von allen Masten flatterten Flaggen, und die Besatzung hatte sich an Deck zur Parade aufgestellt.
Die Zuschauermenge war deutlich unterteilt. Zu beiden Seiten des Hafenamts drängten sich die Inder, die Araber und die Einheimischen. Vor den Amtsgebäuden, unter den bunt gestreiften Markisen, hatte sich die deutsche Kolonie versammelt. Am Kai stand eine makellos gekleidete Wache von Askaris in Positur. Ein junger weißer Offizier ließ sie gerade noch einige elementare Drillübungen vollziehen. Sie schienen so gut diszipliniert und ausgebildet wie nur alle anderen europäischen Truppen, die Temple je gesehen hatte. Die Kapelle der Schutztruppe ließ auf einem zu diesem Zweck errichteten Podium martialische Musik erklingen.
Temple blickte sich um. Alle hatten sich aufs Beste herausstaffiert. Die Frauen trugen weiße Kleider mit Spitzenbesatz und Sonnenschirme, die Männer Ausgehanzüge samt Krawatte und Hut. Temple schloss sich der Menge an und sah den Kommandanten der Königsberg an Land gehen. Von Lettow-Vorbeck, ein strammer Mann mit völlig kahl geschorenem Kopf, und der Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Herr Schnee, begrüßte ihn. Sie schritten zu einer überdachten Reihe von Stühlen, und es folgten einige Ansprachen. Der mit der deutschen Sprache kaum vertraute Temple verstand praktisch nichts und ging schließlich weiter.
In einiger Entfernung von der Königsberg hatte die Tabora von der Deutschen Ost-Afrika-Linie angelegt, das Schiff, das der Kreuzer auf der letzten Hälfte seiner Fahrt von Bremerhaven hierher begleitet hatte. Passagiere der Tabora gingen über eine Mole an Land. In der Nähe luden Trupps von Schwarzen Vorräte und eine große Zahl von Schrankkoffern und Gepäckstücken aus einem Leichter aus.
»Hello, Smith«, rief ihn da eine eigenartig hohe Stimme auf Englisch an.
Überrascht, inmitten von so viel Deutsch untadelig englische Laute zu vernehmen, wandte Temple sich um. Und noch überraschter war er, als er sah, dass die Stimme einem Offizier der deutschen Schutztruppe gehörte.
»Du liebe Güte!«, sagte Temple, wobei sein amerikanischer Akzent sich deutlich von dem des anderen abhob. »Erich von Bishop! Was machen denn Sie in dieser Montur? Ich dachte, Sie hätten die Uniform an den Nagel gehängt.«
Von Bishop war Temples Nachbar. Ihre Farmen lagen im Gebiet des Kilimandscharo, getrennt nur durch ein paar Meilen Land und die Grenze zwischen Deutsch- und Britisch-Ostafrika. Von Bishop war groß und schlank und hatte ein glatt rasiertes, melancholisch wirkendes Gesicht. Er hatte eine große, scharf geschnittene Nase und eine ungewöhnlich lange Oberlippe, die gewiss schuld daran war, dass er so bekümmert aussah. Er war einer jener Männer, die beinahe auf komische Weise hässlich wirkten: Die seltsamen Gesichtszüge hielten gerade eben noch zusammen. Das Überraschendste an ihm war seine Stimme. Sie klang jungenhaft hell und dünn, so voller Luftgeräusche, als könnte sie jeden Augenblick versagen. Sein Haupthaar war wie das seines Kommandeurs, von Lettow-Vorbeck, zu einem grauen Stoppelfeld geschoren, und er trug die weiße Uniform eines Hauptmanns der Schutztruppe mit einem Säbel an der Seite.
»Ich bin doch Reserveoffizier«, erklärte er Temple. »Alle sind zu den Festlichkeiten herbeizitiert worden, es gibt heute noch eine große Parade. Und außerdem erwarte ich meine Frau. Sie kommt aus Deutschland herüber.« Er deutete zum Hafen hin. »An Bord der Tabora.«
»Dann will ich Sie nicht länger aufhalten«, sagte Temple. Er war von Bishops Frau noch nicht begegnet, wusste aber, dass sie über ein Jahr fort gewesen war.
»Nein, bitte, bleiben Sie, Sie müssen sie kennenlernen«, sagte von Bishop. »Schließlich sind wir doch irgendwie Nachbarn.«
»Sehr schön«, sagte Temple. Er war tatsächlich ein bisschen neugierig. Er kannte von Bishop nicht sehr gut. Sie waren sich vielleicht viermal begegnet in den drei Jahren, die Temple jetzt seine Farm bewirtschaftete, aber er hatte sich doch genügend Vorstellungen über den Mann gebildet – er hielt ihn für sehr eigenartig –, um sich zu fragen, wie wohl seine Gattin aussah.
Von Bishop war Anfang fünfzig und, wie Temple wusste, halb deutscher und halb englischer Abstammung. Aus irgendeinem Grund hatte er in Kassel die deutsche Militärakademie besucht und war dann in den neunziger Jahren nach Ostafrika gekommen. Er hatte sich bei der Niederschlagung des schrecklichen Maji-Maji-Aufstands im Jahr 1907 ausgezeichnet und war für diese Verdienste mit dem Adelstitel ausgezeichnet worden. Er besaß eine große florierende Farm, auf der er Mais und Bananen anbaute.
Die beiden Männer näherten sich der Menge, die sich zur Begrüßung der aussteigenden Passagiere versammelt hatte. Temple sah, wie von Bishop sich gleichsam einen Ruck gab, als er eine Frau erkannte, die von dem Leichter die Stufen zum Landungssteg hinaufschritt. Sie trug ein einfaches, knöchellanges lichtblaues Kleid mit kleinen Rüschen an den langen Ärmeln. Ihr Gesicht wurde von einem breiten Strohhut überschattet. Temple erwartete, dass von Bishop ihr entgegenging, aber er rührte sich nicht von der Stelle.
»Aha«, sagte er leise. »Da ist sie.«
»Wer?«, fragte Temple. »Ist das Ihre Gattin?«
»Meine teure Gattin«, sagte er gefühlvoll. Er verschränkte die Hände vor dem Leib und blieb weiterhin stehen. Temple fragte sich, warum er nicht vortrat, um sie zu begrüßen.
»Ach ja«, sagte von Bishop, und sein Gesicht wirkte noch bekümmerter.
»Was ist?«
»Sie sieht … sie sieht anders aus. Wie soll ich mich ausdrücken? Sehr gesund. Ja, gesund und frisch.«
Auch die Frau schien es nicht sehr eilig zu haben. Sie trat vom Landungssteg herunter und sah sich in aller Ruhe um. Ab und zu griff sie in ihre Handtasche und steckte sich etwas in den Mund.
»Erich!« Sie hatte ihn gesehen und kam näher. Erst jetzt ging von Bishop auf sie zu. Er küsste sie höflich auf die Wange und wechselte ein paar Worte mit ihr auf Deutsch. Dann bot er seiner Frau den Arm und geleitete sie zu Temple hinüber.
»Das ist Mr Smith, unser Nachbar in Britisch-Ost. Mr Smith – meine Frau Liesl.«
»Guten Tag«, sagte Temple. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise.«
»O doch, sie war erträglich«, sagte sie langsam auf Englisch mit einem starken deutschen Akzent. »Es freut mich, Sie kennenzulernen.« Sie reichten sich die Hand. Beim Sprechen kam ein starker Pfefferminzgeruch aus ihrem Mund.
Sie war das, was Temple als eine wohlgestalte Frau bezeichnete, und sie war beträchtlich jünger als von Bishop, vielleicht Mitte dreißig. Wie ihr Mann war sie recht groß, mit breiten Schultern und einer kräftigen Busen- und Hüftpartie. Ihre Haut war cremefarben-blass, ihr Gesicht von Sommersprossen überzogen. Sie hatte einen breiten Mund, und ihre Oberlippe war so groß wie die Unterlippe – wenn nicht sogar etwas größer –, was ihr einen Ausdruck verlieh, als unterdrückte sie ständig irgendeine Bemerkung. Unter ihrem Hut hatten sich einige blonde Haarsträhnen selbstständig gemacht.
Von Bishop entfernte sich, um das Umladen ihres Gepäcks in eine Rikscha zu überwachen.
»Und was machen Sie in Dar?«, fragte Frau von Bishop unvermittelt.
»Oh, ich habe hier Kaffeesämlinge eingekauft«, erwiderte Temple. »In Britisch-Ost haben wir nichts, was Ihrem Botanischen Garten gleichkäme. Aber ich muss gestehen, ich wollte mir auch Dar ansehen und Ihre ausgezeichnete neue Eisenbahn.« Er fragte sich, warum er so gestelzt daherredete – es musste mit dem insgeheimen Tadel zu tun haben, den diese Frau ihrer Umgebung ohne Unterlass zukommen zu lassen schien.
»Sie sind kein Engländer?« Sie neigte ihren Kopf zur Seite, als hätte sie ihn bei einer Missetat ertappt.
»Nein, ich bin Amerikaner«, erwiderte Temple. »Ich bin 1909 mit Präsident Roosevelt bei seinem Jagdausflug herübergekommen und dann hier hängen geblieben.«
»Ach so.« Es entstand eine peinliche Pause. »Was macht Erich nur? Hätten Sie gern ein Pfefferminz?« Sie hielt Temple ein Tütchen hin.
»O ja, vielen Dank.« Er steckte sich das Bonbon in den Mund. So viel machte er sich gar nicht aus Pfefferminz.
»Gegen … mal de mer. Wie heißt das auf Englisch?«
»Entschuldigen Sie. Was ist Maldemär?« Zu Temples Überraschung ahmte Frau von Bishop unmissverständlich nach, wie jemand sich übergibt, einschließlich der dazugehörigen Geräusche.
»Sick«, sagte sie. »Krank – auf See.«
»O ja, sea-sick. Seekrank, ja, hmm.«
»Sea-sick?« Die simple Logik des Wortes schien sie zu stören. »Das ist für sea-sick. Pfefferminz.«
Temple nickte heftig, zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Wieder eine Pause. »Nun«, sagte Temple etwas unbeholfen, »wieder zurück zu sein, das ist doch gewiss schön –«
Sie schien etwas darauf antworten zu wollen, doch da trat ihr Mann wieder hinzu.
»Sie haben alles verladen«, verkündete von Bishop fröhlich, wobei er sich auf das Gepäck bezog. »Fahren wir los?«
Er und seine Frau stiegen in eine Rikscha.
»Wir sind Gäste des Gouverneurs«, sagte von Bishop. »Können wir Sie irgendwohin mitnehmen?«
»Nein, vielen Dank«, sagte Temple. »Ich sehe mir noch ein wenig das Glanz und Gloria an. Und dann beabsichtige ich, ein wenig Ihrem guten deutschen Bier zuzusprechen.«
»Natürlich – dann good-bye.«
»Good-bye, Mr Smith«, sagte Frau von Bishop in sehr endgültigem Ton. »War mir eine Freude, Sie kennenzulernen.«
»Good-bye«, sagte Temple und zog den Hut.
»Augenblick noch!«, quäkte von Bishop. »Wann reisen Sie nach Taveta zurück?«
»Na ja … morgen.«
»Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann können wir ja zusammen reisen. Also dann bis morgen, Smith.«
Während sie davonfuhren, sah Temple, wie Frau von Bishop heftig auf ihren Mann einredete. Ein seltsames Paar. Er verfolgte mit dem Blick die kleine Karawane von Rikschas – der, in der die von Bishops saßen, folgten noch drei weitere mit Gepäck –, die sich den sanft geschwungenen Bogen des Kais entlangbewegte, vorbei an der katholischen Kirche, am Postamt, am Europäer-Club und weiter zum Gouverneurspalast, der sich in seinem Hain von Palmen und Mangobäumen an der Mündung der Lagune verbarg. Er ließ den Blick über die von Menschen wimmelnde Flottille auf dem lichtblitzenden Wasser schweifen und bewegte sich dann durch die Menge auf die Rückseite der Hafenamtsgebäude zu. Dort rief er eine Rikscha herbei und stieg ein. Der halb nackte Afrikaner, der sie zog, blickte sich nach Anweisungen um.
»Zur Brauerei«, sagte Temple. Wenn er schon morgen mit den von Bishops zurückreisen musste, wollte er aus seinem letzten Tag in Dar noch das Beste machen.
Etliche Stunden später verließ Temple den Kaiserhof. Es ging jetzt schon auf halb elf zu, und der mondlose Himmel war voller Sterne. Gedankenlos wie immer nahm sein Blick die Konstellationen wahr: Orions Gürtel, den leicht verstreuten Rest des Sternbildes, den Großen Bären, Kassiopeia, die Venus. Die Straßen lagen dunkel und verlassen da. Licht fiel aus den Fenstern des Kaiserhofs, und aus dem Foyer drangen die Klänge eines Pianolas. Es war eine recht warme Nacht. Aus dem Labyrinth des Inderviertels wehten süßliche Gerüche herüber, und laute Rufe und Trommelschläge waren zu hören, so als würde irgendwo gefeiert. Temple schritt die Unter den Akazien ein Stück entlang. Er mochte das Inderviertel nicht allein zu Fuß betreten. Er sah eine Rikscha, rief sie zu sich und stieg ein. Er gab den Namen eines Hotels in der Marktstraße an. Der Rikschaboy zog ihn rasch durch die dunklen Gassen. Temple lehnte sich auf dem harten hölzernen Sitz zurück und genoss die leichte Brise.
»Hier, Bwana«, sagte der Rikschaboy. Temple stieg aus und entlohnt ihn. Kitumoinee Hotel stand da in verblassten Lettern über der Tür. Temple ging hinein. Petroleumlampen sorgten für ein einladendes, behagliches Licht. Man hörte gedämpftes Stimmengewirr. Etwa ein Dutzend Matrosen von der Königsberg saßen in dem großen Raum im Erdgeschoss an einigen Tischen. Ein paar Eisenbahner spielten Karten. In der einen Ecke befand sich eine kleine hölzerne Bartheke vor Regalen voller Flaschen mit Alkoholika. Hinter der Theke stand ein dunkelhäutiger Goaner.
»Bitte, mein Herr?«, sagte er, als Temple näher kam. Temple trat auf ihn zu und legte vorsichtig die Hände auf die Theke. Er schluckte.
»Guten Abend«, sagte er. »Do you speak English?«
Beim Klang der fremden Sprache drehten sich einige Matrosen um. Temple spürte, wie ihm in dem stickig heißen Raum die Kleider am Leib zu kleben begannen. Er fragte sich, warum er sich solche Mühe machte.
»Englisch?«, sagte der Goaner. »Nein.«
Scheiße. Temple unterdrückte einen Fluch. »Oben?«, sagte er, zur Decke hinauf deutend.
Der Goaner verstand und lächelte. »O ja«, sagte er. Dann deutete er auf die Matrosen. »Moment, ja?«
Temple setzte sich und trank zwei Glas Bier. Drei Matrosen kamen die Holztreppe vom Obergeschoss herunter und gesellten sich sogleich grinsend zu ihren Kameraden.
Temple rauchte eine Zigarette. Er versuchte, an nichts zu denken, und konzentrierte sich auf den Geschmack des Biers. Gutes Bier, sagte er sich, hier in der Stadt gebraut, ein besseres hatte er in Afrika noch nicht getrunken … Er sah sich in dem Lokal um. Für einen Schankraum ging es hier recht ruhig zu. Stimmengemurmel von den Tischen der Matrosen, Kartenklatschen vom Tisch der Eisenbahner, ab und zu ein Stuhlrücken auf dem gefliesten Fußboden. Es war, als seien alle bemüht, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten.
Noch zwei Matrosen kamen die Treppe herunter. Der goanische Wirt kam herüber und nahm ihm das Bierglas weg. Er lächelte und nickte Temple zu, wobei er zur Decke hinaufblickte. Temple erhob sich. Er wollte gerade zur Treppe hinübergehen, als der Wirt ihn am Ellenbogen fasste.
»Vier Rupien, bitte.« Temple zahlte.
Er stieg die Treppe hinauf und war sich plötzlich deutlich des Stampfens seiner Schuhe auf den Holzstufen bewusst. Im ersten Stock gab es drei Türen. Behutsam probierte er es an der ersten, doch die schien verschlossen zu sein. Als er gerade die zweite öffnen wollte, kam ein deutscher Matrose heraus. Temple trat zur Seite, und der Matrose ging vorbei. Er sagte etwas auf Deutsch zu Temple, was dieser aber nicht verstand. Temple lächelte dennoch vielsagend, zuckte die Achseln und kicherte leise – es war wohl eine dementsprechende Bemerkung gewesen. Temple probierte es an der dritten Tür, stieß sie auf und trat ein. Das Zimmer war klein und unmöbliert bis auf ein Bett mit Eisengestell. Ein Fenster ging zur Marktstraße hinaus. Die Läden waren leicht geöffnet, und eine einheimische Frau stand davor und sah auf die Straße hinunter. Auf einem Sims über dem Bett stand eine primitive Lampe, nur ein brennender Docht in einer Schale mit Öl.
Die Frau am Fenster kaute heftig an etwas. Sie trug ein grobes Baumwollkleid und hatte sich einen bunten gefransten Schal lose über die Schultern geschlungen. Mit den Zehen des rechten Fußes kratzte sie sich an der linken Wade.
Temple räusperte sich und schloss die Tür. Die Frau sah sich um.
»Abend«, sagte sie lustlos und ging zum Bett hinüber. Sie war, wie es Temple erschien, eine eigenartige Mischung von arabischem, indischem und schwarzem Blut. Ihr langes und drahtiges Haar hatte sie zu einem komplizierten Knoten geschlungen. Um den Hals trug sie Perlenketten und Bänder aus Metall. Ihre dünnen Arme zierte eine ganze Kollektion von Armbändern. Über dem Bett lag eine graue Decke. Temple trat näher. Er sah, dass ihr Haar stark eingeölt, ja, dass ihr ganzer Körper von einer dünnen, glänzenden Fettschicht bedeckt war. Dunkelblaue Tätowierungen hoben sich von der dunkelbraunen Haut ihrer Unterarme ab. In ihrer Nase steckte ein messingner Zierknopf von schlichter Blumenform. Ihr Mittelscheitel war mit einer rostfarbenen, ockerartigen Salbe eingetönt. Ein satter, merkwürdig mehliger Geruch ging von ihrem ganzen Körper aus. Temple fragte sich, wie viele Rassen, Kulte, Theologien und Gebräuche sich in dem kleinen Zimmer an diesem Abend wohl begegneten und welch kleinen Teil er zu dieser Mixtur beitragen würde.
Er blickte sich um und wurde sich plötzlich des Schmutzes bewusst, der sich hier angesammelt hatte. Er sah die mit Draht verstärkte Bettstatt, sah die Fliegen und Insekten, die um die Flamme herumschwirrten und herumkrabbelten. Er konnte sich gut vorstellen, dass die Bettdecke verwanzt war.
Er kratzte sich den Kopf. Er war zu seiner Zeit in wirklich primitiven Bordellen gewesen, doch dieses hier verdiente den ersten Preis. Trotzdem – jetzt war er hier, jetzt musste er auch weitermachen.
Die Frau faltete den Schal vorsichtig über dem Kopfende des Bettes zusammen. In einer einzigen fließenden Bewegung und mit einem Klirren von Geschmeide entledigte sie sich ihres Kleides. Sie trug jetzt nur noch ihre Schmuckkollektion. Weitere Perlenschnüre umspannten ihre Taille, wie Temple bemerkte. Man ging also sozusagen mit einer Tinneftheke in einem Zehn-Cent-Laden zu Bett. Er fragte sich, ob die Perlen vielleicht Talismane irgendwelcher Art waren.
Die Frau setzte sich und spreizte auf unschuldig aufreizende Art die Beine, weil sie sich die Reizstelle an der linken Wade näher ansehen wollte. Zu seiner Verärgerung wurde sich Temple bewusst, dass er sich übers Haar fuhr. Die Brüste der Frau hingen tief herunter und waren eigenartig spitz. Die Tätowierungen, die er an ihrem Unterarm wahrgenommen hatte, erstreckten sich über Teile ihres Oberkörpers.
Unglücklich schnallte er seinen Gürtel los und knöpfte die Hose auf. Er trug keine Unterhose, doch die Frau sah gar nicht zu ihm hin. Sie blickte erst auf, als er taumelte, weil er nicht aus der Hose herauskam. Er hatte, derart vom Exotischen überrumpelt, vergessen, die Schuhe auszuziehen.
»Moment«, sagte die Frau und schritt lässig zum Fenster, wobei ihre Brüste schwankten. Sie kaute heftig noch ein, zwei Sekunden und spie dann etwas in die Nacht hinaus. Es gab einen dumpfen Klatsch, als das, was es auch immer war, auf einem Blechdach darunter landete.
Das ist das Letzte, dachte Temple. Mein Gott, ist das deprimierend. Das war jetzt seine letzte Nacht, und er hatte sich doch amüsieren wollen.
Er zog die Hose wieder hoch.
»I’m sorry – entschuldigen Sie, Lady«, sagte er. »Ist nichts Persönliches, aber – good night.«
Während er hinausging, hörte er ihren Schmuck rasseln, als sie sich das Kleid wieder überstreifte: Es klang wie ein leises Lachen.
2
8. Juni 1914
Nordbahn, Deutsch-Ostafrika
Liesl von Bishop sah zu den hoch aufragenden grünen Höckern der Usambara-Berge hinüber, an denen der Zug auf seinem Weg nach Norden zur Endstation Moshi entlangzockelte. Ihr Blick nahm kaum das Wild wahr, Hirsche und Antilopen, das vom Bahndamm fortrannte. Sie spürte, wie eine große Langeweile sie erfasste. Die Luft im Abteil war heiß und stickig, obwohl alle Fenster geöffnet waren. Sie presste die Stirn ans warme Glas und rekelte sich auf dem glatten Lederpolster. Ihr Sitzfleisch begann zu jucken. Irgendwo über ihrem Kopf summte eine Fliege. Sie rieb sich die brennenden Augen. Erich und der dicke Amerikaner hatten, wie ihr schien, seit der Abfahrt von Tanga pausenlos geraucht. Warum, warum war sie nur nach Afrika zurückgekommen? Sie fragte sich dies zum hundertsten Mal seit ihrer Ankunft vor zwei Tagen. Eine Nacht in Dar – das herablassende Gebaren von Gouverneur Schnee und seiner beschränkten neuseeländischen Frau erdulden zu müssen! Dann eine schwankende Seereise auf einem schmutzigen Küstendampfer von Dar nach Tanga, jedes Mal das Gepäck ausladen und wieder einladen. Ein unerfreulicher Aufenthalt im Hotel Deutscher Kaiser in Tanga – Erich und der dicke Amerikaner waren die ganze Nacht aufgeblieben und hatten zusammen mit rotgesichtigen Farmern und Schutztruppenoffizieren geredet und getrunken. Und dann flüsterte Erich ihr gerade noch etwas zu, als er wankend ins knarrende Bett stieg und sogleich in einen alkoholumnebelten Schlaf fiel.
Am Morgen ging es wieder los: Drei Stunden im Staub und Gestank des Bahnhofs von Tanga – ihr war heiß, sie hatte Durst und sah sich von Gepäck umgeben. Der dicke Amerikaner rannte umher auf der Suche nach Wasser zur Befeuchtung seiner Kaffeesämlinge. Erich war übellaunig und hatte Kopfschmerzen. Sie schritt an den Bahnhofsgebäuden von Tanga entlang, nach einer schattigen Stelle Ausschau haltend, den Seidenfächer schwingend, den ihre Mutter ihr als Abschiedsgeschenk mitgegeben hatte. Sie bemerkte, dass jede der drei Bahnhofsuhren eine andere Zeit anzeigte.
Endlich rumpelte der Zug mit seinen alten Wagen rückwärts in den Bahnhof. Das Gepäck und die Kisten wurden eingeladen, und sie nahmen ihre Plätze in einem Erster-Klasse-Abteil ein. Dann musste man unverständlicherweise noch einmal vierzig Minuten warten, bis der Zug sich schließlich zu seiner täglichen Fahrt nach Bangui in Bewegung setzte, das in der Mitte zwischen Tanga und Moshi gelegen war. In Bangui würden sie eine weitere Nacht verbringen müssen, da der Zug zwischen Bangui und Moshi nur zweimal wöchentlich verkehrte. Liesl seufzte, wenn sie daran dachte, wie schnell und zuverlässig man in Deutschland reiste. Von ihrem Heimatort Koblenz zu ihrer Schwester in München brauchte sie nicht einmal einen Tag!
Sie wandte sich vom Fenster ab und klappte ihren Fächer auf. Aus irgendeinem Grund stand der Amerikaner auf, gefährlich schwankend beim Schlenkern des Waggons. Ein krummer schwarzer Zigarrenstummel ragte zwischen den vorspringenden Haaren seines Schnurrbarts heraus, und er rieb sich kräftig die Hinterbacken, schlug gar mit den Fäusten dagegen, als schüttele er Kissen auf.
Er lächelte, doch der Schnurrbart verbarg noch immer den Mund, und nur die sich verändernden Konturen der Wangen und das Verschwinden der Augen in Deltas von Fältchen deuteten den neuen Gesichtsausdruck an.
Er sprach, ohne die übel riechende Zigarre aus dem Mund zu nehmen – ein vulgärer Mensch, dachte sie –, sie hatte im Hotel schon seine Tischmanieren beobachtet: ein wirklich vulgärer Mensch.
»Dieses lange Stillsitzen«, sagte er. »Da wird man ganz steif.«
Was redete er da? Liesl verstand kaum ein Wort. Dieser schleppende Akzent, und dabei war sie so stolz auf ihr Englisch. Sie lächelte etwas gezwungen zurück und wandte sich wieder dem Fenster und den Bergen zu.
»Ach, sagen Sie, Erich«, hörte sie den Amerikaner sagen, der das ch von Erich wie ein sch aussprach, »was ist denn dran an all diesem Gerede von einem Krieg zwischen England und Deutschland?«
Sie hörte nicht mehr hin. Krieg, Krieg, Krieg. Dieses ewige Gerede der Männer vom Krieg. Sie waren wie Kinder. Ihr Vater, ihr Schwager, ihre Neffen. Krieg, Politik, Krieg, Politik. Sie seufzte abermals, doch ganz leise, damit Erich es nicht hörte, und dachte an die Wohnung ihrer Schwester in München. Elektrisches Licht, Klosetts mit Wasserspülung, schöne Möbel, gutes, abwechslungsreiches Essen. Sie hatte vergessen, wie das war: In all den Jahren mit Erich auf der Farm hatte sie vergessen, was es alles gab. Sie hatte während dieses letzten Heimataufenthaltes gegessen, als müsste sie sich einen Vorrat zulegen, wie ein Tier, das bald überwintert. Sie spürte, wie Hüften und Bauch sich unter dem schon bis aufs Äußerste gelockerten Korsett wölbten. Keines ihrer afrikanischen Kleider passte ihr mehr. Sie spürte, wie ihre Bluse unter den Armen einschnitt, spürte, wie sich der Stoff über ihren breiten Schultern spannte.
Es juckte sie an den Unterseiten der Schenkel. Die Hitzebläschen fingen schon an, nach erst zwei Tagen! Sie brauchte jeden Tag ein Bad und hatte noch keine rechte Gelegenheit dazu gehabt, seit sie von Bord der Tabora gegangen war. Sie verwünschte ihre helle Gesichtsfarbe, ihre weiche, feuchte Haut und beneidete plötzlich den Amerikaner darum, dass er einfach aufstehen und sich kratzen konnte.
Um sich von ihrem Unbehagen abzulenken, öffnete sie ihre Reisetasche und holte die kleine Holzschachtel heraus. Turkish Delight, in Port Said gekauft, ihre letzte Schachtel. Fünf hatte sie gekauft, und sie hatte sie aufheben wollen, doch während der Reise war sie mit einer Gier über die Süßigkeiten hergefallen, als bekäme sie sie zum letzten Mal zu schmecken.
Sie nahm den Deckel ab. Drei Stücke waren noch übrig, wie große Brocken ungeschliffener Edelsteine, blassrosa, schienen sie unter ihrem Puderzuckerüberzug zu leuchten. Sie nahm die kleine Holzgabel, stieß sie in das größte Stück und schob es sich in den Mund. Speichel sammelte sich an. Sie kaute langsam und achtlos, ließ es zu, dass sich Bröckchen zwischen ihren Zähnen verfingen. Noch zwei übrig. Sie schloss die Augen, den Geschmack genießend, und vergaß für einen Augenblick den Juckreiz.
»Muss gut schmecken«, hörte sie den Amerikaner sagen. Und darauf folgte Erichs künstliches Lachen.
»Ja, wie Sie sehen, hat Liesl etwas für Süßes übrig.«
Sie schlug die Augen auf und sah, dass sie sie angrinsten wie zwei Idioten. Sie reichte Erich die Schachtel. Er winkte ab und begleitete die Geste mit einem kurzen Schnauben. Sie hielt sie dem Amerikaner hin. Er blickte fast scheu hinein.
»Ich glaube, das ist mir noch nicht über den Weg gekommen. Was ist das?«
»Turkish Delight«, sagte sie kühl.
»So, kommt also von weit her aus der Türkei.« Zwei plumpe und schwielige Finger pflückten ein Stück heraus. Nur noch eins übrig.
»Exotisch«, sagte der Amerikaner. »Das Licht scheint hindurch. Sehr hübsch.«
Sie beobachtete ihn, wie er die Süßigkeit entzweibiss, erfreut die Brauen hochzog, auch die zweite Hälfte in den Mund steckte und sich dann die Finger ableckte. Zuckerkrümel hoben sich weiß von seinen Schurrbartenden ab.
»Na, das nenne ich eine Süßigkeit«, sagte er und zündete erneut seinen Stumpen an. »Wirklich sehr fein.«
Liesl wusste, dass sie den ganzen Tag aus ihrer schlechten Laune keinen Hehl gemacht hatte, aber das war ihr egal. Und als sie in Bangui ankamen, wurde ihre Stimmung auch nicht besser. Das Gästehaus war klein und schmutzig und wurde von der wortkargen Frau eines Eisenbahners geführt. Liesl sagte, sie habe Kopfschmerzen, und legte sich zu einem recht unruhigen zweistündigen Nachmittagsschlaf hin. Als es draußen dämmrig wurde, stand sie auf, wusch sich das Gesicht und ging hinunter in den Schank- und Speiseraum, der den größten Teil des Erdgeschosses einnahm. Sie trat hinaus auf die Veranda. Erich und der Amerikaner saßen in Korbsesseln und schauten auf die staubige Hauptstraße hinaus. Sie gesellte sich zu ihnen und sagte ihrem Mann, es gehe ihr viel besser. Sie bestellte bei einem Boy eine Tasse Kaffee.
»Da kommen sie schon wieder«, sagte Temple.
Eine Abteilung von etwa sechzig Askaris machte mit einem deutschen Unteroffizier Formalausbildung. Sie marschierten die Straße entlang, dann folgten die Kommandos Halt! Präsentiert das Gewehr! Rührt euch!. Schließlich schulterten sie das Gewehr wieder und marschierten weiter, gefolgt von einer Schar kleiner Jungen.
»Also das frage ich mich jetzt wirklich«, sagte Temple, wobei er mit dem Zeigefinger auf von Bishop deutete, »warum werden Ihre Askaris nur so gedrillt? Das sieht ja aus, als erwarteten Sie, dass es Ärger gibt.«
»Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein«, sagte von Bishop.
»Ich weiß nicht, was da vorgeht. Es heißt, das sei alles wegen der Ausstellung im August, aber seit von Lettow hier ist, hat sich alles verändert. Man hat sogar mich einberufen.« Er breitete die Arme aus und zuckte die Achseln.
Temple wandte sich höflich an Liesl. »Glauben Sie, es gibt Krieg in Europa, Frau von Bishop? Hat man vor Ihrer Abreise davon gesprochen?«
Liesl riss sich von der Beobachtung eines Geckos los, der gerade zum Angriff auf eine Ameise ansetzte.
»Ja, es war die Rede davon. Aber eher von einem Krieg mit Russland. Nicht mit England. Ich weiß es nicht.« Sie lächelte. »Ich habe nicht so genau hingehört. Mich interessiert das nicht.« Das Englisch kam ihr schwer von der Zunge. Sie hatte es so lange nicht sprechen müssen, und es ärgerte sie, dass sie es jetzt ausgerechnet dieses Amerikaners wegen gebrauchen musste.
Temple runzelte die Stirn und wandte sich wieder an von Bishop. »Ich kann mir einen Krieg hier in der Gegend nicht vorstellen – Sie?«
»Eigentlich auch nicht«, sagte von Bishop. »Halte ich für höchst unwahrscheinlich. Von Lettow geht wohl einfach auf Nummer sicher.«
Liesl ließ sie weiterreden. Jetzt, wo die Sonne unterging und den Usambara-Bergen hinter ihnen eine kupferne Farbe verlieh, war es ein klein wenig kühler. Die Zikaden begannen zu zirpen, und sie roch den Duft von Holzkohlenfeuern. Der Boy brachte ihren Kaffee, und sie trank ihn in langsamen Schlucken. Auf der Veranda wurde eine Petroleumlampe angezündet, und sogleich umschwirrten ein paar Falter sie und warfen ihre Schatten auf die wenigen Europäer, die noch draußen saßen und plauderten. Zum ersten Mal, seit sie in Dar den Fuß an Land gesetzt hatte, spürte Liesl, dass sie wirklich wieder in Afrika war – die Erinnerungen, die sie gleich einem Schutzpanzer aus Europa mitgebracht hatte, entglitten ihr oder zogen sich zumindest auf sichere Distanz zurück.
Sie sah ihren Mann an. Er fing kurz ihren Blick auf, doch dann sah er wie schuldbewusst fort. Sie fragte sich, ob er es wohl heute Abend versuchen würde. Sie waren seit über einem Jahr, seit ihrer Abreise nach Europa, nicht mehr zusammen gewesen. Auf der Rückreise hatte sie sich immer wieder ihre Vereinigung vorgestellt und sich dabei verschwommen über die Heftigkeit ihres Verlangens gewundert. Doch das war auf dem Schiff gewesen. Jetzt ließ sie der Gedanke kalt.
Sie blickte verstohlen zu ihm hinüber, sah den schmalen, knochigen Körper, das straffe, faltige Gesicht, die große Nase und die schlaffen, dicken Altmännerohren. Hätte er sich doch das Haar nicht so militärisch kurz geschoren. Das betonte noch sein kantiges Kinn, schien die Schläfenhöhlen zu vertiefen, seine Nase noch länger zu machen … Er war nervös heute Abend, das sah sie.
Sie seufzte. Schon einmal war sie allein in Europa gewesen, während des Maji-Maji-Aufstands 1907. Danach waren sechs Jahre ohne Unterbrechung gekommen. Während dieser Zeit war die Nordbahn fertiggebaut worden, Erich war aus der Armee ausgeschieden und hatte die Farm an den Nordhängen der Pare-Berge gegenüber dem Kilimandscharo gekauft. Die Farm florierte, sie lag auf fruchtbarem Boden. Sie bauten einen großen steinernen Bungalow. Sie lebten gut, und das Geld sammelte sich auf der Bank an, während die Nordbahn die Ernte zum Hafenort Tanga beförderte.
Aber dieses Leben! Die Schönheit der Umgebung und der Erfolg ihres Unternehmens wogen die Langeweile des Alltags nicht auf. Erich arbeitete den ganzen Tag auf der Plantage und kam abends müde nach Hause. Sie gebot über zahlreiche Dienstboten, die ihr jede Arbeit abnahmen, doch ihr war immer unbehaglich in der Hitze, ihre helle Haut vertrug die Sonne nicht. Jedes beißende oder stechende Insekt betrachtete sie als lohnendes Ziel. Sie schien ständig zu schwitzen, und die Kleider klebten ihr rau an der feuchten Haut. Regelmäßig bekam sie Fieberanfälle. Ihre Nachbarn waren weit entfernt und nicht besonders sympathisch, in Moshi gab es auch wenig Abwechslung, und Erich hatte nichts für Tanz oder Geselligkeiten übrig.
Dann hatte sie im letzten Jahr einen ganzen Monat lang heftiges Fieber gehabt, unter Krämpfen gezittert und stundenlang mit den Zähnen geklappert. Sie hatte angekündigt, dass sie nach Hause fahren würde, sobald es ihr besser ging. Erich konnte ihr das nicht verweigern. Sie hatten genug Geld auf ihrem Bankkonto. Sie konnte sich bei ihrer Familie sehen lassen, ausgestattet mit stolzer Kaufkraft. Im Nachhinein lächelte sie über ihre Verschwendungssucht. Sie hatte alles ausgegeben, was sie bei sich gehabt hatte, hatte Geschenke und Luxusartikel gekauft und ihre kleinen Neffen und Nichten verwöhnt. Wie sie ihre Tante Liesl aus Afrika geliebt hatten! Es war ein herrliches Jahr gewesen.
Sie lächelte wiederum – vielleicht war Erich deshalb so nervös. Bei ihrer Abreise vor einem Jahr war sie recht abgemagert gewesen, noch vom Fieber gezeichnet. Vielleicht erkannte Erich sie jetzt nicht mehr richtig wieder. Sie fasste sich an den Nacken und befühlte nachdenklich das weiche Fleisch. Vielleicht glaubte Erich, ein Gespenst vor sich zu haben.
Am nächsten Morgen standen Liesl, von Bishop und Temple Smith auf der Bahnstation Buiko und sahen zu, wie zwei Kompanien Askaris der Schutztruppe auf ein halbes Dutzend Flachwagen kletterten, die an den Zug nach Moshi angehängt waren.
Liesl befächelte sich mit ihrem Strohhut. Wieder hatte Erich am Abend noch mit dem Amerikaner zusammengesessen und getrunken. Er hatte sich behutsam ins Bett gestohlen und sich bemüht, sie nicht zu berühren, da er glaubte, sie schliefe schon. Liesl geriet schon wieder in gereizte Stimmung. Fliegen umschwirrten hektisch ihr Gesicht, ließen sich für Sekundenbruchteile auf ihren Lidern, ihren Lippen nieder. Beim Aufwachen am Morgen hatte sie zwei Sandflöhe unter dem Nagel ihrer linken großen Zehe entdeckt. Kleine rote Stellen, die wehtaten, wenn man sie berührte. Wie konnte sie nur so früh schon wieder Sandflöhe haben? Gott sei Dank würde sie bald zu Hause sein. Ihr Hausboy Mohammed war Experte im Entfernen von Larveneiern, die einem die Sandflöhe unter die Haut legten. Er benutzte dazu eine Nadel: Es war wie das Herausholen einer Zecke. Sie verspürte nicht den geringsten Schmerz, wenn Mohammed ihr diesen Dienst leistete.
Endlich stiegen sie in den Zug, der sich von Buiko aus zu seiner letzten Etappe nach Moshi in Bewegung setzte. Die Usambara-Berge machten der weniger dramatischen Pare-Kette Platz, während sie durch eine üppig-grüne Parklandschaft stetig nordwärts rumpelten, die sanften Hügel zur Rechten, den Pangani-Fluss zur Linken.
»Es wird davon geredet«, hörte sie ihren Mann sagen, »dass man auf einem fünf Meilen breiten Streifen entlang der ganzen Bahnlinie einheimische Plantagen und Dörfer verbieten will. Es ist gutes Farmland und so nah bei der Bahn.«
»Halte ich für ganz vernünftig«, bemerkte Temple, wobei er zum Fenster hinaussah. »In Britisch-Ost machen sie das genauso. Ich wünschte nur, meine Farm hätte auch einen so fruchtbaren Boden.« Er sah nach links zu den Baumreihen hinaus, die den Verlauf des Pangani kennzeichneten.
»Ha!«, rief er plötzlich aus, sodass Liesl zusammenzuckte.
»Da ist er!«
Der Zug machte eine behutsame Kurve nach rechts. Sie drängten sich zum Fenster. Und dort draußen, alles beherrschend, ragte in der Ferne der Kilimandscharo auf, bläulichpurpurn, die schneebedeckten Spitzen frei von Wolken.
»Herrlich«, sagte Erich. »Jetzt weiß ich, dass ich zu Hause bin.«
Die Sonne blitzte gegen das Abteilfenster und blendete Liesl für einen Augenblick. Sie griff in ihre Tasche und kramte nach ihrer getönten Sonnenbrille. Der Kilimandscharo verlor, durch die dunkelgrünen Brillengläser gesehen, wohl etwas von seinem Glanz, aber nichts von seiner strengen Majestätik. Wenn sich die zwei Männer über den Anblick freuten, so bedrückte er Liesl eher. Sie hatte so lange mit dem großartigen Berg gleichsam ihrem Haus gegenüber gelebt, dass sie ihn nicht als strahlendes Denkmal ansah, sondern eher als einen feindseligen, ständig anwesenden Gefängniswärter oder doch zumindest als unerbittlichen Wächter.
Sie lehnte sich zurück und war froh, dass sie die Brille aufgesetzt hatte, denn sie spürte, dass ihr Tränen in die Augen getreten waren. Wie lange würde es wohl dauern, bis sie wieder fortkonnte, fragte sie sich verzweifelt.
»Liesl!«
Der jähe Ausruf riss sie aus ihrer Träumerei heraus, und sie sah, wie ihr Mann mit bebendem Zeigefinger auf sie deutete, während sein Mund sich zu einer grobschlächtigen Nachahmung einer ungläubigen Grimasse geöffnet hatte.
»Was hast du denn da auf dem Gesicht?«, rief er. »Dieses … Ding!«
»Was für ein Ding?«, fragte sie wütend.
»Diese Gläser da, diese Brille.«
»Das ist eine getönte Brille«, sagte sie. Sie sprach sehr langsam und versuchte ihre Verärgerung zu verbergen. »Ich habe sie mir unterwegs in Marseille gekauft. Zum Schutz der Augen vor der Sonne.«
»Aber ich weiß nicht, ob … ob man so etwas tragen sollte«, wies Erich sie zurecht und stieß ein schrilles, nervöses Lachen aus, das für den Amerikaner gedacht war. »Ich finde, du siehst damit aus wie eine Blinde. Meinen Sie nicht auch, Smith? Wie eine Blinde, die Streichhölzer verkauft.«
Diese Zurschaustellung von Kleinigkeiten empörte sie, zumal sie noch das laute Lachen des Amerikaners über Erichs Bemerkung ertragen musste.
»Du benimmst dich lächerlich!«, sagte sie auf Deutsch zwischen zusammengebissenen Zähnen. »In Europa trägt man so was heutzutage überall.«
Obwohl Smith sie nicht verstanden haben konnte, war klar, dass er den Tonfall richtig gedeutet hatte, denn nun sprang er ihr zur Seite.
»Ich glaube, getönte Brillen sind geradezu de rigueur«, sagte er. »In Nairobi tragen sie viele Leute. Und die Uganda Railway hat in ihren Personenwagen farbgetönte Fensterscheiben.«
»Da hast du’s, Erich«, sagte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Du bist zu lange nicht von deiner Farm heruntergekommen.«
Von Bishop schnaubte skeptisch. Die Atmosphäre im Abteil war spannungsgeladen. Der Amerikaner verzog das Gesicht zu einem breiten Lächeln, das ihnen beiden galt, als könnte er damit die Missstimmung wegzaubern.
Er zog seine Taschenuhr heraus und klappte sie auf. »Na ja, nur noch zwei Stunden.«
Liesl und von Bishop wurden am Bahnhof Moshi von zweien ihrer Farmboys abgeholt. Man verlud Liesls Gepäck auf einen amerikanischen Buggy mit zwei Mauleseln davor. Die Farm der von Bishops lag nur eine Fahrstunde von Moshi entfernt genau südlich im fruchtbaren Hügelland vor den Pare-Bergen.
Temples erster Farmgehilfe Saleh war ein Suaheli von der Küste, ein kleiner, verschrumpelter, aber aufgeweckter Mann, auf den Temple sich mehr verließ, als ihm eigentlich lieb war, doch von ihm war nichts zu entdecken, auch nicht von den Farmboys oder dem Ochsenkarren mit seinem Gespann von sechs Ochsen, der die Kisten mit den Kaffeesämlingen in das zehn Meilen entfernte Taveta hätte bringen sollen, der ersten Ortschaft in Britisch-Ostafrika jenseits der Grenze.
Liesl beobachtete, wie Temple das Ausladen der Kisten überwachte, die man auf dem niedrigen Bahnsteig abstellte. Als ihr eigenes Gepäck auf dem Buggy verstaut war, rief sie zu ihm hinüber.
»Mr Smith, wir fahren jetzt.«
Er trat näher und reichte ihr die Hand.
»Es war mir wirklich eine Freude, Sie kennenzulernen, Frau von Bishop.« Sie stellte fest, dass ihr sein Akzent nicht mehr solche Mühe machte. »Ich muss sagen, meine landwirtschaftliche Exkursion war ein Erfolg und – ähem – Ihre Gesellschaft war mir äußerst, äh … und ich hoffe nur, unsere Gespräche haben Sie nicht zu sehr gelangweilt.«
Von Bishop trat auf sie zu. »Ja, Smith, wir müssen los. Noch nichts von Ihren Boys zu sehen?«
»Nein, verdammt noch mal – entschuldigen Sie, Frau von Bishop. Ich muss die faulste Niggerbande von ganz Britisch-Ostafrika eingestellt haben.«
»Nigger?«
»Einheimische, Liebes«, erklärte von Bishop.
»Lassen Sie sich nicht aufhalten«, sagte Temple. »Ich kann mir denken, dass Sie jetzt eilig nach Hause wollen.« Er schüttelte von Bishop die Hand. »War schön, Sie wieder mal zu sehen, Erich. Kommen Sie doch gelegentlich zu mir herüber, und sehen Sie sich mal meine Sisalfabrik an.«
»Gut möglich, Smith. Durchaus möglich.«
Temple schritt vor dem Bahnhof von Moshi auf und ab, während von Bishop Liesl in den Buggy half und dann selbst einstieg. Von Bishop klatschte mit den Zügeln, die Maulesel setzten sich zögernd in Bewegung, und der Buggy holperte die staubige Straße entlang. Liesl blickte sich um und sah, wie Temple seinen breitkrempigen Filzhut abnahm und sich mit einem Taschentuch die Stirn wischte. Er hatte gesehen, dass sie sich umdrehte, und winkte mit dem Hut, bis seine untersetzte Gestalt ihren Blicken entschwand, als der Buggy die hohen Befestigungsanlagen des neuen Forts umrundete, das die Schutztruppe in Moshi errichtet hatte. Liesl blickte zu den Steinmauern und den grobschlächtigen viereckigen Gebäuden der Anlage auf und sah die schwarz-weiß-rote Flagge schlaff an ihrem Mast hängen.
»Ein eigenartiger Mensch, dieser Amerikaner«, sagte sie zu ihrem Mann, um das Schweigen zu brechen, das zwischen ihnen entstanden war.
»Und ein dummer dazu«, erwiderte von Bishop mit einem Lachen. »Wenn er glaubt, er kann in Taveta Kaffee anbauen, dann muss er mehr Geld als Verstand haben.«
3
10. Juni 1914
Taveta, Britisch-Ostafrika
»Bwana Smith ist ein großer Kaufmann«, singsangte Saleh aus dem Stegreif auf Suaheli und ließ dabei müßig im Takt die Peitsche über den Leitochsen des dahinzockelnden Gespanns knallen. Sie hatten gerade die Grenze zwischen Deutsch- und Britisch-Ost überquert und bewegten sich auf einem beschwerlichen Weg zwischen den niedrigen Hügeln hindurch, die an dieser Stelle die Landschaft prägten.
Temple sah, dass Saleh sich umblickte, um sich zu vergewissern, dass er seinem »Lied« zuhörte.
»Bwana Smith hat Kaffee von erlesener Schönheit gekauft«, extemporierte Saleh dröhnend weiter. »Er wird viele Kaffeepflanzen anbauen, er wird ein reicher Mann werden, seine Farmboys werden den Tag preisen, an dem er ihnen Arbeit gab.«
»O-ja-ji!«, sangen die zwei Farmboys mit, die hinter Saleh einhertrotteten. Saleh blickte sich wieder zu Temple um und rieb sich die Hinterbacken durch seinen schmutzig-weißen Umhang hindurch. Temple lachte in sich hinein. Er hatte Saleh drei kräftige Tritte in den Hintern versetzt, als er mit seinen Leuten zwei Stunden nach Ankunft des Zuges eingetroffen war. Außerdem mussten sie jetzt zur weiteren Strafe zu Fuß neben dem Ochsengespann gehen – normalerweise hätten sie hinten auf dem Wagen gesessen und einander in der Führung des Gespanns abgelöst. Saleh hatte heilige Eide geschworen, ein elender Lump von einem Bahnhofsbediensteten habe ihm versichert, der Zug käme erst später an, doch sein nach Maisbier riechender Atem war nicht gerade angetan, einer solchen Versicherung Nachdruck zu verleihen.
Temple schaukelte dahin, während der schwere Wagen sich mit den Radspuren und Steinen des Fahrwegs abkämpfte. Die sie umgebende Landschaft bestand aus dichtem Dorngestrüpp mit einem gelegentlichen kleinen Vulkankegel dazwischen. Hinter sich gelassen hatten sie die fruchtbaren Pare-Hügel und die purpurfarbenen Hänge des großen Bergs, dessen abgeflachter weißer Gipfel von wolkigem Nachmittagsdunst verhüllt war. Temple dachte wieder an die von Bishops. Was für eine Bahnfahrt! Von Bishop war ja ganz nett, aber dermaßen langweilig … Und dann seine Stimme – drei Tage diesen schrillen Falsetton, das war fast zu viel für ihn gewesen.
Aber sie war eine recht angenehme Frau. Große Brüste, breite Schultern und die milchfarben-sommersprossige Haut von jemandem, der gerade erst aus Europa gekommen ist. Es fiel schwer, sich lange in dieser äußerlichen Verfassung zu halten. Daran waren weniger die Sonne und die Hitze schuld als die ständig sich einstellenden Leiden: die Anfälle von Fieber und Durchfall, Insektenstiche und Wunden, die nie zu heilen schienen … Sie waren schon ein eigenartiges Paar, diese von Bishops. Temple fragte sich, wie das wohl war, wenn man den ganzen Tag mit dieser hohen, schrillen Stimme leben musste.
Temple zuckte innerlich zusammen und blickte auf die Wolken von Fliegen, welche die hin und her schwankenden Rücken des Ochsengespanns umschwirrten. Manchmal fragte er sich, ob er recht daran getan hatte, seine Frau und die noch jungen Kinder von Nairobi, wo ein relativ gesundes Klima herrschte, nach Taveta zu holen. Das war für Matilda und die Kleinen vielleicht nicht so gut gewesen. Aber er hätte sich im Hochland nie so viel Land leisten, sich nie so gut etablieren können wie hier unten. Er lächelte etwas verbissen. Wahrscheinlich hätte er auch die Gesellschaft nicht länger ertragen können: diese verrückten Aristokraten mit ihren ständigen Pferderennen und Jagden – die ganze Art, wie sich diese winzige »Gesellschaft« entwickelt hatte, fast über Nacht, wie es schien, mit ihrer eigenen starren Hierarchie, ihren unmöglichen Wertmaßstäben und ihrer bizarren snobistischen Einstellung. Ein Club für ältere Beamte und ein Club für jüngere Beamte. Das endlose Hin und Her zwischen den Siedlern und der Regierung. Das grässliche Privileg, bei der Maseru-Jagd zu Pferde auf Hyänen Jagd zu machen, samt Jagdhörnern und Halli-hallo-tatupapu. O Gott, diese Engländer, fluchte Temple in sich hinein. Er war froh, ihnen entronnen zu sein. Jetzt hatte er seine eigene Farm, eine Sisalfabrik und eine Leinsamenplantage, die ausreichend für seinen Lebensunterhalt sorgten. Er konnte im Norfolk Hotel absteigen, wenn er nach Nairobi kam, konnte seine Familie mit zum Bioskop nehmen, wann immer er Lust dazu hatte. Er richtete sich etwas beklommen auf und strich sich über den Schnurrbart. In Deutsch-Ost schien es besser zu sein. Weniger Lustbarkeiten vielleicht, aber das Leben war gut organisiert, und man schien dort jedermann zu akzeptieren. Schau dir nur von Bishop an, ein halber Engländer, aber ein angesehener Mann.
»Taveta!«, rief Saleh.
Temple blickte auf. Sie hatten eine kleine Anhöhe überwunden, und vor ihnen lag die Ortschaft Taveta. Zwischen den dunkelgrünen Mangobäumen blitzte von Blechdächern die Sonne auf. Häuser und Gebäude standen weit verstreut. Der Fahrweg von Voi her, das an der Bahnlinie von Mombasa nach Nairobi lag, führte von Osten herein und wurde dann zu Tavetas Hauptstraße. Da waren ein Postamt und einige Bungalows, die dem Distriktverwalter, dem Polizeiinspektor und seinem Gefängniswärter gehörten. Einige Wellblechbaracken beherbergten die Büros des D.V. und die Gerichtsräume. Drei Seiten eines Platzes nahmen die weiß getünchten Kasernengebäude der Askari-Polizei, das Gefängnis und ein Stallgebäude ein. Eine unordentliche Anhäufung von hölzernen Hütten und Ständen am Ende der Straße stellte den um sich greifenden Außenbezirk des Inderbasars dar. So weit wie möglich davon entfernt, am anderen Ende der Ortschaft, gab es einen neuen, aus Holz errichteten Laden, dessen Besitzer ein Europäer war. Es gab nur einige wenige Siedler und Farmer wie Temple, da der Bezirk Taveta-Voi nicht als besonders fruchtbares Farmland galt. Die meisten Farmer waren Buren, die, wie Temple, nicht sehr viel für die Briten übrig hatten.
Temples Ochsenkarren rumpelte langsam nach Taveta hinein. Es war später Nachmittag, und es herrschte wenig Geschäftigkeit. Der Ort erinnerte Temple immer wieder an kleine Ortschaften, die er im Westen der Vereinigten Staaten, in Wyoming, gesehen hatte, als junger Mann noch in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sollte er kurz anhalten und in dem Laden, den ein Ire namens O’Shaugnessy führte, einen Schluck trinken? Nein, es war noch eine Stunde bis zu seiner Farm, es war besser, er fuhr weiter.
Er lenkte das Ochsengespann von der Taveta-Voi-Straße herunter und folgte dann in südlicher Richtung dem sich dahinschlängelnden Weg zum Lake Jipe, der zu seiner Farm führte.
Er hatte Taveta erst zehn Minuten hinter sich gelassen, als er auf ein gesatteltes Maultier aufmerksam wurde, das ohne Reiter um eine Wegbiegung herumgetrabt kam, kurz darauf gefolgt von einer hochgewachsenen, schlanken Gestalt in weißem Drillichanzug und Tropenhut, die eine Reitpeitsche in der Hand hielt und dem Tier böse Flüche zurief. Sowie der Mann Temple und den Ochsenkarren erblickte, blieb er sogleich stehen und strich sich den Anzug glatt. Saleh griff nach dem Zügel des Maultiers, als es an ihm vorbeitrottete.
»Ich kann nur sagen, vielen Dank«, sagte die Gestalt in Weiß und schlenderte näher. Temple zog die Zügel an, und die Ochsen blieben sofort stehen. Der Mann kam so lässigen Schritts heran, als befände er sich auf einem Sonntagnachmittagsspaziergang.
»Ach, Smith«, sagte er und hob zum Gruß kurz den Tropenhelm. »Schöner Tag heute.«
Es war der Distriktverwalter von Taveta, mit Namen Wheech-Browning. Er war noch sehr jung, so um die fünfundzwanzig, und sehr groß – fast eins neunzig, schätzte Temple.
»Hallo«, sagte Temple – es fiel ihm schwer, Wheech-Browning mit seinem unmöglichen Namen anzureden.
»Schwierigkeiten?«
»Ja«, gestand Wheech-Browning ein. »Ich habe dieses Maultier in Nairobi von einem Syrer für dreihundert Rupien gekauft, und er hat mir versichert, das Tier sei zugeritten. Es ist zunächst auch ganz schön losgetrabt, aber dann ist es plötzlich schlicht übergeschnappt.« Er wandte sich um und blickte zu dem Tier hinüber, das, von Saleh bewacht, regungslos dastand.
»Oh«, sagte Wheech-Browning. »Scheint ja wieder ganz friedlich zu sein, aber ich kann Ihnen versichern, das kleine Biest hat mich glatt abgeworfen.« Er hielt inne. Sein von Kragen und Krawatte eingeschnürtes Gesicht war hellrot angelaufen, und Schweiß tropfte ihm unter dem Tropenhelm heraus. Temple fand es ungewöhnlich, dass dieser unerfahrene, ungelenke junge Mann in seinem heißen Wellblechgerichtsraum alltäglich über Mörder, Diebe und Trunkenbolde zu urteilen hatte, aber er schien diesen Pflichten ohne großes Nachdenken nachzukommen. Temple war einmal als Zeuge der Anklage vor Gericht gewesen – es handelte sich um einen seiner eigenen Farmboys, der auf einer Nachbarfarm Vieh gestohlen hatte. Er hatte mitangesehen, wie Wheech-Browning den vor Angst schlotternden Mann zu sechs Monaten Zwangsarbeit verurteilte. Ein Mordfall musste zuständigkeitshalber zum Gericht des Provinzgouverneurs in Voi verwiesen werden, aber es war offenkundig, dass Wheech-Browning einen Angeklagten in aller Seelenruhe auch zum Tod verurteilt haben würde, um dann anschließend mit dem Polizeiinspektor eine Partie Tennis zu spielen.
Wheech-Browning klopfte gegen seine Jackentaschen und lockerte die Krawatte.
»Ob ich Ihnen wohl ein Zigarettchen stibitzen dürfte, Smith? Ich muss meine vorhin verloren haben, als das Biest mich abgeworfen hat.«
Temple zog ein Päckchen heraus und bot ihm eine an.
»Dumme Viecher, was?«, sagte Wheech-Browning, wobei er den Rauch ausblies und sein Maultier ansah. »Dachte, ich hätte ein Geschäft gemacht. Aber da wir gerade vom Geschäft sprechen« – er blickte auf die Kästen, die Temple geladen hatte – »was haben Sie denn da mitgebracht?«
»Kaffeesämlinge«, sagte Temple.
»Kaffee? Meinen Sie denn, der wächst hier, alter Junge?«
»Genau wissen wir’s erst, wenn wir’s versucht haben.«
»Das ist ein Argument, zweifellos. Wo haben Sie die Pflanzen her? Nairobi? Nakuru?«
»Nein, aus Dar.«
»Aus Deutsch-Ost? Du liebe Güte, wie faszinierend. Sagen Sie, wie ist das da? Ich hoffe, dass ich auch mal nach Dar komme zu der Ausstellung im August. Unser Konsul dort hat mit einem Cousin von mir in Cambridge studiert. Wie war’s denn bei den Germans da drüben?«
»Oh, sehr hübsch«, sagte Temple. »Sauber und ordentlich. Funktioniert alles – in Dar zumindest. Aber es ging sehr kriegerisch zu. Überall Soldaten.«
»Na, das stand zu erwarten. Typisch deutsche Mentalität, immer marschieren, zack-zack. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass Sie mein Maultier eingefangen haben. Hoffen wir, dass das Tierchen auf dem Heimweg friedlicher ist. Will nicht noch mal auf dem Arsch landen.«
Er ging zu dem Reittier hinüber und saß auf – was bei seiner Größe nicht schwieriger war, als hätte er ein Fahrrad bestiegen. Als seine Füße in den Steigbügeln steckten, befanden sie sich nicht mehr als fünfzehn Zentimeter über dem Boden.
»Scheint ja ganz gut zu gehen«, rief Wheech-Browning, sich umblickend, zurück. »Ach, kommen Sie doch nächste Woche mal bei mir vorbei, ja?«
Temple runzelte die Stirn. »Wozu?«
»Diese Kaffeesämlinge aus Deutsch-Ost da«, rief Wheech-Browning noch lauter. »Dafür müssen Sie mir Einfuhrsteuer zahlen.«