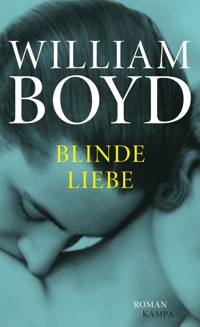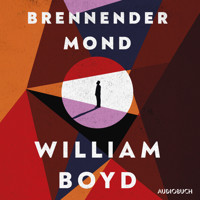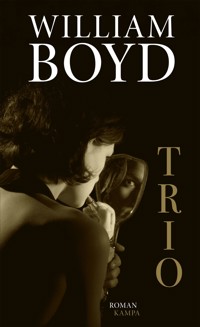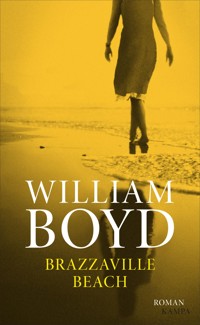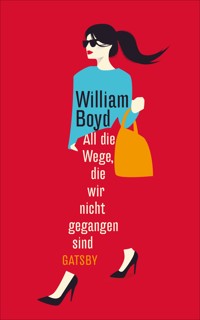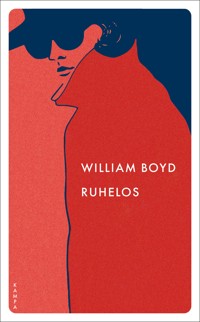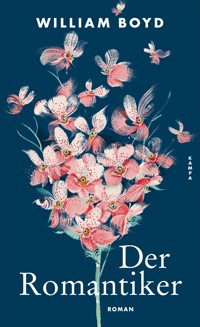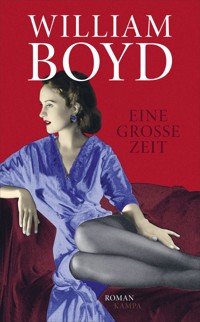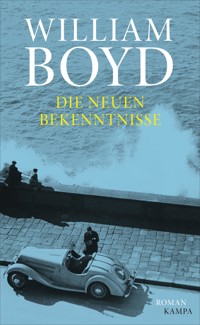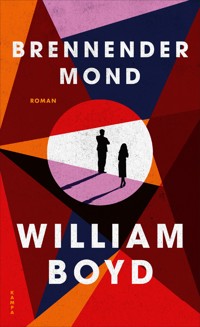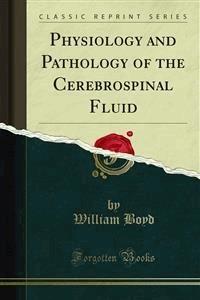Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kunsthändler, notorischer Schürzenjäger, will endlich seine ständigen Liebschaften aufgeben und nur noch leidenschaftlich küssen - das Höchstmaß anAusschweifung, das er sich zugesteht. Aber ist ein Kuss wirklich jemals genug? Ein Paar erzählt die Geschichte seiner Beziehung vom Ende her, dem unerwarteten Wiedersehen im Baumarkt, zurück bis zum ersten Date. Ein doppelt gedemütigter Autor - seine Frau hat ihn verlassen, das Feuilleton sein jüngstes Werk verrissen - tut, was ein Künstler tun muss: Er reist nach Frankreich, wo ihm ne- ben köstlichen Austern auch die Möglichkeit zur Rache an seinem größten Kritiker auf dem Silbertablett serviert wird. Ein Filmregisseur verzweifelt an den Gepflogenheiten Hollywoods - und an der Liebe zu seiner Hauptdarstellerin. Und auch der erfolglose Schauspieler Alec Dunbar bekommt zu spüren, dass ein Unglück selten allein kommt. William Boyds Figuren sind angehende Künstler, Schauspieler und Möchtegern-Schriftsteller, deren hochtrabende Ambitionen schonungslos zur Schau gestellt werden. Wie kein anderer erhellt Boyd die Folgen zufälliger Begegnungen und übereilter Entscheidungen und zeigt erneut, dass er zu den originellsten und fesselndsten Erzählern unserer Zeit gehört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Der Mann, der gerne Frauen küsste
Erzählungen
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer und Chris Hirte
Kampa
Frau mit Hund am Strand
»Das wirkliche und interessanteste Leben eines jeden Menschen spielt sich heimlich, gleichsam unter dem Mantel der Nacht ab.«
Anton Tschechow
Aus irgendeinem Grund beschloss Garrett Rising, als er zwanzig Meilen aus Boston heraus war und Richtung New York fuhr, dass er unbedingt den Ozean sehen musste. Er hatte Sehnsucht nach dem weiten Horizont, nach dem Rauschen der Brandung, so sehr, dass ihm alles andere gleichgültig wurde. Er wusste, es würde ihn beruhigen, also bog er vom Highway ab und fuhr ostwärts zum lockenden Zeigefinger von Cape Cod.
Als Kind war er einmal dort gewesen, mit zehn oder elf, als die Familie Rising für drei Sommerwochen ein Haus in Provincetown gemietet hatte. Er erinnerte sich dunkel an das senfgelbe Haus, an klemmende Fenster, an die ewigen Wutanfälle seines Vaters, die friedliche Bucht gegenüber der Stadt und an den tosenden Ozean auf der anderen Seite, jenseits der Dünen.
Als er in Orleans zum Tanken hielt, durchfuhr ihn ein leichtes Zittern der Erregung. Bedachte er sein Problem, diese erneute Enttäuschung, tat er gerade etwas Spontanes – und zweifellos auch Dummes –, aber das war ihm egal, und außerdem, wem schadete er schon damit. Er wusste nur, dass er jetzt nicht einfach nach New York zurückkonnte – er brauchte den Trost der Wellen.
Garrett Rising war ein hochgewachsener, agiler Mann mit breiten Schultern, schon mit kleinem Bauchansatz, aber schließlich war er einundvierzig, so alt wie das Jahrhundert, daran war nicht zu rütteln. In seinem blonden Haar zeigten sich graue Strähnen, und er hatte eine kleine, feine Nase mit auffallend weiten Nasenflügeln. Viele Frauen hatten ihm versichert, dass sie diese kleine, feine Nase bemerkenswert fanden.
»Toller Film«, sagte der Tankwart, der ihm das Wechselgeld gab und mit dem Kopf auf das Kino gegenüber zeigte: Das Rio, so hieß es. In geschwungenen kirschroten Neonlettern zog sich der Name quer über die Fassade. Der Film, der lief, hieß Scarlet Autumn.
»Ach, ja?«, sagte Garrett. »Muss ich mir mal ansehen.«
»Sie werden es nicht bereuen.«
Garrett fuhr weiter. Er hatte South Wellfleet hinter sich gelassen, als er langsam müde wurde und das Schild sah: »Pamet River Inn, nächste Straße rechts, Ozeanblick, Premium-Zimmer.« Er bog ab und holperte über eine zerfurchte Straße bis zu einer großen weißen holzverkleideten Villa mit Vorbau, gekiestem Wendekreis und kleinen Sommerhütten zu beiden Seiten, die durch einen überdachten Weg verbunden waren. Die Anlage wurde durch einen grasigen Strandhügel vom Ozeanwind abgeschirmt, und im Schatten des Hügels befand sich ein kleines Wäldchen aus Krüppelkiefern. Als Garrett aus dem Wagen stieg und seinen Koffer aus dem Kofferraum zog, hörte er das beruhigende Tosen der Brandung, und nach Süden hin sah er die Mittagssonne hart und silbrig auf der rauen See glitzern.
Er meldete sich an, ein Page trug seinen Koffer zu einem abgelegenen »Cottage«, wie diese Hütten jetzt hießen, und zeigte ihm die Räumlichkeiten. An diesem Freitag im April sei es im Hotel sehr ruhig, erklärte er, nur drei Gäste, und das Restaurant sei bis zum Ferienbeginn nur samstagabends und sonntagmittags geöffnet. Garrett gab ihm fünf Dollar und bat ihn, eine Karaffe Whisky zu bringen. Er machte eine Runde durch das Zimmer und öffnete die Vorhänge, um das klare, helle Licht hereinzulassen. Es gab eine gepflegte Küche mit Herd, Spüle und Eisschrank, ein Bad, und außer dem Doppelbett standen im Zimmer noch zwei Sessel mit Couchtisch. Die Wände waren weiß und schmucklos – bis auf einen alten Kupferstich mit ausgemergelten Puritanern, die gerade ein Versteck mit Maiskolben unter einer Indianerdecke im Gebüsch entdecken. Hier könnte man leben, dachte Garrett, bequem und sorglos, alles da, was der Mensch braucht, und bei der Vorstellung durchfuhr ihn wieder eine leichte Erregung. Er war froh, hier abgestiegen zu sein, aber er würde erst zu Hause anrufen und Bescheid sagen, wenn man ihm den Whisky gebracht hatte.
Er griff nach dem gestrigen Globe, den jemand auf dem Couchtisch hinterlassen hatte, und las die Schlagzeilen zu den Bombenangriffen der Nazis auf London, Hunderte Tote und Verletzte. In London war er nur ein Mal gewesen, 1932, auf dem Weg nach Hamburg, als Sean Kavanaugh ihn nach Deutschland geschickt hatte, um die zwei Reiner-Hoffmann-Druckmaschinen zu einem Spottpreis zu kaufen. Mit seinen amerikanischen Dollars war er dort ein reicher Mann gewesen, erinnerte er sich, so reich wie in Deutschland hatte er sich nie wieder gefühlt. Auf der Rückreise hatte er in London im Hyde Park Hotel übernachtet, und er fragte sich kurz, ob auch das Hotel von den Bomben getroffen worden war. Er dachte an das Mädchen, das er damals mit aufs Zimmer genommen hatte. Ein Pfund zehn Schilling hatte sie verlangt. Wie viel war das? Zehn Dollar? Eine ganz Süße – wie hieß sie gleich? Kitty? Mary? Bei Hotelzimmern dachte er immer an Sex, was nicht sonderlich überraschend war, wie er sich in einer kurzen Aufwallung von Scham bewusst wurde: Schon seit einiger Zeit schien sich Sex für ihn nur noch in Hotelzimmern abzuspielen.
Der Whisky kam, er trank ein wenig, bevor er seine Frau in New York anrief, um ihr mitzuteilen, dass sich seine Pläne geändert hätten und er unterwegs übernachten müsse.
»Hast du den Vertrag?«, fragte Laura.
»Wir haben es fast geschafft«, log er. »Nur noch ein paar Kleinigkeiten.«
»Gott sei Dank. Hast du Daddy angerufen?«
»Das mache ich am Wochenende. Er hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen, das weißt du doch.«
»Er möchte aber informiert sein, er will nach wie vor …«
»Also, ich mache unterwegs Station. Sag ihm, dass ich länger bleibe, um die Details zu regeln.«
»Wie lange?« Laura konnte den Argwohn in ihrer Stimme nicht verhehlen.
»Ich bin morgen zurück.«
»Wo übernachtest du?«
»Ich weiß noch nicht. Ich rufe von einer Telefonzelle an. Irgendwas werde ich finden.«
»Aber nicht so teuer. Wir können uns nicht leisten …«
»Wie geht’s Joanna?«
»Joanna hat wieder Kopfschmerzen. Ich habe den Arzt gerufen. Sie hat keinen Appetit.«
Garrett hörte sich die verschiedenen Krankheitssymptome seiner Tochter an, verabschiedete sich und legte auf. Seine Tochter war achtzehn, und seit ihrer Geburt schien sie immer an irgendetwas zu leiden. Wie konnte man so krank sein, ohne dass ein Arzt eine Ursache dafür fand? Ihre Mutter machte zu viel Getue um sie, immer dieses unnütze und endlose Getue, so etwas musste einen ja krank machen. Garrett versuchte diese Gedanken abzublocken – spürte jedoch den Ärger hochkriechen. Er griff nach seinem Hut: Zeit, dem Meer zu lauschen.
Der Strand war menschenleer. Die Sonne verbarg sich hinter Wolken – das Licht war grau geworden und ließ das Seegras auf den Dünen dunkel wie Moos erscheinen. Der Wind peitschte seine Krawatte; er musste sich umdrehen und die Hände eng um das Streichholz schließen, um seine Zigarette anzuzünden. Er dachte daran, wie ihm der alte Mr Foley die Nachricht beigebracht hatte: sehr schonend, das ließ sich nicht bestreiten, und er hatte ihm eine Dreimonatsfrist eingeräumt. »Foley und McBride werden den Vertrag nicht verlängern, Garrett, es tut mir sehr leid.«
Garrett starrte mit leerem Blick zum Horizont und versuchte die Auswirkungen auf die Firma abzuschätzen. Seiner Rechnung nach bestand das Geschäft zu siebzig Prozent aus dem Druck von Reiseführern für Foley und McBride – allein von den Reiseführern für Los Angeles hatten sie 30000 Exemplare geliefert. Fünfzehn Jahre lang waren sie die Druckerei für Foley und McBride gewesen. Es würde zu Entlassungen kommen: Pauly, Tom Reed, Tom Harbinger …
Er hörte ein schrilles, japsendes Kläffen hinter sich, drehte sich um und erblickte einen kleinen weißen Hund mit hochgerecktem Schwanz und einer dicken Fellkrause um den Hals, der an einem Seetanghaufen herumschnüffelte. Die Leine zog er lose hinter sich her. Dann ein Schrei, etwas entfernter. Mit dem Blick folgte er der Biegung des Strandes und entdeckte ein Stück weiter eine Gestalt, die mit beiden Armen winkte und etwas rief. Er hörte nur die Worte »Mister, bitte …«, der Rest wurde vom Wind verschluckt.
Garrett näherte sich dem Hund und hob die Leine auf. Der Hund knurrte und schnappte nach ihm. Was ist das für ein Köter?, dachte er. Ein kleiner weißer Wutbolzen.
Die Gestalt kam näher, sie trug eine rostrote Windjacke und eine halblange beige Leinenhose. Es war eine Frau.
»Vielen, vielen Dank«, sagte sie. Ihr dichtes braunes Haar war zu einem losen Pferdeschwanz gebunden. Sie hatte ein markantes knochiges Gesicht und eine tiefe Stimme, eine Stimme voller Selbstgewissheit – der Selbstgewissheit des Geldes, dachte er, während sie ihm geradezu überschwänglich dafür dankte, dass er ihren garstigen, ungezogenen, verwöhnten kleinen Strolch eingefangen hatte. Als er ihr die Leine reichte, sah er die Goldringe mit den bunten Steinen an ihren Händen. Ihr Alter war schwer zu bestimmen, ein bisschen jünger als er. Nicht so starren.
»Was ist denn das für eine Rasse?«, fragte er.
»Das ist ein Zwergspitz.«
»Ach ja, richtig.«
»Hätten Sie eine Zigarette für mich? Ich würde töten für eine Zigarette!«
Er hielt ihr die Packung hin, sie nahm eine, und beide stellten sich mit dem Rücken zum Wind, um sie anzuzünden, wobei sich ihre Schultern ein- oder zweimal berührten.
Sie musterte ihn lächelnd. »Ich konnte es nicht glauben, als ich einen Mann mit Hut und Dreiteiler am Strand stehen sah. Ist das eine Fata Morgana, dachte ich, eine Erscheinung?«
»Ich wohne in dem Hotel da drüben.«
»Im Pamet? Mein Gott, so weit bin ich gelaufen? Wie sind denn dort die Zimmer?«
Sie gingen zusammen zum Hotel, weil sie telefonieren wollte, um sich aus Truro einen Wagen schicken zu lassen, der sie zurückbringen sollte, wie sie sagte. Ihr garstiges Hündchen heiße Euclid, erklärte sie, obwohl es einen so intelligenten Namen gar nicht verdient habe.
»Ich heiße Garrett Rising«, sagte er und streckte ihr die Hand hin.
Sie schüttelte ihm die Hand. »Anna …«, sagte sie, zögerte kurz und nannte einen Nachnamen, den er nicht genau verstand. Demonserian? Staufferman? Es kam ihm unhöflich vor nachzufragen, also bot er ihr stattdessen an, sein Zimmertelefon zu benutzen.
Nachdem sie angerufen hatte, lief sie in seinem kleinen Cottage umher und sah sich neugierig um. Sie lachte über den Kupferstich, öffnete den Reißverschluss ihrer Windjacke, zupfte zerstreut ein paar Wollfussel von ihrem cremefarbenen Pullover und ließ sie behutsam in den Papierkorb fallen. Euclid machte es sich auf dem Bettvorleger bequem, vollkommen besänftigt.
»Sie haben hier alles, was ein Mann so braucht«, sagte sie und betrat die Küche.
Außer einer Frau, dachte Garrett automatisch, und im selben Moment, da ihm das Verlangen nach einer Frau bewusst wurde, begehrte er diese Frau, diese hochgewachsene, schöne, selbstbewusste Anna stärker, als er irgendwen oder irgendwas seit Jahren begehrt hatte. Und da sich derlei Gefühle unwillkürlich und instinktiv von Mann zu Frau und von Frau zu Mann zu übertragen scheinen, sah er, wie Anna zögerte, den Eisschrank schloss und sich zu ihm umdrehte. An ihren amüsiert hochgezogenen Brauen, an der kaum wahrnehmbaren Verengung ihrer Augen erkannte er, dass sie seine Gedanken erriet, dass sie die winzige, aber entscheidende Veränderung der Atmosphäre bemerkt hatte. Garrett atmete auf. Sie hatten Signale ausgetauscht, wohl oder übel.
»Darf ich Ihnen einen Drink anbieten?«
Er schenkte zwei Gläser Whisky ein – »Nur den Boden bedeckt«, sagte sie –, und als sie miteinander anstießen, dankte sie ihm noch einmal dafür, dass er Euclid eingefangen hatte. Garrett genoss das Brennen in seiner Kehle, das kleine Feuer in seinem Magen, und davon ermutigt, fragte er, ob er sie zum Dinner einladen dürfe.
»Freitags nie«, sagte sie ungerührt. »Freitagabends fahren wir nach Orleans ins Kino. Komme, was wolle. Oh, da ist mein Wagen!«
»Wir?«, fragte Garrett.
»Mein Mann.« Sie lächelte – ein bisschen schuldbewusst, dachte Jarrett. Als wäre sie so einem kleinen erotischen Abenteuer nicht abgeneigt.
»Aber … er ist verreist. Haben Sie vielen Dank, Mr Rising. Euclid und ich, wir stehen fortan in Ihrer Schuld.« Sie schien sich ein Lachen zu verkneifen. »Komm, Euclid, fahren wir nach Hause.«
»Es war mir ein Vergnügen.«
Garrett schaute ihr nach, während sie den Hund über den Holzsteg zu einem großen glänzenden Packard führte. Der Fahrer öffnete ihr den Wagenschlag, nahm Euclid hoch und setzte ihn auf den Beifahrersitz. Die Frau schaute zurück und winkte, nur eine kurze Handbewegung. Garrett schloss die Tür.
Im Rio, dem Kino von Orleans, lief Scarlet Autumn, doch Garrett folgte dem Film nur mit halber Aufmerksamkeit. Seine Gedanken drehten sich um Anna und zwangsläufig auch um die Zukunft der Kavanaugh-Rising Inc. Als die Lichter wieder angingen, blieb er ratlos sitzen, verwundert über die vielen Tränen der Hauptdarstellerin am Ende des Films, und fragte sich, warum das Schicksal so hart mit ihr umgesprungen war. Er erhob sich, setzte den Hut auf und ging langsam den Gang hoch. Anna saß in der letzten Reihe.
»Hi«, sagte er.
»Fahren Sie mich nach Hause?«
Im Auto – sie passierten gerade Wellfleet –, streckte sie die Hand aus und ertastete die harte Wölbung seines Penis durch die Flanellhose.
»Gut«, sagte sie. »Dacht ich mir.«
Als er aufwachte, sah er eine große, zitronengelbe Raute an der Wand. Es war die Sonne, die ihn blendete; als wäre er in einer anderen Welt gelandet, in der es nur Licht und leere Wände gab. Dann stellte er fest, dass die Vorhänge geöffnet waren und die tief stehende Morgensonne den Raum durchflutete. Er richtete sich auf und sah Anna. Sie schlüpfte flink in ihren Rock und zog den Reißverschluss hoch.
»Guten Morgen«, sagte er. »Wie spät ist es?«
»Noch früh.«
»Komm zurück ins Bett.«
»Ich muss los.«
Er zog sich schnell an, und sie liefen zusammen durch die Dünen zum Strand. Sie streifte ihre Schuhe ab und drehte sich zu ihm um.
»Ich bin im Nu zu Hause«, sagte sie. »Danke, Garrett.«
Er küsste sie, und sie stieß ihm die Zunge tief in den Mund, drückte ihn fest an sich. Dann vergrub sie das Gesicht an seinem Hals, und er hörte sie tief einatmen, als wollte sie seinen Geruch in sich aufsaugen. »Es war nett«, sagte sie leise zu seinem Kragen. »Mein Gott, was für ein Wort.«
»Wann sehe ich dich wieder?«
»Das ist verrückt.« Sie boxte ihn sanft gegen den Arm. »Nein, nein, nein. Das würde zu kompliziert. Es ist aus – wir hatten unser Abenteuer.«
Sie verschloss seine Lippen mit zwei Fingern, damit er nichts erwiderte, drehte sich weg und ging, ohne sich umzusehen, am Strand entlang nach – wohin? – Truro, hatte sie gesagt. Kann kein großer Ort sein, Truro, dachte er. Kinderspiel, dich da zu finden.
Tom Harbinger hielt ihm die frischen Druckbögen hin. Garrett starrte über die Straße in ein Büro, wo eine Sekretärin hinter dem Fenster zu sehen war. Die schräge Sommersonne malte ein leuchtend grünes Viereck auf die dunkelgrüne Wand und bestrahlte das Mädchen, das telefonierte. Sieht ein bisschen wie Anna aus, dachte er, jünger, kürzeres Haar, aber ein ähnlich kantiges Gesicht mit hohen Wangenknochen. Er sah Anna vor sich, wie sie den Hörer unters Kinn geklemmt hielt und mit den Ringen an ihren Fingern spielte, als sie ihren Wagen bestellte. Sie –
»Was meinst du?«, fragte Tom Harbinger. »He, Garrett!«
»Was? Klar doch. Sehen prima aus.«
Er unterschrieb den Laufzettel, und Tom nahm die Bögen mit. Komisch, wie es manchmal kommt, sinnierte Garrett – vielleicht schon zum tausendsten Mal. Wir verlieren Foley und McBride, und eine Woche später gewinnen wir Trans-American Airlines. Er hatte sich verloren geglaubt und war gerettet worden. Wohl wahr, Flugpläne waren nicht so interessant wie Reiseführer, aber sei’s drum. Er war Drucker – und neue Flugpläne wurden viermal im Jahr gebraucht.
Er ging in sein Büro und rief Laura an. Der Doktor sei der Meinung, Joanna leide an Neurasthenie, erklärte sie, und er habe ihr eine Klinik empfohlen. Natürlich, sagte er, egal, was es kostet. Die Trans-American Airlines hatten ihn saniert. Plötzlich stand ihm das Bild von Anna vor Augen, wie sie ihren BH fallen ließ, um ihre weißen spitzen Brüste zu entblößen, und er bekam weiche Knie. Diese Bilder erschienen völlig überraschend und mit absoluter Klarheit, wie Erinnerungen an etwas, was gestern Nacht passiert war. Seit vier Monaten schon, und es war kein Tag, keine Stunde vergangen, ohne dass er an sie gedacht hatte.
Hör zu, Laura, sagte er, ich muss heute noch mal nach Boston. Aber es ist doch Freitag. Ich weiß, ich weiß. Der alte Foley hat angerufen – er will mich dringend sprechen –, wer weiß, vielleicht gibt er mir die Reiseführer zurück. Sag ihm, er soll sie sich sonst wo hinstecken, rief Laura mit Vehemenz. Nein, ich muss zu ihm fahren, sagte Garrett. Wir waren fünfzehn Jahre Geschäftspartner und so weiter, das bin ich ihm schuldig. Du bist ein Schwächling, Garrett, sagte sie. Klar, antwortete er. Ein Schwächling, wie er im Buche steht.
Der Film, den sie im Rio zeigten, hieß The Golden Stranger, in den Hauptrollen Dalton Paul und Jayne Callot. Garrett war zu früh gekommen, eine Weile war er mit der gelangweilten Platzanweiserin allein im Saal. Langsam füllten sich die Reihen, und schließlich gingen die Lichter aus. Er hatte den Eingang gut im Blick, aber Anna hatte er nicht kommen sehen. Als der Film begann, überlegte er zu gehen, und ihn belustigte seine Annahme, eine Frau wie Anna würde jeden Freitagabend ins Kino gehen wie eine gewöhnliche Hausfrau. Er hatte kein Zimmer im Pamet Inn bekommen und eine Art Gasthof in Orleans gefunden, der einfach war, aber sauber. Doch konnte er tatsächlich eine Frau dorthin mitnehmen? Eine Frau wie Anna? Lächerlich, dachte er und versuchte, sich auf den Film zu konzentrieren, aber er hatte den Faden verloren, und der Mann, den er für den Schurken hielt, entpuppte sich als der Gute.
Als er aus der Herrentoilette kam, sah er sie in der Lobby stehen, eine Zigarette rauchen. Draußen regnete es, kirschrote Tropfen rannen im Lichtkreis der Neonreklame an den Scheiben herab. Sie trug einen leichten Mantel und offenes Haar. Es ist kürzer als beim letzten Mal, dachte er, als er von hinten an sie herantrat und sie sanft am Ellbogen berührte.
»Hi.«
Sie drehte sich um, doch nach dem kurzen Aufblitzen freudiger Überraschung wurde ihr Blick hart und ängstlich.
»Was machst du hier? Um Gottes willen!«
Er sprach leise, mit ausdrucksloser Miene. »Ich musste dich sehen. Ich werde sonst verrückt. Ich muss die ganze Zeit an dich denken.« Er lächelte. »Es ist zum Heulen. Die ganze Zeit, den ganzen Tag denke ich an dich. Ich kann nicht anders.«
Sie senkte den Blick und antwortete ebenso leise. »Ich weiß«, sagte sie. »Mir geht es genauso.« Dann blickte sie auf und lächelte falsch. »He, Schatz«, rief sie. »Schau mal, wer hier ist.«
Garrett drehte sich um und sah den Mann, der im Pissoir neben ihm gestanden hatte. Ein großer gebeugter Herr mit Glatzkopf und schlaffem Gesicht, der zwanzig Jahre älter aussah als Anna.
»Das ist Mr Rising – er hat Euclid gerettet.«
»Der Himmel möge Sie strafen«, sagte der Glatzkopf mit einem Grinsen, das sein makelloses Gebiss entblößte. »Ich kann das Vieh nicht ausstehen.«
»Charlie, sei nicht so grausam. Du liebst Euclid, und das weißt du.«
»Wie mein eigen Fleisch und Blut. Wohnen Sie in Orleans, Mr Rising?«
»Ich bin nur auf Besuch.«
»Wechseln Sie die Straßenseite, wenn Sie Euclid das nächste Mal begegnen. Dafür wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich hole den Wagen, Liebling. War nett, Sie zu treffen.«
Sie schüttelten sich die Hand, und Charlie, der Gatte, verschwand.
Anna sah aus, als wollte sie in Tränen ausbrechen.
»Du bist verrückt! Was soll das werden? Was denkst du dir dabei?«
»Komm nach New York«, sagte er, zog eine Visitenkarte heraus und schrieb etwas auf die Rückseite. »Mein Büro ist Downtown, Greene Street. Im Hamilton Hotel Sixth Avenue Ecke Houston ist ein Zimmer für dich gebucht. Für einen Monat. Komm nach New York und ruf mich an.«
»Nein.«
»Wir müssen uns wiedersehen. Wenigstens ein Mal.«
»Nein. Geh weg. Es ist vorbei.«
»Wenigstens ein Mal.«
Draußen vor dem Kino hupte es. Sie warf ihm einen wütenden, gehetzten, resignierten Blick zu und ging.
Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, zog Garrett Hemd und Hose an und machte eine Bestellung beim Zimmerservice: zwei Club-Sandwiches und zwei Bier. Als er das Tablett an der Tür entgegennahm, ignorierte er das dreckige Grinsen des Pagen.
Sie aßen ihre Sandwiches und sprachen darüber, was sie füreinander empfanden und wie der Tag ihrer Begegnung am Strand ihr Leben verändert hatte.
»Schicksal«, sagte sie.
»Euclid«, sagte er, und sie mussten beide lachen.
»Es ist aussichtslos«, sagte sie nach einer Weile. »Ich kann ihn nicht verlassen.«
»Und ich kann sie nicht verlassen.«
»Siehst du. Es ist aussichtslos.«
»Wir können uns hier treffen.«
»Und das nennst du Leben?«
»Besser, als sich gar nicht zu treffen.«
»Aber das ist doch sinnlos!«
»Und welchen Sinn gibt es sonst? Wir sehen uns, alles andere ist unwichtig.«
Sie stieß einen kleinen Schrei der Verzweiflung aus und drehte sich weg, das Gesicht zur Wand. Garrett starrte die Wand an. Die Tapete zeigte Ritter auf Streitrössern, Wimpel flatterten an ihren hochgereckten Lanzen. Das Bier hinterließ einen schalen Geschmack in seinem Mund. Vielleicht konnten sie ins Ausland fahren, sich für ein paar Tage wegstehlen – sich etwas ausdenken, um länger zu bleiben, sich gemeinsam durchschlagen. Kurze Momente waren jedenfalls besser als gar nichts, und der Gedanke, sie nicht wiederzusehen, war schlimmer als der Tod. Er spürte, dass ihre Hand nach ihm tastete, und er ergriff sie.
»Wir müssen etwas tun«, sagte sie.
»Das werden wir«, sagte er. »Versprochen.«
»Was denn?«
Es hob seine Stimmung, dass sie nun offenbar bereit war, es mit ihm zu versuchen, dieses Leben der kurzen Momente – der Momente im Glück.
»Ich denke mir was aus.«
»Und was?«
»Ich weiß es nicht«, sagte er und starrte auf die Ritter mit den Lanzen. »Ich weiß es nicht.«
Notizbuch Nr. 9
[Im Lauf der Jahre hatte er sich angewöhnt, zu einsamen Restaurantbesuchen ein Notizbuch mitzunehmen, in das er seine Gedanken und Beobachtungen eintrug, weil er sein Alleinsein lieber mit Schreiben als mit Lesen kaschierte.]
Heute keine Crab-Cakes, also bestellte ich verärgert einen Pseudo-Niçoise (ohne Kartoffeln). Dieses Lokal ist berühmt für seine Crab-Cakes, und das ist der Grund, weshalb ich hierherkomme – wie die meisten anderen Gäste. Warum gibt es die Crab-Cakes dann nicht täglich? Habe gerade Slang gesehen, interessanter Thriller, weil sich alles in einer Nacht abspielt. Eine eindeutige Hommage an Raupps Death Valley – man kann es auch Plagiat nennen –, aber ohne die Feinheiten, die liebevolle Figurenzeichnung. Schwächen: abrupte Wechsel von harmlos zu Hardcore; alberne Drehbuchideen (die Lapdance-Szenen, die Sprachschule); unglaubliche Zufälle – immer ein Zeichen versiegender Inspiration. Raupp macht es auch so, aber bei ihm funktioniert es irgendwie. Insgesamt ist der Film einfach nicht stimmig und, wie Pierre-Henri Duprez, glaube ich, mal irgendwo gesagt hat: Vor dem Publikum kannst du nichts verstecken. (Was aber so nicht stimmt: Man schaue sich den Schrott in unseren Kinos an, der gierig, hirnlos und gutgläubig konsumiert wird.)
Tanja würde Slang hassen, glaube ich. Regelrecht hassen.
Ich habe mich über die verpfuschten Loops geärgert, die Schatten des Galgenmikros, einen plump montierten Repeat-Shot. Diese Kritikermacke haben wohl alle Regisseure – einfach nur Cineasten sein, das können wir nicht.
Die Hauptrolle, Michaela Wall, ist umwerfend (eine blondere, langbeinigere Tanja). Letzten Endes ist jeder Genrefilm nur so gut wie seine Besetzung.
Mir gegenüber sitzt eine Frau, die ihre Zigarette in knapp neunzig Sekunden geraucht hat: immer drei kurze Züge hintereinander, dann eine Pause und wieder drei kurze Züge. Ohne zu inhalieren, wie es scheint. Man fragt sich, was sie davon hat.
Hinter ihr eine Mutter mit erwachsener Tochter und zwei schreienden Gören. Dieser Lärm! Dazu ziemlich middle-class, dem Akzent nach. Lassen ihre Kinder einfach quäken und quengeln – die anderen Gäste sind sauer, aber keiner sagt was, typisch englisch.
Tanja ist jetzt dreiundvierzig Minuten zu spät.
Eine atemberaubende Schönheit bedient heute im Verband. Russisch? Jedenfalls osteuropäisch. Der lange Rücken einer Ballerina. Leberflecken auf der Wange, am Hals. Hochgewachsen, schmales Patriziergesicht, Haar straff zum Knoten gebunden. Was macht sie hier? Was ist ihre Story, ihr parcours? Ihr Blick zeigt ein wenig Verachtung, während sie ihren Job macht, Drinks serviert, Geschirr abräumt.
Gerade zurück vom Lunch mit Leo Winteringham im Garrick. Keiner dort schien unter fünfzig, männlich natürlich, übergewichtig, schon ziemlich verlebt. Zigarren und Suff: die etwas anrüchige Fraktion der British Society. Leo W. hat mir angeboten, jeden Film zu finanzieren, bei dem ich Regie führe – und das jetzt schon zum dutzendsten Mal. Seltsame Figur, Leo: unverbesserlicher Amerikaner, trotz all seiner Jahre in England. Mager, echsenartig, schroffer Umgangston – ein merkwürdiger Player in dieser privilegierten englischen Szene (er wurde von allen freundlich begrüßt, zugegeben, nur weil er Geld hat).
Als wir Neuigkeiten austauschten (wer in ist, wer out), erwähnte er, dass Tanja Baiocchi ihren Mann verlassen hat. Nur mit Mühe verbarg ich meinen massiven Schock und sagte, ich hätte gar nicht gewusst, dass sie verheiratet sei. War sie nicht in deinem letzten Film?, fragte er. Ja, sagte ich, aber von einem Ehemann sei nie die Rede gewesen. Na ja, vielleicht kein Ehemann, sagte er, dann eben Freund, dieser französische Regisseur, Duprez. Oh, sagte ich, dann weiß ich Bescheid, na klar – und konnte bestätigen, dass die Trennung, entre nous, echt war, absolut und endgültig.
15.30. In der Verbandsbar ist es still, aber die Leute trinken stur weiter, als wollten sie sich vor dem Nachmittag und dem Nachmittagsfrust drücken. Ich müsste Janet anrufen, wie die Einladungen zum Cast- und Crew-Screening laufen und ob sie mir das Hotelzimmer in New York gebucht hat.
Getrunken: Einen Champagner, bevor ich ins Garrick ging, ein Glas Weißwein in der Bar, zwei Glas Weißen zum Lunch und ein Port (Leo trinkt nicht), und bin nun beim zweiten Glas Weißwein im Verband. Unterm Strich eine Flasche. Mehr als eine Flasche: Ich muss aufhören. Wenn ich mit Tanja zusammen bin, trinke ich nicht annähernd so viel.
New York. Carlyle Hotel. Sitze hier bei meinem Vor-Vor-Aperitif (Bloody Mary) – eine neue Angewohnheit, bedingt durch die Tatsache, dass es nur noch ein paar Stunden bis zum Screening von The Sleep Thief sind. Mir ist ungewohnt flau zumute (das ist mein neunter Film, mein Gott!), und ich weiß, warum: Ich erwarte zu viel. Weil ich den Wert und das Potenzial des Films kenne, setze ich darauf, dass er keine Probleme macht – Cannes, ein US-Verleih, der eine oder andere Preis: Schon bin ich zufrieden. Eigentlich brauche ich nur zu warten, auf die langsam wachsende Aufmerksamkeit, die schon zum Erfolg von Escapade führte. Der Film ist fertig, eine gute Arbeit, wir hatten unseren Spaß, was will man mehr? (Und natürlich: die Begegnung mit Tanja.) Lassen wir es also auf uns zukommen. Dieses Screening bringt gar nichts – kann sein, dass wir auf Cannes warten müssen oder sogar die UK-Premiere; kann sein, dass wir noch länger warten müssen, auf Venedig oder Berlin.
Wäre toll, wenn Tanja heute schon käme und beim Screening dabei sein könnte. Warum kommt sie erst morgen?
Vage Zweifel, ob es mit der Qualität der Kopie klappt, dem Projektor, der Lautstärke. Aber was soll man machen?
Sitze im F.O.O.D. auf der Lexington. Tanja hat ihren Besuch verschoben – noch drei Tage warten. Wäre schön gewesen, wenn sie es zum Screening geschafft hätte (schlecht besucht, enttäuschend, aber der Film kam offenbar gut an. Noch keine Angebote. Die Kopie war grässlich).
Zwei sehr gepflegte Frauen sitzen neben mir, unterhalten sich, mit hinreichender Lautstärke und Klarheit. Sie kennen sich kaum, wie es scheint.
»Wo leben Sie?«, fragt die eine.
»Mexiko.«
»Noch weiter weg als ich – Vermont.«
Pause.
»Wo in Mexiko?«
»San Miguel. Eine schöne Stadt.«
»Oh, da gibt es viele Expatriates, oder?«
»Wir sind eine ganze Menge.«
»Ich habe gehört, Facelifts sind dort spottbillig.«
»Billige Facelifts, billiges Hauspersonal. Es hat seine Vorteile.«
Männergespräche sind langweiliger als Frauengespräche, finde ich, und das sage ich als professioneller Lauscher. Tanja war mal zu einem Dreh in Mexiko. Dort hat sie Duprez kennengelernt, glaube ich.
»Du hast vielleicht kein Alkoholproblem, aber ich habe ein Problem mit deinem Alkoholkonsum.« Belauscht im Bemelmans.
Bizarrer Anblick im Going Loco (East Village). Eine junge Mutter (einundzwanzig?, zweiundzwanzig?), die ihr Baby in einer Ecke des Cafés stillt, bekommt einen Anruf. Sie steht auf, geht ans Fenster des Cafés und telefoniert, das Baby noch an ihrer Brust. Diese Ungezwungenheit, die völlige Abwesenheit von pudeur war absolut bewundernswert. Ich fühlte mich sofort alt und griesgrämig, verklemmt aufgrund meiner Erziehung mit ihren überkommenen Werten und Maßstäben – so schwer zu beseitigen wie ein Tattoo. Ich mag die Atmosphäre in dem Lokal, lebhaft und entspannt; an der Bar esse ich eine scharfe Gazpacho mit viel Knoblauch. Sehr rauchig. Morgen Ankunft Tanja.
16 Uhr. Bemelmans. Trinke Bier und esse Cashewnüsse. Im Lokal lauter alte Leute: die Generation New Yorker, die nachmittags einen Cocktail brauchen. Der Mann neben mir hat gerade einen zweiten Martini Dry bestellt.
Ich war essen bei Tanja. Besuchte sie in ihrer Suite im Plaza, und zu meiner Überraschung traf ich dort auf einen kleinen Jungen, etwa sechs oder sieben. »Das ist Pascal«, sagte sie, als wäre seine Anwesenheit die natürlichste Sache der Welt. Dann sprach Pascal Französisch und sagte Maman zu ihr. Warum zum Teufel nennt er dich so?, fragte ich. Er ist mein Sohn, sagte sie, deshalb. Und sah mich an, als wäre ich der letzte Trottel. Eine Nanny kam ihn abholen, aber ich hatte den Appetit verloren. Beim Essen raffte ich mich zu der Frage auf, ob Duprez der Vater sei, und zu meiner Beruhigung sagte sie Nein. Während unserer acht Wochen beim Dreh von The Sleep Thief hat sie Pascal mit keinem Wort erwähnt. Ist das normal für eine Mutter? Hat sie ihn mir verschwiegen, um unsere Affäre nicht zu stören? Vielleicht dachte sie, ich wisse Bescheid, und weil ich es nie erwähnte, kam es ihr diskreter vor, ebenfalls zu schweigen? Sie kommt heute Abend ins Hotel, sobald das Kind im Bett ist.
Seltsam: Bier trinke ich anscheinend nur in Frankreich und den Staaten. Nie einen Tropfen in England.
Im Pub, The Duke of Kent, Montagmittag. Nichts Essbares in der Wohnung, deshalb bin ich hier. Ein leerer Kühlschrank in einer leeren Wohnung – absolut deprimierend. Ich wollte Janet anrufen und sie etwas beim Take-away bestellen lassen, als mir einfiel, dass sie zu einem Dreh auf Malta ist. Janet und meine zwei Assistentinnen, weg. Ein Filmregisseur muss sich, wenn der Film endlich abgedreht ist, erst wieder daran gewöhnen, den Alltagskram allein zu bewältigen: zur Bank gehen, Sachen von der Reinigung holen, Essen und Vorräte kaufen. Seltsam, wieder auf sich gestellt zu sein, seltsam, nach New York wieder in London zu sein. Vermisse Tanja fürchterlich, es tut richtig weh – sie musste nach L.A., zu ihrem Agenten. Sie hat versprochen, nach Cannes zu kommen … Ich bin besessen von ihrer nervösen, agilen Schönheit. Sie ist immer in Bewegung – agitée, würde man in Frankreich sagen.
Mir gegenüber drei Dicke: riesige, massige Kerle, bei Schweinswurst mit Püree, Schwarzbrot und Butter. Zwei mit großen Gläsern Lagerbier, außerdem steht eine Flasche Rotwein auf dem Tisch, die sie sich teilen. Ich muss langsam an meinen neuen Film denken, aber The Sleep Thief lässt mich nicht los. Während ich noch die ganze Zeit von Tanja träume, läuft der Film, unser Film, weiter, als würden wir die verlorene letzte Filmrolle abspielen. Sie haben gerade Nachspeise und noch mehr Bier bestellt. Ich versuche, mich in der Rolle von Pascals Stiefvater zu sehen: Mit der Tatsache, dass wir künftig bei allen Treffen zu dritt wären, habe ich mich abgefunden. Vielleicht könnten wir ihm einen Internatsplatz besorgen. Benji und Max sind in seinem Alter von zu Hause weggekommen und haben sich all die Jahre in Farnham Hall absolut wohlgefühlt, wie es scheint – wobei mir einfällt: Wo stecken sie jetzt eigentlich? Was machen sie? Mein Caesar-Salat mit Lachs ist gekommen: von Lachs kaum eine Spur.
Café Méridien, Cannes. Hier habe ich gegessen, als ich zum ersten Mal in Cannes war, mit Two-and-a-Half Grand. Ich erinnere mich genau an dieses kleine Bistro, an das Gefühl unbändiger Zuversicht damals – mein erster Film, und ausgewählt für »Un Certain Regard« –, nichts konnte mich aufhalten. Ich weiß noch, wie ich einmal am frühen Morgen an dem Lokal vorbeikam und stehen blieb, um dem Patron zuzusehen, der den Bürgersteig spritzte und dann die Tische eindeckte. Heute früh sah ich einen Mann mit finsterem Blick genau bei der gleichen Arbeit, und mir wurde plötzlich auf merkwürdige Weise bewusst, dass ich vor all den Jahren auf demselben Fleck gestanden und das gleiche Ritual verfolgt hatte, dass sich hier zufällig ein Lebenskreis geschlossen hat, und das punktgenau. Rückblende: Ich war neunundzwanzig Jahre alt. Benji war zwei, Max war unterwegs … Zu denken, dass Annie und ich damals glücklich waren …
Tanja hat aus Prag angerufen, wo sie dreht. Es dauert länger, und sie schafft es wahrscheinlich nicht zum Screening. Herrgott noch mal! Es steht in ihrem Scheißvertrag, dass sie für PR beurlaubt werden muss! Ich muss beim Studio anrufen: The Sleep Thief beim Filmfestival von Cannes ohne Tanja Baiocchi – wie sieht das aus? Welche Botschaft ist das denn?
Das kleine Hotel, in dem ich immer absteige, heißt jetzt Hotel Carlone. In einem Videoverleih fand ich ein altes Video von Dix-Mille Balles (Two-and-a-Half Grand). Ich hätte fast geheult.
Welche Farbe hat Tanjas Haar? Karamell. Butterscotch. Fudge. Toffee … Alles essbar, alles Süßigkeiten.
Idee für den nächsten Film, der Blue on Blue heißen soll – ein Ausdruck bei der British Army, wenn man aus Versehen auf die eigenen Leute schießt.
Betrachtungen über den Nabel: eine Narbe, mit der jedes menschliche Wesen herumläuft … Der Schrei eines Babys braucht keine Übersetzung … Ein Schrei hat keinen Akzent … Ein Gähnen wird überall auf der Welt verstanden … Die banalen Tatsachen des Lebens sind einfach nur wahr, trotz ihrer Banalität.
Habe Terry Mulveheys neuen Film gesehen, The Last Rebel (warum hatte er es in die Director’s Fortnight geschafft – und ich nicht?). Ein absolut lachhafter und doch irgendwie schöner Film. Die Story von Wings of a Dove auf den Amerikanischen Bürgerkrieg übertragen. Es wurde nicht einmal versucht, die Frisuren der Männer an das neunzehnte Jahrhundert anzupassen. Für einen schönen Shot verzichtet Mulvehey auf alles: narrative Glaubwürdigkeit, Figurenentwicklung, Tempo, Spannung. Alles wird dem schönen Shot geopfert. Kompositorisch ist der Film ohne Makel, aber als reale Story über reale Menschen – rien. Eitelkeit und Nichtigkeit. Tanja hat die ganze Woche nicht zurückgerufen. Habe ihr eine SMS geschickt, mit der Frage, wer Pascals Vater sei. Ich fürchte, das war ein kapitaler Fehler.
The Duke of Kent wurde in meiner Abwesenheit in The Flaming Terrapin umgetauft. Seltsamer Name für ein Pub, aber was weiß ich? Wir haben jetzt Musik (fast übertönt vom kollektiven Gebrüll der Gäste), wir haben jetzt stumme Fernseher, die ein regengepeitschtes Golfturnier zeigen, mit Golfern, von denen nur die bunten Regenschirme sichtbar sind. Ich schiebe mein Thai-Hühnchen vom Holzkohlengrill auf dem Teller hin und her und bestelle noch ein Glas goldenen, sonnengesättigten australischen Chardonnay (mein drittes).
Es ist Freitag, Lunchtime, und man spürt das wilde Aufkeimen der Wochenend-Fressgelüste. Diese jungen Leute in ihren besten Jahren fressen und saufen und qualmen, als ginge es um ihr Leben. Und natürlich geht es um ihr Leben, wenn sie nicht aufhören, in dieser Weise zu fressen, zu saufen und zu qualmen. Statt Rule Britannia Fool Britannia. Was ist bloß mit uns los? Wenn ich mir die Leute hier ansehe, sind wir eine Nation von maßlosen Gierhälsen geworden. Dralle Girls trinken literweise Stout und extrastarkes Lagerbier, junge Kerle mit Ziegenbart und geschorenen Köpfen beugen sich über vollgeladene Teller, schaufeln sich die Pasteten und Burger, Spareribs und Bratwürste rein, stopfen sich die Backen und Wänste voll. Ich lasse mein Thai-Hühnchen liegen.
Eben habe ich mich zur Theke durchgekämpft und mir noch ein randvolles Glas Wein geholt. Jetzt merke ich mit Schrecken, dass es »große« Gläser sind, die ich getrunken habe, das heißt, jedes Glas entspricht zwei normalen Gläsern Wein. Kein Wunder, dass ich mich ein bisschen aufgeputscht und taumelig fühle.
Wie werde ich ein erfolgreicher Regisseur, Seite eins, erster Absatz, Regel Nummer eins: Verliebe dich niemals in die Hauptdarstellerin.
Vier biedere japanische Geschäftsleute am Nebentisch haben mich eben gebeten, ein Foto von ihnen zu machen, und ich tat ihnen den Gefallen. Haben wohl kaum geahnt, wer es war, der auf den Auslöser drückte. Ist irgendwas seltsam an diesem Bildmotiv? Vielleicht sollte ich es für die Schlussszene von Blue on Blue verwenden. Einfach die vier Japaner in die Cafészene stecken, bevor sich der Hauptheld erschießt – wie sie sich im Hintergrund fotografieren –, und unkommentiert lassen. Cool.
Zwei ausländische Mädchen – Au-Pairs? Touristinnen? –, eine deutsch, die andere aus Belgien(?), sprechen neben mir am Nachbartisch Englisch, unbeeindruckt von meinem Alkoholkonsum und meiner Nähe. Ich erfahre, dass eine von ihnen, die Deutsche, endlich eine Beziehung mit einem Mann hat, die schon einen vollen Monat hält. Die Freundin zeigt echte, unverfälschte Freude. (Nebenbei: Die Glückseligkeit von Frauen, wenn die Freundin einen Mann findet – kein Gefühl, das beim anderen Geschlecht eine Entsprechung hätte.) Diese Mädchen haben beide einen Salatteller bestellt, dazu Wasser die eine, Orangensaft die andere. Das ist ihr Lunch – erstaunlich. Was lockt sie in ein hektisches, lärmiges Fresslokal wie dieses? Diese Mädchen gehören zu einer neuen, internationalen Spezies, sind auf der ganzen Welt zu Hause, sprechen ein gutes, wenn auch nicht akzentfreies Englisch, eine Art fließendes Euro-Englisch: »I am very bad with separation«, sagt die Deutsche, als sie schon im Gehen begriffen ist. Kein Engländer würde das so sagen, aber man versteht es sofort.
Leo Winteringham hat Blue on Blue abgelehnt.
Sind nicht die einzigen Wahrheiten, für die man sich wirklich verbürgen kann, diejenigen, die man selbst tief empfindet? »Ich bin glücklich« ist etwas, was man nur für sich selbst feststellen kann. Absolut. Alle anderen Interpretationen der Welt, die über einen selbst hinausgehen, sind daher suspekt, bloße Vermutungen und Folgerungen. »Tanja Baiocchi ist eine unfassbar schöne Frau«, »The Sleep Thief ist ein außergewöhnlich schlechter Film« – ich verliere den Faden, der schwere australische Wein macht sich bemerkbar, fordert seinen Tribut. Wie ging diese Zeile bei Tennyson? Der Mensch bestellt das Feld und legt sich in die Grube kann man zu intelligent sein für den Erfolg Leo war meine letzte Hoffnung und nach vielen Sommern stirbt der Schwan aber ich weiß nichts nichts keine Gewissheiten zu haben kann sehr anregend sein kreativ diskutieren was genau ich wirklich weiß Tanja Baiocchi ist zu Pierre-Henri Duprez zurückgezogen ich bin nicht glücklich auch ich bin schlecht in Trennung das Problem mit mir ist dass ich nie [Notizbuch endet hier.]
Eine Heimsuchung
ILos Angeles
Ich heiße Alexander Rief. Ich heiße Alexander Rief. Ich heiße Alexander Rief – und ich glaube, ich werde verrückt.«
Ich saß in der Business Class eines Jumbojets auf dem Flug nach L.A., als ich diese Sätze in mein Notizheft schrieb – wohl weil ich glaubte, dass mir die einfache Wiederholung meines Namens eine Art Halt bieten würde, während sich mein Verstand verabschiedete. Ich hatte meine Skizzen für das Demarco-Projekt in Pacific Palisades durchgesehen und fühlte mich relativ gut, ich hatte gegessen und keinen Alkohol getrunken, weil ich einen schwachen Kopfschmerz verspürte. Er fing etwa eine Stunde nach dem Start in London an, was nichts Ungewöhnliches war – außer dass Kopfschmerzen bei mir selten sind –, aber an diesen Schmerz erinnere ich mich, weil er sich fast wie ein Gegenstand in meinem Kopf umherbewegte, so als würde etwas durch mein Schädelinneres kriechen, vom Nacken ausgehend durch die rechte Kopfhälfte, um sich in der Mitte der Stirn festzusetzen. Ich nahm zwei Aspirin und wartete auf die Wirkung, aber sie schienen nicht zu helfen. Der Schmerz nahm stetig zu, so stark, dass ich ihn nicht mehr ignorieren konnte. Er war nicht bohrend, nicht pochend, aber er war da, unabweislich, und ließ nicht locker. Ich massierte meine Stirn mit den Fingerspitzen, ich rieb sie mit dem kühlenden Gel ein, das ich in der Kulturtasche der Business Class fand, und nahm mir schließlich meine Arbeit vor, in der Hoffnung, dass mir die Ablenkung Linderung verschaffen oder ich zumindest an andere Dinge denken würde als an Blutgerinnsel, Schlaganfälle und Tumoren, die sich immer stärker in meine Überlegungen drängten.
Ich sah mir also die Skizzen für die Demarco-Terrassen an, den Verlauf der Gehwege hinab zum Pool und die Randbepflanzung, ich nahm meinen Stift heraus und fügte den Zypressen, die ich hinter das Poolhaus gesetzt hatte, ein paar Schraffierungen hinzu.
Als ich gerade an den Laubschattierungen arbeitete, spürte ich meinen Arm plötzlich kalt werden, als wäre meine rechte Seite der Zugluft ausgesetzt. Im selben Moment spürte ich, aber ohne es wirklich zu fühlen, dass meine Finger den silbernen Stift fester umschlossen; ein leichter, aber deutlicher Tremor brachte die Spitze des Stifts zum Flirren wie den Zeiger eines Seismographen vor einem größeren Erdbeben.
Und dann begann ich – oder vielmehr meine Hand – zu malen, große kräftige Figuren quer über meine zarte Zeichnung der Demarco-Terrassen. Sie sahen x-förmig aus, doch jeder der vier Arme war horizontal in die Länge gezogen. Meine Hand richtete den Stift auf, damit er die Figuren richtig zeichnen konnte, und wenn eine fertig war, fing die Hand sofort mit der nächsten an. Bald war meine ganze Skizze bedeckt, und ich drehte das Blatt um, damit sie weiterzeichnen konnte – was sie auch tat, zielstrebig, sorgfältig, alle X-Figuren in derselben Größe, ohne dass etwas Hastiges oder Fieberhaftes daran war.
Ich saß da, fast atemlos, während meine rechte Hand selbstständig fortfuhr, die Seite vollzumalen. Einmal legte ich die linke Hand beruhigend auf meine rechte Faust, aber