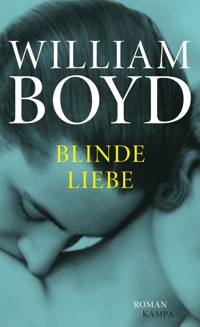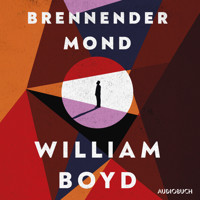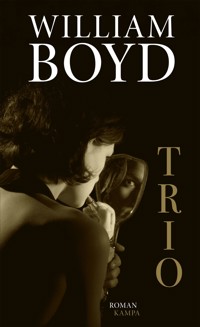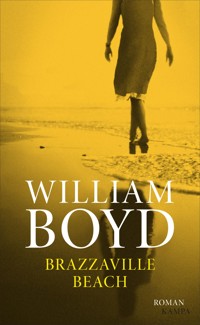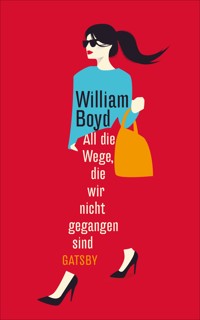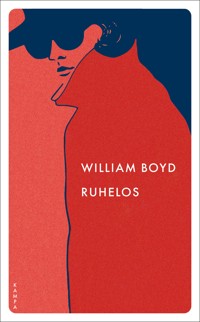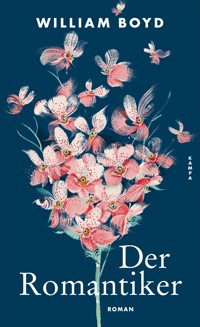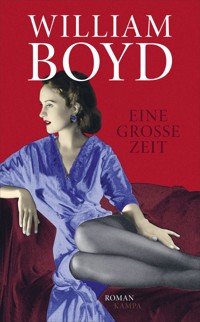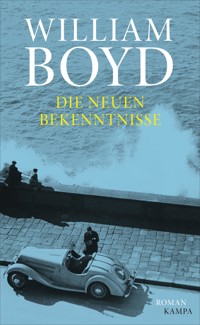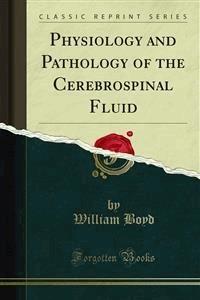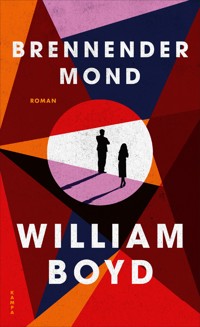
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabriel Dax' Nächte sind kurz. Seit seiner Kindheit leidet er unter Albträumen: Erinnerungen an jene verhängnisvolle Nacht, in der seine Mutter und sein Elternhaus einem verheerenden Brand zum Opfer fielen. Seiner Schlaflosigkeit zum Trotz ist der gefeierte Reiseschriftsteller aus Chelsea auf der ganzen Welt unterwegs – einer vom Kalten Krieg zerrissenen Welt. In Zentralafrika bietet sich ihm die exklusive Gelegenheit, den ersten Ministerpräsidenten des erst seit Kurzem unabhängigen Kongo zu interviewen. Dax wittert eine große Story, doch dann verschwindet Patrice Lumumba kurz nach ihrem Gespräch spurlos. Für die britische Presse ist der afrikanische Politiker damit auf einen Schlag Schnee von gestern, stattdessen aber haben plötzlich diverse Geheimdienste Interesse an Dax' Aufzeichnungen, allen voran die mysteriöse Agentin Faith Green, deren Charme Dax bald zum Verhängnis wird. Er ahnt: Lumumba hat in dem Gespräch mehr offenbart, als so manchem lieb ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
William Boyd
Brennender Mond
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer
Kampa
Für Susan
Lepers of the moon
all magically diseased
we come among you
innocent
of our luminous sores.
/
Aussätzige des Mondes
alle magisch erkrankt
kommen wir unter euch
unschuldig
an unsren leuchtenden Wunden.
Mina Loy
Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr.Dieser Punkt ist zu erreichen.
Franz Kafka
PrologOxfordshire
1936
Gabriel verfolgte aufmerksam, wie seine Mutter das Nachtlicht neben seinem Bett anzündete. Dieses Ritual war ihm wichtig, es stand für Ordnung und Ruhe. Der Docht des Kerzenstummels entflammte, und sie stülpte vorsichtig den Glasballon darüber und pustete das Streichholz aus, das sie benutzt hatte. Der Mond – sein Nachtlicht war ein Mondglobus aus Glas – schien auf, ungleichmäßig pulsierend zunächst, vom Flackern der Kerzenflamme, das sich allmählich legte. Eingeätzte Gebirgszüge, Mondwüsten und Meteorkrater leuchteten in der kleinen Mondlandschaft auf. Gabriel konnte nur schlafen, wenn das Mondnachtlicht auf dem Tischchen neben seinem Bett brannte: aschgrau und golden, eine Welt, die ihm ebenso vertraut war wie der Garten draußen.
»So, mein Schatz. Bitte schön.« Seine Mutter setzte sich neben ihm aufs Bett. »Gabriels Mond, und die Welt ist in Ordnung.«
»Warum haben wir nicht jede Nacht Vollmond?«, fragte er. »Das verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht. Es muss einen Grund dafür geben. Einen astronomischen Grund, nehme ich an. Wir schauen morgen im Lexikon nach.«
Gabriel stellte diese Frage nicht zum ersten Mal und hatte immer ähnlich unbefriedigende Antworten erhalten.
»Ist Daddy auf dem Mond?«, fragte er.
»Nein. Daddy ist im Himmel. Das ist nicht dasselbe wie der Mond.«
»Vielleicht ist ja der Mond der Himmel.«
»Nun, falls er das ist, dann werden wir eines Tages alle mit ihm zusammen auf dem Mond sein«, erwiderte sie auf ihre munter-sachliche Art, als lasse sich alles in der Welt irgendwie begreifen, wenn man sich nur Mühe gab. Dann beugte sie sich vor, um ihn auf die Wange zu küssen. Er roch ihr Parfüm, das Lavendelwasser, das sie benutzte und das nicht ganz den Geruch von Zigarettenrauch überdecken konnte, der ihr anhaftete. Sie rauchte andauernd, seine Mutter.
»Sefton behauptet, es gibt keinen Himmel«, sagte Gabriel. Sein älterer Bruder, der im Internat war, war seit Neuestem glühender Atheist, und das mit vierzehn. »Und er sagt auch, es gibt keinen Gott.«
»Na ja, das ist bloß Seftons Meinung. Ein jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber Sefton kann manchmal sehr dumm sein, um nicht zu sagen, äußerst albern, wie wir alle wissen.«
»Gibt es keinen Gott?«, fragte Gabriel. Die Vorstellung beunruhigte ihn auf unklare Weise.
»Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Master Gabriel Dax«, sagte seine Mutter mit Nachdruck. »Du hast morgen Schule. Da gibt es Wichtigeres, was dich beschäftigen sollte.«
Sie stand auf und strich sorgfältig die Bettdecke glatt.
»Nun schlaf schön, mein süßer Junge. Wir werden alle bei Daddy auf dem Mond sein, ehe du dich’s versiehst.«
Sie knipste die Nachttischlampe aus, und das Zimmer versank im vertrauten Mond-Schummerlicht. Sie warf ihm noch eine Kusshand zu und schloss dann leise die Tür. Gabriel drehte sich auf die Seite und starrte sein leuchtendes Nachtlicht an. Eines Tages würde er zum Mond reisen und seinen Vater finden, sagte er sich. Ja, das würde er …
Es war der Geruch von Rauch, der ihn einige Zeit später weckte, kein Zigarettenrauch allerdings. Eher der Rauch eines Feuers, denn ihm brannten die Augen davon. Was war denn los? Das Zimmer war von Rauch vernebelt, und seinen Mond umgab ein wabernder Lichtkranz. Er schlüpfte aus dem Bett und öffnete die Tür – und wich zurück. Orangefarbenes Flammenlicht, das munter überall umhertanzte. Große, wirbelnde Rauchwolken, die vom Erdgeschoss die Treppe heraufquollen; dicke graue Rauchfoulards, die unter der Decke hingen. Er zog seine Schlafanzugjacke übers Gesicht, um seine Nase zu bedecken, und stürmte panisch die Treppe hinunter. Unten brannte alles, so schien es ihm – wo war seine Mutter?
Er rannte in das große Wohnzimmer und sah sie vor dem Spirituosenschrank liegen, mit dem Gesicht nach unten. Die Perserbrücken um sie herum standen in Flammen, kleine, identische Feuer, genährt vom dichten Flor der Teppiche.
»Mummy!«, schrie er. Aber sie reagierte nicht.
Da krachte ein Teil der Decke in die Tiefe, und heiße Luft fegte durch das schartige Loch nach oben, hinauf ins Obergeschoss, wo sie neuen Flammen Nahrung bot. Der Hitzeschwall an seiner Stirn ließ ihn zusammenzucken, er spürte, wie sein Haar austrocknete und verklebte, schmeckte den Rauch, der ihm aschig-heiß in der Kehle gerann.
Er kniete neben seiner Mutter nieder und schüttelte sie am Arm. Nichts. Er packte sie an der Schulter und drehte sie mühsam herum.
Als er ihre halb geöffneten Augen sah, wusste er, dass sie tot war. Wie konnte er das wissen? Er berührte ihr wunderschönes Gesicht.
»Mummy!«, schrie er ein weiteres Mal. »Mummy! Verlass mich nicht!«
Dann stürzte einer der großen Deckenbalken des Wohnzimmers ein. Gabriel taumelte in der Backofenhitze zurück, die in einer Welle auf ihn zurollte und ihn einhüllte. Seine Haare und Augenbrauen wurden versengt, er konnte es riechen, scharf und beißend. Er spürte, wie seine Stirn und die Wangen glühten und knisterten, geröstet vom Feuersturm.
Er wurde zu einem Tier. Flucht war die einzige Überlebenschance. Er hastete in die Küche, zu der Seitentür dort, aber sie war abgeschlossen. Wo war der Schlüssel? Wo bewahrten sie den Schlüssel auf? Er fühlte die Gluthitze hinter sich, die seinen Rücken umarmte, umfing, umklammerte und seinen Schlafanzug zu Pergament ausdörrte. Er versuchte das Bleifenster neben der Küchentür zu öffnen, doch der Riegel klemmte. Er zog den Tisch mit dem Telefon näher heran, kniete sich auf die Platte, hob den Apparat in die Höhe und benutzte den Hörer als Hammer, mit dem er auf den Griff des Riegels einschlug, bis er nachgab und sich öffnete. Wundervoll kalte Nachtluft fächelte ihm ins heiße Gesicht. Er schleuderte das Telefon aus dem Fenster, ehe er ihm nachfolgte, sich durch die Öffnung ins Freie hievte und zappelte, egal wie – er wollte nicht bei lebendigem Leib verbrennen. Er plumpste in die Rabatte, wälzte sich erleichtert auf dem feuchten Laub und der Erde, rappelte sich auf die Beine und stolperte auf den Rasen hinterm Haus.
Er rannte hinter den Fischteich, wo er sich hinhockte, als wäre er durch das trübe Wasser irgendwie geschützt, und blickte zum Haus zurück, dem Heim der Familie Dax, Yeomanswood Farm. Die Feuersbrunst hatte sich inzwischen voll ausgebreitet, das Strohdach brannte lichterloh, mit fleischig lodernden Flammen, fett und tosend, als ob im Inneren Bomben explodierten. Nur Sekunden später, so schien es, sah er das gesamte Dach mit einem dumpfen Wuumpf einstürzen, und ihr zweistöckiges Haus wurde zu einem riesigen einstöckigen Scheiterhaufen. Die Flammen schlugen weit in die Höhe, als würden sie von einem seltenen Brennstoff genährt, wärmten ihn sogar aus dieser Entfernung und färbten den Fischteich orange.
Dann hörte er die Glöckchen der Feuerwehrautos schrillen, sah ihre Lichter, als sie auf der Landstraße von Witney heranrasten. Sefton war in seinem Internat in Sicherheit – vielleicht könnten sie Mummy ja noch retten, dachte er unsinnigerweise, dabei wusste er – ohne jeden Zweifel –, dass seine Mutter schon tot war, aufgezehrt von dem Feuer. Fort, um von nun an bei seinem Vater zu sein, auf dem Mond.
Er blickte zum Himmel auf, verzagt und voller Angst, und hielt Ausschau nach dem Mond, aber vergebens, denn es war eine bewölkte Nacht. Wo war Gabriels Mond? Er heulte auf vor Jammer und Leid, ein Laut, der seiner kleinen, heißen Lunge entwich, hin- und hergerissen zwischen Nichtbegreifen und bitterer Einsicht. Wie war das geschehen? Was sollte nun aus ihm werden? Wie würde er jemals seine Mummy und seinen Daddy auf dem Mond wiedersehen?
Erster TeilLéopoldville London Madrid Cádiz
1960–61
1Diktatorenland
Es war ein feuchtheißer Augusttag in Léopoldville, in der seit Kurzem unabhängigen Republik Kongo. Gabriel Dax spähte über den gewaltigen, trüben Kongo-Fluss, hinüber in Richtung Brazzaville am anderen, meilenweit entfernten Ufer, dessen Gebäude nur verschwommen zu erkennen waren, wie verschleiert durch den Hitzedunst und die Ferne, einer mythischen Stadt im Hintergrund eines Renaissanceporträts nicht unähnlich. Der Fluss war grün wie Kanonenmetall, trotz des blassblauen, wolkenlosen Himmels. Er war tief, der Kongo, und seine Farbe änderte sich eigentlich nie, mochte der Himmel darüber nun azurblau sein oder dräuend grau.
Gabriel stand auf dem wimmelnden Boulevard, der entlang der Kais verlief, umgeben von Lärm und Trubel wie auf einem Jahrmarkt – beschleunigende Fahrzeuge, Hupen, Geschrei, Pfiffe. Wie breit war der Kongo hier?, überlegte er vage, gefolgt von dem Gedanken, dass er darauf eine genaue Antwort finden müsste. Zehn Meilen, fünfzehn? Eher ein See als ein großer Fluss, dachte er, während er den geschäftigen, rastlosen Schiffsverkehr betrachtete – Fischer in schmalen Holzkanus, brummende Schnellboote, die Fähren, die massig und schwerfällig zwischen den Ufern hin- und herpendelten, an denen sich die Zwillingshauptstädte gegenüberstanden.
Er sah auf die Uhr. Aus Nervosität war er früh dran. Thibault hatte diesen neutralen Treffpunkt vorgeschlagen, anstelle des Hotels, wo es womöglich nicht unbemerkt geblieben wäre, wenn er in ein Regierungsfahrzeug einstieg. Geh runter zu den Kais und warte dort an dem großen Frangipani-Baum in der Rue Victor Hugo, hatte Thibault ihm erklärt, ich hole dich dort um drei Uhr ab. Gabriel stand im getüpfelten Schatten des Frangipani, wo eine Brise sein Haar befingerte, wobei aber die Windstöße warm und feucht waren, verflüssigend beinahe, dachte er. Der Duft der sonnengewärmten Blüten umgab ihn so dicht und intensiv, dass er förmlich mit Händen zu greifen war. Hausierer und Straßenhändler hatten vergebens versucht, ihm Kulis, Kämme, Schlüsselanhänger, Talismane, Schnürsenkel, Armbanduhren, Obst und Zuckerwerk zu verkaufen, doch nun hatte er Durst. Zeit für ein kaltes Bier. Seine lederne Reisetasche mit dem Tonbandgerät hatte er zwischen seinen Füßen abgestellt, und er bereute bereits, dass er sich entschieden hatte, eine Krawatte umzubinden. Einen Premierminister allerdings interviewte man schließlich nicht alle Tage. Er fand, dass er so weit präsentabel aussah, in seinem kurzärmeligen weißen Aertex-Hemd, der Hose aus leichtem, tropentauglichem grauen Flanell und den frisch gebürsteten Wildlederschuhen – jeder Zoll der seriöse, verantwortungsbewusste Journalist für eine große britische Tageszeitung.
Dann sah er den schwarzen Citroën DS, der auf dem Boulevard gemächlich auf ihn zusteuerte. Der Wagen hielt kurz an, und die hintere Tür schwang auf. Gabriel griff nach seiner Tasche und stieg ein. Thibault erwartete ihn auf dem Rücksitz; am Steuer saß ein Soldat. Der Wagen fuhr wieder los, und er und Thibault schüttelten sich die Hände. Sie hatten sich zwei Tage zuvor im Hotel Memling zum Abendessen getroffen. Thibault N’Danza war ein alter Freund von ihm aus Studienzeiten, ein Arzt, jetzt Gesundheitsminister in der Regierung des neuen Staates. Thibault hatte erst das Interview mit Patrice Lumumba angeregt, dem Premierminister, und dann alles Weitere in die Wege geleitet. Es war alles sehr schnell gegangen.
»Hör zu, ich weiß aber nicht sehr viel über kongolesische Politik oder die sonstigen Vorgänge im Land«, hatte Gabriel gesagt. »Ich werde mir ein bisschen wie ein Hochstapler vorkommen.«
»Du brauchst noch nicht mal eine Frage zu stellen«, sagte Thibault. »Er möchte bloß reden. Er möchte, dass alles dokumentiert wird, in einer ausländischen Zeitung – die einen guten Ruf hat«, fügte er mit einem Lächeln hinzu. Thibault war ein schmaler, langgliedriger Mann, von seinem Charakter her wachsam und nachdenklich. Von amerikanischen Missionaren adoptiert, war er in den Genuss einer Ausbildung im Ausland gekommen, wie sie der überschaubaren kongolesischen Mittelschicht, den sogenannten Évolués, verwehrt geblieben war. Aber nun, da das Land unabhängig war, würde sich alles ändern. Kongo den Kongolesen – nicht den Belgiern.
»Dein Tonbandgerät hast du doch hoffentlich dabei«, fragte Thibault.
»Ja. Warum besteht er darauf, dass ich unser Interview aufnehme?«
»Weil seine Stimme dann auf deinen Bändern sein wird. Ungefiltert, nicht verfälscht durch die Deutung eines Journalisten – bei allem Respekt, Gabriel – oder redaktionelle Bearbeitungen. Was immer du schreibst – was immer in deiner Zeitung erscheint –, die Bänder wird es ewig geben.«
»Gut, in Ordnung«, sagte Gabriel. »Spricht er Englisch?«
»Ein wenig. Er versteht es gut. Er wird Französisch sprechen, und ich kann übersetzen, wenn du magst.«
»Mein Französisch ist gar nicht so übel«, sagte Gabriel. »Sehen wir mal, wie es klappt.«
Er lehnte sich auf dem breiten Sitz zurück und versuchte sich zu entspannen, weil ihm auf einmal fast schlecht war vor Aufregung. Diese Art hochrangiger Begegnung war Neuland für ihn – er war Reiseschriftsteller, kein Reporter. Allem Anschein nach war er jedoch der einzige Mann, ausnahmsweise, der zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Schalte dein Tonbandgerät ein, sagte er sich, stell die üblichen banalen Fragen und lass Lumumba dann reden, auch wüten und schimpfen, wenn ihm danach der Sinn steht. Wie schwierig konnte das schon sein?
Nach etwa fünfzehn Minuten bog der Citroën in eine Einfahrt ein. Vor ihnen erhob sich eine hohe Mauer mit einem Metalltor und zwei Wachhäuschen. Ein Soldat mit Maschinengewehr warf einen Blick in den Wagen, sah Thibault, und die Torflügel öffneten sich; man winkte sie zu einer großen Villa im Kolonialstil durch, aus weißem Stuck, mit ausladenden Seitenflügeln und einer hohen, überdachten Säuleneinfahrt. Hier waren weitere Soldaten in Bereitschaft, mit weiteren zur Schau gestellten Waffen.
Thibault führte ihn auf einem Fußweg seitlich ums Haus herum und in einen langen, gepflegten Garten, links und rechts von Hibiskus und einer hohen Adventsstern-Hecke gesäumt. Ganz hinten erhob sich ein geräumiges, pavillonartiges Bauwerk aus Holz mit einer Veranda, weiß getüncht, wie die Villa. Gabriel und Thibault schritten über das harte, federnde Gras des Rasens auf den Pavillon zu. Das Dach war üppig mit lila Bougainvillea überwuchert, und hinter dem bescheidenen Bauwerk standen drei gewaltige Palmen, Baumriesen, Wächtern gleich. Hier, weit abseits vom Fluss, fühlte sich der Tag womöglich noch schwüler und drückender an. Umso dankbarer war Gabriel, als er beim Näherkommen sah, dass es auf der Veranda einen elektrischen Deckenventilator gab, der sich oberhalb der drei Korbsessel drehte, die um einen runden Glastisch herum gruppiert waren.
Als sie fast beim Pavillon angelangt waren, kam aus dem Inneren ein groß gewachsener Mann zum Vorschein, in einem schwarzen Anzug, weißem Hemd und mit einer schwarzen Fliege. Eine gepflegte, geschmeidige Erscheinung in den Mittdreißigern, bebrillt, mit einem sauber gestutzten, kurzen Kinnbart.
»Monsieur le Premier Ministre, je vous présente mon ami britannique, le journaliste, Monsieur Gabriel Dax«, sagte Thibault.
Gabriel schüttelte Patrice Lumumba die Hand.
»C’est un grand honneur, monsieur«, sagte Gabriel. »Merci infiniment.«
»Haben Sie das Tonbandgerät dabei?«, erkundigte sich Lumumba auf Englisch, mit starkem Akzent.
Gabriel hielt seine Tasche in die Höhe.
»Tout est préparé. Alles fertig und parat.«
»Gut. On peut commencer.«
Gabriel packte sein Tonbandgerät aus und stellte es auf den Tisch. Er hatte die Zwillingsbandspulen bereits eingelegt und aufnahmebereit fixiert. Er schob ein Mikrofon in den kleinen Zweifuß-Ständer und stöpselte es ein.
»Funktioniert es auch?«, fragte Lumumba lächelnd.
»Machen wir einen Test«, sagte Gabriel.
Er schaltete das Gerät ein, drückte die Aufnahmetaste und zählte laut bis fünf. Er spulte das Band zurück und drückte auf Abspielen. Lumumbas Anspannung ließ sichtlich nach, als er Gabriels aufgezeichnete Stimme beim Zählen hörte.
Thibault war im Pavillon verschwunden und kehrte nun mit einem Diener zurück, der ein Tablett mit Erfrischungsgetränken trug. Gabriel entschied sich aus irgendeinem Grund für eine Fanta. Lumumba öffnete sich ein Fläschchen Perrier. Thibault nahm Platz – damit war das Triumvirat versammelt.
Lumumba beugte sich vor und flüsterte Thibault etwas ins Ohr. Thibault nickte, flüsterte zurück. Er wandte sich Gabriel zu.
»Es kann losgehen«, sagte er. »Jederzeit.«
Gabriel spulte das Band bis zum Anfang zurück und drückte auf Aufnahme. Die beiden Spulen in dem Gerät begannen sich träge zu drehen. Gabriel schlug sein Notizbuch auf, räusperte sich.
»Monsieur le Premier Ministre«, fing er an. »Quels sont vos espoirs pour la République Démocratique du Congo?«
Gabriel bewegte sich eilig den Gang in der ersten Klasse hinauf, ohne das soeben aufgeleuchtete Schild mit der Aufforderung »Bitte anschnallen« weiter zu beachten. Er schenkte der Stewardess von Sabena Air ein gewinnendes Lächeln, schlüpfte in die winzige Toilette und verriegelte die Tür. Er entleerte ausgiebig seine Blase. Seit dem Abflug aus Léopoldville hatte er einiges an Bier getrunken, während er die ganze Nacht über die Notizen durchging, die er während seines Gesprächs mit Lumumba zu Papier gebracht hatte, und den Aufbau des Artikels zu konzipieren begann, den er darüber verfassen würde. Womöglich hatte das Bier ihn zusätzlich aufgeputscht, ihn in dem Gefühl bestärkt, hier eine Art journalistischen Coup gelandet zu haben. Alle Augen waren auf das ehemalige Belgisch-Kongo und die Wirren dort gerichtet, die Anlass zu Besorgnis boten. Seine Notizen jedenfalls waren umfangreich. Nach dem Interview, zurück im Hotel, hatte er sie noch weiter ergänzt, um sämtliche Einzelheiten, die sich ihm von dem Mann selbst, Patrice Lumumba, eingeprägt hatten. Seine unverkennbare Brille, sein gepflegter Kinnbart, sein scheues Lächeln, bei dem viel Zahnfleisch zum Vorschein kam, die schuppige Trockenheit seiner Haut, als sie einander bei ihrem Kennenlernen die Hände geschüttelt hatten. Wie Sandpapier, fand Gabriel. Gleichwohl, welch ein Segen, dass er in weiser Voraussicht sein Tonbandgerät auf diese Reise mitgenommen hatte. Alles Wichtige war somit auf Band festgehalten, nicht bloß in seinem Gedächtnis, und konnte jederzeit in Ruhe konsultiert werden.
Er betätigte die Klospülung und entriegelte die Tür. Nachdem er das Bordpersonal passiert hatte, kam ihm ein weiterer Passagier entgegen. Während er kurz stehen blieb, um ihn vorbeizulassen, entdeckte er zu seiner eigenen Überraschung in der zweiten Reihe eine Frau, die eins seiner Bücher las. Ist ja verrückt, dachte er. Der leuchtend rote Umschlag und die gezackte Schrift des Titels waren ihm förmlich ins Auge gesprungen. Es war sein drittes Buch, genauer gesagt, sein neuestes, und ihm war bisher noch nie jemand begegnet, der es tatsächlich las. Was für ein Zufall.
Er warf der Frau im Vorbeigehen einen unauffälligen Blick zu. Sie hatte den Kopf über das Buch geneigt und las mit einem Stift in der Hand. In den Vierzigern, schätzte er; ein starkknochiges, blasses Gesicht; seltsam mädchenhaftes, unfrisiertes Haar, das durch einen Haarreifen aus violettem Samt zurückgehalten wurde. Vielleicht sollte er sich zu ihr hinabbeugen und fragen, ob das Buch gut sei. Nein. Sehr schlechte Idee.
Versonnen lächelnd kehrte er an seinen Platz ganz hinten in der Kabine zurück. Beim Einchecken war er aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen in die erste Klasse hochgestuft worden und hatte natürlich alle damit verbundenen Annehmlichkeiten und den vorzüglichen Service voll in Anspruch genommen. Während er sich anschnallte, dachte er über den Zufall nach, einer Fremden zu begegnen, die in sein Buch vertieft war. Diktatorenland: Reisen durch Autokratien. Spanien, Portugal, die Dominikanische Republik, die Tschechoslowakei, die Elfenbeinküste. Von den Kritikern war das Buch in den höchsten Tönen gelobt worden, hatte sich aber nicht gut verkauft – was er im Rückblick auf den etwas hochtrabenden Untertitel zurückführte. Zu spät, es ließ sich nicht mehr ändern – er arbeitete bereits an seinem nächsten Werk, oder war zumindest schon mitten in der Planungsphase. Was ihm vorschwebte, war eine Rückkehr nach Griechenland mitsamt der Ägäis – um einige der Inseln zu besuchen, die er noch nicht kannte, und so vielleicht an den Überraschungserfolg seines Erstlings anzuknüpfen, Das weindunkle Meer … Er müsste sich einmal ernsthaft mit seinem Agenten unterhalten. Sein Lektor und Freund – Inigo Marcher, ebenso faul wie amüsant – war aus heiterem Himmel zu einem anderen, größeren Verlag gewechselt. Vielleicht könnten sie Kasse machen …? Beim Gedanken an seine Bücher lächelte er erneut vor sich hin und spürte gleichzeitig, wie die Boeing leicht kippte und mit einem Heulen gedrosselter Motoren in den Landeanflug zum Flughafen Zaventem in Brüssel überging. Lustig, diese Frau, die gerade Diktatorenland las, dachte er abermals. Wenn sie wüsste, dass der Verfasser nur wenige Plätze von ihr entfernt saß.
Sechs Stunden darauf – der Anschlussflug von Brüssel nach Heathrow hatte Verspätung gehabt – stand er vor seiner Wohnungstür in Chelsea, mit dem Koffer zu seinen Füßen, und suchte seine Taschen nach dem Hausschlüssel ab. Unvermutet riss die dichte Decke dahinziehender Wolken kurz über ihm auf, und ein wenig Sonne schien ihm lauwarm auf den Kopf. Er merkte, dass er froh war, wieder zu Hause zu sein. Seine Wohnung, eine »Garten-Maisonette«, befand sich in der Redburn Street, auf halbem Weg zwischen der King’s Road und der Themse. Die Wohnung war geräumig, zu groß eigentlich für seine Zwecke – zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche mit Essbereich und ein großzügig dimensioniertes Wohnzimmer, das auf den kleinen Garten zum Innenhof hinausging. Links neben ihm wohnte ein mürrischer Polizist, Donald Enright, zu seiner Rechten ein Taxifahrer mit seiner lebhaften Familie, die Calhouns. Die Leute in der Wohnung über ihm, ein junges Paar mit einer dreijährigen Tochter, waren erst vor Kurzem eingezogen und hatten sich ihm noch nicht ordentlich vorgestellt. Seine Nachbarn waren alle höflich und respektvoll, wenn auch nicht übermäßig freundlich. Seinem Eindruck nach war er ihnen nicht ganz geheuer: ein alleinstehender Mann, der viel verreist war und dann, wenn er aus dem Ausland zurückkam, bei sich zu Hause arbeitete, zu jeder Tages- und Nachtzeit, irgendeine Art Autor, wie er behauptete.
Er fand die Schlüssel. In seiner Wohnung kehrte er mit dem Fuß die Post beiseite, die sich hinter der Tür angesammelt hatte, und schaltete das Licht an. Er wohnte gern in Chelsea. Es war günstig mitten in der Stadt gelegen und so schäbig – bis auf ein paar Inseln, wo die Immobilien Gold wert waren –, dass es billig war und er sich diese große Wohnung leisten konnte. Er brachte den Koffer in sein Schlafzimmer und ging ins Wohnzimmer. Seine Afrikareise war relativ kurz gewesen, gerade einmal drei Wochen, und dennoch roch es hier bereits muffig, wie seit Längerem verwaist – nach altem Zigarettenrauch, Staub, klamm irgendwie, feucht. Er müsste die Gaskamine zehn Minuten oder so brennen lassen und es bräuchte frischen Zigarettenrauch – vielleicht einige stark duftende Blumen …
Er schaltete die Tischlampen an und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Gleich darauf sah er die Maus. Sie huschte an der Fußleiste entlang – verflixt, wie flink diese Winzlinge waren – und verschwand in die Küche. Ein kleiner Preis, dachte er, der für drei Wochen Abwesenheit zu zahlen war. Ein ungebetener Gast. Zu gegebener Zeit würde er das kleine Mistviech schon schnappen.
Er schob die Ablenkung durch die Maus vorerst beiseite und konzentrierte sich auf das, was ihm gerade intuitiv aufgefallen war. Sein Schreibsessel, der sonst immer exakt gegenüber vom Fernseher stand, war ein wenig beiseitegerückt. Auch die Bücherstapel auf seinem Schreibtisch, vor dem großen Fenster mit Blick auf den Garten, waren, wie er beim Nähertreten feststellte, nicht mehr so schnurgerade ausgerichtet, wie er sie hinterlassen hatte. Er ging weiter in die Küche. Auf dem Abtropfbrett neben der Spüle stand ein Glas. Vor seiner Abreise in den Kongo hatte er den Abwasch komplett erledigt. Fast schien es, als hätte ihn jemand darauf hinweisen wollen, dass ein heimlicher Besuch stattgefunden hatte.
Er sann kurz darüber nach, etwas beunruhigt. Bei ihm gab es eigentlich nichts, was sich zu stehlen lohnte: sein alter Fernseher, seine schwere Schreibmaschine, sein Hi-Fi-Plattenspieler und seine LPs, einige Dutzend … Er eilte mit großen Schritten in sein Schlafzimmer und riss die Schranktür auf – ja, er war noch da, sein schwarzer Ledermantel, pelzgefüttert, den er von seinem Großvater geerbt hatte, vermutlich das wertvollste Stück in der Wohnung. Wer also hatte hier herumgeschnüffelt und warum?
Er kehrte ins Wohnzimmer zurück und mischte sich einen Gin Tonic. Er zündete sich eine Zigarette an, entdeckte weitere Unregelmäßigkeiten – die umgeklappte Ecke eines Teppichs, ein leicht schief hängendes Bild. Es war jemand in seiner Wohnung gewesen, keine Frage. Lorraine womöglich?, überlegte er. Aber sie hatte natürlich keinen Schlüssel … Warum hatte er ihr eigentlich keinen Schlüssel gegeben?, fragte er sich unvermittelt. Sie war immerhin seine Freundin. Er drückte die Zigarette aus. Dann kam ihm der Gedanke, dass vielleicht Tyrone dahintersteckte, ihr Bruder, der sich damit brüstete, dass vor ihm kein verschlossenes Gebäude sicher war: ein Schlosser, der sich nebenher als Einbrecher betätigte. Es war Lorraine, die ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte, dass Tyrone sein Einkommen als Schlosser durch gelegentliche Einbrüche aufbesserte – was er energisch abstritt. Vielleicht war er also der Eindringling und hatte hier irgendetwas gesucht. Aber was? Er mochte Tyrone, fand seine großmäulige Art amüsant, die schon fast an eine Parodie grenzte. Tyrone, hatte er entschieden, war ein Lorraine-Bonus; er war ein faszinierender junger Bursche.
Tatsächlich hatte Gabriel Lorraine erst über Tyrone kennengelernt. Einmal nämlich war wirklich jemand bei ihm eingebrochen – die Kellertür war eingetreten worden. Eine Armbanduhr und etwas Bargeld waren ihm gestohlen worden, außerdem, und das war am ärgerlichsten, eine heiß geliebte, oft getragene Wildlederjacke. Er hatte einen Schlüsseldienst angerufen, und daraufhin war Tyrone bei ihm aufgetaucht, um sein kaputtes Schloss zu ersetzen. Nach Erhalt der Rechnung hatte Gabriel versehentlich einen nicht unterschriebenen Scheck an Tyrone übersandt, woraufhin umgehend Lorraine losgeschickt wurde, um das Geld bei ihm persönlich einzutreiben. Er hatte die Tür geöffnet und eine junge Frau erblickt, die mit seinem nicht unterschriebenen Scheck vor ihm herumwedelte. Ein ebenmäßiges, leicht männlich angehauchtes Gesicht, schlank, aber breitschultrig, die Haarspitzen bogen sich nach außen, so wie es gerade in Mode war. Anfangs war sie ziemlich aggressiv gewesen. Der älteste Trick der Welt, hatte sie gesagt und dabei den Scheck geschwenkt. Halten Sie uns für so blöd? Er hatte auf der Stelle um Entschuldigung gebeten und die Unterschrift nachgeliefert, zugleich jedoch war da ein spontanes Kribbeln gewesen. Gabriel, dem sein Fehler furchtbar peinlich war, hatte vorgeschlagen, noch auf ein Glas in den Pub um die Ecke zu gehen, als weitere kleine Wiedergutmachung. Warum nicht?, sagte sie, von mir aus gern, und entschuldigte sich bei ihm für ihre »große Klappe«. An jenem Mittag nahm etwas seinen Anfang, das nach wie vor im stürmischen Gange war.
Er packte den Koffer aus und räumte seine Kleidung fort – Koffer nicht unausgepackt zu lassen war eine Marotte von ihm – und vergewisserte sich, ob er genug Geld bei sich hatte. Es war an der Zeit, ein paar Vorräte zu besorgen – verreisen würde er in nächster Zeit erst mal nicht. Er hatte ein Buch zu schreiben, wie auch immer das aussehen mochte. Er war schon unterwegs zur Wohnungstür, als ihn das laute Klingeln des Telefons stoppte.
»Hallo?«
Stille. Eine lange Stille.
»Hallo? Hier Gabriel Dax.« Er bot seinen Namen als Köder an, doch es blieb weiter still. Er sagte noch ein paar Mal »Hallo«, bis ein Klicken zu hören war; der unbekannte Anrufer hatte aufgelegt. Verwählt? Nein. Dazu war es am anderen Ende zu lange still geblieben, ein absichtsvolles, aufreizendes Schweigen.
Gabriel wählte Lorraines Nummer. Sie wohnte noch zu Hause bei ihrer verwitweten Mutter. Am Telefon jedoch meldete sich Tyrone.
»Nein, sie ist bei der Arbeit, Gabe. Spätschicht.«
Lorraine arbeitete als Kellnerin in einer Wimpy Bar, Teil der Fast-Food-Kette. Ihre Filiale befand sich in der Fulham Road, zwanzig Minuten zu Fuß von seiner Wohnung entfernt.
»Ich richte ihr aus, dass du angerufen hast, Kumpel.«
»Du bist nicht zufällig in meiner Wohnung gewesen, Tyrone, oder?«
»Machst du Witze? Was soll ich in deiner Wohnung? Hab doch selber eine.«
»Schon gut. Vergiss es. Sag Lorraine, dass ich aus Afrika zurück bin.«
Gabriel spazierte zum Lebensmittelladen auf der King’s Road und stockte seine Vorräte auf: Brot, Eier, Milch, Cornflakes, Kartoffeln, Speck, Butter und noch eine Flasche Gin, aus dem Schnapsladen. Er war gerade, schwer beladen mit seinen Einkäufen, auf dem Heimweg den Radnor Walk entlang, als er eine Frau in einem rehbraunen Regenmantel sah, die vor ihm, an der Kreuzung Redesdale Street, etwa zwanzig Meter entfernt, die Straße überquerte. Sie tauchte unvermittelt zwischen zwei parkenden Autos auf und schritt eilig über die Straße. Er erkannte sie sofort wieder – es war die Frau aus dem Flugzeug, die sein Buch gelesen hatte. Das konnte er unmöglich auf sich beruhen lassen.
»Hallo!«, rief er laut. »Entschuldigung?«
Sie drehte sich nicht um und verschwand in die Redesdale Street. Gabriel folgte ihr hastig. An der Straßenecke war von ihr keine Spur zu sehen – es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Wo war sie denn abgeblieben? In ein Haus verschwunden? Er drehte sich einmal komplett um die eigene Achse, als könnte sie durch diese Bewegung irgendwie zurückgezaubert werden – aber nein …
Er trottete heimwärts, ließ stirnrunzelnd die merkwürdigen Zufälle Revue passieren: die Frau im Flugzeug mit seinem Buch, dann ihr zweites Auftauchen. Dazu die sorgsam arrangierte Unordnung in seiner Wohnung und der stumme Anruf, was hatte es damit auf sich? Er wurde unruhig. Für sich genommen war keiner der Vorfälle weiter bemerkenswert. Er war nicht beraubt worden, und die Frau schien von der Anwesenheit des Autors, dessen Buch sie las, nichts geahnt zu haben. Manche Tage im Leben sind nun mal so, sagte er sich, schwer zu erklären, seltsame Omen, die von der Ambivalenz der Welt zeugen. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Gabriel, als jede Schulweisheit sich träumen lässt.
Er packte gerade seine Einkäufe aus, als das Telefon klingelte. Es war sein Bruder Sefton.
»Ah, du bist zurück«, sagte Sefton, ein wenig überrascht. »Wie war die Reise, gut?«
»Aufschlussreich.«
»Magst du am Sonntag zum Essen kommen? Victorias Geburtstag – das muss irgendwie begangen werden.«
»Hast du vorhin schon mal versucht, hier anzurufen?«, fragte Gabriel.
»Nein. Wieso?«
»Ach, nur so.«
»Bei dir alles in Ordnung, Gabriel?«
»Ja doch. Alles bestens.«
»Also, kommst du dann zum Mittagessen?«
Weil Gabriel auf die Schnelle keine überzeugende Ausrede einfiel, sagte er zu, verabschiedete sich und legte auf. Er dachte über seinen älteren Bruder nach. Die Beziehung zwischen ihm und Sefton war seltsam förmlich und nicht sonderlich eng – sie waren vom Wesen her zu verschieden –, trotzdem sahen sie sich relativ oft und telefonierten mindestens einmal in der Woche. Gabriel mochte Seftons Frau, Victoria, eine zierliche, zurückhaltende Person, die so wirkte, als lege sie es bewusst auf maximale Unscheinbarkeit an, fast bis hin zur Unsichtbarkeit. Sie machte rein gar nichts aus sich, dabei hätte sie durchaus attraktiv oder zumindest interessant aussehen können, und das ohne großen Aufwand. Amüsant fand er auch ihre Kinder, seine beiden Neffen im frühen Teenageralter, Nigel und Cyril, vierzehn und dreizehn, sie weckten seine Neugier. Von wem stammte noch der Ausspruch, es sei eine der Tröstungen des Älterwerdens, zu sehen, wie sich die Kinder von Freunden entwickelten? Die Kinder seines scheuen, sonderbaren Bruders eigneten sich dafür ebenso gut.
Er machte sich ein Corned-Beef-Sandwich, schenkte sich ein Glas Bier ein und setzte sich dann an seine Schreibmaschine und den Artikel über Lumumba und die sich anbahnende Krise im Kongo. Lumumba war erst seit der Unabhängigkeit im Juni im Amt, doch in Léopoldville hatte kaum drei Monate später bereits eine fieberhaft angespannte Atmosphäre geherrscht. Der Staat Katanga im Süden – mit seinen riesigen Mineralvorkommen – hatte sich zornig abgespalten. Belgische sowie UN-Truppen waren eingetroffen, um eine Art Cordon sanitaire zwischen den Fraktionen einzurichten. Lumumba hatte um russische Militärhilfe ersucht, und damit schien die Möglichkeit eines Bürgerkriegs auf einmal sehr real; schon jetzt stand die junge Republik kurz davor, sich selbst zu zerfleischen. Während des Interviews hatte sich Lumumba vorsichtig optimistisch geäußert, aber alles an dieser Situation erschien zunehmend gefährlich.
Gabriel fing an, seine Notizen abzutippen, und hatte ungefähr tausend Wörter geschrieben, ehe er spürte, wie er allmählich schlappmachte. Er gähnte. Oh, ja, Müdigkeit, Ermattung, meine scheue, widerstrebende Freundin, dachte er. Er sah nach, wie es um seinen Tablettenbestand bestellt war: Es waren noch zwei übrig. Er rationierte die Seconal, weil er wusste, dass die Wirksamkeit von Schlaftabletten rasch nachließ, wenn man jede Nacht eine nahm. Also hatte er bewusst entschieden, mit seiner Schlaflosigkeit – seinen gestörten nuits blanches – zu leben, um dafür hin und wieder eine Nacht tief betäubt durchschlafen zu können. Heute würde er die vollen zehn Stunden benötigen, kalkulierte er, und machte sich im Geist einen Vermerk, seinen Arzt aufzusuchen, um sich ein neues Rezept ausstellen zu lassen.
Er putzte sich gerade die Zähne, als erneut das Telefon klingelte. Er kehrte ins Wohnzimmer zurück und ging ran.
»Hallo, Lorraine?«
Aber nein. Wieder Stille.
»Hören Sie«, sagte er ruhig, »Sie verschwenden Ihre Zeit, wer Sie auch sein mögen. Es verfängt nicht bei mir. Beunruhigt mich nicht im Geringsten. Okay? Und wenn Sie jede Stunde hier anrufen, juckt mich nicht. Wiedersehen.«
Er nahm seine Tablette, ging zu Bett und schüttelte das Kopfkissen auf. Dabei dachte er an die beiden Stunden zurück, die er mit Patrice Lumumba verbracht hatte, daran, wie Lumumba jedes Mal, wenn er seinen Worten Nachdruck verleihen wollte, die Hand ausgestreckt und ihm auf den Handrücken getippt hatte.
»Die wollen mich umbringen«, hatte Lumumba irgendwann mit starkem Akzent auf Englisch gesagt, mit leiser Stimme, als könnte ihn jemand belauschen.
»Wer?«
»Die Briten, die Amerikaner, die Belgier. Präsident Eisenhower wünscht meinen Tod.«
»Präsident Eisenhower? Doch sicherlich nicht?«
»Es gibt hier Leute, die hergeschickt wurden, um mich zu töten. Élimination définitive. Sie verstehen?«
»Ja. Aber anscheinend …«
»Ich nenne Ihnen drei Namen. Bitte merken Sie sich die.«
Gabriel war verwirrt, das Geständnis brachte ihn etwas aus der Fassung. Er nahm diese Behauptungen nicht ganz ernst. Es erschien paranoid, eine Wahnvorstellung.
»Warum? Welchen Nutzen sollte man sich von Ihrer Tötung versprechen?«
»Es geht um Uran, c’est évident, c’est simple.«
Lumumba hatte weiter über die Gefährdungen für seine Person gesprochen oder vielmehr geschwafelt, hatte auch Vorwürfe gegen die UN erhoben, weil sie insgeheim mit den Amerikanern und Belgiern zusammenarbeite.
Gabriel versuchte, sich noch an mehr zu erinnern, schlief aber über dem Thema Uran ein. Seine letzten wachen Gedanken fanden natürlich einen Grund: Atombomben. Uran für Atombomben.
»Was hat dich nach Léopoldville geführt?«, fragte Sefton.
»Bloß ein Auftrag für den Reiseteil, zunächst«, sagte Gabriel. »Eine Reportage über Léopoldville und Brazzaville. Du weißt schon, die beiden Hauptstädte, die nur durch den Kongo getrennt sind. Schon ungewöhnlich. Einzigartig sogar, dass zwei Hauptstädte so dicht beieinanderliegen.«
Sie waren im Garten von Seftons frei stehender roter Backsteinvilla in Highgate, nach dem traditionellen Sonntagsmahl – die Lammkeule, die Unmengen zerkochtes Gemüse, das Trifle zum Nachtisch und die Flasche guter Rotwein. Sefton nuckelte an seiner Verdauungspfeife und ließ Rauchwolken zu der Pergola aufsteigen, unter der sie standen und dabei zusahen, wie Cyril und Nigel auf dem Rasen einen Fußball herumkickten. Nicht direkt Sportskanonen, dachte Gabriel beim Anblick seiner Neffen, als Nigel den Ball in eine Blumenrabatte beförderte. Beide Jungen schienen ihm gleichermaßen unkoordiniert zu sein.
»Aber«, fuhr er fort, »die Sache war die, als ich in Léopoldville ankam, ergab sich die Gelegenheit, Patrice Lumumba zu interviewen, den Premierminister höchstpersönlich, unter vier Augen.«
»Großer Gott! Du? Wie denn das?« Sefton nahm die Pfeife aus dem Mund und deutete mit dem Stiel auf ihn, als wäre er die letzte Person auf der Welt, die dafür infrage kam. Gabriel legte ihm alles dar. Nach seiner Ankunft in Léopoldville habe er Verbindung zu einem alten Studienfreund aufgenommen, Thibault N’Danza, der sich als Gesundheitsminister in Lumumbas Regierung entpuppte. Es sei Thibault gewesen, der das Interview angeregt und alles Weitere im Handumdrehen organisiert habe. Lumumba sei von der Idee begeistert gewesen, sagte Gabriel. Ebenso seine Zeitung. Alles sehr spannend.
»Und du weißt ja auch so viel über die Politik in Belgisch-Kongo, nicht wahr?«, merkte Sefton sarkastisch an.
»Also, ich weiß genug, um dich darauf hinzuweisen, dass es nicht länger ›Belgisch‹ Kongo heißt.«
»Es ist eine praktische Unterscheidung. Zwei Länder, die Kongo heißen, das ist verwirrend. Wie dem auch sei, du hast also Lumumba getroffen. Den Mann der Stunde. Bravo.«
»Die Zeitung war ganz aus dem Häuschen. Exklusiv, all das. Ein Coup. Vergessen Sie die Reisereportage, sagte man mir, Lumumba hat Priorität. Im Grunde habe ich ihm bloß das Mikrofon hingestellt und ihn seinen Monolog halten lassen.«
»Du hast ihn aufgenommen?«
»Aber ja«, sagte Gabriel. »Er hat darauf bestanden. Er wollte, dass alles dokumentiert wird, glaube ich. War sehr darauf erpicht, seinen Standpunkt darzulegen. Den Eindruck hatte ich jedenfalls.«
»Warum?«
»Na ja. Die Sonntagsausgabe einer großen, seriösen, britischen Zeitung, große Reichweite. Ich war rein zufällig in Léopoldville, für einen anderen Auftrag. Ein erstklassiges Forum für einen missverstandenen afrikanischen Politiker in bedrängter Lage.«
Sefton hantierte gerade mit einem Streichholz, um unter Schnaufen und Schnauben seine Pfeife neu anzuzünden.
»War dir der Mann sympathisch?«, wollte er wissen, wobei ihm dichter Rauch aus den Nasenlöchern strömte.
»Ja.« Gabriel rief sich die Begegnung noch einmal vor Augen. »Er hat mir gefallen. Instinktiv. Er schien mir … ein rechtschaffener Mensch zu sein. Dabei aber auch unsicher, eindeutig sehr besorgt, weißt du. Das klang durch. Dass alles sehr labil ist.«
Sefton brach in heftiges Gelächter aus, bis sein belustigtes Gebell in Husten überging.
»Bleib lieber bei der Reiseschriftstellerei, Gabriel.« Er klopfte sich mit der flachen Hand gegen die Brust. Dann wandte er sich seinen Kindern zu. »Ihr müsst aufpassen, wo ihr den Ball hinschießt, Jungs!«, rief er.
Victoria tauchte auf und bot mit leiser Stimme frischen Kaffee an. Sefton lehnte ab, aber Gabriel folgte ihr ins Haus. Für Anfang September war der Tag empfindlich kühl – mit einem kalten, unangenehm rauen Wind und einem Himmel voll schwerfälliger Wolken –, er war froh, wieder ins Warme zu kommen.
»Danke noch mal für das schöne Geschenk«, sagte Victoria.
Gabriel hatte ihr ein geschnitztes Figürchen überreicht, das er auf einem Markt in Léopoldville erstanden hatte, aus Ebenholz, knapp zwanzig Zentimeter hoch, eine Art Mischwesen aus Mensch und Tier mit Hörnern und Brüsten und einem Schwanz, das in der einen Hand eine Hacke hielt und in der anderen eine Kürbisflasche. Es sei ein Talisman, erklärte er, der seinem Besitzer zu Wohlstand, Gesundheit und Glück verhelfen solle.
»Damit gebe ich mich zufrieden«, sagte Victoria, während sie ihm Kaffee einschenkte. Sie schien über das Geschenk aufrichtig entzückt zu sein und hatte es bereits auf dem Kaminsims aufgestellt. »Sie kann unsere Schutzgöttin sein. Ich liebe sie. So wunderschön geschnitzt. Wie aufmerksam von dir, Gabriel. Und du hast meinen Geburtstag nicht vergessen.«
In Wahrheit hatte er bei dem Kauf an Lorraine gedacht, aber Victorias Begeisterung war so augenfällig, dass er sich nun freute, die Statuette stattdessen ihr geschenkt zu haben. Lorraine, das wurde ihm nachträglich klar, hätte wahrscheinlich eher ablehnend reagiert. Ein unnützes Kinkerlitzchen aus Afrika. Er bot Victoria eine Zigarette an – sie lehnte dankend ab, mit der Begründung, sie versuche gerade aufzuhören – und zündete sich selbst eine an. Er musterte sie unauffällig. Völlig ungeschminkt – nicht mal ein wenig Lippenstift an ihrem Geburtstag –, das dichte braune Haar straff zurückgekämmt und zu einem komplizierten Knoten frisiert.
Er mochte Victoria, weil er wusste, dass sie ihn mochte und nichts auf Sefton und seine herabsetzenden Spötteleien gab. Bei einem Besuch hatte er einmal mitbekommen, wie sie am Telefon mit einer Freundin über ihn sprach. Er hatte zufällig gehört, wie sein Name fiel, und dann, ein wenig ängstlich, die Ohren gespitzt.
»Gabriel, ja«, hatte sie zu ihrer Freundin gesagt. »Du hast ihn bei Seftons Party kennengelernt. Erinnere dich – der große, hagere, hübsche, der wie ein darbender Dichter aussieht. Ja, das ist er, Gabriel … Seftons jüngerer Bruder. Unglaublich, dass sie blutsverwandt sind, oder? Und er ist ein sehr guter Autor.«
Gabriel hatte sich leise zurückgezogen, schamrot darüber, sie bei ihrer Lobrede belauscht zu haben, aber auch erfreut. Nun saß sie ihm gegenüber auf dem Sofa und hielt ihren Kaffeebecher mit beiden Händen umfasst, und bei ihrem Anblick rätselte er insgeheim, warum und wie um alles in der Welt sie ausgerechnet Seftons Frau geworden war. Die meisten Ehen sind ein Rätsel, sagte er sich.
»Weißt du was, Gabriel«, sagte Victoria lächelnd. »Ich werde, glaube ich, doch mal eine von deinen französischen Zigaretten probieren.«
Als Gabriel sich später verabschiedete, sagte Sefton, er würde ihn noch zur U-Bahn-Station begleiten, er brauche etwas Bewegung.
Gemeinsam gingen sie die Archway Road hinunter, und Gabriel fiel wieder einmal auf, wie bei jeder Gelegenheit, wenn er mit seinem Bruder allein war, wie unähnlich sie einander waren. Sefton, kompakt und übergewichtig, mit schon grau meliertem Haar, in seiner weinroten Strickweste und dem Wochenendanzug aus Tweed, eine gestreifte Clubkrawatte um den Hals gebunden. Wie war es möglich, dass sie Brüder waren? Doch genau das waren sie, beide ohne Eltern aufgewachsen, nachdem sie viel zu früh im Leben dieselben Tragödien hatten verkraften müssen.
»Und, geht’s jetzt wieder auf Reisen?«, fragte Sefton.
»Nein. Ich rühre mich eine Weile nicht vom Fleck.«
»Hättest du Lust auf einen Abstecher nach Kopenhagen? Um einen Brief für mich zu überbringen, persönlich.«
»Ist es für das Außenministerium?«
»Genau.«
»Nein, danke.«
Gabriel fühlte sich immer leicht unwohl, wenn Sefton ihn vorübergehend in seine Welt zu ziehen versuchte. Er hatte Sefton schon mehrfach »Gefallen« getan, wenn er im Ausland war. Hatte Briefe und kleine Päckchen überbracht, an unscheinbaren Adressen, in Geschäften und Apartmentblocks. Einmal hatte er eine Zeitung (Le Monde) auf einer Parkbank im Jardin du Luxembourg abgelegt. Ein andermal hatte er in einem Café in Lissabon lediglich »Nein« sagen müssen, zu einem Mann, der hereinkam und sich ihm gegenüber an den Tisch setzte. Woraufhin der Mann wieder aufstand und das Lokal verließ.
Er hatte Sefton beschuldigt, dem Secret Intelligence Service anzugehören, was Sefton lachend verneinte. Allein schon die Vorstellung, sagte er, sei zu drollig. Angehöriger des SIS? Ich, beim Auslandsgeheimdienst? Rede keinen Unsinn. Er arbeite schlicht und einfach im Außenministerium, stellte er klar, aber wir haben schon so einige Tricks auf Lager – o ja, du machst dir keine Vorstellung davon. Und dennoch war er Mitte der Fünfziger plötzlich für zwei Jahre an die Botschaft in Genf versetzt worden, wodurch die Familie hatte umziehen müssen, und als Gabriel nach ihrer Rückkehr bei Victoria nachhakte, was für eine Funktion Sefton in der Botschaft ausgeübt hatte, sagte sie, das wisse sie gar nicht so genau. »Irgendein Verwaltungsposten, der mit Pässen zu tun hatte«, besser konnte sie es nicht erklären. Und hier war er nun und bot ihm einen geheimnisvollen Abstecher nach Kopenhagen an.
»Auf unsere Kosten, Gabriel. Du wirst nichts draufzahlen müssen.«
»Ich bin sehr beschäftigt. Mit Schreiben.«
»Nun, denk darüber nach. Es eilt nicht. Kann warten, bis du so weit bist.«
Sefton wechselte das Thema.
»Hast du Onkel Aldous in letzter Zeit mal gesehen?«
»Lustig, dass du fragst. Er hat mich eingeladen, mal auf einen Drink vorbeizukommen.«
»Grüß den alten Mistkerl schön von mir, ja?«
Auf dem restlichen Weg zur U-Bahn tauschten sie Erinnerungen an Aldous Dax aus, fragten sich, wie er wohl mit dem Ruhestand zurechtkam, in den er erst vor Kurzem gewechselt war, und wer die neue Frau in seinem Leben sein mochte. Es gab viele Geschichten zu erzählen.
Lorraine glitt aus dem Bett und tapste durchs Zimmer, um »auf die Toilette zu gehen«, wie sie sagte. Als sie die Tür öffnete, wurde ihre schlanke, nackte Gestalt vom Licht in der Diele erhellt, und Gabriel spürte ein Ziehen in den Lenden, als seine sexuelle Energie von Neuem erwachte. Erstaunlich, denn erst zehn Minuten zuvor hatten sie einander heftig geliebt. Er ließ sich im Bett zurücksinken und dachte darüber nach, welch außerordentliche Wirkung Lorraine auf seine Libido hatte. Dann meldete sich ein leises Schuldgefühl, das seine Lust im Nu überlagerte, und er schämte sich.
Er war sich darüber im Klaren, warum er Lorraine so sehr begehrte: Weil sie kein bisschen wie er war und nichts von seiner Welt wusste; weil sie mit sechzehn von der Schule abgegangen war; weil sie mit breitem Londoner Akzent sprach, so manchen Konsonanten verschluckte; weil sie in englischer Grammatik nicht immer ganz sattelfest war und in einer Wimpy Bar kellnerte – genau das erregte ihn so sehr. Sie war exotisch, fremdartig, hatte nichts mit den anderen Frauen gemein, die er in seinem Leben schon geliebt hatte. Briony, Maud, Janet und Annabel gehörten alle, mehr oder weniger, seiner gesellschaftlichen und bildungsmäßigen Klasse an. Lorraine war Terra incognita, wild, faszinierend.
Merkwürdigerweise kam er zunehmend zu der Überzeugung, dass es ihr mit ihm nicht viel anders erging. Anderen Leuten stellte sie ihn manchmal als »meinen vornehmen Freund« vor. Sie bat ihn oft, einzelne Wörter und Redewendungen zu wiederholen, ließ sich von ihm die Bedeutung erklären, amüsierte sich kichernd über seinen Akzent, als könne sie es kaum fassen, dass sie sich mit einem so schrägen Lebewesen wie ihm paarte. Ja, Fremdartigkeit war keine Einbahnstraße, sie konnte von beiden Seiten aus empfunden werden, dachte er ein wenig reumütig, als sie ins Zimmer zurückkam und sich neben ihm ins Bett kuschelte.
»Wer ist ein kleiner Lustmolch?«, fragte sie, während sie seinen Schwanz befühlte. »Du kriegst aber auch nie genug, Gabe, mal ehrlich.«
Am Montagmorgen suchte er die Zeitungsredaktion auf und überreichte dem Auslandsredakteur, Grant Muldoon, sein fertiggestelltes Interview mit Patrice Lumumba.
»Knapp dreitausend Wörter«, erklärte er Grant. »Sie haben ja gesagt, ich soll so viel schreiben, wie ich möchte. Ich habe noch massenhaft mehr, auf den Tonbändern.«
»Phantastisch.« Grant blätterte die maschinengeschriebenen Seiten durch und nickte. Für seine Verhältnisse wirkte er ungewöhnlich aufgeregt. »Das bringen wir übernächsten Sonntag – groß aufgemacht. Prima Arbeit, Gabriel. Da haben wir Glück gehabt. Dafür gebe ich Ihnen einen aus, oder auch drei.«
Am übernächsten Sonntag allerdings war sein Text nicht in der Zeitung, wie er verwirrt und enttäuscht feststellen musste. Entlohnt hatte man ihn schon, der Scheck war erfreulich rasch per Post eingegangen, doch er hatte nie eine Druckfahne gesehen, ebenso wenig wie redaktionelle Anmerkungen. Eigenartig. Er rief Grant an, der einen ausweichenden, entschuldigenden Tonfall anschlug.
»Der Lauf der Geschichte hat Sie überholt, alter Knabe«, sagte er.
»Wie ist das zu verstehen?«
»Im Kongo hat es eine Art Putsch gegeben. Ein Soldat, ein gewisser Oberst Mobutu, hat anscheinend das Ruder übernommen, er hat jetzt das Sagen. Ihren Mann Lumumba hat man gefeuert, seines Amtes enthoben – er steht wohl unter Hausarrest, nach allem, was wir wissen. Ist momentan nicht einfach, sich ein klares Bild zu verschaffen.«
»Aber, Augenblick mal, was Lumumba zu sagen hat, ist doch nach wie vor interessant.«
»Es war interessant«, sagte Grant. »Tut mir leid, es so ohne Umschweife sagen zu müssen, Gabriel, aber das ist nun auf einmal Schnee von gestern. Wäre blamabel für uns, wenn wir das jetzt noch abdrucken. Die Ansichten eines kürzlich gefeuerten Ex-Premierministers. Vielleicht könnten Sie ja etwas über den anderen schreiben, diesen Mobutu.«
»Über den weiß ich nichts. Nun ja, vielleicht bringe ich den Text irgendwo anders unter – beim New Statesman, oder beim Econommist …«
»Äh, nein, daraus wird leider nichts. Nochmals, so leid es mir tut, Gabriel. Wir haben Sie schon entlohnt, vergessen Sie das nicht. Der Text gehört nicht mehr Ihnen, sondern uns.« Grants Tonfall änderte sich, er klang auf einmal nervös. »Schauen Sie, es ist vielleicht ganz gut so. Ihr Text war, na ja, sagen wir mal – kontrovers. Der Chefredakteur war unschlüssig, er wollte zunächst mit dem Eigentümer sprechen. Dann kam dieser Putsch dazwischen.«
»Wieso um Himmels willen war er bitte schön ›unschlüssig‹?«
»Weil Ihr Text sehr Lumumba-freundlich war«, sagte Muldoon. »Und nicht jeder findet, dass er, ähm, der große, kommende Mann ist, als den Sie ihn dargestellt haben. Im Kongo herrscht Durcheinander. Großes Durcheinander. Eine Menge eigennütziger Interessen, eine Menge Unruheherde.«
»Die Sache mit den Sowjets, meinen Sie.« Gabriel hatte langsam das Gefühl, dass die Angelegenheit für ihn einige Nummern zu groß war.
»Ja, das war nicht hilfreich. Verbuchen Sie das Ganze als Erfahrung. Letzte Woche war Lumumba noch ein heißes Eisen – dann ist das Eisen von einem Tag auf den anderen abgekühlt. Und mit kalten Eisen kann niemand was anfangen. Lassen Sie die Sache auf sich beruhen.«
Widerstrebend folgte er der Empfehlung. Er war über die Episode ein wenig verbittert, zumal der Arbeit wegen, die er hineingesteckt hatte. Ihm kam der ärgerliche Gedanke, dass Sefton womöglich recht hatte – vielleicht sollte er wirklich besser bei der Reiseschriftstellerei bleiben. Er überlegte, ob er die ursprünglich geplante Reportage über Léopoldville und Brazzaville wieder in Angriff nehmen sollte – die beiden durch einen mächtigen Fluss getrennten Hauptstädte …
Und dann stand ihm auch schon die Idee vor Augen, in verblüffender Deutlichkeit. Genau darüber würde er als Nächstes schreiben. Über mächtige Flüsse – den Kongo, den Nil, die Donau, den Amazonas, den Mississippi –, aber auf eine Art, die es so noch nie gegeben hatte. Er rief seinen Agenten an, Jeff Lockhart, der ihn um ein zweiseitiges Exposé bat. Gabriel lieferte wie bestellt. Eine Woche später kehrte Lockhart mit einem Vertrag von Inigo Marcher und seinem neuen Verlag, Mulholland & Melhuish, zurück. Damit war sein nächstes Buch, Flüsse, geboren. Auf manchen Kongo-Regen folgte eben doch Sonnenschein, sagte er sich.
Unterwegs zu seinem Onkel legte Gabriel einen Zwischenstopp bei seinem Arzt ein, Muir Kinross, weil er dieses Rezept für Schlaftabletten benötigte. Muir war in seinen Sechzigern, ein trockener, amüsanter Schotte aus Edinburgh. Er war ein kultivierter, gut gekleideter Mann – stets in eleganten dunklen Anzügen –, dessen Sprechzimmer etwas von einem Bühnenbild hatte: auf dem Boden Teppiche von den Omega Workshops, Bücherregale mit Glastüren, ein spiegelblank polierter Schreibtisch, viele geschmackvolle Bilder an den Wänden. Sogar die Untersuchungsliege stand hinter einem gestickten Paravent aus den Wiener Werkstätten, auf dem sich allerlei Fabeltiere tummelten.
Muir schraubte seinen Füllfederhalter auf und stellte Gabriel in seiner gestochenen Handschrift, lauter Schleifen in lila Tinte, ein neues Rezept aus.
»Damit sollten Sie einen Monat oder zwei auskommen.«
Gabriel schob das Rezept in seine Jackentasche.
»Ich nehme sie nur dann und wann. Wenn das Bedürfnis nach einer durchschlafenen Nacht, sagen wir mal, akut wird.«
»Dieselben Träume? Dasselbe Problem?«
»Ja. Feuer. Es sind immer Feuer«, sagte Gabriel müde. »Kleine Feuer, die nicht ausgehen wollen.« Er legte eine Pause ein. »Ich schlafe ein, träume dann von Feuern und wache auf. Danach kann ich nicht mehr einschlafen.«
»Was ist mit Ihrer Mutter?«
»Sie kommt darin niemals vor – aber natürlich geht es eigentlich um sie. Um jene Nacht.« Er legte eine Pause ein. »Nehme ich an. An viel kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht erinnern. Bruchstücke. Doch es geht immer um Feuer.«
Muir war mit den wesentlichen Einzelheiten von Gabriels Biographie vertraut – und er verschrieb ihm nun schon seit Jahren Schlaftabletten.
»Haben Sie schon mal eine Psychoanalyse in Betracht gezogen?« Muir lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Nur so ein Gedanke.«
»Darüber nachgedacht habe ich schon«, sagte Gabriel. »Aber es gibt hier kein Rätsel – ich weiß ja genau, warum ich nicht schlafen kann und warum ich diese Träume habe. Da gibt es nichts, was mir irgendjemand erklären müsste.«
Muir zuckte mit den Schultern.
»Ich frage bloß, weil einer meiner Patienten, ebenfalls mit Schlafstörungen, mit einer speziellen Psychoanalytikerin herausragenden Erfolg erzielt hat. Sie ist in Hampstead ansässig. Ein Termin bei ihr könnte sich lohnen. Man kann nie wissen …«
Er griff nach seinem Füller und blätterte kurz in einem Notizbuch, bis er fündig wurde. Dann notierte er eine Telefonnummer und eine Anschrift auf einer Karteikarte, die er Gabriel aushändigte.
»Dr. Katerina Haas«, las Gabriel vor. »Klingt deutsch. Gefällt mir. Authentizität. Vielleicht rufe ich mal da an.«
Während der Busfahrt nach Kensington dachte er weiter über diese Katerina Haas nach. Gegen die Psychoanalyse hatte er keine Vorbehalte, solange sich niemand dazu verstieg, sie als Wissenschaft oder irgendwie wissenschaftlich zu bezeichnen. Vielleicht könnte sie ja als Placebo helfen – gemäß dem alten Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Er durfte nichts unversucht lassen, dachte er in einer jähen Aufwallung von Stress: Denn so konnte es unmöglich den Rest seines Lebens weitergehen – die durchwachten Nächte, die Benebelung tagsüber, die Energieschübe und die plötzliche überwältigende Müdigkeit – das mühsame Leben eines Menschen, der nicht schlafen konnte.
Aldous Dax lebte in einer großen Wohnung in einem Mietshaus hinter der Albert Hall. Er nahm Gabriel überschwänglich in Empfang, mit Küsschen links und rechts.
»Liebster Junge, wie schön, dich zu sehen! Geht es dir gut? Du siehst müde aus, Schatz. Hast du immer noch Probleme mit dem Schlaf?«
Mit seinem runden, rosaroten Gesicht und den halblangen grauen Haaren, die pomadig zurückgekämmt und hinter seine Ohren geklemmt waren, sah Aldous aus wie ein Schöngeist aus dem neunzehnten Jahrhundert. Verstärkt wurde dieser Eindruck noch dadurch, dass er ausschließlich helle Kleidung und schlapp herabhängende Fliegen trug. Heute hatte er sich für einen Anzug aus perlmuttfarbiger Seide und ein blassblaues Hemd entschieden, mit einer zitronengelben Fliege. Dazu trug er orientalische Lederpantoffeln mit Stickerei und hochgebogenen Spitzen. Er geleitete Gabriel durch den von der Fußleiste bis zur Decke mit Aquarellen geschmückten Flur und weiter in das geräumige Wohnzimmer, das zugleich als Büro fungierte. Auch hier hingen die Wände voller Bilder, und weitere Bilder lehnten an der Wand, stapelweise, bis zu zehn hintereinander. Zwischen hoch aufgetürmten Stapeln von Kunstbänden auf jeder verfügbaren Oberfläche waren Sofas und Sessel mit losen Überwürfen zu erkennen. Auf Sekretären und Beistelltischen standen Vasen mit großen Sträußen aus Trockenblumen und Gräsern. Was für ein wüstes Durcheinander, dachte Gabriel, so wie jedes Mal, aber auch irgendwie betörend und absolut einzigartig.
An einem Ende des Zimmers saß eine junge Frau an einem Schreibtisch für zwei. Sie trug eine klobige schwarze Brille, und ihr Haar war leuchtend karottenrot gefärbt.
»Das ist Ariadne Vanderpoel«, stellte Aldous sie vor. »Meine rechte und meine linke Hand. Sie hilft mir seit der Schließung, den Bestand der Galerie zu katalogisieren.« Er deutete auf die Gemäldestapel am Boden. »Ein Augias-Stall – ich habe ja keine Ahnung, was ich besitze, keine Ahnung. Ariadne bringt Licht ins Dunkel.«
Gabriel schüttelte ihr die Hand. Sie hatte einen sehr festen, sachlichen Händedruck. »Was für eine Freude«, sagte sie. »Ich habe schon so viel von Ihnen gehört.«
Gabriel zeigte auf Aldous. »Glauben Sie ihm kein Wort, egal, was er sagt. Ein äußerst unzuverlässiger Erzähler.«
Ariadne lachte laut. Aldous schloss sich an.
»Sie können jetzt gehen, meine Süße«, sagte Aldous. »Bis morgen. Ich muss ein indiskretes Wörtchen mit meinem Jungen hier wechseln.«
Als Ariadne hinausgegangen war, um ihren Mantel zu holen, senkte Aldous die Stimme.
»Promoviert in Kunstwissenschaften, in Cambridge. Ein unglaublicher Intellekt.« Er schwieg kurz. »Nein, Sex haben wir nicht, falls dir die Frage auf den Nägeln brennt.«
»War mir gar nicht in den Sinn gekommen.«
Aldous küsste ihn noch einmal.
»Wie wunderschön, dich zu sehen. Ich habe leider nur Whisky da.«
Sie ließen sich, nachdem einige Bücherstapel beiseitegeräumt und so Platz geschaffen worden war, mit großen Gläsern Malt Whisky auf einem der langen Sofas nieder. Diese Wohnung, dachte Gabriel, während er den Blick umherschweifen ließ, war im Grunde mein Elternhaus. Wie hätte da aus mir etwas anderes werden sollen als ein Autor? Sie zündeten sich beide Zigaretten an und begannen zu plaudern und zu tratschen. Gabriel erzählte Aldous von dem sonntäglichen Mittagessen mit Sefton und Familie.
»Ist er immer noch so schrecklich langweilig?«, fragte Aldous.
»Ich halte seine Langweiligkeit mittlerweile für eine schlaue Tarnung«, sagte Gabriel. »Sie soll ihn uninteressant erscheinen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass er eine Art Agent ist.«
»Möge der Herrgott dem britischen Geheimdienst beistehen.«
Mit Sefton war Aldous nie wirklich warm geworden.
»Apropos Agenten«, fuhr er fort, »ich hatte neulich einen sehr mysteriösen Anruf – jemand, der mir ein Bild abkaufen wollte.«
»Das ist doch dein Beruf, oder? Der Verkauf von Bildern?«
»Ich bin im Ruhestand, habe ich diesem Anrufer gesagt. Doch er ließ nicht locker. Er wollte ein Bild von einem gewissen Javier Agustín Montano kaufen, besser bekannt als ›Blanco‹. Den habe ich gleich nachgeschlagen. Und verflucht, der war noch am Leben!«