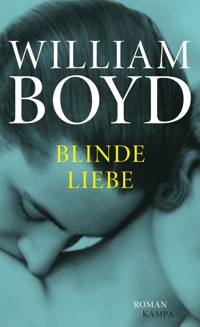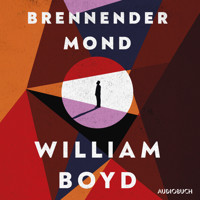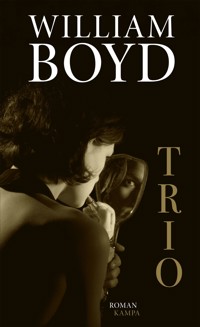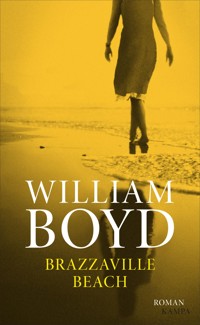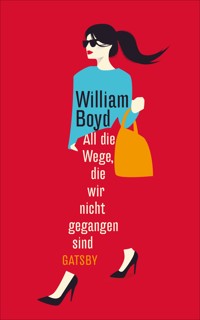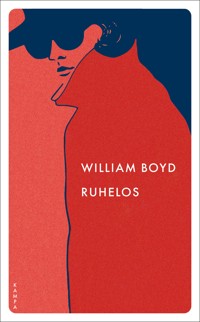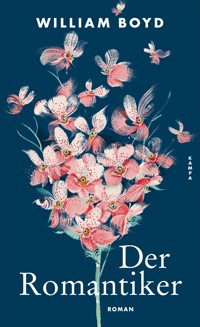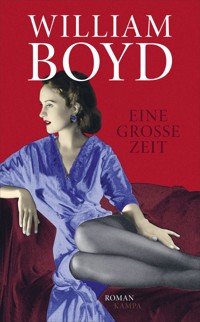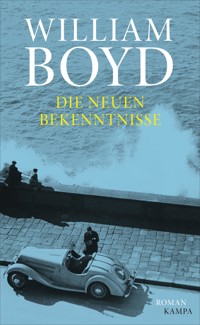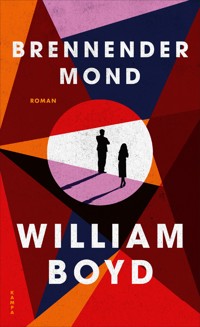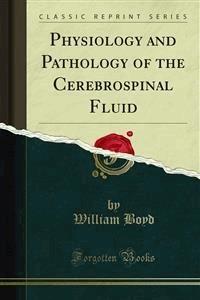Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Brite Morgan Leafy ist Botschaftssekretär Ihrer Majestät im westafrikanischen Kinjanja. Er soll die kulturelle Souveränität der ehemaligen Kolonialherren repräsentieren, ist allerdings nicht gerade ein diplomatisches Naturtalent. Seine Schwäche für schöne Frauen, übermäßiger Alkoholkonsum und die Abneigung dem Land gegenüber erschweren ihm den Job. Hoffnungslos verfängt er sich in den Fallstricken der korrupten Lokalpolitik, und die zarte Romanze mit Priscilla, der Tochter seines Chefs, endet, bevor sie angefangen hat. Als dann noch eine Leiche auftaucht, die er partout nicht mehr loswird, muss Morgan endgültig einsehen, dass in Afrika nichts nach Plan läuft …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Unser Mann in Afrika
Roman
Aus dem Englischen von Hermann Stiehl
Kampa
Für Susan
Irgendwo geht ein eigenartiges und kluges Morgen zu Bett,
plant einen Test für Menschen aus Europa;
niemand ahnt, wer sich am meisten schämen,
wer reicher und wer tot sein wird.
W.H. Auden
I
1
»Sehr freundlich«, sagte Dalmire und nahm dankbar den Gin entgegen, den Morgan Leafy ihm reichte. »Wirklich sehr freundlich.« Er bietet seine beflissene Männerfreundschaft dar wie ein Geschenk, dachte Morgan; er ist wie ein Hund, der darauf wartet, dass ich ein Stöckchen fortschleudere, das er apportieren kann. Wenn er einen Schwanz hätte, würde er damit wedeln.
Morgan lächelte und hob sein Glas. Ich hasse dich, du selbstgefälliger Bursche, schrie er innerlich. Du Häufchen Scheiße, du hast mein Leben ruiniert! Aber er sagte nur: »Herzlichen Glückwunsch. Sie ist ein wunderbares Mädchen. Entzückend. Sie können sich glücklich schätzen.«
Dalmire stand auf und trat ans Fenster, von dem aus man die Einfahrt des Konsulats überblickte. Hitze flimmerte von den geparkten Wagen auf, und alles war in ein gleichmäßig dunstiges Licht getaucht. Es war später Nachmittag und über dreißig Grad warm. Bis Weihnachten war es keine ganze Woche mehr.
Morgan beobachtete mit Abscheu, wie Dalmire seinen verschwitzten Hosenboden zurechtzog. O Priscilla, Priscilla, fragte er sich, warum ihn? Warum Dalmire? Warum nicht mich?
»Und wann ist der große Tag?«, fragte er mit dem Ausdruck höflichen Interesses.
»Noch nicht so bald«, entgegnete Dalmire. »Die gute Ma Fanshawe scheint für eine Hochzeit im Frühjahr zu sein. Pris auch. Aber mir ist alles recht.« Er deutete auf die dunkle Wolkenbank, die über der ausfächernden rostfarbenen Masse von Nkongsamba, der Hauptstadt der Mittelwestregion von Kinjanja in Westafrika, heraufzog. »Sieht so aus, als bekämen wir Regen.«
Morgan wollte den Gin wieder in den Aktenschrank stellen, überlegte es sich dann aber anders und schenkte sich noch einen kräftigen Schluck ein. Er schwenkte die grüne Flasche zu Dalmire hin, der in gespieltem Entsetzen die Arme hochwarf.
»Um Gottes willen, Morgan – könnte keinen mehr verkraften. Das lass ich lieber.«
Morgan rief nach Kojo, seinem Sekretär. Der Mann kam sogleich aus dem Vorzimmer herein. Er war klein und sehr ordentlich gekleidet – gestärktes weißes Hemd, Krawatte, blaue Flanellhose, schwarze Schuhe. In Kojos Gegenwart kam sich Morgan jedes Mal wie ein Landstreicher vor.
»Ah, Kojo. Tonicwater, mehr Tonicwater«, sagte er, wobei er an sich zu halten versuchte.
»Sofort, Sah.« Kojo wandte sich um.
»Warten Sie. Was haben Sie da?« Kojo hielt mehrere Girlandenstreifen in der Hand.
»Weihnachtsschmuck, Sah. Für Ihr Büro. Ich dachte, dieses Jahr, vielleicht …«
Morgan verdrehte die Augen. »Nein«, rief er. »Kommt nicht infrage. Nicht hier.« Verdammt schöne Weihnachten werde ich feiern, dachte er voller Bitterkeit. Dann fuhr er, als er Dalmires verwirrten Blick sah, in ruhigerem Ton fort: »Nicht für hier, Sie wissen doch. Ich nicht mögen für hier.«
Kojo lächelte und ignorierte das Pidgin-Englisch. Morgan forschte in dem Gesicht des kleinen Mannes nach Zeichen der Verärgerung oder der Verachtung, entdeckte aber keine. Er schämte sich seiner Rüpelhaftigkeit: Es war nicht Kojos Schuld, dass Dalmire und Priscilla sich verlobten.
»Natürlich nicht, Sah«, sagte Kojo höflich. »Es wird so wie üblich gemacht. Tonicwater kommt gleich.« Er ging hinaus.
»Ein guter Mann?«, fragte Dalmire, die Brauen hochziehend.
»Ja, allerdings«, erwiderte Morgan, als überrasche ihn dieser Gedanke. »Verdammt fleißig.« Er wünschte, Dalmire würde gehen. Die Neuigkeit drückte ihn zu sehr nieder, als dass er noch lange unbeschwerte Heiterkeit verströmen konnte. Er verwünschte sich dafür, dass er in den letzten Wochen nicht mehr auf Priscilla geachtet hatte, aber es waren unmögliche Wochen gewesen, mit die schlimmsten, die er in seinem nicht leichten Leben in diesem heißen, stinkenden, frustrierenden Scheißland durchgemacht hatte. Denk nicht darüber nach, sagte er sich, dadurch wird alles nur noch schlimmer. Denk lieber an Hazel – die neue Wohnung. Geh heute Abend zu dem Barbecue im Club. Jammer nicht den verpassten Gelegenheiten hinterher.
Er blickte Dalmire an, der als Zweiter Konsulatssekretär sein Untergebener war. Er sagte sich jetzt, dass er ihn eigentlich nie gemocht hatte. Vom ersten Tag an nicht. Etwas an seiner unbekümmerten Oxbridge-Selbstgefälligkeit, etwas an der Art, wie Fanshawe sofort von ihm angetan gewesen war. Fanshawe war der Konsul in Nkongsamba, Priscilla war seine Tochter.
»Schön, dass Sie schon mit Morgan gesprochen haben, Dickie«, hatte Fanshawe zu Dalmire gesagt. »Morgan ist ein alter Hase. Schon an die drei Jahre hier in Nkongsamba, oder, Morgan? Gehört schon fast zum Mobiliar. Haha. Aber ein tüchtiger Mann, Dickie. Finger immer am Puls der Zeit. Haben große Pläne, was, Morgan?«
Morgan hatte die ganze Rede hindurch breit gelächelt, während ihm ein kurzes, aber bösartiges Wutgeheul durch den Kopf ging.
Er blickte Dalmire an, wie er jetzt so am Fenster stand. Er trug ein weißes Hemd, weiße Shorts, beige Kniestrümpfe und glänzend polierte, derbe braune Halbschuhe. Da war noch etwas, das er an dem Mann verachtete: seine affektierte, altkoloniale Kleidung. Grässliche weite Shorts, bauschige Aertexhemden und diese schmale, diskret geknüpfte Collegekrawatte. Morgan bevorzugte ausgestellte, hellfarbene Flanellhosen, bunte Hemden und diese neuen breiten Krawatten mit faustgroßen Windsorknoten, die, wie seine Schwester ihm versicherte, zu Hause der letzte Schrei waren. Doch wenn er Fanshawe, Dalmire oder Jones, dem Buchhalter des Konsulats, begegnete, kam er sich billig und aufgemacht vor, wie ein Handelsreisender. Sogar Jones war seit Dalmires Ankunft zu Shorts übergegangen. Morgan verabscheute den Anblick seiner dicken kleinen walisischen Knie, die zwischen dem Saum der Shorts und den Kniestrümpfen hervorsahen wie zwei kahle, runzlige Babyköpfe.
Morgan wandte seine Aufmerksamkeit mühsam wieder Dalmire zu, der etwas sagte, während er noch immer verträumt zum Fenster hinaussah.
»… wie das Schicksal manchmal spielt. Erstaunlich, dass mein erster Posten gerade Nkongsamba war, Priscilla hat das auch gesagt.«
Morgan hätte plötzlich heiße Tränen der Verzweiflung weinen mögen. Wie konnte er es wagen, ihm mit dem Schicksal zu kommen! Wo so leicht er jetzt dort hätte stehen können als der Frischverlobte, wenn nur Hazel … wenn Priscilla nicht … wenn Dalmire nicht gekommen wäre … wenn Murray … Murray. Er stoppte die Gedanken, die mit ihm durchgegangen waren, dicht vor dem Abgrund. Ja, Murray. Das Schicksal hatte Überstunden gemacht.
»Ganz recht«, sagte Morgan und blickte angestrengt nach der Annigoni-Reproduktion Ihrer Majestät an der Wand seines Büros. »Unbedingt. Gar keine Frage.« Er seufzte leise. Er warf einen Blick zu Dalmire hin, der über die erstaunliche Natur der Dinge verwundert den Kopf schüttelte. Was war so bemerkenswert an Dalmire, fragte er sich. Freundliche, nicht unangenehme Gesichtszüge, dichtes braunes Haar mit einem scharfen, sehr geraden Scheitel, schlanke sportliche Figur. Sehr im Gegensatz zu ihm, wie er zögernd zugeben musste, aber darüber hinaus nichts als untadelige Langweiligkeit. Und er musste auch zugeben, dass Dalmire stets freundlich und fügsam gewesen war; es gab keinen erkennbaren Grund für den giftigen Hass, den er jetzt in seiner Brust nährte.
Aber er wusste, dass er Dalmire auf abstrakte Weise hasste, sub specie aeternitatis gewissermaßen. Er hasste ihn, weil sein Leben so leicht war und er dies keineswegs mit erstaunter Dankbarkeit zur Kenntnis nahm, sondern eher als eine so feststehende und natürliche Tatsache wie die unsichtbaren Planetenbahnen über ihren Köpfen. Er war nicht einmal besonders klug. Als Morgan sich in seiner Personalakte seine Prüfungsnoten ansah, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass Dalmire viel schlechter abgeschnitten hatte als er. Aber er war nach Oxford gegangen, während Morgan eine der erst nach dem Krieg gegründeten Universitäten in den Midlands besucht hatte. Er besaß schon ein Haus – in Brighton, geerbt von einer entfernt verwandten Tante –, während Morgans Stützpunkt in England die beengte Doppelhaushälfte seiner Mutter war. Und doch war Dalmire gleich im Anschluss an seine Ausbildungszeit nach Übersee versetzt worden, während Morgan drei Jahre lang zu Hause in einem überheizten Büro in einer Seitenstraße der Kingsway geschwitzt hatte. Dalmires Eltern wohnten in Gloucestershire, sein Vater war Oberstleutnant. Morgans Eltern wohnten in Feltham, sein Vater war in Heathrow für die Lieferung von Speisen und Getränken zuständig gewesen … Er hätte die Aufzählung fortsetzen können. Es ist einfach nicht fair, stöhnte er in sich hinein, und jetzt hat er auch noch Priscilla bekommen. Er wünschte, dass Dalmire etwas Grausames und Unerklärliches zustieß, etwas Schockierendes und Willkürliches, nur damit er wieder mit dem wirklichen Leben in Berührung kam. Aber nein, die Laune eines bourgeoisen Ex-Public-School-Gottes hatte es noch gefügt, dass Priscilla Dalmire schon wenige Wochen nach seinem Eintreffen erlegen war.
Seine Gedanken wurden unterbrochen durch ein Klopfen und gleich darauf durch Denzil Jones, den Buchhalter, der den Kopf um die Tür herum streckte.
»Entschuldigen Sie, Morgan. Ah, da sind Sie ja, Dickie. Wir sehen uns dann im Club. So gegen fünf, ja?«
»Wunderbar«, sagte Dalmire. »Werden Sie auch mit achtzehn Löchern fertig, Denzil?«
Jones lachte. »Wenn Sie das können, kann ich’s auch. Also dann bis später, okay?« Jones verschwand wieder.
Morgan sagte sich, dass von allen Akzenten, die ihm missfielen, der walisische der ärgerlichste sei. Abgesehen vielleicht vom australischen … oder vielleicht dem von Newcastle upon Tyne, wenn man’s genauer bedachte …
»Ist ein guter Golfspieler, Denzil«, bemerkte Dalmire freundlich.
Morgan machte ein verblüfftes Gesicht. »Er? Golf? Sie machen wohl Witze. Mit so einem Bauch?« Er zog den seinen ein. »Es überrascht mich, dass er überhaupt den Ball sehen kann.«
Dalmire verzog sein Gesicht zu höflichem Widerspruch. »In Denzil steckt mehr, als man ihm auf den ersten Blick ansieht. Handicap sieben. Allenfalls so kann ich ihn schlagen.« Er hielt kurz inne und setzte dann hinzu: »Da wir gerade beim Golf sind – ich habe gehört, Sie spielen auch ab und zu einmal. Wollen Sie nicht mitkommen?«
»Nein, danke«, sagte Morgan. »Ich habe das Golfspielen aufgegeben. Es hat mein seelisches Gleichgewicht ruiniert.« Ihm fiel plötzlich etwas ein. »Ach, sagen Sie, haben Sie Murray mal auf dem Platz gesehen?«
»Dr. Murray?«
»Ja. Den Schotten. Den Arzt.«
»Ja, ich sehe ihn dort so ein-, zweimal die Woche. Spielt recht gut dafür, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Ich glaube, er bringt zurzeit seinem Sohn das Golfspielen bei – er war letzte Woche gewöhnlich mit einem Jungen zusammen. Warum?«
»Reine Neugierde«, sagte Morgan. »Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Vielleicht erwische ich ihn im Club.« Er machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Wie gut kennen Sie Murray denn?«, fragte Dalmire.
»Ich kenne ihn nur als Arzt«, sagte Morgan ausweichend. »Ich musste ihn vor etwa zwei Monaten aufsuchen, als … als ich mich nicht wohl fühlte. Kurz bevor Sie kamen, genauer gesagt.« Morgan errötete, als er sich der peinlichsten Augenblicke seines Lebens erinnerte, und er setzte in bissigem Ton hinzu: »Ich kann den Burschen nicht ausstehen. Ein scheinheiliger Kalvinist. Absolut unsympathisch – kann mir nicht vorstellen, warum er Arzt wurde – schikaniert und kommandiert herum.«
Dalmire sah ihn überrascht an. »Komisch, ich habe gehört, er ist recht beliebt. Bisschen streng, vielleicht – aber ich kenne ihn weiter nicht. Es wird gesagt, er sorgt dafür, dass dieser Gesundheitsdienst an der Universität gut funktioniert. Ist wohl schon lange hier?«
»Ja, ich glaube schon.« Morgan kam sich ein wenig töricht vor; seine Attacke hatte gar nicht so heftig ausfallen sollen, aber so wirkte Murray auf ihn. »Wahrscheinlich haben wir uns einfach nicht richtig verstanden. Konflikt zwischen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die Art der Krankheit und so weiter.« Dabei beließ er es.
Er wollte nicht weiter über Murray reden, weil er den Mann als eine höchst unwillkommene und äußerst ärgerliche Größe in seinem Leben betrachtete. Aus irgendeinem Grund schien er immer wieder seinen Weg zu kreuzen. Was er auch tat, immer schien er irgendwo Murray zu begegnen. Ja, wenn er jetzt so darüber nachdachte, hatte Murray ihn Priscilla gekostet; indirekt war Murray für diese letzte katastrophale Neuigkeit verantwortlich, die Dalmire ihm so freundlich lächelnd mitgeteilt hatte. Er erstarrte unwillkürlich vor Zorn. Ja, erinnerte er sich, wenn Murray ihm an jenem Abend nicht gesagt hätte … Er riss sich zusammen, denn er sah, dass die Wenns nicht aufhören wollten. Es hatte keinen Sinn, sagte er sich, sagte ihm die kalte Vernunft. Murray war – wie der junge Dalmire – nur ein bequemer Sündenbock, ein nützliches objektives Korrelat für seine eigenen dummen Fehler, seine eifrig betriebene Pfuscherei, für die Farce, die er unbedingt aus seinem Leben zu machen versuchte: Morgan Vollidiot Leafy, R.I.P.
Er blickte ostentativ auf seine Uhr und riss dann Dalmire aus seiner Träumerei. »Seien Sie mir nicht böse, Richard« – er konnte sich nicht einmal jetzt dazu bringen, Dalmire Dickie zu nennen –, »aber ich habe noch schrecklich viel zu tun …«
Dalmire sah auf seine Füße und schob beide Hände vor, als wollte er ein Bücherregal vor dem Umkippen bewahren. »Nichts liegt mir ferner, mein Bester«, sagte er gespielt unterwürfig. »Rackern Sie sich um Gottes willen weiter ab.« Er ging zur Tür und schwang einen imaginären Golfschläger. »Sind Sie wirklich nicht an einer Runde heute Nachmittag interessiert? Zu dritt?«
Morgan ging die Art auf die Nerven, wie Dalmire seine Bemerkungen ständig mit den entsprechenden Gesten untermalte, als wäre er Moderator einer Fernsehshow für Kleinkinder. Und so schüttelte er zur Entgegnung übertrieben heftig den Kopf und deutete mit theatralischer Geste Stapel von Papierkram auf seinem Schreibtisch an. Dalmire machte das Daumen-hoch-Zeichen und ging hinaus.
Morgan lehnte sich in gequälter Erleichterung zurück und starrte zu dem stillstehenden Ventilator an der Decke hinauf. Er saß da und lauschte auf das Summen seiner Klimaanlage. Wie, fragte er sich mit einem Lächeln trauriger Ungläubigkeit auf dem Gesicht, wie nur konnte ein sittsames, gebildetes … liebes Mädchen wie Priscilla diese absolute Null heiraten, diesen dummen Abkömmling der englischen oberen Mittelschicht? Er kniff sich in herzzerreißender Fassungslosigkeit in die Nase. Sie wusste, dass ich sie liebte, sagte er sich, warum nur hat sie nicht gesehen … Er hielt den Strom seiner Gedanken zum dritten Mal an. Er musste aufhören, sich etwas vorzumachen: Er wusste, warum.
Er erhob sich und ging um den Schreibtisch herum zum Fenster. Dalmire hatte recht gehabt mit dem Wetter. Dort im Westen zog eine Bank von dichten violettgrauen Wolken über Nkongsamba herauf. Es würde wahrscheinlich heute Nacht regnen; um die Weihnachtszeit gab es unweigerlich ein paar Gewitter. Er schaute über die Provinzhauptstadt hinweg. Was für eine Sackgasse, dachte er wie jedes Mal bei diesem Anblick. Die einzige größere Stadt in einer kleinen Region in einem nicht sehr bedeutenden westafrikanischen Land: der Diplomatenposten eines Lebens! Er verzog das Gesicht: »Tiefste Provinz« war noch zu hoch gegriffen. Ihm war elend zumute: Die Ironie wollte ihm heute nicht beispringen. Manchmal erfasste ihn Panik, wenn er sich vorstellte, dass die Unterlagen über seine Versetzung hierher tief in einem Aktenschrank in Whitehall verloren gegangen waren und dass niemand sich mehr erinnerte, dass er hier war. Bei dem Gedanken kribbelte es ihn auf der Kopfhaut.
Wie Rom war Nkongsamba auf sieben Hügeln erbaut, aber damit war die Ähnlichkeit auch schon zu Ende. Umgeben von leicht gewelltem tropischem Regenwald, sah es aus der Luft aus wie ein riesiger Kotzbrei auf einem großen ungemähten Rasen. Jedes Haus war gedeckt mit Wellblech in unterschiedlich fortgeschrittenen Stadien der Erosion durch Rost, und vom Fenster des vornehm auf einem Hügel oberhalb der Stadt erbauten Konsulats aus überblickte Morgan die zahllosen Dächer, ein ockerfarbenes Damebrett, ein hässliches metallisches Meer, die paranoische Vision eines verrückten Stadtplaners. Abgesehen von einem einzigen Wolkenkratzer im Stadtzentrum, einer Bank, den modernen Studios des kinjanjanischen Fernsehens und dem großen Warenhaus hatten nur wenige Gebäude mehr als drei Geschosse, und die meisten waren aufs Geratewohl zusammenstehende zerbröckelnde Häuser aus Lehmstrohwänden entlang enger Straßen mit Schlaglöchern und tiefen, schlammigen Abzugsrinnen. Morgan stellte sich die Stadt gern als eine riesige Hefekultur vor, die ein geistesabwesender Labortechniker in einem feuchten Schrank vergessen hatte und die nun unter idealen Wachstumsbedingungen unkontrolliert wucherte.
Abgesehen von der klaustrophobischen Dichte der Gebäude und dem widerlichen Geruch von Abfall und verwesender Materie der verschiedensten Art, war es die wogende Manifestation organischen Lebens in allen seinen Formen, die Morgan an Nkongsamba am meisten beeindruckte. Ganze Generationen von Familien trieben sich vor den Lehmhütten herum wie vorspielende Statisten für einen Dokumentarfilm über die Lebensalter des Menschen, von verhutzelten flachbrüstigen Großmüttern bis zu dickbäuchigen Knirpsen, die angestrengt die Stirn runzelten, wenn sie in die Gosse pinkelten. Hühner, Ziegen und Hunde wühlten auf der Suche nach essbaren Brocken in jedem Abfallhaufen herum, und der Strom der Fußgänger, der sich vorsichtig zwischen dem verrückt hupenden Verkehr und den abbröckelnden Rändern der Abflussrinnen bewegte, versiegte nie.
In der wimmelnden Masse bunt gekleideter Menschen gab es beunruhigend verunstaltete leprakranke Bettler mit knotigen, stumpfen Gliedmaßen; sie schwankten und hüpften und bewegten sich gelegentlich in besonders schlimmen Fällen auf Holzwägelchen fort. Da sah man auf Parkplätzen wendige Schwarzhändler, die breithüftige Verkäuferinnen begleiteten; kleine Jungen boten auf umgehängten Brettern Kugelschreiber, Kämme, Kleiderbügel, Sonnenbrillen und billige russische Uhren zum Kauf an; höckerige weiße Kühe wurden von ernst dreinblickenden, schmalgesichtigen Fulanis aus dem Norden durch die Straßen getrieben. Manchmal sah man staubbedeckte, erdverkrustete Irre aus den Wäldern, die verstört ihren Weg durch die Menge suchten. Morgan hatte einen von ihnen einmal an einer geschäftigen Straßenkreuzung stehen sehen. Er trug seinen schmutzigen Lendenschurz, und sein Haar war orangegrau gefärbt. Er stand mit starren, weit aufgerissenen Augen da und blickte über das Menschengewimmel hin, wobei er von Zeit zu Zeit schrille Beschimpfungen und Verwünschungen ausstieß und die Füße wie zu einem Bannfluchtanz bewegte. Die Menge lachte nur oder ignorierte ihn – die Verrückten erfahren in Afrika großzügige Duldung – und ließ ihn ruhig plappern und gestikulieren. Aus irgendeinem Grund hatte sich Morgan diesem harmlosen Narren in seiner schrecklich fremden Umgebung stark verbunden gefühlt – er schien seinen Standpunkt zu teilen und zu verstehen –, und er hatte ihm im Vorübergehen spontan eine Pfundnote in die schwielige Hand gedrückt. Der Verrückte hatte ihm kurz die gelben Augen zugekehrt, ehe er sich den Geldschein in den breiten, feuchten Mund steckte, um ihn mit schmatzendem Genuss zu zerkauen.
Morgan dachte voller Scham an die Episode, während er den Blick über die Stadt schweifen ließ. Je nach Stimmungslage heiterte Nkongsamba ihn auf oder drückte ihn nieder. In der letzten Zeit – zumindest während der letzten drei Monate – hatte es ihn in zutiefst misanthropische Gefühle versetzt, hätte er eine überschüssige Atombombe oder Polarisrakete besessen, er hätte sie mit Wonne hierher umdirigiert. Hätte die sieben Hügel in einer Sekunde ausgelöscht. Den Boden gereinigt. Den Dschungel wieder darüber wachsen lassen.
Einen Augenblick lang stellte er sich den Atompilz vor. Der Staub fiel langsam herunter und mit ihm ein schwerer, zeitloser Friede. Aber in ihm selbst, so argwöhnte er, richtete das wahrscheinlich gar nichts aus. Dort herrschte einfach zu viel rohes, brutales Leben, das sich nicht so leicht auslöschen ließ. Es würde sicher eher so gehen wie mit dieser Kakerlake, die er neulich abends zu Hause töten wollte. Er hatte gerade in irgendeinem grässlichen Taschenbuch gelesen, als er aus dem Augenwinkel heraus ein richtiges Ungetüm hatte über den Betonfußboden seines Wohnzimmers krabbeln sehen: zwei Zoll lang, braun und glänzend wie ein Blechspielzeug, mit zwei zuckenden Fühlern. Er hatte das Insekt in eine Wolke von Fliegenspray eingehüllt, hatte mit dem Taschenbuch danach geschlagen, war mit dem Fuß darauf getreten, war auf dem abscheulichen Wesen herumgehüpft wie ein übergeschnapptes Rumpelstilzchen – alles umsonst. Obwohl das Ding eine transparente Schleifspur nach sich zog und die Fühler geknickt waren, obwohl es zwei Beine verloren hatte und kaum Kurs halten konnte, hatte es dennoch die schützende Fußleiste erreicht.
Er wandte sich ab von dem Anblick und dem leisen Geräusch hupender Wagen, das durch die fest geschlossenen Fenster drang. Der Regen würde guttun, dachte er, würde den Staub binden und für eine Stunde oder so Kühle bringen. Es war wichtig, dass man kühl blieb, sagte er sich, besonders jetzt. In seinem Büro fühlte er sich recht wohl, er hatte die Klimaanlage auf vollen Touren laufen, aber draußen lag seine Feindin, die Sonne, auf der Lauer und wartete nur darauf, den Kampf von Neuem zu beginnen. Er vermutete, dass seine Hitzeempfindlichkeit etwas mit seiner Gesichtsfarbe zu tun hatte, die blass und zart war, mit einer dicken Schicht subkutanen Fetts darunter. Er war jetzt seit fast drei Jahren in Afrika und hatte noch immer nicht das entwickelt, was man eine anständige Bräune nannte. Nur noch mehr Sommersprossen, Millionen davon. Er hob die Unterarme hoch und musterte sie; aus einiger Entfernung sah es so aus, als wäre er recht braun, aber bei näherem Hinblicken stellte sich das als Illusion heraus. Er war wie ein lebendiges pointillistisches Gemälde. Dennoch sollten, wenn seine Berechnungen stimmten, in einem weiteren Jahr die Sommersprossen alle zusammengeschmolzen sein und einen kontinuierlichen bronzefarbenen Schimmer bilden, und dann brauchte er nie mehr ein Sonnenbad zu nehmen.
In einem weiteren Jahr! Er lachte bitter in sich hinein; so wie es im Augenblick aussah, würde es an ein Wunder grenzen, wenn er es nur bis über Weihnachten und die Wahlen schaffte. Dieses letzte Ereignis war so verrückt und unwahrscheinlich, dass es ihn jedes Mal fassungslos machte, wenn er daran dachte. Nur in Kinjanja konnte man auf die Idee kommen, zwischen Weihnachten und Neujahr Wahlen abzuhalten. Und auch nicht irgendwelche unbedeutenden Wahlen: Der Urnengang um die Weihnachtszeit würde sich wohl zum wichtigsten Ereignis seiner Art in der kurzen Geschichte dieses gottverlassenen Landes entwickeln. Diese Überlegungen erinnerten ihn an seine Arbeit, und er trat vom Fenster fort und schritt vorsichtig um seinen Schreibtisch herum, als könnte der gleich explodieren. Behutsam setzte er sich und schlug die grüne Akte auf, die auf der einen Seite der Schreibunterlage seiner harrte. Er las die vertraute Aufschrift: KNP. Die Kinjanjan National Party. Und er erblickte die noch vertrauteren Züge ihres mittelwestlichen Repräsentanten, Professor Chief Sam Adekunle, der ihn unter dem berühmten Schnauzer und zwischen den Koteletten heraus anlächelte. Benommen blätterte er die Seiten um, und sein Blick überflog die Hochrechnungen und Einschätzungen, die grafischen Darstellungen, demographischen Erhebungen, die Aufgliederung von Wahlprogrammen und vertraulichen Analysen der politischen Tendenzen der Partei. Es war ein Stück Arbeit, das sich sehen lassen konnte: gründlich, methodisch und professionell zusammengestellt. Und das alles von ihm allein. Er gelangte zur letzten Seite und las seinen abschließenden Bericht, in dem er zu dem Urteil kam, dass die KNP mit Adekunle die probritischste unter den zahlreichen exotischen Parteien war, die bei den Wahlen antraten, und diejenige, deren Sieg die hohen – und höchst profitablen – Investitionen des Vereinigten Königreichs am wahrscheinlichsten sichern und dafür sorgen würde, dass diese auch in den kommenden Jahren sich behaupteten, wenn nicht expandierten. Er erinnerte sich mit nur begrenzter Befriedigung jetzt, wie erfreut Fanshawe über seine Arbeit gewesen war, wie der Fernschreiber gesummt und getickt hatte zwischen Nkongsamba und der Hauptstadt an der Küste, zwischen Nkongsamba und London. Großartige Arbeit, Morgan, hatte Fanshawe gesagt, weiter so, weiter so.
Morgan verwünschte seine Tüchtigkeit, seinen Scharfsinn, seine zuversichtlichen Beurteilungen. Da hat das Schicksal wieder mal mitgemischt, dachte er grimmig; warum hatte er sich nicht die People’s Party of Kinjanja oder die Kinjanjan People’s Progress Party oder auch die United Party of Kinjanjan People ausgesucht? Weil er so verdammt eifrig war, sagte er sich, so verdammt schlau, das war’s. Weil er einmal im Leben eine gute Arbeit liefern, etwas Beifall ernten und aus dem Kram herauskommen wollte. Er schlug die Mappe mit einem Knurren ohnmächtigen Zorns zu. Und jetzt, klagte er sich mitleidlos an, jetzt hat Adekunle dich am Wickel, nicht wahr? Ganz fest, dass du nur noch zappeln kannst.
Erpressung, so lehrten ihn die Kriminalromane, die er las, war ein hässliches Wort, und es überraschte ihn, dass er es in so enger Verbindung mit seinem eigenen Namen aussprechen konnte, ohne heftigere Gewissensbisse dabei zu empfinden. Adekunle erpresste ihn – so viel war klar –, aber vielleicht rührte seine relative Gelassenheit daher, dass das, wozu er erpresst wurde, recht bizarrer Natur war. Wie unangenehm es auch war, es konnte nicht als beschwerlich bezeichnet werden, ja, er hatte in den zehn Tagen, seit es ihm aufgetragen worden war, noch keinen Handschlag getan. Adekunle hätte alles verlangen können – den Inhalt der Aktenschränke des Konsulats, die Namen der Kandidaten für eine Auszeichnung an Neujahr, den Orden des Britischen Empire für seine eigene Person, freien Zugang zur Diplomatenpost –, Morgan wäre ihm gern zu Willen gewesen, so verzweifelt klebte er an seinem Job. Aber Adekunle hatte nur eine simple Forderung gestellt, simpel, was ihn, alpdruckhaft, was Morgan betraf. Lernen Sie Dr. Murray näher kennen, hatte Adekunle gesagt. Das ist alles, werden Sie sein Freund.
Morgan spürte, wie sein Geist von selbst langsamer arbeitete, eine Art Sicherheitssystem, wenn er überlastet zu werden drohte. Murray. Wieder dieser verdammte Kerl. Warum bloß wollte Adekunle, dass er sich mit Murray anfreundete? Was konnten zwei so grundverschiedene Menschen wie Murray und Adekunle gemein haben, das für beide von Interesse war? Er hatte nicht die leiseste Ahnung.
Er schüttelte heftig den Kopf wie jemand mit Wasser im Ohr. Er legte die Akte wieder in ihre Schublade und drehte lustlos den Schlüssel im Schloss herum. Er musste Adekunle wie ein Geschenk des Himmels vorgekommen sein, ein dicker Weißer, der sich fröhlich als Opfer anbot … An diesem Punkt ließ er um seine Vorstellung herum die verstärkten Titanstahlklappen herunter, ein geistiger Trick, in dem er es zur Perfektion gebracht hatte: Er wollte nicht über die Zukunft nachgrübeln und befahl seinem Denken entschlossen, diese bedrohliche Dimension zu ignorieren. Er vermochte den gleichen Effekt der Selbstabschließung auch bei anderen widerspenstigen Fähigkeiten wie Erinnerung oder Gewissen zu erreichen, die unter bestimmten Umständen sehr lästig sein konnten. Wenn sie sich nicht benehmen wollten, wurde nicht mehr mit ihnen gesprochen. Er schloss die Augen, lehnte sich zurück, tat ganz tiefe Atemzüge und ließ das monotone Summen der Klimaanlage in seinen Kopf eindringen.
Er war im Begriff einzunicken, als es an der Tür klopfte und er, durch die Wimpern blinzelnd, Kojo hereinkommen sah.
»Mein Gott«, sagte er ungeduldig. »Ja, was gibt es?«
Kojo trat, durch seine Feindseligkeit nicht berührt, an den Schreibtisch. »Die Briefe, Sah. Zum Unterschreiben.«
Leise vor sich hin murrend, ging Morgan den Postausgang durch. Drei Absagen zu halboffiziellen Anlässen; Einladungen an prominente Briten zu einem kalten Büfett anlässlich des Besuchs der Herzogin von Ripon in Nkongsamba; die üblichen Visaerteilungen, obwohl es hier eine Ablehnung gab im Fall eines sogenannten Pfarrers der Non-Denominational Methodist Brethren’s Church von Kinjanja, der eine Schwestergemeinde in Liverpool besuchen wollte. Schließlich war da noch ein Brief an den British Council in der Hauptstadt: Ja, man konnte einen Dichter zwei Tage lang unterbringen, während dieser an einem anglo-kinjanjanischen Kulturfestival in Nkongsamba teilnahm. Morgan las noch einmal den Namen des Dichters: Greg Bilbow. Er hatte noch nie von dem Mann gehört. Er unterschrieb rasch im Vertrauen auf Kojos saubere Arbeit. So hält man den Union Jack im Wind, dachte er, rüstet die Welt für die Demokratie. Doch dann zügelte er seinen Spott. In gewissem Sinn war es der geistlose, bürokratische Stumpfsinn seiner üblichen Arbeit gewesen, der ihn dazu gebracht hatte, sich mit solch patriotischem Eifer dem KNP-Dossier zu widmen – und was hatte er sich damit eingebrockt, ha!
Er reichte Kojo die Briefe zurück und blickte auf seine Uhr. »Gehen Sie jetzt nach Hause?«, fragte er, um einen verbindlichen Ton bemüht.
Kojo lächelte. »Ja, Sah.«
»Wie geht es der Frau … und dem Baby? Es ist ein Junge, nicht wahr?«
»Es geht ihr gut, Sah. Aber … ich habe drei Kinder«, erinnerte Kojo ihn freundlich.
»O ja. Natürlich. Dumm von mir. Alle gesund, ja?« Er erhob sich und ging mit Kojo zur Tür. Der kleine Mann reichte ihm mit seinem wolligen Kopf gerade bis zur Achsel. Morgan spähte in Kojos Bürozimmer: Es war festlich geschmückt und funkelte von billigen Papierschlangen.
»Sie mögen Weihnachten, Kojo, wie?«
Kojo lachte. »O ja, Sah. Sehr. Die Geburt unseres Herrn Jesus.« Morgan erinnerte sich jetzt, dass Kojo katholisch war, und ihm fiel auch wieder ein, dass er ihn mit seiner Familie gesehen hatte – einer winzigen Frau in einem prächtigen Spitzenkleid und drei ganz kleinen Kindern in genau gleichen weißen Hemden und roten Shorts vor der katholischen Kirche auf dem Weg in die Stadt an einem Sonntag vor ein paar Wochen.
Morgan musterte seinen kleinen Gehilfen mit unverhohlener Neugierde.
»Alles okay, Kojo?«, fragte er. »Ich meine, keine Probleme, keine größeren Sorgen?«
»Verzeihung, Sah?«, erwiderte Kojo ehrlich verwirrt.
Morgan machte weiter, ohne eigentlich zu wissen, auf welche Antwort er aus war. »Sie sind … glücklich, ja? Alles läuft wie geschmiert, nichts bekümmert Sie?«
Kojo hatte »glücklich« aufgeschnappt. Er stieß ein hohes, keuchendes, ansteckendes Lachen aus. »O ja, ich bin ein glücklicher Mensch.« Während er zu seinem Tisch zurückging, sah Morgan Kojos schmale Schultern noch immer vor Belustigung zucken. Kojo hielt ihn wahrscheinlich für verrückt. Keine unvernünftige Diagnose unter den Umständen, wie Morgan zugeben musste.
Er trat wieder ans Fenster und versuchte, nicht an Priscilla und Dalmire zu denken, während er zur Zufahrt hinunterblickte. Er sah Peter, den schwachsinnigen, rücksichtslosen Konsulatsfahrer, der Fanshawes langen schwarzen Austin Princess polierte. Er sah Jones zu seinem Volkswagen hinausgehen zusammen mit der unerbittlich vergnügten Mrs Bryce, die mit einem Geologen von der Universität verheiratet war und als Fanshawes Sekretärin fungierte. Es gab einige englische Ehefrauen, die als Teilzeitkräfte im Büro des Konsulats arbeiteten, aber Mrs Bryce war als Einzige fest angestellt. Sie war sehr groß und schlank, und ihre Waden waren immer von shillinggroßen roten Mückenstichen bedeckt. Der dickliche Jones watschelte neben ihr her. Sie blieben einen Augenblick bei Mrs Bryces Moped stehen und sprachen miteinander. Sicher erzählt sie Jones, sie sei die glücklichste Frau von Nkongsamba, dachte Morgan säuerlich, und sie murre nie und alles sei wirklich »nett«, wenn man nur die rechte Einstellung dazu habe. Jones ging so freundlich auf sie ein – hatten sie vielleicht etwas miteinander? Diese Idee hätte überall außerhalb Westafrikas ungläubiges Gelächter ausgelöst, aber Morgan wusste von noch seltsameren Paarungen. Nicht ohne einen leisen Ekel über sich selbst versuchte er sich Jones und Mrs Bryce dabei vorzustellen, wie sie es miteinander trieben, doch die schiere Diskrepanz ihrer beiden Körper vereitelte alle seine Bemühungen. Er wandte sich vom Fenster ab und fragte sich, warum er mit seinen Gedanken immer wieder beim Sex landete. War das normal, und ging es anderen ähnlich? Er fühlte sich niedergedrückt.
Während er diese Stimmung loszuwerden versuchte, überlegte er, dass Fanshawe, wenn Mrs Bryce sich auf den Heimweg begab, Feierabend gemacht haben musste, und er war fest entschlossen, es ihm gleichzutun. Er war gerade im Begriff, seine leichte Tropenjacke von dem Bügel an der Tür herunterzunehmen, als das Haustelefon auf seinem Schreibtisch läutete. Er hob den Hörer ab.
»Leafy«, bellte er ein wenig aggressiv in die Sprechmuschel.
»Ah, Morgan«, sagte eine sonore, gebildete weibliche Stimme am anderen Ende. »Hier Chloe.«
Zwei verzweifelte Sekunden lang war Morgan überzeugt, keine Chloe zu kennen, bis er plötzlich den Namen mit der Person verband, die Fanshawes Gattin war: Mrs Chloe Fanshawe, Ehefrau des britischen Konsuls in Nkongsamba. Das verzögerte Erkennen rührte daher, dass sie in Morgans Gedanken nie Chloe und nur selten Mrs Fanshawe war. Gewöhnlich waren noch die freundlichsten Namen »fettes Aas« oder »alte Schachtel«. Die Sache war einfach die, dass sie einander nicht ausstehen konnten. Es war nie zu offener Feindseligkeit, zu einem heftigen Zusammenstoß, zu einem bestimmten Vorfall gekommen, der den Konflikt ausgelöst hätte. Es war eine Übereinkunft, zu der sie beide ganz spontan, ganz natürlich und wie selbstverständlich gelangt waren, als hätte ein besonderer genetischer Umstand zu dieser Animosität geführt. Manchmal sagte sich Morgan, dass es für sie beide von einer gewissen Reife zeugte, sich dies so stillschweigend einzugestehen: Es vereinfachte das Miteinander. So wusste er jetzt sofort, dass dieser betonte Gebrauch von Vornamen bedeutete, dass sie etwas von ihm wollte; und so erwiderte er jetzt vorsichtig: »Hallo … ah ja, Chloe«, den Namen auf der Zunge testend.
»Doch nicht zu viel zu tun, Morgan, oder?« Wenn es auch als Frage formuliert war, fungierte es doch als Feststellung: Eine Antwort war nicht erforderlich. »Möchten Sie auf einen Sherry herüberkommen? Fünf Minuten? Dann bis gleich.« Es klickte.
Morgan überlegte. Einen Moment lang weitete ihm eine ungewohnte Hochstimmung die Brust, als er an die Möglichkeit dachte, dass dies etwas mit Priscilla zu tun haben könnte, der einzigen Frucht der Fanshawe’schen Lenden, doch dieses Gefühl erstarb so schnell, wie es sich eingestellt hatte: Vor noch nicht zwanzig Minuten hatte Dalmire in diesem Zimmer von seinem Triumph berichtet – nichts konnte daran so schnell etwas geändert haben.
Während er sich fragte, was sie wohl von ihm wollte, streifte sich Morgan die Jacke über und schritt durch Kojos Zimmer und dann die Treppe hinunter. Der plötzliche Übergang von der Kühle der Klimaanlage zur spätnachmittäglichen Hitze und Feuchtigkeit war für ihn der übliche Schock. Seine Augen begannen leicht zu tränen, er wurde sich jäh des Kontakts zwischen Haut und Kleidung bewusst, und seine breiten Oberschenkel rieben unterhalb der feuchten Leistengegend unbehaglich aneinander. Als er die Treppe hinuntergegangen war und das Gebäude durch die Eingangshalle verlassen hatte, waren alle Vorteile seines kühlen Nachmittags verschwunden. Die Sonne hing tief über Nkongsamba und machte die Gewitterwolken drohend dunkel, und ihr blendendes Licht stieß ihm voll ins Gesicht. Die Sonne schien groß und rot durch den Dunstschleier des Harmattan – eines heißen, trockenen Mistrals aus der Sahara, der Westafrika jedes Jahr um diese Zeit heimsuchte und der die Feuchtigkeit um einige wenige vernachlässigenswerte Prozente herabsetzte, dafür aber die Luft und jede Ritze mit feinem sandigem Staub erfüllte und Holz und Plastik zerbrach und verzog wie ein unsichtbares Kraftfeld.
Morgan bog um das Konsulat herum und schritt den kiesbedeckten Weg zu Fanshawes Dienstvilla einige hundert Meter entfernt auf dem großen Grundstück hinunter. Der Harmattan hatte alle Grashalme zu einem uniformen Braun verfärbt, von dem sich die Hibiskusgruppen und Bougainvilleabüsche abhoben wie Oasen in der Wüste. Zu seiner Linken, hinter einer unregelmäßigen Baumreihe, lagen die Unterkünfte der Dienstboten des Konsulats, zwei niedrige Betongebäude, voneinander getrennt durch eine roterdige freie Fläche. Morgan sah bei den rauchgeschwärzten Veranden die Stände der Händler mit ihrem Obst und Gemüse, und er hörte das Singen von Frauen, die Kleider stampften am Waschplatz beim oberen Ende des Geländes, das Schreien von Kindern und das Gackern von schmutzigen Hühnern. Offiziell gab es dort sechs Wohneinheiten für das Konsulatspersonal, aber Anbauten waren entstanden und Grashütten, Vettern, Gelegenheitsgärtner und umherziehende Verwandte hatten sich eingefunden, und nach der letzten Zählung wohnten dort dreiundvierzig Menschen. Fanshawe hatte Morgan angewiesen, alle nicht dorthin gehörenden Bewohner auszuweisen, und gesagt, der Lärm werde unerträglich und der Abfallhaufen hinter den Gebäuden sei unschön und breite sich auf die Hauptstraße aus. Morgan hatte noch nichts unternommen und bezweifelte stark, dass er dies je tun würde.
Er schritt quer über den Rasen vor Fanshawes Haus. Er hielt nach Priscillas kleinem Fiat Ausschau, und sein Herz machte einen Satz, als er dessen Hinterende aus der Garage rechts vom Haus herausschauen sah. Dann war sie also zu Hause, wenn Dalmire sie nicht zum Golf mitgenommen hatte. Unwillkürlich rückte er seinen Schlips zurecht.
Die Residenz des Konsuls in Nkongsamba war ein stattliches zweigeschossiges Gebäude. Ein mit Säulen versehener Eingang erhob sich oberhalb von Stufen, die zu einer langen Veranda mit Terrassentüren hinaufführten. Innen waren schöne, große Empfangsräume, und die Rückseite des Hauses blickte auf die vornehmeren Außenviertel am Südwestrand von Nkongsamba hinaus. Die Sonne war im Begriff, in den finsteren Wolken im Westen zu versinken, und warf dramatische Strahlen auf die weiß getünchte Fassade.
Morgan wollte gerade die Stufen hinaufgehen, als sich Fanshawe über die Verandabalustrade lehnte. Er trug ein chinesisches Hemd mit einem runden Kragen, der mit purpurfarbenen Zeichen betüpfelt war.
»Abend, Morgan«, sagte er in lebhaftem Ton. »Kann ich was für Sie tun?« Offenbar wusste er nichts von dem Anruf seiner Frau. Das war ein schlechtes Zeichen.
»Chloe … Mrs Fanshawe hat mich gebeten herüberzukommen«, erklärte er.
»Ach ja?«, sagte Fanshawe, als könne er diese Verirrung seiner Frau nicht begreifen. »Nun, dann kommen Sie bitte herein.«
Morgan ging die Stufen hinauf. Fanshawe stand neben einer roten Gießkanne aus Plastik. »Gebe gerade den Pflanzen Wasser«, sagte er und deutete mit dem Kopf zu einigen schwarzen Steinguttöpfen, die von üppigem Grün überflossen. Mit ausgebreiteter Hand wies er auf die offene Tür. Morgan ging hinein und setzte sich.
Es fiel ihm schwer, seine Gefühle für Fanshawe genau zu beschreiben: Sie schwankten zwischen naserümpfender Verachtung, totaler Gleichgültigkeit und schläfenpochender Gereiztheit wie eines dieser technischen Spielzeuge, bei denen eine an einem Draht aufgehängte Kugel zwischen drei Magneten hin und her zuckt. Er war ein schmächtiger, asketisch wirkender Mann mit streng aus der Stirn zurückgekämmtem, schütterem grauem Haar. Er hatte einen schmalen, akribisch gestutzten Schnurrbart, der eine waagerechte Linie genau in der Mitte zwischen Nase und Oberlippe bildete. Wegen dieses Strichs, der sich nicht um Gesichtskonturen kümmerte, sah es immer so aus, als würde er gleich lächeln, selbst wenn er seine ernste Miene aufgesetzt hatte. Fanshawe war ein Fernostmann und hatte sein halbes Leben in Konsulaten und Botschaften so exotischer Plätze wie Sumatra, Hongkong, Saigon und Singapur verbracht. Nkongsamba war sein letzter Posten vor der Pensionierung, und er fasste ihn als eine eindeutige Kränkung auf. Er hatte noch fast zwei Jahre Dienst vor sich, und die Aussicht, sie als Konsul an einem so gottverlassenen, unbedeutenden Ort herunterreißen zu müssen, mochte sein Berufsstolz nicht so ohne Weiteres hinnehmen. Er träumte insgeheim von einer dramatischen letzten Versetzung, dem brillanten Abschluss einer ereignislosen Laufbahn. Dies führte zu Perioden missionarischen Eifers in seiner Führung des Konsulats, so wie ein Mustergefangener im Todestrakt hofft, sein gutes Verhalten werde ihm Begnadigung in letzter Minute bescheren. Und es erschwerte es ihm auch, in Afrika zu sein, zumal in einem vergleichsweise so unzivilisierten Land wie Kinjanja. »Kulturschock«, hatte er bei mehreren Gelegenheiten düster zu Morgan gesagt, womit er sich auf seine Ankunft auf dem schwarzen Kontinent bezog. »Wie ein Hieb zwischen die Augen. Ich glaube nicht, dass sich Chloe je davon erholen wird.« Beide Fanshawes neigten zu lyrischen Ausbrüchen über die würdevolle Anmut des Ostens, sie sprachen voller Ekstase über die Jahrhunderte, die Äonen von Kultur und geordneter Entwicklung, die der Osten genossen hatte. »Viel zivilisierter, viel gebildeter als wir, mein Lieber«, pflegte Fanshawe in enthusiastischem Ton zu versichern. »Und der Afrikaner – nun ja, was soll ich sagen?« Hier folgten dann ein wissendes Lächeln und eine hochgezogene Augenbraue. »Ein schöner, vornehmer Mensch, der Orientale. Harmonie, wissen Sie, darauf beruht alles. Yin und Yang, nicht wahr, Darling. Yin und Yang«, rief er dann ungeniert über eine lebhafte Cocktailparty hinweg seiner verlegenen Gattin zu. Fanshawe hatte sich, wie Morgan klar geworden war, dazu gezwungen, dies alles zu glauben, und war wie alle Fanatiker unfähig, auch nur zu erkennen, dass es irgendwelche anderen Ansichten gab, und so hatte Morgan es widerstrebend aufgegeben, ihn in eine Diskussion über Dschingis Khan, das Gefängnis von Changi und Pearl Harbour zu verwickeln. Fanshawe mochte wirklich davon überzeugt sein, aber bei seiner Frau, das erkannte Morgan sofort, war es reine Schauspielerei.
So wirkte die Villa zum Beispiel wie eine Kreuzung zwischen einem behelfsmäßigen buddhistischen Tempel und einem chinesischen Restaurant. Da gab es holzgeschnitzte Schirmwände, Papierlaternen, unmöglich niedrige Möbel, Blumenfiguren aus Treibholz, Seidenmalereien und in einer Ecke einen riesigen Gong, der an einem von zwei halblebensgroßen vergoldeten Holzfiguren gestützten Pfosten hing. Als er mit Priscilla abends einmal nach Hause gekommen war (es schien jetzt Jahre her zu sein, sie hatten gerade begonnen, miteinander »auszugehen«), hatte Morgan, erkühnt durch die aufkeimende Romanze und den Alkohol, den gepolsterten Klöppel ergriffen und zu einem langsamen Schwung gegen den Gong ausgeholt und dabei über die Schulter hinweg mit tiefster Bassstimme gerufen: »James Arthur Rank presents.« Das war nicht gut angekommen. Die schockierten, säuerlichen Gesichter der Familie, die angespannte Atmosphäre, die nervösen Sekunden, während er sich bemühte, den Klöppel wieder an seinen winzigen, unpraktischen Haken zu hängen … Es überlief ihn, als er sich jetzt daran erinnerte beim Anblick des Gongs in der Ecke, und er fragte sich, was die alte Schachtel wohl von ihm wollte.
Als könne er seine Gedanken lesen, sagte Fanshawe: »Chloe wird bestimmt gleich unten sein«, und wie auf ein Stichwort kam seine Ehefrau gemessenen Schritts die Treppe vom Obergeschoss herunter. Bevor er ihr begegnet war, hatte Morgan angenommen, Frauen mit dem Vornamen Chloe seien entweder die neurotischen, brillanten Töchter von Oxbridgeprofessoren oder aber törichte, komische Debütantinnen. Mrs Fanshawe war weder das eine noch das andere, und Morgan hatte seine Chloevorstellung beträchtlich revidieren müssen, damit sie hineinpasste. Sie war eine hochgewachsene, mäßig gut aussehende, leicht korpulente Frau mit kurzem, schwarz gefärbtem Haar, das in einer dramatischen Welle aus dem Gesicht zurückgekämmt war und von einem sehr starken Haarspray selbst bei den heftigsten Windstößen unerbittlich in Form gehalten wurde. Morgan hatte nie auch nur ein einziges Haar aus dieser soliden Frisurmasse ausbrechen sehen. Sie hatte eine Brust wie eine Opernsängerin, einen einzigen Keil stark geschnürter und verstärkter Unterwäsche, von dem aus der übrige Körper sich allmählich zu den erstaunlich kleinen und eleganten Füßen hinunter verjüngte – Füßen, die, wie Morgan immer schien, zu klein waren, um das imposante Ungleichgewicht des Busens stützen zu können. Ihre Haltung – Füße leicht auseinandergestellt, Schenkel steif, Kopf zurückgeneigt, als fürchte sie, nach vorn aufs Gesicht zu fallen – schien diesen Eindruck noch zu betonen. Sie setzte sich nur selten der Sonne aus und bewahrte sich ihre Blässe durch diese Vorsicht und mithilfe ihrer Puderdose, deren sie sich oft auch in der Öffentlichkeit bediente, wie eine Memsahib der guten alten indischen Zeit. Ihr zweites kosmetisches Hauptwerkzeug war ein hellroter Lippenstift, der nur dazu diente, die Schmalheit ihrer Lippen noch hervorzuheben.
»Ah, da sind Sie ja endlich, Morgan«, sagte sie (als wäre sie die Person, die man hatte warten lassen), rauschte durch den Raum und ließ sich vorsichtig in einen niedrigen Sessel sinken. »Sherry, glaube ich, Arthur«, sagte sie zu Fanshawe, der pflichtschuldigst alle mit einem hellen Amontillado versorgte.
»Nun –«, Mrs Fanshawe hob ihr Glas. Dann sagte sie etwas, das sich für Morgans Ohren ganz wie Nakanahischana anhörte. »Ein siamesischer Trinkspruch«, fügte sie, sich zu einer Erläuterung herablassend, hinzu.
»Ehem, nakahisch … ehem, zum Wohl«, erwiderte Morgan und nippte widerwillig an seinem warmen, klebrigen Sherry. Er spürte, wie ihm am ganzen Körper der Schweiß ausbrach. Kein Mensch in Afrika trank Sherry, schäumte er innerlich, und schon gar nicht zu dieser Tageszeit, wenn der Körper nach mehr Flüssigkeit mit klirrendem Eis und einem starken Kick darin verlangte. Morgan sah Mrs Fanshawes bleiche Knie an, während sie den Saum ihres seidenen Thaikleids darüber zurechtzupfte. Niemand hatte auch nur nebenbei den Namen Priscilla erwähnt, also packte er entschlossen den Stier bei den Hörnern.
»Gute Nachricht, das mit Priscilla, ehem … hat mich sehr gefreut«, sagte er in etwas lahmem Ton und hob sein klebriges Glas, um zum zweiten Mal an diesem Tag auf das Wohl des Paares zu trinken.
»Oh, Sie haben schon davon gehört«, entgegnete Mrs Fanshawe mit volltönender Stimme. »Ich bin so froh. Hat Dickie es Ihnen erzählt? Wir freuen uns sehr, nicht wahr, Arthur? Er hat eine so aussichtsreiche Zukunft vor sich … Dickie, meine ich.« Das kam alles in einem Schwall heraus, und es folgte ein verlegenes Schweigen, während der angedeutete Vergleich erfasst und innerlich verarbeitet wurde.
»Priscilla kommt gleich herunter«, fuhr Mrs Fanshawe fort, und ihre bleiche Haut weigerte sich zu erröten. »Sie wird sich freuen, Sie zu sehen.«
Sherry drückte immer auf Morgans Stimmung, und diese Lüge verstärkte noch die düstere Laune, die sich so unausweichlich wie die Nacht auf ihn herabsenkte. Er starrte grämlich auf die drachengemusterten Teppiche auf dem Fußboden der Fanshawes, während sie ihn eingehender über Dickies und Priscillas Glück und die ausgezeichneten Verbindungen ihrer neuen Schwiegereltern unterrichteten.
»… und was ganz erstaunlich ist: Es scheint, Dickies Familie ist mit der der Herzogin von Ripon befreundet. Was sagen Sie zu so einem Zufall?« Morgan blickte auf. Gleich würde sie mit ihrem Anschlag auf ihn herausrücken. Sein unfehlbarer Instinkt meldete ihm immer, wenn sich ein neues Thema ankündigte. »Und das bringt mich zu dem, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte, Morgan«, sagte sie dann auch tatsächlich und fuhr sich mit den Händen unter die Oberschenkel, um die Seidenfalten zu glätten. »Hast du mal eine Zigarette, Arthur?«, fragte sie ihren Mann.
Fanshawe hielt ihr ein Etui aus Rosenholz hin, dessen Deckel eine Hokusai-Landschaft aus Perlmutt zierte. Sie nahm sich eine Zigarette und steckte sie in eine Spitze. Morgan winkte ablehnend, als ihm das Etui angeboten wurde. »Hab’s aufgegeben«, sagte er. »Sie dürfen mich nicht in Versuchung führen, nein, nein.« Warum muss ich mich so geistig minderbemittelt anhören, fragte er sich, als Mrs Fanshawe ihn durch zusammengebissene Zähne hindurch anlächelte. Sie zündete ihre Zigarette an. Ich weiß, warum sie eine Zigarettenspitze benutzt, dachte Morgan: Sie beißt gern in etwas. Die Falten an Mrs Fanshawes weichem Hals verschwanden für Augenblicke, als sie den Kopf zurückneigte, um Rauch zu dem rotierenden Deckenventilator hinaufzublasen.
»Ja«, sagte sie, als antworte sie auf eine Frage, »die Herzogin wird irgendwann am Weihnachtstag hier eintreffen. Sie hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, an der Feier für die Kinder am Nachmittag im Club teilzunehmen.« Sie ließ das so unbestimmt in der Luft hängen. Oh, nein, dachte Morgan verzweifelt; die Spiele, sie will, dass ich mich um die Spiele kümmere. Das würde er ablehnen; ganz gleich, wie heftig sie ihn bearbeiteten, er würde den Weihnachtstag nicht damit verbringen, Horden von kreischenden Kindern im Zaum zu halten.
Mrs Fanshawe klopfte Asche von ihrer Zigarette in den Aschenbecher. »Die Herzogin«, fuhr sie leichthin fort, »gibt allen Kindern der englischen Kolonie kleine Geschenke, und« – sie wandte sich um und strahlte Morgan an – »hier haben wir gehofft, Sie einspannen zu können.«
Morgan war verwirrt. »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz …«
Fanshawe schaltete sich ein. »Dass es schön weihnachtlich wird, weiter nichts.« Morgan war nicht klüger, aber schlimme Vorahnungen drückten auf sein Gemüt.
»Genau«, krähte Mrs Fanshawe, als wäre alles klar und ganz einfach. »Wir dachten – nicht wahr, Arthur? –, wir dachten, da wir ja die Gastgeber der Herzogin sind, wäre es schicklich, wenn eine höherrangige Person aus dem Konsulat irgendwie … irgendwie bei dieser so großzügigen Geste mitwirkte.«
Morgan war verstört. »Heißt das, ich soll die Geschenke verteilen?«
»Genau«, sagte Mrs Fanshawe. »Wir möchten, dass Sie den Weihnachtsmann machen.«
Morgan spürte, wie Zorn und Empörung in ihm hochkamen. Er packte die Seitenlehnen seines Sessels und versuchte, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. »Habe ich das richtig verstanden«, sagte er langsam, »Sie wollen, dass ich mich als Weihnachtsmann verkleide?« Er fühlte, wie seine Oberlippe angesichts einer solchen Zumutung bebte. Für was zum Teufel hielten sie ihn – für einen Hofnarren?
»Was höre ich da, Morgan?«, klang es von der Treppe herunter. »Sie wollen als Weihnachtsmann gehen?« Es war Priscilla. Sie trug eine ausgestellte weiße Hose und ein graublaues T-Shirt. Sein klopfendes Herz riss Morgan aus dem Sessel. Priscilla. Diese Brüste …
Er riss sich zusammen. »Nun, ehem …«, sagte er sehr gedehnt, um seine widerstrebende Ablehnung zu unterstreichen.
»Aber das ist ja herrlich!«, quiekte Priscilla und ließ sich auf der Armlehne eines Sofas nieder. »Sie werden ein ganz großartiger Weihnachtsmann sein. Ein guter Einfall von dir, Mami.«
Morgans Verwirrung nahm noch zu: Wie konnte jemand einen so klaren Tonfall missdeuten? Aber gleichzeitig war er erfreut: erfreut, dass sie erfreut war. »Ich weiß nicht«, fuhr Morgan zögernd fort, »ich dachte, Dalm… Dickie würde …«
Schallendes Gelächter folgte auf diesen angedeuteten Vorschlag. »Oh, Morgan, was reden Sie da!«, rief Priscilla aus. »Dickie ist doch viel zu schlank. Oh …« Sie zog in gespielter Zerknirschung mit dem Zeigefinger die Unterlippe herunter. »O Gott, entschuldigen Sie, Morgan.« Doch alle lächelten, er inbegriffen. Er hätte sich umbringen können.
»Sie müssen den Weihnachtsmann machen«, sagte Priscilla und lehnte sich zurück, die Brüste zu ihm hingereckt. »Sie sind bestimmt ganz phantastisch.«
In diesem Augenblick hätte er alles für sie getan. »Na schön«, sagte er, wobei er sich bewusst war, dass er diesen Entschluss wahrscheinlich für den Rest seines Lebens bereuen würde. »Soll mir eine Freude sein.«
»Sehr nett«, sagte Fanshawe und kam mit der Sherryflasche näher. »Sie trinken noch einen Schluck, ja?«
Priscilla verließ das Haus zusammen mit Morgan. Sie fuhr zum Club, wo sie Dalmire nach seinem Golfspiel treffen wollte. Morgan begleitete sie zu ihrem Wagen. Seine Niedergeschlagenheit hatte sich verstärkt, und er verspürte einen beginnenden dumpfen Kopfschmerz.
»Das wollte ich nicht vergessen«, sagte er. »Herzlichen Glückwunsch. Er ist ein netter Bursche, ehem, Dickie. Glückspilz«, setzte er mit einem gequälten Verliererlächeln hinzu – zumindest hoffte er, dass es so aussah.
Priscilla blickte träumerisch zum Konsulat hinüber. Ihre Augen schwangen zu den Gewitterwolken herum, hinter denen die Sonne jetzt, die purpurnen Ränder mit brennendem Orangerot säumend, versunken war. »Danke, Morgan«, sagte sie. »Da.« Sie zeigte ihm die eine Hand. »Gefällt er Ihnen?«
Morgan nahm behutsam den dargebotenen Finger und betrachtete den Diamantring. »Hübsch«, sagte er.
»Es ist der seiner Großmutter«, belehrte ihn Priscilla. »Er hat ihn mit der Diplomatenpost schicken lassen, als er wusste, dass er um mich anhalten würde. Ist das nicht lieb?«
»Das ist es«, bestätigte Morgan und dachte: der heimlichtuerische kleine Bursche.
Priscilla zog die Hand wieder zurück und polierte den Stein an ihrer linken Brust. Morgan spürte, wie ihm die Zunge anschwoll und die Kehle zu verschließen drohte. Sie schien alles vergessen zu haben, was zwischen ihm und ihr gewesen war, schien es völlig aus dem Gedächtnis gelöscht, fortgewischt zu haben wie Feuchtigkeitshauch von einem Fenster, alles fort, sogar jene Nacht. Er schluckte: jene Nacht. Die Nacht, als sie seinen Hosenlatz aufgezogen hatte … das Beste war, er vergaß es auch. Er sah ihr rundes Gesicht, das dichte, dunkle Haar, jungenhaft kurz geschnitten mit einem Pony, der auf ihren Augenwimpern zu ruhen schien. Sie war ein fast hübsches Mädchen auf eine typisch schlichte englisch-insulare Art, aber dieser bescheidenen Schönheit stand die Nase im Wege. Sie war lang und schmal und hob sich am Ende wie eine Sprungschanze. Selbst der geneigteste Beobachter, selbst der vernarrteste Liebhaber musste zugeben, dass dies ein beherrschender Gesichtszug war, der letztlich sogar die starken Reize ihres herrlichen Körpers verdrängte. Morgan erinnerte sich an einen Nachmittag, den er mit ihr beim Sonnenbaden verbracht hatte: Sein Blick war unwiderstehlich die schlanken Beine hinaufgewandert, über die Lendenpartie hinweg, an diesen unmöglichen Brüsten hinauf, um schließlich starr auf dieser seltsamen Nase ruhen zu bleiben. Sie hatte eine makellose Haut, ihre Lippen waren im Gegensatz zu denen ihrer Mutter voll und weich, ihr Haar war voller Glanz. Aber …
Morgan kümmerte sich natürlich überhaupt nicht um ihre Nase, hatte sich nie darum gekümmert, aber im Geist rein ästhetischer Objektivität musste er zugeben, dass sie ein unübersehbares Merkmal war. Nach einem Jahrzehnt oder so im Gegenüber am Frühstückstisch wäre sie ihm vielleicht auf die Nerven gegangen, sagte er sich, wie der Fuchs die zu hoch hängenden Trauben sauer machend, wenn ihn das auch nur ganz von fern befriedigte.
Sie standen einen Augenblick lang schweigend da, Morgan beobachtete eine Soldatenameise, die tapfer über die endlose Gebirgskette des Wegkieses kletterte, und Priscilla hielt ihren Ring in einen letzten Strahl Sonnenlicht.
»Sieht aus, als bekämen wir ein richtiges Gewitter«, bemerkte sie.
Morgan hielt es nicht länger aus. »Pris«, sagte er voller Gefühl, »wegen dieser Nacht damals …«
Sie warf ihm ein Lächeln verständnisloser Offenheit zu. »Sprechen wir nicht mehr davon, bitte, Morgan. Es ist jetzt vorbei.« Sie hielt inne. »Dickie wird im Club schon auf mich warten. Kann ich Sie mitnehmen?« Sie öffnete die Tür ihres Wagens und stieg ein.
Morgan beugte sich herunter und sah zum Wagenfenster hinein. Er machte ein ernstes Gesicht. »Ich weiß, in der letzten Zeit ist es nicht gut gegangen, Pris, aber ich kann es erklären. Es gibt« – er lächelte schwach – »für alles überzeugende Gründe, glauben Sie mir.« Er überlegte eine Sekunde, ehe er hinzufügte: »Ich glaube, wir sollten darüber sprechen.« Das klang gut: durchdacht, abgewogen, ruhig.
Priscilla hatte mit dem Zündschlüssel herumgefummelt. Sie warf ihm noch einmal das gleiche Lächeln zu: jenes Lächeln, das sagte, du kannst reden, so viel du willst, aber hören kann ich nichts davon.
»Kommen Sie zum Barbecue?«
»Was?«
»Heute Abend. Im Club.«
Es hatte keinen Zweck. »Ja, ich nehme an.«
»Dann bis später.« Sie ließ den Motor an, stieß aus der Garage heraus und fuhr die Zufahrt hinunter davon. Morgan sah dem Wagen nach. Wie konnte sie ihn so behandeln.
»Du Aas«, murmelte er dem davonfahrenden Wagen hinterdrein. »Egoistisches, gefühlloses Aas.«
2
Morgan ging verdrossen zum Konsulat zurück. Er sah auf seine Uhr: halb sechs. Er hatte Hazel gesagt, er werde vor fünf in der Wohnung sein. Er konnte den Rauch der Kohlebecken in den Dienstbotenwohnungen riechen: Abendessenszeit, das Konsulat würde geschlossen sein. Er ging zum Parkplatz für das Personal und sah, dass als Einziger sein Wagen noch da stand, sein cremefarbener Peugeot 404 oder »Peejott«, wie sie hier am Ort hießen. Er hatte ihn im Sommer gekauft, zu einer Zeit, da jeder in Urlaub fuhr. Hazel hatte den Peugeot vorgeschlagen, ein Peugeot verlieh in Kinjanja Prestige. An seinem Wagen sollt ihr ihn erkennen. Der Mercedes stand ganz oben auf der Liste; erst mit einem Mercedes hatte man es wirklich geschafft. Mercedeswagen waren für Staatsoberhäupter, einflussreiche Regierungsbeamte, hohe Offiziere, sehr erfolgreiche Geschäftsleute und Chiefs. Danach kam der Peugeot, für die höheren Berufe: Anwälte, höhere Beamte im Staatsdienst, Ärzte, die Leiter von Universitätsfachbereichen. Der Peugeot stand für Ansehen und Solidität. Nummer drei, der Citroën, war für junge Aufsteiger, für aufstrebende leitende Angestellte, Hochschullehrer, Karrieremacher aller Art. Morgan machte sich über solche Statussymbole lustig und rechtfertigte den Kauf des Peugeots mit handfesten technischen Gründen, genoss aber dennoch die anerkennend-prüfenden Blicke, die er ihm einbrachte, und fühlte sich ein wenig geschmeichelt durch die Einschätzung, der man ihn unterwarf, wenn er aus dem Wagen stieg: nicht wichtig genug für einen Mercedes, aber dennoch ein Mann von gewisser Bedeutung. Es war Hazels Pech, dass er mit ihr nur im Schutz der Dunkelheit fuhr; keiner ihrer Freunde hatte sie in dem Wagen gesehen.
Er fuhr zum Haupttor, grüßte den Nachtwächter und bog in die Straße zur Stadt ein. Das Konsulat lag zwischen der Stadt Nkongsamba und dem Campus der Universität. Bis zur Stadt waren es drei Kilometer, einen leicht abfallenden Hang hinunter. Das Konsulat lag auf einem niedrigen Hügelkamm im Nordosten von Nkongsamba. Zwei Kilometer weiter die Straße hinauf lag der Universitätscampus, wo ein großer Teil der örtlichen englischen Kolonie wohnte und arbeitete.
Morgan wollte zuerst nach Hause fahren und duschen, überlegte es sich dann aber anders. Nach Hause, das war eine umzäunte Siedlung mit Namen New Reservation (er kam sich bisweilen wie ein Indianer vor, wenn er diese Adresse angab), die etwa zwanzig Minuten vom Konsulat entfernt an der Hauptstraße gelegen war, die nach Norden aus Nkongsamba herausführte. Er hatte seinen Dienstboten Moses und Friday gesagt, sie sollten mit seiner Rückkehr rechnen, aber er konnte sie immer noch vom Club aus anrufen. So kamen die faulen Gesellen nicht aus dem Trab, dachte er grimmig.
Die Straße war gesäumt von farbenprächtigen Bäumen, die bald scharlachrot erblühen würden. Der Regen, wenn er denn kam, würde bewirken, dass sich alle Blüten öffneten. Er fuhr an dem Sägewerk vorbei, dessen Direktor namens Muller der westdeutsche Geschäftsträger war. Es gab noch einen französischen Agronomen an einer nahegelegenen landwirtschaftlichen Forschungsstation, der sich um die Interessen der wenigen Franzosen im Land kümmerte, aber diese beiden und das englische Konsulat stellten auch schon die gesamte diplomatische Vertretung in Nkongsamba dar. Alle großen Botschaften und Konsulate waren in der Hauptstadt an der Küste konzentriert, in vier Stunden auf einer nicht ungefährlichen Straße zu erreichen.
Er begann sich den Außenbezirken der Stadt zu nähern. Die Straßenränder, staubig und ohne Graswuchs, wurden breiter; leere Stände und abgeräumte Tische, an denen tagsüber Handel getrieben wurde, säumten die Fahrbahn. Er kam an einer Agip-Tankstelle, einer Schuhfabrik und einem Fahrzeugpark vorbei, und dann war er plötzlich in der Stadt, in der es geschäftig zuging, während sich Menschen und Autos mühsam ihren Heimweg bahnten. In den Außenbezirken gab es einige größere Betonbauten, die mit schmiedeeisernen Arbeiten geschmückt waren und in ihren eigenen niedrig ummauerten Gärten standen. Eigenartige süße, brandige Gerüche wehten durch das offene Fenster ins Wageninnere.
Er ging auf Schritttempo herunter, als die Straßen sich verengten, und schloss sich der dahinschleichenden, hupenden Prozession von Wagen an, die Nkongsamba während achtzehn von vierundzwanzig Stunden verstopften. Er ließ die Hand zum Fenster heraushängen und dachte ziellos an den vergangenen Tag und die Phalanx seiner derzeitigen Probleme. Er fragte sich, ob er wegen der Sache mit Priscilla und Dalmire so schockiert war, ob sie ihm wirklich so naheging. Er bekam keine klare Antwort: Zu viel verletzter männlicher Stolz versperrte ihm den Blick. Er fuhr vorbei an den dicht bevölkerten Lehmhütten, die ein wenig unterhalb der Straße standen, vorbei an den neonbeleuchteten Friseurläden, den Limonadereklamewänden, den allgegenwärtigen Colaplakaten, den Garagen unter freiem Himmel, den Möbelgeschäften, den Schneidern, die auf Maschinen mit Fußbedienung wild drauflosnähten. Er sah die hoch aufragende, in Flutlicht getauchte Fassade des Hotels de Executive, und wie jedes Mal in den letzten zwei Monaten verließ ihn der Mut, als jäh die Erinnerung an das erste vertrauliche Treffen mit Adekunle auf ihn einschoss, das dort stattgefunden hatte. Blecherne Reklametafeln blinkten um die Tür herum auf, die Lichter reflektierend, die jetzt überall angingen, während die Dämmerung sich auf die Stadt herabsenkte. Er hörte raue amerikanische Soulmusik aus dem Innenhof mit seiner Tanzfläche herausdringen. »Heute Abend JOSYGBOYE und seine Top Dandies Band!!!«, verkündete eine schwarze Tafel neben dem Eingang. »Fans, das dürft ihr nicht versäumen!!!« Morgan fragte sich, ob Josy Gboye an jenem schicksalhaften Abend auch gespielt hatte.
Er bog in eine Straße voller Schlaglöcher ein, die am Sheila-Kino vorbeiführte, das mit Michèle Morgan und Paul Hubschmid in Tell me Whom to Kill und Neela Akash lockte, einem »prickelnden und tollen indischen Film«, wie es hieß. Er fuhr an dem Kino vorbei und steuerte den Peugeot auf den Vorhof einer Apotheke. Er gab dem Aufseher ein paar Münzen und ging dann die Straße entlang, ohne sich um die kleinen Jungs zu kümmern, die neben ihm herhüpften und »Oyibo, oyibo« riefen, was so viel wie »Weißer« hieß. Das war etwas, was jedes kinjanjanische Kind fast wie selbstverständlich tat; es störte ihn nicht, es war nur die ständige Erinnerung daran, dass er in ihrem Land ein Fremder war. Er schüttelte seine Eskorte ab, indem er schneller ausschritt, und erreichte nach zwei Minuten eine noch recht neue Reihe von Läden. Da gab es einen Optiker, eine libanesische Boutique und ein Schuhgeschäft; über den Läden waren drei Wohnungen. Hazel wohnte – Morgan machte es möglich – über der Boutique.
Er blickte sich rasch um, ehe er die Stufen an der Seite des Gebäudes hinaufrannte bis zum gemeinsamen Außengang im ersten Stock an der Rückseite. Er zog den Schlüssel heraus und öffnete die Tür. Das Erste, was ihm auffiel, war der Geruch von Zigarettenrauch, und seine reizbare Stimmung schwoll sofort zu Zorn an, da er Hazel das Rauchen ausdrücklich verboten hatte, seit er selbst nicht mehr rauchte. Der Raum war auch dunkel, da die Läden heruntergelassen waren. Er tastete nach dem Lichtschalter und knipste. Es tat sich nichts.
»Nie Strom hier«, sagte eine Stimme.
Morgan fuhr zusammen, sein Puls ging schneller. »Wer ist denn das?«, fragte er zornig, spähte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, und machte, als seine Augen sich an das Dunkel gewöhnten, eine Gestalt aus, die am Tisch saß. »Und wo zum Teufel ist Hazel?«, fuhr er in dem gleichen empörten Ton fort und stampfte durchs Zimmer, um die Läden hochzuziehen.
Er drehte sich um. Der unerwartete Besucher war ein schlaksiger, schwarzer Jüngling, der ein bis zur Taille offenes gelbes Hemd und eine grässlich enge graue Hose trug. Er rauchte auch eine Zigarette und trug eine Sonnenbrille. Er hob eine blassbraune Hand zu Morgan hin.
»Hallo«, sagte er. »Ich bin Sonny.«
»O ja?«, sagte Morgan, noch immer wütend. Er öffnete die Tür zum Schlafzimmer. Hazels billige Kleider lagen überall verstreut. Er hörte plätschernde Geräusche aus dem kleinen Badezimmer. »Ich bin’s!«, brüllte er und schloss die Tür.
Sonny hatte sich erhoben. Er war sehr groß und schlank, und er blickte verdrossen auf die Straße hinunter, wobei sich Rauch von seiner Zigarette aufkräuselte. Er trug, wie Morgan bemerkte, sehr spitze braune Schuhe.
»Erfreut, Sie kennenzulernen«, sagte Sonny in einem schleppenden Ton, der Morgans Ohr verletzte. »Hübsche Wohnung, die Sie Hazel da besorgt haben.« Morgan erwiderte nichts: Hazel würde einiges zu erklären haben. Sonny blickte auf das Zifferblatt seiner Uhr an der Innenseite des Handgelenks. »Ah-ah«, sagte er. »Sechs Uhr. Ich muss gehen.« Er machte einen großen Satz zur Tür. »Danke für das Bier«, sagte er, »so long«, und schlüpfte hinaus.
Morgan bemerkte zwei leere Bierflaschen auf dem Tisch. Er stürmte in die Küche und riss den Kühlschrank auf. Noch eine Flasche übrig. Er beruhigte sich ein wenig. Wenn das Stück diesem Sonny das ganze Bier gegeben hätte, sagte er sich, hätte er sie erwürgt. Dann verdunkelte sich sein Gesicht. Er fragte sich, was zum Donnerwetter dieser Kerl überhaupt in seiner Wohnung zu suchen gehabt hatte. Sein Bier getrunken hatte, während Hazel sich wusch. Drohungen vor sich hin murmelnd, schenkte er sich ein Glas aus der übriggebliebenen Flasche ein und