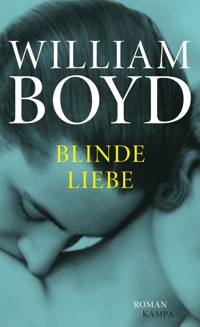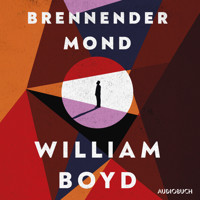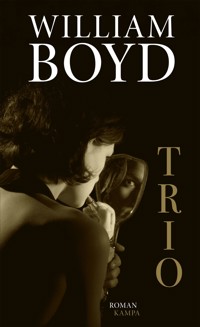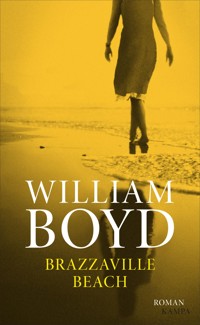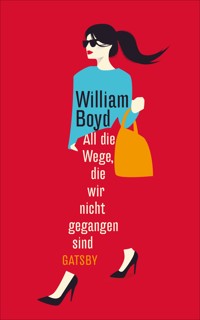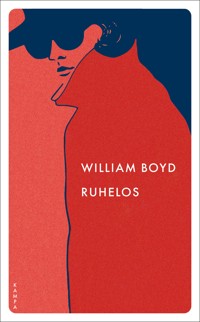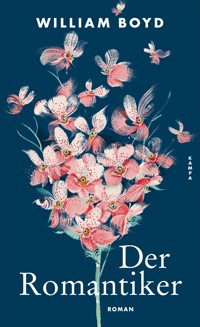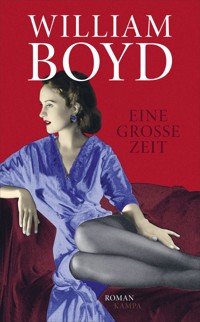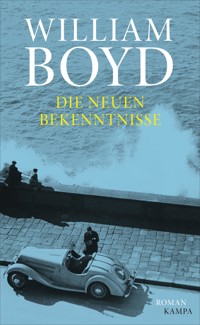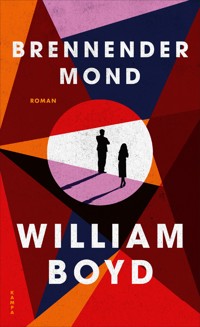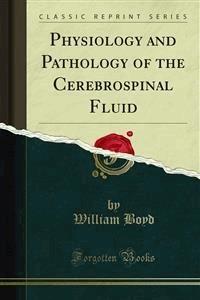Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Der schüchterne britische Kunsthistoriker Henderson Dores reist nach New York. Alles, was er will, ist dazugehören, Teil der amerikanischen Gesellschaft werden, denn amerikanisch sein, so denkt er, heißt, ein unbeschwertes Leben führen. Keine leichte Aufgabe für einen steifen Briten, wie Dores einer ist, verloren in einem Land voller extrovertierter Sonderlinge, wie ihm scheint. Seine Reise führt ihn von New York City bis in den Süden Atlantas. Seine Versuche, die kulturellen Unterschiede zu begreifen - zwischen seiner englischen Heimat und den USA, zwischen New York und den Südstaaten -, bringen sein Leben gehörig durcheinander und die Leser dieses hochkomischen Romans immer wieder zum Lachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Stars und Bars
Roman
Aus dem Englischen von Hermann Stiehl
Kampa
Für Susan
Der »wahrhaft Starke«, gelassen, ausgeglichen, seiner Stärke bewusst, sitzt im Lokal ganz ruhig vor seinem Glas; er braucht sich nicht zu beweisen, dass er keine Angst hat … Mit anderen Worten, den Test gibt es nur für den wahrhaft Schwachen: ganz gleich, ob er ihn besteht oder nicht, er kann sein inneres Wesen nicht ändern. Der wahrhaft Starke bewegt sich geradewegs mitten durch die Fülle des normalen Lebens in Amerika und zieht dabei die direkte und vernünftige Strecke vor. Doch »Amerika« ist genau das, was der wahrhaft Schwache, der neurotische Held, fürchtet.
Christopher Isherwood, Lions and Shadows
Erster TeilVierundzwanzig Stunden in New York
Erstes Kapitel
Schauen Sie, da geht Henderson Dores die Park Avenue in New York hinauf. Ich komme zu spät, denkt er, und das stimmt, er kommt zu spät zur Arbeit. Er trägt seine Säbel in einem schmalen Beutel über der rechten Schulter und bemüht sich, ruhig und lässig zu erscheinen, aber der Ausdruck nachhaltiger Besorgnis auf dem kantigen, offenen Gesicht verrät seine wahre Verfassung. Die Scharen von ordentlichen und gut gekleideten Amerikanern schreiten zielstrebig an ihm vorüber, ohne Eile, voller Selbstvertrauen.
Henderson geht weiter. Er ist fast vierzig Jahre alt – sein Geburtstag steht kurz bevor – und nicht ganz eins achtzig groß. Er ist von kräftiger Statur, und sein Gesicht wirkt freundlich und recht anziehend. Zu seiner ständigen Überraschung sind die Menschen geneigt, ihn auf den ersten Blick zu mögen. Er ist höflich, flott gekleidet und scheint, abgesehen von dieser leicht gerunzelten Stirn, so ruhig und unbekümmert wie Hinz und Kunz. Doch Henderson leidet unter einem Groll, einer Bitterkeit von der tiefsitzenden, heimtückischen Art. Er mag sich nicht mehr, ist nicht zufrieden mit der Persönlichkeit, die ihm mitgegeben wurde, ganz und gar nicht. Etwas an ihm ist nicht auf der Höhe, taugt nichts. Das Fleisch würde er ja gern behalten, aber den Geist würde er lieber tauschen, wenn’s recht ist. Er will ein anderer werden, will anders sein, als er jetzt ist. Und deshalb eigentlich ist er überhaupt hier.
Er fährt sich mit der Hand durch das dichte, blonde Haar, das kurz ist, aber gewissermaßen lang geschnitten, auf die englische Art. In der Tat deutet für den geübten Beobachter alles an ihm auf den typischen Engländer hin. Der bereits erwähnte Haarschnitt, die Augen mit den hellen Wimpern, der Flaum auf den unrasierten Wangenknochen, der alte blaue Zweireiher, der abgewetzte goldene Siegelring am kleinen Finger der linken Hand, die marineblauen, knöchellangen Socken (nur Butler und Chauffeure tragen Schwarz) und die glänzenden, von vielen Knittern überzogenen geschnürten Halbschuhe mit den Kappen an den Spitzen.
Dieses Wissen – dass er so leicht von den anderen zu unterscheiden ist – muss ihn einfach bekümmern, ist es doch sein großer und einziger Traum, sich anzupassen, dazuzugehören, zu verschmelzen mit der Identität dieser ernsthaften, beneidenswerten Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Einfach auch so in Manhattan leben, sagt er sich, während er die Säbel auf die linke Schulter nimmt, wie alle anderen hier. Er runzelt wieder ein wenig die Stirn und geht etwas langsamer. Sein Problem ist folgendes: Er liebt Amerika, aber wird Amerika seine Liebe erwidern? Da vorn wartet der Verrückte.
»Der Kürschner um Mitternacht glaubt, seine Hände seien voller Wolken.«
»Bitte, gehen Sie.«
»Der Kürschner um Mitternacht glaubt, seine Hände seien voller Wolken.«
Gewöhnlich sprach Henderson Dores nicht mit Verrückten. Nach seiner Erfahrung war es möglich, selbst noch das giftigste Gerede zu ignorieren, wenn man so tat, als existierte die andere Person nicht – als wäre sie gar nicht da. Das war ein Trick, den er zuerst furchtsame Professoren in Oxford hatte anwenden sehen, wenn sie in schmalen Gassen von Betrunkenen belästigt wurden. Starres Lächeln, Augen geradeaus, und – Abrakadabra – weg war der Betrunkene. Und so zauberte er mit einer kleinen Willensanstrengung den Verrückten fort, zwang sein Gesicht zu dem erforderlichen sanften, gekünstelten Lächeln, trat zwei Schritte nach links und ging weiter.
Der Verrückte hopste neben ihm her.
Nicht stehen bleiben, lautete die Regel. Er hätte gar nicht erst stehen bleiben sollen, aber was der Verrückte da sagte, ergab irgendwie einen perversen Sinn.
Er ließ den Blick schweifen, versuchte den üblen Gefährten an seiner Seite zu ignorieren. An diesem sonnigen Aprilmorgen schien New York tief durchzuatmen und in der klaren, sauberen Luft zu jubilieren. Es war in seiner Terminologie ein »Baisertag«: knusprig, raffiniert, zerbrechlich.
Es zupfte mehrmals an seinem Ellbogen. Du bist nicht da, sagte sich Henderson, deshalb kannst du mich auch nicht am Ellbogen zupfen. Sein Arm wurde fest gepackt. Er blieb stehen. Eine vage Furcht stimulierte seinen Pulsschlag. Der nicht eben geruchsfreie Verrückte trug einen beigen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen, einen Schal, einen zerknautschten Filzhut und eine Sonnenbrille, und er hatte einen schwarzen Regenschirm aufgespannt. Henderson sah, dass ihm unter dem Hut der Schweiß hervorrann.
»Bitte lassen Sie mich in Ruhe«, sagte Henderson mit fester Stimme.
Die Menge wirbelte um das Verkehrshindernis herum.
»Charmante Leute haben etwas zu verbergen.« Der Verrückte sprach mit einer weiblichen Singsangstimme. Sein Gesicht war zu nah; sein Atem roch eigenartig nach alten Zitronen.
»Lassen Sie mich in Ruhe, oder ich rufe die Polizei.«
»Ach, verpiss dich, Arschloch.«
Das passte schon eher ins Bild. Der Verrückte trat zurück und zielte mit dem Finger nach ihm, den Daumen hochgereckt.
»Peng!«
Henderson zuckte in ungespieltem Schrecken zusammen, wandte sich um und schritt weiter. »Peng! Peng! Peng!«, verklang es hinter ihm. Er erschauerte. Du liebe Güte, dachte er, was für eine widerwärtige Begegnung. Er hob den Beutel mit den Säbeln an und vergewisserte sich, dass der Riemen seinen Anzug nicht zerknitterte. Der Kürschner um Mitternacht glaubt, seine Hände seien voller Wolken. Das ist eigentlich gar nicht so übel für einen Irren, dachte er und beruhigte sich ein wenig. Das klang wie ein Erkennungsspruch bei einem Agententreff oder wie eine Zeile aus einem besseren symbolistischen Gedicht.
Er stapfte den leichten Anstieg der Park Avenue hinauf. Jüngere Leute überholten ihn, unter ihnen ein hübsches Mädchen in einem eleganten pilzfarbenen Seidenkostüm mit gar nicht dazu passenden Trainingsschuhen. Ihre Brüste wippten unter dem glänzenden Stoff der Bluse. Ihr von gefärbten Strähnen durchzogenes blondes Haar wurde von einem Bügel mit winzigen Kopfhörern im Zaum gehalten. Sie verzog das Gesicht im Rhythmus des Liedes, das nur sie allein hörte. Henderson fragte sich, ob er ihr einen »schönen Tag« wünschen sollte. Derlei konnte man hier machen: irgendeinem vorübergehenden Fremden einen fröhlichen Gruß zukommen lassen. »Hey, viel Spaß an der Musik!«, konnte er rufen. Oder »Guten Appetit beim Lunch!« oder »Alles Gute!« Er schüttelte bewundernd den Kopf und sagte nichts.
Er beschleunigte seinen Schritt. Mit der Kuppe eines Zeigefingers strich er Feuchtigkeit aus seinen borstigen blonden Brauen. Diese Brauen begannen ihm Sorgen zu machen. Bis vor Kurzem waren sie ganz normal und unauffällig gewesen, aber neuerdings waren sie buschig und störrisch geworden, und einzelne Haare wuchsen sogar heraus und lockten sich: Sie entwickelten sich zu einem Gesichtsteil für sich. Ärger bereiteten ihm auch seine Brustwarzen. Er rief sich zur Ordnung: Heb dir die Sorgen für den Heimweg auf.
Sein Heim war ein kleines Apartment in der East Sixty-second Street zwischen der Lexington und der Second Avenue. Es lag nicht allzu weit vom Büro entfernt, und stieg der Weg dorthin auch ein wenig an, so stellte das Hinabschlendern am Abend doch eine Entschädigung für die morgendliche Anstrengung dar. Er sah wieder auf die Uhr. Ja, er kam tatsächlich zu spät. Ebenso erstaunlicher- wie erfreulicherweise war er kurz nach fünf Uhr noch einmal fest eingeschlafen und erst um acht aufgewacht, ohne Erinnerung an irgendwelche Träume. Er hatte in der Kehle ein Schluchzen der Erleichterung gespürt: Vielleicht wurde das jetzt endlich anders, vielleicht war dies ein Zeichen – Amerika übte tatsächlich seine Wirkung aus …
Er achtete zurzeit auf Zeichen; er analysierte sie mit dem Eifer eines Oberpriesterlehrlings. Und zunächst schienen sie alle Günstiges zu verheißen.
Er war vor etwa zwei Monaten in Amerika eingetroffen. Es hatte geregnet, als seine Maschine auf dem John F. Kennedy International Airport landete. Vor den Fenstern des Flughafengebäudes fielen schwere, im Kunstlicht gelb schimmernde Tropfen. Er hatte kurz daran gedacht, dem Beispiel des Papstes folgend, den Boden zu küssen (hätte er sich einen Moment lang unbeobachtet gefühlt), doch er schritt schnurstracks aus der Maschine in einen schäbigen Korridor hinein. Er gelangte in sanfter Trance an dem mürrischen Einwanderungsbeamten und dem wortkargen Zöllner vorbei: diese schleppenden Laute, diese unmöglichen Namen, die echte Knarre an der echten Polizistenhüfte.
Draußen regnete es inzwischen noch heftiger. Ein großer, sehr zorniger Schwarzer in einer glänzenden Ölhaut brachte mit heiserer Stimme und herrischen Gesten Ordnung in das Gedrängel zu den Taxis. Warteschlange und Fahrzeuge bildeten zwei folgsame Reihen. Die leuchtenden, zerbeulten gelben Taxis …
Henderson stand eine Weile neben dem Taxiordner. Das Warten machte ihm nichts aus. Der Mann murmelte etwas vor sich hin. Henderson blickte von der Seite auf seinen Schnurrbart und die dicken, wulstigen Lippen und bemerkte, dass der Mann ständig in Bewegung zu sein schien, obwohl er stillstand. Wasser tropfte ihm stetig vom Mützenschild.
»Es könnte schlimmer sein«, sagte der freundliche Henderson. »In England schneit es.«
Der Taxiordner wandte sich um; das Weiße in seinen Augen war so gelb wie Butter.
»Scheiß auf England«, sagte er.
Henderson nickte. »Scheiß auf England«, pflichtete er ihm bei. »Völlig richtig.«
Dieser Augenblick war einer Offenbarung gleichgekommen, sagte er sich jetzt, während er vor einer Ampel wartete, um auf die westliche Seite der Park Avenue zu gelangen. Ein Omen. Der Verkehr stoppte, und er eilte zu der Verkehrsinsel, hielt inne, eilte weiter. Er hatte lange darüber nachgesonnen und maß inzwischen seiner Abreise aus England eine Bedeutung bei, welche die vorgeblichen und wenig bemerkenswerten geschäftlichen Gründe zunächst nicht zu rechtfertigen schienen. Gewiss, er trat in New York einen neuen Job an, aber es war gleichzeitig auch eine Flucht. Eine Flucht vor der Vergangenheit und vor sich selbst.
Er schritt schneller aus, und die Aluminiumglocken seiner Säbel klapperten dumpf aneinander, wenn der Beutel ihm gegen den Oberschenkel schlug.
Er hatte, so sagte er sich, bewusst die Flucht aus England angetreten, um die Schüchternheit hinter sich zu lassen … Ein Mann auf Rollschuhen glitt lautlos an ihm vorbei und schlängelte sich geschickt durch die Menge. Hendersons Bewunderung kam von Herzen. »Viel Spaß dabei!«, hätte er ihm nachrufen mögen, aber er tat es nicht. Warum nicht? Weil er schüchtern war.
Er war (diese Einschätzung nahm er ohne eine Spur von Selbstmitleid vor) ein schüchterner Mensch. Nicht chronisch schüchtern – er stammelte nicht, speichelte nicht beim Sprechen, schwitzte nicht und zuckte nicht zusammen, wie das den am ärgsten von diesem Leiden Betroffenen widerfuhr –, nein, er war schüchtern auf die Art, wie die meisten seiner Landsleute schüchtern waren. Sein Makel war ein angeborener: latent, tiefsitzend, stets gegenwärtig. Es war wie ein Muttermal oder eine versteckte Krankheit; ein ethnisches Merkmal, eine rassische Besonderheit.
Er trat in den Schatten eines hohen Gebäudes und erschauerte unter der plötzlichen Kühle. Zunächst sonnig, später Regen, hatte die Wettervorhersage gelautet. Er hatte heute nur seinen Regenmantel dabei, im Vertrauen auf den freundlichen Wetterfrosch. Vielleicht war das etwas unvorsichtig gewesen. Er überholte zwei junge Männer, die in ein lautes Gespräch vertieft dahinschlenderten. Der eine rauchte eine lindgrüne Zigarre. Er kniff die Augen zusammen, als er durch eine schieferblaue Wolke schritt und den Brechreiz verursachenden Zigarrenrauch roch, der die Frische des Morgens verdarb.
Schüchtern.
Gewiss, Bildung und Erziehung gaben ihm ein recht brauchbares Sortiment von Hilfsmitteln und Methoden an die Hand, um dieses Handicap zu überwinden. Wer ihn beobachtete, wie er auf einer Cocktailparty plauderte oder einen langweiligen Tischnachbarn in ein Gespräch zog, wäre nie auf sein spezielles Leiden gekommen. Aber es war da, und unter der soziokulturellen Tünche litt er auch an allen Unterarten der Schüchternheit, als da wären: mangelndes Selbstvertrauen, Furcht vor Gefühlsäußerungen und spontanen Handlungen, schließlich Angst davor, Aufmerksamkeit zu erregen, und ein fast unwiderstehlicher Drang zur Anpassung.
An der nächsten Ecke bog er in flottem Tempo von der Park Avenue ab und konnte gerade noch mit einem Körperruck drei glänzenden, dampfenden Kothaufen ausweichen, die soeben im näheren Umkreis eines aufstrebenden Bäumchens deponiert worden waren. Er überholte die pelzbekleidete Vettel und ihren abscheulichen Köter. Er warf ihr einen feindseligen, tadelnd strengen Blick zu. Es drängte ihn, die Dame zu fragen, wo sie denn ihre Hundedreckschaufel habe, oder zumindest eine beißende Bemerkung zu machen. Erst letzte Woche hatte er von einem Mann in der City gehört, der angesichts einer spreizbeinigen dänischen Dogge, die direkt vor ihm ihr Geschäft ablud, eine Waffe aus der Jacke gezogen und das Tier auf der Stelle abgeknallt hatte. Eine wahrhaft amerikanische Handlungsweise, dachte er, während er das restliche Stück Straße auf sein Büro zuschritt. Ein missbilligender Blick, ein Na-na! mit zusammengepressten Lippen war alles, was er zustande brachte. Das war typisch, und genau das stimmte mit ihm nicht. Und deshalb hatte er fortgehen, hatte er zwecks Heilung nach Amerika kommen müssen. Weil hier die Schüchternheit verbannt, geächtet, verboten war.
Das war natürlich Unsinn, sagte er sich sogleich, während er um einen Briefträger mit seinem Rollwägelchen herumsteuerte. Es gab viele schüchterne Menschen in Amerika, aber sie waren, wie es schien, auf eine andere Art schüchtern; ihre Unsicherheit trug einen anderen Stempel. Und wenn er schon sein Leben lang schüchtern sein musste, dann wollte er schüchtern sein so wie sie.
An der Tür zu Mulholland & Melhuish, Kunstauktionshaus, hielt er inne. Schönes Gerede, dachte er voller Ironie, leere Worte. Das einzige Problem war, dass er es immer wieder zu Rückfällen kommen ließ. Er hatte schon eindeutige Fortschritte gemacht: siehe Melissa, siehe Irene. Aber er erlitt immer wieder einen Rückfall. Dieser Zusammenstoß mit dem Verrückten vor ein paar Minuten – da hatte er wieder einmal völlig versagt.
Er betrat die Eingangshalle – schwarzweiße Marmorplatten, Eichenholztäfelung.
»Guten Morgen, Mr Dores«, sagte die Empfangsdame. »Wie geht’s?«
Henderson, schon halb an ihrem Tisch vorbei, lächelte automatisch, hielt dann inne. So machte man das nicht.
»Mir geht es gut, danke, Mary. Sogar sehr gut. Danke der Nachfrage.«
»Oh … Oh. Gut. Nichts zu danken.«
Er betrat den kleinen Lift und drückte auf Tür zu. Die Tür glitt zu und klemmte einen blassblauen Arm ein. »Au!«
Er drückte auf Tür auf, und Pruitt Halfacre trat in die Kabine.
»Mann, Henderson! Haben Sie mich nicht gesehen?«
»Entschuldigen Sie, Pruitt. War ganz in Gedanken.«
»O Gott, das ist Öl.« Halfacre musterte den zerknautschten Ärmel. »Ich werde Ihnen wohl die Rechnung schicken müssen, Henderson.«
Machte er Witze oder meinte er es ernst? Bei Amerikanern wusste Henderson da nie Bescheid. Er strich sich über die Augenbrauen. Sie fuhren aufwärts.
»Gute Nachricht, was?«, sagte Halfacre. »Endlich, endlich.«
»Was?«
»Sie haben noch nichts davon gehört? Wir rechnen mit einer Versteigerung von Impressionisten. Zumindest besteht die Hoffnung.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Tom weiß Genaueres.«
Sie verließen den Lift im vierten Stock. Nach der Eleganz der Eingangshalle kamen hier verschrammter Anstrich, helle Lampen und abgewetztes Linoleum.
»Morgen, Ian«, sagte Halfacre.
»Schnapp«, sagte Toothe. Er und Halfacre trugen Fliegen.
»Zwei Seelen, ein Gedanke, Ian.«
»Bisschen spät heute, Henderson, wie?«, sagte Toothe. »Das gehört sich aber gar nicht. Sie sehen sehr erhitzt und nervös aus.« Toothe war Engländer, eine britische Version von Halfacre. Zwei Mimosen von der schlimmsten Sorte. Henderson verzieh Halfacre, weil er Amerikaner war, aber Toothe konnte er nicht ausstehen, wenn er ehrlich war.
»Das macht der Anstieg von meiner Wohnung – meinem Apartment bis hierher«, sagte er zur Entschuldigung.
»Man wird alt.«
»Tod, wo ist dein Stachel«, sagte Halfacre. Toothe lachte.
Henderson lachte ebenfalls, winkte fröhlich und ließ sie auf dem Flur stehen. Während er auf sein Büro zuschritt, überkam ihn plötzlich der Zorn. Man wird alt! Neununddreißig war doch nicht alt. Unverschämter Knilch. Und wie kam er dazu, die Stechuhr zu spielen? Ekel. Die Vierzig gerade erst am Horizont. In der Blüte des Lebens … Aber andererseits waren da diese beunruhigenden Dinge, die mit seinem Körper passierten. Seine Augenbrauen, die Brustwarzen, die Schienbeine, der Hintern.
Als er vor seinem Büro stand, ging die Tür auf.
»Oh.«
»Hallo.« Er grüßte Kimberly, die makellose Kimberly, seine Sekretärin. Wie achtzehn und ging auf die Dreißig zu. Das Haar, die Haut, die Fingernägel, die Augen, die Kleidung. Alles war picobello, tadellos. Wie aus dem Ei gepellt. Ganz im Gegensatz zu ihm.
»Was machen Sie denn hier, Sir?«
»Wie bitte?«
»Ihr Zehn-Uhr-Flug nach Boston? Der Mann mit den Winslow Homers?«
»O Gott!« Henderson erinnerte sich wieder. »Ach, wissen Sie, rufen Sie ihn an und sagen Sie ihm, ich sei krank. Ich komme morgen.«
»Morgen ist Samstag.«
»Dann Montag. O Gott.« Er rieb sich die Augen. »Ich habe verschlafen. Glatt vergessen. Tut mir leid, Kimberly.«
»Sie haben Anrufe bekommen.«
»Was – schon?« Er sah auf seine Uhr. 9:45.
»Eine Miss Düsseldorf und eine Mrs Wax.«
»Schön.«
Kimberly ging. Henderson lehnte seine Säbel hinter der Tür an die Wand und setzte sich. Durchs Fenster überblickte er einen Teil des Central Park. Die Platanen setzten gerade Laub an; die Sonne auf den sanften Hügeln ließ alles frühlingshaft und frisch erscheinen.
Miss Düsseldorf. Das war Irene. Er bestand auf diesem Code: Sie musste ein Pseudonym gebrauchen – den Namen einer Stadt –, wenn sie ihn anrief. Das letzte Mal war es Pnom Penh gewesen.
Wen sollte er zuerst anrufen – seine Geliebte oder seine Exfrau? Er sollte Melissa anrufen, das wusste er, sie hatte es gern, wenn man umgehend zurückrief. Er wählte Irenes Nummer.
»Hallo, Irene. Ich –«
»Heute Abend, und vergiss es nicht, das ist alles.«
»Ja, bis dann. Ich hab’s nicht vergessen. Schließlich habe ich dich eingeladen.«
»Komm nicht zu spät. Ich warte fünf Minuten, dann gehe ich.«
»Ich bin pünktlich. Bye.«
Henderson stand auf und zog das Jackett aus. Er ging zur Tür, um es aufzuhängen, und blieb dort einen Augenblick stehen, das Jackett in der einen, das kantige Kinn in der anderen Hand. Er strich sich behutsam über den Kieferknochen wie jemand, der nach einer Novocainspritze zu sich kommt. Was um alles in der Welt trieb er da, fragte er sich – wie konnte er sich immer mehr mit Irene einlassen, wo er doch eigentlich Melissa wieder heiraten wollte? Er schüttelte den Kopf. Auch das war typisch: Eine klare und vorbestimmte Handlungsweise war durcheinandergebracht worden durch unbeständige und launische Begierden, denen er anscheinend nicht zu widerstehen vermochte. Jetzt stand er kurz davor, eine Wahl treffen zu müssen. Die schlimmste Situation, die man sich denken konnte.
Als er das Jackett über den Kleiderbügel hängte, fiel sein Blick auf die Briefe in der inneren Brusttasche. Auf zweien leuchtete das Rot und Blau von Luftpostbriefen. Als er vorhin aus seinem Apartment geeilt war, hatte er die Post eingesteckt, ohne sie näher anzusehen.
Er legte die Luftpostbriefe auf den Tisch und verspürte in der Brust einen Anflug von Ehrfurcht und Beklommenheit. Die Briefe kamen aus England, seine eigene Handschrift stand darauf – er legte Anfragen immer frankierte und adressierte Rückumschläge bei, um sich einer prompten Antwort zu versichern. Der eine trug den Poststempel Northampton. Er riss ihn mit dem Daumen auf.
Sehr geehrter Mr Dores,
besten Dank für Ihren Brief vom 7. März. Ich erinnere mich sehr gut an Captain Dores. Er war mein Kompaniechef während der Operationen im Raum von Pinbon im Jahr 43. Er war ein feiner und gerechter Mensch und bei den Kameraden beliebt.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich an Malaria erkrankt und nach Indien zurückgeschafft worden war, wo ich drei Monate im Lazarett lag. Als ich wieder zu meiner Einheit kam, war Ihr Vater schon sechs Wochen tot, und von der Kompanie war leider nicht mehr viel übrig, da wir oft im Einsatz gewesen waren.
Vielleicht wenden Sie sich an die nachfolgend Genannten, die bei der Kompanie waren, als Ihr Vater getötet wurde: Lance Corporal David Lee, Royal British Legion, 31 Hardboard Road, Chiswick, London, und Private Campbell Drew, Royal British Legion, Kelpie’s Wynd, Innerliethen, Peeblesshire. Ich habe diese Kameraden das letzte Mal 1967 bei einem Regimentstreffen gesehen, weiß also nicht, ob sie noch am Leben sind.
Captain Dores stand bei uns allen, wie schon gesagt, in hohem Ansehen. Wir waren alle erschüttert, als wir damals von seinem Tod hörten.
In der Hoffnung, Ihnen dienlich gewesen zu sein, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Sergeant (i.R.) Graham Bellows
Noch eine Fehlanzeige, aber immerhin kannte er jetzt noch eine Person, die er anschreiben konnte. An Drew hatte er schon geschrieben. Er warf einen Blick auf den anderen Brief; dieser trug den Poststempel Galashiels. Das war zweifellos seine Antwort.
Drews Handschrift war groß und zackig, und er drückte offenbar sehr stark auf seinen Kugelschreiber.
Sehr geehrter Herr,
zu Ihrem Brief wegen Ihres Vaters. Ich war bei der Kompanie in der Nähe von Pinbon, als er starb. Es war für uns alle eine schwierige Situation, da wir hinter den feindlichen Linien operierten. Wir hatten fast täglich Verluste durch Krankheit, Feindeinwirkung und sogar durch Unfälle. Ihr Vater war ein guter Mensch und ein guter Offizier. Sein Tod war für uns alle ein schwerer Schlag.
Mit freundlichen Grüßen
Campbell Drew
Henderson strich Drews etwas zerknitterten Briefbogen auf der Tischplatte glatt. Er lehnte sich zurück und atmete tief aus. Immerhin einer, der dabeigewesen war. Aber der Brief half ihm nicht weiter. Was genau war an jenem Tag – dem 21. März 1943 – in Burma geschehen? Präziser ausgedrückt: Unter welchen Umständen war Captain Dores ums Leben gekommen? Wie, wo, wann und durch wen? Er beneidete plötzlich diesen Schotten mit der ungelenken Handschrift. Drew hatte seinen Vater gekannt, hatte unter ihm gedient und wahrscheinlich zusammen mit ihm lustige und schlechte Zeiten erlebt; hatte gewissermaßen eine Art Intimität mit ihm geteilt, die seinem Sohn verweigert worden war.
Er starrte auf die Reproduktion einer Landschaft von Monet, die Mulholland & Melhuish 1963 in London für fünfundvierzigtausend Pfund verkauft hatte. Die Farben verschwammen. Er stellte die Augen auf unendlich und versuchte in der Hoffnung, die in ihm aufsteigende Trauer zu unterdrücken, in eine kurze Trance zu versinken. Es klappte nicht. Warum fühlte er sich nicht müder? Als an chronischer Schlaflosigkeit leidender Mensch hatte er doch wohl das Recht, sich ständig erschöpft zu fühlen.
Kimberly betätigte den Summer.
»Mrs Wax, Sir. Auf Apparat eins.«
Henderson zögerte nur eine Sekunde, dann nahm er den Hörer ab.
»Melissa«, sagte er enthusiastisch. »Habe gerade deine Nachricht erhalten.«
»Du hast es nicht vergessen, nein?«
»Natürlich nicht.« Er fragte sich, was er nicht vergessen hatte. Alle erinnerten ihn heute an etwas.
»Dann bis später.«
»Ja – ehem – um wie viel Uhr sagtest du?«
»Um sieben. Bryant freut sich schon.«
»Dito. Dann also um sieben.«
Mrs Wax legte auf. Er glaubte einen durch die Leitung schwingenden gehauchten Kuss gehört zu haben. Die Sache war ein zweifelhaftes Vergnügen. Er runzelte die Stirn. Von den zahlreichen Bedingungen, die Melissa gestellt hatte – ehe sie den Gedanken an ihre Wiedervereinigung auch nur in Betracht zog –, war eine der lästigsten die, dass die Kinder aus ihrer zweiten Ehe »Henderson wie einen Vater lieben lernen sollten«. In seinem Eifer, zu Gefallen zu sein, erklärte sich Henderson mit allem einverstanden, sogar mit der Ächtung von vor-wiederehelichem Sex. Daher das Treffen heute Abend. Er erinnerte sich: Bryant hatte Geburtstag, und Bryant war seine Stieftochter in spe. Er rechnete. Melissa um sieben. Irene traf er um neun, in der Bar eines Restaurants in Soho. Das müsste er schaffen können. Jetzt musste er nur noch ein Geschenk für das Mädchen kaufen.
Henderson blickte in den Korb mit den Posteingängen: drei Briefe. Mit einem gewissen Schuldgefühl wurde er sich bewusst, dass er sich erst jetzt seiner Arbeit zuwandte, obwohl er schon eine Stunde im Haus war. Seine Privatangelegenheiten nahmen einen immer größeren Teil seiner Zeit in Anspruch … Er musste sich jetzt konzentrieren.
Dass das Geschäft bei Mulholland & Melhuish blühte, konnte man nicht gerade behaupten. Deshalb hatte man ihn ja aus England herübergeholt: Er sollte den Laden in Schwung bringen, einiges hereinholen, dafür sorgen, dass die Firma sich ein Renommee erwarb. Da fiel ihm wieder ein, was Pruitt gesagt hatte: dass Aussicht auf eine Versteigerung von Impressionisten bestand. Er fuhr zusammen; er sollte wirklich mehr darüber in Erfahrung bringen, etwas Interesse an den Tag legen, anstatt Briefe zu lesen und mit Freundinnen zu telefonieren. Schließlich fiel das in sein Fach.
Mulholland & Melhuish hatte einen »Impressionisten-Fachmann« gebraucht und deshalb ihn herangezogen. Aus irgendeinem Grund war in Amerika ein Auktionshaus erst richtig etabliert, wenn es eine größere Anzahl von Impressionisten unter den Hammer bringen konnte. Erst dann schien man vertrauenswürdig zu sein und einen Ruf zu erlangen. So war es zumindest im Fall der New Yorker Filialen der anderen berühmten Londoner Auktionshäuser gewesen. Bis man mit einem bedeutsamen Angebot von Impressionisten aufwarten konnte, war mit wenig ernsthaft profitablem Geschäft zu rechnen. Das war so eine Art Äquatortaufe, das musste man hinter sich bringen. Warum das so war, ließ sich nicht sagen. Es war einfach eine der unlogischen Regeln in diesem Spiel.
Er zeichnete konzentrische Kreise auf seine Löschblattunterlage. Mulholland & Melhuish hatte die New Yorker Filiale vor anderthalb Jahren eröffnet. Und bis jetzt war es zu keiner bedeutsamen Versteigerung von Impressionisten gekommen. Man hatte ihn als möglichen letzten Trumpf herübergeholt. Da er eine Autorität auf dem Gebiet der französischen Malerei des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts war, sollten sein Fachwissen, seine akademischen Beziehungen, seine Kenntnisse über Privatsammler potenzielle Kunden anlocken und ihnen Vertrauen einflößen.
Zunächst – wieder ein Zeichen, wieder ein Omen – war alles recht glatt gegangen. Gleich in den ersten vierzehn Tagen hatte er eine große Berthe Morisot zur Versteigerung erworben. Die Moral stieg; Erleichterung und Hoffnung waren in den Büros fast mit Händen zu greifen. Aber seitdem: Fehlanzeige.
Er trommelte mit den Fingern auf die Schreibtischplatte. Pruitts Neuigkeit bedeutete einen Triumph für die Firma, für ihn aber auch so etwas wie ein persönliches Versagen. Er hatte sich nicht energisch genug eingesetzt. Die Probleme seines Privatlebens kosteten ihn zu viel Zeit. Wenn sich Melissa nur nicht so störrisch gezeigt hätte. Wenn er nur Irene nicht begegnet wäre …
Er stand auf und blickte die Regale entlang, die vollgepfropft waren mit dicken Kunstbüchern, abgegriffenen Katalogen, Auktionsakten. Er schlenderte in Kimberlys kleines Büro hinüber. Sie tippte gerade, die leuchtenden Fingernägel schwebten über den Tasten. Ob da auch einmal einer abbrach? Er fuhr sich mit den Fingern durch das dichte Haar und zog die Hose hoch. Er beantwortete Kimberlys fragenden Blick mit einem unbestimmten Lächeln. Er sollte wirklich etwas über diese Versteigerung in Erfahrung bringen, sonst glaubte man noch, er schmolle.
Ein Kopf wurde zur Tür hereingestreckt.
»Meine Güte, ich dachte, Sie seien in Boston.«
Es war Thomas Beeby, sein Chef. Beeby war sehr groß und schlank und hätte wie der klassische, distinguierte englische Gentleman ausgesehen, wären nicht seine erstaunlich rundlichen, rosigen Wangen gewesen, die ihm das zu dem Gesamtbild nicht passende pausbäckige Aussehen eines in die Jahre gekommenen Cherubs verliehen.
»Aufgeschoben, Tom«, sagte Henderson. »Der Mann scheint erkrankt zu sein.« Kimberlys Nägel ließen ohne Pause die Tasten klappern.
»Aber das ist ja wunderbar. Haben Sie schon das Neueste gehört?«
»Die Versteigerung? Ja, ich war gerade auf dem Weg –«
»Es scheint, wir können die Sammlung Gage bekommen.«
»Ach ja?« Gage, Gage. Der Name sagte ihm nichts im Zusammenhang mit einer Gemäldesammlung.
»Kommen Sie mit, ich erzähle Ihnen alles. Gott sei Dank, dass Sie nicht in Boston sind.«
Er folgte Beeby den Flur entlang zu seinem Zimmer. Aus dem Geschoss darunter drangen Geräusche herauf – der Auktionsraum begann sich zu füllen. Heute war Porzellan dran. Ein ehrerbietiger Toothe ging vorsichtig an ihnen vorbei, um die Sache zu übernehmen.
»Alles in Ordnung, Ian«, sagte Beeby. »Henderson ist doch nicht in Boston. Er kann fahren.«
Wohin fahren, fragte sich Henderson.
»Oh, sehr gut«, sagte Toothe. Die Enttäuschung war ihm anzuhören. Henderson verspürte ein kurzes Hochgefühl. Das kleine Schwein, dachte er, hat mir kein Sterbenswort von dieser Sammlung Gage gesagt, wollte sie sich selbst unter den Nagel reißen.
Beeby legte Henderson die Hand auf die Schulter.
»Das ist es endlich, Henderson«, sagte er. »Das ist es, worauf wir so lange gewartet haben.«
Sie betraten Beebys Büro, das ein wenig größer war als Hendersons, aber nicht weniger funktional eingerichtet. Immerhin bot es einen besseren Blick auf den Central Park. Die Sonne schien noch immer auf die Bäume. Fernes Gehupe drang von der Madison Avenue herauf. Beeby zündete sich eine Zigarette an. Henderson fühlte seine Erregung, und er verspürte eine jähe Zuneigung zu dem hochgewachsenen Mann. Beeby hatte ihn nach Amerika geholt, die Fäden gezogen und diese Stelle für ihn geschaffen, und dafür würde Henderson ihm ewig dankbar sein.
»Loomis Gage«, begann Beeby. »Zurückgezogen lebender Südstaatler, Millionär. Ein alter Mann mit einer kleinen, aber erlesenen Sammlung. Einige Holländer, siebzehntes Jahrhundert, Sachen aus unbedeutenden Schulen; nichts Besonderes. Aber. Aber: zwei schöne Sisleys – von 1872, sagt er –, zwei van Dongens, ein großer Derain, ein Utrillo, ein kleiner Braque und zwei Vuillards.«
»Na!«
»Ich möchte, dass Sie da hinfahren, Henderson. Prüfen Sie alles und ziehen Sie es dann für uns an Land. Keine Verkäuferkommission. Versprechen Sie ihm einen Farbkatalog. Eine Ausstellung in London, falls er das wünscht. Was auch immer.«
»Gut.« Henderson ließ sich von Beebys Erregung anstecken. Er begann im Kopf ungefähre Summen zu addieren, kalkulierte die zehn Prozent Käuferkommission, die Mulholland & Melhuish berechnen würde. Das musste ein sehr gutes Geschäft werden. Aber was noch wichtiger war, es würde das Signal für den endgültigen Einzug der Firma in den New Yorker Auktionshandel sein … Doch ein Aspekt dieser wundersamen Chance machte ihn stutzig.
»Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Tom, aber – das ist jetzt rein persönliche Neugier – was hat ihn dazu gebracht, die Bilder gerade uns anzubieten?«
»Der reine Zufall. Er behauptet, in den Zwanzigern den alten Mulholland kennengelernt zu haben. Wollte ihn sprechen. Als ich ihm sagte, er sei tot, hätte er beinahe aufgelegt. Da sagte ich, ich sei der Schwiegersohn von Archie Melhuish, und das hat ihn wieder aufgemuntert. Ein Glücksfall, weiter nichts.« Beeby lächelte fröhlich. »Wir haben mal die Trumpfkarten erwischt.«
Henderson lächelte ebenfalls. Guter, alter Tom, dachte er, es war schön, ihn zur Abwechslung einmal glücklich zu sehen.
»Ich möchte, dass Sie am Sonntag hinfahren.«
»Am Sonntag?«
»Ja.«
»Natürlich.« Henderson lächelte weiter. »Und wo ist das? Genau?«
»Er wohnt an einem Ort namens Luxora Beach.«
»Ist das so eine supermoderne Eigentumswohnanlage?«
»Da bin ich mir nicht sicher.« Beeby runzelte die Stirn. »Es ist in Georgia, glaube ich. Oder Alabama. Irgendwo da in der Gegend. Ich weiß im Augenblick nur, dass Sie am Montag in Atlanta sein müssen.«
»Etwas vage, das alles, nicht?«
»Ja. Aber das ist Absicht. Es geht ihm um seine Privatsphäre. Er hat mir nicht einmal seine Telefonnummer gegeben. Ruft heute Nachmittag noch einmal an und will mir nähere Einzelheiten mitteilen. Jedenfalls – bringen Sie die Sache so schnell wie möglich unter Dach und Fach.«
»Mache ich.« Ihm war eine Idee gekommen. »Eine sehr gute Nachricht, Tom«, sagte er zu dem strahlenden Beeby. »Freue mich wirklich. Gratuliere.« Impulsiv, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, schüttelten sie einander die Hand.
Wieder in seinem Büro angelangt, ließ sich Henderson von Kimberly mit Irene verbinden.
»Mrs Düsseldorf?«
»Okay, Henderson, was ist?«
»Würdest du gern ein paar Tage Urlaub machen? Schon morgen?«
»Ich weiß nicht – wo soll’s denn hingehen?«
»In den Süden.«
Zweites Kapitel
Er war noch immer sehr mit sich zufrieden, als eine Stunde später Pruitt Halfacre in sein Büro kam.
»Zeit zum Lunch?«, fragte Halfacre. Heute kannte Hendersons Wohlwollen keine Grenzen.
»Großartige Nachricht, das mit der Sammlung Gage«, sagte er, als sie die Madison hinunterschritten.
»O ja. Ja«, pflichtete Halfacre ihm bei. Er wirkte ein wenig bekümmert.
»Ist etwas?«
»Wir müssen miteinander reden, Henderson.«
»Ja, gut. Worüber?«
»Warten wir damit bis zum Essen, das wäre mir lieber.«
Sie gingen ein paar Stufen hinunter in ein Restaurant, das in honiggelben und lindgrünen Farbtönen gehalten war. Gleich vorn vor der Theke drängten sich elegante Frauen und hochgewachsene, breitschultrige Männer. Alle sprachen mit lauter, fester Stimme und machten einen gelösten Eindruck. Voller Kummer – er hatte es ja gewusst – spürte Henderson, wie sein Selbstvertrauen zu schwinden begann. Es musste in der Newtonschen Physik irgendein Gesetz geben, das dieses Phänomen erklären konnte und demzufolge eine überlegene Kraft die Macht besaß, einer unterlegenen Kraft des gleichen Typs Energie zu entziehen. Er ließ den Blick über die schicken Leute an den Tischen schweifen. Pruitt begrüßte Bekannte mit lautem Hallo. Ich will so sein wie ihr alle, dachte Henderson, während er fühlte, wie ihm die Schultern herabfielen und die Brust einsank; ich will euer Selbstvertrauen haben und eure Zielstrebigkeit, eure Zähne und eure sonnengebräunte Haut, flehte er, während er zur Seite trat und sich bei einem Kellner entschuldigte. Das ist nicht fair.
Sie drängten sich an die Bar durch, Henderson in Halfacres Kielwasser. Er atmete ein Dutzend verschiedene Duftschwalle ein. Jasmin, Rose, Nektarine, Moschus, Zibet. Juwelen funkelten, dezent und teuer.
»Henderson, darf ich ganz offen zu Ihnen sein?«, sagte Halfacre mit tiefer Stimme dicht an seinem Ohr.
Henderson sah ihn erstaunt an. »Können wir nicht zuerst etwas trinken?«
Ein Barkeeper näherte sich mit dem Gehabe eines Filmstars.
»Tag, die Herren. Was darf’s sein?«
»Dewar’s on the rocks«, sagte Halfacre. »Mit einem Kringel. Henderson?«
»Mir ein Budweiser, bitte«, sagte Henderson. »Ungekringelt.«
Der Barkeeper fand das nicht witzig. Er stülpte ein Glas in einen knirschenden, glitzernden Behälter mit Eiswürfeln und füllte es bis zum Rand. Er goss reichlich Whisky dazu, schnitt einen Kringel Zitrone ab und ließ ihn hineinfallen. Wie können sie ausgezeichnetem Whisky nur so was antun, dachte Henderson. Überall waren Eis und Zitrone drin. Eine wahre Verschwendung von Eis in diesem Lande. Ungeheure Eisvorkommen. Er trank einen Schluck von seinem Bier.
»Sie sagten gerade« – er wandte sich zu Halfacre um – »etwas von völliger Offenheit.«
»Pruitt, dein Tisch ist frei.« Das war der Kellner.
»Thatcher, hi.« Halfacre und der Kellner umarmten sich unter viel männlichem Schulterklopfen. »Ich hab schon gehört, dass du hier bist. Wie läuft’s denn so?«
»Oh, nicht schlecht. Ich arbeite an einem Roman.«
»Großartig! … Ach, das mit Muffy tut mir leid. Ich habe davon gehört. Sie ist wohl nicht klargekommen.«
»Des einen Freud –«
»Des anderen Leid. Zu blöd.« Halfacre verbrachte eine Sekunde in tiefem Nachdenken. »Thatcher, das ist ein Kollege von mir, Henderson. Thatcher und ich sind zusammen zur Schule gegangen.«
»Nett, Sie kennenzulernen, Henderson.«
»Guten Tag«, murmelte Henderson, mittlerweile völlig entmannt. Thatcher geleitete sie durch die mondäne Menge zu ihrem Tisch. Henderson hatte das Gefühl, sein Hals habe sich in den Rumpf zurückgezogen und seine Schultern seien im Begriff, sich vor dem Kinn zu begegnen. Er nahm mit einem Seufzer der Erleichterung Platz. Halfacre schien das in Aussicht genommene Gespräch vergessen zu haben, und Henderson ließ es einen Augenblick lang ruhig angehen. Er vertiefte sich in die Speisekarte und musterte Halfacre über ihren oberen Rand. Er sah Halfacres klar geschnittenes, hageres Gesicht, das kurz geschnittene Haar, die – gerade erst aufgesetzte – modische Schildpattbrille. Hier hatte er das Musterbeispiel, das platonische Ideal vor sich: Harvardstudium, Dr. phil., alteingesessene Familie, bescheidenes, aber angenehmes Privateinkommen; der amerikanische Mann, Marke ausgehendes zwanzigstes Jahrhundert. Wie lässig-selbstverständlich er seine Kleidung trug, wie sehr er sich in diesem feinen Restaurant zu Hause fühlte. Man beachte den meisterhaften Aplomb, mit dem er beiläufige Gespräche anfangen und beenden konnte. Man lausche seinen fest gefügten und vernünftigen Ansichten. Und außerdem war dieser Mann mit einem intelligenten und gut aussehenden Mädchen verlobt. Und was noch hinzukommt, dachte Henderson: Dieser Mann ist elf Jahre jünger als ich.
Thatcher erschien wieder, um die Bestellungen aufzunehmen.
»Hühneromelett«, sagte Halfacre. »Gebratene Scholle, Salatbeilage, ohne Dressing. Ist Ihnen ein Sancerre recht, Henderson?«
»Wunderbar.« Hendersons Blicke zuckten verzweifelt über die Speisekarte auf der Suche nach etwas, das er erstens mochte und von dem er zweitens wusste, was es war. Was Halfacre bestellt hatte, schien hier gar nicht aufgeführt zu sein. Ein solcher Mann ließ sich bringen, was er wollte, und nicht, was angeboten wurde.
»Ich – hm – fange an mit – ehem – crevettes fumées aux framboises. Als Nächstes nehme ich …« Du lieber Gott. »Als Nächstes nehme ich … Rinderfilet mit Karamelsoße.«
»Gemüse, Sir?«
Henderson starrte auf die Karte. Haferwurz, Griechisch-Heu, Wurzelingwer. Was war das alles? Da erspähten seine Augen etwas Bekanntes. »Geschmorter Rettich.«
Die Speisekarten wurden entfernt.
»So, Pruitt«, sagte er, während er die Serviette auseinanderschüttelte, »Sie wollten über etwas mit mir sprechen.«
Pruitt zog mit den Zinken seiner Gabel Furchen in das dicke, weiße Tischtuch.
»Ganz recht.« Er hielt inne. »Henderson, warum sind Sie mir gegenüber so – so feindselig eingestellt? Warum« – Pruitt hielt jetzt die Gabel mit beiden Händen gefasst, als wollte er sie verbiegen – »warum hassen Sie mich, Henderson? Warum verspüre ich diese unglaubliche Aggression, die von Ihnen ausgeht?«
Erst gegen Ende des unbefriedigenden Lunchs (Henderson hatte entgeistert seine gespenstisch roten Krabben angestarrt und nur einen Bissen von der kandierten Lende geschafft) war Halfacre schließlich überzeugt, dass sein Kollege nicht nur nichts gegen ihn hatte, sondern ihn im Gegenteil sogar bewunderte und hoch schätzte. Dass Henderson ihn außerdem für einen idealen Bundesgenossen und klugen Kopf hielt. Halfacre brauchte zwanzig Minuten, bis er vom Stadium der Skepsis über etwas widerwillige Entschuldigungen zu unverhohlener Dankbarkeit fand. Hendersons Fragen förderten zu Tage, dass es zu der Fehleinschätzung eine Woche zuvor gekommen war, als Halfacre ihm den Flur hinunter einen Gruß zugerufen und Henderson – wie Halfacre geglaubt hatte – recht schroff darauf geantwortet hatte.
»Und Sie glaubten, das bedeutete, ich mag Sie nicht?«
»Gott, Henderson. Ich wusste es einfach nicht. Ihre Erwiderung war so … Sie wissen schon, so voller … voller … Was hätte ich mir dabei denken sollen?«
»Sie sagten ›Hi, Henderson‹. Und ich sagte ›Hallo‹.«
»Ja – aber es lag daran, wie Sie das sagten.«
»Hallo. Hallo. Das geht nur auf eine Weise.«
»Da sagen Sie es schon wieder so. Hlou, hlou.«
»Aber so spreche ich nun mal, Pruitt.«
»Aber ich hatte das Gefühl, Sie … Ach, okay, dann bin ich eben ein wenig paranoid. Ich weiß. Ich habe Probleme mit meiner Selbsteinschätzung. Ich mache mir Sorgen wegen solcher Dinge. Die Aggression in dieser Stadt, Henderson. Der Konkurrenzkampf … Sehen Sie, da sind Burschen, mit denen ich zusammen auf der Schule war, mit denen ich aufgewachsen bin – Zahnärzte, Makler –, die verdienen zwölfmal so viel wie ich. Zwölfmal so viel.« Er zählte weitere Sorgen und Ängste auf. Henderson sah zu, wie er sich zu seinem schwarzen Tee eine dicke Zigarre anzündete, und fragte sich, weshalb Halfacre sich eigentlich Sorgen machte. Dessen Probleme hätte er haben mögen … Da kam ihm der Gedanke, dass es am Ende allen Halfacres dieser Welt vielleicht bloß darauf ankam, sich in einem dauernden Zustand der Besorgnis zu befinden – wegen irgendwas, wegen allem möglichen. Ich mache mir Sorgen, ergo sum.
»Ich glaube, es ist gut, dass wir so miteinander reden«, sagte Halfacre um seine Zigarre herum. »Wissen Sie, wenn wir diese Art von hilfreichem holistischem Fluss bewirken können« – eine fließende Bewegung mit beiden Händen –, »Gott, was könnten wir da hervorbringen und auf die Beine stellen … Wir verinnerlichen, Henderson. Ich verinnerliche jedenfalls. Ständig, ich weiß. Mein Fehler. Mein tragischer Makel, ha.« Er runzelte die Stirn. »Und das kann nicht gut sein, oder?«
»Nein, wohl nicht. Aber andererseits –«
»Sie haben recht. Sie haben ja so recht.«
Sie gingen langsam, den großen Park zur Linken, die Fifth Avenue hinauf zum Büro zurück.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Henderson«, sagte Halfacre.
»Keine Ursache.«
»Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr ich Ihre Freundschaft zu schätzen weiß. Wie sehr ich Ihre Bücher bewundere und Ihr Wissen.«
»Schon gut, ich bitte Sie.« Henderson brach der Schweiß der Verlegenheit aus.
»Nein, ich habe das Gefühl, ich muss –«
»Gehen wir in die Frick Collection«, sagte Henderson unvermittelt, einer Eingebung folgend.
Sie bezahlten beide ihren Dollar und traten in das Halbdunkel der kühlen Gemäldegalerie. Das Wassergeplätscher vom Hof her, der solide graue Stein und Marmor und die makellosen Pflanzen verströmten eine lebendige Ruhe und bewirkten die gewohnte Verzauberung. Henderson entkrampfte sich. Wenn ich nur hier mein Bett aufschlagen könnte, dachte er, ich weiß, dann könnte ich schlafen.
Sie schritten langsam durch einen Saal voller Goyas, Lograins und van Dycks, betraten dann einen anderen großen Raum. Der Anblick der Gemälde brachte Halfacre endlich zum Schweigen. Hendersons Gedanken schweiften ab, beschäftigten sich mit seiner Reise in den Süden. Er beschloss, mit dem Auto zu fahren, zwei Tage unterwegs zu verbringen. Er konnte sich Kentucky ansehen, Virginia … vielleicht über Nacht in Washington bleiben. Irene konnte ihm die Hauptstadt zeigen. Er lächelte bei dieser Vorstellung. In schönen Hotels übernachten. Eines in der Nähe dieses Luxora Beach ausfindig machen. Irene konnte schwimmen und Sonnenbäder nehmen, während er tagsüber bei Gage zu tun hatte. Die Abende mit Irene zusammen verbringen, nur sie beide, Melissa und sein Gewissen in New York zurücklassen.
Halt, so nicht, bitte. Das war nicht gerade die angemessene innere Einstellung gegenüber einer zukünftigen Ehefrau. Er verzog ein wenig das Gesicht. Er fragte sich, weshalb er in diesem Zwiespalt leben und, seinem gesunden Instinkt zum Trotz, in Bezug auf seine Pflicht so launenhaft sein musste. Vielleicht würde Pruitt sagen, das sei sein tragischer Makel …
Er sah sich um. Halfacre war schon weitergegangen. Henderson schwenkte nach links und ging, den Hof überquerend, in einen anderen Saal. An den Wänden hingen Romneys, Gainsboroughs und Constables. Jäh überfiel ihn ein Anflug von Heimweh nach England. Er dachte wie im Traum an englische Landschaften, an die Wirklichkeit hinter den hier hängenden Bildern. Jetzt, im April, würde das Laub schon herausgekommen sein, und auf den Feldern … Die riesigen, heckenlosen Felder würden aufdringliche Prärien in brutalem, grellem Gelb sein, da irgendeine Verfügung der Europäischen Gemeinschaft die Landwirte angespornt hatte, jeden verfügbaren Morgen Land mit Raps einzusäen. Und im Herbst, dann war es wie eine Fahrt durch ein vom Krieg verwüstetes Land; breite Rauchsäulen stiegen von den brennenden Stoppeln zum Himmel auf, und der Himmel selbst verbarg sich hinter einem dünnen Schleier aus Ascheflocken. Als er an einem Wochenende im vergangenen Sommer vor dem Häuschen eines Freundes in den Cotswolds saß, hatte er sich vor einem Regen spröden Aschestaubs in Sicherheit bringen müssen, der aus scheinbar klarem Himmel herabfiel.
In dieser von drastischem Realismus geprägten Stimmung wandte er sich Richard Paul Jodrell von Gainsborough zu. Da zeigte sich das hochmütige, selbstzufriedene Gesicht Englands. Und auf Die Mall am St. James’s Park waren die selbstgefälligen Schönen zu sehen, die sich in zwei Jahrhunderten nicht verändert hatten. Er konnte sich ihre Gespräche vorstellen, den Tonfall ihrer trägen Stimmen hören. Er sah genauer hin. Zu seiner leisen Überraschung entdeckte er an einer der Frauen eine verblüffende Ähnlichkeit mit seiner Mutter.
Er dachte an sie, eine gut erhaltene Fünfundsechzigjährige mit spitzer Nase, die in ihrer hübschen »Villa« in Hove lebte. Zu stark geschminktes Gesicht, das graue Haar zu einem jugendlichen Bubikopf getrimmt, unerschütterlich und unreflektiert konservativ. Sie weilte oft bei ihren erwachsenen Nichten und deren jungen Familien – eine wohlhabende und gern gesehene Besucherin in deren im Grüngürtel gelegenen Behausungen. Henderson war ihr einziges Kind, und sie bewahrten tapfer einen Anschein von Zuneigung zwischen Mutter und Sohn, der die gegenseitige Missbilligung im Großen und Ganzen ausreichend verbarg.
Henderson verließ fluchtartig den Raum. Dem wollte er ja gerade entkommen, das war seine Vergangenheit, die jetzt hoffentlich für immer hinter ihm lag. Er verlangsamte den Schritt und schlenderte durch einen Saal mit schaumigen Pastellbildern von Fragonard. Kein Halfacre zu sehen. Er ging wieder zurück.
Halfacre schien sich kaum von der Stelle gerührt zu haben. Er stand vor dem Gemälde Herrin und Magd von Vermeer. Henderson sah, dass ihm Tränen übers Gesicht rannen. Brust und Schultern zuckten unter einem leisen Schluchzen.
»Pruitt«, sagte Henderson bestürzt. »Was ist denn?« Hatte er ihn etwa schon wieder irgendwie gekränkt?
Halfacre deutete auf das Bild.
»Es ist so wahr«, sagte er. »Es ist so wahr.«
Henderson unterdrückte das automatisch aufsteigende hämische Grinsen. Das ist der Unterschied zwischen uns, dachte er traurig. Eine große, unüberbrückbare Kluft. Wir haben beide unsere Laufbahn der Kunst gewidmet, aber er kann in einer Gemäldegalerie weinen. Ich würde eher sterben.
Henderson trat etwas verwirrt beiseite. Er wusste nicht, was er sagen sollte, und ihm wurde plötzlich auf beklemmende Weise klar, dass er noch einen weiten Weg zurückzulegen hatte, bis er sich in diesem Land zu Hause fühlen würde.
Sieh dir die Gemälde an, sagte er sich. Er gehorchte. Die Kreuzabnahme von Gerard David. Der Maler von Frans Hals. Judith und Holofernes von Jacob van Hoegh. Bei diesem Bild blieb er stehen, leicht schockiert angesichts der Wonne, die sich auf Judiths Zügen ausdrückte, während sie brutal Holofernes’ Kehle durchsäbelte. Judith hatte ein keckes, herzförmiges Gesicht mit schmalem Kinn. Holofernes’ Zunge, blass-lila und schaumbefleckt, hing gute sieben, acht Zentimeter heraus.
»Pruitt, kommen Sie, sehen Sie sich das mal an«, sagte Henderson. Das würde bestimmt seinen Tränen Einhalt gebieten.
Am Nachmittag schaute Beeby herein mit Gages Telefonnummer und den Anweisungen über das Wo und Wann ihres Treffens. Sie waren ganz einfach. Wenn Henderson in Atlanta eintraf, sollte er zwischen vier und fünf Uhr nachmittags die angegebene Nummer wählen. Dann würde er erfahren, wie es weiterging.
»Ist das alles?«
»Ja, leider.«
»Bisschen geheimnistuerisch, nicht? Muss das alles wirklich sein?«
»Sie kennen doch diese Leute«, sagte Beeby feierlich. »Unsicher. Eifrig auf ihre Privatsphäre bedacht. Er hat sich nicht von dieser Vorgehensweise abbringen lassen. Eisern war er. Wir müssen das respektieren, Henderson. Wir können es uns nicht leisten, ihn vor den Kopf zu stoßen.«
»Immer schön sachte.«
»Genau.« Beeby kniff die Augen zusammen und wedelte mit der Hand. »Klingt, als hätte er’s faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig vorgehen.«
Henderson begleitete ihn zur Tür. Beeby spielte mit seinem Siegelring.
»Viel Glück«, sagte er und tätschelte Hendersons Ellbogen. Es war ein Ausdruck aufrichtiger Zuneigung und Anteilnahme.
»Keine Sorge«, sagte Henderson; seine Finger streiften über Beebys Ärmel zum Zeichen, dass er die Zuneigung erwiderte. Seitenweise drängten sich Empfindungen und Zeichen in den vier Worten zusammen.
»Ich rufe Sie an, sowie ich Kontakt aufgenommen habe. Und, Tom – es wird schon gut gehen.«
»Gewiss. Dann bis nächste Woche.«
Henderson sah Beebys großer Gestalt nach, wie sie den Flur hinunterschritt. Er merkte, dass seine Augen feucht wurden. Er verlässt sich auf mich, dachte er. Wie ein Vater. Fast.
Drittes Kapitel
Das Sportcenter hatte seine Räume am East River im Kellergeschoss eines alten Gebäudes zwischen der Queensboro Bridge und dem Franklin Delano Roosevelt Drive. Es war der einzige Ort in Manhattan, an dem Henderson einen Coach im Säbelfechten hatte ausfindig machen können, und deshalb versuchte er, barmherzig über das wenig anziehende Erscheinungsbild dieser Stätte hinwegzusehen.
Die Kellerfenster waren massiv vergittert und ließen vor Schmutz kaum Licht durch. Den Treppenschacht zierte Strandgut in Form von Wachspapierkartons und Bier- und Limonadedosen. Die ramponierten genieteten Stahl-Doppeltüren waren gespenstisch und professionell mit futuristischen Namen und Zahlen besprüht.
Henderson trat ein. Ein alter Mann hinter einem Schaltergitter blickte prüfend auf seine Karte, die ihn als Mitglied des Queensboro Fitnessclubs auswies.
»Ist Mr Teagarden da?«, fragte Henderson.
»Ist er.«
Henderson lief einen Gang entlang und betrat den dumpfigen Umkleideraum. Schmale Reihen von grauen Spinden füllten ihn fast zur Gänze. Dazwischen standen niedrige Bänke. Drei junge Puertoricaner im Boxdress standen wie aufgereiht in der Nähe von Hendersons Spind und rauchten.
Er versuchte sich möglichst unbekümmert auszukleiden. Dann zog er seine weißen Socken und den weißen Rollkragenpullover an und stieg in die weißen Knickerbocker. Er hörte, wie man hinter ihm kicherte und Witze machte.
»He, was trägst denn du da für ’n Zeug?«
Henderson schnürte sich die Turnschuhe.
»Bisschen tuntig, was, Mann!«
Er schlang sich den Säbelbeutel über die Schulter.
»Schneewittchen. He, Schneewittchen!«
Er griff nach Maske, Handschuhen und gepolsterter Weste und schritt so erhaben es ging aus dem Umkleideraum.
Der Übungsraum mit seiner niedrigen Decke war erstaunlich groß. Da waren ein Boxring, eine Fläche mit Fitnessgeräten – Flaschenzugapparaturen, Kippsitze und Beinstützen, kurze Laufbänder mit Messskalen und Handgeländern – und die üblichen Hanteln und Gewichte, mit denen die schweißglänzenden, erbshirnigen Muskelprotze herumjonglieren konnten. Da waren ferner eine große Matte für die Liebhaber der asiatischen Kampfsportarten und am anderen Ende, hinter einer Tür, ein Dampfbad und ein Tauchbecken.
In der hinteren Ecke sah er Teagarden, der gerade mit Kreide die piste abgrenzte.
»Ziemlich spät«, sagte Teagarden.
»Viel zu tun gehabt«, entschuldigte sich Henderson. »Und ich muss spätestens um halb sieben gehen.«
»Gibt aber keine Ermäßigung.«
»Nein, so habe ich das auch nicht gemeint …«
Eugene Teagarden war ein Schwarzer. Der einzige schwarze Säbelfechter in Amerika, wie er behauptete, weshalb er so hohe Unterrichtsgebühren verlangte. Er war schlank und rank und hatte einen gepflegten breiten Schnurrbart. Sein Verhalten schwankte launenhaft zwischen Feindseligkeit und Geringschätzung. Er war, soweit Henderson das beurteilen konnte, ein brillanter Fechter. Er lehrte außerdem nicht eigentlich Fechten, sondern »Zen-Fechten«, wie er es nannte. Die reine Technik wurde dabei mit verwirrenden philosophischen Abhandlungen und bewusstseinserweiternden Prozeduren garniert. Angespornt durch die in Amerika ständig zu hörende Aufforderung zu körperlicher Betätigung, hatte Henderson sich für das Fechten entschieden, die einzige Sportart, die ihm während der Schulzeit immerhin ein wenig Spaß gemacht hatte. Es ging ihm weniger um Körpertraining als um ein Gesprächsthema bei Dinners und Partys. Wenn früher oder später die Rede darauf kam, was man für seine Kondition tat, wenn man von Aerobic sprach oder sich über den Schrittlängenfaktor beim Joggen erhitzte, konnte Henderson immer etwas über das Fechten beisteuern.
Er zog einen Säbel aus dem Beutel.
»Dann keine Zeit verschwendet«, sagte Teagarden. »Masken auf. Auslage.«
Henderson stülpte sich die Maske über, das große zyklopische Fliegenauge. Er liebte die Maske; sie machte seinen Kopf so gesichtslos wie eine Glühbirne.
»Denken Sie an die Regeln«, sagte Teagarden.
Kontrollierte Entspannung, sagte Henderson sich vor, kontrollierte Entspannung. Das war der Schlüssel zu Teagardens Methode, das Herzstück des »Zen-Fechtens«. Und deshalb ließ er sich Teagardens Beschimpfungen gefallen: Diese Barschheit tat ihm gut, so hoffte er. Er brauchte nicht das körperliche Training, er brauchte die Therapie.
»Auf die Zehenspitzen.«
Henderson erhob sich auf die Zehenspitzen, Beine gespreizt, linke Hand an der Hüfte, Säbel vor sich angewinkelt.
»Fühlen Sie diese Klinge«, sagte Teagarden, jetzt ebenfalls mit der Maske in Fechterstellung ihm gegenüber stehend. »Sie sind diese Klinge. Es gibt nur noch die Klinge. Sie existieren nicht mehr. Was sind Sie?«
»Ich – äh – bin die Klinge.«
»Kontrollierte Entspannung.«
Henderson entspannte sich und versuchte wachsam zu bleiben.
»Mensur.«
Die Säbel berührten sich. Ein blechern-kratzendes Geräusch.
»Spüren Sie sie?«
»Was?«
»Die sensation du fer.«
»O ja, ich spüre sie.«
»Okay. Flèche-Angriff, wann immer Sie wollen.«
Der Flèche-Angriff war eine Art verrückter, hopsender Vorstoß, bei dem der Angreifer oft an seinem Gegner vorbeistolperte. An irgendeinem Punkt während dieses Angriffs sollte man einen Hieb gegen die Backe oder Flanke des Gegners führen.
Henderson schwankte. Teagarden stand gelassen und regungslos da. Henderson glaubte, er würde jeden Moment nach vorn fallen, so entspannt fühlte er sich.