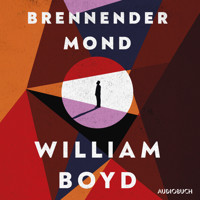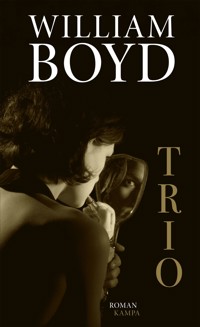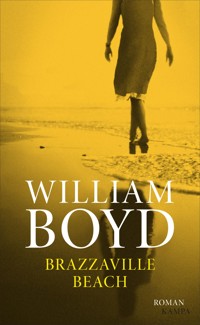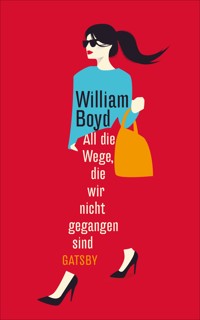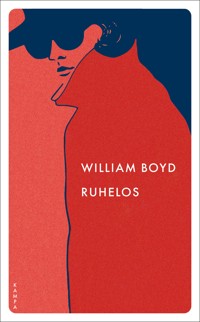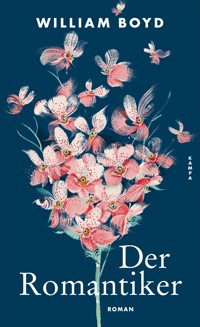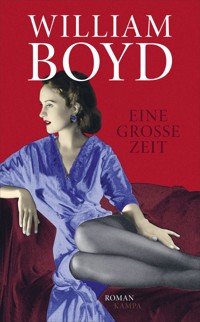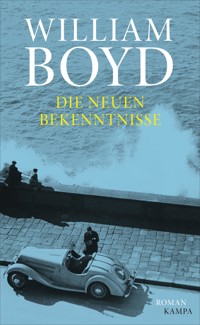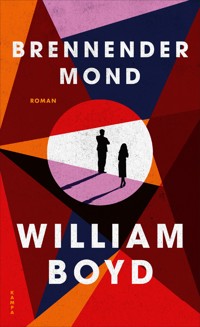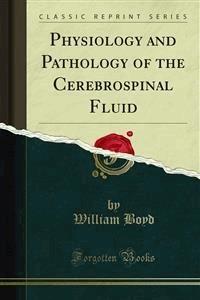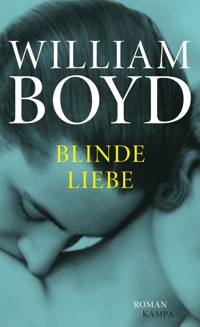
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brodie Moncur hat das absolute Gehör und gilt als Genie unter den Klavierstimmern. Als er in Paris dem grandiosen Pianisten John Kilbarron begegnet, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Rasch zeigt sich, dass Brodies Künste unverzichtbar für Kilbarron sind. Gemeinsam feiern sie Triumphe in ganz Europa, führen in St. Petersburg ein luxuriöses Leben, das Brodie, aufgewachsen in einem schottischen Dorf als Sohn eines tyrannischen Pfarrers, sich nie hätte erträumen lassen. Und doch ist das alles für Brodie unwichtig. Denn der wahre Grund, weshalb er in die Dienste des genialen, aber unberechenbaren Pianisten eingetreten ist, ist dessen Geliebte, die russische Sopranistin Lika.Brodie weiß, dass diese Liebe unmöglich ist, und setzt doch alles für sie aufs Spiel - auch sein eigenes Leben. Denn der Klavierstimmer, der mit wenigen Handgriffen über Erfolg oder Misserfolg eines Konzerts, ja einer Pianistenkarriere entscheiden kann, folgt seinem Herzen, das sich nicht umstimmen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
William Boyd
Blinde Liebe
Die Verzückung des Brodie Moncur
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer
Kampa
für Susan
In seinem letzten Lebensjahr dachte Anton [Tschechow] daran, ein weiteres Theaterstück zu schreiben. Es stand ihm noch nicht ganz klar vor Augen, aber er erzählte mir, dass der Held, ein Wissenschaftler, eine Frau liebt, die seine Gefühle entweder nicht erwidert oder die ihm untreu ist. Der Wissenschaftler reist in den hohen Norden. Den dritten Akt stellte er sich wie folgt vor: Ein Schiff steckt im Packeis fest; der Himmel ist überstrahlt vom Nordlicht. Der Wissenschaftler steht in der tiefen Stille und Erhabenheit der Polarnacht an Deck, eine einsame Gestalt, und vor dem Hintergrund der Nordlichter sieht er den Schatten der Frau, die er liebt.
Olga Knipper-Tschechowa, Die letzten Jahre
Sich zu verlieben ist das einzige unlogische Abenteuer, das einzige Phänomen in unserer banalen und vernünftigen Welt, das wir für übernatürlich zu halten versucht sind. Die Wirkung steht in keinem Verhältnis zur Ursache.
Robert Louis Stevenson, Virginibus Puerisque – Vom Sich Verlieben
Prolog
Port Blair
Andamanen
Kaiserreich Indien
11. März 1906
Liebe Amelia,
gestern Nacht gab es einen Gefängnisausbruch zu beklagen, und es kam zu einem kleineren Aufruhr. Äußerst ungewöhnlich. Drei der Sträflinge wurden getötet, einigen aber ist es gelungen, zu entkommen. Infolgedessen ist über die Stadt eine vierundzwanzigstündige Ausgangssperre verhängt worden, und so sitze ich nun hier in meinem Haus beim Mittagessen und schreibe diesen überfälligen Brief.
Alles ist bestens, meinem Bein geht es viel besser (Dr. Klein sagt, er sei sehr zufrieden, obwohl ich noch am Stock gehe – hochelegant), und der neue Stamm, den wir gefunden haben, wird langsam zutraulich. Colonel Ticknell, der britische Superintendent hier, ist überaus entgegenkommend. »Was immer Sie benötigen, Miss Arbogast, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Zögern Sie bitte nicht, auch bei geringfügigen Kleinigkeiten, usw. usf.« Und ich zögere nicht (Du kennst mich ja). Transport, Träger, Nutzung der Diplomatenpost – sogar eine Schusswaffe ist mir zur Verfügung gestellt worden. Colonel Ticknell hat, glaube ich, eine Schwäche für mich, und er denkt wohl, dass fleißige Fürsorge mein Herz gewinnt. Nun, denken schadet nichts, nehme ich an. Du wirst mich ein berechnendes Luder nennen, aber hier draußen kennt Not kein Gebot.
Und, kaum zu glauben, die Anzeige, die ich in die hiesige Zeitung gesetzt und die ich eigenhändig im Postamt an die Wand geheftet habe, ist beantwortet worden. Ich habe einen neuen Assistenten – endlich!
Ein Polizist klopft an die Tür. Die Ausgangssperre dürfte wohl aufgehoben worden sein. Ich schreibe Dir später noch einmal.
Bis dahin, Deine Dich immer liebende Schwester
Page
PS.: Mein neuer Assistent ist übrigens ein groß gewachsener junger Schotte, etwa Mitte dreißig, namens Brodie Moncur.
Teil IEdinburgh 1894
1
Brodie Moncur stand im Hauptfenster von Channon & Co. und blickte auf die dahineilenden Passanten, die Droschken, Kutschen und die sich abplagenden Brauereipferde draußen auf der George Street. Es regnete. Ein stetiger, sachter Regen, der hin und wieder von einer heftigen Windbö schräg gepeitscht wurde, und durch die Nässe wirkten die verrußten Fassaden der Gebäude gegenüber in dem trüben Licht fast schwarz. Wie Samt, dachte Brodie, oder Maulwurfsfell. Er nahm seine Brille ab und wischte die Gläser mit seinem Taschentuch sauber. Bei einem weiteren, brillenlosen Blick aus dem Fenster schien ihm das verregnete Edinburgh nun gänzlich von Wasser durchdrungen zu sein – die Gebäude gegenüber eine Klippe aus schwarzem Wildleder.
Er setzte die Brille wieder auf, hakte sich die Drahtbügel hinter die Ohren, und die Welt kehrte in den Normalzustand zurück. Er nahm seine Taschenuhr aus der Weste. Fast neun Uhr: Zeit anzufangen. Er klappte den glänzenden neuen Flügel auf dem Schaupodest auf und fixierte den geschwungenen Deckel, der an der Unterseite mit einem Spiegel versehen war (nur zu Schauzwecken – seine Idee), mit dem Stützhalter, um die komplizierte Maschinerie – die Mechanik – des Channon-Flügels besser zur Geltung zu bringen. Dann entfernte er den Tastendeckel und schraubte die Mechanikbacken auf. Er überzeugte sich, dass kein Hammer hochstand und zog dann die gesamte Mechanik auf der Vignolschiene unter der Vorderseite nach vorn. Da das Instrument neu war, ließ sie sich mühelos bewegen. Draußen war bereits ein Passant stehen geblieben und spähte ins Fenster. Das Herausziehen der Mechanik erregte immer Aufsehen. Einen aufgeklappten Flügel hatte jeder schon einmal gesehen, doch durch die Präsentation der Mechanik änderte sich aus irgendeinem Grund die Wahrnehmung. Das Instrument schien nicht länger vertraut. Jetzt waren alle beweglichen Teile jenseits der schwarzen und weißen Tasten zu sehen: die Hämmer, die Wippen, die Stoßzungen, die Hebeglieder, die Dämpfer; das Innenleben war preisgegeben wie bei einer Uhr mit geöffnetem Gehäuse oder einer Lokomotive in einer Reparaturwerkstatt. Geheimnisse – Musik, Takt, Bewegung – wurden auf komplizierte, ausgeklügelte Mechanismen reduziert. Die Menschen waren allenthalben fasziniert davon.
Er öffnete seine Werkzeugrolle aus Leder, nahm den Stimmschlüssel heraus und tat so, als würde er den Flügel stimmen: zog ein paar Saiten hier und da an, prüfte sie und stellte sie neu ein. Alles war tadellos. Dafür hatte er selbst gesorgt, als das Instrument zwei Wochen zuvor nagelneu aus der Fabrik gekommen war. Er stimmte das eingestrichene F eine Spur schärfer als normal und berichtigte es danach wieder, wobei er einige Male kräftig die Taste anschlug. Er hob einen Hammerkopf an und stach vorsichtig mit der dreispitzigen Intoniernadel in den Filz, ehe er den Hammer wieder an seinen Platz zurücksinken ließ. Dieses pantomimische Klavierstimmen sollte Kunden anlocken. Bei einer der seltenen Belegschaftsversammlungen hatte er angeregt, einen versierten Pianisten zu engagieren und im Laden Klavier spielen zu lassen, wie es in den Ausstellungsräumen in Deutschland üblich war; so wie es die Hersteller Pleyel und Érard in den 1830ern in Paris eingeführt und damit große Menschenmengen angelockt hatten. Schwerlich eine bahnbrechende Neuerung also, aber ein spontanes Konzert in einem Schaufenster wäre sicherlich attraktiver als die manierierten Tonwiederholungen auf einem Klavier, das gerade gestimmt wurde. Donk! Ding! Donk! Donk! Donk! Ding! Er hatte sich jedoch nicht durchsetzen können – ein versierter Pianist würde Geld kosten –, und stattdessen wurde ihm die Aufgabe des Schau-Stimmens übertragen: morgens eine Stunde und eine weitere nach dem Mittagessen. Tatsächlich lockte er damit Zuschauer an, wobei er allerdings der einzige direkte Nutznießer war. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass das Unternehmen infolge seiner Vorführungen auch nur ein Klavier mehr verkaufte, doch waren schon viele Privatleute und auch Vertreter einiger Institutionen (Schulen, Gemeindesäle, Kneipen) in den Laden gekommen und hatten ihm ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt, damit er außerhalb der Arbeitszeit ihr Klavier stimmte. Dadurch hatte er sich mehr als ein paar Pfund hinzuverdient.
Er schlug also einige Male das eingestrichene A an und lauschte dabei mit schräg gelegtem Kopf, wie um den Ton richtig zu erfassen. Dann spielte er ein paar Oktaven. Er stand auf, schob einige Filzstreifen zwischen die Saiten, zückte seinen Stimmschlüssel, setzte ihn wahllos an einen Stimmwirbel an und drehte ihn ein winziges bisschen, um etwas Spannung zu erzeugen, dann lockerte er den Wirbel wieder leicht und schlug den Ton energisch an, um die Saite, deren Schwingungen er durch den Schlüssel hindurch in der Hand spüren konnte, endgültig zu stimmen. Danach setzte er sich wieder, spielte einige Akkorde und lauschte dem ganz eigenen Ton des Channon. Voluminös und mit starkem Nachklang: Der präzis gearbeitete dünne Resonanzboden aus schottischer Fichte unter den Saiten war das besondere Markenzeichen der Firma Channon, ihr Betriebsgeheimnis. Gegen ein Orchester konnte sich ein Channon mindestens so souverän durchsetzen wie ein Steinway oder ein Bösendorfer. Wo genau sich die Fichtenwälder in Schottland befanden, aus denen Channon sein Holz bezog, welche Bäume ausgewählt wurden – je gerader der Wuchs, desto gerader die Maserung – und welche Sägewerke das Holz vorbereiteten, diese Einzelheiten waren nur einer Handvoll Eingeweihter in der Firma bekannt. Channon nahm für sich in Anspruch, dass der ganz eigene, unverwechselbare Klang ihrer Klaviere auf die Qualität des schottischen Holzes zurückging, das sie verwendeten.
Nach dem Ende seiner Scheinvorführung nahm Brodie am Flügel Platz und fing an, den »Skye Boat Song« zu spielen; dabei sah er, dass sich dem einzelnen Zuschauer inzwischen drei weitere hinzugesellt hatten. Er wusste, würde er eine halbe Stunde weiterspielen, würden ihm schließlich zwanzig Leute zusehen. Es war eine gute Idee, die sie auf dem Kontinent gehabt hatten. Von diesen zwanzig würden sich zwei vielleicht erkundigen, was ein Stutzflügel oder ein Klavier kostete. Er unterbrach sein Spiel, nahm sein Plektrum heraus und schlug damit einige Saiten im Flügel an, wobei er aufmerksam lauschte. Wie das wohl auf Außenstehende wirken mochte? Ein Mann, der mit einem Plektrum auf einem Flügel spielte wie auf einer Gitarre. Alles sehr geheimnisvoll –
»Brodie!«
Er sah sich um. Emmeline Grant, Mr Channons Sekretärin, stand seitlich neben der Fensterrahmung und gab ihm mit der Hand Zeichen. Sie war eine kleine, korpulente Frau, die zu verbergen versuchte, wie gern sie ihn hatte.
»Ich bin gerade beschäftigt, Mrs Grant.«
»Mr Channon möchte Sie sehen. Unverzüglich. Kommen Sie mit, jetzt gleich.«
»Ich komme ja schon, ich komme ja schon.«
Er stand auf, überlegte kurz, ob er den Flügel zuklappen sollte, entschied sich jedoch dagegen. In zehn Minuten wäre er wieder zurück. Nach einer Verbeugung vor seinem kleinen Publikum folgte er Mrs Grant durch den Ausstellungsraum mit seinen glänzenden Pianos und in die Haupthalle des Channon-Stammhauses. Auf olivgrün-dunkelgrau gestreifter Tapete hingen strenge, ernst blickende Porträts früherer Generationen von Channons. Ein weiterer Fehler, dachte Brodie: die Halle erinnerte an eine Kunstgalerie in der Provinz oder an ein Bestattungsinstitut.
»Geben Sie mir zwei Minuten, Mrs G. Ich muss mir rasch die Hände waschen.«
»Beeilen Sie sich bitte. Ich warte oben auf Sie. Es ist wichtig.«
Brodie begab sich nach hinten und ging durch eine lederverkleidete, mit Messingknöpfen besetzte Tür in den Lagerbereich, wo sich auch die Werkstatt befand. Ein Mittelding aus Zimmerei und Büro, dachte er jedes Mal, wenn er den Raum betrat, in dem es nach Holzspänen, Leim und Harz roch. Er stieß die Tür auf und traf seine Nummer zwei, Lachlan Hood, bei der Arbeit an; er war dabei, die Saitenstifte in einem Stutzflügel auszuwechseln – ein zeitaufwendiges Unternehmen, denn von diesen Stiften gab es Hunderte.
Lachlan blickte auf, als er eintrat.
»Was ist los, Brodie? Solltest du nicht im Fenster sitzen?«
»Mein Typ wird verlangt. Mr Channon.«
Er öffnete seinen Rollschreibtisch und zog die Schublade auf, in der er seine Tabakbüchse aufbewahrte. »Margarita« hieß die Marke: eine Mischung aus Virginia-, Perique- und türkischem Tabak, hergestellt von einem New Yorker Tabakladen namens Blakely und in Edinburgh nur bei einem Händler erhältlich: Hoskings, am Grassmarket. Er nahm eine der drei Zigaretten heraus, die er bereits vorgedreht hatte, steckte sie an und gönnte sich einen tiefen Zug.
»Was will er denn von dir?«, fragte Lachlan.
»Keine Ahnung. Es sei ›wichtig‹, sagt die liebe Emmeline.«
»Tja, war nett, dich kennenzulernen. Ich nehm mal an, dass ich jetzt deinen Job bekomme.«
Lachlan war aus Dundee und hatte einen starken Akzent. Brodie machte das Zeichen zur Abwehr des bösen Blicks in seine Richtung, drückte nach zwei weiteren Zügen seine Zigarette aus und machte sich auf den Weg zu Ainsley Channons Büro.
Ainsley Channon war der sechste Channon an der Spitze der Firma seit ihrer Gründung Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Auf dem Treppenabsatz stand ein Fünf-Oktaven-Cembalo von 1783 – das erste Channon-Instrument, das ein wirklicher Erfolg war und den Aufstieg der Firma begründete. Heute war das Haus der viertgrößte, manche sagten sogar der drittgrößte Klavierhersteller in Großbritannien, nach Broadwood, Pate und, möglicherweise, Franklin. Und als wollte er die lange Familientradition unterstreichen, kleidete sich Ainsley Channon in einem Stil, der seit einem halben Jahrhundert überholt war. Er trug einen üppigen Backenbart und einen steifen Kläppchenkragen, dazu eine Seidenkrawatte mitsamt Krawattennadel. Sein schütteres graues Haar, das er hinter die Ohren gestrichen trug, war annähernd schulterlang. Er sah aus wie ein alter Musiker, wie ein stämmiger Paganini. Brodie wusste, dass er keinen einzigen Ton spielen konnte.
Er pochte leise an die Tür, ehe er eintrat.
»Nur herein, Brodie. Brodie, mein Junge. Setz dich doch, setz dich doch.«
Der Raum war groß und düster – trotz der morgendlichen Stunde brannten die Gaslampen – und hatte drei hohe Sprossenfenster mit je zwölf Scheiben, die auf die George Street hinausgingen. Durch den unverändert diesig niedergehenden Regen konnte Brodie verschwommen den hohen, dünnen Turm der St Andrew’s and St George’s West Church erkennen.
Ainsley kam hinter seinem Schreibtisch hervor und zog einen Sessel für Brodie heran. Er klopfte einladend auf die lederbezogene Sitzfläche.
Brodie setzte sich. Ainsley blickte ihn lächelnd an, musterte ihn, als hätte er ihn seit Jahren nicht gesehen.
»Erst einmal ein Gläschen.«
Es war weniger eine Frage, mehr eine Feststellung, und Brodie erhob keine Widerrede. Ainsley ging an einen Tisch mit einer stattlichen Sammlung lichtfunkelnder Karaffen, wählte eine aus und goss zwei Gläser voll. Er brachte Brodie sein Getränk, ehe er sich wieder auf seinem Schreibtischsessel niederließ.
»Zum Wohl«, sagte Ainsley und hob sein Glas.
»Slange var«, erwiderte Brodie auf Schottisch und nippte an seinem bernsteinfarbenen Whisky. Malz, torfig, Westküste.
Ainsley nahm eine Mappe aus dunkelbraunem Karton vom Tisch und schwenkte sie in seine Richtung.
»Die Akte Brodie Moncur«, sagte er.
Unvermittelt geriet Brodies Herz ins Stolpern. Er beruhigte es mit einem weiteren Schluck Whisky.
Ainsley Channon hatte immer eine etwas versponnene, entrückte Art an sich. Von daher wunderte sich Brodie nicht über den verschlungenen Weg, den die Besprechung nahm.
»Wie lange bist du nun bei uns, Brodie? Seit ungefähr drei Jahren jetzt, ja?«
»Tatsächlich seit sechs, Sir.«
»Großer Gott, großer Gott, großer Gott.« Er hielt kurz inne, während er lächelnd darüber nachsann. »Wie geht es deinem Vater?«
»Gut, Sir.«
»Und deinen Geschwistern?«
»Alle gesund und wohlauf.«
»Hast du Lady Dalcastle in letzter Zeit mal gesehen?«
»Nein. Schon länger nicht.«
»Wunderbare Frau. Wunderbare Frau. Sehr tapfer.«
»Ihr geht es, glaube ich, auch sehr gut.«
Ainsley Channon war ein Cousin von Lady Dalcastle, die wiederum eng mit Brodies verstorbener Mutter befreundet gewesen war. Lady Dalcastles Vermittlung hatte Brodie es zu verdanken, dass er seinerzeit bei Channon eine Lehre als Klavierstimmer beginnen konnte.
Ainsley warf erneut einen Blick in seine Akte.
»Ja. Du bist ein gescheiter Junge, keine Frage. Sehr gute Noten.« Er sah auf. »Kannst du parlee-wuh?«
»Entschuldigung?«
»Französisch sprechen? Oh, là là. Bonjour, monsieur.«
»Nun, ich habe Französisch in der Schule gelernt.«
»Lass mal was hören.«
Brodie dachte kurz nach.
»Je peux parler français«, sagte er. »Mais je fais des erreurs. Quand même, les gens me comprennent bien.«
Ainsley sah ihn erstaunt an.
»Das ist ja unglaublich! Dieser Akzent! Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass du Franzose bist.«
»Danke, Sir. Merci mille fois.«
»Großer Gott. Wie alt bist du jetzt, Brodie? Dreißig? Zweiunddreißig?«
»Ich bin vierundzwanzig, Sir.«
»Du lieber Heiland! Wie lang bist du nun bei uns? Drei Jahre, jetzt?«
»Sechs«, wiederholte Brodie. »Ich bin beim alten Mr Lanhire in die Lehre gegangen, damals, ’88.«
»Ach ja, ganz recht. Findlay Lanhire. Gott hab ihn selig. Der beste Klavierstimmer aller Zeiten. Aller Zeiten. Der Allerbeste. Aller Zeiten. Er hat den Phoenix entworfen, weißt du.«
Der Phoenix war das Klaviermodell, das sich bei Channon am besten verkaufte. Im Lauf seiner sechs Jahre hatte Brodie Hunderte davon gestimmt.
»Was ich weiß und kann, habe ich alles von Mr Lanhire gelernt.«
Ainsley beugte sich vor und musterte ihn.
»Erst vierundzwanzig? Du hast einen alten Kopf auf den Schultern, Brodie.«
»Ich habe hier direkt nach der Schule angefangen.«
Ainsley senkte wieder den Blick auf die Akte.
»Welche Schule war das?«
»Mrs Maskelynes Musikakademie.«
»Wo ist die? In London?«
»Hier in Edinburgh, Sir.«
Ainsley war im Kopf immer noch mit Rechnen beschäftigt.
»’88, sagst du?«
»September 1888. Da habe ich hier bei Channon angefangen.«
»Nun, jetzt haben wir eine Channon-Herausforderung für dich …« Er hielt inne. »Schenk uns nach, Brodie.«
Brodie holte die Karaffe, schenkte ihnen beiden nach und setzte sich dann wieder. Ainsley Channon hatte die Fingerspitzen vor sich aneinandergelegt und schaute sein Gegenüber unverwandt an. Wieder stieg in Brodie ein leises Unbehagen auf. Er nippte an seinem Whisky.
»Du weißt, dass wir diesen Channon-Ausstellungsraum in Paris eröffnet haben, letztes Jahr …«, sagte Ainsley.
Brodie bejahte es.
»Nun, er läuft nicht besonders gut«, vertraute Ainsley ihm an, mit gesenkter Stimme, als fürchtete er, dass jemand sie belauschen könnte. »Unter uns gesagt, läuft er sogar miserabel.« Er erläuterte die Lage näher. Calder Channon, Ainsleys Sohn, war zum Filialleiter in Paris ernannt worden, und obwohl alles gut aufgestellt schien – gute Kontakte, ein gut bestücktes Sortiment, regelmäßige Werbeanzeigen in der Pariser Presse –, verloren sie Geld, nicht in beunruhigendem Umfang, aber langsam und stetig so viel, dass man es nicht länger ignorieren konnte.
»Wir brauchen etwas frischen Schwung dort«, stellte Ainsley fest. »Wir brauchen jemanden, der etwas vom Klaviergeschäft versteht. Wir brauchen jemanden mit pfiffigen Ideen …« Er legte eine dramatische Pause ein. »Und wir brauchen jemanden, der Französisch spricht. Calder scheint dazu nicht in der Lage zu sein.«
Brodie verkniff sich das Eingeständnis, dass seine Französischkenntnisse eher rudimentär waren, und ließ Ainsley weiterreden.
»Der Plan lautet wie folgt, Brodie, mein Junge.«
Brodie sollte so bald wie möglich nach Paris reisen – am besten schon in einer Woche, sobald er seine Angelegenheiten geregelt hatte – und dort als Calder Channons Nummer zwei anfangen. Als stellvertretender Filialleiter in Paris. Dabei sollte er nur ein Ziel vor Augen haben, erklärte Ainsley: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und nochmals verkaufen.
»Weißt du, wie viele größere Klavierhersteller es in Europa gibt? Na los, rate mal.«
»Zwanzig?«
»Zweihundertfünfundfünfzig, bei der letzten Zählung! Das ist die Konkurrenz, mit der wir es aufzunehmen haben. Unsere Klaviere sind wundervoll, aber in Paris kauft sie niemand, oder zu wenige Leute. Stattdessen kaufen sie Schund wie Montcalms, Angelems, Maugeners, Pontenegros. Inzwischen fangen sie sogar an, Klaviere in Japan zu fertigen! Ist das zu fassen? Es ist ein heftig umkämpfter Markt. Hervorragende Qualität reicht da nicht aus. Es muss sich etliches ändern, Brodie. Und etwas sagt mir, dass du für die Aufgabe der Richtige bist. Du kennst Klaviere in- und auswendig und bist ein Weltklasse-Klavierstimmer. Und du sprichst fließend Französisch. Großer Gott im Himmel! Calder braucht jemanden wie dich. Warum habe ich dummer alter Narr das nicht eher begriffen?« Er lehnte sich zurück, trank einen großen Schluck Whisky und dachte nach. »Calder war zu selbstsicher, zu überzeugt von seinem Erfolg, das wird mir nun klar. Er braucht jemanden an seiner Seite, der ihm hilft, das Schiff zu steuern. Wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ich verstehe, Sir. Aber, wenn die Sprache ein Problem ist, warum stellen Sie nicht einfach einen Franzosen ein?«
»Um Himmels willen, nein! Hast du den Verstand verloren? Wir brauchen einen der unsrigen dort. Jemanden, dem man voll und ganz vertrauen kann. Der zur Familie gehört, gewissermaßen.«
»Verstehe.«
»Bekommst du das hin, Junge?«
»Versuchen kann ich’s auf jeden Fall, Sir.«
»Wirst du dein Bestes geben? Dich richtig ins Zeug legen?«
»Selbstverständlich.«
Ainsley schien mit einem Mal bester Dinge. Er sicherte Brodie eine ansehnliche Gehaltserhöhung zu, und außerdem würden seine Stellung sowie sein Gehalt in sechs Monaten noch einmal überprüft, gemessen am Erfolg.
Ainsley kam hinter seinem Tisch hervor und goss ihnen noch zwei Whisky ein, um ordentlich auf das neue Pariser Unternehmen anzustoßen. Sie prosteten sich zu und tranken.
»Vor deiner Abreise treffen wir uns noch mal, Brodie. Ich habe ein paar kleine Tipps, die dir ganz nützlich sein könnten.« Er nahm Brodie das Glas aus der Hand und stellte es auf dem Tisch ab. Die Besprechung war beendet. Ainsley begleitete Brodie noch hinaus. Kurz vor der Tür nahm er ihn fest am Ellbogen.
»Calder ist ein guter Junge, aber ein loyaler Stellvertreter könnte ihm nicht schaden.«
»Ich werde mein Bestes tun, Mr Channon. Sie können sich auf mich verlassen.«
»Das werde ich. Es ist eine große Chance für uns. Paris ist heutzutage die Welthauptstadt der Musik. Nicht London, nicht Rom, und auch nicht Berlin. Abgesehen von Wien natürlich. Aber wir könnten die Nummer eins in Europa werden – sie alle hinter uns lassen: Steinway, Broadwood, Érard, Bösendorfer, Schiedmayer. Du wirst sehen.«
Zurück in der Werkstatt, rauchte Brodie noch eine Zigarette und dachte angestrengt nach. Er sollte sich freuen, das wusste er, unbändig freuen, aber irgendetwas hielt ihn davon ab, etwas Unbestimmtes, ärgerlich Unklares. War es Paris, der Umstand, dass er noch nie dort gewesen war, dass es sich um seine erste Auslandsreise überhaupt handelte? Nein, das fand er eher aufregend: in Paris zu leben und zu arbeiten, das wäre –
Lachlan Hood kam vom Laden in die Werkstatt.
»Noch hier?«
»Nicht mehr lange«, sagte Brodie.
»Wusste ich’s doch. Tja, Brodie, Pech gehabt. So kann’s gehen, alter Junge.«
»Nein. Ich soll nach Paris gehen. Calder mit dem Laden dort helfen.«
Lachlan schien aufrichtig bestürzt, er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen.
»Wieso du? Verdammt! Warum nicht ich? Ich war immerhin schon in Amerika.«
»Mais est-ce que vous parlez français, monsieur?«
»Was?«
»Genau.« Brodie breitete in gespieltem Bedauern die Hände aus. »Die Vorzüge einer guten Schulbildung, mein Sohn. Ich spreche zufällig vorzüglich Französisch.«
»Lügner. Verfluchter Lügner. Du sprichst höchstens Opern-Französisch.«
»Na schön, ich geb’s zu. Entscheidend ist, ich spreche genug Französisch. Was ungefähr hundert Prozent mehr Französisch ist als du.« Er bot Lachlan eine Zigarette an und lächelte gönnerhaft.
»Wenn alles gut läuft, lasse ich dich vielleicht nachkommen.«
»Dreckskerl.«
2
Brodie hielt eine Droschke an, die bei Channon & Co. vor- beizuckelte, und nannte dem Kutscher die Charles Street, unweit der Universität, als Ziel, wo sich das Bonar-Konzerthaus befand. Er stieg ein und zog die Vorhänge ein wenig zu, um in der Dunkelheit das beruhigende Klappern der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster und das Quietschen der Kutschfedern zu genießen, während ihn das Gefährt in den Osten der Stadt beförderte. Vor ihm hatte offenbar eine Frau in der Droschke gesessen, wie er aus dem Duft von Parfum schloss – Rosenwasser oder Flieder –, der den Geruch nach altem Leder und Pferdemist überdeckte. Nun, da er allein war, dachte er eingehender über Ainsley Channons Angebot nach, das er, wie ihm nun bewusst wurde, ohne lange nachzudenken angenommen hatte. Hätte er sich lieber etwas Bedenkzeit ausbitten sollen? Doch was gab es hier noch lange nachzudenken? Paris gegen Edinburgh einzutauschen; vom leitenden Klavierstimmer zum stellvertretenden Filialleiter aufzusteigen; statt vier Guineen die Woche acht zu verdienen, das war wirklich keine schwierige Entscheidung.
Er bezahlte den Kutscher und nahm den Weg zum Bühneneingang. Die Hausleitung hatte für diesen Abend einen alten Konzertflügel von Channon angefordert, verbunden mit der Auflage, dass dieser den Wünschen des Maestros gemäß eingestellt würde, wie auch immer diese lauten mochten. Der Direktor des Konzerthauses, ein ernster, kahlköpfiger Mensch, von dem ein eigentümlich muffiger Geruch ausging, führte Brodie durch dunkle Gänge hinter der Bühne in den eigentlichen Konzertsaal.
»Wer ist der Künstler?«, erkundigte sich Brodie, dem der Name entfallen war.
»Georg Brabec.«
»Noch nie von ihm gehört.«
»Tja. In Prag und Budapest ist er in aller Munde. Das erzählt er mir jedenfalls pausenlos. Auch in Leipzig ist er eine ganz große Nummer, und so weiter.«
»Der Herrgott steh uns bei.«
Brodie schwante nichts Gutes. Es waren die zweit-, dritt- und viertklassigen Konzertpianisten, die einem Klavierstimmer die meisten Scherereien bereiteten; je dürftiger ihr Rang, desto größer die Probleme. Er hatte einmal für den großen Gianfranco Firmin ein Klavier gestimmt, als dieser in den Assembly Rooms auftrat, Firmin, einer der berühmtesten Klaviervirtuosen Europas, der dabei ein bescheidener, reizender Mensch war und sich selbst nicht zu wichtig nahm. Jeder Bitte ging ein höfliches »Wenn es nicht zu viel Umstände macht«, »Wäre es vielleicht möglich« voraus – ohne jede Arroganz, ohne jegliche Allüren eines Genies.
Brodie stieg die kleine Treppe zur Bühne hoch und bahnte sich einen Weg durch die Stühle und Notenständer, die bereits für das Orchester aufgebaut waren, zu dem Channon, der vor dem noch leeren Auditorium stand. Daneben Georg Brabec, mit schulterlangem Haar und, wie Brodie feststellte, einer dramatischen grauen Strähne. Dazu ein schütterer Schnauzbart. Offenbar ein Vertreter der Liszt-Schule, das verhieß nichts Gutes. Brabec rauchte einen Zigarillo.
Brodie reichte ihm die Hand und stellte sich vor. Brabec fiel ihm ins Wort, noch ehe er bei seinem Nachnamen angelangt war.
»Der Flügel ist nicht gestimmt«, sagte er mit einem undeutlichen, ausgeprägt mitteleuropäischen Akzent. Brodie konnte ihn nicht einordnen.
»Und mit zu viel Hall in hohen Tönen.«
»Ich habe ihn heute Morgen gestimmt, ehe wir ihn hertransportiert haben, Sir«, sagte Brodie höflich und geduldig.
Er setzte sich und spielte ein paar Akkorde: C-Dur, fis-Moll, Es vermindert. Er hatte in Oktaven gespielt. Der Flügel war perfekt gestimmt.
»Und ich wollte alten Flügel.«
»Es ist ein alter Flügel, Sir. Vierzig Jahre alt.«
Brabec hieb mit einer Hand energisch auf einige Tasten.
»Hören Sie: hier ist dünn. Der Hammer trifft …« Er suchte nach dem passenden Ausdruck. »Der Hammer trifft nicht recht. Nicht richtig.«
Brodie seufzte innerlich. Setzte aber nach außen hin ein Lächeln auf.
»Ich sehe es mir mal an, Sir.«
Er öffnete seinen kleinen Gladstone-Koffer und nahm seine Werkzeugrolle aus Leinwand heraus.
Brabec fuchtelte mit dem Zigarillo aggressiv vor Brodies Brust herum und aschte dabei um ein Haar auf seine Jackenaufschläge.
»Und die Tasten sind sauber. Ich habe nicht um sauberen Flügel gebeten.«
»Ich kümmere mich darum, Sir.«
Brodie entfernte den Tastendeckel und zog die Mechanik heraus. Die meisten Konzertpianisten – 99 Prozent von ihnen, soviel er wusste – hatten absolut keine Ahnung, was sich technisch zwischen ihrem Tastenanschlag und dem dabei erzeugten Ton abspielte. Umso mehr Eindruck machte es, wenn man die verborgene Kompliziertheit der beweglichen Teile zum Vorschein brachte. Brabec starrte die Mechanik einen Moment lang blinzelnd an.
»Überlassen Sie das ruhig mir, Sir«, sagte Brodie. »Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald alles in Ordnung ist.«
Der Direktor erschien erneut und geleitete Brabec zur Künstlergarderobe.
Als sie fort waren, schob Brodie die Mechanik ins Gehäuse zurück und packte sein Werkzeug wieder ein. In seinem Gladstone-Koffer hatte er eine kleine Flasche mit einer dünnen Lösung aus Honig und Wasser dabei. Mit einem feinen Dachshaarpinsel bestrich er die Tasten mit dieser Lösung, ehe er sie mit einem Lappen abwischte und sich danach überzeugte, dass keine sichtbaren Spuren zurückgeblieben waren. Über die Jahre angesammeltes Fingerfett, darauf waren manche Pianisten aus, wenn sie ein altes Klavier verlangten, einen Anflug von Klebrigkeit, damit die Fingerkuppen einen gewissen Halt fanden. Es war alles in Ordnung: Der Channon war perfekt gestimmt und eingestellt.
Georg Brabec hätte nun noch mehr Grund, mit sich zufrieden zu sein.
Brodie machte sich auf die Suche nach dem Direktor und fand ihn in seinem Büro, mit einem Gläschen verdünntem Portwein vor sich auf dem Tisch.
»Kein besonders umgänglicher Zeitgenosse, unser Signor Brabec«, sagte Brodie.
»Ja. Ein Schwachkopf«, bestätigte der Direktor mit tonloser Stimme. »Und jetzt hat er auch noch den Wunsch geäußert, dass Sie dem Konzert beiwohnen. Für den Fall, dass das Instrument in der Pause nachgestimmt werden muss.«
»Sagen Sie ihm, ich wäre hier«, sagte Brodie. »Im Falle eines Falles werden Sie mich dann aber wahrscheinlich nicht finden können.«
»Völlig richtig.« Der Direktor lächelte jetzt sogar und hielt sein Glas in die Höhe. »Mögen Sie auch einen Schluck?«
Mit einem Glas leicht säuerlichen Rotweins in der Hand folgte Brodie Senga die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer. Sie sah immer wieder über die Schulter, als könnte sie es nicht ganz fassen, dass er sie tatsächlich aufgesucht hatte. Brodie hatte das Konzerthaus verlassen, sobald Brabec auf die Bühne gekommen war und sich verbeugt hatte, und war dann auf direktem Wege zu Mrs Loutherns »Haus« gegangen, das in einer Seitenstraße der Royal Mile lag, unten in Richtung Holyrood Palace. Er hatte zehn Minuten warten müssen, bis Senga frei war, und in dieser Zeit mit zwei der anderen Mädchen in dem kleinen Salon gesessen. Die Mädchen hatten schweigend Bézique gespielt und ihn nicht weiter beachtet, obwohl er der einzige Mann war, der im Haus wartete.
Mrs Loutherns Etablissement hatte einen Hinterausgang, der in eine Wohnstraße hinter dem Gebäude führte, was Brodie ganz besonders schätzte. Man verließ das Haus nicht auf demselben Wege, auf dem man es betreten hatte – also durch den Salon –, sodass Brodie nicht erfahren würde, wer Sengas letzter Freier gewesen war. Er machte sich nichts vor. Sie ging hier einem Gewerbe nach, und je mehr sie zu tun hatte, desto besser für sie. Dennoch war es ihm mehr als recht, nicht einem grinsenden, rotgesichtigen Bauern begegnen zu müssen, der zur Landwirtschaftsmesse in der Stadt war und geradewegs aus ihrem Bett kam. Brodie konnte gut und gern darauf verzichten, demonstrativ an seine eigene Stelle in der Warteschlange erinnert zu werden.
Mrs Louthern schenkte ihm von dem minderwertigen Rotwein nach und meinte, dass Ida oder Joyce ihm gern zu Diensten wären, sofern er es eilig hätte. Nein danke, sagte Brodie, er würde lieber auf Senga warten. Und Senga tauchte dann auch zuverlässig auf.
In ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss gab Senga ihm einen Kuss auf die Wange. Er habe ihr gefehlt, sagte sie. Was durchaus zutreffen konnte, da er seit über zwei Monaten nicht hier gewesen war. Brodie stellte sein Glas ab und fing an, sich zu entkleiden. Senga knüpfte ihren Rock auf und legte ihre Rüschenbluse ab; in ihrem Hemd aus Baumwolle und in Stiefeletten stand sie da und sah dabei zu, wie er sich bis auf die Unterwäsche auszog.
»Ich hätte gern, dass du das Hemdchen auch ablegst, Senga«, sagte er.
»Das macht zwei Shilling mehr«, erwiderte sie. »Selbst für dich.«
Das kümmerte ihn nicht, er wollte, dass sie beide nackt waren. Senga stammte aus South Uist, ein junges Ding, das nach Edinburgh gekommen war, um als Dienstmädchen in einem großen Haus in der New Town zu arbeiten. Sie war schwanger geworden, hatte umgehend ihre Stellung verloren und war schließlich hier in Mrs Loutherns Etablissement gelandet, wo sie einem anderen, durchaus einträglicheren Broterwerb nachging. Sie war jünger als er, um die zwanzig, vermutete Brodie, und das Kind wurde wahrscheinlich anderweitig versorgt. Gefragt hatte er nicht danach: Was sie von sich preisgab, blieb Senga selbst überlassen.
Sie war blond, schlank und vollbusig, was erklärte, warum sie so gefragt war, wobei er jedoch einige Freier hatte sagen hören, dass sie die »Schielende« nicht haben wollten. Ihr rechtes Auge wies eine Fehlstellung auf, und das fanden manche offenbar abstoßend. Brodie, der selbst unter einer erheblichen Sehschwäche litt, störte es nicht. Sie pflegte weiter die guten Umgangsformen, die sie in dem Haus in der New Town gelernt hatte, obwohl ihre Begegnungen rein sexueller Natur waren, und war immer höflich, zudem schien sie ihn ehrlich gernzuhaben. Wichtiger noch, sie erregte ihn. Vielleicht gerade wegen ihres Schielauges, wie er mitunter überlegte.
Als sie beide nackt waren, zog Senga ihn zu dem schmalen Bett aus Gusseisen. Sie nahmen nebeneinander Platz, und sie machte sich mit beiden Händen sanft an seinem Glied zu schaffen, bis es hart wurde.
»Warum warst du so lange nicht hier, Brodie.«
»Ich hatte viel zu tun«, sagte er, während er ihre schaukelnden Brüste im Auge behielt.
»Was zu tun?«
»Schreiben.« Er hatte ihr erzählt, er sei Komponist.
»Hast du ein Lied für mich geschrieben?«
»Kann schon sein.«
Als sie sah, dass er bereit war, legte sie sich hin und spreizte die Beine. Brodie ließ sich auf sie gleiten, wobei er sich auf den Armen abstützte.
»Darf ich dich küssen?«, fragte er.
»Ich küsse nicht gern«, sagte sie. »Das weißt du doch.«
»Ich geb dir einen Shilling mehr.«
»Ich verzichte auf den Shilling. Ich küsse nicht gern.«
»Na schön. Wie du meinst.«
Er ließ sich auf den Armen nach unten sinken, und sie griff nach unten und führte ihn ein – so mühelos, dachte er. Wie oft sie das wohl schon gemacht hat?
»Nimm die Brille ab, Brodie.« Sie hatte einen weichen Highland-Akzent.
»Nein.«
»Na komm.«
»Ich will dich ansehen, Senga. Du bist ein hübsches Mädchen. Ich sehe das hübsche Mädchen, das ich gerade vögle, gern an.«
Sie zog ihre Knie zurück. Sie kannte die Abläufe und das Geschäker bereits.
»Das sagst du bei allen Mädchen. Ein hübscher Dreckskerl wie du mit deinem Riesengerät, wie ein Hockeyschläger. Du willst uns Mädchen sehen, während du dich vergnügst, ist es nicht so, edler Herr? Du siehst uns gerne erschaudern, nicht wahr?«
»Genau so ist es.«
Brodie bestellte ihnen von unten eine Flasche Rotwein. Unerhörte fünf Shilling, völlig überteuert, aber er mochte noch nicht gehen. Solange man Geld ausgab, stand einem Mrs Loutherns Haus offen. Es war schon vorgekommen, dass er die Nacht dort verbracht hatte und am nächsten Tag in den strahlenden Edinburgher Morgen hinausgetreten war, empfangen von gnadenlos heller Sonne und frischem Wind, und direkt zur Arbeit gegangen war, nach Alkohol, Tabak und Unzucht stinkend – so kam es ihm wenigstens vor –, unrasiert und mit fettigem Haar, worauf er sich mittags eilig zum Friseur begab, um sich rasieren und etwas Pomade ins Haar kämmen zu lassen, ehe Mrs Grant sich bei Mr Channon über die liederlichen Sitten seiner Angestellten beklagen konnte.
Er goss Senga ein Glas ein, und sie trank den Wein in gierigen Schlucken. Nach ihrer Betätigung hatten sie sich beide wieder angekleidet. Sie hieß eigentlich Agnes McCloud, aber sie mochte den Namen Agnes nicht und hatte ihn daher einfach umgedreht.
»Ich gehe fort, Senga.«
»Nein! Wo könnte es besser sein als in Edinburgh?«
»Paris.«
»Ah. Ach so.« Sie sah kurz geknickt drein. Damit konnte sie nicht konkurrieren.
»Was hast du in Paris vor?«
»Eine Sinfonie oder zwei komponieren, nehme ich an.«
»Und es gibt dort viele dieser französischen Mädchen, mit denen du herumtändeln kannst.«
»Ich werde immer an dich denken, Senga.« Er schenkte ihnen beiden Wein nach.
»Nein, wirst du nicht. Du wirst mich im Nu vergessen.«
»Nein, werde ich nicht. Versprochen. Du bist sehr besonders.« Er berührte sie an der Wange unter dem rechten Auge. »Deswegen möchte ich dir etwas sagen.«
»Was denn bitte?«
»Weißt du, dein Schielauge? Dein rechtes Auge. Das kannst du in Ordnung bringen lassen.«
Dieses Thema war noch nie zur Sprache gekommen, und Senga wirkte mit einem Mal verwirrt, verletzlich. Unvermittelt stand die eigentümliche, unausgesprochene Regel ihres Handels mit ihm – Geld gegen erwiesene Dienste – deutlich im Raum. Sie war auf gewisse Art zum Objekt degradiert worden, und Brodie schämte sich insgeheim, die Angelegenheit angesprochen zu haben, und sei es nur, um ihr zu helfen.
»Was ist mit meinem Auge?«
»Es hat eine leichte Fehlstellung, so nennt man das. Aber heutzutage kann das behoben werden.«
Er nahm eine seiner Visitenkarten heraus und notierte auf der Rückseite den Namen und die Adresse seines Optikers.
»Ich übernehme die Kosten. Geh einfach bei diesem Mann vorbei, zeig ihm diese Karte, und er wird sich der Sache annehmen.«
»Muss ich dann so eine grauslige Brille wie du tragen? Solche grässlichen Flaschenbodengläser.«
»Eine Zeit lang, und vielleicht auch eine Augenklappe, bis dein Auge stärker wird … Aber das Leben wird danach besser sein, Senga, glaube mir.«
»Das Leben wird sein, wie das Leben eben sein wird, Brodie. Da können wir nicht viel dran ändern.«
»Eines Tages komme ich wieder zurück. Trink noch einen Schluck Wein.«
Er füllte ihre Gläser auf. Sie sah ihn an, mit schrägem Blick; härter irgendwie.
»Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nun, ich wünsche dir alles Gute.« Mit diesen Worten stand sie auf und ging zur Tür. »Danke für den Wein. Jetzt muss ich mich aber weiter um meine Angelegenheiten kümmern.«
3
Brodie beglich den Rest der Monatsmiete, die er seinem Vermieter für das Zimmer in der Pension in Bruntsfield schuldete. Der Vermieter, ein mürrischer Kerl namens McBain, war verärgert darüber, einen langjährigen Mieter von heute auf morgen zu verlieren, und hatte vor, wie Brodie bemerkte, ihn zusätzlich zur Kasse zu bitten. Er suchte Brodies Zimmer eingehend nach Schäden oder Anzeichen von Vernachlässigung ab, wurde jedoch nicht fündig.
»Es ist so kurzfristig, weil ich für meinen Arbeitgeber nach Paris gehe, verstehen Sie«, sagte Brodie, der damit McBains Neid zu erregen gedachte.
»Besser Sie als ich. Das ist eine Senkgrube, Paris. Eine Kloake.«
»Sie waren also schon mal dort, Mr McBain. In Paris.«
»Um zu wissen, was eine Senkgrube ist, brauche ich sie nicht selbst zu betreten.«
Brodie schleppte seinen Schiffskoffer bis ans Ende der Straße und wartete dort darauf, dass eine Droschke des Wegs kam. Paris war die Chance seines Lebens, so viel stand fest, aber es hielt dennoch allerlei Unwägbarkeiten bereit. Eine davon zeichnete sich immer mehr ab: Calder Channon. Brodie kannte ihn ein wenig, aus der kurzen Zeit, die er in dem Ausstellungsraum in der George Street verbracht hatte, bevor die Zweigstelle in Paris eröffnet wurde. Ein unbeständiger, komplizierter Mensch, so Brodies Einschätzung, obendrein sehr von sich überzeugt. Andererseits, Paris war Paris – eine ganze Stadt konnte Calder Channon wohl kaum ruinieren.
Am Bahnhof Waverley stieg er in den um 10.45 Uhr abgehenden Zug nach Hawick und blickte vom Fensterplatz eines Raucherabteils auf die wellige Hügellandschaft der Borders-Region, während sie von Edinburgh in Richtung Süden fuhren. Vallonné war das Wort, das die Franzosen für diese Art Landschaft verwendeten, wie ihm plötzlich einfiel. Die Hügel waren sanft gerundet, nicht felsig oder zerklüftet, bedeckt mit zähem blondem Gras und Heidekraut. Nichts Abweisendes oder Ehrfurchtgebietendes – die Natur in ihrer lieblichsten, hübschesten Ausprägung. Und unten, zwischen den Hügeln, gab es rasch dahinströmende, flache Bäche, Wälder und Wäldchen, überschaubare Weizen- und Gerstenfelder, Schafe und Rinder, die auf Weideland grasten. Hinter den Wolken kam die Sonne zum Vorschein, und die Täler wurden kurz wie von einer perfekten Lichtfanfare herausgehoben. Brodie spürte, wie sein Herz heftig schlagend Applaus spendete. Die Landschaft war wunderschön, aber er war unterwegs nach Hause.
Am Bahnhof von Peebles wuchtete er seinen Koffer hinten auf einen Pferdewagen und wies den Fahrer an, ihn nach Liethen Manor zu bringen, ein Dorf etwa drei Meilen außerhalb der Stadt, abseits der Straße nach Biggar. Der Fahrer, ein junger Bursche, noch keine zwanzig, griff gern zu, als Brodie ihm eine Zigarette anbot; er brach sie entzwei und steckte sich die eine Hälfte hinters Ohr, für später.
»Ich glaube, ich kenne Sie«, sagte der Fahrer nach zwanzig Minuten, während er den Rest von Brodies Zigarette bis zum letzten Stummel rauchte.
»Nun ja, ich habe den größten Teil meines Lebens in Liethen Manor verbracht.«
»Sie sind ein Moncur. Genau, das ist es – Sie sind Malcolm Moncurs Sohn.«
»Richtig. Damit habe ich meine Sünden abzubüßen.«
»Oh, nein! Nein, nein, er ist ein großartiger Mann.«
Als sie von der Straße nach Biggar abbogen und über die dreibogige Brücke über den Tweed rollten, spürte Brodie, dass ihn der Mut verließ, wie offenbar jedes Mal, wenn er nach Hause zurückkam. Sie waren auf einer einspurigen, von Bruchsteinmauern gesäumten asphaltierten Straße unterwegs, die sich zwischen Ackerland und Waldgebieten das Liethen-Tal hinaufschlängelte, und fuhren dem kleinen Dörfchen entgegen. Liethen Manor lag beschaulich am Nordufer des Liethen Water, einem kleinen, schnell dahinströmenden Zufluss des Tweed. Brodie ließ den Blick ringsum über die sanften Hügel schweifen, die das Dorf einrahmten, und erinnerte sich daran, wie oft er sie alle bestiegen hatte: den Cadhmore, den Ring Knowe, den Whaum. Dies war sein Zuhause, das war nicht abzustreiten. Und er dachte sich eine neue Definition für das Wort aus. »Zuhause« – der Ort, den man verlassen muss.
Sie erreichten die ersten Ausläufer von Liethen Manor. Ein aufgegebenes Mauthäuschen, dann einige geduckte, schiefergedeckte Arbeiterunterkünfte mit kleinen Fenstern. Auf dieser Seite des Dorfes gab es einen Laden, ein Gasthaus, einen Mietstall und einen Hufschmied, dazu einen Fachhandel für Landwirtschaftsbedarf, eine Grundschule und ein Postamt. Dazwischen eine ungeordnete Ansammlung von Cottages und größeren Häusern, zu denen Gemüsegärten gehörten. Bedeutend war das Dorf dank seiner ungewöhnlich großen Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhaus, beides erst dreißig Jahre zuvor erbaut, am unteren westlichen Ende der Hauptstraße, wenn man sie denn so nennen wollte. Es handelte sich um imposante Gebäude aus rotem Sandstein, die für dieses bescheidene Dörfchen in seinem beschaulichen Tal ein wenig überdimensioniert wirkten. Die große Kirche und das angrenzende dreistöckige Haus hätten eher in den wohlhabenden Vorort einer Großstadt gepasst.
Die Kutsche klapperte durch das Dorf und vorbei an der Kirche St Mungo’s, die noch immer ganz neu aussah – reinste Neugotik mit Strebebögen, Kreuzblumen, wo auch immer sich eine Kreuzblume anbringen ließ, und einem hohen Glockenturm ohne Spitze. Der mit Vogelbeeren und Eiben bestandene Friedhof war gedrängt voll von alten Gräbern: frühere Gemeindemitglieder, die braven Leute aus dem Liethen-Tal, die hier ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Dann bogen sie in die kiesbestreute Auffahrt des Pfarrhauses ein, das in einem großen, dunklen Garten voller Zierkoniferen – Andentannen, Lärchen und Zedern – sowie Buchen stand. Buchen gediehen auf dem Boden des Liethen-Tals gut.
Brodies Stimmung verdüsterte sich weiter, als die Kutsche vor der von Säulen umstandenen Eingangstür des Pfarrhauses Halt machte, und er wandte sich nach St Mungo’s um, erbaut auf dem Gelände der alten Liethen Kirk, die komplett abgerissen worden war, um der neuen Kirche zu weichen. Die Kirche und das Pfarrhaus waren nach Entwürfen seines Vaters errichtet und über ein kompliziertes Tontinengeschäft finanziert worden. Pastor Malcolm Moncur hatte Liethen Manor auf die kirchliche Karte gesetzt, und diese dominanten, unpassenden Bauwerke legten aufdringlich Zeugnis von seiner Macht und Vorherrschaft ab.
Brodie zahlte dem Jungen seinen Sixpence und gab ihm noch eine Zigarette.
»Predigt Moncur diesen Sonntag?«, fragte der Junge.
»Davon gehe ich aus«, sagte Brodie und instruierte den Jungen bei dieser Gelegenheit, ihn Sonntag früh um Punkt sechs Uhr wieder hier abzuholen. Während die Kutsche auf dem bekiesten Vorplatz wendete, öffnete sich die Haustür, und zwei von Brodies sechs Schwestern kamen herausgestürmt, um ihn in Empfang zu nehmen. Er wandte sich seiner Familie zu und begrüßte sie mit dem breitesten Lächeln, das er zustande brachte.
Brodie saß in seinem alten Zimmer auf dem Bett, oben im dritten Stock des Pfarrhauses, direkt unterm Dach. Er hatte die paar Habseligkeiten zusammengesucht, die sich noch hier befanden – ein Paar schwere Stiefel, ein Tweedmantel, einige Fotos, ein paar Bücher –, und sie bereits in seinen Koffer gepackt. Zwei Nächte daheim, dachte er bei sich, das kann doch sicher nicht so schlimm sein.
Es klopfte, und sein Bruder Callum kam herein.
»Bist du ein dummer, abtrünniger Mistkerl, oder bist du ein schrecklicher, armer Irrer, der in die Irrenanstalt in Penicuik gehört?«, sagte Callum, anscheinend bitterernst.
»Tja, ich bin hier«, sagte Brodie. »Du hast also vermutlich recht. Ich bin verrückt. Aber andererseits, das bist du auch.«
Sie schüttelten sich herzlich die Hand. Callum boxte ihn gegen die Schulter, und Brodie boxte ihn zurück. Das machten sie immer, wenn sie sich wiedersahen.
»Ich wäre dir sehr für eine deiner feinen amerikanischen Zigaretten verbunden, besten Dank«, sagte Callum. Brodie kramte seine Dose mit Tabak der Marke Margarita aus dem Koffer, und dann steckten sie sich beide eine an.
Callum war zwei Jahre jünger als Brodie, kleiner und muskulöser, mit einem weichen blonden Schnauzbart. Er war als Angestellter bei einem Notar in Peebles beschäftigt, der zur ehrwürdigen Gilde der Writers to the Signet gehörte. Er streckte sich auf Brodies Bett aus, schlug die Knöchel am Fußende übereinander und rauchte theatralisch, während er Rauchringe zur Decke emporsteigen ließ.
»Deinem Telegramm war zu entnehmen, dass du nach Paris gehst«, sagte Callum.
»Ganz recht. Ich bin hergekommen, um meine Sachen zu packen und mich von meinem dummen Bruder zu verabschieden – und natürlich auch vom Rest der Moncurs.«
»Oh, ja, du wirst französische Mädchen durchvögeln, du Glückspilz.«
»Ich habe einen sehr ernsthaften Job zu übernehmen. Wo ist Malky?«
»Malky ist nach Glasgow gefahren. Er wird heute Abend zurück sein.«
»Glasgow.« Brodie dachte kurz nach. »Warum fährt er ständig nach Glasgow? Hat er eine Frau dort?«
»Weil ihn in Glasgow niemand kennt, dort ist er sicher. Und eine spezielle Frau gibt es nicht. Ich wette, dass er da einfach nur mit seinen Kumpanen in Freudenhäusern rumhurt. Inkognito.«
In dem Stil redete Callum weiter über ihren Vater, machte sich mit anzüglichen Anspielungen über ihn lustig. Nur wenn er und Brodie unter sich waren, nannten sie ihn »Malky«. Brodie trat an das kleine Dachfenster und warf einen Blick nach unten in den Garten. Drei seiner Schwestern saßen dort in Korbsesseln und waren mit Näharbeiten beschäftigt. Doreen, Ernestine und Aileen. Die drei ältesten Moncur-Kinder, alle schon über dreißig, alle unverheiratet. Bei ihm und Callum hießen sie nur »die Eens«. Er blickte auf die Eens hinab, während sie arbeiteten und schwatzten. Es mutet an wie eine Szene aus einem russischen Roman, dachte er: Tolstoi oder Turgenjew. Er hatte sechs Schwestern, vier davon älter als er, und doch war keine einzige von ihnen verheiratet. Warum, fragte er sich. Er wandte sich vom Fenster ab. Wobei, er war schließlich auch nicht verheiratet, und Callum ebenso wenig, und der dritte Moncur-Sohn, Alfie, war erst neunzehn. Vielleicht würden sie alle noch heiraten, zu gegebener Zeit … Am wichtigsten war es, so viel Abstand als möglich zwischen sich und Malcolm Moncur zu bringen. Deswegen wollte er so dringend nach Paris, das begriff er mit einem Mal – Edinburgh war noch nicht weit genug entfernt. Von allen Moncur-Kindern war er der Einzige, der eine Flucht geplant und mit Erfolg umgesetzt hatte. Vielleicht würde sein Beispiel die anderen ja inspirieren.
Um Punkt sechs Uhr begab sich Brodie zum Abendessen nach unten. Er war frisch rasiert und hatte sich das Haar mit Pomade glattgekämmt. Er trug seinen dunkelgrauen Anzug, ein weißes Hemd mit weichem Kragen und seine Fliege von Channon & Co., die mit Musiknoten getüpfelt war. Damit kam er sich irgendwie älter vor. Er war ungewöhnlich nervös, dafür, dass er nun im Kreise seiner Lieben willkommen geheißen werden sollte.
Er trat in den großen Salon, wo er Callum und fünf der Schwestern antraf.
»Wo ist Electra?«, fragte er. »Und Alfie?«
»Die kommen noch«, sagte Doreen in scharfem Tonfall. »Wir werden alle hier sein, um den verlorenen Sohn zu begrüßen.«
»Was ist denn an ihm verloren?«, sagte Callum. »Wohl mehr der verlorene Idiot.«
Aileen kam zu ihm herüber und nahm ihn am Arm. Aileen mochte er vielleicht am meisten, überlegte er.
»Er ist verloren, weil er fortgegangen und nun wieder zurück ist«, sagte sie.
»Und wie lang wirst du uns mit deiner Gesellschaft beehren?«, fragte Doreen. Sie war die älteste und bekleidete eine Stellung irgendwo zwischen Haushälterin und Ersatzehefrau. Zumindest ging Malcolm Moncur mit seiner ältesten Tochter ähnlich schroff um wie mit seiner Frau, als sie noch am Leben war, erinnerte sich Brodie.
»Zwei Nächte«, sagte er. »Am Sonntag reise ich nach Paris ab, bei Tagesanbruch.«
»Du musst für die Predigt bleiben«, sagte Ernestine und warf Doreen beunruhigte Blicke zu. »Papa wird sich wünschen, dass du so lange bleibst.«
»Ja, leider Gottes habe ich keinen Einfluss darauf, wann der Dampfer ablegt.«
Brodie hörte jetzt Stimmen und Gelächter, Männerstimmen und Männergelächter, die vom Wohnzimmer seines Vaters her durch den Flur drangen. Sein »Empfangszimmer«, wie er es mitunter nannte.
»Wer ist da bei Papa?«, fragte er Doreen.
»Der Bürgermeister von Lyne und einige Freunde, die aus England hochgekommen sind. Dem Sport zuliebe.«
»Und was für Sport wird das wohl sein?«, sagte Callum. »Weder Fisch noch Geflügel, jede Wette.«
»Callum!«
Sie lauschten dem lauter werdenden Gelächter aus dem Wohnzimmer und hörten dann Malcolm Moncur, der mit seiner dröhnenden Stimme rief: »… und der dürfte mir nicht mal die Schuhe putzen!«
Brodie wurde für einen Moment übel. Er wandte sich ab und ging zu seinen Schwestern hinüber.
»Besteht die Aussicht auf einen Aperitif? Einen Sherry oder Madeira?«
»Papa hat die Speisekammer abgesperrt und den Schlüssel an sich genommen.«
Sämtlicher Alkohol im Pfarrhaus, der im Übrigen in Hülle und Fülle vorhanden war, wurde in einer begehbaren Speisekammer unter Verschluss gehalten, die vom Wohnzimmer abzweigte. Nur Malcolm Moncur verfügte über einen Schlüssel; nur er gab in seinem Haus die Spirituosen aus.
»Im Empfangszimmer wird noch etwas sein«, sagte Callum. »Falls sie noch nicht alles ausgetrunken haben.«
»Husch mal eben ins Zimmer und schnapp dir eine Flasche«, sagte Brodie zu Isabella, der zweitjüngsten. Sie war ein stilles Mädchen, das, wie er, eine Brille trug. »Dir kann er nicht böse sein. Sag ihm, dass wir hier draußen vor Durst umkommen.«
»Ich traue mich nicht, Brodie. Er verhaut mich mit dem Gürtel.«
»Du bist doch schon siebzehn, Isabella!«
»Wenn er in Fahrt ist, schlägt er mich auch heute noch mit dem Gürtel.«
»Du lieber Gott. Ist Rauchen gestattet?«
Er nahm sein Zigarettenetui aus Zinn mit den vorgedrehten Zigaretten heraus und ließ es herumgehen. Von seinen drei älteren Schwestern – den Eens – rauchten alle, wie er erfreut feststellte. Kleine Akte der Rebellion waren in diesem Haushalt wichtig. Er gab ihnen Feuer, dann entschied Edith, seine vierte ältere Schwester, dass sie ebenfalls gern eine hätte, und als schließlich auch er und Callum sich eine ansteckten, rauchten die sechs Geschwister gemeinsam (nur Isabella hatte abgelehnt), während sie plauderten, und erzeugten dabei einen solchen Nebel, dass Electra, als sie, gefolgt von Alfie, hereinkam, die Glastüren zum Rasen hinter dem Haus öffnete, um, wie sie sagte, etwas Luft hereinzulassen. Die beiden begrüßten Brodie scheu, als wäre er ein Fremder.
»Wie ich höre, verlässt du uns«, sagte Electra. Sie war klein und zierlich, die hübscheste der Moncur-Schwestern.
»Ja. Ich ziehe nach Paris.«
»Du wirst nie zurückkommen«, sagte sie.
»Selbstverständlich komme ich zurück«, sagte Brodie. »Es ist nur der Arbeit wegen. Ich wandere ja nicht aus.«
»Ich würde auswandern«, sagte sie und schlug die Augen nieder.
»Und wohin würdest du auswandern?«, ließ sich eine laute Stimme von der Tür her vernehmen. »Ins dunkelste Afrika? Da wärst du im Handumdrehen eine Hühnersuppe, mein Schatz. Da bleibst du besser bei deinem alten Papa. Eh? Eh?«
Electra glitt hinter Brodie, als Malcolm Moncur in den Raum kam und seine große Familie musterte, während alle Frauen eilig ihre Zigaretten ausdrückten.
Brodie wechselte einen Blick mit Callum. Sie kannten die Anzeichen, die verschiedenen Stadien von Malcolm Moncurs Trunkenheit. Jetzt gerade war er, Brodies Einschätzung nach, zu vier Fünftel betrunken: Es könnte ein schwieriger Abend werden.
Pastor Malcolm Moncur war ein kleiner, stattlicher Mann – kurz vor der Verfettung – mit einem großen, markanten Kopf, der nahezu im Missverhältnis zu seinem übrigen stämmigen Körper stand. Er war beinahe sechzig, sein hellrötlich-braunes Haar aber war noch nicht ergraut, bis auf die Schläfen, und er hatte einen dichten, ansehnlichen Schnauzbart wie aus Kokosfasern, in etwas dunklerem Rot. Callum hatte den Verdacht, dass er ihn beim Friseur färben ließ.
Malky Moncur, wie üblich betrunken, dachte Brodie, während er darauf wartete, dass der Blick seines Vaters auf ihm landete. Was kurz darauf der Fall war.
»Apropos Afrika. Seht doch nur! Der Farbige ist heimgekommen. Sieh an, sieh an.«
»Hallo, Papa«, sagte Brodie in ruhigem Tonfall.
»Wie geht’s meinem kleinen Mulatten?«, sagte er, während er auf Brodie zukam. Brodie war einen Kopf größer als sein Vater, und dieser Größenunterschied schien Malky jedes Mal aufzuregen, als handelte es sich um einen persönlichen genetischen Affront. Brodie war sehr dunkel – sein Haar pechschwarz, die Augen dunkelbraun, die Haut sandfarben –, als Einziger in dieser Familie blonder, helläugiger, blasshäutiger Moncurs. Über diese Unstimmigkeit hatte sein Vater sein Leben lang Bemerkungen gemacht. Brodie hegte tatsächlich die stille Hoffnung, dass er das Ergebnis einer Liebelei seiner Mutter mit einem olivenhäutigen Südländer auf Durchreise in Schottland war. Ein reines Hirngespinst, das wusste er.
»Wie ich sehe, bist du so schwarz wie immer. So schwarz wie der Tag, an dem du geboren wurdest.«
»Danke, Papa«, sagte er gleichmütig. »Du scheinst wohlauf. Glasgow war wohl sehr belebend.«
Die beiden sahen einander an. Brodie verzog keine Miene. Die anderen magst du ja kontrollieren, dachte er, aber mich kontrollierst du nicht, Malky Moncur: Ich bin mein eigener Herr.
»Leidender Heiland!« Malky Moncur wandte sich seiner ältesten Tochter zu. »Bekommen wir was zu essen, oder müssen wir verhungern, Doreen? Ich komme um vor Hunger!«
Und damit marschierte Pastor Malcolm Moncur los ins Speisezimmer, gefolgt von den Schwestern und Brüdern Moncur, die schweigend vielsagende Blicke miteinander wechselten.
Das Essen verlief relativ gut, fand Brodie. Doreen schnitt einen großen Hammelbraten auf, der – mit Kartoffeln und Möhren als Beilage – von ihrer Köchin und Haushälterin Mrs Daw aufgetragen worden war. Ein kurzes Tischgebet wurde gesprochen (von Alfie), ehe die Familie zu Messer und Gabel griff und mit hungriger Begeisterung zu essen begann. Dazu gab es Wasser aus Krügen, und ausnahmsweise war Brodie froh darüber, dass seine Familie so groß war, denn auf diese Weise waren viele Unterhaltungen auch abseits von Malkys Dunstkreis möglich. Doreen und Ernestine, die ihren Vater flankierten, gelang es im Großen und Ganzen, ihn an seinem Tischende in Zaum zu halten. Hin und wieder aber erhob sich Malky von seinem Stuhl und verließ das Zimmer für einige Minuten; oder er spazierte den Tisch hinunter, um der einen oder anderen Tochter liebevoll die Schulter zu tätscheln und ihr etwas ins Ohr zu flüstern; oder er machte sich, bei Bedarf, persönlich auf, um den Salzstreuer oder den Wasserkrug ausfindig zu machen und damit an seinen Platz zurückzukehren. Diese umherwandernde Art des Speisens schien ihm zu behagen; seine Laune jedenfalls hob sich, und er wirkte milde, beinahe väterlich, fand Brodie, während das Mahl seinen Lauf nahm.
Das änderte sich allerdings beim Nachtisch: Blanc-Manger mit Himbeergelee, eine Speise, gegen die Malky mit den Worten »Ich mag ja ein gottverdammter Narr sein, aber diesen Mist esse ich nicht!« Protest einlegte, ehe er sich aus dem Zimmer entfernte und die übrige Familie mit ihrem Dessert allein ließ. Die Stimmung hellte sich umgehend auf.
Nach dem Essen zogen sich die Frauen auf ihre Zimmer zurück, Brodie, Callum und Alfie aber entschieden, es mit Malky in seinem Wohnzimmer aufzunehmen, wenn sich dadurch die Aussicht auf einen Drink ergab. Als sie das Zimmer betraten, stand die Tür der Speisekammer offen, und Malky machte sich darin zu schaffen.
»Gibt’s in diesem Pub was zu trinken?«, rief Callum, worauf Malky aus der Kammer zum Vorschein kam, ohne Jacke und mit herunterhängenden Hosenträgern.
»Spricht da der armselige, elende Gehilfe eines drittklassigen Notars aus Peebles?«, stieß Malky aggressiv hervor, der mit einer Brandyflasche in der Hand schwankend vor ihnen stand. Inzwischen zu fünf Fünftel betrunken, entschied Brodie.
»Falls es nichts zu trinken gibt, gehen wir schlafen«, fuhr Callum tapfer fort.
Malky versorgte sie widerwillig mit kleinen Gläsern voll Brandy, und sie ließen sich auf Sesseln nieder, während er sich auf das Sofa gegenüber fläzte.
»Zum Wohl, Papa.« Brodie hob sein Glas.
»Slange«, erwiderte Malky. »Und dein angeberisches englisches Gerede aus Edinburgh dulde ich nicht hier im Haus.«
»Ich werde doch auf dein Wohl trinken dürfen.«
»Weinender Gott!«, sagte er theatralisch. »Weinender Gott, dass ich drei solche Söhne haben muss.«
Brodie hielt den anderen sein Zigarettenetui hin, und Malky beugte sich vor, um sich eine zu nehmen.
»Und wie geht’s Ainsley Channon?«, wollte er von Brodie wissen. »Dem gottverfluchten Flaschenspüler.«
»Sehr gut«, sagte Brodie. »Ich soll dich herzlich von ihm grüßen.«
»Seine herzlichen Grüße kann er sich sonst wo hinstecken, sage ich.«
Callum hatte sich inzwischen in den Besitz der Brandyflasche gebracht und schenkte allen nach.
»Ainsley Channon ist ein guter Freund dieser Familie«, sagte Callum, um weitere Schimpftiraden hervorzulocken. »Sieh doch nur, was er alles für Brodie tut.«
»Er ist ein Edinburgher Ladenschwengel«, sagte Malky, »der das Glück hatte, einen Familienbetrieb zu erben, nachdem sein Cousin jung gestorben ist. Er sitzt in der George Street auf seinem Hintern und zählt das Geld, das hereinkommt.«
Brodie gab Callum verstohlen Zeichen, das Thema auf sich beruhen zu lassen, aber Malky entging seine Handbewegung nicht.
»Dass er dich nach Paris schickt, ändert nicht das Geringste«, sagte Malky kalt. »Du schwarzer Mistkerl.«
Brodie trank seinen Brandy aus.
»Gute Nacht, lieber Vater.«
Er ging hinaus, ohne die Tür zu schließen und ohne die Verwünschungen zu beachten, die ihm nachfolgten, als er die Treppe zu seinem Zimmer im obersten Stock hinaufstieg. Wut empfand er keine; er fühlte sich eher seltsam. Warum empfand sein Vater – ein komplizierter Mensch, zugegeben – solche Abneigung gegen ihn? Er ging an den kleinen Sekretär aus Eiche an der Wand gegenüber von seinem Bett, öffnete eine Schublade und nahm das Medaillon mit der Fotografie seiner Mutter heraus, das er dort aufbewahrte. Moira Moncur 1842–1884.
Sie war im Kindbett gestorben, als er vierzehn war, also hatte er zumindest deutliche Erinnerungen an sie: eine blasse, liebevolle, aber abgehetzte Person, belastet von ihren vielen Kindern und ständigen Schwangerschaften. Zwischen 1861 und ihrem Tod dreiundzwanzig Jahre später hatte sie, wie Brodie unlängst zusammengerechnet hatte, vierzehn Kinder zur Welt gebracht, darunter fünf Totgeburten oder Säuglinge, die nur wenige Tage gelebt hatten. Er fragte sich, was sein Vater wohl über diese Frau, seine Gattin, dachte. War sie nur eine Art Kinderfabrik für ihn, eine Zuchtkuh? Zunächst kamen innerhalb von fünf Jahren vier Töchter, danach die ersten beiden Totgeburten, gefolgt von seiner, Brodies, Ankunft im Jahr 1870. Sie war achtundzwanzig damals. Es folgten zwei weitere Jungen (Callum und Alfie, mit einem toten Bruder dazwischen), ehe mit Isabella und Electra erneut der weibliche Kreislauf einsetzte, ebenfalls mit einem toten Baby dazwischen. Das totgeborene Kind, das am Ende ihr Ableben beschleunigte, war ein weiterer Sohn, der namenlos blieb. Neun lebende Kinder also, und mit zweiundvierzig Jahren war sie verstorben.
Er betrachtete eingehend ihr Gesicht auf dem Foto in dem ovalen Medaillon. Die altertümlich steife Pose wie auch die lange Belichtungszeit machten es unmöglich, aus dem Porträt einen Eindruck von der wirklichen Person zu gewinnen. Es war eine Maske, dieses Bild, nicht mehr, keine Wiedergabe eines lebendigen, atmenden Menschen. Wie war sie als Mensch? Was wäre, wenn sie noch lebte? Zweiundfünfzig Jahre wäre sie nun. Hätten sich die Dinge ganz anders entwickelt? Es erschien unvorstellbar: Wie hätte sie es an der Seite des monströsen, egozentrischen Unruhestifters aushalten sollen, zu dem Malky Moncur sich entwickelt hatte? Brodie mutmaßte, nicht zum ersten Mal, dass ihr vorzeitiger Tod in ihrem Mann womöglich eine teuflische Seite hervorgebracht hatte. Wobei das, wie er sich berichtigte, zu viel der Nachsicht war – Malky Moncur war eine dunkle Ausnahmeerscheinung, einzigartig. Er hatte immer gewusst, in welche Richtung es mit ihm ging: Sein Ziel stand fest.
Brodie verstaute das Medaillon sorgsam in seinem Koffer, und dabei kamen ihm seine fünf totgeborenen Geschwister in den Sinn. Er war sich nicht ganz im Klaren über ihr Geschlecht, wie er sich eingestehen musste; es waren Jungen und Mädchen gewesen, manche mit Namen, manche bloß anonyme Föten. Angesichts seiner Ahnungslosigkeit erfasste ihn ein schlechtes Gewissen. Irgendwo musste es eine Gemeindechronik mit entsprechenden Aufzeichnungen geben. Vielleicht sollte er ihrem Andenken zuliebe den kargen Tatsachen, die über sie existieren mochten, auf den Grund gehen. Das Vorhaben erschien ihm jedoch auf einmal erdrückend, sinnlos, und er ließ sich schwer auf sein Bett sinken, erschöpft von den zahlreichen Anspannungen der Heimkehr. Denk an Paris, sagte er sich – das ist das Geschenk, das die Götter des Glücks dir gemacht haben.
Paris erwartete ihn.
4
Am nächsten Morgen, Samstag, machte sich Brodie – frisch rasiert, die Fingernägel mit dem Taschenmesser gesäubert und mit der ersten Margarita des Tages zwischen den Fingern – auf den Weg durchs Liethen-Tal, um Lady Dalcastle zu besuchen, die oben auf Dalcastle Hall lebte, etwa eine Meile entfernt. Bei seiner Ankunft hatte er ihr eine kurze Nachricht übersandt, und sie hatte zurückgeschrieben, dass elf Uhr für ein Treffen ideal sei. Sie blicke dem Wiedersehen »mit Vorfreude« entgegen.
Dalcastle Hall war eine seltsame Stilmischung. Brodie passierte ein schnörkeliges Tor, kam vorbei an einem neugotischen Pförtnerhäuschen mit mehreckigen Schornsteinen, Firstziegeln, Zierleisten im Zuckerbäckerstil und Radfenstern und marschierte über die von uralten Buchen gesäumte, mit Schlaglöchern übersäte Auffahrt auf das Herrenhaus zu. Als Erstes kam zwischen den Bäumen ein alter Turm mit dicken Mauern zum Vorschein, burgartig verstärkt, wie es schien, und mit kleinen, hohen, unregelmäßigen Fenstern. Er war in schlechtem Zustand. Der Mörtel zwischen den Steinen war mit Moos und kleinen Farnen bewachsen, und einige der Fenster waren mit Brettern vernagelt. Als Brodie weiterging, rückte der georgianische Flügel ins Blickfeld: weißer Stuck, dreigeschossig, symmetrisch angeordnete Schiebefenster, daran angrenzend ausgedehnte Stallungen und, jenseits davon, die hohen grauen Mauern um zwei Gärten, der eine mit einem Rasen, Blumenbeeten und Treibhäusern, der andere für Obst und Gemüse. Lady Dalcastle lebte allein hier, genauer gesagt, allein mit ihrer Dienerschaft. Ihr Mann, Hugo Dalcastle, war in seinen Dreißigern gestorben (»An Alkohol und Ausschweifungen«, wie Malky behauptete), und ihr einziges Kind, Murdoch, Hauptmann bei den Scots Greys, war zehn Jahre später, 1870, in Ashanti in Westafrika vierundzwanzigjährig dem Gelbfieber erlegen. In ihrer Trauer hatte Lady Dalcastle Trost und Gesellschaft bei der Pastorenfrau Moira Moncur gefunden, und die beiden hatten überraschend schnell Freundschaft geschlossen.