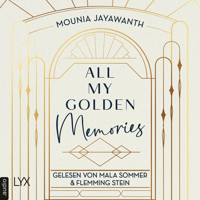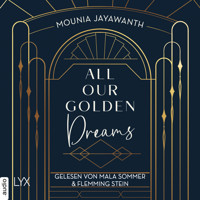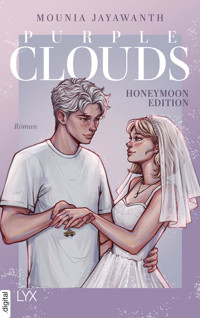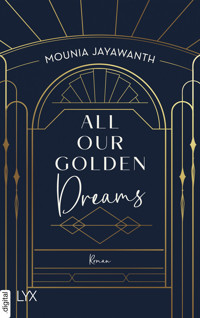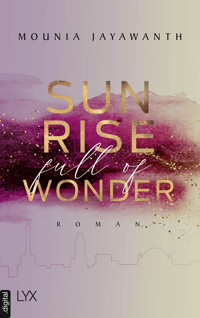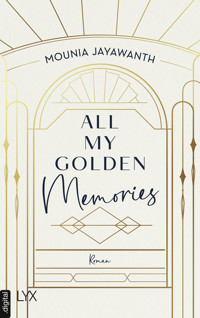
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Van Day Reihe
- Sprache: Deutsch
Nach zwei Jahren treffen ihre Welten wieder aufeinander ...
Als ein Skandal das familiengeführte Luxushotel Van Day in New York erschüttert, kehrt Ryan Van Day, der Sohn der Besitzer, nach Hause zurück. An einen Ort, den er zwei Jahre lang gemieden hat, um seiner einstigen besten Freundin nicht zu begegnen. Ellis Wheaton lebt seit ihrer Kindheit im Hotel - allerdings nicht in einer der exklusiven Suiten, sondern einer kleinen Angestelltenwohnung. Obwohl sie aus so unterschiedlichen Welten kommen, gab es eine Zeit, in der Ryan und Ellis unzertrennlich waren - bis ein Streit alles veränderte. Als sie jetzt wieder aufeinandertreffen, keimen zwischen ihnen plötzlich neue Gefühle auf: ein Knistern und Prickeln, das immer stärker wird. Doch können sie jemals ganz überwinden, was sie schon einmal auseinandergerissen hat?
»Eine wunderschöne Geschichte voller großer Gefühle und Intrigen in der vergoldeten Welt der New Yorker Upper East Side. Willkommen im Hotel VAN DAY!« KIM NINA OCKER, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Band 1 der VAN-DAY-Dilogie von Mounia Jayawanth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Damals
1. Kapitel
2. Kapitel
Damals
3. Kapitel
4. Kapitel
Damals
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Damals
9. Kapitel
10. Kapitel
Damals
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Damals
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Damals
18. Kapitel
19. Kapitel
Damals
20. Kapitel
21. Kapitel
Damals
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Damals
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Damals
35. Kapitel
Die Autorin
Die Romane von Mounia Jayawanth bei LYX
Impressum
Mounia Jayawanth
All My Golden Memories
Roman
ZU DIESEM BUCH
Seit ihrer Kindheit lebt Ellis Wheaton im Luxushotel Van Day in New York – allerdings nicht in einer der exklusiven Suiten, sondern zusammen mit ihrer Mutter in einer kleinen Angestelltenwohnung. Ellis liebt ihr Zuhause. Sie kennt dort jedes romantische Turmzimmer und jeden Winkel des pompösen Ballsaals. Doch dann erschüttert ein Skandal das Hotel, der nicht nur die Zukunft des Van Days, sondern auch die von Ellis bedrohen könnte. Und als wäre das nicht genug, kehrt nun Ryan Van Day, der Sohn der Hotelbesitzer, nach Hause zurück. Ryan, der einmal der wichtigste Mensch in Ellis‘ Leben war. Denn obwohl die beiden aus ganz verschiedenen Welten kommen, gab es eine Zeit, in der sie unzertrennlich waren. Bis ein Streit zwischen ihnen alles veränderte. Als Ellis und Ryan wieder aufeinandertreffen, kehren langsam die Vertrautheit und Freundschaft zurück, die sie damals verbanden – und mit ihnen ein Knistern und Prickeln, das immer stärker wird. Doch können sie jemals ganz überwinden, was sie schon einmal auseinandergerissen hat?
Liebe Leser:innen,
wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Buch folgende Themen behandelt: toxische Familienverhältnisse, Erkrankung eines Familienmitglieds, sexistisches Verhalten und Erwähnung von Suizid.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Mounia und euer LYX-Verlag
Für alle, die zurückkommen.
PLAYLIST
We Don’t Talk Anymore – Charlie Puth, Selena Gomez
Like Strangers Do – AJ Mitchell
Heat Waves – Glass Animals
Loved You Once – Clara Mae
Like 1999 – Valley
IDK – Ali Gatie
Automatic – Fly By Midnight, Jake Miller
Cotton Candy – Nic D
Can I Kiss You? – Dahl
No One Compares To You – Jack & Jack
Somebody To You (Acoustic Version) – The Vamps
Running On My Mind – Ali Gatie
Feel My Love – Glenn Travis
Never A Good Time – NOTD, The Band CAMINO
Midnight Rain – Taylor Swift
Late Night Talking – Harry Styles
Tomororow – Fly By Midnight
Worst of You – Maisie Peters
House of Cards – Alexander Steward
Turn Back Time – Daniel Schulz
Damals
Ryan, acht Jahre alt
Mit einem Pliing schieben sich die Türen des Personalaufzugs auseinander – und da steht sie. Ein Mädchen, vielleicht so alt wie ich, mit braunen lockigen Haaren, die ihr offen über die Schultern fallen. Sie trägt ein weißes INY-S-Shirt, das ihr zwei Nummern zu groß zu sein scheint. Eindeutig eine Touristin. Aber was hat sie hier oben verloren?
»Hallo«, sagt das Mädchen fröhlich, der Blick erwartungsvoll und neugierig. »Ist das der fünfzehnte Stock?«, fragt sie mich lachend.
»Ähm, ja«, sage ich, und halte schnell meinen Fuß vor den Sensor, damit sich die Türen nicht wieder schließen. »Aber du darfst hier eigentlich nicht …«
»Ha! Wusst’ ich’s doch!« Und damit hüpft sie über mein ausgestrecktes Bein.
Was zum … Ich bin so perplex, dass ich mich einen Moment lang nicht bewegen kann, doch dann befreie ich mich aus meiner Starre, ziehe den Fuß wieder ein, und folge ihr über den leeren Hotelflur.
»Was machst du hier?«, frage ich, und beschleunige mein Tempo, um mit ihr Schritt zu halten.
»Ich wollte ganz nach oben. Der große Mann an der Rezeption hat gesagt, dass es nur vierzehn Stockwerke gibt, aber ich war mir ganz sicher, dass ich mich draußen nicht verzählt hatte!«
»Nein, es gibt gerade wirklich nur vierzehn. Auf diesem hier werden momentan keine Zimmer vermietet.«
»Warum?« Sie rüttelt an einem Türknauf und ich reiße entsetzt die Augen auf. Was ist denn mit der los?
»Hey, du darfst das nicht!«, sage ich streng, und greife nach ihrem Unterarm, um sie von der Tür wegzuziehen.
»Warum ist ein ganzes Stockwerk gesperrt?«
»Weil hier alles renoviert werden muss.«
»Ah.« Das Mädchen schnuppert in der Luft, als würde sie erst jetzt den Geruch der frisch gestrichenen Wand wahrnehmen. »Und warum?«
Mann, ist die nervig. »Darum.«
»Aber was ist mit den Türmchen?«
Ich runzele die Stirn. »Was?«
»Die kleinen Türmchen auf dem Dach, die ich von draußen gesehen habe.«
»Ach so.« Ich schüttele den Kopf. »Nein, da kann man nicht hin.«
»Warum nicht?«
»Weil …« Ich schließe den Mund wieder, weil mir klar wird, dass ich es selbst nicht weiß. Um ehrlich zu sein habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es von hier aus einen Zugang zu den kleinen blauen Türmchen gibt. Ob sich dort auch Zimmer befinden?
»Es geht einfach nicht. Und jetzt komm«, sage ich und ziehe sie am Arm zurück in Richtung Aufzug.
»Wohin gehen wir?«, fragt sie, während sie mir stolpernd folgt.
»Du darfst hier nicht sein. Ich bringe dich wieder nach unten.«
»Und warum warst du dann hier?«
»Deine Eltern suchen dich bestimmt schon«, sage ich, ohne auf ihre Frage einzugehen. »Wie bist du überhaupt in den Personalaufzug gekommen?«
»Wie wohl, ich habe auf den Knopf gedrückt und bin rein.«
»Nein, ich meinte …« Ich verdrehe die Augen. »Ach egal.«
Vor dem Aufzug angekommen, drücke ich auf den vergoldeten Knopf, um den sich prompt ein leuchtend gelber Kreis bildet. Während wir warten, beobachte ich das Mädchen im Spiegelbild der glänzenden Türen. Ihr Kopf ist zur Seite geneigt, der Mund leicht geöffnet.
»Wow«, haucht sie. »Ist es hier überall so schön?«
»Redest du vom Flur?«, murmele ich, ohne den Blick von ihrem Spiegelbild zu lösen.
»Ja, er ist so groß und hell.«
Ein kleines Lächeln umspielt meine Lippen. Wenn sie diese Baustelle schon begeistert, sollte sie erst den Rest des Hotels sehen.
»Und der Teppich ist so hübsch.«
»Das ist doch nur ein roter Teppich«, sage ich mit einem flüchtigen Blick nach unten. Wo bleibt denn der Aufzug? Allmählich werde ich nervös, dabei weiß ich nicht mal, warum. Wieder drücke ich auf den Knopf, obwohl mir selbst klar ist, dass er dadurch auch nicht schneller kommt.
»Gar nicht wahr. Guck.« Sie geht auf die Knie und bedeutet mir mit einer hektischen Handbewegung, ihr zu folgen. »Guck!«, sagt sie wieder und zieht diesmal sogar an meinem Hosenbein.
Oh Mann. Seufzend gebe ich nach und hocke mich hin.
»Siehst du das?« Mit den Fingern fährt sie über die feinen goldenen Schnörkel.
»Ja?«, gebe ich unbeeindruckt zurück.
»Sie sehen aus wie kleine Wellen, die alle ineinander übergehen. Und der Stoff ist so schön weich.«
Als ich nichts darauf erwidere, schaut sie ruckartig auf, und mit einem Mal sind sich unsere Gesichter so nah, dass mein Atem ins Stocken gerät. Ihre Augen sind groß und braun, die Brauen dunkel und dicht. Und ihre Haare … Sie erinnern mich an das Schnörkelmuster vom Teppich. Kleine Locken, die sich in Wellen kräuseln.
»Du bist nicht sehr begeistert, oder?«
Ich blinzele. »Was?«
»Vom Teppich.«
»Oh, ach so. Ähm …«
Plötzlich gleiten die Aufzugtüren auseinander, und wir beide zucken zusammen.
Na endlich.
»Komm«, sage ich, und stütze mich auf dem Teppich ab, um aufzustehen.
Sie hat recht. Er ist wirklich weich.
Im Aufzug sieht sich das Mädchen wieder nach allen Seiten um, und diesmal kann ich ihre Begeisterung noch weniger verstehen. Der Personalaufzug ist viel größer und schlichter als der für die Gäste. Hier gibt es keine bodentiefen Spiegel, nur silberne Wände und einen zerkratzten Metallboden.
»Wie heißt du eigentlich?«, fragt das Mädchen. Das grelle Deckenlicht macht ihre Augen heller.
»Ryan. Und du?«
»Ellis. Ich bin gerade mit meinen Eltern hierhergezogen.«
»Hergezogen?« In ein Hotel? Moment …
Ich reiße die Augen auf. »Du bist Ellis? Das Kind der neuen Köche?«
»Jaa?« Sie legt den Kopf schief. »Kennen wir uns etwa?«
»Oh Mann«, stöhne ich, und obwohl ich weiß, wie unhöflich es ist, schaffe ich es nicht, meine Enttäuschung zu verbergen. »Ich dachte, du wärst ein Junge.«
Als meine Eltern mir erzählten, dass eine gute Freundin meiner Mom und deren Ehemann ganz spontan als neue Köche eingestellt werden, und hier vorübergehend als Gäste wohnen werden, haben sie erwähnt, dass sie auch ein Kind mitbringen. Ellis – geschrieben wie der Name des Jungen aus meiner Schule. Aber sie ist ein Mädchen. Was bedeutet, dass es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis meine Schwester Sam sie sich krallen wird.
Und ich werde wieder allein sein.
»Warum ist es schlimm, dass ich ein Mädchen bin?«, fragt Ellis und klingt ehrlich interessiert.
»Ist es nicht, ich dachte nur … ach, vergiss es«, winke ich ab und spüre, wie meine Laune zusammen mit dem Aufzug immer tiefer sinkt.
Ellis’ Blick wird argwöhnisch. »Ryan, bist du etwa ein Chauffeur?«
Irritiert blicke ich sie an. »Hä?«
»Meine Mom sagt, dass Jungs, die sich besser finden als Mädchen, Chauffeure sind.«
Was redet sie für einen Quatsch?
»Ich … bin kein Chauffeur! Und ich hab doch nichts gegen Mädchen!«
Endlich öffnen sich die Türen, und ich atme erleichtert auf. Mit schnellen Schritten marschiere ich nach draußen und schlage den Weg zur Lobby ein.
Vor der Rezeption entdecke ich meine Mom, die mit einer Frau und einem Mann zusammensteht. Sie sind anders gekleidet als unsere üblichen Gäste. Eher bequem und ganz bestimmt nicht so schick wie meine Mutter.
»Ellis!«, ruft der Mann und zeigt in unsere Richtung. Die anderen folgen seinem Blick, und selbst aus der Ferne kann ich sehen, wie sich die Frau neben ihm vor Erleichterung an die Brust fasst.
»Dad!«, ruft Ellis und rennt auf ihn zu. Ihr Vater, ein Mann mit schwarzen Haaren und hellbrauner Haut, fängt sie auf und drückt sie ganz fest an sich. »Wohin bist du wieder ausgebüxt, meine Kleine?«, fragt er sanft.
»Wir haben dir doch gesagt, dass du dich nicht von der Stelle rühren sollst«, donnert die Frau neben ihm, die genauso aussieht wie Ellis. Wahrscheinlich ihre Mutter. Sam und ich sehen eher unserem Dad ähnlich. Nur die schwarzen Haare haben wir von Mom.
»Siehst du? Ich habe doch gesagt, du musst dir keine Sorgen machen«, meint Mom und wendet sich an den Rezeptionisten. »Gavin, sagst du Bescheid, dass sie wieder aufgetaucht ist?«
Gavin nimmt den Hörer in die Hand und nickt bestätigend.
Mom wendet sich mir zu und lächelt breit. »Hast du Ellis gefunden, Schätzchen?«
Sie hat wieder diese Stimme aufgesetzt, die viel freundlicher und höher klingt als ihre übliche. Ich weiß nicht, warum sie das immer macht, wenn andere Menschen dabei sind.
»Ja.« Fast will ich sagen, wo ich sie gefunden habe, aber dann müsste ich zugeben, dass ich mich auch im fünfzehnten Stock aufgehalten habe. Und der ist ja eigentlich gerade gesperrt …
»Mom, ich glaube, Ryan ist ein Chauffeur«, sagt Ellis, und sofort zucke ich zusammen.
Jetzt fängt sie schon wieder damit an!
»Ein Chauffeur?«, wiederholt ihre Mom, und Ellis nickt eifrig. »Ja. Er mag keine Mädchen.«
»Das stimmt gar nicht!«, schimpfe ich, während meine Mom und ihr Dad losprusten.
»Ellis, hast du Ryan etwa als Chauvinisten beleidigt?«, japst ihre Mutter erschrocken.
»Oh.« Erkenntnis leuchtet in ihren braunen Augen auf. »Stimmt, so hieß das Wort.«
Wieder lacht ihr Dad, verstummt jedoch sofort, als er sich einen finsteren Blick seiner Frau einfängt.
»Beeindruckend, dass dein Kind schon solche Worte kennt«, kichert meine Mutter, aber Ellis’ Mom wirkt überhaupt nicht beeindruckt, sondern schockiert.
»Entschuldige dich bei ihm«, verlangt sie. »Sofort!«
Die Standpauke zeigt ihre Wirkung. Ellis zuckt zusammen, und senkt verschämt den Kopf. »Tut mir leid«, murmelt sie und streckt mir ihre kleine Hand hin. Ich zögere, doch als meine Mutter mich auffordernd anstupst, schüttle ich sie schließlich. Aber nur kurz, weil ihre Hände echt schwitzig sind.
»Schätzchen, so darfst du wirklich nicht mit ihm reden«, sagt ihre Mom und nickt in meine Richtung. »Weißt du überhaupt, wer das ist?«
Ein dicker Kloß bildet sich in meinem Hals.
»Das ist Ryan«, sagt Ellis und zieht die Stirn kraus.
»Ja, Ryan Van Day«, sagt sie und betont meinen Nachnamen, als sei er heilig. »Seiner Familie gehört das Hotel, in dem wir vorübergehend wohnen werden«, erklärt sie, und macht eine ausladende Geste, die die Lobby und das ganze Hotel einzuschließen scheint.
»Wirklich?« Ellis’ Augen weiten sich, und sofort kriege ich Angst. Angst, dass sie mich jetzt anders sieht, anders mit mir redet. Oder auch gar nicht mehr mit mir redet. So wie alle anderen es immer tun.
Weil ich der Enkel des Hotelerben bin.
»Heißt das etwa, du bist öfter hier?« Ihre Stimme klingt aufgeregt. »Dann können wir bestimmt mal miteinander spielen!«
»Ich …« Verdattert schließe ich den Mund wieder. Sie will mit mir spielen? Obwohl ich nicht gerade nett zu ihr war?
»Ellis!« Ihre Mutter schnalzt mit der Zunge und zieht ihre Tochter ein Stück von mir weg. »Bedräng ihn doch nicht so. Sonst müssen wir bald wieder ausziehen«, setzt sie mit einem nervösen Lachen hinterher.
»So weit kommt’s noch.« Mom winkt ab und zeigt auf Ellis’ Eltern. »Euch beiden ist schon klar, dass ihr uns das Leben rettet, oder?«
Damit meint sie vermutlich, dass uns momentan eine Menge Küchenpersonal fehlt, nachdem der Chefkoch Streit mit Grandpa Al hatte, und der daraufhin gekündigt und all seine Assistenten mitgenommen hat.
»Außerdem glaube ich, dass es diesem Einzelgänger hier ganz guttun wird, nicht immer nur alles allein zu unternehmen«, fährt meine Mutter fort und wuschelt mir mit ihren frisch manikürten Fingern durch die Haare.
Mein Kopf wird heiß.
»Mom!«, jammere ich und entziehe mich ihrem Griff. So was kann sie doch nicht vor anderen sagen! Erst recht nicht vor Ellis.
Aber Ellis lächelt nur, und ihr Blick ist so intensiv, dass ich wegschauen muss. Trotzdem höre ich sie. Sanfte Worte, die mir unter die Haut gehen.
»Jetzt bist du nicht mehr allein.«
1. KAPITEL
Gegenwart
Ellis
War es Mord? Berühmte Schauspielerin Edith Langston tot im Hotel aufgefunden
Bei Detective Crime rüttelte sie die Achtziger mit spannenden Mordfällen auf, doch nun wurde sie möglicherweise selbst einem zum Verhängnis. Die britische Schauspielerin Edith Langston ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Eine Reinigungskraft fand sie am Morgen des 12. Juli in ihrem Hotelbett. Langston war von ihrem Heimatort Surrey extra nach New York City gereist, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen.
Ihre Fans sind erschüttert. Was zum plötzlichen Tod der Schauspielerin führte, ist noch unklar, aber erste Aussagen versichern: Es war Mord!
Eine Angestellte sagt: »Ihr Gesicht war völlig verzerrt. Die arme Frau sah aus, als hätte sie bis zum Schluss gekämpft.«
Ein Hotelgast, der im selben Stock wie Edith Langston wohnte, bestätigt, dass er aus der Richtung ihres Zimmers laute Stimmen gehört habe. Für ihn besteht kein Zweifel, dass mehr als ein natürlicher Tod dahinterstecken muss. »Da war eine Menge Krawall. Es klang, als wollte jemand in ihr Zimmer. Und anscheinend ist es ihm auch gelungen.«
Sind das alles nur Spekulationen oder könnte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass der Schatten eines Leichenwagens auf die prächtige Fassade des Hotels Van Day fiel. Erst vor zwei Jahren sorgte das Luxushotel an der Madison Avenue für große Schlagzeilen, als der Hotelbesitzer Albert Van Day (79 †) in einem seiner eigenen Hotelzimmer verstarb. Der Pressesprecher gab Altersschwäche als Grund bekannt, doch mit dem aktuellen Tod der millionenschweren Schauspielerin Langston rückt alles in ein neues Licht. Zwei reiche Menschen, die in beinahe demselben Hotelzimmer starben. Handelt es sich hier nur um einen Zufall? Oder besteht zwischen den Toden möglicherweise ein Zusammenhang?
Fassungslos starre ich auf den Artikel und spiele mit dem Gedanken, ihn nur deshalb auszudrucken, um ihn anschließend dramatisch zusammenzuknüllen und in den Müll zu werfen. Bislang war jeder Beitrag dieser Art auf seine Weise lächerlich, aber bei diesem hier fehlen mir wahrhaft die Worte. Ein Mord? Ein Serienmord? Die arme Edith Langston hatte einen Herzinfarkt, und jetzt bauscht die Klatschpresse ihren Tod zu einem Skandal auf?
Ihre Fans sind erschüttert. Ähm, und was ist mit den Freunden und Angehörigen, die sich neben dem Verlust auch noch mit diesen Artikeln herumschlagen müssen?
»Du liest dir das Zeug immer noch durch?«
Ich zucke zusammen und drehe den Kopf zu meinem neuen Mitarbeiter Emory. Er ist groß und schlaksig, hat silbern gefärbtes Haar, das in alle Richtungen absteht, und immerzu ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Genau wie ich trägt er einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd, dunkelblauer Weste und einer goldenen Krawatte. Wir waren schon öfter zusammen an der Rezeption, doch heute sind wir beide in der Nachtschicht und kommen zum ersten Mal dazu, richtig miteinander zu reden.
»Ja, ich kann nicht anders«, grummele ich und werfe der mit Fotos und Werbung überladenen Klatschseite einen finsteren Blick zu. »Es macht mich einfach so sauer.«
Eine Woche ist es schon her, seit Edith Langston verstorben ist, und dank dieser immer noch andauernden Schlagzeilen, ist die Zahl der Stornierungen um fast dreißig Prozent gestiegen. Etliche Gäste, die nicht mehr herkommen wollten, weil im Internet dieser Unsinn erzählt wird. Genau dasselbe Drama hatten wir schon vor zwei Jahren nach dem Tod von Grandpa Al. Wochenlang lungerten Reporter vor dem Eingang herum, schrieben vom Mord im Luxushotel und dachten sich die wildesten Geschichten aus. Und jetzt passiert es schon wieder.
Dabei verstehe ich den Trubel nicht, denn so grausam es klingt: Menschen sterben – auch in Hotels. Es ist traurig, aber nicht unüblich. Warum macht die Presse gleich einen solchen Eklat daraus?
Emory wirft einen Blick über meine Schulter und überfliegt die Zeilen.
»In beinahe demselben Hotelzimmer«, zitiert er lachend. »Okay, erklär mir das: Wie kann ein Hotelzimmer denn beinahe dasselbe sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.«
»Abgesehen davon hatte Edith Langston ihr Zimmer im zwölften Stock und Grandpa Al ein Penthouse im vierzehnten.«
Von wegen beinahe dasselbe Zimmer.
Emory hebt überrascht die Augenbrauen. »Grandpa Al?«
»Oh. Ich meine natürlich Albert Jr. Van Day.« Hitze steigt mir in die Wangen. »Und außerdem ist das überhaupt kein richtiger Journalismus!«, setze ich, in der Hoffnung, das Thema zu wechseln, hinterher. »Ich meine, klar, so etwas wie den einen Journalismus gibt es nicht, aber wenn die Schreibenden schon nicht neutral bleiben, könnten sie sich doch zumindest an die Fakten halten, und ihre Quellen ordentlich überprüfen.«
»Aber irgendwer meinte doch, dass ihr Gesicht wirklich verzerrt war«, wendet Emory ein.
»Das stimmt nicht«, schnaube ich. »Verstorbene haben keine Muskelspannung mehr und Louisa hat gesagt, dass sie einfach so aussah, als hätte sie friedlich geschlafen.« Meine Hand schließt sich fester um das Gehäuse der Maus. »Diese Person hat ganz eindeutig gelogen.«
»Okay, aber was ist mit den lauten Stimmen vor ihrer Tür?«
Verstört drehe ich mich zu ihm und bedenke ihn mit einem »Ist das dein Ernst?«-Blick. »Sag bloß, du glaubst den Kram, der dort steht?«
»Nein, aber …« Er richtet seine Krawatte und zuckt mit den Schultern. »Ich mein ja nur.«
»Es gab einen Junggesellenabschied im selben Stockwerk, der für den Lärm verantwortlich war«, kläre ich ihn auf. »Und bei einem großen Star wie ihr wurden die Kameraaufzeichnungen tausendmal überprüft. Es war nichts und niemand zu sehen. Aber das wird natürlich nirgendwo erwähnt. Der Artikel ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Scheiß auf die Wahrheit, scheiß auf die trauernden Angehörigen. Hauptsache, die Headline sorgt für genug Klicks.«
Emory fährt sich durch den silbernen Schopf und macht ein nachdenkliches Gesicht. »Hast du eine Ahnung, wer die Zitate gegeben haben könnte?«
Ich schüttele den Kopf. Louisa hat Edith Langston gefunden, aber sie hätte niemals geplaudert, und auch sonst niemand von den Reinigungskräften, da bin ich sicher. Überhaupt könnte ich es mir bei keinem vorstellen, nicht einmal bei Tratschonkel Dennis.
»Ich hoffe, dass sich der Trubel bald legen wird«, seufze ich und bewege die Maus, um die vielen offenen Fenster zu schließen.
Detective-Crime-Star Edith Langston tot. Warum schweigt die Familie?
Noch ein Todesfall im Hotel Van Day! Hat der Serienkiller wieder zugeschlagen?
Nach Langston-Tragödie: Spukt es im Hotel Van Day?
»Ha, der mit dem Geist war echt witzig«, gluckst Emory, der mir noch immer über die Schulter schaut.
»War er nicht«, grummele ich. »Hier spukt kein Geist.«
»Hey, das ist doch nur Gossip«, winkt er ab und gähnt einmal tief. Bis drei Uhr halten die meisten von uns noch durch, aber früher oder später setzt die Müdigkeit bei allen ein. Ich hingegen bin hellwach. Diese Artikel sind wie ein Bad in eiskaltem Koffein.
»Und noch dazu von der lächerlichsten Sorte«, fährt Emory fort. »Warum regst du dich so darüber auf?«
»Weil ich nicht will, dass jemand schlecht über dieses Hotel redet«, murmele ich und lehne mich mit dem rechten Arm gegen den Tresen der Rezeption, während ich den Blick über die geschwungene Decke der Hotellobby wandern lasse. Worte können nicht beschreiben, wie viel mir dieser Ort bedeutet.
»Warte.« Irgendwas in seinem Kopf scheint einzurasten. »Bist du etwa die, die mit ihrer Mutter hier wohnt? Der Köchin?«
Ich verkneife mir ein Lächeln. »Offenbar eilt mir mein Ruf voraus. Lass mich raten: Dennis hat von mir erzählt?«
»Dennis«, bestätigt Emory und wir beide lachen los.
»Glaub dem ja nichts«, warne ich und deute auf den Computerbildschirm. »Er ist die Personifizierung solcher Artikel. Was auch immer er sagt, du musst immer dreißig Prozent davon abziehen.«
»Also seid ihr keine Schnorrer, die auf Kosten des Hotels in einer pompösen Suite leben?«, stichelt Emory und ich verdrehe die Augen. Typisch Dennis. Ich mag unseren Front Desk Manager eigentlich, allerdings ist es kein Geheimnis, dass er ein Problem damit hat, dass meine Mom und ich im Hotel ein paar Privilegien genießen. Aber dass er immer gleich so übertreiben muss …
»Nein. Wir wohnen zwar hier, aber wir zahlen Miete.«
Und sonderlich pompös ist unsere Angestelltenwohnung auch nicht …
»Jetzt macht auch der Spruch mit ›Grandpa Al‹ mehr Sinn. Ich hab mich schon gewundert, warum es so klang, als würdest du ihn kennen. Wow.« Emory macht ein ehrfürchtiges Gesicht. »Stimmt es, dass du schon hier lebst, seit du ein Kind warst?«
Ein warmes Gefühl durchflutet meinen Körper. »Ja, das stimmt.«
»Und wie war es so?«, fragt er und streckt den Rücken durch, der ein lautes Knacken von sich gibt.
»Es war …« Mit den Fingern fahre ich über das polierte Holz des Tresens und suche eine Weile nach dem richtigen Adjektiv. »Märchenhaft«, flüstere ich und spüre, wie meine Wangen sich röten.
»Aww.« Emory hält sich eine Hand ans Herz. »Ich sehe es genau vor mir. Klein Ellis schreitet über den glänzenden Marmorboden und weiß gar nicht, wo sie zuerst hinsehen soll.« Er öffnet staunend den Mund und tut so, als würde er alles verzückt beobachten.
Ich pruste los und halte mir schnell eine Hand vor den Mund, weil mein Lachen als Echo in der leeren Lobby widerhallt. »So war es wirklich«, flüstere ich. »Ich meine, da ist ein riesiger Springbrunnen in der Lobby!«, sage ich und deute auf besagte Sandsteinkonstruktion, von der selbst aus der Ferne noch sanftes Wasserplätschern zu hören ist. »Und überall diese Art-Deco-Möbel.« Mein Blick wandert hinter dem Springbrunnen vorbei zu den Sesseln, die mit rotem Samt bezogen sind, eine gefächerte Lehne haben und auf goldenen Messingfüßen stehen. Vor ihnen niedrige Glastische, die ebenfalls dünne Metallbeine haben. »Es war so klassisch und zugleich modern«, rede ich ohne Halt weiter. »Gatsby trifft auf Renaissance.« Erneut hebe ich den Kopf zur stuckverzierten Decke und muss lächeln. Das mochte ich schon immer am Hotel – das Zusammenspiel beider Strömungen; ein Hotel, das von einem französischen Architekten mit symmetrischen Proportionen, gebogenen Decken und weiteren Renaissanceeinflüssen entworfen und in den Zwanzigern von einer amerikanischen Designerin mit farbenfrohen Möbeln und ausdrucksstarken Tapeten eingerichtet wurde.
»Alles war so schön und prächtig. Ich habe mich gefühlt wie in einem Schloss.«
»Das Schloss von Manhattan«, zitiert Emory den alten Kosenamen, der seinen Ursprung in den frühen Zwanzigern fand. In unserem Souvenirshop finden sich noch Postkarten mit dem damaligen Slogan.
»Genau!«
»Aber ist das Leben auf Dauer nicht langweilig geworden?«
Überrascht ziehe ich die Stirn kraus. »Wie meinst du das?«
»Na ja, Urlaub ist doch nur deshalb so schön, weil er … du weißt schon.« Er macht eine vage Geste. »Urlaub ist. Irgendwann endet er, und das macht die Zeit, die einem bleibt, umso kostbarer. Aber sobald der Alltag eintritt, wird alles zur Normalität. Und dann sehnt man sich doch automatisch nach etwas Abwechslung, oder?«
Ich schüttele den Kopf. »Nicht bei diesem Hotel. Wenn du einmal hier bist, willst du nie mehr weg. Wirklich«, beteuere ich, obwohl ich das eher selten mache. Prahlen, meine ich. Ich weiß, welches Vorrecht ich genieße, in einem Luxushotel wohnen zu dürfen, während andere keinen bezahlbaren Fleck in dieser Stadt finden. Deswegen erzähle ich auch fast niemandem von meiner besonderen Adresse, auch nicht den neuen Hotelmitarbeitenden, die es früher oder später allerdings sowieso immer von Dennis erfahren. Manche begegnen mir deshalb mit Missgunst, und das Schlimmste ist, dass ich es ihnen nicht einmal verübeln kann. Es ist verdammt unfair.
Andererseits wissen sie auch nicht, dass meine Wohnsituation gerade die einzige Stabilität in meinem Leben ist. Der Rest ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen.
»Aber war es trotzdem nicht etwas öde, so ganz ohne andere Kinder?«, fragt Emory weiter. »Die meisten Gäste, die herkommen, sind doch eher älter, oder?«
Ein plötzlicher Druck senkt sich auf meine Brust. »Es war nicht langweilig. Und … es gab Kinder«, füge ich stockend hinzu, während ich den Blick durch die Lobby schweifen lasse, durch die Ryan und ich immer gejagt sind. Meine Kehle schnürt sich zu. Ein Teil von mir hatte gehofft, dass er dem Hotel nach seinem Highschool-Abschluss einen Besuch abstatten und erst dann nach Harvard gehen würde, aber meine Hoffnungen waren vergebens. Und ich werde den Gedanken nicht los, dass er meinetwegen nicht kommt. Um mich nicht zu sehen.
Weil er wirklich nichts mehr mit mir zu tun haben will.
2. KAPITEL
»Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt«, sage ich, während ich mir im Badezimmer einen Fischgrätenzopf flechte. Der goldene Rand des Spiegels rahmt mein Gesicht ein, und wenn ich mich nicht bewege, könnte es den Anschein haben, als sei mein Spiegelbild mit den edlen Badfliesen im Hintergrund ein Porträt aus einem vergangenen Jahrhundert.
»Also wollte ich der Sache nachgehen«, fahre ich fort und lasse kurz von meinen Haaren ab, um meine Finger zu strecken.
»Was war dabei Ihr Ziel?«, fragt die Stimme namens Jimmy in meinem Kopf. »Wollten Sie die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen?«
»Ja, das natürlich auch, aber als Journalistin ging es mir hauptsächlich darum, die Wahrheit zu berichten.«
»Und wie kam es dazu, dass sie schon ganz am Anfang, noch vor allen anderen einen Verdacht hatten?«
»Ich liebe Rätsel und Geheimnisse und würde sagen, dass ich schnell erkenne, wenn mir etwas unschlüssig erscheint. Schon als Kind ging ich gern Dingen nach und …«
Plötzlich wird die Tür aufgerissen, und der Rest des Satzes bleibt in meiner Kehle stecken. Meine Mutter platzt herein und trägt bereits ihre weiße Kochuniform. Die braunen Haare sind zu einem strengen Dutt geknotet. Als ihr Blick auf mich fällt, hebt sie eine Augenbraue. »Führst du schon wieder Interviews mit dir selbst?«
Hitze schießt mir in die Wangen. »Mom! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du vorher anklopfen sollst?«
Sie grinst. »Wer war es diesmal? Jimmy Fallon?«
Ich winde mich innerlich. »Kannst du bitte gehen?«
»Also ja.« Ihre Lippen zucken. »Erklär mir nur noch, warum eine Journalistin zu einer Late Night Show eingeladen wird?«
Ich schließe die Augen und atme tief durch. »Weil ich einen berühmten Fall aufgedeckt habe, und dieser verfilmt wurde.«
»Aufgedeckt? Du bist also nicht nur Journalistin, sondern auch Detektivin.«
»Mom!«, stöhne ich und versuche die Tür zu schließen, aber sie stemmt ihre Hand dagegen.
»Ich muss da auch rein. Und du solltest raus. Aus dem Hotel, meine ich«, setzt sie hinterher und deutet hinter sich. »Seit Tagen hockst du nur hier rum.«
»Na und?« Ich marschiere an ihr vorbei in mein Zimmer. Meine Mutter und ich teilen uns die bescheidene Angestelltenwohnung mit zwei Schlafzimmern und einem kleinen Wohnbereich. Die Wohnung ist spärlich eingerichtet, hat einen Wasserschaden an der Badezimmerdecke, und ist auch an anderen Stellen sanierungsbedürftig. Aber da wir hier zu einer äußerst bezahlbaren Miete wohnen dürfen und unser Geld gerade ohnehin sehr knapp ist, beschweren wir uns nicht.
»Geh doch mal ein bisschen frische Luft schnappen. Setz dich in ein Café und iss eine Kleinigkeit.«
»Ich kann doch auch hier was essen«, entgegne ich und lasse mich auf mein ungemachtes Bett plumpsen.
Mom folgt mir und lehnt sich gegen meinen Türrahmen. Sie sieht müde aus, was kein Wunder ist, weil sie seit dem »Vasen-Fiasko« vor zwei Monaten rund um die Uhr arbeitet.
»Bitte, Liebling«, sagt sie und als sie ihren wehleidigen »Tu’s für mich«-Gesichtsausdruck auspackt, knicke ich ein. Wenn es sie so glücklich macht …
»Meinetwegen«, grummele ich, und lasse mich von ihr hochziehen, obwohl ich mich viel lieber mit einer Serie zurück ins Bett kuscheln will. Auf dem Weg zur Tür schnappe ich mir Laptop und Ladegerät und stopfe beides in meine Tasche. Ohne gehe ich nie aus dem Haus. Zwar bezweifle ich, dass ich zum Schreiben kommen werde, aber man weiß ja nie, wann einen die Inspiration packt.
»Aber komm nicht erst in der Dunkelheit nach Hause«, ruft Mom, als ich gerade dabei bin, in meine Schuhe zu schlüpfen. »Und nimm später den Haupteingang.«
Ich unterdrücke ein Lachen. Das wandelnde Paradoxon namens Mutter. Erst will sie mich nach draußen drängen und dann wieder hinein.
Sie hat ja recht, denke ich, während ich die Tür hinter mir schließe. Seit über einer Woche war ich nicht mehr draußen. Ich arbeite im Hotel, esse im Hotel, und wenn mir danach ist, mir die Beine zu vertreten, steige ich ein paar Treppen auf und ab. Armselig, ich weiß. Aber seit die Highschool vorbei ist, und meine Freunde Deb und Rahim verreist sind, finde ich immer weniger Gründe, um das Hotel zu verlassen.
Im Flur treffe ich Louisa, die einen Rolly vor sich herschiebt. Sie arbeitet im Housekeeping und ist der so ziemlich liebste Mensch auf der Welt. Da sie etwas älter als meine Mutter ist, war sie für mich immer wie eine Tante.
»Schätzchen«, begrüßt sie mich in einem streng-mütterlichen Tonfall. »Arbeitest du etwa schon wieder?«
»Nein, ich gehe eine Runde spazieren.«
»Wirklich?« Ihre linke Augenbraue verschwindet unter ihrem schwarzen Pony, der von vereinzelten grauen Haaren durchzogen ist. »Zwingt dich Kelly?«
Erneute Hitze steigt mir ins Gesicht. »Was … nein, ich … ich will einfach nur raus!«
»Natürlich.« Sie lächelt wissend, belässt es jedoch dabei. »Viel Spaß. Und wenn du willst, kannst du dich später noch dem Bingo-Abend anschließen.«
Der Bingo-Abend findet ein- bis zweimal die Woche im Pausenraum statt, und entstand zu einer Zeit, in der Bingo noch cool war. Heute werden statt Bingo meistens irgendwelche Kartenspiele gespielt, und mitmachen können alle, die Lust haben. Es ist ein schönes Event, um außerhalb der Arbeit mit Kollegen zusammenzukommen, zu reden, zu trinken und zu spielen. Eigentlich bin ich immer gern dabei, aber heute fehlt mir die Energie für die Interaktion mit so vielen Menschen, deshalb lehne ich dankend ab.
Ich verabschiede mich von Louisa, drücke mich an ihr und dem Rolly vorbei und laufe in Richtung der Personalaufzüge. Unten angekommen nehme ich wie üblich einen der hinteren Ausgänge, der mich an der 61st Street rausbringt. Im Schlendertempo spaziere ich die Straße runter, biege in die Madison Avenue ein und genieße jeden Schritt in meinen Sneakers, die so viel bequemer sind als die schwarzen Trotteurs, die ich während des Arbeitens tragen muss. Ich habe kein wirkliches Ziel, folge einfach nur dem glühenden Lichtball der untergehenden Sonne, der sich zwischen den immer größer und dichter werdenden Wolkenkratzern hindurchquetscht, und den Himmel in ein warmes Orange taucht.
Als ich an einer Ampel zum Stehen komme, höre ich mein Handy in der Tasche klingeln, und noch ehe ich den Namen lese, weiß ich, dass es mein Vater ist. Niemand sonst ruft mich unangekündigt an. Ein paar Atemzüge lang betrachte ich sein Gesicht, das immer auf dem Display erscheint, wenn er anruft. Es ist ein altes Foto, vor vier oder fünf Jahren aufgenommen, als ich ihn in San Francisco besucht habe. Zu gern würde ich abheben und seine vertraute Stimme hören, doch ich zögere. Ich musste Mom schwören, dass ich ihm auf keinen Fall erzähle, dass sie bei einem privaten Catering-Auftrag im Esszimmer des Kunden versehentlich eine hundertachtzigtausend Dollar teure Vase zerbrochen hat, die sie – wir – nun schweren Herzens abbezahlen müssen. Dad hat die Angewohnheit, jedem seine Hilfe aufzudrängen, und obwohl wir sie diesmal gut gebrauchen könnten, ist Mom zu stolz (und stur), um die Almosen ihres Ex-Mannes anzunehmen. Andererseits kann, nein, will ich Dad auch nicht anlügen.
Sein Bild verschwindet wieder, und ich seufze tief, ehe ich das Handy wieder einstecke. Gar nicht mit ihm zu reden ist auch keine Lösung, aber noch ist mir keine bessere Alternative eingefallen.
Drei Blocks später spüre ich, wie meine Beine bereits schwer werden. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, wieder kehrtzumachen, doch dann entscheide ich mich, irgendwo was essen zu gehen. Vielleicht Pizza?, überlege ich, verwerfe den Gedanken allerdings sofort wieder. Ich hätte zwar schon Lust auf eine leckere Calzone bei Alfredo’s, aber es käme mir wie Verrat vor, ohne Ryan in unser Stammlokal zu gehen. Auch, wenn ich beinahe fürchte, dass es ihm ohnehin egal wäre.
Weil ich ihm egal bin.
Stattdessen setze ich mich ins nächstbeste Deli, und bestelle mir einen schwarzen Kaffee und einen Bagel mit Cream Cheese. Es ist mein erstes Essen heute; wegen der Nachtschicht gestern habe ich den ganzen Tag verschlafen, und bin erst vor zwei Stunden aufgewacht. Mein Magen knurrt, als mir der Duft des getoasteten Brots in die Nase steigt.
Während ich esse, beobachte ich die Leute, die am Lokal vorbeigehen. Hauptsächlich Touristen – man erkennt sie daran, dass sie viel langsamer laufen, und jeden Winkel der Stadt fotografisch festhalten. New Yorker schauen sich nie wirklich um, stürmen einfach an einem vorbei, weil sie es immer eilig haben.
Dann sehe ich einen Mann, und mir bleibt kurz das Herz stehen. Es ist nicht Ryan, er sieht ihm bis auf das schwarze Haar nicht einmal ähnlich, aber seine Gangart – schlurfende Schritte, leicht nach vorn gekrümmte Schultern …
Hastig nehme ich einen Schluck Kaffee und versuche, die aufkommende Sehnsucht runterzuspülen. Durch den Hoteltratsch habe ich erfahren, dass die ganze Familie Van Day gerade auf den Bahamas ist. Am Strand sonnen und Cocktails schlürfen. Ein Geschenk zum Schulabschluss – Ryan soll angeblich Jahrgangsbester gewesen sein – oder vielleicht eher Drittbester, wenn man bedenkt, dass ich die Info von Dennis habe.
Trotzdem – zu gern würde ich ihm gratulieren und ihm sagen, wie sehr er es verdient hat, doch nach meinen erfolglosen Versuchen, unsere Beziehung zu kitten, vermute ich, dass er mir nicht einmal antworten würde.
Der Typ mit dem Ryan-Gang verschwindet um die Ecke, und plötzlich frage ich mich, was passieren würde, wenn wir uns durch Zufall auf der Straße begegneten. Würden wir uns freundlich begrüßen und ein bisschen Small Talk führen? Oder würden wir wie Fremde einfach aneinander vorbeigehen und so tun, als hätten wir uns nicht gesehen?
Seufzend stütze ich das Kinn auf die Handfläche und schaue nach draußen. Beobachte, wie es immer dunkler wird, und spüre mit jedem Atemzug, wie auch in mir eine Düsternis aufzieht. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so selten rausgehe. Die Wände des Hotels sind wie ein Schild, das meine Sorgen und Ängste abschirmt. Aber hier draußen bin ich ihnen schutzlos ausgeliefert. Manhattan ist laut, doch meine Gedanken sind lauter. Sie schreien mich förmlich an, erinnern mich daran, dass ich von nun an allein bin. Ryan ist weg, Rahim geht für ein Jahr nach Europa, und auch Deb wird ab September an der UPenn studieren. Alle verlassen mich, und die Einsamkeit ist leichter zu ertragen, wenn ich sie in Arbeit ersticke. Im Hotel habe ich wenigstens das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Geld verdienen, um Mom mit den Schulden zu helfen, die sie ohne meine Hilfe unmöglich allein abbezahlen kann. Meine Mutter denkt, dass ich nach der Highschool sowieso erst mal eine Pause vom Büffeln brauche, andernfalls hätte sie niemals zugelassen, dass ich ihretwegen meine Zukunftspläne über Bord werfe. Tue ich ja nicht. Nächstes Jahr werde ich studieren. Zwar nicht an der Columbia, die mich zwar wider aller Erwartung tatsächlich genommen, mir jedoch kein Stipendium angeboten hat. Es war hart, weil ich schon mit einem Bein drin war und es um ein Haar geschafft hätte, in meine Traumuni zu kommen. Aber sechsundsechzigtausend Dollar Semestergebühren fallen nun mal nicht vom Himmel, daher gehe ich an die University of Pennsylvania, die mir ein Stipendium gegeben hat. Nicht meine erste Wahl, nicht New York, aber es ist trotzdem eine der renommiertesten Universitäten des Landes, die mich trotz ihrer sechsprozentigen Zulassungsrate angenommen hat. Und immerhin wird Deb auch dort studieren.
Allerdings werden wir einen Jahrgang voneinander getrennt sein. Wir werden keine Einführungskurse zusammen belegen, nicht auf Erstsemesterpartys gehen oder zusammenziehen …
Weil das Leben dazwischengekommen ist.
Die meiste Zeit über versuche ich, mir einzureden, dass es okay ist. Dass ich keinen Grund habe, mich zu beschweren, dass ich das Hotel liebe, gern dort arbeite und jeden Tag neue Erfahrungen sammele. Und es stimmt auch. Aber hier draußen, in der Wirklichkeit, schwappt die Welle des Frusts trotzdem über mich herein, droht mich niederzureißen. Tränen brennen mir in den Augen, und mit einem Mal kann ich keine Minute länger ganz allein in einem Deli hocken. Schnell hänge ich mir meine Tasche um und trete mit einem schweren Druck auf der Brust nach draußen.
Die alten Stuckfassaden erstrahlen im letzten Licht der Sonne, sodass es sich sogar schon aus der Ferne von den anderen Gebäuden abhebt: Hotel Van Day. Große goldene Letter, die leuchtend über dem Eingang zu schweben scheinen. Darunter ein roter Teppich, der das Eintreten noch prächtiger macht. Mein Blick wandert höher, zu den vielen Reihen bodentiefer Fenster mit französischen Balkonen. Das Dach ist in der Dunkelheit nicht zu erkennen, dabei gefallen mir die kleinen Türmchen und halbrunden Fenstern dort schon immer am besten. Ich spüre, wie mein Puls abflaut. Ich kann noch so aufgebracht sein, der Anblick des Hotels bringt mich jedes Mal wieder runter und lenkt den Fokus nicht auf das, was weg ist, sondern auf das, was ich habe. Ein wunderschönes Zuhause.
»Hey, ihr zwei«, begrüße ich Levi und Gonzales, die heute am Eingang die Stellung halten.
»Hey, Kleines. Hat deine Mom wieder gesagt, du sollst abends durch den Haupteingang rein?« Levi grinst.
»Wer sonst?«, seufze ich, und die beiden lachen, als hätten sie einen alten Witz gehört. Was irgendwie sogar der Fall ist, denn Mom tut immer so, als würde sich die Upper East Side bei Nacht in Sin City verwandeln.
»Wie läuft’s so?«, erkundige ich mich. Augenblicklich verdüstern sich ihre Mienen.
»Du meinst, bis auf die Tatsache, dass den ganzen Tag Leute kamen, weil sie ein Foto vom Mordhotel machen wollten?«, schnaubt Gonzales. Schockiert reiße ich die Augen auf. »Wie bitte?«
»Den ganzen verdammten Tag«, pflichtet Levi ihm bei und ich schüttele fassungslos den Kopf. Wie viele Leute lesen eigentlich diesen Gossip-Scheiß?
»Wie sollt ihr damit umgehen?«, frage ich.
»Einfach ignorieren«, sagt Gonzales. »Die Chefin glaubt, dass es schneller vorbeigeht, wenn wir dem Rummel so wenig Beachtung wie möglich schenken.«
»Aber ist das wirklich die richtige Lösung? Wäre es nicht klüger, sich als Hotel in irgendeiner Weise zu positionieren?«
Zu dritt unterhalten wir uns über das Für und Wider, und regen uns gemeinsam über die Menschen auf, die keinem Klatsch widerstehen können. Dann verabschiede ich mich von den beiden und nehme die steinernen Treppen zur Lobby. Auf der letzten Stufe komme ich jedoch automatisch zum Stehen, denn – woah! Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr den Haupteingang genommen und völlig vergessen, wie atemraubend der Anblick der Lobby von hier ist. In ihrer Mitte ragt der Springbrunnen auf, eine schmale verzierte Säule, deren Basis ein Sockel aus Sandstein bildet. Die darüberliegenden Ebenen sind mit Figuren aus dunklem Messing verziert und verjüngen sich leicht bis zu seiner eleganten Spitze. Am Ende der Eingangshalle führen geschwungene Wendeltreppen in den ersten Stock, dort, wo sich die meisten Veranstaltungsräume befinden. Die kuppelartige Decke ist stuckverziert und bereits ein Kunstwerk für sich.
Ich laufe um den Springbrunnen herum, vorbei an den edlen Sesseln und dazugehörigen Tischen, und mit jedem Schritt, den ich gehe, spüre ich, wie sämtliche Sorgen von mir abfallen. Der Schutzschild des Hotels zieht sie zurück, setzt sie vor die Tür und gewährt ihnen keinen Zugang.
Worüber rege ich mich eigentlich so auf? Ich wohne hier und liebe alles daran, sogar die viele Arbeit. Sogar die Tatsache, dass mich jeder Winkel an Ryan erinnert. Dann verzögern sich meine Zukunftspläne eben um ein Jahr! Die Zeit wird so schnell vorbeigehen, dass ich es kaum merken werde, und außerdem tue ich etwas Gutes. Ich helfe Mom und bleibe für sie hier, genau wie sie damals für mich geblieben ist.
Auf dem Weg zu den Aufzügen winke ich Emory zu, der mit dem Telefon in der Hand an der Rezeption steht und aussieht, als würde er gerade von dem Anrufenden angeschrien werden. Dennis, der mit seinen roten Haaren und dem hellen Schnurrbart ein bisschen was von Garfield hat, hält die Hände vor der Brust verschränkt und macht ein »Damit musst du jetzt allein klarkommen«-Gesicht. Armer Emory. Zu gern würde ich ihm zu Hilfe eilen, aber das würde Dennis ohnehin nicht zulassen. Ich glaube, er ist einer dieser Menschen, der seinen Kindern das Schwimmen beibringt, indem er sie einfach gnadenlos ins Wasser wirft. Als Dennis kurz wegguckt, recke ich beide Daumen in die Höhe und forme mit dem Mund ein lautloses »Du packst das!«
Emory lächelt schwach, hält sich die Finger wie eine Knarre an die Schläfe, und als Dennis wieder den Kopf hebt, unterbrechen wir schnell den Blickkontakt.
Bei den Aufzügen angekommen, spiele ich mit dem Gedanken, noch einen Abstecher ins Kimberly’s zu machen, das Hotelrestaurant, in dessen Küche Mom arbeitet. Ich könnte mich zu ihr schleichen und mir etwas von dem Trüffeltiramisu stibitzen, das heute auf der Karte steht. Und wenn wir schon dabei sind, auch das Mango Panna Cotta. Wasser läuft mir im Mund zusammen und ich will gerade wieder kehrtmachen, als das vertraute Pliing ertönt, sich die Türen öffnen und meine Pläne in einem grellen Blitz des Schocks zersplittern.
Ryan steht im Aufzug. Mir klappt die Kinnlade runter. Genau wie ihm. Sekundenlang starren wir uns an, rühren uns nicht, blinzeln nicht. Mein Herz hämmert in der Brust, während tausend Gedanken, tausend Gefühle auf mich einstürmen.
Dann schließen sich die Türen des Aufzugs wieder, und als Ryan aus meinem Sichtfeld verschwindet, blinzele ich und frage mich, ob er es wirklich gewesen ist. Ryan, mein Ryan, kein Doppelgänger mit ähnlichen Haaren oder seiner Gangart. Aber wie kann das sein? Müsste er nicht auf den Bahamas sein? Und hat er wirklich …
Mit pochendem Herzen drücke ich erneut auf den Knopf, und als sich die Aufzugtüren kurz darauf öffnen, ist der Aufzug leer. Doch ein bekannter Geruch schwebt nach wie vor in der Kabine, und mir dreht sich der Magen um. Es ist der unverkennbar würzige Duft der Calzone von Alfredo’s, deren Pizzaschachtel er vorhin in der Hand balanciert hat.
Damals
Ryan, acht Jahre alt
Alle im Hotel sagen, dass ich ein einsamer Wolf bin, weil ich oft allein rumhänge. Aber das heißt nicht, dass ich gern allein bin. Die meisten gehen nicht auf mich zu, weil sie mich nicht zu sehen scheinen, und ich … traue mich nicht. Es ist schwierig, und ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll oder was ich sagen darf, um keinen Fehler zu machen. Außerdem mögen viele sowieso Sam lieber. Wer auch immer sie kennenlernt, ist begeistert von ihr und vergisst mich direkt wieder. Von mir ist niemand begeistert.
Na ja, außer Ellis. Ich glaube, sie mochte mich. Aber vielleicht habe ich sie neulich im Aufzug verschreckt, denn in den letzten zwei Wochen habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Ihren Eltern bin ich öfter über den Weg gelaufen, nur sie schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein.
Bis jetzt. In diesem Moment tritt ein brauner Lockenkopf durch den Eingang des Kimberly’s, und als ich sie sehe, spüre ich, wie eine unerklärliche Anspannung von mir abfällt.
Ellis schaut sich mit offenem Mund nach allen Seiten um, und beim Anblick ihres entzückten Gesichts muss ich unwillkürlich lächeln. Diesmal kann ich ihre Begeisterung sogar verstehen. Das Restaurant sieht mit dem Mosaikboden, den Steinsäulen und Kronleuchtern ziemlich schick aus.
Als sie den Blick suchend durch die Menge wandern lässt, glaube ich eine absurde Sekunde lang, dass ich es bin, den sie finden will. Doch dann steuert sie die Tür zur Küche an. Vermutlich will sie zu ihren Eltern.
»Ellis«, höre ich mich plötzlich sagen und sinke verlegen in meinen Stuhl, als sich einige Köpfe in meine Richtung drehen. Dabei habe ich mir extra den Tisch in der Nische geschnappt, um vor den Blicken der anderen geschützt zu sein. Aber ich wollte Ellis nicht schon wieder verpassen.
Warum eigentlich?
Ellis bleibt abrupt stehen, dreht den Kopf zur Seite, und als unsere Blicke sich treffen, weiten sich ihre Augen. Einen kurzen Moment lang steht sie unschlüssig da, dann setzt sie sich langsam in Bewegung und schlängelt sich an einer Topfpalme vorbei zu meinem Tisch.
»Hey, Ryan«, sagt sie leise und hebt die Hand, in der sie irgendeinen weißen Stoff umklammert hält.
Ich lächele befangen. »Hey.«
Kurz herrscht Schweigen zwischen uns.
»Ich, ähm … hab dich lange nicht mehr gesehen«, beginne ich.
»Ich weiß.« Ellis sieht sich um, als wäre sie auf der Hut. »Meine Mom hat gesagt, ich soll dich nicht nerven«, flüstert sie.
»Was?« Ich richte mich auf.
Sie ist mir aus dem Weg gegangen?
»Das musst du nicht. Du … also … nervst mich nicht«, stammele ich und spüre, wie mein Kopf heiß wird.
Ellis’ Augen werden groß. »Wirklich?«
Ich nicke knapp, und sofort breitet sich ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. »Cool. Kann ich mich zu dir setzen?«
»Klar.«
Der Stuhl schabt über den Boden, als sie ihn zurückzieht und mir gegenüber Platz nimmt.
»Findest du diesen Tisch eigentlich auch so hübsch?«, fragt sie und legt das weiße Stoffding zur Seite, um mit den Fingern über den Tischrand zu fahren.
Lächelnd nehme ich die Gabel wieder in die Hand. Ellis ist wirklich leicht zu begeistern. »Wegen dem goldenen Rand?«
»Ja, es macht ihn so edel.«
Gerade will ich fragen, welcher Ort im Hotel ihr am besten gefällt, als ihr Blick auf mein Essen fällt. »Oh, du isst Moms Caesar Salad.«
»Deine Mom hat den gemacht?«, frage ich mit vollem Mund.
»Jepp.«
»Der ist richtig lecker!«, sage ich und schlucke den Bissen runter.
»Das liegt am Dressing – ihr Geheimrezept. Und das Brot für die Croutons backt sie immer selbst. Die Schüssel kann man übrigens auch essen.«
»Wirklich?« Ich senke den Blick auf die gelbe Schale, in dem sich mein Salat befindet.
»Ja, die besteht aus Parmesan.«
»Wow.« Jetzt verstehe ich erst recht, warum alle so von den neuen Köchen schwärmen.
»Möchtest du auch was?«, biete ich an, aber sie winkt ab. »Nein danke, ich habe vorhin schon was gegessen. Warum isst du ganz allein?«
Ihre Frage überrumpelt mich. »Ich, ähm … einfach so«, entgegne ich stockend und beschließe, schnell das Thema zu wechseln. »Wie gefällt es dir hier eigentlich?«, frage ich und breche mir ein Stück vom Parmesan ab.
»Es ist so schön«, seufzt sie und fährt wieder über den Tisch. »Ich bin jetzt schon traurig, dass wir bald wieder wegmüssen.«
Erschrocken lasse ich den Käse in meinen Salat fallen. »Ihr geht weg? Aber ich dachte … also, meine Mutter hat gesagt, ihr könnt so lange bleiben, bis ihr eine eigene Wohnung gefunden habt.«
»Nein, weg aus New York, meine ich. Wir sind zwar gerade erst hergezogen, aber mein Dad hat ganz spontan ein Jobangebot in Kalifornien bekommen.«
»Oh. Ach so«, murmele ich und verstehe nicht, warum da plötzlich ein seltsam stechendes Gefühl in meiner Brust ist. »Musste er deshalb schon weg?«
»Ja. Er hat dort ein Vorstellungsgespräch oder so.«
»Wird er es annehmen?«
Ellis macht ein unschlüssiges Gesicht. »Ich weiß es nicht, ich habe nur mitgekriegt, dass er und Mom sich am Telefon ziemlich doll gestritten haben. Eigentlich möchte sie bleiben. Sie mag New York und hat sich so gefreut, als sie eine Stelle in einem der beliebtesten Restaurants der Stadt bekommen hat. Und dann auch noch als Chefköchin. Außerdem mag sie das Hotel und ihre Kollegen. Aber vor allem will sie euch nicht hängen lassen.«
Mit hängen lassen meint sie vermutlich, dass wir ohne die beiden schon wieder kein gutes Küchenpersonal hätten.
»Ja, das wäre echt blöd«, sage ich und lege die Gabel zur Seite. Mit einem Mal ist mir der Appetit vergangen.
Sie blickt traurig auf den Tisch. »Ich will gar nicht weg von hier.«
Ich auch nicht.
»Ich liebe das Hotel. Und diese Stadt ist so cool.«
Ich muss an ihr Touristenshirt von neulich denken.
»Vielleicht überlegt dein Dad es sich ja noch anders«, sage ich aufmunternd.
»Hoffentlich.« Ihr Blick wandert zu meinem, und plötzlich richtet sie sich auf. »Hey, was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte: Warum wohnst du hier?«
Ich runzele die Stirn. »Wie meinst du das?«
»Meine Eltern haben gesagt, dass ihr hier auch eine Wohnung habt. Ist es normal, dass die Leute, denen das Hotel gehört, auch im Hotel leben?«
»Ach so. Nein, es stimmt zwar, dass wir oben eine Suite haben, aber eigentlich wohnen wir da nicht wirklich.«
Ellis hebt beide Augenbrauen. »Eigentlich?«
»Ja, unsere richtige Wohnung ist im Battery Park. Ganz unten am Wasser.«
»Aber ihr seid doch trotzdem oft hier, oder?«
»Ja, weil … meine Mom und mein Dad … also … sie verstehen sich nicht so gut«, sage ich leise. »Deshalb ist Mom oft hier, kümmert sich um Hotelkram, und …« Ich halte inne. Warum erzähle ich das alles?
Ellis’ Pupillen weiten sich. »Oh.«
»Das … darf ich eigentlich nicht verraten«, gebe ich kleinlaut zu.
»Keine Sorge, ich sag’s nicht weiter«, verspricht sie ernst und aus irgendeinem Grund glaube ich ihr.
»Vermutlich bin ich sowieso bald …«
»Ellis!«
Wir beide schrecken zusammen. Hinter Ellis entdecke ich Mrs Wheaton, die mit schnellen Schritten auf unseren Tisch zu stapft.
»Oh nein.« Ellis zieht eine Grimasse. »Sorry Mom. Ich habe mich mit Ryan verquatscht. Hier ist deine Kochmütze.« Schnell reicht sie ihrer Mutter den weißen Stoff.
Mrs Wheaton seufzt, und wieder einmal wird mir bewusst, wie sehr die beiden sich ähneln. Ihre Mom ist hübsch, denke ich, und plötzlich frage ich mich, ob ich Ellis auch hübsch finde.
»Du ärgerst ihn doch nicht etwa schon wieder?«, fragt sie an ihre Tochter gewandt.
»Nein, Ma’am!«, sage ich schnell und kriege plötzlich Angst, dass Ellis gehen muss.
Und ich wieder allein bin.
»Sie … ärgert mich nicht«, bringe ich heraus. »Sie … kann bleiben.«
Mrs Wheaton hebt die Augenbrauen und lächelt überrascht. »Okay, zunächst einmal musst du mich nicht Ma’am nennen. Kelly reicht aus, in Ordnung?«
Ich nicke knapp.
»Und wenn Ellis bleiben darf und das auch möchte – wovon ich stark ausgehe, weil sie die ganze Zeit nur von dir …«
»Mom!«, würgt Ellis ihre letzten Worte ab und Mrs Wheaton kichert, ehe sie ihrer Tochter sanft über den Kopf wuschelt. So zärtlich ist meine Mutter nie zu mir. Wenn mich jemand umarmt oder küsst, dann ist das eher Dad.
»Na gut, ich lasse euch beide dann mal wieder allein. Aber ich warne dich, junge Dame.« Sie wirft ihrer Tochter einen mahnenden Blick zu. »Wehe du beleidigst Ryan erneut.«
Ellis schaut grinsend zu mir rüber. »Solange er sich nicht wie ein Chauffeur benimmt.«
Ich muss lächeln. Ellis ist wirklich … speziell.
Ich greife nach meiner Gabel.
»Hey, Ryan?«, fragt sie, als ich mir den dritten Bissen in den Mund schiebe.
Ich schaue von der Schüssel auf. »Ja?«
Ellis beugt sich vor. Ihre Augen schimmern geheimnisvoll. »Wollen wir gucken, ob wir einen Eingang zu den Türmchen finden?«
3. KAPITEL
Gegenwart
Ellis
Das Schlimmste ist, dass er ohne mich bei Alfredo’s war. Drei Tage ist unser Aufeinandertreffen her, und noch immer versetzt mir die Erinnerung an die Pizzaschachtel in Ryans Hand einen enttäuschten Stich. Dass er sich nach seiner Rückkehr nicht bei mir gemeldet hat, ist die eine Sache, aber dass er allein zu Alfredo’s gegangen ist …
»Wheaton, hörst du mir überhaupt zu?«
Blinzelnd reiße ich den Kopf hoch und blicke zu Anitta, die den Rest der Servicekräfte in der kleinen Küche versammelt hat. Als Oberkellnerin trägt sie als Einzige von uns einen Anzug, und ist eine dieser Frauen, bei der man das Alter absolut nicht einschätzen kann. Ihr dunkler Haaransatz ergraut bereits, doch ihr Gesicht wirkt so jung und eben – sie könnte dreißig oder auch fünfzig Jahre alt sein.
»Äh, ja, entschuldige«, sage ich und nicke etwas zerstreut.
»Also nicht vergessen.« Anitta wendet sich den restlichen Mitarbeitern zu. »Ihr redet nicht mit der Presse, gebt keine Interviews und auch sonst keine Informationen über das Hotel preis. Wenn euch irgendjemand blöd kommen sollte, sagt ihr mir sofort Bescheid. Das Codewort ist: ›Neues Geschirr decken.‹ Verstanden?«
»Verstanden«, sagen wir im Chor.
Eine ähnliche Ansprache hat uns auch Dennis an der Rezeption gehalten. Wir alle haben sie bekommen, eine Warnung, mit niemandem über den Langston-Skandal zu sprechen. Bei all der Heimlichtuerei könnte man fast annehmen, dass an den Gerüchten etwas dran sei. Ich persönlich würde ganz anders mit der Sache umgehen, als so zu tun, als wäre nichts. Aber wer bin ich schon, darüber zu entscheiden …
Anitta löst die Gruppe auf, und wir zerstreuen uns. Gähnend schnappe ich mir Block und Stift und stecke beides in meine Schürzentasche. Nach einer weiteren Nachtschicht bin ich unglaublich müde, allerdings ist jemand vom Service ausgefallen, und als Anitta mich gefragt hat, ob ich kurzfristig einspringen will, konnte ich einfach nicht ablehnen. Außerdem lassen sich hundertachtzigtausend Dollar nun mal nicht auf der Straße finden, und je mehr Schichten ich übernehme, desto schneller zahlen Mom und ich den Batzen Geld ab.
Als ich den Restaurantsaal betrete, verpufft meine Hoffnung auf eine ruhige Schicht zu den restlichen Staubkörnern, die in der stickigen Luft tanzen. Das Kimberly’s