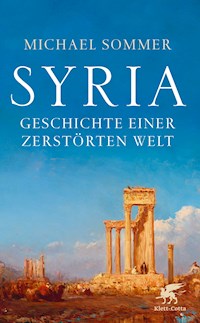19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mehr Antike wagen! Eine spannende und unterhaltsame Reise zu den Grundlagen der modernen Welt Vom Kampf um Troia bis zum Ende des römischen Imperiums: In seinem fesselnden Parforceritt durch die Antike entfaltet Michael Sommer anderthalb Jahrtausende Menschheitsgeschichte. Mit vielen Rückbezügen auf die heutige Zeit schärft seine pointierte Erzählung unser Bewusstsein für die großen Bögen des historischen Dramas, das sich um das antike Mittelmeer ereignete. Ein hochaktuelles Buch, das zeigt, wie stark unsere eigene Gegenwart mit der antiken Welt der Griechen und Römer verflochten ist. Von wem stammt die Idee, dass wir alle Bürger sind und keine Untertanen? Wieso sehnen sich freie Menschen in Krisenzeiten nach der Autorität eines einzelnen Mannes? Was macht Jerusalem bis heute zum Zankapfel zwischen den Völkern und Religionen? Michael Sommer entführt seine Leser auf eine ebenso unterhaltsame wie instruktive Reise zu den Anfängen Europas. Eindrucksvoll stellt er unter Beweis, dass die Beschäftigung mit 2000 oder mehr Jahre zurückliegenden Ereignissen ein großes intellektuelles Vergnügen bereitet. Dabei nimmt er den Leser nicht nur mit in die Ewige Stadt, sondern führt ihn an die alles entscheidenden Schauplätze der antiken Geschichte: mitten hinein in den Trojanischen Krieg und auf die Agora des demokratischen Athen; nach Karthago und in die prächtige Oasenstadt Palmyra; in die Schluchten des Balkan und die spätantike Auvergne, wo die letzten Römer gegen die Goten kämpften. Und auf diesem Weg macht der Leser fast beiläufig die Erfahrung, dass die Auseinandersetzung mit der Antike nicht nur die Augen öffnet für das Werden seiner eigenen Gegenwart, sondern nebenbei auch ganz viel Spaß macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Sommer
Alle Wege führen nach Rom
Die kürzeste Geschichte der Antike
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung mehrerer Abbildungen von © Shutterstock/Artem Efimov, fantasycreationz und Arcangel/Martin Bredice
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98640-2
E-Book ISBN 978-3-608-11920-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
EINS
Die Trabantenstadt. Das nächste Fremde
ZWEI
Der Zorn des Achill. Griechenland lernt laufen
DREI
Experimente. Die Griechen und die Welt
VIER
Die Wölfin erwacht. Rom erobert das Mittelmeer
FÜNF
Vox populi. Republik ohne Republikaner
SECHS
Pax Romana. Wie man ein Imperium beherrscht
SIEBEN
Phantomschmerzen. Das Ende der Zivilisation
ACHT
Mehr Antike wagen
Zeittafel
Literatur
Bildnachweis
Register
Ekkehard Lederbogen (1941–2022)
magistro optimo
Vorwort
»Was soll uns heute noch die Alte Geschichte?«, fragte Christian Meier(1) schon vor einem halben Jahrhundert. Dass Fächer, die sich mit fernen Zivilisationen befassen, unter Rechtfertigungsdruck stehen, ist nicht erst so, seit das Digitale allem Analogen unbarmherzig Konkurrenz macht. Meier fand damals innovative, zum Teil auch verblüffende Antworten, die noch heute zum Nachdenken anregen. Dennoch muss jede Generation wieder neu die Frage stellen, warum eine Gesellschaft in etwas investieren soll, das doch vermeintlich keinen Nutzen bringt, schon gar keinen, der unmittelbarer Verwertung zugänglich wäre.
Meine Erfahrungen als Hochschullehrer und als jemand, der versucht, auch einer breiten Öffentlichkeit die ferne Antike ein wenig näherzubringen, bestätigen den Eindruck, dass Griechen und Römer auf dem Rückzug sind: aus der Bildung, aber auch ganz allgemein aus der Gesellschaft. Kaum jemand, der heute die Schule verlässt, weiß noch etwas mit dem Peloponnesischen Krieg, dem Zorn des Achill(1) oder der Catilinarischen Verschwörung(1) anzufangen. Viele von diesen jungen Leuten haben bei Lehrern gelernt, deren Wissen über die Geschichte vor 1789 lückenhaft ist.
Das ist schade, denn wer etwas über die Antike lernt, erfährt auch viel über sich selbst, über das moderne Europa und über seine Kultur, die vielfältige, in Jahrhunderten gewachsene Bezüge zum Altertum hat, das wir genau deswegen »klassisch« nennen. Er betritt, wenn er sich ins Abenteuer Antike stürzt, einen Boden, der allen Europäern gemeinsam ist: den einzigen Boden, den alle Nationalkulturen mit gutem Recht für sich reklamieren können. Deshalb ist die Alte Geschichte, die Archäologie der antiken Mittelmeerzivilisationen, sind die vermeintlich toten Sprachen Latein und Griechisch kein verstaubtes Bildungswissen, sondern Klammern, die unserem vielfältigen Kontinent beim Zusammenwachsen helfen könnten. Ich bin deshalb der Auffassung, dass es sich lohnt, mehr Antike zu wagen, und dass sich Bildungspolitiker, die sich nicht auf dieses Wagnis einlassen mögen, an der Idee Europa versündigen.
Tom Kraushaar, der Verlegerische Geschäftsführer des Klett-Cotta-Verlags, hat mich vor einiger Zeit dazu angeregt, ein Buch zu schreiben, das Appetit auf die Antike machen soll. Ich bin Historiker, und für mich erwächst ein Gutteil der Befriedigung, die ich aus der Beschäftigung mit der Antike beziehe, daraus, dass sie mir die Augen öffnet für Zusammenhänge, die mir sonst verschlossen blieben. Ich habe deshalb die Geschichte der antiken Welt in den Mittelpunkt dieses Buches gestellt: weil es in ihr viel zu entdecken gibt, weil sie spannend ist und weil sie dazu einlädt, unsere Gegenwart aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Der Kollege x oder die Kollegin y hätte fraglos ein völlig anderes Buch geschrieben, um Lust auf die Antike zu machen. Ich habe mich dafür entschieden, die Alte Geschichte als eine Geschichte zu erzählen, von der zahllose Pfade in unsere Gegenwart führen. Einige davon sind verschlungen, manche auch nur schwer im Dickicht der Jahrhunderte zu finden. Mir macht es immer wieder großen Spaß, sie zu erkunden, und etwas von diesem Vergnügen möchte ich teilen.
»Niemand schreibt ein Buch allein«. Diese Weisheit gab vor kurzem eine Politikerin zum Besten. Auf dieses Buch trifft sie zu. Ich wollte, wenn ich abschließend begründe, warum wir mehr Antike wagen sollten, nicht nur meine eigene, sondern auch die Perspektiven und Erfahrungen von Mitmenschen einfließen lassen, die alle eine enge Beziehung zur Antike haben, aber eben eine andere als ich. Ich habe, bevor ich das Schlusskapitel geschrieben habe, Gespräche mit Werner Brinker, Fritz Felgentreu, Anna Heinze und Stefan von der Lahr geführt, deren Blickwinkel in meine Überlegungen eingeflossen sind. Sie alle werden auch selbst zu Wort kommen.
Werner Brinker ist Vorsitzender der Universitätsgesellschaft Oldenburg (UGO) und war bis 2015 Vorstandsvorsitzender der EWE AG, des fünftgrößten Energieversorgers in Deutschland. Er ist Wasserbauingenieur und wurde an der TU Braunschweig mit einer Arbeit über Frontinus(1) und die römische Wasserversorgung promoviert. Fritz Felgentreu ist habilitierter Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer. Er forscht zur lateinischen Literatur der Spätantike und vertrat als Verteidigungspolitiker bis 2021 für die SPD den Wahlkreis Neukölln im Deutschen Bundestag. Anna Heinze ist Kunsthistorikerin und stellvertretende Direktorin des Landesmuseums für Kunst(1) und Kulturgeschichte in Oldenburg. Sie hat viele Ausstellungen mit Antikebezug kuratiert und begeistert sich seit ihrer Schulzeit für die Helden des Altertums. Stefan von der Lahr wurde über den archaischen Dichter Theognis von Megara promoviert und ist heute Lektor für Antike im Verlag C. H. Beck, München. Er schreibt Kriminalromane, die in den modernen Städten Rom und Neapel spielen, in denen die Antike noch immer lebendig ist. Ihnen allen danke ich herzlich dafür, dass sie mich an ihren Gedanken teilhaben ließen.
Zu großem Dank verpflichtet bin ich auch Christoph Selzer und Julian Hermann vom Klett-Cotta-Verlag, die das Entstehen dieses Buches in allen seinen Phasen mit großem Sachverstand und ebenso großem Engagement begleitet haben. Ich widme es Ekkehard Lederbogen, der mir viel mehr beigebracht hat als Latein und Griechisch. Er hat mir mit seiner ansteckenden Begeisterung die Augen geöffnet für das Staunenswerte in der Welt von Griechen und Römern. Wenn jemand verantwortlich dafür ist, dass ich die Antike zu meinem Beruf gemacht habe, dann er: ein Altphilologe aus Berufung und Humanist aus Überzeugung. Ich verdanke ihm unendlich viel mehr, als sich in Worte fassen lässt.
EINS
Die Trabantenstadt. Das nächste Fremde
»Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien(1) ist von den Römern besetzt … Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.« Um doch noch ganz Gallien besetzen zu können, hecken die Römer einen diabolischen Plan aus. Direkt neben dem Dorf lässt Caesar(1) eine Trabantenstadt mit römischen Bewohnern entstehen. Sein Stararchitekt Quadratus baut mitten in die bretonischen Wälder den ersten Wohnblock, derweil im Circus Maximus(1) in Rom unter den Zuschauern Wohnungen in der Trabantenstadt verlost werden. Ein römisches Ehepaar, die glücklichen Gewinner der Tombola, ist zunächst nur mäßig begeistert, kann dem Leben in der Provinz aber bald sogar positive Seiten abgewinnen. Auch die anderen Neuankömmlinge schätzen die Vorzüge des Landlebens.
Sie tragen ihre Sesterze in das gallische(2) Dorf, wo bald immer mehr Geschäfte aufmachen, bis das ganze Dorf einer Shoppingmeile gleicht. Die Gallier ändern ihre Lebensgewohnheiten, jagen nur noch dem Profit nach und verlieren das Interesse an den römischen Legionären, die endlich vor Prügeln sicher sind. Da wird es Asterix(1) und Obelix(1) zu bunt. Sie nehmen die Dinge in die Hand: Obelix spielt den verrückten Berserker und randaliert in dem Wohnblock, während Asterix so tut, als wolle er ihn bändigen. Schließlich berichtet Asterix den Tombolagewinnern, Obelix sei leider seiner Aufsicht entkommen. In Panik kehrt das Ehepaar mit Sack und Pack der Trabantenstadt den Rücken, und der Gallier Troubadix(1) zieht in die Wohnung ein. Von den Gesängen des Barden terrorisiert, verlassen auch die übrigen Bewohner den Wohnblock. Quadratus muss, um ihn nicht leerstehen zu lassen, Legionäre in das Gebäude einquartieren. Auch die fühlen sich aber durch Troubadix belästigt und setzen den Barden vor die Tür. Für die Gallier ist das Grund genug, Rache zu nehmen. Sie zerstören den Wohnblock, verprügeln die Römer und kehren in ihr altes Leben zurück.
Ich war sieben oder acht Jahre alt und hatte die Windpocken. Ich lag auf dem Sofa im Wohnzimmer und hörte nichts als das Ticken der Standuhr. Schlimmer als das Fieber und das Jucken war die Langeweile. Krankheitstage können sich zäh in die Länge ziehen. Die Erlösung traf in Gestalt meines Vaters ein, der ein dünnes Heft im Format DIN A4 in der Hand hielt. Band 15 der Asterix(2)-Reihe: Streit um Asterix. Damals noch ziemlich frisch. Bevor zwei Stunden um waren, musste mein Vater noch einmal aus dem Haus, Nachschub kaufen. So las ich Die Trabantenstadt.
Dass man Asterix(3) als eine Parabel auf die Moderne lesen kann, wusste ich damals noch nicht. Das Elend der französischen Banlieue(1) und des sozialen Wohnungsbaus (die Habitations à loyer modéré, HLM, werden in einem anderen Asterix-Band auf die Schippe genommen), die Macht der Werbung und die Lächerlichkeit des Show Business, der Wertewandel und die Entwurzelung, das Technokratentum der »Énarques« – all das wird in der Trabantenstadt gekonnt ins Asterix-Universum importiert, um es zu parodieren. Man muss aber schon ziemlich viel über Frankreich und seine Gesellschaft wissen, um es verstehen und in vollen Zügen genießen zu können. Jedenfalls mehr als ein Achtjähriger.
Die Geschichten um Asterix(4) und Obelix(2), um das gallische(3) Dorf und die Welt um 50 v. Chr. sind aber auch auf eine völlig andere, eher vordergründige Art unterhaltsam und spannend, und jedes Kind weiß das zu schätzen. Wenn aus Eicheln, die Miraculix mit Zaubertrank präpariert hat, im Blitztempo Bäume wachsen und dann ein Unfall passiert, der eine riesige Eiche im Haus des Druiden wachsen lässt, dann ist das Slapstick vom Feinsten. Die Comics faszinieren aber noch aus einem dritten Grund: Das Setting im antiken Gallien(4) und, im größeren Maßstab, im Römischen Reich der Zeit Caesars(2), ist alles andere als beliebig austauschbar, sondern gibt im Gegenteil der Reihe ein unverwechselbares Kolorit. Geführt von der Erzählkunst eines Goscinny(1) und dem Detailblick eines Uderzo(1) (und, in Deutschland, nicht zu vergessen von den kongenialen Übersetzungen einer Gudrun Penndorf(1)), taucht nämlich der Leser ein in eine fremde, faszinierende Welt. Er fühlt sich zu Hause im Fantasiekosmos des gallischen(5) Dorfes, hat Teil an Freud(1) und Leid des römischen Soldatendaseins und reist mit Asterix, Obelix und Idefix dorthin, wo das pralle Leben ist: ins Ägypten(1) Kleopatras, die mit Caesar(3) eine riskante Wette eingegangen ist; nach Griechenland(1), wo Asterix an den Olympischen Spielen teilnimmt; ins unfassbar saubere Helvetien(1); nach Spanien(1) und in den Orient; und natürlich nach Rom, die erstaunlichste Stadt des Universums.
Wer jetzt, wie ich, rund 50 Jahre alt ist, ist mit Asterix(5) groß geworden und hat mit ihm die antike Welt vermessen. Er hat Zaubertrank getrunken und Wildschwein gegessen, den Gesang des Barden ausgehalten, das Piratenschiff versenkt und die Römer vermöbelt, vor denen er, obwohl sie natürlich spinnen, eigentlich einen Heidenrespekt hat. Bei aller Anfälligkeit fürs Lächerliche ist die römische Armee (Asterix: »Je besser die Armee, desto schlechter das Essen« – und später: »Ich hätte nicht gedacht, dass die römische Armee so gut ist«) selbst noch im Comic ein bewundernswürdiger Organismus. Es gibt Momente, da kann man die Verzweiflung ihrer Offiziere angesichts der Unmöglichkeit, im hintersten Winkel Galliens dem römischen Frieden Geltung zu verleihen, nur allzu gut nachfühlen.
Immer wieder zollen die Asterix(6)-Macher Uderzo(2) und Goscinny(2) zwischen den Zeilen der kolossalen Zivilisationsleistung der Römer ihren Respekt. Ob man mit den Augen der Helden von einer Hügelkuppe der Seine-Metropole Lutetia(1) ansichtig wird oder mit ihnen auf einer Römerstraße wandert, stets schwingt Bewunderung für die Architekten des Imperiums mit – im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Auch wenn bereits die frühe Ökologiebewegung ihre Spuren hinterlassen hat (»Mit ihren neumodischen Bauwerken verschandeln die Römer noch die ganze Gegend«), überwiegt doch die Sympathie für die Baumeister der zeichnerisch mit Liebe und Präzision dargestellten Amphitheater, Aquädukte und Mietskasernen, der Insulae der »Trabantenstadt«.
Die zivilisierende Energie des Imperiums wird selten anschaulicher als in diesem Asterix(7)-Band, der sich im Irrealis des Asterix-Universums den Kunstgriff erlauben kann, einen Wohnblock der Bauweise Rom oder Ostia(1) direkt neben das gallische Dorf zu stellen. Selbst im Rohbau fällt der Vergleich in puncto Ästhetik und Wohnkomfort für das Dorf wenig schmeichelhaft aus. Im Fortgang der Geschichte ist es dann aber die Ankunft der Römer, die das Leben im Dorf radikal verändert. Die neuen Nachbarn stellen durch ihre schiere Präsenz, durch ihren im Vergleich raffinierten Lebensstil und nicht zuletzt durch ihre Kaufkraft die verschworene Gemeinschaft der Gallier auf eine existentielle Probe. »Gebt zu, dass das hier eleganter ist als unsere übliche Tracht!«, sagt die Dorfschöne, nachdem sie ihre gallischen(6) Röcke gegen ein figurbetontes römisches Kleid getauscht hat. Über die Römer sagt sie: »Sie helfen uns, aus dem Stadium der Barbarei herauszukommen.« Es bedarf des beherzten, sehr wohl auch robusten Einsatzes unserer Helden, um die Trabantenstadt aus der Welt zu schaffen, den Zivilisationsprozess rückgängig zu machen und den barbarischen Normalzustand wiederherzustellen.
Zwei Jahre nach den Windpocken hatte ich meine erste Lateinstunde. Marcus et Cornelia in horto ambulant, »Marcus und Cornelia gehen im Garten spazieren«. Ich fragte mich, warum ich das interessant finden sollte. Von dem bunten, faszinierenden Asterix(8)-Universum jedenfalls waren Texte, die sich holländische Schulbuchmacher in den 1970er Jahren für Lateinanfänger in der Unterstufe ausgedacht hatten, Lichtjahre entfernt. Didaktisch wertvoll heißt noch lange nicht inspirierend.
Ohnehin besuchte ich die Lateinstunde nicht freiwillig. Bremen, wo ich aufgewachsen bin, war schon damals Schulnotstandsgebiet. Die Idee des »längeren gemeinsamen Lernens«, wie heute die Einheitsschule verharmlosend genannt wird, sollte, wenn man dem damaligen SPD-Senat(1) glaubte, ins bildungspolitische Elysium führen. Die Grundschule war um eine zweijährige »Orientierungsstufe« verlängert worden. Ein Gymnasium nach dem anderen verschwand aus der Schullandschaft und machte dem von den Regierenden gewollten flächendeckenden Angebot von Gesamtschulen Platz.
Dem gallischen Dorf nicht unähnlich, hielt sich mitten in der Stadt ein humanistisches, das »Alte Gymnasium«(1), das bereits 1528 als Lateinschule der Hansestadt gegründet worden war. Weil es auch in Bremen viele Eltern gab, die das Gesamtschulangebot wenig attraktiv fanden, war diese Schule hoffnungslos überbucht. Der einzige sichere Weg aufs Alte Gymnasium(2) führte über einen vorbereitenden Lateinkurs, der begleitend zur Orientierungsstufe in den Klassenstufen fünf und sechs zu besuchen war. Zwei Stunden pro Woche, nachmittags!
Meine ersten Gehversuche mit dem Ablativus Absolutus und dem AcI unternahm ich also nicht in dem Gründerzeitgemäuer des Alten Gymnasiums(3) in der Dechanatstraße, sondern in einem auf bizarre Weise ähnlich preußisch anmutenden Zweckbau in der Bremer Neustadt. Auf das kleine Häuflein Kinder, die alle von ihren Eltern für eine Schullaufbahn auf dem Alten Gymnasium(4) vorgesehen waren, ließ man eine junge Referendarin los. Ich frage mich bis heute, wer hier weniger motiviert war: sie oder wir?
Aus meinem Freundeskreis musste ich mir immer wieder anhören, was denn der ganze Aufwand solle. Und das alles für eine tote Sprache! Damit könne man doch rein gar nichts »anfangen«. Ich gestehe, dass ich damals auch keine Antwort darauf wusste. Die Tür zur Welt von Asterix(9) jedenfalls schien der Lateinunterricht keinen Spalt weiter zu öffnen. Ohnehin hatten Die drei ??? zwischenzeitlich Asterix in meiner Gunst auf den zweiten oder dritten Platz verdrängt.
1982 saß ich in der Aula des Alten Gymnasiums(5) und hörte die Begrüßungsrede des Direktors, der natürlich Altphilologe war. Ich weiß nicht mehr, ob die Redensart per aspera ad astra gefallen ist, sie hätte jedenfalls gepasst: Über die Qualen der zähen Nachmittagssitzungen mit Marcus und Cornelia hatte ich das Eintrittsticket ins Alte Gymnasium(6) gelöst. Honorige Leute hatten dort ihr Abitur gemacht: Joachim Neander(1), der Schöpfer vieler ehedem bekannter Kirchenlieder, der Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde(1), der Dichter Rudolf Alexander Schröder(1) und der damalige Bundespräsident Karl Carstens. Der Schulleiter sagte übrigens auch etwas von einer »subversiven Kraft«. Sie wohne den antiken Texten inne, die wir bald lesen würden. Es dauerte dann doch noch etliche Jahre, bis ich Sallust(1), Cicero(1) oder gar Thukydides(1) im Original lesen konnte und eine Ahnung davon bekam, was der Direktor mit diesem Satz meinte.
»Subversiv« fühlten wir uns allerdings schon damals. Wir besuchten eine Schule, die von den roten Mandarinen der Hansestadt allenfalls geduldet und keinesfalls geliebt wurde; und wir lernten eine Sprache, die als nutzlos galt, als bildungsbürgerliches Relikt und deshalb als elitär. Im sozialdemokratischen Bremen(7) hegte man gegen alles, was nur entfernt nach Elite roch, noch stärkere Aversionen als im Rest der Republik(1). Unsere Eltern, die auf einer Schulversammlung gegen die drohende Schließung von Gymnasien protestierten, mussten sich vom Bildungssenator anhören, was sie denn dagegen hätten, wenn ihre Sprösslinge das Pausenbrot mit Arbeiterkindern teilten.
Der sozialdemokratische Bildungssenator ahnte 1982 vielleicht nicht, dass er mit seinen Reserven gegen klassische Bildung in einer Traditionslinie stand, die weit zurückreicht: mindestens mitten ins wilhelminische Kaiserreich, ins Jahr 1890. Wilhelm II.(1), seit gerade zweieinhalb Jahren deutscher Kaiser und selbst Absolvent des altsprachlichen Gymnasiums in Kassel, wollte das preußische Schulsystem an Haut und Haaren reformieren und berief dazu einen Kongress nach Berlin ein. Zur sogenannten Dezember-Konferenz hatte der preußische Kultusminister von Goßler(1) geladen, Wilhelm(2) selbst hielt die Eröffnungsrede. Der Kaiser forderte darin, man müsse die »heranwachsende Generation so instruieren«, dass man »der Bewegung« – er meinte die Sozialdemokratie – »Herr werden könne«. Das gehe nur, wenn man »junge Deutsche« erziehe und nicht »junge Griechen und Römer«. Man müsse sich von seit dem Mittelalter tradierten Bildungswissen emanzipieren, in dem es auf Latein und »ein bißchen Griechisch dazu« angekommen sei. »Das ist nicht mehr maßgebend«, stellte der Kaiser(3) kategorisch fest. Unterhalte man sich mit den »Philologen« darüber, was das Ziel des Schulunterrichts sein solle, dann würden die antworten, die »Hauptsache« sei die »Gymnastik des Geistes«. Dem stellte Wilhelm ein Bildungsideal entgegen, das ein ganz anderes Ziel verfolgte: dass nämlich »der junge Mensch doch einigermaßen praktisch für das Leben und seine Fragen vorgebildet werden solle«.
Über die Frage, wieviel Praxisnähe oder -ferne das Gymnasium verträgt, wird seither heftig gerungen. 2015 sorgte eine Kölner Gymnasiastin für Aufsehen, als sie twitterte: »Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.« Die sogenannte Naina(1)-Debatte haute mitten in die Kerbe bildungspolitischer Diskussionen, die um einen stärkeren Anwendungsbezug gymnasialer Bildung kreist: Vermeintlich gestriger Stoff soll modernen Inhalten weichen, um die Schüler fit für die Probleme von morgen zu machen. Hinter Initiativen, mehr praxistaugliche Fächer wie ökonomische Bildung und Informatik im Abitur zu verankern, stehen mächtige Lobbyinteressen und viel Geld. Dass ein Mehr an Wirtschaft und MINT nur durch ein Weniger an Althergebrachtem erkauft werden kann, die alten Sprachen natürlich in vorderster Front, scheint sich von selbst zu verstehen. Schließlich gibt es eine Obergrenze für die Aufnahmefähigkeit von Schülerhirnen, das sehen auch die ehrgeizigsten Pädagogen ein. Deshalb ist das »Entrümpeln« von Lehrplänen zu einem Ceterum Censeo wirtschaftsnaher Bildungsakteure geworden, ungeachtet der Tatsache, dass die Metapher zu den »verbrannten Wörtern« gehört, wie Welt-Autor Matthias Heine(1) die noch immer benutzten Begriffe aus dem NS-Wortschatz genannt hat.
Ich möchte die Tendenz, nicht unmittelbar anwendungsgerechtes Bildungswissen zu »Gerümpel« zu erklären und für die Schule mehr Praxisorientierung zu fordern, den produktivistischen Reflex nennen. Der Produktivismus zeichnet sich durch den festen Glauben an kurzfristige Kosten-Nutzen-Rechnungen aus. Alles, was sich nicht direkt im Bruttosozialprodukt niederschlägt, ist für ihn im Grunde ein teurer Luxus, der immer wieder auf den Prüfstand gehört. Der produktivistische Reflex fordert die humanistische Bildung, vereinfacht gesagt, von rechts heraus. Er ist viel älter als Wilhelms(4) Ansprache vor der Dezember-Konferenz. Thomas Paine(1), ein radikaler Intellektueller und Gründervater der Vereinigten Staaten, hatte bereits Ende des 18. Jahrhunderts in der Schrift The Age of Reason seine Zeitgenossen für ihre Obsession mit der klassischen Antike getadelt. Paine meinte, man müsse nach vorne, anstatt rückwärts blicken und nahm die produktivistische Kritik vorweg, indem er feststellte, wahre Bildung bestehe nicht in der »Kenntnis von Sprachen, sondern in der Kenntnis der Dinge, denen Sprachen ihre Namen geben«. Neue Erkenntnisse seien vom Studium der alten Sprachen nicht zu erwarten.
Zur Herausforderung durch den produktivistischen Reflex tritt der in Deutschland traditionell starke elitenfeindliche Reflex, der hinter klassischer Bildung das Distinktionsmerkmal einer dünnen Schicht von Privilegierten wittert: eine Festung des Bildungsbürgertums, die es zu schleifen gilt. Als ab den 1960er Jahren Chancengleichheit vermehrt als Ziel von Bildungspolitik ausgerufen wurde, geriet vor allem der altsprachliche Unterricht ins Visier. 1972 bemerkte der damalige Berliner Bildungssenator Carl-Heinz Evers(1), ein Sozialdemokrat: »In Wirklichkeit ist Latein kaum etwas anderes als ein zusätzliches Element der sozialen Auslese.« Und auf einem Frankfurter GEW-Kongress, ebenfalls 1972, wurden Latein oder eine zweite Fremdsprache als »funktionslos gewordenes Herrschaftswissen« bezeichnet. Auch dieses Argument war alles andere als neu. Wieder war es Thomas Paine(2) gewesen, der es zuerst gegen das Studium der alten Sprachen vorgebracht hatte: Latein und Griechisch seien nichts als sinnlose Statussymbole der Reichen und Mächtigen, die ihnen helfen, sich von der breiten Masse vermeintlich Unwissender abzuheben.
Der Vorwurf, die Beschäftigung mit der Antike sei ein reines Elitenprojekt, dessen primäre Funktion darin bestehe, systematisch alle weniger Privilegierten auszugrenzen, erlebt seit einigen Jahren ausgehend von den angelsächsischen Ländern eine bemerkenswerte Renaissance. Neu an der vor allem in den USA aufgeflammten Debatte ist, dass sie maßgeblich von universitären Vertretern der klassischen Disziplinen selbst befeuert wird. Variiert wird hier die identitätspolitische Agenda, die längst nicht nur amerikanische Universitäten fest im Griff hat, zur Fundamentalkritik an einer ganzen Disziplin. Die Classics gelten dies- und jenseits des Atlantik inzwischen weiten Teilen des akademischen Publikums als ähnlich »toxisch« wie die Männer, nach denen noch vor kurzem viele Universitätsgebäude benannt waren: Woodrow Wilson(1) etwa in Princeton oder William Gladstone(1) in Liverpool.
Dem Fach wird vorgeworfen, es sei eine der »rassisch homogensten Ecken« des Wissenschaftsbetriebs und es rechtfertige »imperiale Kontrollsysteme, Rassenhierarchien und oppressive ästhetische Ordnungen«. Diese Sätze schrieb 2017 Mathura Umachandran(1), damals Gräzistik-Doktorandin in Princeton, in dem von Donna Zuckerberg(1), der Schwester des Facebook-Moguls, herausgegebenen Online-Magazin Eidolon. Schärfer noch formulierte der aus der Dominikanischen Republik stammende und in Princeton lehrende Althistoriker Dan-el Padilla Peralta(1): Den Altertumswissenschaften wohne eine gefährliche Kraft inne, die benutzt worden sei, um zu morden, zu versklaven und zu unterwerfen, erklärte er 2018 auf der Jahrestagung der Society of Classical Studies in San Diego. Wenn es eine Fächergruppe gebe, die »scholars of color« systematisch delegitimiere, dann seien das die Classics. Einer solchen Disziplin weine er keine Träne nach, würde sie verschwinden.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis solche Sätze auch in Deutschland fallen werden. Schon jetzt sind Bestrebungen erkennbar, den schulischen Fächerkanon um die »Herkunftssprachen« zu erweitern, die Migranten nach Deutschland mitgebracht haben. Die Rede ist von Türkisch, Arabisch, Farsi, Polnisch und Griechisch – wobei Altgriechisch selbstverständlich nicht gemeint ist. So wolle man, erklären Bildungspolitiker, Schüler mit Migrationshintergrund besser fördern. Argumentiert wird damit, dass besser Deutsch lerne, wer seine Muttersprache richtig beherrsche. In der GEW erkenne man so aber auch an, dass die Sprachen für Deutschland eine Bereicherung seien. Wie immer man solche Sprachangebote begründet: Im Ergebnis laufen sie darauf hinaus, dass die Reste des gemeinsamen Bildungsfundaments, über die unsere Gesellschaft noch verfügt, pulverisiert werden. Genau das, die Atomisierung von Gesellschaft in kleine und kleinste Gruppen, ist in letzter Konsequenz das Ziel jeder Identitätspolitik, wie sie auch mit den Herkunftssprachen betrieben wird.
Die Berliner Bildungskonferenz(1) von 1890 endete mit dem Beschluss, dass die humanistischen Gymnasien das Abiturprivileg behielten: Die meisten Fächer konnte nach wie vor nur studieren, wer zuvor das altsprachliche Gymnasium besucht hatte. Im Gegenzug erklärten sich die Vertreter der Gymnasien bereit, auf den lateinischen Abituraufsatz und einen Teil der Unterrichtsstunden für Latein zu verzichten. Zehn Jahre später, auf der Nachfolgekonferenz im Juni 1900, fiel das Abiturprivileg schließlich doch.
Seit Thomas Paine(3) sind Produktivismus und Antielitismus die Strömungen, die alle unter Rechtfertigungsdruck setzen, die das Erbe von Griechen und Römern nach wie vor hochhalten möchten. Beide erheben im Kern denselben Vorwurf gegen die Bildung in humanistischer Tradition: sie sei rückwärtsgewandt und nutzlos. Viele Freunde der Antike haben auf die Herausforderung reagiert, indem sie wortreich den Verfall klassischer Bildungsideale beklagen und das Ende des Abendlandes immer dann nahe wähnen, wenn Besitzstände infrage gestellt werden. Das gilt heute wie damals, 1900, als der Deutsche Gymnasialverein mit der »Braunschweiger Erklärung(1)« gegen das Ende des Abiturprivilegs wetterte. Klagen dieser Art haben immer einen weinerlichen Tonfall, und Larmoyanz macht selten sympathisch. Wer jammert, tut seinem Anliegen kaum einen Gefallen.
Andere haben mit Argumenten wider den Stachel des Zeitgeists gelöckt. Ihre Rechtfertigungsstrategien laufen meist darauf hinaus, dass sie gegen den von der Gegenseite erhobenen Nutzlosigkeitsvorwurf den praktischen Wert klassischer, vor allem auch altsprachlicher Bildung unter Beweis zu stellen suchen. Altphilologen weisen gerne darauf hin, dass die Kenntnis einer alten Sprache auch beim Erlernen moderner Fremdsprachen hilft. Zu Zeiten, da Grammatik und Stilistik im Deutschunterricht kaum noch gelehrt werden, sei der Lateinunterricht eine Schule auch für die Muttersprache geworden. »Jede Lateinstunde ist auch eine Deutschstunde«, pflegen Lateinlehrer zu sagen und haben damit im Großen und Ganzen recht. »Latein, des isch Sprache an sich«, lautete in meiner Studienzeit das griffigere, in breitem Badisch geäußerte Credo eines beliebten Dozenten an der Freiburger Universität. Tatsächlich begreift die Grundstrukturen von Sprache, wer sich die Mühe macht, der Consecutio Temporum und dem doppelten Objektsakkusativ intensiv auf den Grund zu gehen.
Das zweite Argument ist an das erste angelehnt, aber abstrakter. Ähnlich wie das mathematische Spielen mit Zahlen trainiere der Umgang mit vermeintlich toten Sprachen kognitive Fähigkeiten, denn schließlich funktioniert deren Erlernen anders als der zum Teil ja intuitive Erwerb einer modernen Fremdsprache. Auf einer tieferen Ebene, heißt es, fordern schwierige, teilweise arkane, fast immer aber durch den Abstand von Jahrtausenden sperrige Texte unseren hermeneutischen Scharfsinn heraus. Darin steckt sicher viel Wahres: Wer einen Aristoteles oder Vergil(1) meistert, braucht sich vor Shakespeare oder Thomas Mann nicht zu fürchten.
Selbst wenn man nicht bereit sei, den kognitiven und hermeneutischen Mehrwert des Sich-Befassens mit goldener oder silberner Latinität zu akzeptieren, sprächen normative Gründe für die klassische Bildung, argumentieren deren Anhänger drittens. Schließlich sei die gesamte Kultur Europas auf der griechisch-römischen Antike aufgebaut: Literatur, Kunst(2), Architektur, Philosophie, politisches Denken, das Recht, selbst die Naturwissenschaften. So seien wir nicht nur durch die jahrhundertelange Rezeptionsgeschichte mit den alten Zivilisationen verklammert, sondern die Antike sei auch das gemeinsame Fundament aller europäischen Nationalkulturen. Wolle man den Europagedanken auf eine ideelle Grundlage stellen, dann sei die Antike dafür gewissermaßen der kleinste gemeinsame Nenner.
Auch diesem Argument ist Plausibilität nicht abzusprechen. Wer ein einiges Europa will, der braucht eine fundierende Erzählung, ein »Narrativ«, wie man heute sagt. Und dieses Narrativ benötigt einen Ankerpunkt in der Vergangenheit, als der sich die Antike in besonderer Weise eignet. Wie die übrigen Versuche, den Nutzlosigkeitsvorwurf zu kontern, haftet allerdings auch dem Europa-Argument etwas Defensives an. Man übernimmt den Nützlichkeitsbegriff der Gegenseite, behauptet aber schlicht das Gegenteil: Das Preis-Leistungs-Verhältnis klassischer Bildung stimme eben am Ende doch.
Was aber, wenn der größte Vorzug dieser Bildung sich nicht in Euro und Cent berechnen lässt und er sich Evaluierungen wie den Pisa-Studien (und wie sonst die Feldversuche von Bildungsforschern heißen mögen) entzieht? Wenn wir vielleicht den Schaden, der durch den Verzicht auf eine humanistische Bildung entsteht, erst ermessen können, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen und eine mehrhundertjährige Tradition abgerissen ist? Ich möchte behaupten, dass wir ohne Wissen um die Antike unvollständig wären und es vermutlich noch nicht einmal bemerken würden, weil uns dann jede Voraussetzung dazu fehlte. Die Griechen und Römer, so denke ich, ebnen uns den Weg zu einem Verstehen von Geschichte und damit uns selbst, das uns ohne sie verschlossen bliebe.
Diesem Gedanken hat vor rund 50 Jahren zum ersten Mal der Althistoriker Christian Meier(2) in einem bemerkenswerten Text mit dem Titel »Was soll uns heute noch die Alte Geschichte?« Ausdruck gegeben. Meier stellte seine Frage vor dem Hintergrund der Legitimitätskrise, in die seine Wissenschaft in den 1960er Jahren und vor allem mit dem Epochenjahr 1968 geschlittert war, und er spitzt sie zu auf die historische Wissenschaft von der Antike. Nicht mehr zeitgemäß, lautete auch damals schon das Verdikt über die Disziplin, beschäftige sie sich doch mit einer Geschichte, die lange vorbei war. Meiers Antwort ist nicht defensiv und nicht apologetisch, sondern in höchstem Maße kämpferisch, ja angriffslustig. Augenzwinkernd merkt Meier an, »daß der Reiz, die Liebenswürdigkeit dieser Zeit unbefangenster Weltkenntnis und freier Bewegung« – also im Grunde die ästhetische Faszination der Antike für den Kenner und Genießer – »kein schlechtes Motiv wäre, sich mit ihr zu beschäftigen.« Als Argument, die Alte Geschichte »im Kanon der historischen Wissenschaften« zu belassen, reiche das freilich nicht hin.
Nein, letztlich zu Gunsten der Antike spreche nicht ihre Anmut, sondern ihre Andersartigkeit, ja Fremdheit. Meier(3) beruft sich hier auf einen berühmten Satz des Altphilologen Uvo Hölscher(1): Die Antike sei »das nächste Fremde«. Weil sie so fremd sei, biete sie dem Historiker überhaupt erst die Möglichkeit, sich in eine ferne Realität zu versenken, die Welt aus einer anderen als der eigenen Perspektive zu betrachten und so dann etwa das Mittelalter, die Frühmoderne oder die Zeitgeschichte in ihrem Besonderssein erfassen zu können. Die Antike sei gewissermaßen das große Tertium Comparationis, an dem man andere Epochen, die eigene eingeschlossen, messen könne. Wer nur die jüngere Geschichte kenne, meint Meier, dem fehle der Blick für die historische »Mehrdimensionalität«, der »steht gleichsam nur auf einem Bein in der Geschichte«.
Meier(4) hat mit seinem Argument, der erkenntnistheoretische Mehrwert der Antike liege gerade in ihrer Fremdheit, 150 Jahre humanistische Ideengeschichte vom Kopf auf die Füße gestellt. Vor Meier nämlich war stets für die Beschäftigung mit Griechen und Römern geltend gemacht worden, dass die »Alten« – in Deutschland vor allem die Griechen – uns so nahe, ja womöglich geistesverwandt seien. Bereits Wilhelm von Humboldt(1) empfahl die Griechen zum Studium, weil die Deutschen »ein ungleich festeres und engeres Band an die Griechen als an irgendeine andere, auch bei weitem näherliegende Zeit oder Nation« knüpfe. Die Seelenverwandtschaft zwischen Deutschen und Griechen beschwor in dieser Tradition ein anderer Meyer(1), diesmal mit y: Eduard Meyer war der altertumswissenschaftliche Großordinarius schlechthin im Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts. Gerade als Antwort auf einen Zeitgeist, der die humanistische Bildungsidee in den Hintergrund zu drängen und statt seiner mehr Gegenwartsbezüge zu fordern schien, kam Meyer(2) immer wieder auf die Aktualität des Altertums zu sprechen. So lieferte er sich mit dem Volkswirt Karl Bücher eine erbitterte Kontroverse, in der er die von Bücher nachdrücklich bestrittene »Modernität« antiker Ökonomien nachzuweisen versuchte. In seiner Berliner Rektoratsrede vom Oktober 1919 zog der Althistoriker die für ihn naheliegende Parallele zwischen der Katastrophe Athens(1) am Ende des Peloponnesischen Krieges und dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches, dessen Zeugen Meyer und seine Zuhörer gerade geworden waren. Christian Meier hat 1970 mit seiner Frage, was uns heute noch die Alte Geschichte solle, eigentlich einen Schlussstrich unter solch anachronistische Versuche wechselnder moderner Gegenwarten gezogen, sich die Antike per Aktualisierung anzueignen. Auch wenn das noch immer geschieht, zum Beispiel dadurch, dass jüngst vermehrt von »Globalisierung« statt von »Romanisierung« die Rede ist, ist doch die Fremdheit des griechisch-römischen Altertums mittlerweile allgemein akzeptiertes Gemeingut. Trotzdem ist sie für Meier nur das Andere und nicht das »ganz Andere«, das er durch Indien(1) oder China(1) repräsentiert sieht (Schwarzafrika oder Altamerika(1) erwähnt Meier nicht). Bereits Hölscher(2) hatte ja die Antike auf die Formel gebracht, sie sei das nächste Fremde. Anders als bei Indien oder China(2) sei es bei Griechen und Römern immerhin möglich, »das Dortige auf uns zu beziehen«. Die Antike, lesen wir zwischen den Zeilen, ist uns bei aller Ferne eben doch immerhin so nahe, dass sie uns etwas angeht.
Dieser letzte Punkt ist heute präzisierungsbedürftig. Ist es in einer globalisierten Welt, in der vor allem das Reich der Mitte auf dem besten Weg ist, dem Westen wirtschaftlich und militärisch den Rang abzulaufen und großen Teilen der Welt (Afrika(1) etwa, aber mit Projekten wie der »neuen Seidenstraße« auch der europäischen Süd- und Ostperipherie) seinen Stempel aufzudrücken, überhaupt noch statthaft, die europäische Antike vor der Vergangenheit Indiens und Chinas(3) zu privilegieren? Und ist uns nicht die Antike inzwischen noch ferner geworden als anno 1970? Wie viele Schüler absolvieren heute noch das humanistische Vollprogramm mit Latein ab Klasse fünf und Griechisch ab Klasse sieben? Der Gräzist Jonas Grethlein(1) sagt es so: Mehr Kinder würden heute »mit Mangas als mit Gustav Schwabs ›Die schönsten Sagen des klassischen Altertums‹« großwerden. Grethlein wäre kein Altphilologe, würde er die Relevanz der Antike für uns nicht vor allem aus Texten herleiten. Und er wäre ein schlechter Gräzist, wenn ihm der Nachweis nicht gelänge, dass die Griechen uns in Gestalt der Tragödien und von Thukydides’ »Geschichte des Peloponnesischen Krieges« Werke von paradigmatischer Zeitlosigkeit hinterlassen haben. Solche Texte haben Bedeutung als intellektuelles Welterbe, nicht weil sie mit uns Europäern durch ein besonders enges Band der Intimität verbunden wären.
Archäologen können mit vollem Recht auf die universelle Bedeutung des Parthenon oder der Laokoon(1)-Gruppe, Philosophen auf den Grundlagencharakter der »Nikomachischen Ethik« oder der »Apologie des Sokrates(1)« verweisen und sie können mit Leichtigkeit begründen, warum selbst noch ein postklassizistisches, posthumanistisches Zeitalter gut daran tut, sich mit solchen Meilensteinen der Architektur-, Kunst(3) oder Ideengeschichte zu beschäftigen. Ohnehin stimmen jedes Jahr Millionen von Kulturreisenden mit den Füßen über die Relevanz von Orten wie Pergamon(1) oder Pompeji(1) ab.
Ich bin Althistoriker und beschäftige mich mit Geschichte. Die Geschichte ist ein abstraktes, vermeintlich dröges Ensemble von Ereignissen, Prozessen und Strukturen. Ihre Muse, Klio(1), hat es scheinbar schwerer als ihre für die schönen Künste oder die Philosophie zuständigen Kolleginnen, das geneigte Publikum zu verführen. Doch vermag auch sie Leidenschaft zu wecken. Leidenschaft entsteht da, wo sich unvermittelt verborgene Zusammenhänge offenbaren, wo sich auf einmal unter dem Wust der Zahlen und Fakten abzeichnet, wie unsere Welt geworden und was an ihr besonders ist. In einem Aufsatz mit dem etwas sperrigen Titel Die ›Objektivität‹ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis erklärt Max Weber(1), der Gründervater der Soziologie, warum wir ständig mit Kopfgeburten operieren, wenn wir versuchen, Geschichte oder Gesellschaft auf Begriffe zu bringen. Wir sagen »Sozialismus« und vergessen, dass sich hinter dem Begriff ganze Ungetüme von Definitionen und Theorien verbergen; wir sagen »Revolution« und sind uns meist kaum bewusst, dass der Begriff die Abstraktion von möglicherweise völlig unterschiedlichen realhistorischen Phänomenen ist. Weber beschreibt, wie wir die Wirklichkeit mit unseren Begriffen, die er »Idealtypen« nennt, ordnen, wie wir aber zugleich die Idealtypen aus der Abstraktion hundertfacher Wirklichkeiten gewinnen. Der Idealtypus, schreibt Weber, werde »gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde.«
Wer in der Lage ist, Idealtypen zu konstruieren, verliert seine Sprachlosigkeit im Angesicht der ehrfurchtgebietenden Komplexität der Welt. Er kann die unendliche, verwirrende Variationsvielfalt von Wirklichkeit auf Begriffe bringen und sortieren. Weber(2) war als Idealtypenbildner in einer einzigartigen Position, denn er verschlang mit nie versiegender Neugier alles Historische: die jüngere Geschichte Europas ebenso wie sein Mittelalter und seine Antike, aber auch die Geschichten Persiens, Indiens, Chinas(4), des afrikanischen Kontinents, Amerikas und auch Geschichten, für die sich damals sonst niemand interessierte, wie die der Afroamerikaner. Max Weber wäre nie auf den Gedanken gekommen, Völker für »geschichtslos« zu halten, nur weil sie nicht europäisch waren. Die Geschichte der Welt und aller ihrer Teile war für ihn die unerschöpfliche Schatztruhe, aus der er seine Idealtypen herauszog.
Gerade weil Weber(3) über ein auch in die Tiefe reichendes globalhistorisches Wissen verfügte, ließ ihn zeit seines Lebens der Sonderweg nicht los, der Europa seit der Antike vom Rest der Welt abgenabelt hatte. Nur hier war schließlich die Geschichte in die Moderne eingemündet. Das Anderssein des »Abendlandes«, wie Weber den Westen noch nennt, lässt sich für ihn auf wenige Faktoren reduzieren: die Emanzipation von theokratischen Ordnungen, das Fallen magisch-animistischer, die Gesellschaft spaltender »Tabuschranken« und die Verbrüderungsfähigkeit der antiken, besonders aber mittelalterlichen Stadtgemeinde. Herausgekommen sei dabei ein Gesellschaftsentwurf, in dem es keine von der Tradition verordneten Gewissheiten mehr gab: Über alles musste nachgedacht, über alles debattiert werden. Weber hat die »Konzeptionsstunde der Moderne« mitten in die Antike verlegt: Im »Tag von Antiochien(1)« verdichtete sich für den Soziologen das Fallen der irrationalen Barrieren, die zuvor wie Gräben die Gesellschaft gespalten hatten. Der Apostel Paulus(1) berichtet im Galaterbrief selbst von der Episode, die sich irgendwann um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. im syrischen Antiocheia(1)(1) zugetragen haben soll: Hier hielten die Apostel Paulus und Petrus(1) gemeinsam mit zum Christentum(1) bekehrten Nichtjuden – sogenannten Heidenchristen – ein Mahl. Als plötzlich der Jesus-Bruder Jakobus(1) auf der Bildfläche erschien, stand Petrus auf und beendete das Essen. Paulus hielt seinem Apostelbruder dafür eine Standpauke, die sich gewaschen hatte: Indem er die Speisegemeinschaft mit den Heidenchristen gebrochen habe, habe Petrus sich an Christus versündigt. Mit dem die Tischgemeinschaft verbietenden Gesetz sei, meint Weber leicht augenzwinkernd, die entscheidende Tabuschranke gefallen: Alle Menschen konnten jetzt Brüder werden.
Webers(4) Suche nach den Ursprüngen, auf die sich die Moderne zurückführen lässt, weist den Weg zur Antwort auf unsere Frage, warum es sich lohnt, mehr Antike zu wagen. Erstens, da stimme ich mit Jonas Grethlein(2) überein, hat das griechisch-römische Altertum womöglich mehr Paradigmatisches und daher die ganze Menschheit Angehendes hinterlassen als jede andere Zivilisation. Ein Grund dafür könnte sein, dass vieles (nicht unbedingt alles, was man ihnen früher zugeschrieben hat) von den Griechen überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte ausprobiert worden ist. Bereits Wilhelm von Humboldt(2) hat die Griechen eine »anfangende Nation« genannt. Ein britischer Archäologe hat über das archaische Griechenland(2) geäußert, es sei ein »age of experiment«. Die Formel trifft eigentlich auf die gesamte griechische(3) Antike zu. Damit ist nicht gesagt, dass Griechen und Römer das Monopol auf paradigmatisches Experimentieren hatten. Das taten selbstverständlich auch Chinesen(5), Azteken(1) oder Zulus(1). Wer mehr Antike wagt, sollte auch mehr Globalgeschichte wagen. Es ist Unsinn, die eine Geschichte gegen die andere ausspielen zu wollen. Einzigartig ist die griechisch(4)-römische Zivilisation aber insofern, dass wir mit ihr einen in sich geschlossenen historischen Zyklus vor uns haben, der von anfänglich kleinräumiger Fragmentiertheit in den »dunklen Jahrhunderten« von ca. 1200 bis 700 v. Chr. über eine den gesamten Mittelmeerraum durchdringende und um 150 n. Chr. ihren Höhepunkt erreichende engmaschige Verflechtung bis hin zur fast totalen Wiederentflechtung am Übergang von der Antike zum Mittelalter um 500 n. Chr. reicht. Das Briefcorpus des spätantiken Bischofs Sidonius Apollinaris(1) führt die Dimensionen der Entflechtung binnen weniger Jahrzehnte eindrucksvoll vor Augen. An dem Kontinuum von rund 1700 Jahren lässt sich vieles lernen, vor allem Demut. Wer die Antike von ihrem Anfang bis zum Ende überblickt, ahnt nämlich, dass das Immer-Mehr an Wohlstand, Technologie, globaler Arbeitsteilung, Verflechtung und Vernetzung kein Automatismus ist, der stets nur in eine Richtung führen muss: nach oben. Fortschritt ist nicht irreversibel, und nirgends steht geschrieben, dass nicht irgendwann eine unsichtbare Hand den großen Resetknopf drückt.
Die antiken Zivilisationen sind, zweitens, nicht nur ein Welt-, sondern auch ein europäisches Erbe, weil hier von der Antike in die Gegenwart eine direkte Linie von anderthalb Jahrtausenden Rezeptionsgeschichte führt. So geht die Formensprache aller Architektur seit dem Mittelalter, verstärkt seit der Renaissance auf antike Komponenten zurück – und selbst noch in der radikalen Abwendung von diesem Vokabular durch das Bauhaus rezipiert die Moderne indirekt die Vorbilder des Altertums. In der Literatur gehen bis heute unzählige archetypische Stoffe auf die Antike zurück – man denke an die unlängst von Feridun Zaimoglu(1) und Günter Senkel(1) nachgedichtete Antigone(1) des Sophokles(1)