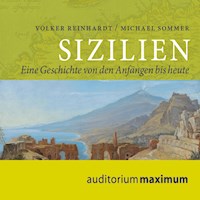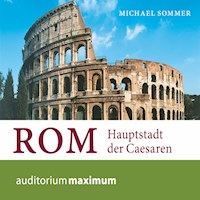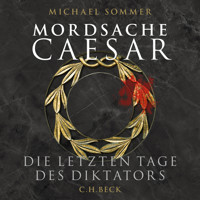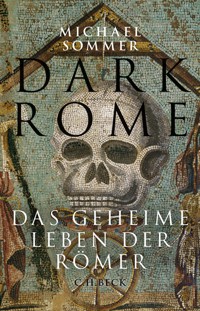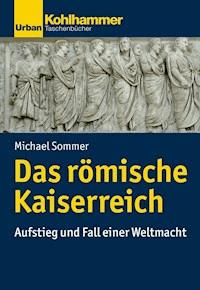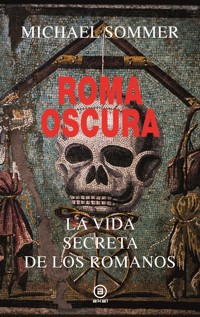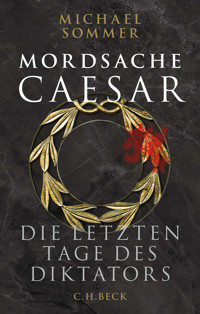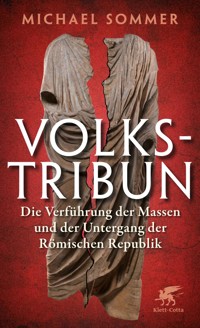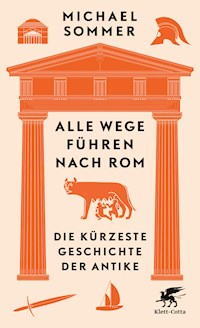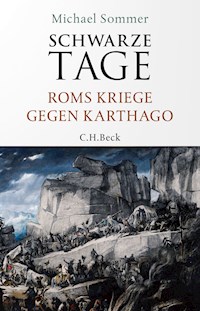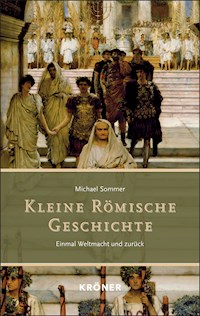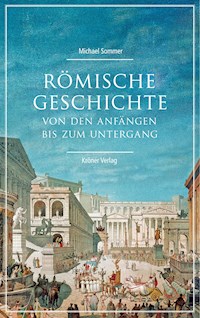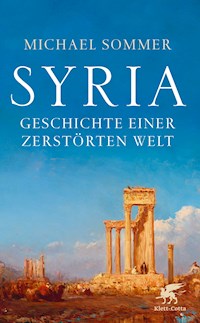9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Phönizier bildeten eine der Hochkulturen des Vorderen Orients und waren ein wirkungsmächtiger Faktor der Geschichte des antiken Mittelmeerraums. Der Band bietet einen anschaulichen Überblick über ihre Religion, ihr Wirtschaftsleben und insbesondere ihre weitreichenden Handelsbeziehungen sowie ihre politische Geschichte, in deren Verlauf die Phönizier in intensivem, gelegentlich auch konfliktgeladenem Austausch mit ihren Nachbarn standen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Michael Sommer
DIE PHÖNIZIER
Geschichte und Kultur
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
I. Wer waren die Phönizier?
II. Die Levante
Historische Geographie einer Küstenlandschaft
Phönizien – ein Land der Städte
Sukas
Arados
Amrit
Byblos
Berytos
Sidon
Sarepta
Tyros
Akko
Keisan
Dor
III. Vor den Phöniziern: Die Levante in der Bronzezeit
Primäre Zivilisationszentren: Mesopotamien und Ägypten
Syrien-Palästina
Das System der Spätbronzezeit und sein Ende
IV. Phönix aus der Asche: Die Phönizier und ihre Nachbarn in den Dunklen Jahrhunderten
Die neue Rolle der Levante
Tyros und Israel
Die Welt der Dinge: Phönizisches Kunsthandwerk
Historische Perspektiven: Texte und Artefakte
V. Phönizier in Übersee
Die Organisation des Fernhandels
Fernhandel und Kolonisation
Kition und das phönizische Zypern
Ägäis
Karthago und das punische Nordafrika
Der Golf von Neapel und Etrurien
Sardinien
Sizilien
Malta
Der ferne Westen
VI. Im Schatten der Großmächte
Imperien im Vorderen Orient
Assyrien und der Westen (ca. 1200–700 v. Chr.)
Die Phönizier als Funktionsethnie der Großreiche (ca. 700–300 v. Chr.)
Alexanders Erben
VII. Die phönizische Stadt
Das Königtum
Bausteine einer kollektiven politischen Identität
Religion
VIII. Schluss
Anhang
Zeittafel
Bibliographie
Überblicks- und Nachschlagewerke, Ausstellungskataloge
Die großen Räume
Fernhandel, Expansion und Kolonisation
Weitere Literatur
Bildnachweis
Namen- und Ortsregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
Wie schreibt man die Geschichte eines Volkes, das gar nicht existiert hat? Die «Phönizier» tauchen in zahlreichen Texten aus dem Mittelmeer und seiner näheren Umgebung auf, gleich unter vielen Namen: als Phoinikes und Sidones bei den Griechen, als «Kanaaniter» im Alten Testament, als Punii oder Poeni bei den Römern. Eine Sammelbezeichnung für sich selbst hatten die semitischsprachigen Bewohner der levantinischen Städte, die in der Eisenzeit aufs Meer hinausfuhren, mit fernen Küsten Handel trieben und sich später dort auch niederließen, offenbar nicht. Ebenso wenig hatten ihre Enkel in Karthago, in Spanien oder auf Sardinien ein Wort für die große Kultur- und Sprachgemeinschaft, die von den Seefahrern im Osten begründet worden war – und die neben dem griechischen und dem lateinischen ein drittes antikes, ein «phöniko-punisches» Mittelmeer konstituiert.
Primärer Horizont ihrer Identität war für die Menschen dieses dritten Mittelmeers – wie für die Griechen und auch wie für viele im späteren römischen Imperium – ihre Stadt. Ethnische und sprachliche Zugehörigkeit waren in einer Zeit vor dem Nationalstaat durchaus relevant, aber weniger entscheidend als in der Moderne. Die Lebenskreise mochten verhältnismäßig groß sein, die geographische Mobilität bedeutender, als sich vermuten ließe, der Rahmen für bürgerschaftliches Engagement und politische Aktivität war relativ eng. Er beschränkte sich auf die Stadt und ihr unmittelbares Umland. Das war in der griechischen Polis so, im frühen Rom und auch in den Städten des phönizisch-punischen Mittelmeers.
Gab es also keine Phönizier? Zu dieser Schlussfolgerung könnte man gelangen, wenn man sich auf die Zeugnisse verlässt, die Menschen aus Tyros, Sidon oder auch Karthago hinterlassen haben. Die britische Althistorikerin Josephine Quinn hat deshalb unlängst die Suche nach den Phöniziern für gescheitert und die Objekte der Suche zu «Phantom-Phöniziern» erklärt. Freilich ist damit wenig gewonnen: Erstens sahen ihre Nachbarn, wenn sie die Bewohner der eisenzeitlichen Levante betrachteten, eben sehr wohl das Verbindende und warfen sie deshalb semantisch in einen Topf. Und zweitens schrieben die Menschen vom Ostrand des Mittelmeers über Jahrhunderte eine gemeinsame Geschichte. Sie benutzten dieselbe Sprache, verehrten dieselben Götter, schufen Gegenstände, die sich einer einheitlichen materiellen Kultur zuordnen lassen, und lebten in Gesellschaften, die ähnlich organisiert waren, teilweise auch im selben «Staat». Die Themen dieser Geschichte rücken ebenfalls das Gemeinsame in den Lichtkegel: Seefahrt, Fernhandel, Kolonisation. Daran hatten nicht alle Anteil, die wir Phönizier nennen, und es machten auch viele mit, die anderswoher kamen. Aber die Hauptrolle in der Verflechtungsgeschichte des antiken Mittelmeers spielten lange Zeit die Städte an der Küste des heutigen Libanon.
Deshalb lohnt es sich trotz allem, diese Geschichte als eine Geschichte der Phönizier zu schreiben. Sie ist so interessant wie die der Griechen und Römer, spielte aber lange in der klassischen Altertumswissenschaft kaum eine Rolle. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten gründlich geändert. Vor allem in den Mittelmeerländern Spanien und Italien ist die phönizisch-punische Archäologie als eigenständige Disziplin entstanden. Auch die historische Forschung würdigt den Beitrag, den das dritte Mittelmeer zur antiken Zivilisation geleistet hat. Allerdings spielen Phönizier und Karthager in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer eine Nebenrolle. Dabei ging von der Levante um 1000 v. Chr. der entscheidende Impuls aus zu einem Prozess, der sich als erste Globalisierung der Weltgeschichte beschreiben ließ.
Die antike Mittelmeerwelt war ein Tummelplatz für Akteure unterschiedlichster Herkunft. In Erscheinung traten diese Akteure nicht nur als Kollektive, sondern vor allem als Individuen, die Chancen nachjagten, Risiken auf sich nahmen, Netzwerke pflegten und Wissen ansammelten. Fernhandel und Mobilität schufen vielfältige Querverbindungen zwischen entlegenen Teilen des Mittelmeers. Die scharfe Trennung zwischen Orient und Okzident, die sich in modernen Fächergrenzen spiegelt, reflektiert unkritisch eine (von vielen) antiken Lesarten: den griechischen Topos vom asiatischen Barbarentum, der in einer spezifischen historischen Situation (den Perserkriegen des 5. Jahrhunderts v. Chr.) der Stärkung panhellenischer Identität gegen den Gegner aus dem Osten gedient hatte.
Die folgenden Kapitel wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass das antike Mittelmeerbecken nicht nur geographisch, sondern auch kulturell-zivilisatorisch, bei allem Trennenden im Detail, eine Einheit war – oder besser: mit der Zeit zu einer solchen gemacht wurde. Das Buch zeichnet die Geschichte der Phönizier nach, die – noch vor den Griechen – zu Architekten dieser Einheit und damit, bezogen auf die «Welt» des Mittelmeers und seiner Randregionen, einer antiken Globalisierungswelle wurden. Ihr Fernhandel und ihr kolonisatorisches Abenteuer an den fernen Küsten des westlichen Mittelmeers ließen einen Raum allmählich zusammenwachsen, der am Beginn der Eisenzeit, um 1200 v. Chr., fragmentierter kaum hätte sein können.
Ihre Heimat hatten die Phönizier in den Städten der Levante, am Ostrand des Mittelmeers, entlang der Küsten der modernen Staaten Syrien, Libanon und Israel. Wie die Phönizier von diesen Städten aus zu entlegenen Ländern aufbrachen, sie für ihren Handel erschlossen und sich schließlich dort niederließen, ist das große Thema dieses Buches (Kapitel V).
Doch war die Expansion der Phönizier von Voraussetzungen abhängig, die zum Teil weit in die Bronzezeit zurückreichten. «Phönizier» ist eine Bezeichnung, die den Bewohnern der Levante von außen, durch die Griechen, übergestülpt wurde. Wer waren die Menschen, die von ihren Nachbarn zugleich bewundert und gefürchtet wurden, und wie lässt sich ihre Identität aus dem Material, das kaum textliche Selbstzeugnisse enthält, rekonstruieren (Kapitel I)? Wie sah es in Phönizien aus, bevor um 1200 v. Chr. eine große Strukturkrise die Voraussetzungen dafür schuf, dass die Levantestädte zu Drehscheiben des interkontinentalen Fernhandels heranwachsen konnten (Kapitel II)? Welche Dynamik setzte der Umbruch frei, und warum war es gerade Phönizien, das sich in der frühen Eisenzeit – buchstäblich wie der Phönix aus der Asche – zuerst aus den Trümmern der bronzezeitlichen Welt erhob (Kapitel IV)?
Neben der Geschichte der Phönizier in der mediterranen Diaspora steht das weitere Schicksal ihrer Städte in der Levante, die seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. unter die Vorherrschaft erst des Neuassyrischen, dann des Neubabylonischen und schließlich des Perserreiches gerieten (Kapitel VI). Schließlich verdienen Herrschaft, Religion und Gesellschaft der Phönizier Beachtung: Welche Rolle spielten der König, Magistraturen und Versammlungen, wie war es um das Pantheon der Städte bestellt, unter denen die eisenzeitlichen Metropolen Tyros und Sidon hervorragten (Kapitel VII)?
Auf gut hundert Seiten lässt sich kaum mehr als ein Überblick in groben Umrissen geben. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat Beachtliches geleistet und erheblich dazu beigetragen, die Phönizier dem historischen Zwielicht zu entreißen, das sie lange umgab. Vieles davon musste in so knappem Rahmen unerwähnt bleiben, die Auswahl ist eingestandenermaßen subjektiv. Wenn es dem Buch aber gelänge, Interesse und Verständnis zu wecken für die Komplexität mediterraner Geschichte jenseits von Griechenland und Rom – und damit für die höchst vielschichtigen Wurzeln unserer eigenen, europäischen Kultur –, so hätte es sein Ziel mehr als erreicht. Gewidmet ist es dem Andenken an Hans Georg Niemeyer (1933–2007), der wie kein anderer in seinem archäologischen Lebenswerk ebendieser Vielschichtigkeit auf den Grund gegangen ist.