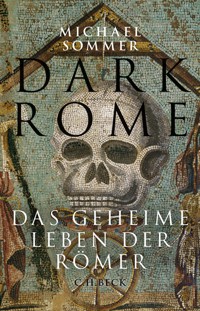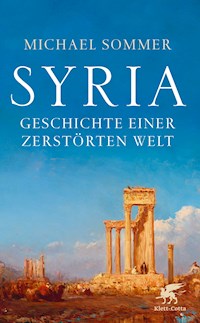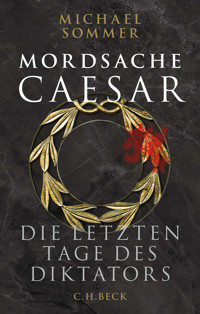
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rom hält den Atem an: Während der Senatssitzung am 15. März 44 v. Chr. ist Gaius Julius Caeser unter den Dolchen der Verschwörer fällt – tödlich verwundet durch mindestens 23 Stiche. Wie konnte es so weit kommen? Wer waren die Täter? Welche Motive trieben sie an? Als historischer Ermittler untersucht Michael Sommer den berühmtesten Mordfall der Weltgeschichte und präsentiert seine Ergebnisse – eine packende Geschichte, die sich wie ein Kriminalroman auf den unvermeidlichen Höhepunkt hin zuspitzt. Das Attentat mag Caesar unerwartet getroffen haben, doch aus heiterem Himmel kam es nicht. Im Stillen hatte sich seit längerer Zeit eine Gruppe aus alten Gegnern und enttäuschten Anhängern formiert, die ihm nach dem Leben trachteten. Nach seiner Ausrufung zum Diktator auf Lebenszeit am 15. Februar 44 v. Chr. begann sich das Netz einer Verschwörung zu spinnen, die sich auf den unvermeidlichen blutigen Höhepunkt an den Iden des März hin zuspitzen sollte. Auf Grundlage der reichen antiken Quellen schildert Michael Sommer die Geschehnisse aus den verschiedenen Perspektiven einer Vielzahl beteiligter Akteure. Mit detektivischer Genauigkeit legt er dabei die teils sehr unterschiedlichen Motive der Caesarmörder offen. Die sogartige Darstellung dieses Tyrannenmordes wird so zugleich zum Spiegel einer ganzen Epoche im Umbruch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MICHAEL SOMMER
MORDSACHECAESAR
DIE LETZTEN TAGE DES DIKTATORS
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Karte: Römisches Imperium zur Zeit Caesars
Abbildung: Digitale Rekonstruktion des Forum Romanum Anfang des Jahres 44 v. Chr.
Vorbemerkung des Historikers
ERSTER TEIL: REPUBLIK
Lucius Junius Brutus,
oder:
Der Mythos von der Freiheit
(510 v. Chr.)
Lucretias Blut
Mos maiorum
Res publica
2.0
Dignitas
Populariter agere
Caesar, oder:
Der Würfel sei geworfen
(10. Januar 49 v. Chr.)
Wälder und Triftwege
Subura
Suo anno
Drei Männer
Gallia est omnis divisa
Über den Rubikon
ZWEITER TEIL: DIKTATUR
Cato, oder:
Wie man sein eigener Herr bleibt
(12. April 46 v. Chr.)
Stoische Politik
Flurbereinigung
Tod in Alexandria
Teneo te, Africa
Cicero, oder:
Vorboten des Unheils
(September 46 v. Chr.)
Otium cum dignitate
Pro Marcello
Triumph
Juristische Brutalität
Erudituli
Trebonius, oder:
Die Sache verlangt nach einem Mann!
(Sommer 45 v. Chr.)
Hydra
Declaratio amoris
Der Tag von Narbo
Octavius, oder:
Ein unbeschriebenes Blatt
(13. September 45 v. Chr.)
Reisegesellschaft
Via Labicana
Deo invicto
Lacrimas non teneres
Kleopatra, oder:
Ein Diadem ist eines zu viel
(26. Januar 44 v. Chr.)
Dolabella
Regina
Rex
DRITTER TEIL: VERSCHWÖRUNG
Cassius, oder:
Er ist viel zu blass
(Ende Januar 44 v. Chr.)
Ein guter Freund
Nägel mit Köpfen
Mit dem Geist in die Zukunft
Marcus Brutus, oder:
Die Schrift an der Wand
(Anfang Februar 44 v. Chr.)
Praestat nemini imperare
Kennst du dich selbst nicht?
Euangelia
Antonius, oder:
Nur Jupiter ist König
(15. Februar 44 v. Chr.)
Nummer zwei
Luperkalien
Diadem
Verzockt
Ligarius, oder:
Was für eine Zeit, krank zu sein
(Ende Februar 44)
Team Tyrannenmord
Deine Brüder lagen ihm zu Füßen
Gewissensprüfung
Decimus Brutus, oder:
Die Grenzen der Pietas
(Anfang März 44 v. Chr.)
Eine Frage des Vertrauens
Caducii et Carnyces
Dextrarum iunctio
Dem Schmerz standhalten
Calpurnia, oder:
Wenn Giebel stürzen
(14./15. März, nachts)
Welcher Tod ist der beste?
Sechzig Männer
VIERTER TEIL: ATTENTAT
Pompeius, oder:
Das ist ja Gewalt!
(15. März 44 v. Chr.)
Die erste Stunde
Die vierte Stunde
Die fünfte Stunde
Die sechste Stunde
Divus Iulius, oder:
Mit dem Mut von Männern
(15.–20. März 44 v. Chr.)
Corpus Delicti
Framing
Post scriptum des Historikers
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Vorbemerkung des Historikers
Erster Teil | Republik
Zweiter Teil | Diktatur
Dritter Teil | Verschwörung
Vierter Teil | Attentat
Post scriptum des Historikers
Zeittafel
Bibliographie
Quellen (empfohlene Textausgaben mit Übersetzung)
Geschichte der römischen Republik allgemein
Staat, Gesellschaft und Elite
Caesar
Weitere Protagonisten
Die Iden des März
Der Weg in den Prinzipat
Bildnachweis
Personenregister
Ortsregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Karte: Römisches Imperium zur Zeit Caesars
Abbildung: Digitale Rekonstruktion des Forum Romanum Anfang des Jahres 44 v. Chr.
Vorbemerkung des Historikers
Am 15. März 44 v. Chr. vormittags gegen 11.30 Uhr wurde Gaius Julius Caesar, Diktator und römischer Bürger, während der Senatssitzung in der Curia Pompeia auf dem Marsfeld getötet. Der Tat dringend verdächtigt werden Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, Decimus Junius Brutus, Gaius Trebonius und etwa 60 weitere Männer, ausnahmslos römische Senatoren. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Informationen über die Planung des Anschlags haben, werden gebeten, sich zu melden.
Wie schreibt man die Geschichte eines historischen Kriminalfalls? Eines Mordes, der über 2000 Jahre zurückliegt und dessen Drahtzieher wir obendrein genau kennen? Das klassische Whodunnit im Stil von Arthur Conan Doyle oder Agatha Christie scheidet jedenfalls als Genre aus. Niemand interessiert sich für eine Mordsache, wenn der Täter von vornherein feststeht. Und bei Caesar wissen wir ja ganz genau, dass die beiden Bruti, Cassius und noch ein paar andere ihn auf dem Gewissen haben. Ist Caesars Ermordung also der falsche Stoff für eine historische Kriminalerzählung?
Keineswegs. Die Aufklärung eines Verbrechens erschöpft sich schließlich nicht in der Feststellung der Delinquenten und ihrer Personalien. An einem Kriminalfall hängt so viel mehr als die Ermittlung des Täters: der Hergang der Tat, die Umstände, das Milieu, die Hintergründe, die Vorgeschichte, das Motiv. Vor allem das Motiv. Warum musste Caesar sterben? Weil er selbst ein Verbrecher war und die Republik auf dem Gewissen hatte? Oder weil er dem grenzenlosen Ehrgeiz der Mörder im Weg stand? Wurden die Täter von Rachedurst getrieben? Handelten sie aus Gemeinsinn? Verfolgten die sechzig Männer alle dasselbe Ziel? Wohl eher nicht. Sie waren alle Individuen, mit eigener Agenda, eigenen Zielen und ihrem je eigenen Verhältnis zu Caesar. Unter den Sechzig waren eingefleischte Gegner des Diktators. Aber auch manche seiner engsten Freunde.
Caesar war kein gewöhnliches Mordopfer. Als er starb, war er Diktator auf Lebenszeit, de facto Alleinherrscher über eine Republik, die schon keine mehr war, in der aber auch keine alleinigen Machthaber vorgesehen waren. Für viele war Caesar ein Hoffnungsträger, eine Lichtgestalt. Für andere war er ein Tyrann. Die Mordsache Caesar ist ein politischer Kriminalfall. Ohne gründliche Kenntnis des politischen Koordinatensystems, in dem die Beteiligten agierten, bleibt sie unverständlich. Wer wissen will, warum Caesar sterben musste, muss zuerst begreifen, was die römische Republik in ihrem Innersten zusammenhielt – und was sie schließlich auseinanderfallen ließ. Um das zu erklären, muss man weit ausholen.
Die Geschichte von Caesars Ermordung beginnt 400 Jahre vor seiner Geburt, mit der Gründung der Republik. Spätere Generationen hatten nur noch eine vage Vorstellung von dem, was damals, um 500 v. Chr., geschehen war. Sie stellten sich ihren letzten König, Tarquinius Superbus, als grausamen Tyrannen vor. Lucius Junius Brutus war der Mann, der ihn stürzte und aus Rom vertrieb. Er trug denselben Familiennamen wie der spätere Caesarmörder Marcus Junius Brutus. Das war Zufall – und doch wieder auch nicht. Nichts geschah in der römischen Geschichte ganz zufällig. Das historische Gedächtnis war lang, und die Ahnen schwebten wirkungsmächtig über allem, was bedeutende Römer an großen Taten vollbrachten. Der Mythos vom Sturz des letzten Königs war eine Geschichte, welche die Republik mit großer Resilienz wappnete, wie man heute sagen würde. Resilienz gegen Tyrannen, Resilienz gegen Einzelne, die zu stark wurden. Der Resilienzvorrat der Republik hielt bis in die Generation Caesars. Dann war er verbraucht.
Wer den Mord verstehen will, muss das Opfer kennen, muss wissen, warum Caesar sich an entscheidenden Stellen seines Lebensweges so entschied, wie er es tat. Als er sich 60 v. Chr. mit Pompeius und Crassus zusammentat, um das freie, republikanische Spiel der Kräfte auszuhebeln. Als er 49 v. Chr. den Rubikon überschritt und damit einen Bürgerkrieg entfesselte. Und als er nach gewonnenem Bürgerkrieg die Gegner nicht mit Hass und Rache verfolgte, sondern mit demonstrativer Milde versuchte, sie in den neuen Staat zu integrieren. Clementia hieß das Zauberwort. Es war die Tugend eines Königs. Man muss die Kluft, die zwischen der alten Republik und dem neuen, von Caesar geschaffenen Staat lag, in ihrer ganzen Tiefe ausmessen, um zu begreifen, warum dieser Mann so vielen ein Dorn im Auge war. Wer Ehrgeiz und Ansehen hatte, sich als Vertreter einer jahrhundertealten Leistungselite verstand, für den stellte Caesar eine Provokation dar. Man fühlte sich herausgefordert, weil nun der Diktator darüber entschied, was Leistung war und wer Karriere machte. Weil er Loyalität belohnen und Untreue bestrafen konnte.
Deshalb haben die letzten Tage des Diktators eine lange Vorgeschichte. Die Mordsache Caesar reicht bis in die ersten Tage der Republik und tief in die Biographie des Opfers zurück. Der Ermittler muss ein Bild von Caesars Persönlichkeit gewinnen und in das Milieu eindringen, in dem in Rom Politik gemacht wurde. In der Diktatur, nach Caesars Sieg über Pompeius, findet er erste Indizien. Sie deuten an, dass sich gegen den Machthaber etwas zusammenbraute. Zuerst sind es vage Anhaltspunkte: Stimmungen, Gesten, Gesprächsfetzen. Dann, in Caesars letztem Winter, gewinnt die Verschwörung Konturen. Immer klarer zeichnet sich die Gruppe um Cassius und Brutus ab, immer mehr Zulauf erhält sie, immer entschiedener verfolgt sie ihr Ziel, den Diktator aus dem Weg zu räumen.
Der historische Ermittler kann sich nicht auf viele Indizien stützen. Erhalten sind nur ein paar Briefe, die Caesarmörder wie Brutus, Cassius und Trebonius geschrieben haben, meist an Cicero, und in denen sie sich, wenn überhaupt, dann nur zwischen den Zeilen über ihre Pläne äußern. Schließlich las der Feind womöglich mit. Der Ermittler ist also auf Zeugenaussagen angewiesen. Sie stammen von Gewährsleuten, die allesamt ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Oft schildern sie ihre eigene Version der Ereignisse, weil sie voreingenommen sind: gegen Caesar, wie Cicero, der Zeitgenosse und genaue Beobachter der römischen Politik; oder für ihn, wie die meisten, die erst zur Feder griffen, nachdem sich Augustus, Caesars Adoptivsohn, im Spiel um die Macht durchgesetzt hatte. Manche Zeugen wollen mit ihrem Bericht in erster Linie unterhalten, einer – Plutarch – ist hauptsächlich an der Moral der Akteure interessiert. Keiner der Zeugen war bei der Tat oder ihrer Vorbereitung dabei: Cicero gehörte nicht zur Verschwörung, und Zeitzeugen wie Nikolaos von Damaskus waren zur fraglichen Zeit nicht in Rom. Andere Gewährsleute, wie Velleius Paterculus, schrieben eine Generation später und wieder andere – Appian, Cassius Dio und wiederum Plutarch – sogar erst Jahrhunderte nach den Ereignissen. Woher also hatten sie ihr Wissen?
Der Ermittler muss Schneisen ins Dickicht der Überlieferung schlagen. Er muss Widersprüche aufdecken und Plausibilitäten gegeneinander abwägen. Er hat damit zu kämpfen, dass die römische Geschichtsschreibung, der er einen Großteil seiner Zeugnisse verdankt, einen besonderen Wahrheitsbegriff pflegte. Ihre Auffassung von Wahrheit weicht fundamental von der moderner Historiker ab. Die Autoren der Antike machten ihren Stoff der Rhetorik gefügig: Ein gut unterhaltender, dramaturgisch brillant gestalteter und mit Stilfiguren auftrumpfender Text war allemal besser als das dröge Referieren von Fakten. Um die Geschichte hinter den Geschichten rekonstruieren zu können, muss der Ermittler zu Theorien greifen und sich Modelle zurechtlegen. Passt das, was an Tatsachen vor uns liegt, dort hinein? Oder brauchen wir eine neue Theorie? Ohne Deutungsrahmen lässt sich den spärlichen Fakten kein Sinn abringen.
War Caesar ein Tyrann und waren seine Mörder Befreier? Oder waren Brutus und Cassius eiskalte Killer, die einen politischen Visionär um persönlicher Vorteile willen umbrachten? Diese Frage wird der Ermittler in seinem Bericht letzten Endes unbeantwortet lassen. Der Leser möge sich selbst ein Urteil bilden. Es ist nicht Aufgabe des Ermittlers, die politische Lebensleistung Caesars zu bewerten. Er kann auch kein Richter über die Mörder und ihre Moral sein. Er versucht, ihre Motive freizulegen und ihr Handeln zu erklären. Wie man die Motive bewertet, steht und fällt mit der Frage, ob man das Urteil der Mörder über ihr Opfer teilt. Für all das kann der Ermittler Anhaltspunkte liefern, nicht mehr und nicht weniger.
Er befindet sich damit in bester Gesellschaft. Die zeitlose Relevanz des Stoffes entdeckte als Erster William Shakespeare – und entwickelte daraus ein Drama von enormer Suggestions- und bleibender Faszinationskraft. Bezeichnend ist, was Historiker und Literaturkritiker jahrhundertelang in «Julius Caesar» hineingelesen haben. Sie waren ratlos: Wer ist der tragische Held? Caesar, der das Opfer von Mördern wird? Oder Brutus, der Caesar tötet, aber sein Ziel verfehlt? Hat Shakespeare ein republikanisches Drama geschrieben, das der Rechtfertigung des Tyrannenmordes dient? Oder ist das Stück pro-monarchisch, die Mörder verblendete Idealisten, die sich gegen die Zeit stemmen? Im England der Epoche waren das drängende Fragen. Lange wollte man die Ambivalenz der Figuren nicht wahrhaben: Caesar ist zugewandt, gerecht und weise, ein guter König. Aber er ist zugleich der Faszination der Macht erlegen. Brutus ist mutig, gebildet und zutiefst menschlich: das Musterbeispiel eines intellektuellen Politikers mit funktionsfähigem moralischen Kompass. Aber er erliegt der Illusion, dass er Rom – und sich selbst – aus Caesars Schatten befreien kann. Wie sich zeigt, wird ihm das nicht gelingen. Der Geist des Diktators ist nach vollbrachter Tat mächtiger als Caesar es zu Lebzeiten je war.
Shakespeare bringt in seinem Drama mit wenigen, kräftigen Strichen zwei grundlegende Dilemmata der Weltgeschichte auf den Punkt. Erstens den Zusammenhang zwischen Individuum, Ereignis und dem, was Soziologen «Kontingenz» nennen. Kontingent ist, was weder unmöglich noch notwendig ist. Menschen sind ständig Kontingenzerfahrungen ausgesetzt. Sie planen etwas und machen sich Gedanken über die Wirkungen, die sie damit erzielen. Dann tun sie es – und alles kommt ganz anders. Ihre Kontingenzerfahrung mussten auch die Caesarmörder machen. Sie glaubten, mit ihrer Tat das Rad der Geschichte zurückdrehen zu können. Stattdessen drehten sie es mit Schmackes weiter. Keiner, der auf der großen Bühne der Weltgeschichte etwas bewegt, kann genau vorausberechnen, was er mit seinem Handeln auslöst. Die «Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit», die der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz über dem Krieg schweben sah: Sie hängen über aller Geschichte.
Auch das zweite Dilemma hat mit Kontingenz zu tun. Shakespeare beschreibt im Drama, wie Standpunkte Perspektiven bestimmen. Wenn Brutus sagt:
Wolltet ihr lieber, Cäsar lebte und ihr stürbet alle als Sklaven, als daß Cäsar tot ist, damit ihr alle lebet wie freie Männer? Weil Cäsar mich liebte, wein’ ich um ihn; weil er glücklich war, freue ich mich; weil er tapfer war, ehr’ ich ihn; aber weil er herrschsüchtig war, erschlug ich ihn,[1]
dann möchten wir seiner Logik willig folgen, sobald und solange wir die Prämisse teilen: Caesar war ein Gewaltherrscher, ein Tyrann. Doch auch Wahrnehmung ist kontingent. Wo der eine den Tyrannen sieht, wähnt ein anderer den Retter; wo einer Knechtschaft fürchtet, hofft jemand anderes auf Befreiung. Shakespeare verschiebt im Drama immer wieder die Perspektive, so dass der Zuschauer hin- und hergerissen ist zwischen Brutus’ Blick auf das Geschehen und der genau gegensätzlichen Perspektive des Antonius:
Er brachte viel Gefangne heim nach Rom, Wofür das Lösegeld den Schatz gefüllt. Sah das der Herrschsucht wohl am Cäsar gleich? Wenn Arme zu ihm schrien, so weinte Cäsar: Die Herrschsucht sollt’ aus härterm Stoff bestehn. Doch Brutus sagt, daß er voll Herrschsucht war, Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann.[2]
Heute hat die Forschung Shakespeares Quelle, Plutarch, gründlich durchleuchtet und ihm etliche Schnitzer nachgewiesen. Bringt uns das weiter in der Auflösung des Kontingenzdilemmas? Nein, das heutige Caesar-Bild und das Bild, das wir uns komplementär dazu von seinen Mördern machen, oszilliert auch über 400 Jahre, nachdem der Engländer sein Drama verfasst hat, munter weiter zwischen Schwarz und Weiß. Der Ermittler kann an dieser Farbenlehre nicht rütteln. Ebenso wenig kann es der Historiker. Und so urteile der Leser.
ERSTER TEIL
REPUBLIK
Lucius Junius Brutus, oder:Der Mythos von der Freiheit(510 v. Chr.)
Ihr Peiniger kommt in der Nacht. Sextus ist der Sohn des römischen Königs Lucius Tarquinius. Mit nur einem Begleiter ist er nach Collatia geritten – ein Städtchen in der Campagna, ein paar Meilen vor den Toren Roms. Im Haus des Collatinus nimmt das Gesinde ihn gastlich auf. Sextus ist hier kein Unbekannter. Der Hausherr ist sein Cousin, die beiden zechen gern miteinander. Wie schon so oft bewirten die Diener den Königssohn auch an diesem Abend und führen ihn schließlich in das Gästezimmer. Bald ist es ruhig im Haus. Sextus wartet noch eine Weile, dann schleicht er ins Schlafzimmer von Lucretia, der Hausherrin und Frau seines Gastfreunds. Er zieht sein Schwert und presst Lucretia die andere Hand auf den Mund. Die junge Frau schreckt auf. «Ein Laut und du bist tot.» Dann gibt er sich zu erkennen und redet auf Lucretia ein. Wie sehr er sie liebt! Wie groß seine Sehnsucht ist! Er bittet und droht. Wenn sie ihm nicht zu Willen ist, wird er sich mit Gewalt holen, wonach er verlangt. Lucretia schüttelt den Kopf. Lieber will sie sterben, als ihre Ehre zu verlieren. Sextus grinst und beugt sich hinunter, ganz nah an ihr Ohr: «Wenn du tot bist», flüstert er, «dann töte ich einen deiner Sklaven und lege ihn nackt neben deine Leiche. Du weißt, was alle dann denken werden …» Das bricht ihren Widerstand, und sie lässt über sich ergehen, was sie nicht verhindern kann.[1]
Lucretias Blut
Seit Gründung der Stadt, die der Mythos Romulus zuschreibt und die der Universalgelehrte Varro auf das Jahr 753 v. Chr. datiert hat, war Rom von Königen regiert worden. Die Sage zählt insgesamt sieben, nach Romulus der Reihe nach: Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius und Tarquinius Superbus. Jedem dieser Könige schreiben Legenden zivilisatorische Leistungen zu, nur der letzte, dessen Beiname «der Arrogante» bedeutet, terrorisierte die Römer mit seinem grausamen Regiment ebenso wie ihre Nachbarn. Selbst die eigene Familie litt unter Tarquinius’ Brutalität. Der Tyrann, der sich gewaltsam an die Spitze geputscht und seinen Vorgänger hatte töten lassen, rief Opposition förmlich auf den Plan. Die Gegner kamen aus seiner nächsten Umgebung. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis.
Der arrogante Tarquinius stammte aus einer etruskischen Familie. Rom lag am Rand Etruriens, und Etrusker spielten in der Stadt früh eine wichtige Rolle. Die Kulturen befruchteten einander gegenseitig, und die Römer lernten viel von ihren nördlichen Nachbarn. Gelehrige Schüler waren sie auch in Sachen Mantik. Die Etrusker hatten es zu einiger Meisterschaft gebracht in der Kunst, die Zukunft anhand von Vorzeichen und Eingeweideschau vorherzusagen. Wie die meisten Römer und Etrusker ist auch Tarquinius Superbus vom festen Glauben an Omina und Orakel erfüllt. Deshalb handelt er sofort, als man ihm von einer Schlange berichtet, die aus einer hölzernen Säule hervorgekrochen sei. Der Vorfall wird als ungünstiges Vorzeichen interpretiert. Um seine Bedeutung zu ergründen, schickt Tarquinius drei junge Männer zum Apollon-Orakel von Delphi: die beiden Söhne des Königs und seinen Neffen Lucius Junius Brutus. Den Beinamen Brutus («der Stumpfsinnige») hat ihm seine Überlebensstrategie für das gefährliche Hofleben eingetragen: Der Königsneffe stellt sich dumm, um vor den Nachstellungen des Potentaten sicher zu sein.
In Delphi befragen die drei Männer die Pythia zur Bedeutung der Schlange. Natürlich wollen die beiden Söhne auch noch wissen, wer von ihnen die Nachfolge des Vaters antreten werde. Die Apollon-Priesterin im Orakel von Delphi pflegte ihre Wahrheiten in Rätseln zu enthüllen. Sie weissagt den Dreien, die Herrschaft in Rom werde auf denjenigen von ihnen übergehen, der als erster die eigene Mutter küssen würde. Die beiden Prinzen sind völlig perplex. Was ist hier zu tun? Schließlich befindet sich ihre Mutter hunderte Meilen entfernt in Italien. Brutus aber wirft sich zu Boden und küsst die Erde: die gemeinsame Mutter aller Menschen. Der vermeintlich Zurückgebliebene hat das Rätsel als Einziger gelöst.
Jahre später herrscht Krieg in Latium. Ein paar junge Aristokraten, samt und sonders Etrusker, versammeln sich im Zelt des Königssohnes Sextus. Der Alkohol fließt in Strömen, und man spricht – worüber auch sonst? – über Frauen. Alle loben die eigene Gefährtin in den höchsten Tönen. Ein Verwandter des Königs, Lucius Tarquinius Collatinus, ist als Einziger der Gruppe mit einer Römerin verheiratet: mit Lucretia, der Tochter des vornehmen Spurius Lucretius Tricipitinus. Er erklärt, sie sei allen anderen an Tugend überlegen. Um seine Behauptung auf die Probe zu stellen, schwingen sie sich auf ihre Pferde und reiten nach Rom. Dort finden sie zu ihrer Überraschung die werten Gattinnen vor, wie sie mit Gleichaltrigen trinken und Spaß haben. Einzig Lucretia sitzt zu Hause im Kreis ihrer Dienerinnen und spinnt Wolle, wie es sich für eine römische Matrone gehört.
«An Ort und Stelle ergriff die bösartige Lust Sextus Tarquinius, sie zu vergewaltigen», kündigt unser Berichterstatter Livius das kommende Unheil an. Wenige Tage später sucht er Lucretia in ihrem Haus in Collatia auf und bedrängt sie in der Nacht. In ihrer Not lässt Lucretia die Vergewaltigung geschehen, schickt aber, kaum ist die schreckliche Tat passiert, nach ihrem Gatten und ihrem Vater. Collatinus und Tricipitinus eilen in Begleitung zweier weiterer Männer herbei: des Königsneffen Brutus und des Publius Valerius Publicola, auch er ein römischer Aristokrat. Sie berichtet den Männern, was vorgefallen ist. Obwohl die Männer beteuern, nicht Lucretia, sondern allein der Tarquinier sei schuld an dem Vorfall, stößt sich die sittsame Dame den Dolch in die Brust. Sie wolle nicht weiterleben, um künftigen Ehebrecherinnen als Beispiel zu dienen.[2]
Die Tat ruft nach Vergeltung. Brutus ergreift den Dolch mit Lucretias Blut und spricht den heiligen Schwur:
Bei diesem Blut, das bis zu der Entehrung durch den Königssohn das reinste war, schwöre ich, und ich rufe euch, ihr Götter, zu Zeugen, dass ich Lucius Tarquinius Superbus mitsamt seinem verruchten Weib und seiner ganzen Nachkommenschaft mit Schwert und Feuer und jeder möglichen Gewalt verfolgen und nicht zulassen werde, dass diese Familie oder irgendjemand anders in Rom als Könige herrscht.[3]
Die anderen Männer nehmen, einer nach dem anderen, den Dolch in die Hand und sprechen die Eidesformel nach. Gemeinsam zieht man von Collatia nach Rom, versammelt das Volk und lässt es für die Abwahl des Tarquiniers votieren. Dann werden die Tore der Stadt geschlossen. Zu dieser Zeit belagert Tarquinius mit seinem Heer die Latinerstadt Ardea südlich von Rom. Als er von dem Staatsstreich erfährt, wendet er sich sofort gegen die Stadt am Tiber. Die Revolte greift jedoch auf seine Soldaten über, und das Heer fällt von seinem König ab. Tarquinius muss ins Exil gehen.
Nach der Vertreibung des Königs tritt erneut das Volk zusammen. Brutus begründet in einem regelrechten Staatsakt die Republik und gibt ihr auch gleich eine Verfassung mit zwei Konsuln als jährlich wechselnden Oberbeamten, die an die Stelle des Königs treten und denen Liktoren mit Rutenbündeln (fasces) als Zeichen ihrer Amtswürde voranschreiten. Außerdem setzt er die Zahl der Senatoren auf 300 fest. Dann lässt er das Volk schwören, «niemanden mehr als König in Rom zu dulden». Streng solle es über die neu gewonnene Freiheit und die republikanischen Institutionen wachen. Die Sage datiert den Sturz des letzten römischen Königs und die Gründung der Republik ins Jahr 509 v. Chr.[4]
Daran, dass sich diese Geschichte wirklich so abgespielt hat wie von Livius berichtet, sind begründete Zweifel angebracht. Verbürgte Tatsache ist immerhin die bedeutende Rolle, die Etrusker im frühen Rom spielten. Dass die Tiberstadt zeitweise unter Herrschaft einer etruskischen Familie stand, ist ebenso glaubhaft wie die von der Lucretia-Geschichte vorausgesetzte Durchmischung etruskischer und römischer Eliten.
Etliche Elemente der Schilderung passen beim besten Willen nicht ins 6. Jahrhundert v. Chr.: Konsuln als Obermagistrate gab es in der frühen Republik vermutlich genauso wenig wie das später hochgehaltene Kollegialitätsprinzip. Die Zahl von 300 Senatoren dürfte aus viel späterer Zeit stammen. Die rührselige Geschichte um die tugendhafte Lucretia beruht sicherlich auf Erfindung und die Befragung des Apollon-Orakels durch Brutus und die Königssöhne ist ebenfalls nicht historisch verbürgt. Misstrauisch macht sogar der Zeitpunkt, zu dem Tarquinius Superbus angeblich aus Rom vertrieben wurde: Nur ein Jahr zuvor, 510 v. Chr., hatten die Athener ihren Tyrannen Hippias zu Fall gebracht. Auch um das Ende der Tyrannis in der griechischen Stadt rankt sich eine Legende: Die Geschichte vom Mord an Hippias’ Bruder Hipparchos durch Harmodios und seinen Freund Aristogeiton wenige Jahre zuvor wurde zum Gründungsmythos der Attischen Demokratie. Für die Nachgeborenen spielte es keine Rolle mehr, dass Hipparchos das Opfer einer Privatrache geworden war. Was zählte, war die Plastizität der Story: Die Demokratie brauchte Helden und ein identitätsstiftendes Narrativ, und die Erzählung vom Tyrannenmord lieferte ihr beides frei Haus.
Mos maiorum
Dieselben Funktionen erfüllte auch die Geschichte um Lucretia und Brutus. Sie wirkte wie ein Resonanzboden, der die in der Republik herrschenden Normen verstärkte, ihnen Gesichter gab und obendrein noch ihren Ursprung erklärte. Die moralische Verkommenheit der letzten Tarquinier, die das Königtum in Tyrannis umschlagen ließ, macht jedermann begreiflich, warum die Monarchie im republikanischen Rom mit einem solch mächtigen Tabu belegt war. Die Herrschaft von Königen, das lehrten die Tarquinier, musste früher oder später in Gewaltherrschaft umschlagen. Wer in Verdacht geriet, nach der Alleinherrschaft zu streben, war ein toter Mann, ehe er sich’s versah. Auch dafür gab es in der römischen Geschichte halb mythische Präzedenzfälle: Spurius Cassius Vecellinus und Spurius Maelius sollen im ersten Jahrhundert der Republik nach der Königswürde gegriffen haben. Man bestrafte sie mit dem Tod, und weil man ganz sichergehen wollte, wurden zur Auslöschung jeder Erinnerung an die Delinquenten sogar ihre Häuser zerstört. Schon etwas deutlicher tritt Marcus Manlius Capitolinus aus dem die römische Frühzeit umhüllenden Dunkel. Er war ein Kriegsheld und soll kurz nach 400 v. Chr. das Kapitol gegen angreifende Kelten verteidigt haben. Später wurde ihm vorgeworfen, er plane einen Staatsstreich und wolle sich zum Alleinherrscher aufschwingen. Tatsächlich hatte er sich zum Fürsprecher verschuldeter Bürger gemacht und einen Aufstand gegen die herrschenden Patrizier angezettelt. Auch Capitolinus wurde verurteilt und hingerichtet.
Der erste Schwur des Brutus ruft die Götter zu Zeugen an, dass seine Mitverschworenen und er jeden, der nach dem Königtum strebt, mit «Schwert und Feuer» verfolgen werden. Der zweite Schwur verpflichtet alle Römer dazu, den Anfängen monarchischer Umtriebe zu wehren. Freiheit bedeutet, keinen König zu haben, das ist das erste Grundgesetz der Republik, das durch die doppelte Zeremonie des Eides sakralrechtlich zementiert wird.
Dazu bedurfte es nicht der Schriftform. Die «Verfassung» der sich auf den Trümmern des Königtums erhebenden Republik gründete sich auf keinen Rechtskodex, sondern allein auf Tradition. Die römische Gesellschaft war durch und durch konservativ, sie stand jeder Veränderung skeptisch gegenüber. Was sich einmal bewährt hatte, daran hielt man mit eiserner Entschlossenheit fest. Werte, Institutionen, Sentenzen und Handeln der Altvorderen blieben Richtschnur für jede neue Generation. Alles zusammen lagerte sich wie Sedimente im Erfahrungsschatz der Römer ab, verkapselt in dem, was sie selbst «Sitte der Vorfahren» nannten: mos maiorum.
Der mos maiorum war die übermächtige Tradition, in deren Schatten alle standen, die eine Entscheidung zu treffen hatten. Wer sich auf sie berufen konnte, hatte immer recht, wer sich außerhalb stellte, war politisch – und oft auch physisch – ein toter Mann. Was genau besagte der mos maiorum? Als Destillat aus erinnerter Geschichte war er stets auslegungs- und kanonisierungsbedürftig. Damit war er zugleich anpassungsfähig an den Zeitgeist. Der mos war kein Gesetzbuch, auch kein in sich stimmiges Konglomerat von Praktiken, Ethiken und Handlungsdirektiven. Er war, wie es der Althistoriker Uwe Walter genannt hat, ein «Pool normativer Muster». Seine Elemente konnten herangezogen werden, um eigenes Handeln zu rechtfertigen oder das Agieren politischer Gegner zu diffamieren. Was mit dem mos noch zu begründen war und womit man sich bereits über ihn hinwegsetzte, war ebenfalls Auslegungssache. Nach Caesars Ermordung zerschlug Augustus die Reste der Republik und begründete den Prinzipat als faktische Monarchie. Den Bruch mit ausgerechnet dem heiligsten Grundsatz, der seit dem Eid des Brutus in den Kern des mos maiorum eingebrannt war, verkaufte er seinen Mitbürgern aber als das genaue Gegenteil: als Wiederherstellung der durch Bürgerkrieg und die laxer werdende Moral aus den Fugen geratenen Republik.[5]
Der Mythos war sozusagen erzählter mos maiorum. Weil die Römer späterer Jahrhunderte selbst kaum etwas über die Anfänge ihrer Stadt und die Frühzeit der Republik wussten, füllten sie das Vakuum mit Geschichten, solchen wie der von Romulus und Remus oder eben Lucretia. Die Geschichten haben eine doppelte Funktion: Erstens erklären sie das historische Gewordensein der Gegenwart. Sie führen Institutionen, Gebäude, Kulte, Verhaltensweisen, Freund- und Feindschaften auf ihre Ursprünge zurück und verleihen ihnen ein ehrwürdiges Alter. Die Aeneis, Roms Nationalepos aus der Feder des augusteischen Dichters Vergil, schildert die Irrfahrten von Aeneas, dem Flüchtling aus Troja und Gründer von Roms Vorgängersiedlung Alba Longa. Vergil lässt Aeneas auf seiner Reise im Karthago der Königin Dido Station machen, wo sich der Held und die Königin ineinander verlieben. Weil Aeneas Dido in Erfüllung seiner Pflicht wieder verlässt und nach Italien weitersegelt, begeht die Karthagerin Selbstmord, aber nicht, ohne vorher Rache zu schwören. Der Mythos liefert einen Grund für die historische Erbfeindschaft zwischen Rom und Karthago, die sich in drei großen Kriegen im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. entlud. Die Dido-Geschichte ist dabei eine spätere Hinzufügung zur viel älteren Sage um Aeneas.
Doch der Mythos hat noch eine zweite, normsetzende Funktion: Er legitimiert bestehende Verhältnisse und begründet Ansprüche. Viele Geschichten werden vor allem aus diesem Grund erzählt. Die Erzählung von Lucretia und Brutus war eine mächtige Waffe in der Hand all derjenigen, die verhindern wollten, dass Einzelne zu mächtig wurden. Wir werden noch sehen, wie sie eingesetzt wurde, um gegen Caesars Diktatur Stimmung zu machen. Auch lange nach dem Ende der Antike ließ sich der Mythos immer wieder reaktivieren: im England Shakespeares, wo der Bürgerkrieg zwischen Republikanern und Monarchisten seine Schatten vorauswarf, im Freiheitskampf der amerikanischen Kolonien, im revolutionären Frankreich und in der kurzlebigen, 1849 von Giuseppe Mazzini proklamierten Repubblica Romana.
Charakteristisch für römische Mythen war, dass auch die großen Familien der Republik Kapital daraus schlagen konnten. Die gens Iulia, der Caesar entstammte, führte sich auf Aeneas höchstpersönlich zurück und damit auf die Göttin Venus, die Mutter des Helden. Die Abstammung wurde von Caesar politisch instrumentalisiert, der im Zentrum des von ihm errichteten Forums einen Tempel für Venus Genetrix («Stammmutter») anlegen und auch Münzen mit dem Bild der Göttin prägen ließ. Eine Generation später erkannten die Leser von Vergils Aeneis in dem Protagonisten Aeneas das Alter Ego seines entfernten Nachkömmlings Augustus. Auch hier wurde mit mythischer Abstammung Politik gemacht: Aeneas verkörperte die Werte, auf denen Augustus seine Alleinherrschaft begründet hatte, vor allem die unverbrüchliche Loyalität den Göttern gegenüber: pietas.
In der Geschichte um den Sturz des Königtums tritt mit Brutus ein aristokratisches Geschlecht ins Rampenlicht, das in der mittleren und späten Republik weit verzweigt war und dessen Vertreter wichtige Positionen bekleideten: die gens Iunia. Besonders prominent waren ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. die Iunii Bruti. Allerdings waren diese Junier nichtadlige Plebejer, Lucius Junius Brutus aber hatte dem ursprünglichen, patrizischen Adel der Tiberstadt angehört. So jedenfalls will es der Mythos. Vermutlich erfanden sich die plebejischen Junier ihre ruhmreichen Vorfahren samt familiärem Anhang kurzerhand, als sie im 3. Jahrhundert als Teil der neuen, patrizisch-plebejischen Aristokratie zu Macht und Einfluss gelangt waren. Ein Ahnherr, dem die Republik ihre Freiheit zu verdanken hatte, konnte im Ehrhaushalt des Gemeinwesens außerordentlich gute Dienste leisten.
Silberdenar des Marcus Junius Brutus, 54 v. Chr. Avers: Jugendlicher Kopf der Libertas mit Kranz nach rechts. Legende: LIBERTAS. Revers: Amtsdiener, Liktoren, Lucius Junius Brutus (2. v. r.) nach links. Legende: BRVTVS.
Silberdenar des Lucius Plaetorius Cestianus, 43/42 v. Chr. Avers: Bärtiger Kopf des Marcus Junius Brutus nach rechts. Legende: BRVT(us) IMP(erator)/L(ucius) PLAET(orius) CEST(ianus). Revers: Pileus, von zwei Dolchen eingerahmt. Legende: EID(ibus) MAR(tiis).
Auch der Caesarmörder Marcus Junius Brutus wusste sich dieser Ressource zu bedienen. Er ließ als junger Mann 54 v. Chr. Silberdenare prägen, die auf der Vorderseite das jugendlich schöne Haupt der Göttin Libertas (die personifizierte Freiheit) mit einem Kranz im Haar zeigen. Auf der Rückseite dieser Denare sind vier Gestalten zu sehen, die in einer Art Prozession unterwegs sind. Bei der dritten Person von links handelt es sich um den Republikgründer Lucius Brutus. Eingerahmt wird er von zwei Liktoren mit ihren Rutenbündeln als Symbol seiner konsularischen Amtsgewalt. Ihnen voran geht ganz links ein Amtsdiener. Brutus konnte über das Bildprogramm der Münzen entscheiden, weil er einer der IIIviri monetales war. In das Kollegium der Münzmeister wurden Nachwuchspolitiker durch die Quästoren berufen. Für viele war es die erste Gelegenheit, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Es ist bezeichnend, dass Marcus Brutus sie nutzte, um seinem legendären Vorfahren Lucius Brutus ein Denkmal zu setzen. Mehr als zehn Jahre später, 43 v. Chr., gaben Brutus und die anderen Caesarmörder dann Denare mit dem Bildnis des Lucius Brutus aus. Auf der Rückseite war der Pileus zu sehen, die Zipfelmütze, die in Rom Sklaven am Tag ihrer Freilassung trugen und mit der noch heute die Marianne der Französischen Revolution dargestellt wird. Das Symbol der Freiheit wird flankiert von zwei Dolchen und der abgekürzten Legende: EID MAR (eidibus Martiis) – «Die Iden des März». Wer die Münze in die Hand nahm, verstand die Symbolik sofort: Der Tyrannenmord hatte Rom die Freiheit zurückgegeben, die Mörder hatten sich also an den Eid gehalten, den Lucius Brutus den Römern einst abgenommen hatte. Ganz im Sinne dieses Ahnherrn waren Dolche die Werkzeuge, mit denen der mos maiorum vollstreckt wurde.
Res publica 2.0
Die Republik, die Lucius Brutus begründet hatte, war ein Projekt der Elite, ihre Freiheit die Freiheit der ganz Wenigen. In den Spitzenämtern wechselte sich ein kleiner Zirkel von Männern ab, die wir «Patrizier» nennen. Bei den Römern hießen sie schlicht «Väter», patres. Von den gewöhnlichen Zeitgenossen hoben sie sich durch alle möglichen Standesinsignien ab. Nur Patrizier durften Schuhe aus rotem Leder tragen, und die wichtigen Ämter sowie Priesterschaften waren allein ihnen vorbehalten. Natürlich blieb man unter sich: In aristokratische Familien konnte nur einheiraten, in wessen Adern blaues Blut floss. Immer hermetischer isolierte sich die Oberschicht der Patrizier vom Rest der Gesellschaft. Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., zwei Generationen nach Gründung der Republik, brachte man am Tiber zum ersten Mal Recht in schriftliche Form. Die Gesetze der «Zwölf Tafeln» brachen mit dem Faustrecht, gossen aber auch die Privilegien der Patrizier in Paragraphen. Wer nicht zu dem erlauchten Zirkel gehörte, hatte nichts zu sagen. Weil sie praktisch nur soziales Füllmaterial waren, hießen diese Leute Plebejer, von lateinisch plere – «voll machen». Gemeinsam bildeten sie die Plebs.
Doch bald schon mussten die Patrizier erkennen, dass ohne diese Leute in Rom kein Staat zu machen war. Erstens brauchte die Stadt in der Mitte Italiens Soldaten, um sich gegen ihre zahlreichen Feinde behaupten zu können: erst die Stämme der unmittelbaren Nachbarschaft, dann die Etrusker, schließlich die Kelten im Norden und die Samniten und Griechen im Süden der Apenninhalbinsel. Die Plebejer, weit zahlreicher als die Patrizier, stellten das Gros des Heeres, blieben aber, wenn es um die Verteilung von Einfluss und Ämtern ging, außen vor. Zweitens waren die Plebejer alles andere als eine homogene Gruppe. Viele von ihnen besaßen nichts, aber eine wachsende Minderheit gelangte zu Wohlstand, zahlte Steuern und konnte sich einen gehobenen Lebensstil wie die Patrizier leisten: Man besaß große Landgüter, die reiche Dividende abwarfen, und gab sich aristokratischem Müßiggang hin. Die reichen Plebejer und die als Schwerbewaffnete im Heer dienenden Angehörigen der Mittelschicht machten ihrem wachsenden Unmut über das Herrschaftsmonopol der Patrizier Luft. Ein effektives Mittel des Widerstands war schon damals der Streik: Die Plebejer zogen aus Rom heraus und auf die Kuppe des Aventin im Süden der Stadt. So verweigerten sie demonstrativ jede Mitwirkung an den Geschäften der Gemeinde. Die Plebs konstituierte sich als gesetzgebende Körperschaft und wählte eigene Magistrate. Aufgabe der Volkstribune war es, Übergriffe der Patrizier abzuwehren und sich im Konfliktfall schützend vor die Plebejer zu stellen. Dazu stattete man sie mit weitreichenden Kompetenzen aus. Sie konnten die Plebs zusammenrufen und Gesetze einbringen. Außerdem war ihre Person kraft sakralen Rechts unantastbar.
Der Überlieferung nach soll eine secessio plebis schon wenige Jahre nach Gründung der Republik stattgefunden haben: 494 v. Chr. Der erste «Auszug» der Plebs datiert aber wohl noch nicht ins zweite Jahrzehnt der Republik. Erst ab der Mitte des 5. Jahrhunderts traten die Plebejer periodisch immer wieder in den Ausstand und setzten die secessio als Druckmittel ein, um Zugeständnisse von den Patriziern zu erpressen. Die «Ständekämpfe» dauerten rund 200 Jahre und endeten mit dem fast vollständigen Sieg der Plebejer: Nicht nur waren ihnen fortan – abgesehen von ein paar Priesterkollegien – sämtliche Magistraturen zugänglich, die Beschlüsse der Plebs, plebis scita, erlangten außerdem Rechtsverbindlichkeit für das gesamte Volk. Der Volkstribunat verlor seinen usurpatorischen Charakter und wurde ins Tableau der übrigen Magistraturen mitaufgenommen.
Allmählich entstand daraus eine rechtlich formalisierte Ämterlaufbahn mit vier Stufen, der cursus honorum: Eingangsamt war die Quästur, in deren Geschäftsbereich die Finanzen lagen. Es folgte die Ädilität, deren Inhaber die Aufsicht über öffentliche Gebäude, Gladiatorenspiele und religiöse Feiern führten. Vor allem waren sie für die Finanzierung zuständig – aus eigener Tasche wohlgemerkt. Wer politisch Karriere machen wollte, brauchte Geld, viel Geld. Die dritte Stufe bildete die Prätur, das Richteramt der Republik. Krönender Abschluss jeder Karriere war der Konsulat. Die Konsuln führten den Oberbefehl im Krieg und gaben jedem Jahr ihren Namen. Der Erste Punische Krieg brach also nicht 264 v. Chr. aus, sondern im Konsulat des Appius Claudius Caudex und des Marcus Fulvius Flaccus. Alle fünf Jahre wurden außerdem zwei Zensoren gewählt. Sie aktualisierten die Senatsliste, indem sie neue Mitglieder daraufsetzten und alte davon strichen. Der Rausschmiss drohte Senatoren, wenn sie nicht mehr reich genug waren, um zur obersten Vermögensklasse der sogenannten Ritter zu gehören, oder sich durch ihren Lebenswandel als unwürdig erwiesen hatten. Jedes der Ämter wurde von mindestens zwei Personen übernommen, keines bekleidete der Träger länger als ein Jahr. Anstelle der Ädilität konnten Plebejer als zweite Stufe des cursus honorum auch den Volkstribunat übernehmen, die einzige Magistratur, zu der Patrizier keinen Zugang hatten. Eigentlich waren die Schutz- und Repräsentationsfunktionen des Volkstribunats mit dem Sieg der Plebs in den Ständekämpfen obsolet geworden. Der Volkstribunat war deshalb schon im 3. Jahrhundert v. Chr. kaum mehr als ein institutionelles Relikt. Doch so war sie eben, die römische Gesellschaft: konservativ bis ins Mark. Sogar an einem funktionslos gewordenen Überbleibsel hielt sie unbeirrt fest.
Die «zweite» Republik, die schließlich aus den Ständekämpfen hervorging, ruhte auf fünf Säulen: erstens auf der überragenden Autorität des Senats, zweitens auf der kompetitiven Besetzung der Magistraturen durch Volkswahl aufgrund von Leistung, drittens auf die Gesellschaft durchziehenden vertikalen und horizontalen Bindungen wechselseitiger Loyalität, viertens auf der grundsätzlichen Bedeutung, die der persönlichen Ehre für das politische Handeln des Einzelnen zukam, und fünftens auf dem Glauben an die Macht der Genealogie.
Die Ämter ebneten ihren Trägern den Weg in den Senat. Wer mindestens die Quästur bekleidet hatte, war qualifiziert, per Beschluss der Zensoren in das Hohe Haus aufgenommen zu werden. Dort saßen sie dann abgestuft nach der letzten Magistratur, die sie bekleidet hatten. Wie alles in Rom war auch die Geschäftsordnung des Senats streng hierarchisch. Als Erste ergriffen die früheren Konsuln mit den meisten Dienstjahren das Wort. Meist war eine Debatte schon ausdiskutiert, wenn alle Konsulare und vielleicht ein paar ehemalige Prätoren gesprochen hatten. Senatoren, die noch kein hohes Amt bekleidet hatten, waren Hinterbänkler: Stimmvieh, das nur zählte, wenn man zur Abstimmung schritt. Im Senat – und hier allein – wurden die Weichen der römischen Politik gestellt. Das Gremium traf Beschlüsse, die erst einmal nicht rechtskräftig waren, sondern durch die Konsuln oder Volkstribunen dem Volk zur Annahme vorgelegt werden mussten. So unangefochten war allerdings die Autorität des Senats, dass das Volk die Gesetze in aller Regel kommentarlos abnickte. Ohnehin war die Volksversammlung kein Ort für politische Debatten. Stumm trat das Volk, in Abteilungen gegliedert, an die Urnen. Seine Funktion erschöpfte sich darin, Senatsbeschlüsse durch Abstimmung zu ratifizieren und per Wahl das politische Personal zu legitimieren.
Dignitas
Die Ämter waren Ehrenämter, honores. Sie brachten nichts ein, sondern kosteten im Gegenteil die Inhaber und mehr noch die Bewerber Unsummen von Geld. «Ehre» ist der Schlüsselbegriff zum Verständnis der römischen Elite. Das gesamte politische System beruhte darauf, dass sich Leistung in Ehre umtauschen ließ. Das lateinische Äquivalent zu Ehre ist dignitas. Sie ist der universell gültige und von allen verstandene Gradmesser für den Rang, der einem Individuum in der Hackordnung der römischen Elite zukommt. Dignitas bezeichnet den Wert eines Mannes im Auge seiner Mitmenschen. Jeder römische Aristokrat wurde so erzogen, dass sein Sinnen und Trachten stets auf die Anerkennung durch Dritte gerichtet war. Dignitas bemaß sich nach Bekanntheit, nobilitas, Einfluss, auctoritas, und vor allem nach honores. Bedeutend für die Stellung des Einzelnen unter seinen Standesgenossen war auch die Zahl der Klienten, clientes, und Freunde, amici. Je einflussreicher und angesehener ein römischer Aristokrat, desto besser war er in der Gesellschaft vernetzt. Informelle Bindekräfte unbedingter gegenseitiger Loyalität ketteten ihn horizontal an Gleichrangige (amici) und vertikal an sozial Niedrigerstehende (clientes). In einem auf Lücke gebauten Staat wie dem römischen, in dem es keine Polizei und keine Strafverfolgungsbehörden gab, leisteten amicitia und patrocinium – das lateinische Wort für Patronage – einen nicht geringen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Außerdem ließ sich mit den Bindekräften in den politischen Gremien, Senat und Volksversammlung, Stimmung erzeugen und Willensbildung organisieren: Man mobilisierte Freunde und Klienten, damit möglichst viele Bürger zur Volksversammlung kamen und dort ihre Stimme dem richtigen Kandidaten gaben. Ehre war schließlich auch an Wirkungsmöglichkeiten geknüpft: Wer andere an dignitas überragte, dem wurden neue Felder zur Bewährung zugewiesen und damit Gelegenheit gegeben, die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Leistung, Ehre, Macht: Ohne diesen Dreiklang ging in der Republik nichts.