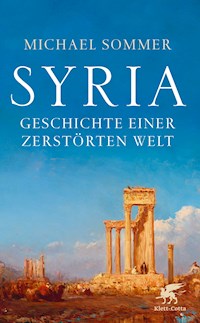22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die dunkle Seite der Macht Michael Sommer erweckt eines der turbulentesten Kapitel der römischen Geschichte zum Leben: skupellose Politiker wie Caesar, Pompeius und Clodius, Bandenkriege und Tabubrüche. Er zeigt das alte Rom als aufregend-verstörendes Laboratorium, an dem sich paradigmatisch für alle Epochen zeigen lässt, wie »Populismus« politische Gewalt gebiert und wie Verführung genutzt wird, um eine bestehende Ordnung zu stürzen. Wie treibt man eine Republik in den Ruin? Mit welchen Mitteln kann man eine politische Elite zwingen, dass sie kampflos ihre Positionen und die von ihr getragene Ordnung preisgibt? Michael Sommer gewährt einen ungewöhnlichen Einblick in das Uhrwerk der römischen Politik und die Machenschaften ihrer Protagonisten: Er zeigt den Volkstribunen Publius Clodius als Virtuosen der Verführung. Im Auftrag des mächtigen Cäsar entfesselte er eine Orgie der Gewalt und verwandelte die Straßen Roms in ein Schlachtfeld. Er kontrollierte die öffentliche Meinung und verwandelte den republikanischen Freiheits- in einen Gewaltraum: Wer unter seinen Gegnern nicht das Opfer von Tätlichkeiten wurde, dem wurde so effektiv gedroht, dass er den Mund hielt. Doch Clodius agierte stets auch auf eigene Faust: Als Bandenführer mit unbändiger Energie und dem Vorsatz, seinen Willen gegen alle Regeln der Republik durchzusetzen, schrieb Clodius die Signatur der Epoche, die eine zeitlose Warnung an uns alle enthält: Zahlen sich Gewalt und die Verführung der Massen aus?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Sommer
Volkstribun
Die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247105
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98644-0
E-Book ISBN 978-3-608-12241-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Prolog: Die Verführung der Massen
Der Leviathan
Das Volk führen
Den Leviathan reiten
Das Volk verführen
Erster Akt: Der Patrizier
Pompa Funebris
Blutvergießen
Gens Claudia
Caecus
Zweiter Akt: Der Aufrührer
Flammen über Asien
Eine römische Jugend
Ans Ende der Welt
Meuterei
Auf verlorenem Posten
Dritter Akt: Der Transvestit
Im Mainstream
Bona Dea
Transitio
Tage des Zorns
Brechende Schutzwälle
Inimicissimus Caesaris
Vierter Akt: Der Dompteur
Vier Gesetze
Vis et furor
Durchregieren
Nemesis
Fünfter Akt: Der Revolutionär
Pro domo
Prozesse
Neue Realitäten
Via Appia
Epilog: Der Untergang der römischen Republik
Nachspiel auf dem Gericht
Acta est fabula
Danksagung
Anmerkungen
Vorwort
Prolog: Die Verführung der Massen
Erster Akt: Der Patrizier
Zweiter Akt: Der Aufrührer
Dritter Akt: Der Transvestit
Vierter Akt: Der Dompteur
Fünfter Akt: Der Revolutionär
Epilog: Der Untergang der römischen Republik
Literatur
Bildnachweis
Register
Allen, die sich den staatsmännischen Takt für das Mögliche und Unmögliche bewahren.
Vorwort
Als Bibulus(1), der Konsul, mit Lucullus(1) und Cato(1) auf das Forum hinunterging, stürzte sich die Menge auf ihn und zerbrach die Rutenbündel seiner Liktoren. Jemand warf Bibulus einen Eimer mit Jauche über den Kopf, und zwei der Tribunen, die ihn begleiteten, wurden verwundet.[1]
Bibulus(2) bekommt es nicht gut, dass er sich im Wendejahr 59 v. Chr. seinem Kollegen Caesar(1) und dessen Gesetzgebung in den Weg stellen will. Die von Caesars Gefolgsmann Vatinius(1) aufgehetzte Menge schreckt vor roher Gewalt nicht zurück. Die Quellen berichten von tätlichen Angriffen gegen den Konsul und die ihn begleitenden Volkstribunen. Die Fasces der Liktoren, das Symbol seiner Würde als höchster Magistrat der Republik, werden zerbrochen. Der in Rom traditionell so ausgeprägte Respekt vor dem Amt, so scheint es, hat sich in nichts aufgelöst. Nur Plutarch(1) lässt uns am unappetitlichen Höhepunkt des Spektakels teilhaben: Ein Teilnehmer der Demonstration ist offenbar so wütend auf Bibulus, dass er einen Eimer Jauche über seinem Kopf entleert.
Zehn Jahre vor diesen Ereignissen, Ende 69, führt der Prokonsul Lucullus(2) Krieg in Asien. Seine Legionäre marschieren durch die Schluchten des Kaukasus(1) und über die endlosen Ebenen Mesopotamiens: durch Landstriche, in die noch nie ein Römer seinen Fuß gesetzt hat. Lucullus hat, nachdem er in Asien eingetroffen ist, die Steuerlast der Provinz reduziert und die astronomischen Gewinne der römischen Bankiers mit einem Deckel versehen. Das rächt sich nun. Die Lobby der Finanzhaie setzt in Rom das Gerücht in Umlauf, Lucullus ziehe von Ruhmsucht getrieben den Krieg in die Länge. Rund zweieinhalb Jahre später ist der große General und Feinschmecker sein Kommando los.
Shitstorms und Fake News: Diese Methoden des politischen Kampfes kommen uns heute nur allzu vertraut vor. Gewalt und Desinformationen sind gefährliche Waffen, die sich nicht nur gegen Gegner richten, sondern ganze politische Systeme aus den Angeln heben können. So geschah es auch in der Spätzeit der römischen Republik. Als Lucullus(3) seinen Krieg in Asien führte, schien die Republik unangefochten, ihre politische Führungsschicht fest im Sattel zu sitzen. Zwanzig Jahre später tobte der Bürgerkrieg, Caesar(2) holte zum tödlichen Schlag gegen die Ordnung aus, die jahrhundertelang allen Krisen getrotzt hatte.
Dieses Buch will Schritt für Schritt rekonstruieren, wie es dazu hatte kommen können. Wie der Republik allmählich die Republikaner davonliefen und die Elite ihre Autorität verlor. Jede Geschichte braucht einen Helden. Diese hier hat einen Protagonisten, der vielen heute als Antiheld gilt, aber für unzählige Römer doch ein Held war: Publius Clodius(1) Pulcher wurde in eine der angesehensten und mächtigsten Familien der römischen Republik hineingeboren. Er brachte alles mit, um in dieser Republik selbst strahlende Erfolge feiern zu können. Trotzdem widmete er sein politisches Leben der Zerstörung ihrer Ordnung. Und wurde am Ende selbst unter den Trümmern begraben, die er hinterlassen hatte. So oder so ähnlich ließe sich die Geschichte des Publius Clodius erzählen.
Man kann sie aber auch ganz anders schreiben. Das römische Volk war frei. Aber die meisten Bürger konnten mit dieser Freiheit wenig anfangen, weil sie arm und abhängig waren. Clodius(2) machte den Römern ihre Bedürftigkeit bewusst. Er brachte sie dazu, ihren Schmerz laut herauszuschreien, wurde selbst zum Resonanzboden ihres Schmerzenschreies und zeigte ihnen, wie sie sich Linderung verschaffen konnten. In einem System, das von einer tyrannischen Aristokratie beherrscht wurde, ging das nur mit Gewalt. Clodius wurde der Held der Massen, und als er tot war, feierte die Volksmenge ein blutiges Requiem für ihn.
Wer war dieser Clodius(3) zu Lebzeiten? So genau wussten das vermutlich nicht einmal seine Zeitgenossen. Ständig wechselte er Bündnispartner und Rollen, stets ließ er seine Mitmenschen im Unklaren darüber, ob er eine Maske trug oder sie sein wirkliches Gesicht vor sich hatten. Clodius war als Publius Claudius Pulcher zur Welt gekommen. Irgendwann, wir kennen nicht den genauen Zeitpunkt, änderte er seinen Namen in Clodius. So sprach das Volk auf der Straße »Claudius« aus. Wollte er damit ein Zeichen seiner Volkstümlichkeit setzen? Denkbar, doch womöglich war der Namenswechsel kein politisches Programm, sondern einfach eine Frage des Zeitgeistes. Man war gern extravagant, und besonders extravagant war es, wenn Hocharistokraten dem Volk aufs Maul schauten. Zwei von Clodius’ Schwestern nannten sich Clodia(1)(1), aber die Brüder Gaius(1) und Appius(1) blieben beim aristokratischen Claudius, und Clodius’ Kinder kehrten zum traditionellen Gentilicium ihrer Familie zurück. Moden ändern sich schnell.
Es gibt Biografien, die erinnern an ein klassisches Drama. Die Handlung strebt unaufhaltsam einem Höhepunkt zu, von dem es im letzten Akt steil bergab geht. Der Held wird von einem Schauspieler verkörpert, der Maske und Kostüm stetig wechselt, doch darunter bleibt er stets er selbst. Er und die übrigen Protagonisten bewegen sich auf einer Bühne zwischen Kulissen, von denen einige unverrückbar installiert sind, die sie aber zum Teil auch nach Gutdünken herumschieben können. Clodius(4) war ein Kulissenschieber. Stets sorgte er dafür, dass die Requisiten auf der Bühne so standen, dass sie ihm Deckung boten und seinen Mitspielern im Wege standen.
Der Held des Dramas, das hier erzählt wird, war auch ein Rollenspieler. Nie ist der Rollenspieler das, als was er sich zeigt. Clodius(5) brillierte während seines Erwachsenenlebens in den unterschiedlichsten Rollen: Geboren als Patrizier, zum Aufrührer geworden im fernen Armenien(1), ein (nicht nur) politischer Transvestit, Dompteur der Massen und verhinderter Revolutionär. Stets verbarg sich unter der Maske derselbe Clodius, das Produkt einer vierhundertjährigen Familiengeschichte im Zentrum der Macht. Im Umgang mit der Macht und den anderen Mächtigen konnte sich diese Familie ein Quantum Souveränität genehmigen, das anderen abging. Das prägte. Wie viele Angehörige seiner Familie war Clodius ein politischer Solitär: rücksichts- und bindungslos, aber auch origineller und virtuoser in seinem Stil, Politik zu machen.
Zu besonderer Virtuosität brachte Clodius(6) es in der Entfesselung von Gewalt. Dieses Buch ist eine Geschichte über Gewalt. Über das, was Gewalt in der Politik anrichten kann.
Prolog: Die Verführung der Massen
Die Geschichte der römischen Republik ist eine welthistorisch einzigartige Geschichte des Erfolgs. 509 v. Chr., als der Legende nach der letzte König gestürzt und die Republik ausgerufen wurde, war Rom(1) ein Flecken am Unterlauf des Tibers(1) in der Mitte Italiens(1). Das Territorium der Stadt konnte ein guter Wanderer bequem an einem Tag durchqueren. Gut hundert Jahre später hatten die Römer die etruskische Nachbarstadt Veji(1) erobert und ausgelöscht, ihr Land annektiert. Nach noch einmal einem guten Jahrhundert, man schrieb das Jahr 275 v. Chr., war ganz Italien erobert. Die Republik hatte sich ihres ersten Feindes entledigt, der nicht aus Italien kam: des Molossers Pyrrhos(1), der zunächst im Auftrag der griechischen Stadt Tarent Krieg gegen Rom geführt hatte. Am Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. waren die Tiberstadt und ihre Verbündeten mit Hannibal(1) fertiggeworden, einem ungleich gefährlicheren Gegner. Karthago(1), die mächtigste Rivalin im westlichen Mittelmeerbecken, lag am Boden. Und noch einmal gut 50 Jahre später konnten die Römer das gesamte Mittelmeer(1) mit Fug und Recht als »ihr« Meer bezeichnen: mare nostrum. In rund 350 Jahren war die Republik vom mittelitalischen Kleinstaat zur beherrschenden Macht der mediterranen Welt aufgestiegen.
Der Leviathan
Die Geschichte der römischen Republik ist eine welthistorisch einzigartige Geschichte des Misserfolgs. Denn am Ende scheiterte die res publica, deren unbedingtem Herrschaftsanspruch sich ein Stadtstaat, ein Stamm, schließlich ein großes Imperium nach dem anderen hatte beugen müssen. Sie scheiterte nicht an äußeren Feinden, denn die hatte sie schließlich alle vom Spielfeld genommen. Sie scheiterte an sich selbst – und an ihrer Unfähigkeit, die zu zähmen, auf die es in der politischen Arena ankam: die breite Masse der Bürger, vor allem aber die Elite, die in Rom ein kleiner, streng vom Rest der Gesellschaft abgeschotteter Zirkel war. Wie konnte es dazu kommen?
Philosophen und Theologen streiten noch heute über die Frage, ob der Mensch gut sei oder böse. Einigkeit besteht immerhin in dem Punkt, dass der Mensch seiner biologischen und mentalen Grundausstattung nach defizitär ist. Aristoteles(1) hat daraus gefolgert, er sei ein soziales Lebewesen: zoon politikon. Nur durch Zusammenarbeit mit anderen Menschen könne er überleben. Thomas Hobbes(1) hingegen glaubte, dass im Urzustand der Menschheit ein Krieg Aller gegen Alle herrsche. Der Mensch an sich sei egoistisch und zu sozialem Handeln nur befähigt, wenn er dazu gezwungen wird. Um den zerstörerischen Krieg zu überwinden, hätten sich die Menschen per Gesellschaftsvertrag darauf geeinigt, einen Teil ihrer natürlichen Freiheiten und Rechte zu opfern. Sie hätten so den Staat geschaffen. Hobbes benutzt für den allmächtigen, souveränen Staat die biblische Metapher des Leviathan: Das Seeungeheuer des Alten Testamentes ist sterblich, bricht aber jeden menschlichen Widerstand. Hobbes’ Leviathan schützt die Menschen vor sich selbst und vor anderen. Indes: Auch der Leviathan ist bedroht. Nirgends steht geschrieben, dass die von ihm gesicherte Ordnung ewig währt.
Am Anfang aller Staatlichkeit, in den Flusstalzivilisationen Mesopotamiens, Ägyptens(1), Indiens(1) und Chinas(1), stand ein mehr oder weniger theokratisch hergeleitetes Königtum, das despotisch-allmächtig über eine Bevölkerung aus Untertanen gebot. Die politische Willensbildung funktionierte streng von oben nach unten: »Will er, so tut er«, hieß es über den ägyptischen Pharao. Macht ist nach Max Weber(1) »jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht«. Bei Macht geht es also um Willensdurchsetzung, und insofern ist der Pharao allmächtig. Auch wenn der König durchaus Erwartungen seiner Untertanen zu erfüllen und im Koordinatensystem der herrschenden Vorstellungen von Gerechtigkeit – in Ägypten: Ma’at – zu agieren hatte, gab er die Befehle, die anderen gehorchten. »Er spricht und es geschieht«, lautete die Formel dafür im alten Ägypten.[1]
Der ägyptische Leviathan bändigte die Untertanen durch das ganze Arsenal der Machtformen, die der Freiburger Soziologe Heinrich Popitz(1) in einem kleinen, nicht nur für Historiker lesenswerten Büchlein typologisch aufgefächert hat: Er konnte diejenigen, die sich ihm in den Weg stellten, ob äußere oder innere Feinde, physisch vernichten. Er konnte ihnen drohen und ihnen etwas versprechen, er konnte strafen und belohnen. Bei den meisten aber konnte er sich darauf verlassen, dass ihnen seine Autorität in Fleisch und Blut übergegangen war, ja: dass sie sich ihr sogar gerne unterwarfen. Er konnte, in den Kategorien von Popitz, Aktionsmacht einsetzen, instrumentelle Macht und autoritative Macht. Die drei Typen sind wie unterschiedliche Aggregatzustände von Macht: Mit jeder Stufe verfestigt sie sich ein Stück. Die verdauerte, institutionalisierte Form von Macht ist Herrschaft. Sie hängt, sagt wiederum Weber(2), vom Legitimitätsglauben der Beherrschten ab. Herrschaft rationalisiert die Durchsetzung des Willens und reduziert so die Kosten für die Ausübung von Macht: »Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden«. Weil die Beherrschten an die Autorität der Herrscher glaubten, war der Leviathan in den frühen Flusstalzivilisationen von innen kaum zu besiegen, allenfalls ließ er sich in sehr langen Rhythmen domestizieren. Im alten Ägypten(2) und ähnlich im alten Mesopotamien(1) konzentrierte sich zumindest der Idee nach Herrschaft auf eine einzelne Person. Der Pharao ritt den Leviathan sozusagen ganz alleine.[2]
Ab etwa 700 v. Chr. experimentierten Gesellschaften in Griechenland(1) und im von Griechenland aus kolonisierten Mittelmeerraum mit einem radikal neuen Verständnis von politischer Ordnung. Darin war der Einzelne nicht länger Untertan, sondern Teilhaber von Herrschaft. Der Bürger war geboren, und der Staat war identisch mit der Summe seiner Bürger, die Polis war nicht Athen(1), sondern hoi Athenaioi: »die Athener«. Aristoteles(2) beschreibt es so: »Die Tugend des Bürgers besteht darin, gut zu regieren und gut regiert zu werden.« In der Herrschaft, die er »politisch« nennt und vom Despotismus abgrenzt, sind Herrscher und Beherrschte identisch. Die Kehrtwende verdankte sich zwei elementaren Erfahrungen, die das alte Hellas auf seinem Weg in die Geschichte gesammelt hatte: der Kolonisation, durch die Griechen weite Teile des Mittel- und des Schwarzen Meeres(1) als ihr Siedlungsgebiet erschlossen, und der Hoplitenphalanx, mit der sich die Polis gegen ihre Feinde zur Wehr setzte. Wer überall neue Städte gründete, merkte schnell, dass er sich nicht auf die Götter verlassen durfte, wenn es um Fragen der politischen Organisation ging. Gesellschaft und Staat waren menschengemacht, Bürger hatten einen freien Willen. Und wer mit seinen Nachbarn Seite an Seite in identischer Rüstung und mit identischen Waffen kämpfte, mit dem Schild den linken Nebenmann deckend, dem leuchteten die Ideen von Gleichheit und Solidarität unmittelbar ein. Bürger waren also nicht nur frei, sondern auch gleich.[3]
Mit der Idee des Bürgers war der revolutionäre Gedanke der Volkssouveränität in der Welt, der fortan nicht mehr daraus zu entfernen war. Vom Volk, nicht von göttlichen, numinösen Mächten oder von der Person des Monarchen selbst, ging alle Staatsgewalt aus. Der Bürger und eben nicht die später ebenfalls von den Griechen erfundene Demokratie macht den Kern der politischen Identität Europas(1) aus. Despoten gab es zwar immer wieder, aber sie waren gut beraten, Kreide zu fressen und zumindest den Anschein zu erwecken, sie würden ein gewisses Quantum bürgerlicher Freiheiten respektieren. So unterschiedlichen Gewaltherrschern wie den römischen Kaisern, den absolutistischen Monarchen der Frühmoderne oder faschistischen wie realsozialistischen Machthabern gelang es nicht, die Geschichte hinter die Erfindung des Bürgers zurückzudrehen. Der Bürgergedanke schuf neue Formen der Legitimierung von Herrschaft, aber er erschwerte dem Leviathan in einem entscheidenden Punkt auch seine Arbeit. Der Bürger hatte sich einen Teil der Freiheiten und Rechte zurückertrotzt, die der Untertan einst an das Ungeheuer abgetreten hatte. Die Freiheit des Bürgers setzte das Problem auf die Tagesordnung, wie diese Freiheit so zu begrenzen sei, dass aus ihr keine Anarchie erwuchs.
Das Volk führen
Noch ein anderes Problem wurde mit der Erfindung des Bürgers akut: Die Fragen aller Fragen, die Machtfrage, zu klären, war nicht mehr so einfach wie im Despotismus. Wie lautete der Wille, der durchzusetzen war, wenn es ein kollektiver Wille von vielen, kein Wille von einem oder wenigen war? Eine kommunikative Ebene trat zum einfachen Prinzip der Willensdurchsetzung hinzu. Hannah Arendt(1) trägt der Komplexität der Machtfrage in pluralistischen Gesellschaften Rechnung, wenn sie diese Dimension einpreist: »Macht entspringt der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.« Entscheidende Quellen von Macht werden deshalb die Bündnis-, aber auch die Überzeugungsfähigkeit von Individuen.[4]
Doch wie sollten Tausende, gar Hunderttausende oder Millionen ihren politischen Willen artikulieren? Selbst in der Überschaubarkeit der griechischen Poleis, von denen die meisten nur wenige Tausend Bürger zählten, war guter Rat teuer. Nach und nach fand man Lösungen: Das Volk versammelte sich und traf wichtige Entscheidungen wie die über Krieg und Frieden. Es kürte Beamte, die auf Zeit die Geschäfte der Polis führten. Es wählte einen Rat als politischen Ausschuss, in dem vier- oder fünfhundert Bürger wichtige Fragen berieten, bevor sie der Volksversammlung vorgelegt wurden. Es setzte Gerichte ein. Wählbar für diese Funktionen, regimentsfähig, waren zunächst nur Angehörige der Eliten, also die, die mehr besaßen und deshalb von ihren täglichen Verrichtungen »abkömmlich« waren, wie wiederum Max Weber(3) formuliert.[5]
Damit stellte sich der Bürgergesellschaft unversehens ein drittes Problem: Wie sollte man das Verhältnis zwischen Eliten und allen anderen austarieren? Die griechischen Denker ließ diese Frage nicht los. Als erster ersann Platon(1) drei Grundtypen politischer Ordnung: die Monarchie, in der einer herrscht, die Aristokratie, in der die Besten (also wenige) herrschen, und die Demokratie, in der das Volk herrscht, der demos (also alle). Platon war ein Gegner der Attischen Demokratie, in der er aufgewachsen war. Er hielt die Vielen für nicht zum Herrschen befähigt und stand mit dieser Auffassung keineswegs allein. Der breiten Masse fehle die intellektuelle Grundausstattung, die Urteilsfähigkeit zum Regieren, meinte etwa auch der Verfasser eines antidemokratischen Pamphlets, das unter Xenophons Namen überliefert ist: Armut sowie Mangel an Erziehung und Bildung würden sie »zur Schlechtigkeit verleiten«.[6]
Die Verführbarkeit der Masse war auch das Thema einer 424 v. Chr. uraufgeführten Komödie des Dichters Aristophanes(1). In dem Stück ist der feiste Herr Demos ein seniler Tattergreis, den sein Sklave, der »Paphlagonier«, dadurch von sich abhängig gemacht hat, dass er ihm täglich sein Leibgericht auftischt und ihm im Übrigen bei jeder Gelegenheit Honig um den Bart schmiert. Als unversehens der »Wursthändler« auftritt, ein noch geschickterer Verführer, liefern sich die beiden einen erbarmungslosen Wettbewerb um die Gunst des Demos, den schließlich der Wursthändler gewinnt. Die Komödie ist eine bitterböse Parabel auf die Verführbarkeit des Volkes und die Skrupellosigkeit von Demagogen, die Athen(2) in den Peloponnesischen Krieg gegen die zweite griechische Großmacht geführt und in den 420er Jahren verhindert hatten, dass der Konflikt beigelegt wurde.[7]
Aller Kritik zum Trotz funktionierte die Attische Demokratie ziemlich reibungslos. Die Besoldung von Richter- und Beamtenstellen sowie das Losprinzip, durch das mit Ausnahme der militärischen Ämter alle Funktionen besetzt wurden, garantierten identische Partizipationschancen für alle Bürger. Das Scherbengericht, ostrakismos, stellte sicher, dass niemand zu mächtig wurde. Einmal im Jahr wurde abgestimmt und derjenige, auf den die meisten Stimmen entfielen, für zehn Jahre in die Verbannung geschickt. Selbst demagogos war kein ehrenrühriger Titel. Allen war bewusst, dass es redegewandter Leute mit Autorität bedurfte, um diffuse Stimmungen im Volk aufzufangen, zu kanalisieren und daraus einen politischen Willen zu artikulieren. Der Althistoriker Moses I. Finley(1) hat schon vor über 60 Jahren mit dem moralischen Naserümpfen über den Demagogen aufgeräumt und in Erinnerung gerufen, dass er eine unverzichtbare, »strukturelle« Zutat zur Attischen Demokratie war. Finley vergleicht ihn, »up to a point«, mit dem Typus des modernen Politikers. Ähnlich bemerkte schon Max Weber(4) in seiner Schrift »Politik als Beruf« 1919: »Der ›Demagoge‹ ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie der Typus des führenden Politikers im Okzident.« Die Unverzichtbarkeit der Demagogen korrigiert das Idealbild der absoluten Egalität, wie sie dem Selbstverständnis nach in der Demokratie herrschte. Macht war nicht gleich über das politische Feld verteilt, sondern verdichtete sich in Individuen, die besser reden konnten, weil sie besser gebildet waren als der Durchschnitt. Besser gebildet waren diese Männer, weil sie zur Elite der ökonomisch Bessergestellten gehörten. Sie hatten, mehr als der Durchschnittsbürger, im Sinne Arendts die Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und gemeinsam mit ihnen zu handeln. Der Demagoge war dem Wortsinn nach ein »Volksführer«, kein Volksverführer. Demagogen operierten selbstverständlich mit Halb- und Unwahrheiten, um das Volk auf ihre Seite zu ziehen, aber sie stachelten sie nicht zu gewaltsamen Protesten an. Ihre Waffe blieb stets das Wort.[8]
Das politische Feld auch der Attischen Demokratie war also nicht völlig plan. Die Landschaft wies relativ flache Erhebungen um die Demagogen auf, aber keine Gebirge und keine tiefen Täler völliger Ohnmacht. Die Demokratie meisterte ihrer Radikalität zum Trotz etliche Herausforderungen, die sich politischen Ordnungen damals wie heute stellen. Der Ostrakismos war ein Instrument der Elitenkontrolle, die in den meisten Gesellschaften, auch in modernen Repräsentativsystemen, ein meist ungelöstes Problem ist. Über die Demagogen gelang die politische Willensbildung in einer sonst amorphen Volksmasse. Sie wirkten, analog unseren Parteien, sozusagen an der politischen Willensbildung mit. Die Institutionen der Polis und vor allem die in Athen(3) auf breiter Front verwirklichte Besoldung der Ämter leisteten die Integration breiter, auch der unteren Bevölkerungsschichten. Und schließlich war die Legitimität der Ordnung durch die kompromisslose Durchsetzung der Volkssouveränität unangefochten. Mehr noch: Die Demokratie bot keinerlei Angriffsfläche für soziale Protestbewegungen. Auch deshalb blieb politisch motivierte Gewalt im klassischen Athen die absolute Ausnahme. Die Gesellschaft unterstellte sich freiwillig dem Gesetz, die Bürger für die Schlichtung ihrer Streitigkeiten den Gerichten. In den Gerichten unterwarfen sich die Reichen dem Urteil derer, die auf den Richterstühlen saßen. In ihrer Mehrzahl waren das ganz normale Leute. Die Demokratie bewältigte die Herausforderungen auch deshalb, weil die Bevölkerung Attikas kompakt und homogen war. Die attische Spielart der Demokratie war eine politische Ordnung, die nur in Face-to-Face-Gesellschaften funktioniert. Noch James Madison(1) und Alexander Hamilton(1) erklärten während der Verfassungsdiskussion in den dreizehn Kolonien den Gedanken für völlig abwegig, die angestrebte Föderation könne demokratisch aufgebaut sein: Dazu war sie einfach viel zu groß.[9]
Den Leviathan reiten
146 v. Chr. stand der Geschichtsschreiber Polybios(1) vor den rauchenden Trümmern des einst weltbeherrschenden Karthago(2) und fragte sich, warum Rom und nicht irgendeine der vielen anderen Mächte zwischen Atlantik(1) und Nahem Osten den beispiellosen Sieges- und Eroberungszug angetreten hatte, der jetzt das Mittelmeer(2) politisch in einer Hand vereinte. Polybios wäre kein griechischer Intellektueller gewesen, hätte er sich nicht eine Theorie zurechtgelegt, um seinen Landsleuten das Wunder der römischen Expansion zu erklären. Er griff auf das ursprünglich von Platon(2) erdachte und später von Aristoteles(3) verfeinerte Instrumentarium der drei Verfassungstypen zurück. Die Stärke der römischen Republik bestehe darin, argumentiert Polybios, dass die monarchische, aristokratische und demokratische Komponente in ihrem Staatsaufbau in perfektem Gleichgewicht lägen. Monarchisch sei die Amtsgewalt der höchsten Magistrate, der Konsuln, aristokratisch seien Autorität, Beratungs- und Beschlussfassungskompetenz des Senats und demokratisch sei das ausschließliche Recht der Volksversammlung, Gesetze zu beschließen sowie Magistrate zu wählen. »Und die Hinzuziehung dieser drei Elemente bei der Ausarbeitung der Verfassung und ihrer anschließenden Handhabung war in jeder Hinsicht so ausgewogen und gleichmäßig, dass es selbst für einen Einheimischen unmöglich war, mit Sicherheit zu sagen, ob das gesamte Gemeinwesen nun aristokratisch, demokratisch oder monarchisch war.«[10]
Das Gemeinwesen, politeuma, wie Polybios(2) es nennt, war das Produkt einer Jahrhunderte dauernden Auseinandersetzung zwischen Roms altem Geburtsadel, den Patriziern, und allen anderen, den Plebejern. Die 509 v. Chr. errichtete Republik war zunächst ein Projekt der Patrizier gewesen, an dessen Verwaltung die Plebejer keinen Anteil hatten. Das änderte sich allmählich, nachdem die Plebejer – der Legende nach zuerst 494 v. Chr. – kollektiv in den Streik getreten und aus der Stadt ausgezogen waren. Zug um Zug wurden die Patrizier in den Ständekämpfen zu Zugeständnissen gezwungen, bis 287 v. Chr. die nahezu völlige Gleichstellung mit den Patriziern erreicht war.[11]
Darüber, ob Polybios(3)’ Modell der »Mischverfassung« die römische Republik korrekt beschreibt oder nicht, tobte in der Alten Geschichte vor knapp 40 Jahren ein heftiger Streit. Lange galt als ausgemacht, dass der Grieche etwas Entscheidendes übersehen hatte. Dass sich die Institutionen der Republik nämlich nicht in Magistraturen, im Senat und der Volksversammlung sowie ihren rechtlich genau festgelegten Kompetenzen erschöpften, sondern tief in der Gesellschaft Kräfte am Wirken waren: Kräfte, die dafür gesorgt hätten, dass sich mit dem Ende der Ständekämpfe die Macht in den Händen einer neuen, jetzt patrizisch-plebejischen Elite konzentrierte. Sie bestand demnach aus den führenden Männern im Senat, jenen, die zuvor die Prätur oder gar den Konsulat und damit die beiden höchsten Ämter der vierstufigen Ämterlaufbahn bekleidet hatten, des cursus honorum. Bereits Theodor Mommsen(1) prägte für diese Elite den Begriff »Nobilität« und definierte ihn als »Erbadel« von »Quasi-Patriciern«. Die Nobilität, so Mommsen, habe für ihre Nachkommen den privilegierten Zugang zu den höchsten Ämtern reserviert und ihn Außenstehenden so schwer wie möglich gemacht. Tatsächlich gelang es »neuen Männern«, homines novi, nur äußerst selten, in den Kreis der Nobilität vorzudringen. Der berühmteste homo novus war Marcus Tullius Cicero(1).[12]
Die Nobilität verstand sich als Leistungselite. Nobilis war man, wenn man »kenntlich« war – und das wurde man durch Verdienste. Verdienste erwarb man in den Magistraturen: den Ehrenämtern, honores, der vierstufigen senatorischen Laufbahn, die von der Quästur über die Ädilität und die Prätur bis zum Konsulat emporführte. Alle Magistraturen waren Wahlämter, es entschied das versammelte Volk. Als Leistung galt die Errichtung oder Instandsetzung öffentlicher Gebäude, auch von Straßen oder Aquädukten. Die Ausrichtung von Gladiatorenspielen und Tierhetzen war ebenfalls auf dem Leistungskonto zu verbuchen. Die wichtigste Leistung aber bestand im siegreichen Bestehen von Kriegen. Wer, wie Scipio Africanus(1) und sein Adoptivenkel Scipio Aemilianus(1) über Karthago(3), wie Marius(1) über die Kimbern und Teutonen oder wie Pompeius(1) über die Seeräuber und über Roms orientalischen Lieblingsfeind Mithradates(1) von Pontos triumphiert hatte, besaß Autorität und gehörte zum exklusiven Kreis der Männer, deren Wort in der Kurie allerhöchstes Gewicht hatte. Leistung war ein Kapital, das in den großen Familien Generation um Generation aufgehäuft wurde. Wer sich Wahlen stellte, wurde nicht allein daran gemessen, was er persönlich im Dienst der Republik vollbracht hatte, sondern auch an den Taten seiner Vorfahren. Edle Herkunft war die wertvollste Trumpfkarte im Kampf um Ehre und Verdienste: Im Normalfall stach sie alle Asse, die andere im Ärmel haben mochten. Die Bedeutung des »Ahnenkapitals« erklärt, warum es Außenseitern wie Cicero(2) allen persönlichen Verdiensten und allen Bekenntnissen der Republik zur Meritokratie zum Trotz so schwer gemacht wurde, bis ins höchste Amt aufzusteigen.[13]
Das kollektive Machtinstrument der Nobilität war der Senat. Debatte und Meinungsfindung in diesem Gremium waren einer strikt hierarchischen Logik unterworfen. Zuerst ergriffen die Senatoren mit der höchsten Autorität das Wort, und das waren in der Reihenfolge der Seniorität diejenigen, die zuvor die führenden Ämter bekleidet hatten: Konsulare und Prätorier. Die Nobilität gab daher im Senat den Ton an, auch wenn sie nicht über die Mehrheit verfügte. War ein Beschluss, senatus consultum, erst einmal gefasst, dann vertraten ihn alle Senatoren, ganz gleich, wie kontrovers die Diskussion innerhalb der Kurie zuvor gewesen war. Die Standessolidarität der Nobilität war die zentripetale Gegenkraft zum Konkurrenzdruck, der auf den führenden Senatoren lastete. Wer aus der Reihe tanzte, musste scharfe Sanktionen des Kollektivs fürchten. Das Procedere sah vor, dass Konsuln oder Volkstribunen die Beschlüsse des Senates in der Volksversammlung als Gesetzesvorlagen zur Annahme vorschlugen. Der Vorschlag hieß rogatio, und nur diese Magistrate besaßen das Rogationsrecht. Rein rechtlich stand es jedem Magistrat frei, auch eigenmächtig ein Gesetz einzubringen, doch in der Praxis waren die Kosten solchen Handelns unkalkulierbar. Im Senat wie im politischen Raum insgesamt traf permanent der Geltungsdrang von Einzelnen auf die entschlossene Abwehrhaltung des Kollektivs. Die Fähigkeit der Nobilität zur Selbstdisziplinierung machte die Stärke des römischen Leviathan aus. Lange blieben seine Klauen und Zähne scharf – bis zu der Zeit, von der dieses Buch handelt.[14]
Eine Generation nach Mommsen(2) arbeitete sich der Schweizer Althistoriker Matthias Gelzer(1) in seiner Habilitationsschrift an der Frage ab, was es denn der Nobilität erlaubt habe, ihr faktisches Machtmonopol so effektiv gegen die Außenwelt zu verteidigen. Bereits Mommsen hatte gesehen, dass die nobilitäre Exklusivität »nie durch Gesetz geregelt« worden und »daher mehr thatsächlicher als rechtlicher Art« gewesen sei. Gelzer stieß bei seiner Suche auf Beziehungsgeflechte, die Roms Gesellschaft in ihrer Tiefe horizontal und vertikal durchzogen: »Freundschaft«, amicitia, zwischen Gleichrangigen und »Beschützung«, patrocinium, zwischen Patron und Klient. Zwischen Gleichen und Ungleichen herrschte das Band von fides, unbedingter gegenseitiger Solidarität. Solche »Nahverhältnisse« waren in einer Gesellschaft, die keine Polizei und keine Staatsanwaltschaft kannte, unerlässliche Diziplinierungs- und Friedenssicherungsmechanismen. Ohne die soziale Kontrolle des Bindungswesens wäre die römische Gesellschaft an Gewalt erstickt. Gelzer interpretierte die Nahverhältnisse aber noch als etwas anderes: als Netzwerke, über die sich das politische Feld sortiert und Entscheidungsfindung stattgefunden habe: Freunde hätten einander politische Hilfestellung, der Patron dem Klienten die Gewährung von Schutz, der Klient dem Patron Gefolgschaft geschuldet, und das alles generationenübergreifend. Durch das Netzwerk des Bindungswesens, folgerte Gelzer, sei es den in der Nobilität versammelten mächtigen Patronen möglich gewesen, Wahlergebnisse regelrecht zu programmieren: »So ist der Mächtigste der, welcher kraft seiner Clienten und Freunde die meisten Wähler mobilisieren kann.«[15]
In Gelzers(2) die Debatte lange beherrschendem Modell fand politische Willensbildung zunächst durch Absprachen in den Hinterzimmern der mächtigen Häuser Roms statt, dann im Senat und schließlich strikt von oben nach unten in der Gesellschaft: dadurch, dass Patrone ihren Klienten auftrugen, wen sie zu wählen oder für welches Gesetz sie zu stimmen hätten. Nach Arendts Machtbegriff wären Nobiles umso mächtiger gewesen, je mehr Freunde und Klienten sie hatten. Darauf, dass diese einfache Rechnung so nicht aufgeht, hat zuerst der britische Althistoriker Fergus Millar(1) hingewiesen. Millar stellte provokant fest, Demokratie sei keine Frage gesellschaftlicher Bindekräfte, sondern im strengen Sinne ein Verfassungsprinzip. Seine radikale Lösung des Problems lautete: »Polybius was right and his modern critics are wrong.« Das politische System der römischen Republik, folgerte Millar, habe durchaus eine starke demokratische Komponente gehabt: Das zu leugnen, hieße zu verkennen, dass die Volksversammlung auf zahlreichen Gebieten das letzte Wort hatte, dass Macht von der Fähigkeit abhing, politische Überzeugungsarbeit zu leisten, und dass es einen öffentlichen Raum gab – das Forum, die Komitien und die Straße –, in dem politisch debattiert wurde und Redner mit geschliffener Rhetorik die Klingen kreuzten.[16]
Millar(2) hat seine These unter dem Druck der von ihm ausgelösten Kontroverse immer weiter radikalisiert und behauptet, die Republik sei eine Demokratie gewesen. Wie Polybios(4) ignoriert er geflissentlich die Differenz zwischen »Verfassung« und politischer Wirklichkeit in Rom. Die Bindekräfte von amicitia und patrocinium waren reale Machtfaktoren, auch wenn sich mit ihnen Wahlen und Abstimmungen nicht vorherbestimmen ließen. In der Forschung glaubt man heute nicht mehr an die Macht einflussreicher Senatoren, durch »simples, schematisches Manövrieren großer Clientenmassen« Wahlergebnisse zu beeinflussen oder gar zu erzwingen, aber die Zahl der Klienten war trotzdem ein wichtiger Gradmesser für soziales Prestige und politischen Einfluss. Die Klientel war einer unter mehreren Transmissionsriemen, über die senatorische Politiker Einfluss auf die politische Stimmung im Wahlvolk nehmen konnten. Sie war alles andere als unmaßgeblich.[17]
Mit der Mobilisierung von Freunden und Klienten allein war aber keine Wahl zu gewinnen. Wer als Erster aus dem Rennen hervorgehen wollte, musste politische Landschaftspflege in weit größerem Stil betreiben. Er musste dafür sorgen, dass sein Name buchstäblich auf jeder Hauswand zu lesen stand. Mund-zu-Mund-Propaganda war die wirkungsvollste Waffe im Kampf um die Sympathien der Massen. Die Genossen in den Wahlabteilungen, tribus, aber auch Nachbarn, Freigelassene, selbst Sklaven müsse man sich durch gute Taten, beneficia, verpflichten, damit sie, wo immer möglich, Überzeugungsarbeit leisten, empfahl Quintus Cicero(1) seinem Bruder Marcus(3) in einer Commentariolum petitionis betitelten Schrift mit Tipps für einen erfolgreichen Wahlkampf. Fast erübrigt es sich zu sagen, dass Bewerber auch vor Stimmenkauf nicht zurückschreckten, wenn es darum ging, das Wahlvolk für sich einzunehmen. Doch selbst der teuerste und aufwendigste Wahlkampf musste wirkungslos verpuffen, wenn der Kandidat mit seiner Bewerbungsrede vor der Volksversammlung enttäuschte. Eine sorgfältig geschulte Redebegabung war nahezu die Grundvoraussetzung dafür, in der hochkompetitiven politischen Arena der römischen Republik reüssieren zu können.[18]
Politische Willensbildung funktionierte auch in Rom nicht ausschließlich von oben nach unten. Bei Themen, die dem Volk auf den Nägeln brannten und bei denen aufgrund evidenter gemeinsamer Interessen ein spontaner Konsens herzustellen war, konnte sie auch die umgekehrte Richtung gehen. Im Jahr 200 v. Chr. legte der Konsul Publius Sulpicius Galba Maximus(1) dem Volk einen Antrag vor, mit dem ein neuer Krieg gegen den makedonischen König Philipp V.(1) beschlossen werden sollte. Der Hannibalkrieg und damit der schwerste militärische Konflikt, den die Republik überhaupt in ihrer 500-jährigen Geschichte bestanden hatte, lag zu diesem Zeitpunkt gerade ein Jahr zurück. Der Senat stand einmütig hinter diesem Vorhaben, doch die versammelten Zenturien des nach siebzehn Jahren des Tötens kriegsmüden Volkes lehnten ihn fast unisono ab. Dies ist freilich der einzige überlieferte Fall eines vom Senat beschlossenen und dann vom Volk abgelehnten Antrages. Der Senat reagierte, indem er den Konsul abermals vorschickte und eine Versammlung, contio, abhalten ließ, auf der er um Vertrauen warb und dem Volk die Sachlage erläuterte. Die Episode zeigt, gerade weil sie die absolute Ausnahme repräsentiert, wie unerschütterlich das Vertrauen des Volkes in die kollektive Problemlösungskompetenz der Nobilität war. Das Vertrauen verdankte sich vor allem dem in Rom tief verankerten Respekt vor den Ahnen und ihren Verdiensten: Wer eine schier endlose Reihe von Konsuln und Prätoren zu seinen Vorfahren zählte, der konnte bei wichtigen Entscheidungen so falsch nicht liegen.[19]
Es war aber nicht nur Vertrauen, das die breite Masse daran hinderte, in Opposition zur Nobilität zu treten, es war vor allem die Unfähigkeit, politische Stimmungen autonom in politisches Handeln zu verwandeln. Die römische Gesellschaft kannte durchaus das Äquivalent einer öffentlichen Meinung: Es herrschte keinerlei Zensur, auf den Straßen machten Gerüchte und Klatsch die Runde, wer lesen konnte, konsultierte Flugschriften und die politische Publizistik. Auch in den Organisationszellen der Gesellschaft, in den Nachbarschaften, vici, den tribus, in den Berufsgenossenschaften, collegia, und natürlich in der Familie sprach man über Politik. Die Stimmung auf der Straße war unberechenbar und hochvolatil. Sie konnte vor allem dann schnell kippen, wenn Katastrophen wie Hungersnöte oder Krankheiten über die Stadt hereinbrachen. Dennoch war die öffentliche Meinung ihrer Natur nach informell. Sie blieb diffus und ungerichtet, aus ihr ließen sich keine Beschlüsse und Gesetze destillieren, mit ihr keine Wahlen gewinnen. Aus den Stimmungslagen der Öffentlichkeit ließ sich aber auch keine Gewalt generieren, mit der man die Nobilität einfach beseitigen und ein anderes Regiment an ihre Stelle hätte setzen können. Macht durch Masse war eine Gleichung, die in Rom aufgrund der überstarken auf die Gesellschaft wirkenden Beharrungskräfte nicht aufging. Nicht umsonst hat es eine Revolution am Tiber(2) nie gegeben, selbst die Ständekämpfe waren ein langer, evolutionärer Prozess gewesen.[20]
Der eingespielte Weg der politischen Entscheidungsfindung führte bei Sachfragen über den Senat und die Antragstellung durch einen Magistraten. Die einzige Alternative war unüblich, aber rechtlich durchaus vorgesehen: Ein Magistrat konnte eigenmächtig, unter Umgehung des Senats, einen Antrag zur Abstimmung stellen. So vorzugehen, barg große Risiken. Wer diesen Weg wählte, brach für alle sichtbar mit der Tradition. Das Althergebrachte nannten die Römer »Sitte der Vorfahren«, mos maiorum. Zwar war der Inhalt des mos nirgendwo kodifiziert, und so etwas wie eine schriftlich ausgearbeitete »Verfassung«, die dem politischen System einen Rechtsrahmen gab, kannte die Republik auch nicht. Der mos stellte als exemplarisch aus, was die Vorfahren getan oder angeblich getan hatten. Er war ein »Pool normativer Muster, die selektiv aufgerufen werden konnten«: Was mos maiorum war, war im Lauf der Jahrhunderte durchaus Wandlungen unterworfen, aber es war stets verbindlich und setzte dem Handeln politischer Akteure effektive Grenzen. Wer mit der Tradition brach, vor einem Antrag an die Volksversammlung den Senat zu konsultieren, begab sich also auf schwankenden Boden. Andererseits warteten auf den, der eigenmächtig handelte und sich direkt, ohne den Umweg über den Senat, ans Volk wandte, durchaus auch große Chancen. Als Erster ging den Weg, der bald der »populare« heißen sollte, 133 v. Chr. Tiberius Sempronius Gracchus(1). Sein Sprungbrett war das Amt des tribunus plebis, des Volkstribunen.[21]
Das Volk verführen
Der Volkstribunat war das wichtigste Instrument, das sich die Plebejer im Kampf gegen die Patrizier geschaffen hatten. Es war den Magistraturen nachempfunden, mit denen die Patrizier die Gemeinde verwalteten. Wie sie war er mehrstellig und auf ein Jahr begrenzt. Weil sich die Plebs als eigenständige Gemeinde konstituiert hatte, wurden die Tribunen nicht von der Volks-, sondern von der Plebejerversammlung, concilium plebis, gewählt, der sie auch vorstanden und die zu eigenen Beschlussfassungen, plebis scita, befähigt war. Die Volksbeschlüsse galten zunächst nur für die Plebs und erlangten erst 287 v. Chr. dieselbe Wirksamkeit wie Gesetze, leges. Anfangs waren alle Befugnisse angemaßt, die sich die Plebs selbst und ihren Tribunen gegeben hatte. Mommsen(3) bezeichnet die Plebs in diesem Frühstadium der Ständekämpfe als »die Revolution in Permanenz«, ihr Recht sei »die Möglichkeit der Selbsthülfe« gewesen.[22]
Die Instanz der Selbsthilfe war der Volkstribun. Damit er im Konfliktfall die Plebejer gegen patrizische Übergriffe schützen, auxilium leisten konnte, hatte die Plebs ihn mit weitreichenden Möglichkeiten versehen. Grundlage seiner politischen Potenz war die physische, sakralrechtlich untermauerte Unantastbarkeit, sacrosanctitas, seiner Person. Sie war unberührbar, tabu, der »Basilisk als Institution«, wie José Ortega(1) y Gasset schreibt. Die sakrale Unverletzlichkeit trat an die Stelle der rechtlichen Unverletzlichkeit der Magistrate. Sie erlaubte es ihm, bei Handlungen jedes regulären Magistraten, gegen die ein Plebejer das tribunizische auxilium anrief, »dazwischenzutreten«, zu interzedieren. Das Interzessions-, ein faktisches Vetorecht, erstreckte sich auf sämtliche Rechtsakte, die ein Magistrat vorzunehmen imstande war: gegen Anweisungen, decreta, Gesetzesanträge, rogationes, und das Erwirken eines Senatsbeschlusses, senatus consultum facere. Der Volkstribun besaß gegenüber Plebejern die Zwangsgewalt, coercitio, und die Jurisdiktion. Außerdem war er befugt, das concilium plebis einzuberufen, dort Plebiszite einzubringen und die Wahl der ihm nachfolgenden Tribunen zu leiten. Begrenzt waren die außerordentlich weiten Kompetenzen des Volkstribunen allein durch das Recht seiner Kollegen, seinerseits gegen ihn zu interzedieren.[23]
Eine Institution, der so viel Altehrwürdigkeit wie dem Volkstribunat innewohnte, konnte in der traditionsverhafteten römischen Gesellschaft nicht einfach abgeschafft werden, auch dann nicht, als das Amt nach dem vollständigen Sieg der Plebs in den Ständekämpfen eigentlich seinen Sinn verloren hatte. Die politische Ordnung Roms war gespickt mit Relikten, und so blieb auch der Volkstribunat erhalten. Er wurde spätestens unter Sulla(1) zu einem Amt, das als zweite Stufe in die Ämterlaufbahn des cursus honorum eingereiht wurde und dem Träger nach dem Amtsjahr die Tür zum Senat öffnete. Obwohl Volkstribunen mit Ende zwanzig oder Anfang dreißig meist recht jung waren, behielt die Magistratur ihre rechtliche Hebelwirkung und ihre moralische Autorität. Hellsichtig bemerkt Ortega(2) y Gasset, womöglich sei es gerade der Volkstribunat in seiner Relikthaftigkeit gewesen, der die römische Republik »dreieinhalb Jahrhunderte vor der schiefen Ebene der Revolution bewahrt« habe, indem er ein rechtliches und moralisches »Scharnier« zwischen dem Senat und den breiten Volksmassen bildete.[24]
Die sacrosanctitas des Amtes, das seinen Trägern auch Immunität vor Strafverfolgung gewährte, das Interzessionsrecht, die Möglichkeit, die Volksversammlung einzuberufen und Volksbeschlüsse mit Gesetzeskraft zu erwirken, das alles verlieh den Amtsinhabern in der Theorie viel Macht, machte den Tribunat zu einem formidablen Instrument des politischen Wettbewerbs. Dass diese Macht sich nicht materialisierte, lag an der zunächst nicht zu durchbrechenden Binnensolidarität der Senatorenschaft. Keinem Volkstribun kam es in den Sinn, keiner hätte es auch nur gewagt, sein Amt als Waffe gegen die eigenen Standesgenossen zu gebrauchen – keiner, bis zu Tiberius Gracchus(2). Denn dass man diese Waffe auch offensiv als Schwert im Kampf gegen politische Rivalen führen konnte, war seine große Entdeckung. Er wurde 133 v. Chr. inmitten einer Agrarkrise, in der sich die Schere zwischen Arm und Reich geöffnet hatte, zum Volkstribun gewählt. Gracchus machte sich im Vorfeld der Wahl zum Anwalt der Schwachen und versprach eine Bodenreform, ohne dafür zuvor die Zustimmung des Senats eingeholt zu haben. Er erklärte den römischen Bürgern, wie schlecht es ihnen ging, und versprach ihnen, Politik dafür zu machen, dass es ihnen besser gehen würde. Kaum ins Amt gewählt, nutzte er die Machtfülle des Volkstribunates und den »Mythos seiner Herkunft«, um seine politische Agenda gegen erhebliche Widerstände im Senat durchzuboxen. Am Ende scheiterte Gracchus, aber er hatte einen neuen Politikstil geprägt, der das Volk direkt ansprach. Tiberius Gracchus war der erste popularis, die römische Variante des Demagogen.[25]
Viele folgten ihm(3) auf seinem popularen Weg, übten sich im populariter agere, wie Cicero(4) es nannte. Alle versprachen sie den Armen Land und später auch günstiges Getreide. Weil sie meist den Volkstribunat zur Plattform für ihre Politik gemacht hatten, betrachtete die Senatsmehrheit das Amt in einer politisch immer aufgeheizteren Atmosphäre zunehmend als Bedrohung. Sulla(2) zog während seiner Diktatur (82–79 v. Chr.) die Konsequenzen daraus und beschränkte die Amtsvollmachten der Tribunen: Sie durften Gesetze dem concilium plebis nurmehr nach Rücksprache mit dem und Zustimmung durch den Senat vorlegen, das Interzessionsrecht wurde beschnitten, vor allem wurde der Tribunat zur Sackgasse. Wer ihn bekleidet hatte, durfte sich um kein weiteres Amt mehr bewerben, lebenslang. Der Volkstribunat wurde nicht abgeschafft, aber »politisch amputiert«.[26]
Sullas(1) antipopularen Reformen war keine Dauer beschieden. Bereits 70 v. Chr. gaben Gnaeus Pompeius(2) und Marcus Licinius Crassus(1) als Konsuln dem Tribunat seine alten Befugnisse zurück. Fortan war das Amt wieder ein nützliches Werkzeug für alle, die im politischen Wettbewerb früh Sichtbarkeit erlangen wollten, längst nicht nur, aber besonders für Popularen. Etliche der Figuren, die in dieser Geschichte wichtige Rollen spielen, waren in den 60er und 50er Jahren des letzten vorchristlichen Jahrhunderts Volkstribune: Aulus Gabinius(1), Marcus Porcius Cato(2), Quintus Fufius(1) Calenus(2), Titus Annius Milo(1), Publius Sestius(1) – und natürlich der Hauptprotagonist, Clodius(7).[27]
Publius Clodius(8) – oder Claudius – Pulcher war um 92 v. Chr. als Patrizier zur Welt gekommen und musste erst zum Plebejer werden, um den Volkstribunat überhaupt bekleiden zu können. Wenn Nobilität in irgendeiner Familie förmlich ins Genom eingebrannt war, dann bei den Claudii Pulchri. Wer, wie Clodius, auf so viele berühmte Vorfahren zurückblicken konnte, gehörte kraft Geburt zum Club der Mächtigsten und war mit der Autorität einer Ahnenreihe ausgestattet, die in 400 Jahren mindestens zehn Generationen von Konsuln gestellt hatte. Das war einer von fünf Gründen, weshalb ihm gelang, woran alle gescheitert waren, die sich seit Tiberius Gracchus im populariter agere versucht hatten: Clodius überwand die Beharrungskräfte, die Roms Republik fest im Griff hielten, und schuf sich eine Anhängerschaft, die über den Tag hinaus Bestand hatte. Anders als bei seinen Vorgängern fiel bei Clodius die Mobilisierungskurve nicht nach wenigen Monaten steil ab. Der schillernde Aristokrat war und blieb der Held der Massen. Der zweite Grund dafür, dass seine Rechnung aufging, war das Nachlassen der alten Bindungen: Clodius sprengte die bereits im Schwinden begriffene Solidarität der Klientel, die bis dahin ein zentrales Instrument der Massenmobilisierung gewesen war, und setzte an ihre Stelle einen neuen Typus von Gefolgschaft. Sie war durch und durch politisch. Zusammengehalten wurde sie durch persönliches Charisma, Netzwerke und gemeinsame Interessen. Hier lag der dritte Grund dafür, dass Clodius Erfolg haben konnte: Die Massen waren sich ihrer Interessen nur allzu bewusst, weil sie nicht wussten, wie sie satt werden sollten. In den Jahren nach 60 v. Chr. durchlitt Rom eine der größten Hungerkrisen der Republik. Mitten in dieser Notzeit konnte Clodius seinen vierten Trumpf ausspielen: Anders als Tiberius Gracchus(4) und die Popularen vor ihm sprach er die Massen nicht nur an, er führte und verführte sie, so dass sie Dinge taten, die sie ohne ihn nicht getan hätten. Clodius war ein begnadeter Agitator, der das Geschäft von der Pike auf gelernt hatte, und ein nicht minder begabter Redner. Die Masse war Wachs in seinen Händen. Sie schreckte, von ihm angestachelt, auch vor extremer Gewalt nicht zurück. Den fünften und wichtigsten Baustein zu seinem Erfolg steuerte die Nobilität selbst bei: Ihre Binnensolidarität, die stets stärker gewesen war als der zentrifugale Ehrgeiz der Einzelnen, war unwiderruflich zerbrochen. Clodius konnte seine Standesgenossen nach Gutdünken gegeneinander ausspielen. Er übte sich in diesem Spiel mit Beharrlichkeit und taktischem Geschick.
Drei der fünf Faktoren bewirkten, dass das politische System als solches in eine Legitimitätskrise geriet. Zwei davon – Erosion der alten Klientel und Spaltung der Nobilität – waren chronisch und wirkten langfristig, der dritte trat akut als Katalysator hinzu: die Hungersnot. Zusammen schufen sie den idealen Nährboden für Protestbewegungen. Der schleichende Legitimitätsverlust der herrschenden Ordnung und gewaltsamer Protest waren Phänomene, die der Attischen Demokratie fremd gewesen waren, mit denen Rom sich aber schon seit den Gracchen hatte herumschlagen müssen. Um 60 v. Chr. gewannen die Proteste indes eine neue Qualität. Die Schlüsselfigur in diesem Prozess war Publius Clodius(9).
Der Politikwissenschaftler James DeNardo unterscheidet zwei Mobilisierungsmechanismen für Protestbewegungen: »ideologische« und »organisatorische« Rekrutierung. Ideologische Rekrutierung wird dadurch geleistet, dass politische »Dissidenten« Standpunkte und Forderungen publik machen. Die Bürger können dann entscheiden, ob sie den Dissidenten näherstehen oder der Regierung. Im einen Fall schließen sie sich den Protesten an, im anderen bleiben sie zu Hause. Diese Form der Mobilisierung war in Rom seit den Gracchen gang und gäbe. Organisatorische Rekrutierung setzt voraus, dass die Mitläufer von Protesten über soziale Kontakte in die Bewegung hineingezogen werden, nicht notwendig, dass sie durch Beschwernisse hineingeschoben werden. Die Beweggründe, die Mitläufer in die Proteste hineinziehen, sind oft außerpolitischer Natur: Freundschaften, Drohungen, finanzielle Anreize oder ganz einfach Abenteuerlust. Organisatorische Rekrutierung war um 60 v. Chr. ein neuer Faktor der Mobilisierung, den Clodius(10) perfektionierte. Ein begnadeter Agitator wie er verstand auf beiden Klaviaturen virtuos zu spielen.[28]
Nichts Neues in Rom war das Umschlagen von Protesten in Gewalt. Bereits die Volkstribunate von Tiberius Gracchus(5) sowie seinem Bruder Gaius(1) hatten 133 und 121 v. Chr. jeweils in einer mit aberwitziger Geschwindigkeit rotierenden Gewaltspirale ihr Ende gefunden. Lucius Appuleius Saturninus(1) hatte, nachdem er im Dezember 100 v. Chr. für eine zweite Amtszeit als Volkstribun gewählt worden war, seine Anhänger einen der Kandidaten für den Konsulat erschlagen lassen und dann mit ihnen das Kapitol(1) gestürmt. Auch er selbst kam gewaltsam ums Leben. 87 v. Chr. griff Lucius Cornelius Cinna(1) in Rom inmitten von Straßenschlachten nach der Macht und ließ seinen Kollegen Gnaeus Octavius(1) umbringen. Gemeinsam war diesen Gewalteruptionen ihr ephemerer Charakter. Sie endeten stets mit dem Tod ihrer Urheber. Clodius(11) hingegen verstand es, Gewalt als sorgsam dosiertes Mittel über lange Zeiträume einzusetzen und so das Zerbröseln der Nobilitätsherrschaft zu beschleunigen.
Gewalt ist für den, der sie einsetzt, nicht gratis zu haben. Sie muss organisiert werden, möglicherweise müssen Waffen bereitgestellt werden. Empörung kann sich gegen die Krawallmacher richten, die öffentliche Meinung sich gegen die Protestierenden wenden. Vor allem birgt Gewalt Risiken für alle, die an den Ausschreitungen teilnehmen. Die Regierung kann mit Repressalien antworten und Gegengewalt einsetzen. Wer die Gewalt auf die Straße trägt, riskiert Verwundung oder im Extremfall den Tod. Deshalb birgt Gewalteinsatz für die Hintermänner stets die Gefahr, dass ihre Bodentruppen auf der Straße der Mut verlässt, dass sie der Protestbewegung den Rücken kehren. Wer an der Eskalationsschraube der Gewalt dreht, kann überdrehen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Andererseits können gewaltsame Störungen ein wirksames Mittel sein, dem Ziel näherzukommen. Wer Gewalt einsetzt, übt Druck auf die Obrigkeit aus, deren Autorität umso mehr Schaden nimmt, je länger die Krawalle dauern. Er kann die Auseinandersetzung eskalieren und den Einsatz erhöhen, ohne mehr Leute auf die Straße zu bringen. Gewalt kann ein effektives Mittel sein, den Gegner einzuschüchtern und Konzessionen zu erzwingen.[29]
Die Kombination aus organisatorischer Rekrutierung und gezieltem, wohldosiertem Gewalteinsatz war das Neue an der von Clodius(12) angeführten Bewegung und ihr Erfolgsgeheimnis. Überhaupt war eine Bewegung, die sich systematisch gegen die Nobilitätsherrschaft richtete, ein Novum in der politischen Landschaft Roms. Sie brachte die bereits erodierende Legitimität der Ordnung in wenigen Jahren vollends zum Kollabieren. Die Verführung der Massen durch Clodius war deshalb der entscheidende Schritt auch zum Sturz des Leviathan.
Erster Akt: Der Patrizier
Am Fuß des Kapitols in Rom befindet sich die alte Familiengruft der gens Claudia. Zu diesem Grabmal machte sich Ende des Jahres 76 v. Chr. eine große Zahl von Menschen auf. Ein langer Zug wälzte sich quer durch die Stadt zum Forum, machte dort bei den Rostra(1) halt und setzte dann seinen Weg bis zum Südwesthang des Kapitols fort. Die Spitze des Zuges bildeten Musiker, es folgten Klageweiber, Tänzer und Possenreißer. Daran schlossen sich Schauspieler an. Sie trugen lebensechte, aus eingelegten Glasaugen starrende Abbilder aus Ton oder Wachs: imagines. Die Masken oder Büsten – die genaue Ausführung ist in der Forschung umstritten – stellten die verblichenen Angehörigen des trauernden Hauses dar. Normalerweise wurden sie im Atrium aufbewahrt, wo die Klienten warteten, wenn sie ihrem Patron allmorgendlich ihre Aufwartung machten. Jedes Bild war in einem Schrein aufgestellt, auf dem säuberlich Name und Karriere des Dargestellten vermerkt waren. Jetzt, für den Leichenzug, waren sie aus ihren Schreinen hervorgeholt und symbolisch zu neuem Leben erweckt worden.
Pompa Funebris
Die Hauptperson war aber natürlich der Tote selbst: Normalerweise wurde der Verstorbene, aufrecht sitzend und von einem Leichenausstatter prächtig zurechtgemacht, zum Grab getragen und dort auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Appius Claudius Pulcher(1) war als Prokonsul im fernen Makedonien(1) gestorben. Dass sein Leichnam nach der Überführung in die Hauptstadt noch in präsentationsfähigem Zustand war, darf bezweifelt werden. Gut erhalten hingegen waren die Beutestücke, die der Tote in seinen Kämpfen errungen hatte. Sie und prachtvolle Weihegaben, mit denen er Roms Heiligtümer verschönert hatte, wurden im Zug mitgeführt.
Dass vornehme Römer das Zeitliche segneten, kam mehrmals im Jahr vor. Wenn ein großes Haus, eine domus, trauerte, gab es immer etwas zu sehen: den üppig inszenierten Leichenzug, pompa funebris, oft auch Gladiatorenspiele zu Ehren des Toten. Selten aber konnte ein Verstorbener mit einem Spektakel auftrumpfen wie im Jahr 76 der Prokonsul Appius Claudius(2). Als ehemaliger Konsul, die Forschung spricht von einem Konsular, hatte er in der ersten Reihe der römischen Politik gestanden. Die Pompa war ein Gradmesser für den gesellschaftlichen Rang, den der Tote zu Lebzeiten kraft seiner individuellen Taten und Tugenden, aber auch dank des von seinen Ahnen aufgehäuften symbolischen Kapitals erworben hatte. Emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war die Leichenrede an den Rostra(2). Hier, auf der Rednertribüne, zählte in der Regel ein naher Verwandter, oft der Sohn, manchmal auch ein enger Freund des Verblichenen, dessen Verdienste auf. War er ein guter Redner, dann steckte er mit seiner Trauer die versammelten Zuschauer an. Und gute Redner waren die meisten Nobiles, denn die Fähigkeit, eine Menge in den Bann zu ziehen, gehörte zu den Schlüsselqualifikationen für eine politische Karriere. Der Redner machte dem Publikum bewusst, dass nicht nur die Angehörigen, sondern die res publica in ihrer Gänze einen unersetzlichen Verlust erlitten hatte. Damit nützte er auch seiner eigenen politischen Laufbahn: Sprang der Funke über, dann mehrte die Rede sein individuelles Kapital und das seiner Ahnen. Sie beglaubigte den Anspruch des Trauerredners darauf, in die Fußstapfen des Toten treten und auch politisch seinen Platz einnehmen zu können.[1]
Appius Claudius(3) wurde auf seinem Trauerzug von den imagines seines Vaters, Großvaters, Urgroßvaters, Ururgroßvaters, Urururgroßvaters, Ururururgroßvaters und noch unzähliger weiterer Ahnen begleitet: mehr als zehn Generationen von Claudii, deren Stammbaum bis in die Frühzeit der Republik zurückreichte. Familien der Nobilität gestatteten das Mitmarschieren im Zug nur den Vorfahren, die ein höheres Amt, in der Regel mindestens die kurulische Ädilität, erreicht hatten. Bei den Claudii Pulchri spielte diese Einschränkung keine Rolle. Denn ausnahmslos alle Vorfahren waren Konsuln gewesen, so dass kein Mangel an vorzeigbaren Repräsentanten des Geschlechts herrschte. »Im Laufe der Zeit wurde sie mit achtundzwanzig Konsulaten, fünf Diktaturen, sieben Zensuren, sechs Triumphen und zwei Ovationen geehrt«, schreibt der Kaiserbiograph Sueton(1) in seiner Tiberius-Vita über die gens Claudia. So viel akkumuliertes Ahnenkapital konnten außer den Claudiern allenfalls noch die Cornelii Scipiones vorweisen, deren Vorfahren die bedeutendsten Feldherren in den Punischen Kriegen gestellt hatten. Wer die Leichenrede für Appius Claudius hielt, wissen wir nicht. Er hatte drei Söhne, den knapp 25-jährigen Gaius(2), den etwas jüngeren Appius(2) und den etwa 15-jährigen Publius(13). Gaius und Appius hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten Stufen ihrer politischen Karriere absolviert und als Militärtribunen Soldaten kommandiert. Gaius war außerdem Mitglied eines Priesterkollegiums, der Salier. In wenigen Jahren würde er 30 Jahre alt sein und dann für die Bewerbung um das erste Amt der senatorischen Ämterlaufbahn qualifiziert, die Quästur. Gaius wäre deshalb der ideale Kandidat auch für die Trauerrede auf seinen Vater gewesen. Einen besseren Einstand in die eigene Karriere hätte er sich jedenfalls nicht wünschen können.[2]
Welche Stationen im Leben seines Vaters wird Gaius Claudius(3), wenn er denn die Leichenrede hielt, hervorgehoben haben? Selbstverständlich listete er die Ämter auf, die sein Erzeuger bekleidet hatte: Appius Claudius Pulcher(4) war um oder kurz nach 100 v. Chr. Quästor geworden und versah in diesem Amt richterliche und finanzhoheitliche Funktionen. Ein paar Jahre später bekleidete er die kurulische Ädilität, zu deren Aufgaben es gehörte, die Aufsicht über öffentliche Gebäude, Tempel, Märkte und die Getreideversorgung zu führen. Ädilen hatten außerdem öffentliche Gladiatorenspiele sowie Wagenrennen auszurichten und dafür aus eigener Tasche aufzukommen. Um dieses Amt hatte sich Appius Claudius(5) einmal vergeblich beworben, was der Trauerredner selbstverständlich verschwieg. Auch ein Claudius konnte bei Wahlen durchfallen. 89 v. Chr. amtierte er als Prätor, ein Amt, dessen Inhaber vor allem richterliche Funktionen ausübten.[3]
Wenige Jahre später erlitt seine Karriere abermals einen Knick. Lucius Cornelius Sulla(3) wurde für das Jahr 88 v. Chr. zum Konsul gewählt und mit dem Oberbefehl im Krieg gegen den König Mithradates(2)VI. von Pontos(1) beauftragt. Mithradates hatte die römische Provinz Asia(1) im westlichen Anatolien angegriffen und dort in der »Vesper von Ephesos(1)« an einem Tag angeblich Zehntausende Römer und Italiker abschlachten lassen. Das Kommando war attraktiv, denn auf den Schlachtfeldern des Orients gab es reiche Beute und viel Ehre zu gewinnen. Doch Sulla hatte mächtige Feinde, die dafür sorgten, dass ihm per Volksbeschluss das Kommando gegen Mithradates wieder entzogen wurde. Der Konsul war kein Mann, der sich eine Brüskierung dieses Formats ohne Weiteres bieten ließ. An der Spitze seiner bereits ausgehobenen Soldaten marschierte er nach Rom(2) und nahm sich mit Gewalt den Oberbefehl, den man ihm hatte vorenthalten wollen. Indem er mit seinem Heer die Stadtgrenze überquerte, beging Sulla einen ungeheuerlichen Tabubruch, denn heiliges Recht machte Rom zur entmilitarisierten Zone, in der Soldaten nichts zu suchen hatten.