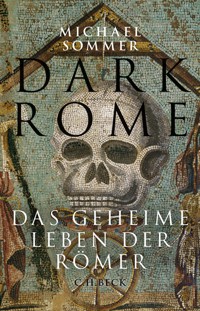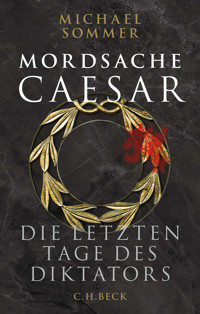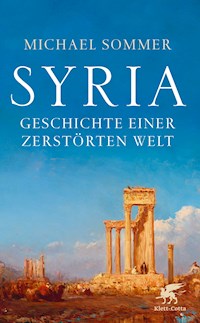12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
SHOWDOWN IN KARTHAGO - ROMS AUFSTIEG ZUM WELTREICH
Sommer 216 v.Chr. – der Karthager Hannibal hat in einem strategischen Coup die Alpen überquert und dezimiert in einer Serie von Schlachten die römischen Truppen. Der Name CANNAE, wo mindestens 50 000 Legionäre den Tod gefunden haben, steht wie ein Menetekel über Rom. Droht den Römern ein weiterer
dies ater, ein neuerlicher schwarzer Tag? – Doch als die letzte Schlacht der Punischen Kriege geschlagen ist, liegt Karthago in Trümmern, und Rom beginnt seinen Aufstieg zum Weltreich.
«Ich habe Angst vor der Zukunft, dass vielleicht einmal ein Anderer unserer Vaterstadt dasselbe Urteil spricht», so soll der Feldherr Scipio im Jahr 146 unter Tränen zu dem Historiker Polybios gesprochen haben, als er in die brennenden Ruinen Karthagos blickte. Er selbst hatte den Befehl gegeben, die antike Metropole, die über Jahrhunderte hinweg den Gang der Geschichte am Mittelmeer maßgeblich geprägt hatte, in Schutt und Asche zu legen. Siebzehn Tage soll Karthago gebrannt haben. Die Stadt wurde damals vollständig zerstört, ihre Stätte verflucht; die überlebenden Bewohner wurden in die Sklaverei verkauft. Seinen Soldaten gestattete der Oberbefehlshaber wegzuschaffen, so viel sie eben tragen konnten. Die Epoche, die mit dem Ausbruch des Ersten Punischen Krieges 264 begann und mit der Zerstörung Karthagos ihren Abschluss fand, ist die dynamischste Phase der Geschichte nicht nur der römischen Republik, sondern der gesamten antiken Mittelmeerwelt. In ihrer machtpolitischen Architektur blieb damals buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen, und auch die innere Struktur der römischen Gesellschaft wandelte sich von Grund auf.
Michael Sommer bietet in dem vorliegenden Band nicht nur eine spannende und informative Gesamtdarstellung der Ereignisse, sondern er leuchtet zudem kenntnisreich die Hintergründe dieses Konflikts aus und stellt die Protagonisten und ihre Motive während der verschiedenen Entwicklungsphasen des Konflikts vor. So wird schließlich deutlich, weshalb Rom und die Mittelmeerwelt 264 in eine Periode krisenhafter Beschleunigung eintraten und warum diese mit Roms Triumph und Karthagos Vernichtung endete.
- Roms Sieg über Karthago – Eine Weichenstellung für unsere westliche Kultur
- Von einer folgenreichen, welthistorischen Auseinandersetzung
- Ursachen, Verlauf und Folgen der Punischen Kriege
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MICHAEL SOMMER
SCHWARZE TAGE
Roms Kriege gegen Karthago
C.H.BECK
ZUM BUCH
«Ich habe Angst vor der Zukunft, dass vielleicht einmal ein Anderer unserer Vaterstadt dasselbe Urteil spricht», so soll der Feldherr Scipio im Jahr 146 v. Chr. unter Tränen zu dem Historiker Polybios gesprochen haben, als er in die brennenden Ruinen Karthagos blickte. Er selbst hatte den Befehl gegeben, die antike Metropole, die über Jahrhunderte hinweg den Gang der Geschichte am Mittelmeer maßgeblich geprägt hatte, in Schutt und Asche zu legen. Siebzehn Tage soll Karthago gebrannt haben. Die Stadt wurde damals vollständig zerstört, ihre Stätte verflucht; die überlebenden Bewohner wurden in die Sklaverei verkauft. Seinen Soldaten gestattete der Oberbefehlshaber wegzuschaffen, so viel sie eben tragen konnten.
Die Epoche, die mit dem Ausbruch des Ersten Punischen Krieges 264 begann und mit der Zerstörung Karthagos ihren Abschluss fand, ist die dynamischste Phase der Geschichte nicht nur der römischen Republik, sondern der gesamten antiken Mittelmeerwelt. In ihrer machtpolitischen Architektur blieb damals buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen, und auch die innere Struktur der römischen Gesellschaft wandelte sich von Grund auf.
Michael Sommer bietet in dem vorliegenden Band nicht nur eine spannende und informative Gesamtdarstellung der Ereignisse, sondern er leuchtet zudem kenntnisreich die Hintergründe dieses Konflikts aus und stellt die Protagonisten und ihre Motive während der verschiedenen Entwicklungsphasen des Konflikts vor. So wird schließlich deutlich, weshalb Rom und die Mittelmeerwelt 264 in eine Periode krisenhafter Beschleunigung eintraten und warum diese mit Roms Triumph und Karthagos Vernichtung endete.
ÜBER DEN AUTOR
Michael Sommer ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Oldenburg. Er forscht zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des römischen Kaiserreichs und epochenübergreifend zur Geschichte der Levante. Bei C.H.Beck sind von ihm lieferbar: «Wirtschaftsgeschichte der Antike» (2013) und «Die Phönizier. Geschichte und Kultur» (2008).
INHALT
VORWORT
EINS: ASCHE
1. «Nicht Liebe noch Bund»: Die Quellen
«Poenus plane est!»
«Die ganze Oikoumene»: Polybios
Jenseits von Polybios
2. Krieg – Macht – Bewährung: Leitfragen und -themen
Krieg
Macht
Bewährung
ZWEI: PRÄLUDIUM
1. Mittelmeer
2. Karthago
Qart-Ḥadašt
Auf dem Weg zur maritimen Großmacht
3. Sizilien
Phönizier und Griechen auf Sizilien
Karthago gegen Syrakus
4. Rom
Die Wölfin erwacht
Friedliche Koexistenz
DREI: WASSER
1. Sizilianisches Gambit
Söhne des Mars
Entscheidung in Rom
Casus Belli
2. Der erste Krieg zwischen den Römern und den Karthagern
Der Krieg um Sizilien (264–257)
Der Libysche Krieg und sein Nachspiel (256–248)
Die Feldzüge der Karthager unter Hamilkar (247–241)
3. Das Ende
Entscheidung
Frieden
VIER: INTERLUDIUM I
1. Nachkriegszeit
Krieg ohne Gnade
Die großen Inseln
Ligurien und die Celtica
Illyricum
Iberien
2. Vorkriegszeit
Der Vertrag
Schritte in den Krieg
FÜNF: ERDE
1. Den Krieg nach Italien tragen
Über die Alpen
«Wir sind in einer großen Schlacht besiegt worden»
Verbrannte Erde
Cannae und die Folgen
2. Symploke
Iberien
Griechenland
Sizilien und Sardinien
Italien
Afrika
SECHS: INTERLUDIUM II
1. Veteranen
Hannibal
Scipio Africanus
Massinissa
2. Hundertachtundsechzig
Der Tag von Pydna
Der Tag von Eleusis
SIEBEN: FEUER
1. Ceterum censeo …
Die Grenzen instrumenteller Macht I: Iberien
Die Grenzen instrumenteller Macht II: Korinth
Die Grenzen instrumenteller Macht III: Rom
2. … Carthaginem esse delendam
Endspiel
Scipios Tränen
3. Erinnerungsorte
Colonia Iunonia Carthago
La malheureuse Carthage
ACHT: SCHLUSS
ANMERKUNGEN
EINS: ASCHE
ZWEI: PRÄLUDIUM
DREI: WASSER
VIER: INTERLUDIUM I
FÜNF: ERDE
SECHS: INTERLUDIUM II
SIEBEN: FEUER
ACHT: SCHLUSS
BIBLIOGRAPHIE
BILDNACHWEIS
ORTSREGISTER
NAMENREGISTER
SACHREGISTER
VORWORT
Schwarze Tage durchlitt nicht nur Karthago, als es sich 149 v. Chr. so mutig wie vergeblich gegen die Vernichtung durch die Römer aufbäumte. Harte Zeiten lagen hinter fast allen Bewohnern des Mittelmeers, ob sie in Nordafrika oder Italien, in Spanien, Griechenland, Ägypten oder auf einer der großen Inseln zu Hause waren. Die Punischen Kriege brachten Tod, Verwundung, Leid, Zerstörung und Armut über Hunderttausende. Niemand hat sich die Zeit genommen, ihre Geschichte aufzuschreiben. Ein paar Großen gaben die welterschütternden Konflikte Gelegenheit, in die Geschichte einzugehen. Hannibal, Scipio und Cato sind Namen, mit denen auch unsere Gegenwart noch etwas anzufangen weiß, auch wenn die Antike an Schule und Hochschule längst eine Randexistenz führt.
Eine Gesamtdarstellung dieser Zeit zu schreiben, ist eine Herausforderung, der kein Althistoriker widerstehen kann – jedenfalls keiner, der sich mit der römischen Republik beschäftigt. Das gute Jahrhundert zwischen 264 und 246 v. Chr. ist nicht nur die Epoche, in der Rom den Grundstein für sein Imperium legte, sondern eine Zeit enormer Umbrüche für die gesamte antike Mittelmeerwelt. Während Rom immer mächtiger wurde, versanken große Reiche in Trümmern, vor allem, aber längst nicht nur, Karthago. Die Frage, die schon der Zeitgenosse Polybios stellte und deren Beantwortung er zu unserem Glück ein kolossales Geschichtswerk gewidmet hat, beschäftigt uns bis heute: Warum Rom? Was war der Grund dafür, dass die Tiberrepublik ihre Konkurrenten um die Hegemonie einen nach dem anderen vom Spielfeld nahm?
Die Zeit der Punischen Kriege war nicht nur als historische Epoche von außerordentlicher Dynamik, sie ist auch ein rasch wachsendes Forschungsfeld. Längst nicht nur der Hannibalkrieg hat in den letzten rund 30 Jahren Aufmerksamkeit erhalten. Auch die zahlreichen Nebenkriegsschauplätze, von Nordafrika bis zum Alpengebiet, vom Balkan bis Iberien, sind inzwischen eingehend untersucht worden. Quellenkundliche Arbeiten stehen neben solchen, die das politische Geschehen, aber auch die Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte und neuerdings auch die Archäologie des römischen Expansionszeitalters zum Gegenstand haben. Viel Beachtung hat die senatorische Elite Roms erfahren, doch auch Karthago erfreut sich wachsenden Interesses in der Forschung.
Eine neue Geschichte der Punischen Kriege, die zugleich eine Geschichte des Mittelmeerraums im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. sein muss, braucht sich deshalb nicht groß zu rechtfertigen. Diese Geschichte wendet sich an Antike-Enthusiasten und alle, die es werden wollen. Sie möchte zeigen, wie die Forschung heute schwierigen, sperrigen und nicht selten einseitigen Texten Wissen über die Vergangenheit abringt. Dass das ein mühevoller, nie leichter und selten zu eindeutigen Ergebnissen führender Prozess ist, illustriert der Anmerkungsapparat, der sich als Wegweiser zu den Quellen versteht. Das Buch ist auch ohne ihn verständlich, aber es erfüllt seinen Zweck besser, wenn es zum Nachlesen bei Polybios, Livius, Appian und den vielen anderen antiken Autoren anregt, ohne die wir nichts über die Epoche wüssten.
Die Anmerkungen verwenden die in der deutschen Altertumswissenschaft gebräuchlichen Abkürzungen von Autoren und Werktiteln. Aufschluss über ihre Bedeutung gibt das Wikipedia-Lemma «Liste der Abkürzungen antiker Autoren und Werktitel», das auch einen exzellenten Überblick über den reichen Schatz der griechisch-lateinischen Literatur insgesamt vermittelt. «Nackte» Jahreszahlen beziehen sich auf Daten vor Christi Geburt, alle übrigen tragen den Zusatz «n. Chr.». Das Register enthält biographische Kurzinformationen zu den handelnden Personen des Dramas, bei denen in vielen Fällen durch Namensgleichheit Verwechslungsgefahr besteht. Nicht geläufige Begriffe werden im Text oder im Anmerkungsapparat erklärt.
Wissenschaft lebt vom Austausch, und auch dieses Buch ist nicht in mönchischer Klausur entstanden. Der Verzicht auf Präsenzlehre unter dem Vorzeichen der Corona-Epidemie macht bewusst, wie sehr Wissenschaft vom Gespräch im Hörsaal zehrt. Ich bin meinen Oldenburger Studenten für lebhafte, stets kritische Diskussionen in einer ganzen Reihe von Seminaren zum Thema dankbar. Ein herzliches Dankeschön gilt meinen Mitarbeitern Antonietta Castiello, Peter von Danckelman und Georg Müller, die das Manuskript gelesen haben und denen ich unzählige Anregungen verdanke. Dexter Hoyos hat mit mir geduldig Facebook-Diskussionen von einem Ende der Welt zum anderen geführt und mich mit Literatur versorgt. Über Fragen der Kriegstechnik habe ich mich in langen Telefonaten mit Raimund Schulz unterhalten. Ganz besonderen Dank schulde ich Tassilo Schmitt, der mich mit seiner profunden Kenntnis der Quellen auf unzählige Ideen gebracht und vor vermutlich noch mehr Irrtümern bewahrt hat. Die verbleibenden gehen selbstverständlich allein auf mein Konto. Auf zahlreiche Fehler hat mich auch meine Doktorandin Caroline Thongsan aufmerksam gemacht, der ich für die Erstellung des Registers zu großem Dank verpflichtet bin. Ihr ist es tatsächlich gelungen, sämtliche Hannos und Hasdrubals auseinanderzuhalten. Eine große Freude war die Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr und Andrea Morgan vom Verlag C.H.Beck, die das Buch von der Idee bis zum Druck kundig und mit nicht versiegender Geduld betreut haben. Schließlich danke ich meiner Frau Diana und meinem Sohn Jan dafür, dass sie mich in Corona-Zeiten mit den Punischen Kriegen geteilt haben.
Oldenburg, im September 2020Michael Sommer
EINS: ASCHE
Dann, o ihr Tyrer, verfolgt diesen Stamm und des ganzen Geschlechtes
Künftige Brut mit Haß, bringt dies als Opfer der Sühnung
Meiner Asche. Nicht Liebe noch Bund sei zwischen den Völkern.
Möge aus meinem Gebein sich einst ein Rächer erheben,
Der mit Feuer und Schwert die dardanischen Siedler verfolge,
Jetzt so wie einst, zu welcherlei Zeit die Macht es gestattet.
Ufer sei stets dem Ufer und Flut den Fluten entgegen,
Waffen den Waffen, und ewig sie selbst und die Enkel im Kampfe![1]
Mit einem Fluch verabschiedet sich Dido aus dem Leben, die Königin und Gründerin Karthagos. Sie stößt ihn aus, nachdem Aeneas ihr und ihrer Stadt den Rücken gekehrt hat, der Überlebende des Trojanischen Krieges und Liebhaber der schönen Königin. Aeneas hat es auf seiner Flucht aus dem brennenden Troja nach Karthago verschlagen. Dort kann ihn Didos Liebe nicht halten, als der Götterbote Merkur ihm seine Mission in Erinnerung ruft, mit seinen Gefährten in Italien eine Stadt zu gründen. Nach der heimlichen Abreise des Helden besteigt Dido einen Scheiterhaufen und stößt sich das Schwert in den Leib. Zuvor aber ruft sie ihr Volk (die «Tyrer») zu ewigem Hass auf Aeneas und seine Nachkommen («die dardanischen Siedler») auf. Dido ist selbst vor ihrem Bruder Pygmalion aus der phönizischen Stadt Tyros geflohen, und Dardanos ist der mythische Stammherr der Trojaner. Ascanius, der Sohn des Aeneas, errichtet später der Sage nach in Latium die Stadt Alba Longa, einer seiner Nachkommen ist Romulus, der Gründer Roms. Zwischen Karthago und Rom also soll «nicht Liebe noch Bund» sein, Afrika und Italien («Ufer sei stets dem Ufer entgegen») sollen auf ewig miteinander im Krieg liegen. Ein Rächer soll sich in Karthago erheben, der «mit Feuer und Schwert» den Römern heimzahlt, was Aeneas ihr, Dido, angetan hat: wenn «die Macht es gestattet» – wenn also politisch die Zeit reif ist für Rache.
1. «Nicht Liebe noch Bund»: Die Quellen
Die Worte des Zorns und der Rache legte um 20 v. Chr. der Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) der Königin Dido in den Mund. Der Tod der Karthagerin ist eine der dramatischsten Szenen in der Aeneis, dem Nationalepos der Römer, dem es an Dramatik wahrhaftig nicht mangelt. Didos Fluch erfüllte sich auf grausame Weise. Drei große Kriege, von denen der erste ein Regionalkrieg um Sizilien, der zweite nach antiken Maßstäben ein Weltkrieg und der dritte ein Vernichtungsfeldzug war, besiegelten Roms Aufstieg zur Hegemonialmacht des Mittelmeerraums – und Karthagos Untergang. Für den augustuszeitlichen Leser der Aeneis, für den die mythische Vorgeschichte Roms und die Epoche der Punischen Kriege zwei Koordinaten im historischen Kontinuum waren, ergab die Verknüpfung zwischen Aeneas und Karthago unmittelbar Sinn. Rom und Karthago waren neben Athen und Sparta die archetypischen Erbfeinde der klassischen Antike, und der Konflikt mit Karthago war für Rom gleichzeitig Auftakt und dynamischste Phase seiner Expansionsgeschichte. Wo, wenn nicht hier, sollte ein augusteischer Leser den entscheidenden Wendepunkt nicht nur der römischen, sondern der Weltgeschichte suchen, in dem das imperium sine fine, das in Zeit wie Raum grenzenlose Reich, das Iuppiter in der Aeneis den Römern verheißt, Gestalt gewann? Bis heute berühmt sind das Wort vom keine Gnade kennenden «karthagischen Frieden» und die Forderung des Politikers und Feldherrn Cato, Karthago müsse zerstört werden. Im Zeitraum von fast 118 Jahren lagen Römer und Karthager 42 Jahre lang im Krieg. Bei Vergil zeigt sich eine Perspektive, die Geschichte auf ein Ziel zusteuern lässt, das sie in der Realität nicht hatte und generell nie hat. Was in der Rückschau wie ein Jahrhundertkonflikt zwischen den beiden Groß-, ja Weltmächten des Altertums aussieht, der vom ersten Aufeinanderprallen über die sizilische Stadt Messene (Messina) 264 bis zur Auslöschung Karthagos durch Scipio Aemilianus im Jahr 146 reichte, nahm sich für die Zeitgenossen keineswegs so folgerichtig aus. Schließlich entrollte sich das Geschehen über vier Generationen, und nicht immer folgte logisch ein Ereignis auf das nächste, bis Karthago in Trümmern lag.
«Poenus plane est!»
Informiert sind wir über die Ereignisse ausschließlich durch Quellen, die eine ganz und gar oder doch vornehmlich römische Perspektive einnehmen. Was immer Karthager über die Auseinandersetzung mit Rom schrieben und dachten, es ist unwiederbringlich verloren, sieht man von ein paar Zitaten in der römischen Geschichtsschreibung ab. Die Einseitigkeit des Blickwinkels schlägt sich in dem Begriff nieder, der sich in allen europäischen Wissenschaftssprachen für den Großkonflikt eingebürgert hat: die Punischen Kriege, les guerres puniques, le guerre puniche, las guerras punicas, the Punic Wars. Die Bewohner Karthagos hießen auf Lateinisch Poeni, das dazugehörige Adjektiv lautete Poenus oder Punicus, abgeleitet von griechisch φοίνιξ (phoínix), was so viel bedeutet wie «purpurrot». Phoínikes war der griechische Name primär für die in der Levante beheimateten Phönizier, die den Griechen in der Eisenzeit als tüchtige Seeleute und Lieferanten von Luxusgütern begegneten. Darunter waren auch besonders wertvolle, in Phönizien hergestellte Purpurstoffe, so dass der Name hier seinen Ursprung haben dürfte.
Die Karthager waren, wie die Dido-Legende andeutet, Nachkommen von Phöniziern, die sich in Nordafrika niedergelassen hatten. Allerdings konstruiert bereits der Sammelbegriff «Phönizier» Zusammengehörigkeit dort, wo sie eigentlich gar nicht vorhanden war. Spätestens der Geschichtsschreiber Timaios von Tauromenion sah um 300 in den Karthagern Nachkommen der Phönizier. Karthago pflegte zwar stets Bindungen an seine levantinische Mutterstadt, sie waren aber doch eher locker und vor allem affektiver, nicht politischer Natur. Schon die Bewohner der «phönizischen» Städte Tyros, Sidon, Berytos, Byblos und Arados betrachteten sich wohl nur als entfernte Verwandte. Hauptsächlich sahen sie sich als Bürger ihrer Stadt, die mit ihren Nachbarn wohl sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeiten teilten, mit ihnen aber auch häufig bittere Konflikte austrugen – ganz ähnlich wie die Griechen. Das gilt auch für Karthago, das seine Mutterstadt Tyros schnell überflügelte und obendrein Menschen aus aller Herren Länder in seinen Mauern beherbergte. Wenn Karthago etwas war, dann eine multikulturelle Metropole, keine «phönizische» Stadt.
Hinzu kommt, dass die Wörter Poenus und Punicus in Rom einen höchst zweifelhaften Klang hatten. Die «punische Treue», Punica fides, war sprichwörtlich. In der wohl um 135 und damit ein Jahrzehnt nach Karthagos Zerstörung erstmals aufgeführten Komödie Poenulus («Das Punierlein») des Dichters Plautus (ca. 254–184) heißt es im Prolog: Poenus plane est! – «Er ist ein Punier durch und durch» –, und das ist gewiss nicht als Kompliment gemeint. Das römische Karthagobild war von Stereotypen regelrecht überwuchert: Karthager galten als notorische Lügner, als verschlagen, vertragsbrüchig aus Gewohnheit und profitgierig. Dass man den Nordafrikanern ein gerüttelt Maß an Perfidie unterstellte, war nicht erst das Ergebnis der langen Kriege und auch nichts ganz Neues. Bereits die Griechen hatten in den Phöniziern so kunstfertige wie weitgereiste Botschafter einer zunächst überlegenen Zivilisation gesehen, die aber stets auf den eigenen Vorteil bedacht waren und es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nahmen. Schon in Homers Odyssee (um 700) begegnet dieser Typus in Gestalt seefahrender Händler, die um des Profits willen nicht einmal vor Kindesentführung zurückschrecken. Und das Werk Herodots, des «Vaters der Geschichtsschreibung» (ca. 485–424), beginnt mit den Phöniziern, denen er die Schuld am Dauerstreit zwischen Hellas und dem Orient gibt. Schließlich seien es phönizische Händler gewesen, die bei einem Besuch im griechischen Argos die Tochter des Königs entführt hätten.[2]
Aus dem Blickwinkel der Griechen waren alle Nichtgriechen, auch die Römer, Barbaren. Aus der ab der späten Republik Konturen gewinnenden gemeinsamen Perspektive von Griechen und Römern galt dasselbe: Demnach waren Phönizier wie Karthager Barbaren. Keine primitiven Barbaren wie Skythen und Kelten, aber gleichwohl Barbaren, bei denen mit Verhalten zu rechnen war, das von bekannten Mustern abwich, und denen deshalb nicht zu trauen war. Weil nahezu die gesamte griechisch-römische Historiographie und auch die sonstige Literatur von dieser Barbarentopik durchzogen ist, sollte man den Texten gegenüber besondere Vorsicht walten lassen. Eigentlich verbietet es sich von selbst, die römische Benennung «Punische Kriege» einfach unkritisch zu übernehmen: «Römisch-Karthagische Kriege» wäre angemessener. Weil aber die eigentlich romzentrierte Bezeichnung in allen Wissenschaftssprachen eingeführt ist und auch als Epochenbegriff geradezu kanonischen Rang besitzt, hält diese Darstellung ebenfalls daran fest. Außerdem sind die lateinischen und griechischen Texte so gut wie alles, was wir an Quellen über die Konflikte des 3. und 2. Jahrhunderts besitzen. Materielle Zeugnisse gibt es kaum, und so konnte auch die vorliegende Darstellung selbstverständlich nur auf Grundlage der antiken Literatur, vor allem der historiographischen Werke geschrieben werden. Der Versuch, eine Geschichte der «Punischen Kriege» gegen den Strich der Quellen zu schreiben, ist zum Scheitern verurteilt, auch wenn er immer wieder unternommen worden ist. Daher lohnt als Erstes ein kurzer Blick auf die wichtigsten Texte und ihre Verfasser.[3]
«Die ganze Oikoumene»: Polybios
Wichtigste Quelle für die gesamte Epoche sind die «Historien» (Historíai) des aus Megalopolis in Arkadien stammenden Griechen Polybios (ca. 200–120). Von allen erhaltenen Werken wurden die Historien mit der kürzesten zeitlichen Distanz zu den Ereignissen verfasst: Das Werk entstand ab 167, als der nach der Schlacht von Pydna nach Italien deportierte Polybios Aufnahme im Haus des Feldherrn Lucius Aemilius Paullus Macedonicus fand. Die ersten fünf der insgesamt 40 Bücher sind vollständig erhalten, vom Rest haben teils sehr bedeutende Fragmente in Form von Zitaten bei späteren Autoren überdauert. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen die Jahre 220 bis 168: von den Ereignissen, die zum Zweiten Punischen Krieg führten, bis zur Schlacht von Pydna, durch die Rom seine Hegemonie im Osten durchsetzte – für Polybios eine echte Sattelzeit der antik-mediterranen Geschichte:[4]
«Denn wer von den Menschen wäre denn so gleichgültig und oberflächlich, dass er nicht zu erfahren wünschte, wie und durch welche Art von Organisation und Verfassung ihres Staates in nicht ganz dreiundfünfzig Jahren [220 bis 167] fast die ganze Oikoumene unter die alleinige Herrschaft der Römer gefallen ist.»[5]
Die Oikoumene – das ist für Polybios die gesamte bewohnte, zivilisierte Welt. Wer sie beherrscht, steht, so wie die Tiberrepublik ab Mitte des 2. Jahrhunderts, konkurrenzlos da. Polybios ist einer Geschichtsbetrachtung verpflichtet, die er «pragmatisch» nennt: Geschichte soll nützlich sein. Er schreibt in erster Linie für ein Publikum, das selbst Verantwortung trägt. Die politische Elite soll durch das Studium der Vergangenheit in die Lage versetzt werden, in ihrer Gegenwart vernünftige Entscheidungen zu treffen. Anschauungsmaterial dafür findet der Geschichtsschreiber aus Megalopolis in Roms Aufstieg zur Weltmacht in Hülle und Fülle.[6]
Begreifbar wird die Geschichte der römischen Machtentfaltung durch die universalhistorische Weitung des Blicks auf den gesamten Mittelmeerraum: von der Iberischen Halbinsel über Nordafrika, Italien und den Balkan bis nach Syrien und Ägypten. Polybios’ Gegenstand ist nicht ein einzelner Krieg, sondern die kausale Verkettung einer Vielzahl von Konflikten. In der Tradition des Thukydides und in polemischer Absetzung von vielen seiner eigenen Vorgänger ist für Polybios Wahrheit das Ziel jedweder Beschäftigung mit Geschichte. Entferne man aus der Geschichte die Wahrheit, so bleibe nichts als nutzloses Geschwätz. Bei der Fülle der Informationen gelte es, durch Abwägung von Plausibilitäten die Spreu vom Weizen zu trennen. Polybios wendet sich gegen die Verfälschung von Fakten ebenso wie gegen die Tendenz, Geschichte zu dramatisieren, wie er sie bei vielen seiner Kollegen beobachtet. Besonders kritisch steht er Timaios von Tauromenion gegenüber, einem sizilischen Historiker des 3. Jahrhunderts, dem er Parteilichkeit und mangelnde Sorgfalt bei der Recherche vorwirft, vor allem das Fehlen jeglicher eigener Anschauung. Polybios kann für sich nicht nur in Anspruch nehmen, Örtlichkeiten besucht und mit vielen Zeitzeugen gesprochen zu haben, sondern auch, dem dröhnenden Schlussakkord seiner Geschichte selbst beigewohnt zu haben: Bei der Belagerung und Zerstörung Karthagos im Jahr 146 durch Scipio Aemilianus war der Geschichtsschreiber Augenzeuge; als der römische Feldherr Tränen über das Schicksal der Stadt vergoss, stand er daneben.[7]
Polybios’ Nähe zu Scipio Aemilianus ist aber gerade ein Grund, manchen Passagen des Werkes mit gesundem Misstrauen zu begegnen. Nicht nur dem Sieger von 146, sondern auch dessen Adoptivgroßvater Scipio Africanus maior sowie wiederum dessen Vater und Onkel setzt Polybios mit seinem Geschichtswerk ein Denkmal. Das Charisma militärischen Ruhms und politischer Erfolge, soziales Ansehen, auch Freundschaften und politische Netzwerke – all das vererbte sich im Rom der Republik von einer Generation auf die nächste, wurde als «Ahnenkapital» über Jahrzehnte und Jahrhunderte akkumuliert. Das heißt nicht, dass Polybios sich mit seinen Historien ganz und gar in den Dienst des Hauses Scipio und seiner Familiengeschichte gestellt hätte. Es ist aber wahrscheinlich, dass viele der von ihm konsultierten Augenzeugen und sonstigen Quellen aus dem Dunstkreis der Cornelii Scipiones kamen, also der öffentlichen Wahrnehmung dieses Clans verpflichtet waren. Wie mächtig diese Tradition war, zeigt sich nicht nur bei Polybios, sondern in allen Berichten über die Scipionen: Stets überragten sie ihre Zeitgenossen an militärischem Genie und politischem Weitblick, ob der Konsul Scipio vor der römischen Niederlage gegen Hannibal an der Trebia Ende 218 seinem forschen Kollegen Sempronius Longus widersprach und anregte, die Schlacht ins Frühjahr zu verschieben, oder ob Scipio Aemilianus bereits als junger Offizier den Kontrapunkt zu den unfähigen römischen Kommandeuren im Dritten Punischen Krieg setzte.[8]
Außer auf eigenes Erleben und Augenzeugenberichte – darunter von römischen und nichtrömischen Kriegsteilnehmern und deren Nachkommen – konnte Polybios sich auf Archive stützen: insbesondere das offizielle römische Archiv im Aerarium, wo nicht zuletzt sämtliche römisch-karthagischen Verträge lagerten. Von Bedeutung waren zudem private Archive, die unter anderem Briefe enthielten wie den, den der ältere Scipio nach der Einnahme Neukarthagos 209 an Philipp von Makedonien geschrieben hatte. Polybios’ wichtigste Quellen für weiter zurückliegende Ereignisse waren die heute verlorenen Geschichtsdarstellungen älterer Autoren: für den Ersten Punischen Krieg vor allem Philinos, Verfasser einer Monographie über diesen Konflikt, und Quintus Fabius Pictor, Teilnehmer der Schlacht am Trasimenischen See 217. Philinos, ein sizilischer Grieche aus Akragas (Agrigent), hatte selbst im Ersten Punischen Krieg auf Seiten der Karthager gekämpft, Fabius Pictor war der Sohn eines Konsuls und weitläufig verwandt mit Quintus Fabius Maximus Verrucosus, dem 217 ernannten Diktator, der in seinem Werk auch eine prominente Rolle spielte. Der Griechisch schreibende Pictor, der als Begründer der römischen Geschichtsschreibung gilt, diente Polybios als wichtigste Quelle für den Hannibalkrieg. Gattungstechnisch steht die von ihm verfasste Geschichte Roms in der Tradition der griechischen ktíseis, also von Werken, welche die Geschichte einer Stadt bis auf ihre Gründung zurückverfolgen. Pictor begründete eine dreiteilige Gliederung, die sogenannte historia tripartita, die sehr schnell kanonischen Rang erlangte: In großer Dichte schilderte er offenbar die Ereignisse der römischen Frühgeschichte um den Gründungsakt und die Königszeit, recht summarisch dann die Zeit der frühen Republik bis zum Beginn des Sizilienkrieges und wieder sehr ausführlich schließlich die Ereignisse ab 264, die für ihn Zeitgeschichte waren und durch Augenzeugenberichte und Selbsterlebtes leicht zu durchdringen. Für diese Phase bediente sich Pictor eines Darstellungsschemas, das die Ereignisgeschichte nach Amtsjahren gliedert und das deshalb «annalistisch» genannt wird.
Dieses Darstellungsschema war ein Erbe der durch den Pontifex maximus, den Leiter des wichtigsten Priesterkollegiums, geführten offiziellen Jahreschronik der annales maximi und für die frühe römische Historiographie stilprägend. Es zerriss durch seinen radikalen Synchronismus Sinn- und Handlungsstränge und zeichnete in dürren Worten und ohne stilistischen Anspruch die wichtigsten Ereignisse auf. Die zwei Generationen nach Cato hielten am annalistischen Aufbau und an der griechischen Sprache fest: zum einen, weil sie ein literarisches Genre aufgriffen, das von Griechen begründet und durch Pictor nach Rom verpflanzt worden war, vor allem aber, um den intellektuell im 2. Jahrhundert noch immer tonangebenden Griechen die römische Sicht auf die Vergangenheit zu vermitteln. Die große Innovationsleistung der sogenannten älteren Annalistik, die bis ca. 150 reichte – ihr sind der noch im Hannibalkrieg kämpfende Lucius Cincius Alimentus, der um 200 schreibende Senator Aemilius Sura, Publius Cornelius Scipio Augur, der Sohn des Africanus, und Aulus Postumius Albinus, Konsul des Jahres 151, zuzurechnen –, war dennoch die Konzeption der römischen Geschichte als Einheit, die von der Gründung Roms bis in die Gegenwart der Autoren reichte. Die Annalisten waren ausnahmslos Senatoren und damit selbst Gestalter von Politik, und ihre einschlägige Erfahrung wie auch ihr sozialer Status leiteten selbstverständlich ihren Blick auf die Geschichte. Das annalistische Schema wurde in der römischen Geschichtsschreibung erst durch den älteren Cato (234–149) durchbrochen. Er war auch der Erste, der sein Geschichtswerk, die Origines, auf Latein verfasste.[9]
Polybios begegnet Fabius wie Philinos mit erheblichem Misstrauen, weil sie Partei für ihr jeweiliges Lager bezogen und deshalb die Fakten zurechtgebogen hätten. Noch skeptischer ist er gegenüber den Griechen Chaireas und Sosylos, die Hannibal auf seinem Italienfeldzug begleiteten. Polybios wirft beiden vor, «Machwerke» verfasst zu haben, in denen sie nichts als das «Geschwätz aus Barbierstuben und von den Gassen» kolportiert hätten. Laut Cornelius Nepos verdankte Hannibal Sosylos seine Griechischkenntnisse. Immerhin hat sich von dem Geschichtswerk des Griechen ein Papyrusfragment erhalten, in dem er eine sonst nicht bezeugte Seeschlacht zwischen der Flotte Massalias (Marseille) und einem karthagischen Geschwader mit großem militärischem Sachverstand beschreibt. Polybios konsultierte außerdem Schriften römischer Autoren über den Hannibalkrieg, die er aber nicht namentlich nennt; möglicherweise befand sich darunter eine «Hauptquelle», die später auch Livius nutzte.[10]
Jenseits von Polybios
Einen gänzlich anderen Ansatz als Polybios verfolgte Diodor (ca. 90 – nach 30), ein aus dem sizilischen Agyrion stammender Autor spätrepublikanischer Zeit. Als Verfasser einer Weltgeschichte, der Bibliothḗkē Historikḗ, ging es ihm vor allem darum, das vorhandene Wissen über die Vergangenheit einem Publikum zugänglich zu machen, das nicht umständlich erst zahlreiche Monographien zu Rate ziehen wollte. Deshalb zeichnet sich sein Werk nicht durch Originalität und kritische Analyse aus, wohl aber dadurch, dass es aus zahlreichen, inzwischen teilweise verlorenen, aber autoritativen Quellen schöpfte. Für die Zeit der Punischen Kriege und davor lagen Diodor außer Polybios vor allem die erwähnten Werke des Philinos und des Timaios vor, für die Zeit danach das Polybios fortsetzende Werk des aus Apameia in Syrien stammenden Poseidonios. Der Zeitraum, den die ursprünglich 40 Bücher von Diodors Weltgeschichte behandelten, erstreckt sich im Wesentlichen von 146 bis zum Beginn von Caesars Gallischem Krieg 58. Wohl um 60 begann Diodor mit der Arbeit an seinem Werk, das er um 30 abschloss. Fast vollständig erhalten sind die Bücher 1 bis 5 mit einer Kulturentstehungstheorie und Regionalgeschichten für Ägypten, den Nahen Osten, Indien, Nordafrika und Griechenland sowie die Bücher 11 bis 20, die den Bogen von den Perserkriegen bis zur Zeit der Diadochen spannen, die Alexander dem Großen nachfolgten. Die Bücher 21 bis 32, die den Zeitraum der römisch-karthagischen Konflikte behandeln, sind immerhin in teils bedeutenden Fragmenten erhalten.[11]
Eine gute Generation nach Diodor lebte Titus Livius (ca. 59 v. Chr. – 17 n. Chr.), der aus Patavium (Padua) stammte, um 30 nach Rom ging und dort im Intellektuellenkreis um Kaiser Augustus Aufnahme fand. Um diese Zeit begann Livius mit der Arbeit an seiner römischen Geschichte, die den programmatischen Titel Ab Urbe condita («Seit Gründung der Stadt») trägt, von Roms mythischen Anfängen bis zum Jahr 9 v. Chr. reicht und ebenfalls dem annalistischen Schema folgt. Von den ursprünglich 142 Büchern, die in Gruppen zu je 15 angeordnet waren, sind noch 35 vollständig erhalten: die erste Dekade zur römischen Frühgeschichte und die Bücher 21 bis 45, die den Zeitraum von 219 bis 167 behandeln. Für die meisten der übrigen Bücher informieren Inhaltsangaben (Periochae) und Auszüge (Epitomae) in groben Zügen über den Inhalt. Livius ist zusammen mit Polybios die wichtigste Quelle für den Hannibalkrieg und die Zeit danach. Polybios gehörte zusammen mit den Vertretern der sogenannten jüngeren Annalistik – Autoren, die im ersten Jahrhundert v. Chr. schrieben und deren historisches Schlüsselerlebnis die Diktatur Sullas war – zu den von Livius rezipierten Geschichtsschreibern, möglicherweise schöpften beide zum Hannibalkrieg auch gemeinsam aus dem verlorenen Werk eines namenlos bleibenden römischen Historikers. Die «annalistische Tradition», aus der auch Diodor viel Material für die ältere römische Geschichte bezog, galt lange als im Vergleich zu Polybios wenig zuverlässig. In jüngerer Zeit hat sie Bruno Bleckmann in einer großen quellenkritischen Studie zum Ersten Punischen Krieg als besonders ergiebig für die innerrömische Perspektive rehabilitiert. Eine weitere, von Livius für den Hannibalkrieg intensiv genutzte Quelle ist ein monographisches Werk über diesen Krieg, mit dem der Jurist und Rhetor Lucius Coelius Antipater wohl zwischen 120 und 110 an die Öffentlichkeit trat. Die Historiae, auch Bellum Punicum genannt, verbanden die Lust an der Dramatisierung, die der hellenistischen Historiographie eignete und die vor fiktionalen Elementen nicht zurückschreckte, mit einem durchaus kritischen, vor allem aber intensiven Quellenstudium.[12]
Weil die vollständig erhaltene Darstellung des Krieges bei Polybios 216 mit der Schlacht von Cannae abbricht, verdanken wir Livius viele Informationen über die weiteren Ereignisse in Italien und Spanien. Ab Urbe condita wurde in erster Linie auf der Grundlage anderer historischer Darstellungen geschrieben, kaum je zog Livius Dokumente aus Archiven heran, wie Polybios das immer wieder tat. Aus arbeitsökonomischen Gründen folgt Livius meist über längere Abschnitte einem einzigen Autor, ohne dann andere Überlieferungsstränge zu berücksichtigen. Auch das unterscheidet ihn von Polybios, der immer wieder explizit Quellen gegeneinander abwägt. Ein Kollateralschaden dieser Vorgehensweise sind «Dubletten», die Livius regelmäßig produziert: Er berichtet dann über ein und dasselbe Geschehen, als wären es zwei Vorkommnisse, weil er seine Informationen aus unterschiedlichen Quellen schöpft. Gelegentlich reflektiert aber auch Livius die Plausibilität seiner – oft ungenannten – Vorlagen. Er fällt insofern aus der Reihe der Geschichtsschreiber, als er kein Senator war, sondern im Gegenteil ein unpolitischer Autor aus der italischen Provinz mit recht traditionellen Ansichten. Die Geschichte betrachtet er als großes Reservoir moralischer Exempel im Guten wie im Schlechten, und das immer aus der Perspektive seines Jahrhunderts, dessen Maßstab er stets anlegt. Nichtrömisches kommt bei Livius nur dort vor, wo es sich auf die römische Geschichte beziehen lässt, die dadurch, dass sie in der Weltherrschaft gipfelt, Beweis genug ist für Roms moralische Überlegenheit. All das macht Livius zu einer höchst problematischen Quelle: Was nicht durch Polybios beglaubigt ist, sollte nur mit größter Vorsicht herangezogen werden.[13]
Unter den Adoptivkaisern Hadrian und Antoninus Pius wirkte der aus Alexandreia stammende Gerichtsredner und Schriftsteller Appian (ca. 90–165 n. Chr.). Der Verfasser eines 24-bändigen Geschichtswerkes versteht sich als Chronist der römischen Expansion von ihren Anfängen in der Königszeit bis in seine Gegenwart. Er bricht radikal mit dem chronologischen Darstellungsschema, wie es die antike Historiographie stets beherrscht hatte, und gliedert seinen Stoff regional: So schlägt er den Bogen von der Eroberung Italiens (Bücher 1 bis 3) über Gallien (Buch 4), Sizilien (Buch 5), Iberien (Buch 6), den Hannibalkrieg (Buch 7), Nordafrika (Buch 8), den hellenistischen Osten (Bücher 9 bis 11), die Kriege gegen Mithradates (Buch 12), die römischen Bürgerkriege (Bücher 13 bis 17), Ägypten (Bücher 18 bis 21) und die Eroberungen des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Buch 22) bis zu den Expansionskriegen Kaiser Trajans in Dakien (Buch 23) und Arabien (Buch 24). Vermutlich noch unkritischer als Livius folgt Appian den Tendenzen und Darstellungsweisen seiner breit gestreuten, griechischen wie lateinischen Vorlagen. Immerhin arbeitete Appian durchaus präzise: Wo sich Zitate kontrollieren lassen, gibt er den Wortlaut seiner Quelle akkurat wieder. Speziell für die Ereignisse in Iberien und Nordafrika, aber auch für den späteren Verlauf des Hannibalkrieges in Italien ist Appian ein unverzichtbarer Gewährsmann, wenngleich sich viele seiner Angaben nicht überprüfen lassen.[14]
Das gilt auch für die lange völlig unterschätzte Gesamtdarstellung der Geschichte Roms aus der Feder des bithynischen Senators Cassius Dio Cocceianus (ca. 163 – nach 229 n. Chr.). Obwohl Cassius Dio aus großem zeitlichen Abstand zu den Ereignissen schrieb, ist seine von den Anfängen bis in seine Gegenwart reichende Rhōmaïkḗ Historía («Römische Geschichte») ein unschätzbarer Fundus von Informationen, die keine andere erhaltene Quelle übermittelt und die er vor allem aus der annalistischen Tradition schöpft. Um 180 n. Chr. nach Rom gekommen, absolvierte der Bithynier eine Karriere, die ihn bis ins Zentrum der Macht führte: Unter Kaiser Septimius Severus bekleidete er einen ersten Suffektkonsulat,[15] danach Statthalterschaften in der Provinz Africa proconsularis mit Sitz in Karthago, in Dalmatien und Oberpannonien und schließlich den ordentlichen Konsulat 229 n. Chr. Von den 80 Büchern der Römischen Geschichte sind nur die Bücher 35 bis 54 fast vollständig erhalten. Sie behandeln den Zeitraum von 65 bis 12 v. Chr. Für alle anderen Bücher liegen aber mehr oder weniger ausführliche Exzerpte von spätantiken und byzantinischen Historikern vor. Für die Zeit der Punischen Kriege gibt es die Epitome des Ioannes Zonaras, eines im 12. Jahrhundert n. Chr. lebenden byzantinischen Mönches, Juristen und Geschichtsschreibers, die sehr zuverlässig ihrer Vorlage folgt. Dio wertete ausschließlich – ungenannt bleibende – Darstellungen anderer Historiographen aus, keine Originaldokumente. Seine Urteilskraft ist allerdings durch seine aktive Rolle in der Politik und durch die eigene Anschauung vieler Örtlichkeiten geschärft. Die Geschichtsschreibung der Republik hält er nach eigenem Bekunden, im Gegensatz zur kaiserzeitlichen, für grundsätzlich vertrauenswürdig, weil alle Informationen damals offen zutage gelegen hätten. Außerdem teilt Cassius Dio das pessimistische Urteil der meisten seiner Zeitgenossen, alle Geschichte sei im Prinzip nichts anderes als ein permanenter Abstiegskampf. Er ist damit aber auch ein Korrektiv gegenüber solchen Vertretern der Zunft, die ihre Aufgabe vor allem darin sahen, Roms Expansion ein glorifizierendes Denkmal zu setzen.[16]
Neben diesen Hauptquellen gibt es noch eine Reihe weiterer Texte, die ergänzendes Material für die Epoche enthalten. Cornelius Nepos (ca. 100 – nach 27 v. Chr.) verfasste Biographien berühmter Heerführer – darunter Hamilkar und Hannibal – und mehrerer lateinischer Geschichtsschreiber, unter anderem Catos. Für seine Hannibal-Vita benutzte er neben Polybios die Geschichtsschreiber Sosylos und Silenos, die am Feldzug teilgenommen hatten; Silenos stammte aus Kale Akte auf Sizilien. Er wird von Polybios nicht namentlich genannt, diente aber auch Coelius Antipater als Quelle. Ebenfalls der Gattung Biographie gehören die 23 Parallelviten berühmter Männer an, in denen der aus Chaironeia stammende Philosoph Plutarch (ca. 45–125 n. Chr.) jeweils einen Griechen einem Römer gegenüberstellt. Erhalten sind 22 Doppelbiographien, darunter die des Fabius Maximus, des fünfmaligen Konsuls Marcus Claudius Marcellus, des Siegers von Pydna, Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, des Titus Quinctius Flamininus und die des älteren Cato. Plutarch wollte die Viten solcher Männer als – im Positiven wie Negativen – moralische Standards setzende Beispiele gelesen wissen, nicht um ihrer selbst und um des historischen Interesses willen. Dennoch lohnt ihre Lektüre. Ausgerechnet das erste Vitenpaar – Epameinondas und Scipio Africanus maior – ist verloren, aber besonders die Fabius-Maximus-Biographie ergänzt die sonstige Überlieferung zur ersten Phase des Hannibalkrieges.[17]
Pompeius Trogus, der unter den Kaisern Augustus und Tiberius in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lebte, war Verfasser der ersten lateinischen Weltgeschichte in 44 Büchern mit dem Titel Historiae Philippicae. Erhalten ist sie nur in Form von Kurzfassungen der einzelnen Bücher und von Zusammenfassungen des in der mittleren Kaiserzeit oder um 390 n. Chr. schreibenden Epitomators Marcus Iunianus Iustinus. Das Werk des Pompeius Trogus war eine «Weltgeschichte um Rom herum»: eine Geschichte der Welt, bevor große Teile von ihr durch Rom unterworfen wurden. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, daher wohl der Titel, der Aufstieg Makedoniens zur Weltmacht unter Philipp II. Das Werk ist geographisch gegliedert; die Bühne, auf der sich hier Geschichte abspielt, ist im Wesentlichen das Alexanderreich von Griechenland bis Indien. Die Ereignisse im Westen finden demgegenüber nur am Rande Berücksichtigung, doch das 43. Buch enthält Material über die griechische Kolonie Massalia (Marseille) und das 44. Buch hat Iberien einschließlich der karthagischen Herrschaft über die Halbinsel zum Gegenstand.[18]
Vereinzelte Informationen über die Punischen Kriege haben auch in anderen Werken überdauert, für deren Verfasser das Geschehen am Rande von Interesse war. Das gilt für die Geōgraphiká des aus Pontos stammenden, in augusteischer Zeit schreibenden Geographen Strabon (ca. 63 v. Chr. – 23 n. Chr.) ebenso wie für die Kurzdarstellung des unter Trajan und Hadrian schreibenden Historiographen Florus, die als Loblied auf Roms Herrlichkeit angelegt war und die Kriege in den Mittelpunkt stellte, die Roms Größe begründet hatten, unter anderem in einiger Gründlichkeit den Hannibalkrieg. Auch andere solcher kurzgefassten Geschichtsabrisse, sogenannte Breviarien, die in der Spätantike eine besondere Konjunktur hatten, lassen sich als Quellen für die Epoche heranziehen, so diejenigen aus der Feder von Aurelius Victor (ca. 320–390 n. Chr.) und von dessen Zeitgenossen Festus. Am ausführlichsten ist die Darstellung bei Eutrop (gestorben um 390 n. Chr.), der in immerhin drei seiner zehn Bücher umfassenden römischen Kurzgeschichte die Epoche der Punischen Kriege abhandelt. Schließlich enthält auch nichthistoriographische Literatur Berichtenswertes über die Epoche: vor allem das auf Livius und zu einem geringen Teil auf anderen Quellen fußende Epos Punica des frühkaiserzeitlichen Dichters Silius Italicus, das in 17 Büchern den Hannibalkrieg besingt; und die Essay-Sammlung Noctes Atticae («Attische Nächte») des um 130 n. Chr. geborenen Grammatikers Aulus Gellius.[19]
Gegenüber der relativen Fülle literarischer Quellen treten materielle Zeugnisse zurück, so groß und stetig wachsend ihre Bedeutung für andere Epochen der Alten Geschichte ist, insbesondere für die römische Kaiserzeit. Aus dem 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. gibt es kaum Inschriften, die etwas zur Rekonstruktion der Ereignisgeschichte beitragen könnten. Eine signifikante Ausnahme ist die in die ersten Jahrzehnte des 3. Jahrhunderts zurückreichende monumentale Grabanlage der Cornelii Scipiones in Rom, aus der zahlreiche erhaltene Grabinschriften für Angehörige der Familie stammen: zwar nicht für Scipio Africanus, den Sieger der Schlacht von Zama 202, wohl aber für einen seiner Söhne, für einen Neffen und für Lucius Cornelius Scipio Barbatus, den Konsul des Jahres 298 und ältesten bekannten Vertreter des Scipionenclans. Ein in seinem Wert schon zweifelhaftes Zeugnis ist die Siegesinschrift des Gaius Duilius auf einem Säulendenkmal auf dem Forum Romanum, der Columna rostrata, die an den Seesieg des Konsuls bei Mylai erinnert. Sie wurde wie die Säule selbst unter Augustus erneuert, in einem pseudo-archaischen Latein, das kaum dem ursprünglichen Wortlaut entsprechen dürfte. Immerhin ist die Säule ein Zeugnis für die beginnende Praxis, die virtus – die Tugend der «Mannhaftigkeit» – großer Männer im öffentlichen Raum zu dokumentieren. An Triumphzüge, die siegreichen Feldherren gestattet wurden, erinnern die Fasti triumphales: Listen, die auf vier Marmortafeln verewigt und auf dem Forum Romanum einzusehen waren. Die für die Chronologie der Republik unschätzbaren Tafeln wurden im 16. Jahrhundert geborgen und sind zum großen Teil erhalten. Allerdings fehlt für die Epoche der Punischen Kriege der wichtige Zeitraum von 222 bis 197 – und damit der gesamte Hannibalkrieg. Neben Inschriften gibt es nur wenige materielle Zeugnisse aus dem 3. und 2. Jahrhundert. Wichtige, aber nicht immer leicht zu interpretierende Fundstücke sind die Münzen aus Rom, aus den mit ihm verbündeten italischen Städten, aus Sizilien und aus dem unter der Herrschaft der Barkiden, der Familie Hannibals, stehenden Iberien. Dank umfassender archäologischer Feldforschung in Karthago wissen wir heute erheblich mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten darüber, wie die Stadt unmittelbar vor ihrer Zerstörung 146 aussah.[20]
2. Krieg – Macht – Bewährung: Leitfragen und -themen
Die Epoche, die mit dem Ausbruch des Ersten Punischen Krieges 264 begann und mit der Zerstörung Karthagos 146 ihren Abschluss fand, ist die dynamischste Phase nicht nur der Geschichte der römischen Republik, sondern der gesamten antiken Mittelmeerwelt. In der machtpolitischen Architektur dieser Welt blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Aber auch die innere Struktur der römischen Gesellschaft wandelte sich von Grund auf. Die Epoche weist alle Symptome einer Krise auf, wie Jacob Burckhardt sie so eindrucksvoll beschrieben hat: «Der Weltprozeß gerät plötzlich in eine furchtbare Schnelligkeit; Entwicklungen, die sonst Jahrhunderte brauchen, scheinen in Monaten und Wochen wie flüchtige Phantome vorüberzugehen und damit erledigt zu sein.»[21]
Warum traten Rom und die Mittelmeerwelt 264 in eine solche Periode krisenhafter Beschleunigung ein und warum endete sie mit Roms Triumph und Karthagos Vernichtung? Das ist die übergeordnete Problemstellung dieses Buches. Tatsächlich stecken darin gleich drei Fragen, auf die es Antworten zu finden gilt. Erstens: Warum konnte die italische Landmacht Rom siegreich aus dem Konflikt mit Karthago hervorgehen? Um zu einer Antwort zu gelangen, müssen wir tief ins Innenleben der römischen Gesellschaft eindringen, besonders in das ihrer Elite. Für die entstehende Nobilität waren die immer zahlreicheren und immer größeren Kriege «Bewährungsräume», die es in den folgenden Kapiteln auszumessen und zu kartieren gilt. Zweitens: Wie konnte sich die politische Tektonik des Mittelmeers zwischen 264 und 146 so grundlegend verändern, dass Rom als einzige Macht übrigblieb? Waren im 3. Jahrhundert außer Rom die wichtigsten Akteure Karthago, das antigonidische Makedonien, das Seleukidenreich und das ptolemaiische Ägypten, dazu eine Handvoll mittlerer Staaten und Stämme an der Peripherie, wurde jede dieser Mächte in kürzester Zeit vollständig deklassiert. Drittens: Wie verhalten sich die Kriege zwischen Rom und Karthago zu anderen Konflikten der Weltgeschichte? Oder anders gefragt: Was waren das für Kriege, die mehr als ein Jahrhundert lang überall im Mittelmeer wüteten, vom Atlantik bis nach Syrien?[22]
Krieg
Warum ziehen Menschen überhaupt in den Krieg? Die Frage lässt sich auf allen drei Auflösungsebenen beantworten: Individuen haben ihre Motive, sich in den Krieg zu stürzen, Staaten wiederum ihre Gründe, die andere sein können und meist sind. Und der Mensch als Gattung hat ebenfalls die Potentialität zum homo necans, zum Menschen, der tötet, egal, ob wir nun glauben, Gewalt sei seinem genetischen Code eingeschrieben oder lediglich Mittel zum Zweck. Krieg mag keine anthropologische Universalie sein, aber er ist in der Geschichte allgegenwärtig, von seiner weltweiten Ächtung scheint die Menschheit im 21. Jahrhundert so weit entfernt zu sein wie eh und je. Cicero unterscheidet in De officiis («Über die Pflichten») zwei Arten der Auseinandersetzung (duo genera certandi): solche durch Verhandlungen (per disceptationem) und solche durch Gewalt (per vim). Zur disceptatio greife der Mensch, zur vis das Tier. Daher sei Gewaltanwendung nur als letztes Mittel legitim. Bei Cicero geht es um Gewalt allgemein, bei dem preußischen Generalmajor und Militärschriftsteller Carl von Clausewitz (1780–1831) um den Krieg in der Variante des Kabinettskrieges. Er hat ihn in seinem umfangreichen Werk Vom Kriege als «Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen», definiert. Berühmt ist seine Bemerkung, Krieg sei die «bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln» und damit ein ihr untergeordnetes Instrument. Diese Definition aber ist zugleich voraussetzungsreich, denn sie bedarf des voll entwickelten Staates mitsamt seinem Gewaltmonopol, und unvollständig, denn sie verzichtet auf eine nähere Beschreibung der «Mittel». Für vormoderne Kriege brauchbarer ist die Definition des Politikwissenschaftlers Hedley Bull, der unter Krieg organisierte Gewalt versteht, die von politischen Einheiten gegeneinander ausgeübt wird. Krieg setzt demnach, erstens, Gewaltanwendung voraus, die, zweitens, bestimmten Regeln und, drittens, zumindest subjektiv, zweckrationalem Kalkül folgt. Viertens wird Gewalt kollektiv ausgeübt, durch politische Einheiten, die nicht unbedingt Staaten sein müssen, aber jedenfalls nicht als Form der Austragung eines Konflikts zwischen Individuen.[23]
Übrig bleibt ein breites Spektrum von Phänomenen, die sich unter dem Begriff Krieg fassen lassen: kurze und lange, Blitz- und Abnutzungskriege; Beute-, Annexions- und Hegemonialkriege; Regional- und Weltkriege; Präventiv-, Sanktions- und Vernichtungskriege; symmetrische und asymmetrische Kriege; Befreiungs-, Dekolonisations- und Sezessionskriege; Bürger-, zwischenstaatliche und Koalitionskriege; Ressourcen-, Kultur- und Machtkriege; begrenzte und totale Kriege; erklärte und unerklärte Kriege. Geeignet für den Zweck dieses Buches ist eine Typologie, die abstrakt genug ist, um möglichst viele dieser Kategorien in Skalenwerte zu übersetzen, und hinreichend offen, um nicht nur neuzeitliche Konflikte analytisch zu erfassen. Diese Bedingungen erfüllt am ehesten die Kriegstypologie des an der University of Illinois lehrenden Politikwissenschaftlers John A. Vasquez. Vasquez gliedert Kriege nach den Kriterien Potential, Intensität und Komplexität. Typen wie der «totale Krieg» sind Ideal-, keine Realtypen. Sie sind Konstrukte: Ihr Platz ist nicht in der Wirklichkeit, sondern im ordnenden Geist des Forschers, der an ihnen die Wirklichkeit misst. Außerdem ist keines der Gegensatzpaare absolut, sie alle markieren lediglich die Endpunkte von Skalen. Schließlich gilt: Kriege sind, wie schon Clausewitz wusste, hochdynamisch und schwer vorauszuberechnen, häufig neigen sie zur Eskalation. Deshalb kann ein Krieg, der als «binärer» und «begrenzter» Krieg beginnt, sich mit der Zeit zu einem «komplexen», «totalen» Krieg ausweiten.[24]
1. Potential: Rivalitätskriege vs. asymmetrische Kriege. Rivalitätskriege sind Kriege zwischen grundsätzlich gleichen Gegnern, alle anderen Kriege sind asymmetrisch. Maßstab für Gleich- oder Ungleichheit ist das Potential der kriegführenden Mächte: Ist es vergleichbar hoch, dann tendieren die Gegner dazu, dieselbe Logik des Krieges anzuwenden. Unter «Potential» sind sämtliche zur Erreichung bestimmter Ziele einsetzbaren Ressourcen zu verstehen: militärische, aber auch etwa wirtschaftliche, demographische und technologische. Durch sein in einem oder mehreren Konflikten erwiesenes Potential kann sich ein Akteur eine nachhaltige Reputation verschaffen, die einen bestimmten Status in der Hierarchie des Systems begründen kann und selbst das Äquivalent einer Ressource ist. So entsteht ein Rückkopplungseffekt: Potential verstärkt sich selbst.
Rivalitätskriege liegen in häufig generationenlangem Wettbewerb um Vorrang begründet, der sich im Affekthaushalt ganzer Nationen niederschlagen kann, man denke an die «Erbfeindschaft» zwischen Deutschland und Frankreich und die ideologische Überfrachtung des Ost-West-Konflikts. In Rivalitätssituationen können wechselseitige Furcht, Misstrauen und Unsicherheit wie Brandbeschleuniger wirken. Oft werden die Rivalen zum Wettrüsten veranlasst oder erliegen im Extremfall der Versuchung, als Ultima ratio zum Präventivkrieg zu greifen. Parteien investieren oft schon im Vorfeld des Krieges ohne Rücksicht auf Kosten und Nutzen in Möglichkeiten, dem Rivalen Schaden zuzufügen. In Rivalitätskriegen bringen die Gegner vergleichbare Machtmittel und Waffen zum Einsatz, sie kämpfen nach grundsätzlich gleichen Regeln und Rhythmen.
Einer gänzlich anderen Logik folgen asymmetrische Kriege. Die kriegführenden Parteien verfügen nicht nur über quantitativ und qualitativ deutlich unterschiedliche Potentiale, sie bedienen sich auch unterschiedlicher Mittel der Kriegführung und greifen zu gegensätzlichen Strategien der Be- und Entschleunigung: Typischerweise bedient sich die schwächere Seite der Guerillataktik und ist bemüht, Konflikte bei niedriger Intensität in die Länge zu ziehen. Anders als bei Rivalitätskriegen herrscht bei asymmetrischen Kriegen meist kein zum heißen Krieg eskalierender Dauerzustand des kalten Krieges. Kriegsauslösend sind eher kurzfristige Kosten-Nutzen-Erwägungen einer Partei: die Aussicht auf einen schnellen Sieg für die stärkere oder auf leichte Beute für die schwächere Seite.[25]
2. Intensität: Begrenzte vs. totale Kriege. Der totale Krieg ist ein Kampf um die Existenz. Er mobilisiert das gesamte Potential einer kriegführenden Partei. Der Krieg ergreift dann Besitz von einer ganzen Gesellschaft und so gut wie allen ihren Ressourcen. Der Mobilisierungsgrad reflektiert die Höhe des Einsatzes: Wird um alles gespielt, werden auch sämtliche zur Verfügung stehenden Ressourcen mobilisiert. Schon Clausewitz hat erkannt, dass die totale Mobilisierung von Ressourcen durch eine Partei zwingend dasselbe Vorgehen durch die andere nach sich zieht. Je näher ein Krieg der Totalität kommt, desto mehr wird jede Partei versuchen, den Gegner nach dem Krieg auch innerlich zu rekonfigurieren, im Extremfall zu vernichten. Beispiele für solche Rekonfigurierungen des besiegten Gegners sind die Demokratisierung Westdeutschlands und Japans durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Verwandlung Ostdeutschlands in eine «Volksdemokratie» nach sowjetischem Muster ebenfalls nach 1945. Krieg lässt sich in mehreren Abstufungen begrenzen, mit einer Skala von «total» bis «begrenzt» in Abhängigkeit von den Zielen: Will ich die globale Ordnung verändern? Eine Hegemonie errichten? Großflächig Gebiete annektieren? Den Gegner nachhaltig schwächen? Eine geringfügige Grenzkorrektur erzwingen? Eine Rinderherde erbeuten? Die Wahl der Mittel wird sich unfehlbar an den gesetzten Zielen orientieren. Territorialkriege tendieren dann zur totalen Eskalation, wenn das Kernland einer der kriegführenden Mächte unmittelbar bedroht oder sogar Kampfgebiet ist, während sie begrenzt bleiben, solange es um Peripherien geht. Kriege können aber auch durch kulturelle Restriktionen bis hin zur Ritualisierung eingehegt und so begrenzt werden. Am besten funktioniert das, wenn sich die kulturelle Prägung der Gegner nicht oder nur marginal unterscheidet. Bestes Beispiel ist der ritualisierte Krieg zwischen den Hoplitenphalangen der griechischen Poleis in archaischer und frühklassischer Zeit, mit jeweils nur einer begrenzten Zahl von Opfern und relativ geringen durch Kriege bewirkten Verschiebungen in der Machtbalance. Wie total ein Krieg den eingesetzten Mitteln nach ist, lässt sich am Mobilisierungsgrad demographischer und materieller Ressourcen und an den zur Anwendung gelangenden Taktiken ablesen. Sind die taktischen Mittel mit hoher – gegnerischer oder sogar eigener – Ressourcenvernichtung verbunden, so tendiert der Krieg zur Totalität. Beispiele wären etwa die Taktik der verbrannten Erde, Flächenbombardements auf zivile Ziele, der Einsatz nuklearer taktischer Gefechtsfeldwaffen oder gar strategischer Interkontinentalraketen oder auch die Kamikazeangriffe der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Natürlich können Ziele wie eingesetzte Mittel zwischen Konfliktparteien eines Krieges variieren. Deshalb ist denkbar, dass die eine Macht sich im «totalen» Krieg befindet, während es für die andere ein «begrenzter» Krieg ist. Je asymmetrischer Kriege sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf unterschiedlichen Niveaus der Totalität geführt werden. Rivalitätskriege hingegen haben von sich aus die Tendenz, früher oder später zu totalen Kriegen zu eskalieren.
3. Komplexität: Binäre vs. komplexe Kriege. Binäre Kriege werden nur von einem Teilnehmer auf jeder Seite geführt, komplexe Kriege hingegen auf wenigstens einer Seite von einer Allianz aus mehreren Partnern. Auch hier zeigt sich wieder die Eskalationslogik von Kriegen: Oft brechen sie als Konflikt zwischen nur zwei Parteien aus, in den Zug um Zug weitere Mächte hineingezogen werden. So weitete sich der Polen 1939 durch Deutschland erklärte Krieg zum Zweiten Weltkrieg aus, der Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zum Ersten. Aber auch die umgekehrte Entwicklung ist denkbar: Der Erste Punische Krieg begann als komplexer Krieg zwischen Rom und den Mamertinern auf der einen, Syrakus und Karthago auf der anderen Seite und spitzte sich sehr schnell zum binären Kräftemessen zwischen Rom und Karthago zu, der Zweite Punische Krieg mündete in die von Polybios beschriebene Symploke, die Verflechtung von weit auseinanderliegenden Kriegsschauplätzen mit unzähligen Akteuren.
Macht
Vergrößert man die Brennweite der Betrachtung, so stößt man auf das durch drei «Punische», ebenso viele «Makedonische» und einen «Syrischen» Krieg, dazu asymmetrische Kriege in der Celtica, im Illyricum und in Iberien zwischen 264 und 146 völlig verwandelte politische System des Mittelmeerraums. Wie schon der Florentiner Staatsphilosoph Machiavelli richtig erkannt hat, ist der Aufstieg der römischen Republik zur Weltmacht eines der großen, vielleicht das größte historische Lehrstück in Sachen Machtpolitik. Was ist Macht? Wie funktioniert sie? Warum sind die einen mächtig und die anderen ohnmächtig? Und wie lassen sich so große Verschiebungen in einem Mächtesystem erklären, wie wir sie im 3. und 2. Jahrhundert beobachten? Wieder einmal liefert Max Weber die klassisch gewordene Definition eines geschichtlichen Schlüsselbegriffs: «Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.» Doch ein dynamisches Modell der Durchsetzung von Macht, das wie geschaffen ist für die Epoche, stammt von einem jüngeren Soziologen, dem Freiburger Heinrich Popitz.[26]
Popitz definiert Macht, von der Etymologie ausgehend, ähnlich wie Weber: «das Vermögen, sich gegen fremde Kräfte durchzusetzen». Macht ist aber nicht gleich Macht, sondern sie kann sich in unterschiedlichen Stadien verfestigen, ähnlich wie Materie in ihren Aggregatzuständen. Die Grundform von Macht nennt Popitz Aktionsmacht. Sie besteht in der Fähigkeit des Menschen, andere Organismen zu verletzen. Aktionsmacht ist die Macht des Jägers. Sie setzt ein, wer andere tötet, ihrer Freiheit beraubt, verletzt, aber auch, wer sie ökonomisch schädigt, indem er ihnen Ressourcen entzieht. Aktionsmacht wird «aus dem Handgelenk» ausgeübt, oft spontan, und ohne dass sie Organisation und Kontrolle voraussetzen würde. Sie vergeht mit dem Augenblick, ist auf «eine bestimmte Kraftprobe beschränkt». Aktionsmacht in Form brutaler Kriege bekamen zuerst Roms Nachbarn in Italien zu spüren. Doch lehrte bereits das Beispiel der etruskischen, von den Römern 396 zerstörten Stadt Veii, dass die Gewaltanwendung sinnlos verpuffte, wenn sie keine Strukturen aufzubauen half. Den Fehler korrigierten die Römer, indem sie, anstatt Besiegte vollständig zu vernichten, mit ihnen Bündnisverträge, foedera, abschlossen. Konsequent setzte Rom in der Zeit nach dem Keltensturm um 390 auf die Instrumente von Strafen und Belohnen. So wurde Städten, die sich freiwillig unterwarfen, Autonomie belassen, andere, wie Antium und Circei, wurden nach dem Latinerkrieg 338 als Gemeinden aufgelöst und durch römische Bürgerkolonien ersetzt, deren schiere Existenz beständige Drohung war. Die Wehrgemeinschaft, in die Italien durch die Tiberstadt mit den Jahren verwandelt wurde, funktionierte nach der Logik eines Verbrechersyndikats, das sein jeweils letztes Opfer bei entsprechendem Wohlverhalten zum Komplizen des nächsten Coups machte.[27]
Popitz nennt die Macht, die sich hier artikuliert, instrumentelle Macht, denn durch sie werden Menschen auf Dauer zu Instrumenten eines fremden Willens. Wenn der Mensch sein Gegenüber dazu bringen kann, ihm zu gehorchen, weil es Strafen fürchtet und Belohnungen erhofft, geht Macht in einen anderen Aggregatzustand über. Die Fähigkeit, Verhalten durch Strafen und Belohnen sowie die Ankündigung von beidem – Drohen und Versprechen – zu steuern, verleiht der Macht Dauer. Die Methode der instrumentellen Macht ist das Formulieren von Alternativen. Instrumentelle Macht fängt den, auf den sie ausgeübt wird, in fremdbestimmten Dichotomien: Er kann sich nur fügen oder verweigern, ein Drittes gibt es nicht. Die Drohung des instrumentelle Macht Ausübenden ist eine Erpressung, das Versprechen Bestechung. In die Hände spielt dem Mächtigen die Hoffen und Furcht auslösende Ungewissheit darüber, was die Zukunft bringen möge. Er kalkuliert die «Beweglichkeit antizipierender Phantasie» von vornherein in seine Drohungen und Versprechungen ein. Dieser Zustand war im römisch beherrschten Italien sehr schnell erreicht: Die Römer waren Meister darin, ihrer Macht Dauer zu verleihen, indem sie Strafen und Belohnen, Drohen und Versprechen zu Instrumenten ihrer Politik machten.
Instrumentelle Macht steuert einen fremden Willen von außen. Im dritten Aggregatzustand von Macht erfolgt die Steuerung von innen: Autoritative Macht erzeugt Konformität, derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, unterwirft sich ihr mit Haut und Haar. Auf Drohungen und Versprechungen kann der autoritativ Mächtige verzichten, weil er für sein Gegenüber die Quelle von Anerkennung ist, nach der es den anderen verlangt. Die Alternative ist wieder eine von Hoffen und Furcht, diesmal aber auf die Gewährung von Anerkennung respektive vor deren Entzug. Die Autoritätsbindung, folgert Popitz, sei die Form von sozialer Bindung, die «am eindeutigsten zur Machtausübung» disponiere. Sie sei allerdings auch, ob sie sich nun «behütend oder bedrückend» äußere, «in besonderer Weise riskant». Die Römer waren Virtuosen auch dieser Variante von Macht. Die Vorteile, zum Syndikat der Wehrgemeinschaft zu gehören, entfalteten in den Gemeinden Italiens bald normierende Kraft und lösten dort, vielleicht in Kombination mit einer Art Stockholm-Syndrom, eine starke innere Identifikation mit Rom aus, so dass es der Drohungen und Versprechungen immer weniger bedurfte. Vermutlich hätte eine nur auf instrumenteller Macht ruhende Wehrgemeinschaft den Stresstest des Krieges gegen Pyrrhos von Epeiros (280–275) nicht überstanden. So aber stand das unter Roms Führung geeinte Italien am Vorabend der Punischen Kriege robuster da als zuvor: Gemeinsam bestandene Proben schweißen zusammen.
Macht kann noch in einen vierten Aggregatzustand eintreten, den Popitz datensetzende Macht nennt, und auch für ihn bietet das römische Italien Anschauungsmaterial. Wer über datensetzende Macht verfügt, kann die Natur so verändern, dass dadurch den Menschen ein bestimmtes Verhalten aufgezwungen wird. Datensetzende Macht übt der Stadtplaner ebenso wie der römische Feldmesser aus, der durch die Vermessung und Flurteilung des eroberten Raumes, die Zenturiation, gravierend ins Landschaftsbild eingreift – und damit in die Lebensbedingungen unzähliger Menschen. Die römische Herrschaft drückte auf diese Weise Italien auch physisch-materiell ihren Stempel auf.[28]
Folgende Hypothese sei nun für die Epoche der Punischen Kriege formuliert: Die Verschiebung in der politischen Tektonik des mediterranen Systems hatte ihre Hauptursache darin, dass sich der Aggregatzustand der von Rom ausgeübten Macht in gut hundert Jahren massiv veränderte, allerdings nicht überall gleichzeitig und gleich schnell. Bis zur Schlacht von Zama gegen Hannibal 202 war Rom außerhalb Italiens im Wesentlichen auf Aktionsmacht angewiesen, um anderen Akteuren im System seinen Willen aufzuzwingen. Nach Zama trat zunächst neben sie, dann an ihre Stelle die instrumentelle Macht des Versprechens und Drohens. Aktionsmacht war nach der Vernichtung Korinths und Karthagos im Epochenjahr 146 praktisch überall zum Auslaufmodell geworden. Nur zur Bekämpfung marginaler Gruppen wie der Stämme in Iberien war sie noch erforderlich, während Rom andernorts, vor allem in Griechenland und Ägypten, bereits autoritative Macht ausübte. In Italien hingegen hatte der gleiche Prozess zeitlich versetzt schon früher seine Spuren hinterlassen. Die italische Wehrgemeinschaft war bei Ausbruch des Ersten und erst recht des Zweiten Punischen Krieges bereits so konsolidiert, dass Rom hier flächendeckend auf autoritative Macht zurückgreifen konnte. Die Wirksamkeit dieser Macht wurde erwiesen durch den auf den ersten Blick erstaunlichen Zusammenhalt der Wehrgemeinschaft im Angesicht des Hannibalkrieges. Roms Macht verfestigte sich zuerst in Italien, dann auf der Balkanhalbinsel und in Nordafrika, schließlich auf der Iberischen Halbinsel und zuletzt im Nahen Osten, wo erst mit der Niederringung des pontischen Königs Mithradates 64 durch Pompeius jeder Widerstand gebrochen wurde.
Bewährung
Das Handeln von Individuen freilich ist genauso entscheidend für Ausbruch, Verlauf und Ende von Kriegen wie das von Staaten und politischen Institutionen. Leitend für das Handeln der senatorischen Elite in Rom war eine rigide aristokratische Wettbewerbsethik. Das war grundsätzlich nichts Neues und ist nichts spezifisch Römisches. Die Dialektik von Konkurrenz und Kohäsion ist kennzeichnend für alle Aristokratien, und stets kreist Wettbewerb um Ehre, Ansehen und Einfluss. Außerdem müssen Eliten legitimieren, warum es sie geben soll. Aristokraten kämpfen sozusagen an zwei Fronten: Erstens müssen sie ihren Status innerhalb der Aristokratie in Konkurrenz zu anderen Aristokraten klären und zweitens müssen sie die Privilegien ihres Standes gegenüber der Allgemeinheit beglaubigen. Beides funktioniert, immer und überall, am besten, indem man Distanz zu anderen schafft: materiell durch Reichtum, habituell über den charakteristischen Lebensstil einer exklusiven leisure class, zu dem auch das ostentative Zurschaustellen des Reichtums vor allem durch sogenannte conspicuous consumption gehört, und praktisch über Leistungen. Dass die Verhältnisse in Rom in der Forschung besondere Beachtung gefunden haben, liegt natürlich daran, dass für die Republik, bei allen Lücken, eben doch Zeugnisse in unvergleichlicher Dichte vorhanden sind, viel mehr und vor allem viel direktere als etwa für Karthago. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die entstehende römische Nobilität eine Aristokratie sui generis war, die sich in wichtigen Elementen von ihren auch antiken Pendants unterschied.
Die meritokratische Komponente hatte in Rom besonderes Gewicht, weil die Auseinandersetzung zwischen dem alten Geburtsadel der Patrizier und den aufstrebenden plebejischen Familien in den sogenannten Ständekämpfen bis 367 eine neue patrizisch-plebejische Elite geschaffen hatte, die sich nicht länger auf Abstammung berief, sondern auf ihre Leistung für die Republik. Deshalb war fortwährende Bewährung für römische Aristokraten unerlässlich. Die römische Kardinaltugend schlechthin war virtus, wörtlich: Mannhaftigkeit. Virtus war eine klassische Bewährungstugend, und sie konnte in verschiedenen Räumen nachgewiesen werden, wobei «Raum» im übertragenen Sinn für Aktionsfelder, aber auch wörtlich für Schauplätze von Kriegen stehen kann. Der Vorteil des Bewährungskonzepts gegenüber dem von Bruno Bleckmann und Hans Beck vertretenen Modell aristokratischer Konkurrenz besteht darin, dass es nicht nur antagonistische Tendenzen in der römischen Elite beleuchtet, sondern auch die ihr innewohnenden starken Kohäsionskräfte, ohne die ein erfolgreiches Bestehen der Kriege und vor allem ihrer Krisen undenkbar gewesen wäre. Römische Aristokraten handelten aller Rivalität zum Trotz längst nicht nur eigensüchtig. Wer sich bewährte, tat das, indem er eine Leistung für die res publica und mithin für alle erbrachte. Der Nachweis von virtus erfolgte gerade auch dadurch, dass sich der Einzelne in das Kollektiv einer Elite mit ausgeprägtem Korpsgeist einreihte. Idealtypisch verkörpert die virtus der römische Aristokrat Cincinnatus, dieser noch halbmythische, vom Pflug an die Spitze des Heeres berufene Kriegsheld, der als Diktator 460 die Rom bedrohenden Stämme der Aequer, Volsker und Sabiner bezwang. Danach pflügte er weiter Furchen auf seinem Acker, als sei nichts geschehen. 439 soll er erneut zum Diktator ernannt worden sein, um einen Plebejeraufstand niederzuschlagen, und wieder sei Cincinnatus danach in sein bäuerliches Leben zurückgekehrt. Der zweifache Diktator bewährte sich gleich dreifach: als guter Soldat im Krieg gegen Roms Feinde, als guter Politiker im internen Hader zwischen Patriziern und Plebejern und als guter Bürger, der nach vollbrachter Tat auf seine Scholle zurückkehrte und nicht an der Macht festhielt.[29]
Die Bewährungsräume für die römische Elite blieben in den 200 Jahren nach der ersten Diktatur des Cincinnatus nahezu unverändert, auch wenn zur Elite infolge der Ständekämpfe immer mehr Plebejer gehörten: Kriege gegen die näheren und ferneren Nachbarn in Italien, Organisation des Bundesgenossensystems, Rechtsprechung und Verwaltung der Stadt – insgesamt ein angemessenes Aufgabenprofil für die «tüchtige Ratsherrenversammlung», als die Theodor Mommsen den römischen Senat bezeichnet hat. Dass die Zeichen auf Veränderung standen, kündigte erstmals die denkwürdige Zensur des Patriziers Appius Claudius Crassus – bekannt als Caecus – an. Claudius war Anfang dreißig, als er 312 in dieses Amt gewählt wurde, und hatte gerade erst die Ädilität bekleidet, die zweite von vier Stufen der Ämterlaufbahn, des cursus honorum. Das war im 4. Jahrhundert noch nichts Besonderes. Womit der neue Zensor Aufsehen erregte, war zum einen das gewaltige Bauprogramm, das er initiierte: Er ließ die Aqua Appia bauen, die älteste von später insgesamt elf Wasserleitungen, mit denen Rom versorgt wurde, und die Via Appia, die zunächst Rom und Capua miteinander verband und die Logistik in den noch immer wütenden Samnitenkriegen erleichterte. Zum Zweiten setzte Claudius Reformen in Gang wie die Volkswahl der Militärtribune und eine Reform der Tribus, in die der römische Bürgerverband gegliedert war. Diese Maßnahmen erregten Anstoß und stießen auf den erbitterten Widerstand etlicher Senatoren. Die politische Rührigkeit des Zensors, insbesondere aber seine Bauprojekte geben einen Eindruck davon, wie die Avantgarde der Aristokratie die Spielregeln für den Erwerb von virtus zu verändern begann. Männer wie Claudius erschlossen neue, zuvor völlig unbekannte Bewährungsräume, in denen sie die Konkurrenz deklassieren konnten. Mit Manius Curius Dentatus trat wenig später ein Plebejer in die Fußstapfen des Claudius: Auch er ließ einen Aquädukt errichten, gründete als Konsul 284 außerdem die Kolonie Sena Gallica (Senigallia) und schlug siegreiche Schlachten gegen Sabiner, Senonen, Samniten und Lukaner sowie 275 gegen Pyrrhos. In jenem Jahr bekleidete er bereits zum dritten Mal den Konsulat.[30]
Das alles war nur ein Vorgeschmack auf die Bewährungsräume, die Roms außeritalische Kriege seinen Aristokraten ab 264 eröffneten. Mit den Einsätzen stiegen auch die – materiellen wie symbolischen – Dividenden in schwindelerregende Höhen. Der Kurswert nichtmilitärischer Formen von Bewährung, durch die Claudius und Dentatus ihre virtus noch eindrucksvoll nachgewiesen hatten, fiel mit dem Ersten Punischen Krieg ins Bodenlose. Wenigstens ist das der Eindruck, den die Überlieferung schafft, die zunehmend um kriegerische Bewährung von großen Männern kreist. Allenfalls mit Koloniegründungen und Landverteilungsmaßnahmen konnten ehrgeizige Politiker noch von sich reden machen. Der aristokratische Bewährungsraum par excellence wurde aber auf Jahrhunderte der Krieg. Die Logik dieses Raumes setzte ihre eigenen Dynamiken frei. Erstens bedeutete jeder Friedensschluss die Schließung eines solchen Raumes und damit den Verlust von Bewährungschancen für jene, deren virtus