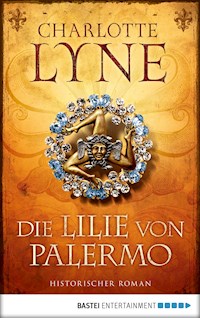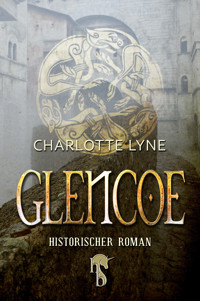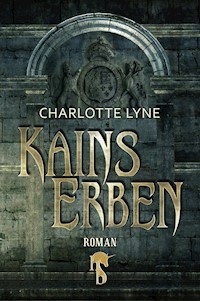4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Wittenberg des Jahres 1521 kursieren Gerüchte, der Reformator Martin Luther sei nach dem Reichstag zu Worms ermordet worden. Elisabeth, Lutheranerin und Witwe des reichen Tuchhändlers Eckhart, will – zusammen mit dem Philosophiedozenten Markus und dem jüdischen Malergesellen David - die Tat aufklären und Luthers Mörder finden. Gleichzeitig verwandeln Horden von Luthers Anhängern und Gegnern Wittenberg in ein Pulverfass. Bis in einer Dezembernacht ein Fremder auftaucht und sich seinen Freunden zu erkennen gibt: Es ist Luther, der zu seinem Schutz auf die Wartburg verbracht wurde und dort die Bibel übersetzte. Elisabeths Bruder Konrad wird die Aufgabe erteilt, die Schrift zu verbreiten. Am Tag darauf ist er tot …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charlotte Lyne
Allein aus Gnade
Ein historischer Wittenberg-Krimi
Für meine Eltern,zur Erinnerung an Sommer,Spargel und Wittenberg
»O Gott, ist Luther tot, wer wird uns hinfort das heilige Evangelium so klar vortragen? O ihr alle frommen Christenmenschen, helft mir fleißig beweinen diesen gottgeistlichen Menschen.«
Albrecht Dürer
Prolog
Wittenberg, Dezember 1520
»Der Antichrist? Wer von uns ist denn der Antichrist?«
Die Frage des Mannes in der dunklen Kutte platzte in die Stille. Elisabeth schlang die Arme um den Leib. Das Schaudern, das ihren Körper erfasste, war nicht der Kälte geschuldet. Seit ihrer Ankunft auf dem Grasland vor dem Elstertor hatte sie im Nacken einen Blick gespürt, der ihr das Blut zum Stocken brachte. Flüchtig sah sie hinauf in den Himmel, die schwarze Kuppel, über die geballte Wolken jagten. Sobald einen Herzschlag lang Mondlicht dazwischen hervorbrach, blitzte wie ein Trugbild die Stadt auf, um gleich darauf erneut in Finsternis unterzutauchen. Die just entzündete Flamme erhellte kaum die Scheite ringsum.
Das ist alles, was du jemals fühlst, alles, was dich jemals treibt, schalt sich Elisabeth, deine ewige Angst vor jedem Schatten an der Wand. Sie zwang sich, den Blick wieder dem Scheiterhaufen zuzuwenden, dem Schauspiel, um dessentwillen sie hergekommen war. Die eben noch klägliche Flamme begann zu zucken, leckte in die Höhe und sprang zugleich nach allen Seiten. Unter Knacken und Knistern schlugen die lodernden Zähne sich ins Holz. Das Feuer schnitt eine Bresche in die Nacht und zwang die Stadt zum Tanz im flackernden Licht. In jedem Winkel, so schien es Elisabeth, wurde gebaut, selbst am Markt war schon ein Platz für das künftige Rathaus abgesteckt.
Sie zupfte ihren Gatten am Ärmel. »Gehen wir näher ans Feuer? Es ist so kalt.«
Eckhard ließ sein silbernes Lachen aufzirpen und folgte ihr durch den Ring aus Leibern, dicht gefolgt von Konrad, ihrem Bruder, der bereits den ganzen Weg über geschwiegen hatte.
»Wenn’s richtig losgeht, wird dir schon warm werden«, gurrte Eckhard, und er behielt Recht: Im nächsten Atemzug hob alles um sie herum zu johlen an, riss die Arme hoch, hüpfte auf und nieder, und Elisabeth, Eckhard und Konrad steckten in einem Rudel von Studenten fest. Ein Gegenstand flog in das prasselnde Feuer, das inzwischen über die Köpfe der Versammelten hinaus züngelte. Einer der Studenten warf seine Mütze hinterdrein.
»Johann Eck: De primatu Petri.« Die Stimme des Mannes in der Kutte, der keinen Schritt weit vom Feuer stand, gebot dem Toben Einhalt. Er sprach nicht sonderlich laut, doch sein Spott funkelte wie eine blanke Scherbe. Mit beiläufiger Geste schleuderte er die Schrift, deren Titel er verlesen hatte, von sich. »Ins Feuer mit dem Dreck vom Eck.«
Bedauern um das Buch, das in den Flammen verkohlte, war fehl am Platz. Zimperliches Ding, schalt sich Elisabeth, du bist die Frau eines reformerisch gesinnten Wittenbergers und selbst eine Reformerin! Konrad hatte ihr erklärt, das Traktat verherrliche die Tyrannei des Papsttums, und der Verfasser, der verbohrte Theologe Eck, sähe am liebsten ihresgleichen statt der Papiere im Feuer. Trotz allem packte sie erneut der Schauder. Sie umfasste mit kalten Fingern ihre Kehle, weil Beklommenheit sie würgte.
Besser wär’s, wir würden weder Bücher noch Menschen verbrennen.
Auf der hohen Stadtmauer tanzten die Schatten des Feuers wie beleidigte Geschöpfe der Nacht. Hinter dem Schwarzen Kloster, dem Konventhaus der Augustiner, tauchten noch mehr Studenten auf. In ihrem Grölen schwang, so schien es Elisabeth, Mordgier mit. Sie folgten dem Aufruf, den der Mann in der Kutte auf den Gängen der Universitätsgebäude angeschlagen hatte: Kommt alle zum Elstertor, um die neunte Stunde des zehnten Dezember, und seht mit an, was Martin Luther den Taten des Papstes zu erwidern weiß.
Martin Luther. Ein Augustiner Mönch war er, Lehrer der Theologie, von nicht mehr als mittlerem Wuchs, die Schultern gebeugt, das Gesicht ausgezehrt. Von seiner ausgeprägten Stirn abgesehen schien nichts Ungewöhnliches an dem Mann, der eben eine weitere Schrift vom Boden auflas und sie über seinem Kopf schwenkte. Und doch war es er allein, jener Mann in der schwarzen Kutte, der sie hier zusammengerufen hatte, wo sie sich an seinem Feuer entzünden oder in ihm verglühen würden: Martin Luther.
Die Schrift flog, dass die Bögen sich lösten und einzeln dem Flammentod entgegen schwebten. Zur Antwort ertönte tosender Beifall, den Luther wie ein geschickter Chorleiter sogleich wieder zu dämpfen wusste, als er nach dem nächsten Brandopfer, einem in Leder gebundenen Büchlein, griff.
»Und was haben wir hier? Einen Auszug aus dem kanonischen Recht, hört, hört. Also Recht nennt sich dies.«
Elisabeth krallte sich die Finger in den Hals. Für gewöhnlich verbrannte man an diesem Ort die Lumpen von Pesttoten, und heute das Recht der Heiligen Kirche? Gewiss, Luthers Zorn war verständlich, seine eigenen Schriften waren in Lüttich wie in Löwen und zuletzt gar in Köln den Flammen übergeben worden, und ihm selbst hatte man in Rom als Ketzer den Prozess gemacht. Im Sommer war die päpstliche Bulle ergangen, die von ihm forderte, seine Lehren zu widerrufen und der Verbrennung seiner Bücher zuzustimmen. Dies hatte binnen sechzig Tagen zu geschehen, andernfalls drohte ihm der Bannfluch der Kirche, und was das bedeutete, wusste in Wittenberg jedes Kind: Der streitbare Mönch würde der weltlichen Gewalt ausgeliefert, die Reichsacht über ihn verhängt, und ein so grauenhaftes Schicksal stünde ihm bevor wie einstmals dem mutigen Jan Hus: der Tod auf dem Scheiterhaufen.
Luther hatte die sechzig Tage verstreichen lassen, ohne einen Finger zu seiner Rettung zu rühren. Gleichmütig hatte er zugesehen, wie die Bulle in den deutschen Landen verbreitet wurde, ja er hatte sich sogar selbst eine Ausgabe drucken lassen und sie in Cranachs Weinausschank unter Hohnlachen an Freunde verteilt. In seiner Spottlust glich er Eckhard, der ein Exemplar des giftsprühenden Druckwerks ergattert hatte und darüber in sein grillenhaftes Kichern ausgebrochen war. Elisabeth warf einen Seitenblick auf ihren Gatten. Vielleicht habe ich dich deshalb genommen, durchfuhr es sie, weil ich mich vor allem fürchte und du vor nichts. Weil meine Angst und ich uns nichts so sehr wünschen wie ein geborgenes Leben.
Das schmale Buch flog ins Feuer. Luther stemmte die Hände in die Hüften und sog die vor Feuchtigkeit flimmernde Nachtluft ein. Eine Atempause. Elisabeth entspannte sich. Eckhards fleischiger Wanst in ihrem Rücken schien ein Bollwerk gegen jegliche Gefahr, doch das Gefühl von Bedrohung, von dunkler Gegenwart wollte nicht weichen. Was aber sollte dort im Gesträuch denn lauern? Von der Kurie entsandte Häscher, die das Ärgernis Luther bei Nacht und Nebel aus dem Weg meucheln wollten? Welch lachhafter Gedanke! Meuchelmorde wurden nicht vor hundert Augen begangen, und diese vor Eifer bebenden Studenten hätten vermutlich jeden in Stücke gerissen, der ein Haar um die Tonsur ihres Helden krümmte.
Elisabeths Blick glitt über die Gesichter im Kreis. Wie sie glühten, wie fiebrig ihre Stirnen glänzten! Eine Hand hob sich, sandte ihr ein Winken. Sie atmete auf. Zur Rechten erkannte sie zwei Vertraute: Philipp Melanchthon, der Inhaber des neu gestifteten Lehrstuhls für Griechisch, und sein Student Markus Reuther, der eher wie ein väterlicher Beschützer denn wie ein Schüler seines winzigen Lehrherrn wirkte. Markus überragte Melanchthon um zwei Haupteslängen und war ein halbes Dutzend Jahre älter als der Gelehrte, der bereits als Wunderknabe von vierzehn den ersten akademischen Grad erworben hatte. Elisabeth musste lachen, sooft sie das Gespann erblickte. Melanchthon war wie stets in seiner eigenen Welt versunken, das gelockte Haupt in den Wolken, ohne zu spüren, wie es um ihn her brodelte. Markus, ihr Freund aus Jugendtagen, hatte ihm die Hände auf die Schultern gelegt, als fürchte er, sein kleiner Gefährte würde andernfalls zu Boden sinken. Diese zwei zumindest waren nicht vom Fieber ergriffen, sondern bewahrten bei aller Begeisterung für Luthers Aufbruch die Besonnenheit.
Ein eisiger Wind fuhr in Elisabeths Nacken und zerrte ihre Haube hoch. Im selben Augenblick senkte ihr Gatte ihr die Pranken auf die Schultern, wie Markus es bei Melanchthon tat. »Was ist dir, Els? Siehst du wieder einmal Geister, die dir Furcht einjagen?«
Vielleicht tue ich das. Der Geist, der hinter mir im Schatten steht, jagt mir Furcht ein, er mag ein Hirngespinst sein oder nicht.
Derweil bückte sich Luther und las die letzte Schrift vom Boden auf. Mit beiden Händen hielt er sie hoch und ließ sie im Nachtwind flattern. Elisabeth erkannte die gekreuzten Schlüssel und die Tiara – das Wappen Papst Leos. Sie hörte ihr Herz hämmern, wie um den Schutz der Rippen zu durchbrechen. »Ich frage noch einmal:« Luthers Stimme glich der Feuersäule. »Wer von uns ist denn der Antichrist?«
»Sag es uns, Bruder Martinus«, brüllte einer der Studenten.
Mehrere stimmten ein, johlten Anfeuerungen, schüttelten geballte Fäuste.
»Der Papst ist der Antichrist«, loderte Luthers Flammenstimme dazwischen. Nicht laut. Nur brandhell. Elisabeth krümmte den Rücken. Luther hielt sich die Schrift vor Augen, als müsse er deren Titel ablesen: »Hier also haben wir eines seiner Machwerke: Bulla contra errores Martini Lutheri et sequacium. Die Bulle gegen die Irrtümer Martin Luthers und seiner Anhängerschaft. Und wer ist jener Martin Luther, der eine solche Gefahr darstellt, dass es Papst Leo vonnöten ziemt, ihn mit dem grausamen Bannfluch zu bedrohen? Ihr wisst es alle. Es ist jener schlichte Bruder, der vor euch steht. Und die Anhängerschaft, die nach dem Willen Roms gleich mit gebannt wird, das ist nicht nur mein guter Doktorvater Karlstadt hier, das seid ihr selbst, ein jeder von euch.«
Das Gebrüll, das aufquoll, war nicht menschlich. Luther schwang die Bulle. »Was meint ihr, Gefährten, wohin gehört solcher Schimpf!«
Er würde es nicht wagen, nicht den Erlass des Heiligen Stuhls! Trotz des Tumultes vor ihren Augen, trotz der festen Hände ihres Gatten, spürte Elisabeth die Gegenwart der Gestalt im Schatten, ein Tier, das im Unterholz lauerte und jederzeit herausspringen mochte.
»Ins Feuer damit, Bruder Martin! Ins Feuer!«
Im Bruchteil eines Augenblicks sah Elisabeth Luther lächeln. »Weil du, gottloses Buch, den Herrn betrübt hast«, rief er, »so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer.«
Durch den Lichtkegel schwirrte das Bündel Papier. Die Flammen lechzten, streckten sich und fingen es in ihren Klauen. »Seht, ihr papistischen Brandstifter, so leicht ist es, Papier zu verfeuern!« Kaum hob das Gejohle an, presste Elisabeth sich die Hände auf die Ohren und kniff die Augen zu.
Eine Ewigkeit verstrich, ehe der Aufruhr sich legte, der Ring aus Menschen sich lockerte und schließlich zerstreute. Als sie die Augen öffnete, sah sie Luther zu Markus und Melanchthon sprechen. Langsam löste sie die Hände von den Ohren. Hinter ihr pfiff ihr Gatte durch die Zähne. »Feige kann man unsern guten Luther schwerlich schimpfen«, bemerkte er mit einem Kichern. »Aber ob das klug war, Schwager, was meint Ihr?«
»Es war in höchstem Maße unklug«, gab Elisabeths Bruder zur Antwort. Wie stets, wenn der dünnlippige Konrad sprach, erschien jedes Wort wie in Kupfer gestochen. »Er zwingt Rom zum Handeln, und dazu ist es zu früh, nicht nur für ihn, sondern für ganz Wittenberg. Wer soll den Brand, den er lostritt, löschen können?«
Das verglimmende Feuer sprühte Funken. Elisabeth, die an allen Gliedern fröstelte, mochte nicht warten, bis es gänzlich niederbrannte. Stattdessen hakte sie sich bei Eckhard ein und schlug forscher, als ihr zumute war, vor: »Lasst uns nach Hause gehen. Es gibt ja nichts mehr zu sehen, und behaglich ist’s hier draußen wahrlich nicht.«
Behaglich war ihr Haus im Herzen der Stadt, wo die Jüdenstraße in den Kirchplatz mündete. Es war gut geheizt, fest verschließbar, und die Magd würde ihnen noch einen Krug Würzwein und eine Schüssel Hammelbrühe wärmen. Ein dankbarer Blick streifte das Antlitz ihres Mannes, das mondrund auf dem engen Kragen thronte wie die fleischgewordene Güte. Wenn ich schon dich nicht lieben kann, wie’s dir gebührt, das Leben, das du mir bietest, liebe ich.
Eckhard tätschelte ihr die Hand. »Müde, mein Weiblein?«
»Ganz schrecklich.«
»Dann wünsche ich eine angenehme Nacht«, sagte Konrad.
»Was denn, Schwager, kommt Ihr auf keinen Bissen mehr mit? Nun ziert Euch nicht, schließlich weiß ich, dass Schmalhans bei Euch Küchenmeister ist.«
»Mir steht der Sinn nicht nach Essen«, erwiderte Konrad verschnupft.
Eckhard klatschte ihm die Pranke auf die Schulter. »Ach was, macht Euch nicht allzu viele Sorgen. Vielleicht verläuft ja doch noch alles sich im Sand.«
Unwillkürlich senkte Elisabeth den Blick auf ihre Füße, auf das zerrupfte Wintergras und den Sand zwischen den Büscheln. Ohne aufzublicken, ließ sie sich von Eckhard weiterziehen, an den Hecken vorbei zum Tor, das hinter ihnen für die Nacht verschlossen würde. Kurz davor fuhr sie, ohne den Grund zu kennen, herum – und dort stand er. Fahl schmiegte der letzte Schein des Feuers sich um seine reglose Gestalt, derweil die Schatten der kahlen Zweige Linien auf sein Gesicht zeichneten. Wie Sprünge in Ton. Der Blick des Mannes kreuzte den ihren. Elisabeth entfuhr ein Laut. Im Schritt erstarrte sie.
»Willst du Wurzeln schlagen, Els?« Eckhard zerrte sie am Arm. »Eben noch hattest du Angst, du frörest dir den ergötzlichen Hintern ab.«
Elisabeth befahl sich, weiterzugehen, den Kopf fortzudrehen, ihrem Gatten zu folgen. Unsäglich langsam leistete ihr Körper Folge. Der im Schatten gelauert hatte, war also kein Feind, kein Meuchler mit geladener Handbüchse. Es war ein Mann, dessen Anblick sie einst mehr als jeden anderen herbeigesehnt, der ihr Herz zum Hüpfen gebracht hatte und der es jetzt sich zusammenziehen ließ wie ein zu Tode erschrockenes Tier. Thomas. Einen Frühling zuvor ihr Verlobter. Heute ein Fremder, dem die Augen vor Erbitterung brannten.
Du hast mir nichts gelassen, Lisa. Nur den Weg zu Gott.
Was hatte er mit angesehen? Seine Liebste im Arm ihres lutherischen Gatten, dazu das Feuer, das den Erlass seines Papstes verschlang?
»Kommst du endlich?«, brummte Eckhard. »Mir tut ein Becher Wein Not, nicht zu klein und nicht zu geizig eingeschenkt.«
»Mir auch«, murmelte Elisabeth. Mit den Händen um den Hals lief sie los. Im Geiste glaubte sie noch immer, ein Paar dunkler, zornglühender Augen zu sehen. Ob es sich dabei um das Augenpaar des verschmähten Bräutigams oder um das des todesmutigen Reformators handelte, vermochte sie nicht zu sagen.
1
Wittenberg, April 1521
Im Weinausschank von Lucas Cranach war jede Bank bis auf den letzten Platz besetzt. Markus ließ den Blick über die Menschenmenge gleiten: Der enge Raum summte und schepperte vor Leben, die Tische wackelten und der Wein schäumte über, derweil vor den Fenstern die Karren der Händler übers Pflaster rumpelten und Trauben von Weibern zum Einkauf strömten. Die Gastwirtschaft lag dem Bauplatz für das Rathaus gegenüber, am Markt, dem Herzen der Stadt. Neben dem Ausschank betrieb der geschäftstüchtige Cranach hier seine Werkstatt und in der Nähe eine Apotheke.
In der Frühlingsluft standen die Läden offen, und es war eine Lust, dem Treiben zuzusehen, das davon kündete, dass Wittenbergs Stunde gekommen war. Seit vor zwei Jahrzehnten die Universität Leucorea gegründet worden war, blühten der Buchhandel, das Gastgewerbe und vor allem das Baugeschäft, denn Friedrich der Weise wollte eine Residenz, die sich hinter keiner zweiten zu verstecken brauchte. Der sinnesfreudige Kurfürst förderte Bildung und Kultur nach Kräften. Seinem Hofmaler Cranach zahlte er hundert Gulden im Jahr und hatte ihm sogar ein Wappen verliehen. Neben der Tür, die jetzt aufflog, prangte es: die schwarze, geflügelte Schlange. In einem Windschwall preschten sie herein: Der kugelrunde Eckhard Schramm voran und sein Gefolge, Gattin und Schwager, an den Flanken hinterdrein. Bei sich nannte Markus die kleine Schar das Dreigestirn. Wie gewöhnlich blickte Melanchthon nicht einmal auf, als die Neuankömmlinge in die Schankstube strömten.
Markus jedoch sprang von der Bank, ergriff den Weinkrug und schwenkte ihn zum Gruß. »Gelobt sei Jesus Christus, Oheim!«
»Sieh an, mein Neffe Markus und sein Griechlein. In Ewigkeit Amen, Kumpane.« Unter heftigen Atemzügen ließ Eckhard, Markus’ Oheim von der mütterlichen Seite, sich auf die Bank plumpsen. Er nahm ihm den Krug ab, goss sich den nächststehenden Becher voll und trank. »Schon etwas gehört?« Seine Korinthenäuglein wanderten von Markus zu Melanchthon. Wiewohl er gut und gern sechzig Jahre auf dem Buckel hatte, strahlte sein Gesicht vor Lebenskraft.
Markus folgte dem Blick des Oheims. Melanchthon hob endlich den Kopf. Er stellte keine Frage, sie alle wussten, wovon Eckhard sprach. An den Nebentischen verstummten Gespräche, doch zur Furcht bestand kein Grund. Dies war das Haus eines Lutheraners. Sie trafen hier zusammen, nicht nur, weil Cranach süffigen Wein ausschenkte, sondern vor allem, weil sie im Schutz seiner Wände unbesorgt sprechen konnten.
»Ich habe Nachricht aus Erfurt«, ließ sich Melanchthon vernehmen und versprühte dabei ob seines Zungenfehlers einen Tröpfchenhagel über den Tisch. Markus verbiss sich ein Schmunzeln. Zu sagen, dass er den kleinen Mann liebte, war keine Übertreibung. In Markus’ Elternhaus hatte es für den Bildungshunger des Sohnes kein Verständnis gegeben, und wäre Melanchthon ihm nicht beigesprungen, so hätte er sich statt in den Hörsälen der Universität im Holzhandel seines Vaters verdingen müssen. Der geniale Lehrer aber hatte seine Begabung erkannt, ihn ermutigt und ihm sogar eine Kammer in seinem Haus überlassen. Nun beugte Markus sich zu Melanchthon herunter und berührte dessen Schulter: »Augenblick, mein Griechlein. Lasst doch Herrn Konrad und Frau Elisabeth erst einmal zu Atem kommen. Und der Wein ist uns, wie ich sehe, auch ausgegangen.« Sie nannten ihn alle so: Griechlein. Den Spitznamen hatte Luther ihm verpasst, und Melanchthon war es recht. Dass er mit dem Vornamen Philipp hieß, hatte er vermutlich vergessen.
Überraschend zart lachte Eckhard auf. »Das seht Ihr goldrichtig, mein Bester.« Mit dem leeren Krug winkte er nach Jobst, einem von Cranachs Malschülern, der sich Kost und Logis beim Meister verdiente, indem er im Ausschank half. Der Jobst war ein schlankes Bürschlein, schwarzlockig wie ein Welscher, der sich zwischen den Tischen bewegte, ohne je Lärm zu machen. Sogleich verschwand er hinter dem Schanktisch und füllte ihren Krug neu auf. Als er das Getränk an den Tisch trug, hielt Eckhard ihn am Handgelenk fest. »Was ist das denn für einer, euer neuer Roter?«
»Ein Franke«, murmelte Jobst, ohne Eckhard anzusehen. »Den haben wir in der Frühe erst bekommen.« Dabei rollte er das »R« an der Zungenspitze, wie Cranach selbst es tat. Des Malers Landsmann war er also, ein Franke wie der Wein. Und doch lag in der weich verschliffenen Mundart ein Ton, der anders war, den Markus zu kennen glaubte, aber nicht einzuordnen wusste.
»Fein, Kerlchen, davon füllst du mir nachher, ehe wir gehen, zwei Schläuche ab, verstanden? Und jetzt troll dich! Was wir zu reden haben, ist für feuchte Öhrchen nicht bestimmt.«
Das ließ der Jobst sich nicht zweimal sagen, sondern huschte auf seine geisterhafte Art davon. Ein paar Augenblicke lang sprach allein der Wein: mit Glucksen in Becher geschenkt und mit Schlürfen durch Kehlen gejagt.
»Ich wünschte, du würdest ihn nicht so behandeln«, platzte die Stimme Elisabeths in das genüssliche Schweigen.
»Aber wen denn, Weibchen?« Verblüfft wandte Eckhard sich ihr zu. Elisabeth sah nicht aus wie ein Weibchen, so verhuscht und verängstigt sie sein mochte. Neben ihrem Gatten wirkte sie, als hätte man eines der schreckhaften Rassepferde des Fürsten neben einen properen Brauereigaul gespannt. Markus kannte sie seit etlichen Jahren, doch die Vertrautheit der gemeinsam verbrachten Jugend war in Eckhards Gegenwart dahin.
»Cranachs Jungen«, gab sie dem Dicken hitzig Antwort.
»Und in welcher Weise behandle ich den missfällig?«
»Von oben herab behandelst du ihn. Er ist ein begabter Maler, der sich sein Handwerk hart erkämpft. Kein Schankbursche.«
»Was du nicht sagst.« Eckhard zog die Brauen in die Stirn. »Vielleicht sollte besser ich dem Herrn Künstler aufwarten, statt umgekehrt. Wäre damit deiner Liebe zum Bodensatz Genüge getan? Wenn das so weitergeht, muss ich dir den Malunterricht in Cranachs Werkstatt untersagen. Sinnlos verschleudert ist mein Geld dafür ohnehin.«
Elisabeth duckte sich. Ehe in ihm etwas aufbegehren konnte, hob Markus die Hände. »Sollten wir nicht wieder auf Luther kommen? Die Sorge um ihn versetzt uns in Erregung, aber es wäre töricht, dies im Streit miteinander auszulassen. Luther braucht sein Wittenberg vereint. Lasst Euch von meinem Griechlein berichten, welchen Empfang man ihm in Erfurt bereitet hat.«
Melanchthon nickte wie ein Pumpenschwengel. Seine Begabung, von einem Gespräch nur zu hören, was ihm taugte, war beneidenswert. »Wie einen Fürsten haben sie Luther bejubelt, ihn mit Fanfaren in die Stadt und sogleich bis auf die Kanzel geleitet, auf dass er ihnen predige«, berichtete er. »Die Empore bebte, so dicht mit Menschen befüllt war die Kirche.«
Man musste Melanchthon sehr gut kennen, um vom Zucken der Mundwinkel abzulesen, wie viel ihm Luthers Werk bedeutete, wie er um das Leben des Vorreiters bangte und wie es ihn freute, dass dieser auf der Durchreise nach Worms solche Triumphe feierte. Ihnen allen erging es ja ebenso, und der Pulk von Menschen, der sich um ihren Tisch scharte, sprach für sich: Halb Wittenberg zitterte um das Wohl seines berühmtesten Einwohners. Luther, der tollkühn die Bulle des Papstes ins Feuer geworfen hatte, war zum Verhör vor den Reichstag in Worms zitiert. Dass er dort erscheinen und vor Kaiser und Kurie seine Sache vertreten durfte, war der Fürsprache des Kurfürsten zu danken. Über andere hätte man für das, was Luther gewagt hatte, ohne Anhörung die Reichsacht verhängt, sodass ein jeder ihn ungestraft hätte töten können. Stattdessen hatte Kurfürst Friedrich erwirkt, dass der Kaiser dem Rebellen Gehör schenkte und ihm freies Geleit für die Reise gewährte. Von diesen Tagen in Worms hing alles ab: Würde Luther, um sein Leben zu retten, seine Thesen widerrufen? Oder stünde er wie die Eichen vor Wittenbergs Toren unverbrüchlich zu seinem Wort?
Als wäre Melanchthon Markus’ Gedankengang gefolgt, beendete er jetzt seine Rede: »Und somit ist es unsere Pflicht, für unseren Christenbruder fleißig zu beten. Müssten wir dieses Mirakel unter den Menschen verlieren – nicht auszudenken, was aus den Reformen würde. Etwas Schlimmeres könnte uns auf Erden nicht geschehen.«
»Hört, hört. Glaubt Ihr wahrhaftig, was Ihr da sagt, kleiner Grieche?«
Markus schoss herum. Der Sprecher war ein Kerl mittleren Alters, ein Zimmerer, den Markus von Luthers Predigten in der Stadtkirche kannte. Sein Gesicht wirkte verzerrt, und sein Atem ging in so schweren Stößen, dass Eckhard ihm seinen Becher abnahm und ihn mit fränkischem Wein auffüllte. »Das Schlimmste, das uns geschehen könnte, wäre Luthers Verrat, nicht sein Tod. Widerruft er, so zerschlägt er die Bewegung. Stirbt er hingegen mutig für die Sache, so werden wir uns gewaltig erheben, heute hier in Wittenberg, und morgen schon überall!«
Eckhard, im Begriff, dem Manne den Becher zu reichen, knallte ihn stattdessen zurück auf den Tisch, dass der Rotwein schäumte. »Und jetzt das Maul gehalten, Herr Großsprecher.« Den beißenden, bösen Spott, mit dem er zuvor auch seine Frau bedacht hatte, trauten dem leutseligen Dicken wenige zu. Markus aber wusste es besser: Mit eben dieser Mischung, trauter Kumpanei über einem Kern aus Schmiedeeisen, hatte der Oheim sein Vermögen im Tuchhandel gemacht.
»Du schwatzt nicht von einem Ding, einem Buch etwa, das sich nachdrucken lässt, sondern von einem Mann, der mehr Schmalz im Hirn hat als zehn von deiner Sorte. Wenn du den für eure Bewegung so einfach dem Flammentod überantworten willst, dann soll mir deine Bewegung gestohlen bleiben.«
Der Zimmerer holte keuchend Atem. Ein Wort wollte folgen, zwei, dreimal entrang sich seiner Kehle ein Laut, dann verstummte er. Ein paar andere murrten, einer reckte gar die Faust. Die, denen eine Reform im Geistigen nicht genügte, die sich einen gewaltsamen Umsturz wünschten, waren in Wittenberg zahlreicher, als Eckhard vermuten mochte.
Der nahm geräuschvolle Schlucke aus dem Becher, den er dem Zimmerer eingeschenkt hatte, und schüttelte zwischendurch sein Haupt. »Gestopfter Fettsack«, hörte Markus einen der Männer knurren. »Was weiß der von der Bewegung, was weiß der überhaupt?«
Eckhard wollte aufspringen, doch sein Schwager, der lange Konrad Priesteritz, kam ihm zuvor. Mühsam beherrscht erhob er sich und drückte Eckhard auf die Bank zurück, die geballte Faust unterm Tisch verborgen. »Ich rate, sich zu mäßigen«, sagte er. »Wir sind ehrbare Wittenberger Christen, die für die Erneuerung der Kirche die Hände rühren. Wir kamen hier zusammen, weil wir uns Nachricht von einem der Unsrigen erhofften, der in erheblicher Gefahr schwebt. Lässt uns dabei der Mob keinen Frieden, so wäre mir der Wein in dieser Stube vergällt, trotz aller Wertschätzung für unseren Gastwirt.«
Wie aufs Stichwort verriet das Schlagen der Hintertür, dass Cranach vom Hof hereingekommen war. Markus wandte den Kopf. Der bärtige Maler, der sein jüngstes Kind auf dem Arm trug, hatte sich zu Jobst gesellt und beobachtete das Geschehen.
»Was kratzt dich denn, Laffe?«, bellte einer von den Leuten des Zimmerers. »Die Bewegung oder dein Wein?«
»Wo der Mensch und sein Bedürfen keinen Raum haben, entbehrt die Bewegung des Sinns«, entgegnete Konrad. Er war eine beachtliche Erscheinung, hochgewachsen, die Züge wie in Holz geschnitzt und das Haar eisengrau, wiewohl er keinen Tag älter als vierzig sein konnte. Ein Mann, der ruhig wirkte, in dem aber eine Kraft brodelte, die vernichten konnte. Jeder in Wittenberg kannte seine Geschichte: Mit einem Vater, der sich ins Schuldgefängnis gesoffen hatte, waren Konrads Aussichten trübe gewesen. Er aber hatte dank seiner Strebsamkeit im Buchhandel Fuß gefasst, hatte seine Schwester trefflich verheiratet und würde sich mit etwas Hilfe durch das Vermögen seines Schwagers aus dem Elend herausschuften. Aus seiner Verachtung für die Hitzköpfe machte seine Miene keinen Hehl.
Sein Herausforderer gab sich dennoch nicht geschlagen. »Wollt Ihr denn, dass Luther widerruft? Dass er die Wahrheit, die er uns gepredigt hat, verrät und leugnet, wollt Ihr das?«
»Zumindest will ich nicht, dass ein Mann, der uns unersetzlich ist, das Schicksal eines Jan Hus erleidet.«
»Und wer ist denn wohl dieser Hus?«
»Wie bedauerlich, dass Ihr das fragen müsst. Vielleicht solltet Ihr, ehe Ihr die Mäuler aufreißt, erst einmal lernen, worüber Ihr redet? Hus starb vor hundert Jahren für Eure Sache im Feuer. Soll es so Eurem Wunsch nach auch Luther ergehen?«
»Was schwatzt Ihr?«
»Ich gebe Euch Antwort. Jan Hus war ein tapferer Prediger, der gegen den Ablass und die Ausschweifungen des Klerus zu Felde zog. Aufs Konzil nach Konstanz beorderte man ihn, und freies Geleit versprach man, ganz wie es Luther zugesagt ist. Aber der Geleitbrief wurde gebrochen und Hus gefangen gesetzt. Widerruf oder Tod hieß es für ihn, und da er sich weigerte, von seiner Lehre abzuweichen, starb er in Qualen auf dem Scheiterhaufen. Ihr mögt verzeihen, dass uns der Gedanke, ein Gleiches könnte unserem Freunde Luther drohen, mit Furcht erfüllt.«
»Aber wenn Luther ein Leid geschieht, zieht Wittenberg in den Kampf«, begehrte sein Gegner auf. »Nur der Mann stirbt. Die Sache lebt.«
»Stirbt der Mann, so ist die Sache ein Wurm ohne Kopf und wäre kein Segen mehr, sondern ein Fluch«, beschied ihn Konrad. »Damit sei es genug. Zieht Euch zurück und lasst uns unsern Wein trinken.«
»Der Bitte schließe ich mich an«, brach der klare Bass Cranachs sich Bahn. »Ich kam, um meinen Gästen frohe Kunde zu bringen, keineswegs um einen Flächenbrand in meiner Schänke auszutreten.«
»Frohe Kunde? Von Martin Luther?« Ein vierschrötiger Mann in Reisekleidung verschaffte sich im Gedränge Gehör.
»Und wer seid Ihr, wenn ich fragen darf?«, erkundigte sich Cranach.
Der Fremde lüftete die Kappe und verbeugte sich. »Gestatten? Johannes Bugenhagen mein Name, just immatrikulierter Student der Leucorea. Aus Pommern hat es mich in Eure Stadt verschlagen, weil ich die neue Theologie aus berufenem Munde hören wollte.«
Für einen Studenten, fand Markus, war der Mann recht alt, und das plumpe Gesicht schien eher einem Bauern als einem Gelehrten zu gehören, aber Markus wusste selbst zur Genüge, dass Herkunft kein Gradmesser für Geisteskräfte war. Der Dickliche sprach weiter: »Wenn Ihr also gute Kunde von Doktor Luther habt, wird er wohl bald wieder hier sein und seine Lehren fortführen?«
»Das gebe Gott«, entgegnete Cranach. »Das Verhör vor dem Reichstag steht ja erst bevor. Ein Bote aus Worms, der mir eben auf schweißnassem Gaul in den Hof trabte, berichtete lediglich, dass Luther wohlbehalten eingetroffen ist und dass die Massen ihn umjubeln. Ein gutes Zeichen, denke ich. Einem Volksliebling wird man so leicht nichts anhaben können.« Damit wandte er sich von dem Fremden ab, trat mit Jobst im Gefolge hinter dem Schanktisch hervor und gesellte sich zu seinen Stammgästen. Sein Kind, einen zarten Knaben von vielleicht fünf Jahren, setzte er behutsam zu Boden. Ans Bein des Vaters gedrückt blieb es stehen und lauschte begierig auf den Fortgang des Gesprächs. Was für ein Glück hatte dieses Kind, in solchem Haus aufzuwachsen und wie Milch die Worte gelehrter Männer aufzusaugen!
Unter Gemurmel zerstreute sich der Pulk. »Lass uns nachher den Karlstadt hören«, vernahm Markus noch einmal den kampfbereiten Zimmerer. »Der ist ein anderes Kaliber als diese laschen Pfeffersäcke.«
»Alles zum Besten, die Herren?« Cranach klopfte auf ihren Tisch.
»Meint Ihr Luther betreffend oder den Wein?« Eckhard seufzte wie ein nörgelndes Kind. »Luther soll sich nur kein Haar krümmen lassen. Die verrückten Schwärmer brächten es fertig und steckten uns die Stadt in Brand. Ich für meinen Teil erwäge, die Nachricht von seinem Widerruf im Voraus zu verbreiten, damit wieder Ruhe herrscht. Mein Schwager Konrad hat den Nagel aufs Haupt getroffen: Wenn diese Sache ihren Kopf verliert und der Wurm von einem Leib allein loskraucht, wird sie vom Segen zum Fluch.«
Cranach tätschelte dem Freund den fetten Rücken. »Nun, derzeit sieht es ja aus, als bliebe uns derlei erspart. Wie ist es also jetzt um den Wein bestellt? Ein Neuzugang aus meiner Heimat, recht rau, aber voller Würze, unserm Luther somit ähnlich. Ich hoffe, er mundet?«
»Leider hat’s mit dem Munden ein Ende.« Eckhard nahm den leeren Krug beim Henkel und ließ ihn an seinem Zeigefinger schaukeln. »Vorzüglich war das Gesöff, und ich hätte auf den Ärger gern noch ein Maß bestellt, aber ich fürchte, mein Weib kratzt mir die Augen aus.«
»Warum sollte sie?«
Aller Blicke wandten sich Elisabeth zu, die reglos sitzen blieb. Nur ihre Miene verschloss sich, die klaren Züge gemahnten auf einmal an die scharfen ihres Bruders. Sie war im Grunde eine schöne Frau, fand Markus, eine stille Schönheit, die sich entfaltete, je länger man ihr zusah.
»Meiner Els schmeckt’s nicht, dass ich Euren Jungen für einen Schankburschen hielt. Wenn Ihr die Els fragt, ist dieses Knäblein, das sie den Pinsel schwingen lehrt, ein begnadeter Künstler, der Euch demnächst überflügeln wird.«
Cranach breitete einen Arm um den Jungen, in dessen fahle Wangen das Blut schoss. »Der Jobst ist mein Lieblingsschüler. Emsig und begabt.«
»Bei Tag bin ich hier Schankbursche.« Jobst senkte den Kopf und hob ihn gleich wieder, um Eckhards Frau einen Blick zuzuwerfen. »Lasst es gut sein, Frau Elisabeth. Ich danke Euch. Und Euch, mein Herr, bringe ich sofort den Wein.« Lautlos wand er sich aus dem Arm seines Lehrherrn und trollte sich hinter den Schanktisch.
»Bring mir besser gleich die zwei Schläuche«, rief ihm Eckhard hinterdrein. »Nehmt’s mir nicht krumm, Cranach, aber mir ist für heute die Geselligkeit verleidet. Erst Streit mit dem Weib, dann Streit mit dem Mob – ganz Wittenberg verliert den Verstand. Ginge es nach mir, so beeilte sich Luther mit seinem Widerruf und käme ohne Verzug nach Hause. Besser im Verborgenen köcheln, bis die Zeit heranreift, als einen Aufstand von Verblendeten, Eiferern und Juden schüren.«
Jobst, der auf beiden Schultern die Weinschläuche schleppte, blieb stehen. Im selben Atemzug sprang Elisabeth auf. »Was redest du von Juden?« In ihren Augen sah Markus Angst aufblitzen, ihre Lippen zitterten, und dennoch überwand sie sich. »In dieser Stadt gibt es doch gar keine Juden. Aus der Jüdengasse, wo du dir dein Haus hingestellt hast, sind sie wie Vieh hinausgetrieben worden, und würde heute noch einer hier aufgegriffen, so wäre er ein toter Mann.«
Konrad schoss in die Höhe, aber ehe er dazwischenfahren konnte, schob sich Markus neben Elisabeth. »Beruhigt Euch, Els.« In Gesellschaft ihres Mannes wagte er nicht, sie mit dem freundschaftlichen Du anzusprechen. »Dass Ihr für die Juden eintretet, ehrt Euch. Auch Luther tut es ja, er sagt, wir sollen jeden Juden, der die Taufe nimmt, als Bruder willkommen heißen. Aber es ist kein Grund, sich zu ereifern. Ist Euch womöglich nicht wohl?«
»Mir jedenfalls steht’s bis zum Hals.« Eckhard stand auf und riss dem Jobst die Schläuche weg. »Weiber, Pöbel und jetzt auch noch Juden, da wird einem ja der Wein zu Essig. Kommt Ihr, Schwager? Dass Euch an solchen Gesprächen gelegen ist, bezweifle ich.«
Konrad schluckte an einer Erwiderung. Markus’ Hand lag noch immer auf Elisabeths Arm, bis sie sie sacht herunterstrich. Ihr Blick traf den seinen. Als er etwas sagen wollte, schüttelte sie rasch den Kopf. Dann ließ sie sich von ihrem Bruder am Arm packen und folgte ihrem Gatten aus der Schänke.
*
In diesen Tagen wünschte sich Thomas mehr denn je, er müsse das Konventhaus nie verlassen. Zwischen dem Dormitorium, der Kapelle und seiner Zelle im obersten Stockwerk spielte sich das Leben ab, das er ertrug. Das Schwarze Kloster nannte man das Gebäude in der Stadt, nicht um seiner dunklen Mauern, sondern um der schwarzen Kutte willen, die nun auch er selbst als Novize der Augustiner-Eremiten trug. War es zu fassen? Vor kaum mehr als einem Jahr war er als Student in der Grundausbildung an jenen Mauern, die jetzt seine Welt bedeuteten, tagtäglich gedankenlos vorbeigeschlendert. Auch der Ketzer war einst nicht mehr als ein Student gewesen, fiel ihm ein und sein Gesicht wurde heiß. Er nannte Luther, der doch sein Ordensbruder war, in Gedanken nie anders. Der Ketzer hatte die Rechte studiert, ehe etwas ihn bewogen hatte, sich den Schädel scheren zu lassen und die schwarze Kutte anzulegen. Er war dem Orden beigetreten und hatte ihm geraubt, was seit Jahrhunderten Menschen in ihm suchten: Einkehr und Frieden.
Beides hatte auch Thomas sich erhofft, und beides hatte der Ketzer Luther ihm genommen, wie er ihm alles genommen hatte: zuerst die Beständigkeit seiner Welt, dann das Mädchen, das Sinn und Inhalt seines Lebens darstellte, und schließlich auch noch die Zuflucht, in die er sich wie ein verletztes Tier verkrochen hatte, um zu genesen oder zu verrecken.
Natürlich war es Unsinn, Luther den Verlust Lisas zur Last zu legen, Thomas wusste das selbst. Immerhin aber war Lisas Bruder Lutheraner und hatte jenen anderen Lutheraner, den in die Jahre gekommenen Fettwanst, als Bräutigam für seine Schwester herbeigeschleppt. Zum einen, weil der Dicke Geld hatte, das Konrad Priesteritz brauchte, wie er Thomas einst unverblümt entgegengeschleudert hatte. Zum zweiten, weil sie alle unter ihrer ketzerischen Decke steckten und darauf lauerten, die unter Schmerzen erkämpften Grundfesten von Thomas’ Leben zu zerstören.
Luther hatte bereits verhohlen dazu aufgefordert, und jetzt schien er seinem schändlichen Ziel so nah wie nie: Das Kapitel der Wittenberger Augustiner dachte über seine Auflösung nach. Bruder Gabriel, der trotz seines entstellten Gesichts ein mitreißender Leutefänger war, trat so leidenschaftlich dafür ein wie Luther selbst.
Thomas hätte aus Wittenberg, ja aus ganz Kursachsen fortgehen sollen, wie es ihm Glaubensbrüder rieten. Bruder Norbert, sein Novizenmeister, hatte angeboten, ihn in die bayrische Ordensprovinz zu entsenden, wohin der ketzerische Irrsinn nicht vorgedrungen war. Doch Wittenberg war Thomas’ Heimat. Allein der Gedanke an einen Abschied rief eine Flut von Bildern in ihm wach: Lisa am Elbufer, den Rock voller Grasflecken, eine Fußspitze im hurtig fließenden Wasser. Lisa, die ihm durchs Menschenmeer der Langen Straße entgegenstürmte, die Arme ausgebreitet, das Gesicht ein einziges Lachen. Sie hatten einander geliebt, seit sie Kinder waren. Thomas starrte auf die weiß getünchte Wand. Konnte man den Ort, an dem man glücklich gewesen war, verlassen, wenn man keine Aussicht hatte, je wieder glücklich zu sein?
Die Tür schob sich auf. Thomas zuckte zusammen, wiewohl er den Besucher erwartet hatte. Bruder Norbert kam, um ihn abzuholen. In Vertretung des Ketzers Luther hatte er in der Stadtkirche eine Messe zu lesen und wünschte die Begleitung des Novizen. »Bist du bereit, Thomas?«
Nein, wollte er rufen, doch stattdessen nickte er, zwang seinen Blick von der Wand fort und folgte dem anderen wie ein Hund. Erst auf der Stiege entfuhr ihm die Frage: »Warum wünscht Ihr, dass ich mit Euch gehe?«
Der Alte blieb stehen und drehte sich um. »Du vergräbst dich wie ein Zisterzienser, aber dies hier ist ein augustinisches Stadtkloster. Als Novize eines Bettelordens bist du nicht gehalten, ein Leben in Abgeschiedenheit zu führen.« Bruder Norberts Schultern zuckten. »Ich bin ein gebrechlicher Mann. Bei dem Aufruhr, der derzeit in der Stadt herrscht, gehe ich den Weg nicht gern allein. Und da du selbst eines Tages als Prediger in einer Pfarrkirche stehen sollst, bist du bestens geeignet, mich zu begleiten.«
Unwillkürlich schüttelte Thomas den Kopf. Wie üblich scheiterte er an der Vorstellung von sich selbst auf einer Kanzel, von seiner Stimme, die sich erhob und vor Hunderten von Menschen Gott zum Lob sprach.
Wie kann denn ich vor Gott bestehen?
Seine Hände schoben sich unter die Ärmel seiner Kutte, die Nägel bohrten sich in die Haut der Unterarme. Den Anforderungen, die sein Orden an ihn stellte, war er nicht gewachsen und hätte wahrhaftig das menschenferne Leben eines Zisterziensers wählen sollen. Aber er fühlte sich den Augustinern verbunden. Er war ein Knabe von kaum zehn Jahren gewesen, als Kurfürst Friedrich die Augustinermönche in seine Residenz gebeten hatte, damit sie den Lehrkörper für seine neue Universität stellten. Welche Begeisterung hatte damals geherrscht, wie entschlossen war Thomas selbst gewesen, sich aus der dumpfen Enge seines Daseins ans Licht zu kämpfen! Den augustinischen Lehrern hatte er seine Freistelle an der Leucorea zu verdanken. Für ihn gab es keinen anderen Orden, kein anderes Zuhause, denn sein Zuhause war Lisa gewesen.
»Kommst du weiter, Thomas?« Bruder Norbert berührte ihn am Arm. »Unser Dienst in der Stadtkirche ist heute wichtiger denn je. Die Menschen sind verstört und ängstigen sich. Wir sollten sie unsere eigene Angst nicht spüren lassen.«
»Ihr habt Angst?«
»Aber ja.« Der Novizenmeister ging voran und Thomas folgte ihm, in den ersten Stock, in dem die Unterrichtsräume lagen, und dann hinunter ins Erdgeschoss mit dem Refektorium. »Die Gläubigen haben Angst um den Pfarrer ihrer Kirche, und wir haben Angst um unseren Bruder.«
Angst um Luther. Um den Ketzer.
Wie konnte der gottesfürchtige Norbert einen solchen Mann Bruder nennen? Vom Gehorsam hatte der Ordensgeneral Luther bereits vor zwei Jahren entbunden und dennoch lief dieser weiterhin in der Kluft der Augustiner umher und missbrauchte deren Namen. Im Turmzimmer des Klosters, so behauptete er, sei ihm die ketzerische Anwandlung gekommen, die den teuflischen Stein ins Rollen brachte. Beherrschung hatte nie zu Thomas’ Stärken gehört, er platzte laut heraus: »Wollt Ihr, dass der Konvent sich auflöst, wie Luther es uns rät?«
»Was ich will, ist nicht maßgeblich.« Ohne sich noch einmal umzudrehen, stapfte Bruder Norbert durch den Kreuzgang und über den Hof. Sonnenlicht zwängte sich zwischen die Zweige der Linde. »Was Gott will, bestimmt mein Handeln. Und ja, ich halte es durchaus für möglich, dass Bruder Martin recht hat und die mönchische Lebensweise uns Gott nicht länger nahebringt, sondern uns von ihm trennt. Im Gebet müssen wir um diese Frage ringen. Wenn du dich dem nicht gewachsen siehst, gilt mein Angebot, mich für deine Entsendung nach Bayern zu verwenden.«
Sie schoben das schwere Tor auf. Es war längst Frühling geworden, und Thomas hatte nichts davon bemerkt. In der Langen Straße überfielen ihn die Geräusche eines Wochentags, das Sirren und Schwirren, Gewirr von Stimmen und Gerumpel schwerer Räder. Thomas musste innehalten. Der Ansturm sich verwebender Gerüche überwältigte ihn. In die Süße der Aprilluft drängten sich die Würze aus den Türen der Garküchen, der Brodem, den Menschenhaut ausströmt, und die scharfe Säure in der Gasse verrichteter Notdurft. Gerüche des Lebens. Als riefe und griffe es nach ihm und wollte ihn mit seinen Krallenfingern wieder zu sich zerren.
Sie zwängten sich zwischen den Weibern, die schwatzend und Körbe schwenkend dem Markt zustrebten, und dem Gezockel der Gespanne hindurch. Ein wenig Sonne und ein leichter Wind liebkosten den Streifen Haut in Thomas’ Nacken. Ein Gruß von Vergangenem, verspielt und kaum spürbar, und doch entzündete er in Thomas eine Wehmut, die ihm die Brust zusammenpresste. Besaß die Welt je solchen Zauber, wie wenn man sie verloren hatte? Mit dem nächsten Schritt vernahm er das Rufen:
»Wartet! Ich komme mit Euch!«
Inzwischen hatten sie den Abzweig hinauf zum Kirchplatz genommen und überblickten die Freifläche um die Stadtkirche. Vom Markt her kam ihnen eine Gruppe von drei Leuten entgegen, und ein vierter eilte winkend hinterdrein. »Wartet doch, Oheim Eckhard! Ich käme gern auf einen Schluck aus Euren fränkischen Schläuchen mit zu Euch.«
Just vor dem Hauptportal der mächtigen, dreischiffigen Kirche hätten sie aufeinanderprallen müssen. Norbert verharrte, Thomas tat es ihm gleich, und die drei, die der vierte unter Keuchen erreichte, hielten ebenfalls inne. Keine zwei Schritte trennten sie. Auch ohne Nennung von Namen, ja selbst ohne hinzusehen, hätte Thomas jeden einzelnen erkannt.
Konrad Priesteritz. Als Sohn eines Säufers bald so arm wie Thomas als Vollwaise. Durch die Gnade Gottes aus dem Gröbsten heraus und dennoch ein Ketzer, ein Verräter an Gott, verführt durch die Lehren jenes Luther, der jetzt vor Kaiser und Kurie stand. Priesteritz hatte Gott verhöhnt und seine eigene Schwester an einen noch übleren Ketzer verscherbelt.
Eckhard Schramm. Fett wie die fleischgewordene Völlerei, begierig wie die Wollust, erfüllt vom Hochmut der Reichen und im Herzen träge und leer. Gab es einen, der ihm mehr verhasst war als dieser? Thomas wollte Schramm keines Blickes würdigen, aber die Absicht misslang. Noch gründlicher misslang sie ihm bei Schramms Frau.
Elisabeth. Lisa. Nachbarstochter. Gefährtin. Liebste. Wiewohl sie das Haar jetzt züchtig unter der Haube trug, hatte ihr Gesicht noch immer etwas Blondes an sich. Ihre Augen hatten die Farbe von unverdünntem Bier, und um dieser Augen willen hatte Thomas, der kein Bier mochte, damals begonnen, welches zu trinken. Sie war eine so seltsame Mischung, schreckhaft wie ein Fluchttier, und dennoch war etwas in ihr fest und ruhig, etwas, von dem sie selbst nicht wusste, dass sie es besaß. Auch jetzt flackerte ihr Blick vor Furcht, doch ihre Züge regten sich nicht. »Guten Tag, Thomas«, sagte sie. »Gelobt sei Jesus Christus.«
Der vierte im Bunde, der vom Rennen noch immer keuchte, war Markus Reuther, einst Thomas’ Studienkamerad, der Schützling des genialen Melanchthon. Eine Schande, dass solch formidable Köpfe dem wahren Glauben verloren gingen, dass sie der teuflischen Versuchung erlagen wie Fliegen einer Klatsche. »In Ewigkeit Amen«, murmelte Thomas, wollte den Blick zu Boden schlagen, aber vermochte sich nicht zu lösen.
Auch Elisabeth sah ihn unverwandt an. Fragend, wie er fand. Aber welche Antwort wäre er ihr schuldig?
Reuther zog zwar flüchtig die Mütze, kümmerte sich ansonsten aber nicht um die Augustiner, sondern sprach atemlos auf Schramm ein: »Ist es recht, dass ich mich bei Euch einlade, auf einen Wein, auf einen Napf Suppe? Daheim beim Griechlein sitzt heute wieder jeder Hungerleider der Stadt zu Tisch. Ihr kennt ihn doch. Er bringt es nicht übers Herz, einem Bittenden die Tür zu weisen.«
Schwätzer, dachte Thomas. Der Student sprach so laut, dass bereits die ersten Gaffer stehen blieben.
»In jedem Fall ist es undenkbar, an Melanchthons Tisch ein vertrauliches Wort zu wechseln. Und gerade heute will doch ein jeder von uns unter seinesgleichen sein.«
Schramm drosch ihm mit Wucht auf den Rücken. »Schwing keine Volksreden, Neffe. Dass du Schmarotzer mir willkommen bist, weißt du. Ich lasse doch einen armen Studenten, der’s in Ewigkeiten nicht zu vollen Taschen bringen wird, nicht darben.«
Sein Lachen war hässlich, fand Thomas. Er glaubte, auch Elisabeth schaudern zu sehen, aber vermutlich bildete er sich das ein.
»Auf, auf, machen wir, dass wir weiterkommen.« Der Dicke zog Elisabeth am Arm und wollte seine Schar vorantreiben, als stünden Thomas und Norbert nicht dort. Der Novizenmeister sprang erschrocken aus dem Weg. Thomas blieb stehen. Um nichts in der Welt hätte er sich den kleinsten Schritt weit rühren können.
Verblüfft stockte auch Schramm. Wäre der nicht so kurz gewesen, hätten er und Thomas Brust an Brust gestanden. So tippte der Wanst seines Feindes ihm an Körperteile, von denen er, ein Diener Christi, vergessen wollte, dass er sie besaß. Aus jener Tiefe stieg ihm ein Kribbeln in die Kehle, das er allzu gut kannte, eine Todsünde, gegen die er machtlos war. Sein Jähzorn.
»Willst du mir nicht Platz machen, Vischer?«
Thomas hatte seinen Familiennamen mit den weltlichen Kleidern abgelegt. Schramm hatte kein Recht, ihn zu gebrauchen, seine Kutte und die münzgroße Tonsur zu missachten. Er sah nicht länger Lisa, sondern dem Feind in die Augen, die winzig wie Korinthen waren. »Komm zur Seite«, hörte er mit banger Stimme Bruder Norbert murmeln, und Lisa rief seinen Namen, aber er hörte es kaum, weil das Blut in seinen Ohren rauschte. Es gab nur noch ihn und Schramm.
»He, Kerl, bist du taub? Verstopft man euch in eurem Kloster die Lauscher, auf dass einzig päpstliches Gewäsch eindringt? Oder hat dir schon die Metze, die dich geboren hat, das Gehör mit Dreck verschmiert?«
Ehe er nachdenken konnte, hatte Thomas die Faust erhoben. Lisa schrie auf, Bruder Norbert eilte hinzu und krallte sich in den Stoff seines Ärmels. Thomas schüttelte ihn ab. Eine große Stille breitete sich in ihm aus, als seine Faust auf Schramms Schädel niedersauste.
Doch ehe sie traf, noch bevor er den dumpfen Aufprall spürte, umfasste eine Hand sein Gelenk. Hart wie eine Zwinge. Thomas kam zu sich, ließ sich den Arm zur Seite biegen. Schramm taumelte seitwärts und rieb sich die Stirn, als hätte der Schlag ihn getroffen. »Seid Ihr jetzt gänzlich des Teufels?«, rief Konrad Priesteritz, der ihn noch immer schmerzhaft am Gelenk hielt. »Ihr schuldet meinem Schwager Dank, wenn er von Eurer Tätlichkeit nicht Meldung macht.«
»Und ob ich davon Meldung mache!« Schramms Stimme quietschte wie ein empörtes Kind, und Priesteritz gab Thomas’ Gelenk frei.
»Du hast ihn herausgefordert.« Das war Elisabeth. Seine Lisa, der niemand eine Unze Mut zutraute. Ihre Schultern bebten, aber ihr Ton war firm. »Du hast es genauso gewollt, also beklage dich nicht.«
»Sind jetzt schon alle toll?«, bellte Schramm. »Ich sage ja, falls Luther nicht gewitzt genug für einen Widerruf ist und sich den Garaus machen lässt, darf man es in diesem Tollhaus von Stadt keine Seele wissen lassen. Nicht genug, dass Hurensöhne Mönchskutten tragen, hier spielt nachgerade jeder verrückt.«
Thomas’ Blick kreuzte den Elisabeths. Von den Gaffern drängten mehrere heran, fluchten ihm und schüttelten Fäuste. Sogleich würden Hiebe ihn treffen, ins Gesicht, in den Leib, bis er sich am Boden wand. Und dann würde Elisabeth sich abwenden, würden Schramm oder Konrad sie am Handgelenk packen und fortziehen. Die Vorstellung machte ihn rasend, ließ ihn schreien: »Tod Eurem Luther! Ich hoffe, jemand macht in Worms ein Ende mit ihm.«
»Ich bitte für meinen Novizen um Vergebung!« Bruder Norbert presste Thomas die Hand auf den Mund. Seine Stimme zitterte. »Es sind harte Zeiten, niemand weiß, was er sagt.«
»Und das glaubst du, Mönchlein?« An Schramms Stirn schwoll eine Ader zum bläulichen Wurm. »Der da weiß genau, was er gesagt hat, und ich weiß genau, was ich tue: Ich erstatte Meldung, und zwar sofort.«
Zweifellos hätte er das getan, zweifellos hätten unterdessen die Gaffer Thomas lahm geprügelt, hätte nicht eine johlende Schar, die vom Markt herübergerannt kam, sie abgelenkt. Vorn lief ein Alter, der eine Heugabel schwang. Dahinter erkannte Thomas des Fischhändlers Käthe. »Den Büttel, den Büttel!«, schrie die so markerschütternd, wie sie sonst ihren Dorsch anpries, »droben am Bauplatz ist eine Mordtat geschehen!«
»Den Toten haben sie in die Grube geworfen!« Der Schweine-Bert, der eine hoppelnde Sau am Strick führte, blieb schnaufend stehen. Die Übrigen taten es ihm gleich und bekreuzigten sich.
»Wen hat’s denn erwischt?«
»Wo steckt nur die Marktaufsicht, weiß man schon, wer’s getan hat?«
»Der Zimmerer Peter«, rief der Schweine-Bert triumphierend. »Mit seiner Horde ist der auf einen von den Burschen aus dem Bayrischen los.«
»Einen Hammer hat er ihm auf den Schädel gedroschen, bis der arme Kerl verreckt ist.«
»Meiner Treu, was hat dem Zimmerer denn solch ein Bayer getan?«