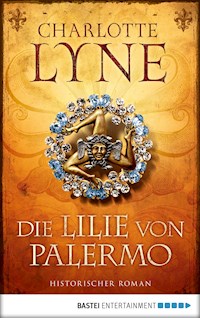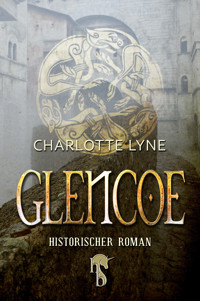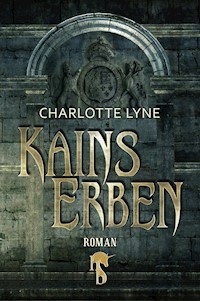6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cölln-Berlin, die aufstrebende Doppelstadt, im Jahr 1325. Die Waise Magda Harzer, ihre 3 Brüder und der Großvater wollen sich hier eine neue Existenz aufbauen. Ungeklärte Schicksalsschläge haben die Bierbrauerfamilie aus Bernau vertrieben. Magda kämpft trotz großer Anfangsschwierigkeiten um den Zusammenhalt der Familie. Ihre Brüder bringen sich und sie immer wieder in Schwierigkeiten, aber Magda hält unermüdlich zu ihnen und sorgt mit Ideenreichtum und bodenständiger Tatkraft für den Unterhalt. Nur dem zukünftigen Franziskanermönch Thomas kann sie ihre eigenen Sorgen und Ängste anvertrauen. Als Propst Nikolaus in einer Predigt den Zorn der Berliner Bevölkerung provoziert, muss Magda ihre ganze Kraft einsetzen, um einen ihrer Brüder davor zu bewahren, als Sündenbock geopfert zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charlotte Lyne
Das Mädchen aus Bernau
Historischer Roman
In Liebe
Für meine Stadt
„Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner.“
Theodor Fontane
Erster Teil
Bernau, Brandenburg1319–1324„Ein fruchtbares Gelände für sumpfige Typen –schon seit siebenhundertfünfzig Jahren.“Wolfgang Neuss
1
Die Nacht, in der Magda sich vor sich selbst zu fürchten begann, zog düster herauf und folgte einem Tag voll Unfrieden. Bis zu jener schwarzen Nacht zu Michaelis hatte Magda bereits jahrelang mit ihrer Eigenheit gelebt, ohne jemanden in Schrecken zu versetzen oder auch nur für Verblüffung zu sorgen.
Als sie vor dem Morgengrauen aus einem qualvollen Schlaf schreckte, war sie in eisigen Schweiß gebadet und die Decke wärmte sie nicht, so fest sie sie auch um sich schlang. Ihr Herz raste vor Entsetzen. Endlich zwang sie sich, die Reste der bodenständigen Vernunft, die ihr als Brandenburgerin im Blut lag, zusammenzuklauben und sich aufzusetzen. Statt weiter unter der durchnässten Decke zu zittern, stieß sie sie von sich und legte sich ihr Schultertuch um.
Erinnere dich, befahl sie sich. Es war nur ein dummer Traum, wie es die vielen Male zuvor nur ein Traum war. Es ist unmöglich, in die Zukunft zu schauen, allein Gott kann das, kein törichtes Mädchen aus Bernau. Mühsam, umwallt von Nebeln des Schlafes, versuchte sie die Nächte heraufzubeschwören, in denen der Traum sie gequält hatte. Mit aller Kraft klammerte sie sich an die Hoffnung: Wenn sie feststellte, dass nicht jedes Mal am Tag darauf das eine, das Entsetzliche geschehen war, dann hatte sie den Beweis, dass dieser Traum keine Prophezeiung war. Dann war sie gerettet und ihr Leben, wie sie es kannte, wäre nicht auf alle Zeit zerstört.
Als die Träume sie zum ersten Mal heimsuchten, war sie mit ihren dreizehn Jahren noch beinahe ein Kind gewesen und ihr Vater hatte noch gelebt. Er war ein Abenteurer, einer von denen, die um ihr Leben spielten wie andere an den Würfel- und Kartentischen auf dem Markt um Pfennige. Ein Getriebener war er, der mit seinem Bündel den Weg hinunterzog, ein Lächeln aufsetzte und winkte, aber auf die Frage „Wann kommst du wieder?“ keine Antwort wusste.
In den ehrbaren Bierbrauerhaushalt war er nicht geboren worden, und recht eingefügt hatte er sich nie. Statt den Brauprozess zu überwachen, wie es die Zunft ihm gebot, verlegte er sich aufs Reisen. Kaum war er angekommen, brach er schon wieder auf. Die ständigen Fahrten galten angeblich dem Verkauf des Bieres, den er nicht angestammten Händlern überlassen mochte. Schließlich verscherbelten die Bremer wie die Bayern ihr Gebrautes bereits bis nach Flandern, und musste das Bier aus Brandenburg sich etwa dahinter verstecken?
Mitnichten musste es das! Gerade das Bier der Bernauer, das würzigste und haltbarste der ganzen Mark, konnte jedem Gerstensaft im Reich das Wasser reichen. Weshalb sollte Magdas Vater also nicht reisen, um in der Fremde neue Liebhaber für jenen goldenen Tropfen zu gewinnen, dem Albrecht, der erste Markgraf Brandenburgs, eine Stadt gewidmet hatte? Und dass Reisen gefährlich war, wusste jedes Kind. Als Magda darum eines Morgens der Barbara, des Großvaters lediger Schwester, erzählte, sie habe geträumt, der Vater habe sich durch die niedrige Tür in ihre Kammer gezwängt und gesagt, er wolle von ihr Abschied nehmen, wunderte die sich kein bisschen.
„Ein Segen, dass er wenigstens im Traum Manieren zeigt wie ein Christenmensch“, erwiderte sie und schickte Magda mit einem liebevollen Klaps an den Kessel mit der Maische zurück. „Viel auf Träume zu geben, ist verlorene Liebesmüh, mein Kälbchen. Man träumt wohl manchmal, was man sich klammheimlich wünscht, aber das heißt noch lange nicht, dass man es bekommt.“
Es war das erste und zugleich das letzte Mal, dass Magda mit einem Mitglied ihrer Familie über ihre Träume sprach.
Noch vor dem Abend wurde die Leiche des Vaters gefunden, am Weg, der vom Waldrand durch das Moor bis vor Bernaus Stadttor führte und den er immer heraufgekommen war. Raubritter hatten ihn überfallen und ihm die Kehle der Länge nach durchschnitten – und das nur des Fuhrwerks wegen und ein paar Proben Bier. Solche Verbrechen geschahen häufig, seit Markgraf Waldemar im Sommer gestorben war und seine Mark in Aufruhr und Verwirrung zurückgelassen hatte. Viele behaupteten auch, der Ritterstand sei schon viel länger verkommen und verwahrlost, nämlich seit es im Reich keinen Kaiser mehr gab.
„Als Gott von der Erde gegangen ist“, pflegte der Großvater zu schimpfen, „hat er zwei Schwerter drin stecken lassen, damit Recht und Ordnung herrschen. Das eine ist der Kaiser und das andere der Papst, und wenn das eine fehlt oder das eine mit dem andern wie ein Marktweib Gezänk anfängt, dann klafft ein Loch, und Recht und Ordnung sind beim Teufel.“
Magda verstand von alledem wenig, aber eines wusste sie: So hart und kalt der grausame Tod des Vaters ihr eigenes Leben auch treffen mochte, verwunderlich war er nicht. Ihr Traum war keine Prophezeiung, sondern nur ein Zufall, wie es Hunderte gab.
Der Großvater trauerte mehr dem Fuhrwerk nach als dem Schwiegersohn. „Du, brich dir nicht dein Herzchen“, sagte er zu Magda. „Ein Vater, wie ein Vater sein soll, war der ja für euch beileibe nicht, nicht.“
Es war Diether, der jüngste unter Magdas drei Brüdern, der den Vater in seinem Blut gefunden hatte. Seither schien er nicht mehr er selbst, und er war es auch, der jetzt Trost und Beistand brauchte. Magda hingegen hatte auf ihren zwei Füßen schon immer fest auf dem Boden gestanden, verwurzelt wie ein Holunderstrauch in roter Brandenburger Erde. Wenn überhaupt etwas an dem Traum sie verstörte, dann war es eine Einzelheit, die sie Barbara verschwiegen hatte:
Sie hatte im Schlaf ihre Mutter gesehen, obwohl sie die gar nicht kannte, weil sie an den Strapazen von Magdas Geburt gestorben war. Sie, die unbekannte Mutter, hatte im Traum den Vater in ihre Kammer geschoben. Ihr Gesicht war ein weißer Flecken ohne Züge und Konturen, und sie hatte kein Wort gesprochen. Woran Magda erkannt hatte, dass die Frau ihre Mutter war, wusste sie nicht. Mit der Zeit verdrängte das Leben den Tod, und sie dachte nicht länger an den Traum.
Zwei Jahre verstrichen, ohne dass Magda noch einmal von einem Menschen träumte, der sich des Nachts, an der Hand ihrer Mutter, in ihre Kammer schlich. Dann aber träumte sie in einer Frühsommernacht von Barbara. Die Tür des winzigen Raumes, den sie mit niemandem teilte, weil es in der Familie keine weitere Tochter gab, schob sich mit einem Knarren auf und der weiße Flecken zeigte sich, das Gesicht der nie gekannten Mutter. Aus der Nachthaube quoll dichtes, unbändiges Haar wie bei Magda, nur dass es bei der Mutter in einem zarten Blondton schimmerte, während ihr eigenes struppig und rotbraun wie Rosshaar war.
Sogleich zog die Mutter sich zurück und schob Barbara ins Zimmer, die Großtante, die sich um die vier Halbwaisen gekümmert, Honigkuchen und Maulschellen verteilt, Rotz, Blut und Tränen abgewischt hatte, seit Magda auf der Welt war. „Ich möcht Lebewohl sagen“, sagte Barbara, die sonst nie so förmlich sprach, und dann nickte sie ein wenig mit dem Kopf, wie um sich zu verneigen, trat zurück und verschwand in der Dunkelheit.
Von diesem Traum erzählte Magda am Morgen den anderen kein Wort. Es war ein fröhlicher Morgen, an dem der Stadtknecht mit gewichtigen Schritten durch die Gassen stolzierte, die weithin hallende Bürgerglocke schwang und aus der Tiefe seiner Kehle brüllte: „Bürger von Bernau, Bürger von Bernau! Morgen ist Brautag, von Stund an wird nicht mehr in die Panke gepinkelt, und wer’s trotzdem tut, der ist nicht besser als ein Schwein und entgeht seiner Strafe nicht!“
Lentz, Magdas ältester Bruder, und Diether stießen einander die Ellbogen in die Seiten und tauschten ein Grinsen. Brautage waren immer heitere Tage, auch wenn die Männer schwitzten und ächzten, während sie die schweren Fässer mit dem sprudelnden Pankewasser füllten und auf ihre Karren luden. Vom Fluss hinauf bis in jeden Winkel der Gassen tönte das röhrende Gelächter der Brauer. Dabei war Lentz sonst ein gemächlicher Bürger, aber an Brautagen fiel alle Zurückhaltung von ihm ab und er gebärdete sich rau und ausgelassen wie seine Gefährten. Selbst Utz, der Zweitälteste, der Wert auf gesittetes, städtisches Betragen legte, ließ sich ein wenig gehen. Vermutlich war es die Erleichterung darüber, dass das Brauen wiederum gestattet worden war, die diese Ausgelassenheit in den Brüdern entfesselte. Dazu kam der sonderbare Zauber, der seine Wirkung nur entfaltet, wenn Männer ohne Frauen unter sich sind.
Auch Endres, der Lehrling, ging mit ihnen. Lentz und Utz gegenüber legte er jedoch dieselbe Scheu an den Tag wie sonst, und laut gelacht hätte er nie. Sein Leben hatte ihn still gemacht. Magda sandte ihm ein rasches Lächeln, als er seinen Napf beiseiteschob und sein Bündel vom Tisch hob, um mit ihren Brüdern die Fässer aufzuladen. Sie war inzwischen fünfzehn, in einem Alter, in dem die meisten Mädchen jemandem versprochen waren, und dass sie Endres versprochen war, schien ihr so sicher wie das Wort der Bibel, das Propst Nikolaus mit sich überschlagender Stimme in der Marienkirche am Markt verlas. Magda verstand kein Latein, doch um die Wahrheit des verlesenen Wortes zu spüren, brauchte sie nichts zu verstehen. Genauso verhielt es sich mit Endres und ihr: Sie gehörten zusammen, das spürte sie, ohne dass je Verständliches dazu gesprochen worden war.
Endres war Großvaters Patensohn, der Enkel seines engsten Freundes. Jener war Kannengießer gewesen, bis sein Haus aus Fachwerk an einem glutheißen Sommertag Feuer fing und restlos niederbrannte. Der Kannengießer, sein Sohn und die Schwiegertochter verloren in den Flammen ihr Leben, der einzige Enkel aber kam mit dem Todesschrecken davon. Schwarz vom Ruß und auf allen vieren hatte er sich in die Braugasse geschleppt und an ihre Tür geklopft. Magdas Vater hatte angeboten, ihn aufs Kloster nach Chorin zu bringen, wo sich die frommen Brüder um Waisenkinder kümmerten, aber der Großvater war ihm über den Mund gefahren: „Das arme Wurm ist mein Patensohn, das kommt mir zu keinem Klosterbruder nicht“, bestimmte er. „Unter meinem Dach bleibt’s. Wo wir vier nicht verhungern, wird auch ein fünftes satt, satt.“
Der Großvater hasste sämtliche Klosterbrüder, ob sie nun Zisterzienser aus Zinna, Chorin und Lehnin oder Franziskaner aus dem Grauen Kloster in Berlin waren. Dieser Hass, den Utz von ihm geerbt hatte, rührte daher, dass die Klöster keinen Bierpfennig entrichten mussten und ihr Bier daher billiger verkaufen konnten als die städtischen Brauer. Auch vom Brauverbot, das drohte, wenn nach Unwettern und Missernten das Getreide knapp war, blieben die Klöster ausgenommen, was den Großvater erst recht erzürnte.
„Unsereins bringen die um Lohn und Brot“, schimpfte er. „Dabei sollen die doch wohl von Gottes Gnaden leben wie Vögel auf dem Feld! Mir jedenfalls bleiben die vom Leib, und den Endres kriegen sie im Leben nicht. Der kann bei mir das Brauerhandwerk erlernen, solider und herzhafter als bei den panschenden Kuttenträgern, Kuttenträgern!“
Da im Haus der Großvater, nicht der Vater, das Sagen hatte, war es so gekommen. Mittlerweile war Endres achtzehn Jahre alt und hatte acht davon unter ihrem Dach, hinter dem sechszackigen Stern der Bierbrauer verbracht. Der Großvater pflegte zu sagen, von den vier Jungen, die unter seiner Obhut heranwuchsen, sei allein der Endres zum Brauer geboren, und er sagte es besonders gern, wenn Utz oder Diether es hörten.
Endres hatte keinen Besitz auf der Welt. Das Grundstück, das er von seinen Eltern hätte erben sollen, zog ein Gläubiger ein, und sonst war nach dem Brand nichts geblieben. Aber er besaß seinen Fleiß und den festen Willen, dem Großvater die erwiesene Wohltat zu vergelten. Neben der Arbeit im Brauhaus setzte er sich, so oft es seine Zeit erlaubte, ans Schreibpult, um sich ins Gebiet der Buchführung einzufinden. Der Großvater hatte darauf nie Zeit verwendet, aber neuerdings entdeckten immer mehr Handwerker, dass solche Kenntnisse von Nutzen waren. Utz verfügte längst darüber, und Endres setzte alles daran, sie sich anzueignen.
Er war schlank, beinahe zierlich, hatte weiche, rehbraune Locken, und der Blick seiner Augen berührte Magda tiefer als gedrechseltes Geplapper. Jetzt blieb er stehen und erwiderte ihr Lächeln. Die Zeit hielt inne, doch gleich darauf galoppierte sie schon wieder voran. „He, Endres, willst du Wurzeln schlagen?“, rief Diether. „Wenn du hier weiter bummelst wie ein Mädchen, ist die Panke leer geschöpft, bevor wir kommen.“
Hastig schwang Endres herum und folgte Diether aus dem Haus. Gleich darauf hallte Gelächter durch die taufrische Luft des Morgens. Unter ihren Brüdern war Diether Magda der liebste, doch in diesem Augenblick hätte sie ihn zum Teufel schicken wollen. Gewiss, Endres war sein Freund, er stand ihm näher als Lentz und Utz, von denen er sich gemaßregelt fühlte, aber konnte er deshalb seiner Schwester nicht den allerkleinsten Augenblick mit ihm allein gönnen?
Aufseufzend machte sie sich daran, den Tisch, an dem sie ihre Hirsegrütze gegessen und Dünnbier getrunken hatten, abzuräumen. Die hölzernen Näpfe und Krüge trug sie Barbara hin, die über der gemauerten Feuerstelle im Kessel rührte und sie später auswaschen würde. „Na, mein Kälbchen?“, fragte die Großtante und wandte sich ihr zu. „Was bedrückt dich denn?“
„Nichts“, erwiderte Magda, auch wenn ihr auf einmal beklommen zumute war, weil sie glaubte, Barbaras Stimme zu hören, wie sie ihr im Traum Lebewohl wünschte. „Kochst du Milchsuppe? Mit Backpflaumen?“ Sie streckte die Hand aus, um eine der Früchte zu stibitzen und über der Süße dumme Sorgen zu vergessen. Ehe sie sich’s versah, klatschte Barbaras Hand auf ihre. „Genascht wird nicht.“ Drohend hob sie den Kochlöffel und verbiss sich ein Schmunzeln. „Wenn ich dich Gierschlund an meinen Topf lasse, habe ich nachher deinen Brüdern nur heiße Luft aufzutischen.“
Gespielt beleidigt trollte sich Magda, und Barbara setzte sich mit einem Kanten Brot und einem Krug Bier zu Tisch, um selbst zu frühstücken. Tagein, tagaus versorgte sie die Familie, die Hühner und die Ziegen, kochte für den Abend und half beim Mälzen und Maischen, doch diese kleine Weile mit ihrem Brot am Tisch, die gönnte sie sich, einerlei, welche Stürme um sie tosten.
Magda ging, um Grut zu sammeln, die Kräuter, die sie zum Würzen des Bieres brauchen würden. Die meisten Brauer setzten dem Getränk nur noch Hopfen zu, der es haltbar machte und ihm eine kräftige, bittere Note verlieh, doch ihr Großvater schwor auf das alte Rezept, nach dem seine Familie seit Jahrhunderten braute. Damals hatte noch der Landesherr das Grutrecht verliehen, das kostbare Privileg, die Kräuter sammeln und damit Bier brauen zu dürfen. Auch wenn der Hopfen die Würze im Grunde überflüssig machte, war der Großvater stolz auf dieses Recht und bestand darauf, es zu nutzen.
Die Gagelsträucher mit ihren schillernden, aromatisch duftenden Blättern hatte der Ahnherr des Großvaters vor hundertfünfzig Jahren auf dem Karren mitgebracht, als er dem Ruf des Markgrafen Otto I. gefolgt und aus dem Harz in die Mark Brandenburg gezogen war. In dem harschen, sandigen Boden der Mark verkümmerten die empfindlichen Pflänzchen, doch Großvaters Ahnherr war ein Sturschädel, wie Großvater selbst, und nicht bereit, aufzugeben. Mit unermüdlicher Pflege gelang es ihm schließlich, die Sträucher in der fremden roten Erde heimisch zu machen, und die herbe Bittersüße ihrer Blätter war das Geheimnis des Bieres, das seine Familie noch immer unverändert braute. So wie sie noch immer die Harzer genannt wurden, selbst wenn sie bald so lange hier lebten, wie das Städtchen Bernau zwischen sumpfigen Wäldern und buckligen Moränenhügeln stand.
Magda pflückte Blätter von den Zweigen, bis ihr Beutel voll war, und lauschte dabei auf das übermütige Johlen, das vom Fluss heraufdrang. Dann kehrte sie ins Haus zurück, um ihre Ausbeute bei Barbara abzuliefern. Die saß noch immer bei Tisch über Bier und Brot. Das kam sonst nie vor. Mehr als ein paar Augenblicke ließ sie sich für ihr Frühstück nie Zeit. Im Näherkommen sah Magda, dass sie im Sitzen eingeschlafen war, den Kopf in den Armen geborgen. Mit dem Ellbogen hatte sie den Krug umgestoßen, sodass sich eine dünne, bierduftende Lache über den Tisch ergoss. Auch das kam nie vor. Barbara war streng mit sich, schlief wenig und hasste Verschwendung. Sie würde zornig auf sich sein.
„Großtante Barbara!“, rief Magda, um sie zu wecken. „Ich bringe die Grut für die Würzepfanne!“
Barbara rührte sich nicht. Magda trat hinter sie und berührte ihre Schulter, packte, wie es ihre Art war, fest zu, um sie wachzurütteln, ließ aber gleich wieder los und zog die Hand zu sich. Ein Schrei lag ihr auf den Lippen, doch Entsetzen schnürte ihr die Kehle zu. Später wusste sie nicht zu sagen, woran sie gemerkt hatte, dass Barbara nicht mehr lebte. Sie war weder kalt noch steif, aber Magda erkannte es in dem Augenblick, in dem ihre Hand die vertraute Schulter umspannte: Barbara war tot. Die sorglose Heiterkeit des Brautags war verflogen. Von nun an waren Magda, Endres und ihre Brüder mit dem Großvater allein.
Vielleicht hätte Magda in jenem Moment des Schreckens an ihren Traum denken und den Zusammenhang erkennen sollen, aber sie tat es nicht. Barbara war alt gewesen, und alte Menschen starben. Dass sie – die kleine Magda Harzer aus Bernau – Träume hatte, die vom Tod kündeten, begriff sie erst Jahre später, in jener kalten Nacht zu Michaelis, die ihr Leben wie eine eisenblanke Sichel in zwei Hälften schnitt.
2
Der Großvater litt zum Gotterbarmen unter dem Tod seiner Schwester. Barbara hatte ihm zur Seite gestanden, als ihm erst seine Frau und dann seine einzige Tochter gestorben waren, doch jetzt stand ihm niemand zur Seite, und er war für den Rest seines Lebens allein. Magda sah, wie er sich mühte, seinen Schmerz vor ihnen zu verbergen. Als sei nichts geschehen, tat er von früh bis spät seine Arbeit und brummte dabei wie eh und je vor sich hin. „Du bist es jetzt, die sich um uns kümmern muss“, sagte er zu Magda. „Ist ja sonst nur noch Mannsvolk im Haus, das keinen Teller Grütze kochen kann, kann.“
Magda versprach es und war fest entschlossen. Weil der Großvater nicht weinte, wollte auch sie nicht weinen, sondern voll Tatkraft im Haus das Ruder führen, wie Barbara es all die Jahre hindurch getan hatte. Aber Magda war erst fünfzehn, und Barbara hatte sie mit ihrer Fürsorge verwöhnt. Mit dem großen Haushalt war sie heillos überfordert, und der Sturm der Traurigkeit, den sie nicht aus sich herausweinen durfte, ballte sich in ihr, als staue man die Frühlingsflut der Panke hinter Dämmen.
Von den Brüdern merkte niemand, wie ihr zumute war, und auch Endres schien nichts mitzubekommen, doch dem Großvater entging es nicht. Stillschweigend nahm er ihr die Pflichten in der Küche wieder ab und versah sie selbst. Von nun an schmeckte die Milchsuppe zumeist verbrannt und Kraut und Fisch versalzen, aber er sorgte für sie, und es erging ihnen wohl, wie es ihnen immer wohlergangen war. Sie litten keinen Hunger, und sie litten erst recht keinen Mangel an Liebe. Ihr Haus war warm. Am Sonntag, in der Marienkirche, dankte Magda Gott dafür, dass er ihnen den Großvater geschenkt hatte. „Ich bitt dich, Allmächtiger Vater, lass ihn noch lange, lange, lange bei uns bleiben – so lange, wie die Panke Tropfen hat und das Moor ringsum im Frühling kleine Nattern, amen.“
Wenn der Großvater eines Tages nicht mehr da war oder wenn ihn die Kräfte verließen – wer würde ihr dann helfen, ihre Brüder zu hüten?
Nach der Messe ging sie ins Brauhaus, wo der Großvater Maische für ein deftiges Weizenbier anmischte, und schloss ihm von hinten die Arme um den Leib. „Danke, Großvater“, sagte sie. „Danke, dass du für uns kochst, weil ich es doch nicht zustande bringe, und danke, dass du auf uns achtgibst und unsere Kleider zur Lene zum Flicken bringst. Denk nur ja nicht, ich wüsste davon nichts, denn ich weiß jedes bisschen! Aber das eine, Großvater, das brauchst du nicht für uns zu tun.“
„Und was soll das sein?“
„Den strammen Maxen markieren.“
„Den was, was, was?“
„Den starken Mann, der sich das Weinen verdrückt, als hätte er Barbara nicht lieb gehabt.“ Sie hatte kaum ausgesprochen, als ihre Tränen zu strömen begannen. Sie hielt sie nicht auf. Auf einmal kam es ihr falsch vor, dass sie so viele Tage lang um ihre Tante nicht geweint hatte.
Der Großvater drehte sich um und nahm sie in die Arme. „Ach herrje, du rotzfreches Kälbchen“, brummte er, „was für ein Segen bist du denn?“
„Es wird schon werden, Großvater“, sagte Magda und schmiegte sich an die weich geschabte Lederschürze des Alten, die nach Grut und Hopfen roch.
„Ist bisher doch auch geworden, was?“ Unter seinem dichten Bartgestrüpp verkroch sich Großvaters Lächeln. „Hab ja meiner armen Sanne versprochen, dass ich euch großkrieg, als aufrechte Brandenburger, und mein Versprechen halt ich, da komme, was wolle. Wünschte nur, du wärst ein paar Jahre älter, damit du auf deine Brüder achtgeben könntest. Auf den Utz wie auf den Diether, denen fehlt ja die harte Hand des Vaters genauso wie die hätschelnde der Mutter. Deshalb sind sie wie junge Hunde und völlig außer Rand und Band. Nur der Lentz, der ist gut geraten. Ja, ja, auf den Lentz kann unsereins stolz sein, der macht mir keine Sorgen, Sorgen.“
Utz, so fand Magda, war auch gut geraten. Er war der gelehrteste unter ihren Brüdern, war nach Chorin zum Unterricht gegangen, obwohl er die Klosterbrüder verabscheute, und bestand darauf, auch seine Geschwister Lesen und Schreiben zu lehren. „Wer dumm bleibt, bleibt arm“, hatte er ihnen erklärt. „Heutzutage, in unseren freien Städten, kann ein Bürgerlicher so viel werden wie ein Adelsmann, wenn er auf Bildung setzt und sich von seinem Weg nicht abbringen lässt.“
Einen so klugen und gebildeten jungen Mann konnte man doch wohl kaum als missraten und noch viel weniger als jungen Hund bezeichnen?
Was dagegen Diether betraf, so mochte der Großvater nicht ganz unrecht haben. Der jüngste der drei war im Grunde der liebenswerteste Bursche, der in Bernau herumlief, und mit seinem sonnigen Wesen, seinem Feuer und seiner Lebenslust gewann er Menschen in Scharen für sich. Ihr selbst hatte er die Kinderzeit zuweilen in eine Zauberwelt voller Farben und Träume verwandelt. Er vermochte aus dem Rohr des Schilfs Flöten zu schnitzen und darauf die Lieder der Vögel und des plätschernden Baches nachzuspielen und er sprudelte über vor Geschichten, denen sie in eisigen Nächten atemlos lauschte.
Zu ihrem Leidwesen gehörte zu dieser hellen, sprühenden Wesensart jedoch eine zweite, eine finstere Seite: Diether hatte etwas von einem Tunichtgut, einem Draufgänger, der über die Stränge schlagen musste, um nicht vor Langeweile zu vergehen. Seit dem Tag, an dem Diether den Vater mit aufgeschlitztem Hals im Moor gefunden hatte, waren die Kräfte in ihm aus dem Gleichgewicht geraten. Jäh sah sie ihn vor sich, wie er an jenem Morgen vor dem Haus gestanden hatte, das Hemd vom Saum bis zum Hals mit Blut verschmiert, Mund und Augen aufgerissen, nicht fähig, einen menschlichen Laut herauszubringen.
Seither gewann das Dunkle, das Gefahrvolle in ihm immer häufiger die Oberhand. Nicht nur sich selbst brachte er damit in Schwierigkeiten. Magda und Endres hatten ihm heimlich schon aus so mancher Klemme geholfen, damit die verdiente Strafe ihm erspart blieb. Aber Diether war schließlich erst achtzehn – mitten in der Gärung, wie das junge Bier! Mit den Jahren und mit einem Freund wie Endres als Vorbild würde er die Reife, die ihm fehlte, gewiss noch erringen.
Magda umarmte den Großvater noch fester und beschloss, ihm bei der Erfüllung seines Versprechens nach Kräften zu helfen, auch wenn sie ihn nichts davon spüren lassen durfte.
„Und um deine Mitgift, Kälbchen, da mach dir mal keinen Kopf“, fuhr der Großvater jetzt wieder voll Zuversicht fort. „Für die ist bestens gesorgt. Nicht nur deine Würzepfanne bekommst du, wie von alters her eine jede Tochter der Harzers, sondern jeglichen Hausrat und Geld obendrein. Seit Jahren hab ich das alles erspart und in meiner Truhe verschlossen, und an diese Truhe kommt mir keiner. Der verdammte Propst Nikolaus nicht, und wenn er tausendmal schreit, wir führen alle zur Hölle, weil wir der Kirche nicht genug in den Rachen werfen. Und der Utz, der mir in den Ohren liegt, wir müssten unbedingt Handel treiben, erst recht nicht. Die Truhe bleibt verschlossen, bis mein Kälbchen seinen Hirschen findet, so wahr ich Seyfrid, der Harzer, heiße, heiße.“
Die Angewohnheit des Großvaters, am Ende einer Rede oder eines Gesprächs ein Wort zweimal oder gar dreimal zu sagen, war nützlich, denn so wusste Magda stets, wann er fertig war. Um ihre Mitgift hatte sie sich in Wahrheit nie gesorgt. Endres schließlich würde sie nicht um ihres Besitzes willen nehmen, sondern weil Gott sie füreinander bestimmt hatte, seit dem Tag ihrer Geburt. Dennoch dankte sie dem Großvater und warf sich ihm noch einmal in die Arme. Über den Traum, den sie in der Nacht vor Barbaras Tod gehabt hatte, sprach sie weder mit ihm noch mit einem von den anderen, und mit der Zeit vergaß sie ihn.
In den nächsten Monaten geschah ohnehin so viel, dass für Träume kein Platz blieb. Die Ernte im folgenden Sommer ersoff in Strömen, die sich aus dem Himmel ergossen, und in Fluten, die über die Ufer der Panke quollen. Eine solche endlose Kette von Unwettern hatten selbst die Ältesten unter den Bernauern nie zuvor gesehen, und Propst Nikolaus wetterte in der Marienkirche von der Strafe Gottes, die über die Brandenburger gekommen war, weil sie der Kirche zu wenig Spenden entrichteten und weil ihr Landesherr es wagte, sich gegen den Heiligen Vater aufzulehnen.
„Himmelschreiender Unsinn“, lästerte der Großvater. „Das Wetter tut, was es will, so ist es immer gewesen, und der verdammte Pfaffe soll aufpassen, dass Gott keinen Hagelstein schickt und ihm sein unsägliches Schwatzmaul stopft, stopft.“
Im Herbst aber wurde das Gemunkel von der Strafe Gottes lauter, denn es geschah, was die Zunft der Brauer seit Langem befürchtet hatte: König Ludwig in Bayern sprach für seinen minderjährigen Sohn, den er mit der Mark Brandenburg belehnt hatte, ein Brauverbot aus. Nach der Missernte sei das Getreide knapp, hieß es in der Erklärung, die auf dem Markt verlesen wurde, es müsse gespart werden, um das Volk zu nähren, und Bier gebe es derzeit nur noch von den Klöstern zu kaufen.
„Und wovon sollen wir jetzt leben?“, wetterte der Großvater und raufte sich das schlohweiße Gestrüpp von Haar. „Bei Gott, dem Allmächtigen, unter Markgraf Waldemar hätte es so was nicht gegeben – nie und nimmer hätte ein Askanier seine Bierbrauer hungern lassen, nie und nimmer, nimmer, nimmer!“
Am Sonntag in der Messe predigte Propst Nikolaus wie gewöhnlich darüber, dass der Kirchenzehnt, den die Bernauer entrichteten, beileibe nicht genüge, um ihre Schuld vor Gott zu begleichen, und dass Spenden in Fülle vonnöten seien, wenn sie der Strafe, die sie ereilt hatte, entgehen wollten. „Zur Hölle fahrt ihr, ihr verblendeten Sünder!“, schrie und geiferte er, bis seine Stimme sich überschlug. Der größte der Sünder, ja geradezu der Satan in Menschengestalt, war in seinen Augen König Ludwig, der sich Papst Johannes widersetzte und mit Krieg und Not überrollt werden würde, um für seine Taten zu büßen. „Und ihr alle, die ihr es mit ihm haltet, büßt mit ihm!“, keifte er und wies mit dem Finger bald auf diesen, bald auf jenen, als wisse er von jedem, ob er es mit dem König oder dem Papst hielt.
Diether amüsierte sich köstlich und ahmte mit allerlei Faxen das tiefrote, verzerrte Gesicht des Gottesmannes nach. Utz’ Gesicht hingegen wurde mit jedem Wort düsterer und verschlossener, und der Großvater rief plötzlich, mitten ins Wutgebrüll des Propstes hinein: „Mir reicht’s! Die Familie Harzer lässt sich diesen Kohl nicht länger bieten, bieten!“ Damit packte er Magda beim Arm und zog sie mit sich aus der Kirche. Ein Blick über die Schulter verriet ihr, dass Lentz, Utz und Diether folgten.
Eine Handvoll weiterer Handwerksmeister schloss sich an, doch die meisten wagten nicht, gegen den mächtigen Propst aufzubegehren, denn der verkündete schließlich Gottes Gesetz. Den Großvater aber scherte das nicht, er machte die Dinge mit Gott allein aus und hatte das immer getan. „Die verdammten Kuttenträger ziehen uns das letzte Hemd vom Buckel“, wetterte er, von den Übrigen umringt. „Und wofür? Damit dieser Papst in seinem Avignon Geld hat, um sich mit dem König, der kein Kaiser ist, zu zanken. Und den König, der in Bayern sitzt, kratzt auch nichts anderes als der verdammte Zank. Das Brauen verbietet er uns, wohl, damit wir dem Papst nichts mehr in den Beutel werfen können. Beim heiligen Florian, was aus uns noch werden soll, wo kein Waldemar mehr über uns die Hand hält, das weiß der Himmel oder weiß es nicht, nicht, nicht.“
Der heilige Florian war der Schutzherr der Bierbrauer, und den rief der Großvater nur an, wenn er es lichterloh um sich brennen sah. Vor dem Abendessen ging Magda mit Endres zur Allmende, um die Ziegen einzufangen, und fragte ihn, ob der Großvater recht hatte.
„Er dürfte schon recht haben“, antwortete Endres in seiner stillen, besonnenen Art. „Papst Johannes bedroht König Ludwig mit dem Kirchenbann und versucht, die Polen und Litauer in einen Krieg gegen die Mark zu hetzen. Er braucht Geld in Hülle und Fülle, und König Ludwig hat wahrlich andere Sorgen als ein paar Brauer am östlichsten Rand seines Reiches. Für den Markgrafen Waldemar sah das seinerzeit anders aus, der hätte auf seinen Bierpfennig nur ungern verzichtet. Aber das heißt ja nicht, dass König Ludwig falsch handelt.“
„Der Papst erkennt König Ludwig nicht an, nicht wahr? Und er wird niemals gestatten, dass er sich zur königlichen noch die kaiserliche Krone aufsetzt?“ Dieser Streit zwischen König und Papst währte schon ewig und erschien Magda als ein heilloser Wirrwarr, der aus unerfindlichen Gründen Einfluss auf ihr Leben nehmen durfte. Warum herrschte überhaupt ein Mann über die Mark Brandenburg, der diese nie betreten hatte? Was konnte einer, der hier nicht lebte, von der harten, roten Erde wissen, die den Menschen das Äußerste abverlangte, von den weiten Sümpfen, die Schafe und Kinder verschlangen, und von den schwarzen Wäldern, in denen kein König, sondern Riesen und Bären regierten?
„Nein, das gestattet er nicht“, stimmte Endres ihr zu. „Und ob das Recht bei ihm oder beim König liegt, vermag ein kleiner Lehrling wie ich nicht zu entscheiden. Was aber das Brauverbot angeht, hat König Ludwig, wenn du mich fragst, richtig gehandelt. In den Scheuern ist kaum genug Getreide, um die Menschen in der Stadt satt zu kriegen, also ist erst recht keines da, um es zu mälzen. Oder möchtest du etwa, dass unsertwegen jemand hungert?“
„Natürlich nicht. Aber werden denn nicht wir hungern, Endres?“
Der Freund schüttelte den Kopf „Wir werden unsere Gürtel ein wenig enger schnallen müssen, aber das Bier, das wir eingelagert haben, können wir umso teurer verkaufen. Schon heute sind auf dem Markt die Preise in die Höhe geschnellt. Zusammen mit dem, was dein Großvater für Notzeiten erspart hat, werden die Erträge schon reichen, bis wir wieder brauen dürfen. Haben nicht die meisten Leute viel weniger als wir?“
Erleichtert lehnte Magda den Kopf an seine Schulter. Sie saßen am Rand der Allmende auf bemoosten Steinen und blickten über das zottige Gras, an dem die Ziegen rupften, bis hinüber zum Wald. Für gewöhnlich schlugen sie sich um diese Jahreszeit in das duftende Dickicht der Bäume, um den harzigen Kiefernhonig zu sammeln, von dem Magda nie genug bekommen konnte. Nach den endlosen Wolkenbrüchen jedoch versank der Wald schier im Sumpf, und ihn zu betreten, konnte das Leben kosten. Aber was war schon dabei, einen Winter lang ohne Honig zu leben? Sie hatten ein warmes Haus, sie hatten Brot genug und sie hatten einander!
„Für die Linharts an der Mauer sieht es übler aus“, bemerkte Endres, als läse er ihre Gedanken. „Sie haben nichts eingelagert. Utz sagt, sie würden am liebsten in unser Lager einbrechen und uns das letzte Fass stehlen.“
Die Linharts an der Mauer waren ihre Rivalen, eine Familie von Bierbrauern, in der jeder Erbsohn wiederum den Namen Linhart erhielt. Ihr Brauhaus samt Ausschank hatten sie nicht in der Braugasse, sondern dort, wo sich die zweimal mannshohe Stadtmauer erhob. „Keine ehrbare Gegend“, pflegte der Großvater naserümpfend zu bekunden, denn an der Mauer befand sich das Haus des Blutvogts, und was der berührte, hatte mit einem Schlag seine Ehrbarkeit verloren. Die käuflichen Weiber und das finstere Gelichter trieben sich dort herum, aber dafür, fand Magda, konnten die Linharts ja nichts. Sie hatten ihre Brauerei in jener Gasse gehabt, lange bevor sich der Rat von Bernau entschloss, die imposante Mauer hochzuziehen und damit der Welt zu zeigen, dass Bernau nicht einfach eine Siedlung war, die wieder verschwinden würde, sondern eine Stadt – stolz und sicher befestigt wie die Burg eines adligen Herrn.
„Stadt ist, was Stadt sein will“, behauptete Utz. „Doch Bernau hätte früher aufstehen müssen, um im Wettlauf der Städte mitzuhalten.“ Ganz verstand Magda nicht, was der Bruder, der unentwegt gelehrt daherschwatzte, damit zu erklären versuchte. Sie war jedoch hell genug, zu begreifen, dass die Stadt sich um das Schicksal der Linharts nicht scheren konnte, wenn sie in der neuen Welt, die Utz heraufziehen sah, bestehen wollte.
Endres legte den Arm um sie und ließ seine Finger zögerlich auf ihren Rippen spielen. Magda spürte die sachte Berührung und ein Schauder jagte über ihren Rücken. Augenblicklich wünschte sie sich, seine Finger würden fester, fordernder zupacken, weiterwandern, sich die Linien ihres Leibes ertasten, wie sie sich die seinen hätte ertasten wollen. Sie zuckte zusammen. War das wirklich sie, die das gewünscht hatte? Sie, die tugendsame Enkelin von Brauer Seyfrid, dem Harzer?
„Was ist denn?“, fragte Endres. „Frierst du? Du zitterst wie Espenlaub, dabei ist noch nicht mal November.“
Magda musste sich die Hand auf den Mund pressen, um nicht loszuprusten. Wusste Endres wirklich nicht, dass das, was sie zittern ließ, alles andere als Kälte war? Diether, dessen war sie sicher, hätte es gewusst, und sie selbst wusste es auch, obwohl Diether ihr immer wieder sagte, von solchen Dingen dürften kleine Mädchen gar nichts wissen. Er grinste ja dabei und wenn sie ihn bestürmte, es ihr zu erklären, hielt er nicht lange stand, sondern flüsterte ihr das verbotene Geheimnis ins Ohr. Endres hingegen war im Vergleich zu ihnen der reinste Unschuldsengel. Ein Schwall Zuneigung schwappte über Magda. Im Nu hatte sie die Arme um ihn geworfen und ihm einen Kuss auf die Wange gedrückt.
Endres’ Blick war Gold wert. Verstört starrte er sie an, während seine Hand hinauf an seine Wange wanderte, als hätte er keinen Kuss, sondern eine Backpfeife bekommen. Als er endlich den Mund öffnete, sah Magda, dass ihm die Oberlippe bebte. Ich hab ihn ja lieb, dachte sie und spürte Wärme, die aus ihrem Unterleib in ihren ganzen Körper stieg. Ich hab diesen schüchternen, verlässlichen Burschen ja wirklich und wahrhaftig lieb.
„Mir kommt nicht recht vor, was wir tun“, sagte Endres und senkte den Kopf.
„Aber warum denn nicht, um alles in der Welt?“
„Dein Großvater war besser zu mir, als jeder Verwandte es hätte sein können“, antwortete Endres zum Boden gewandt. „Und deine Brüder, Lentz und Utz, sie dulden mich, obwohl sie die Arbeit leicht allein schaffen könnten. Ich käme mir vor wie ein Schuft, wenn ich mit dir etwas täte, das kein Mann deiner Familie gutheißen könnte.“
„Herr im Himmel, Endres!“, platzte Magda heraus. „Kannst du dich noch ein bisschen geschwollener ausdrücken? Dann verstehe ich nämlich kein Wort mehr.“
Endres räusperte sich.
„Na komm schon“, drängte Magda. „Heraus mit der Sprache!“
Er blieb ernst und hob den Blick nicht vom Boden. „Du bist mir lieb“, stieß er rau hervor. „So wie keine andere. Als ich dich eben angefasst habe, da hätt’ ich’s wie ein Bruder tun wollen. Aber ich bin ja nicht dein Bruder, Magdalen. Ich bin’s ja nicht.“
„Und weißt du was?“, rief Magda geradezu triumphierend und küsste seine Wange hemmungslos ein zweites Mal. „Ich bin froh, dass du’s nicht bist. Heilfroh bin ich. Warum soll das Mannsvolk in meiner Familie nicht gutheißen, wenn du und ich heiraten? Ich bekomme einen braven Mann, und das Gewerbe bekommt einen tüchtigen Brauer. Besser geht es doch nicht.“
„Du darfst das nicht, Magdalen.“
„Was soll ich nicht dürfen?“
„Das“, murmelte Endres und wies, statt das gefährliche Wort auszusprechen, auf seine Wange, auf der ein wenig Nässe glänzte. „Wie könnte denn ich dich heiraten? Ich habe nichts, bin nichts, habe ja noch nicht einmal vor der Zunft meine Prüfung abgelegt.“
„Warum tust du’s dann nicht?“, erwiderte Magda trocken. „Diether sagt, er kann dir im Brauhaus nicht das Wasser reichen, und der Großvater sagt, das können auch Utz und Lentz nicht mehr.“
„Dass das nicht wahr ist, weißt du.“
„Und weshalb sollte mein Großvater lügen?“
Endres zuckte die Schultern. „Weil er ein netter Mann ist.“
Magda lachte laut auf. „Mein Großvater ist Seyfrid, der Harzer, und das heißt so manches hier in Bernau. Einen netten Mann aber hat ihn, glaube ich, nicht einmal seine eigene Schwester je genannt.“
„Dann eben, weil er Mitleid mit mir hat“, mutmaßte Endres. Er hatte einen Stock aufgehoben und bohrte damit in der Erde, die schon steinhart wurde, obwohl der Sommer gerade erst vorüber war. „So oder so – nichts von alledem bedeutet, dass er mich seine Enkelin heiraten ließe. Sein Liebstes würde er doch wohl keinem Habenichts geben, nur weil der Habenichts ihm leidtut.“
„Aber du musst doch kein Habenichts bleiben, Endres!“ Es war zum Haareraufen, warum betrug sich dieser kluge Bursche nur auf einmal so dumm? „Du legst deine Prüfung vor der Zunft ab, dann kannst du Geselle werden, und dann …“ Sie brach ab, weil ihr siedend heiß ein schrecklicher Gedanke kam.
„… gehe ich auf Wanderschaft“, sprach er aus, was sie gedacht hatte. Als Brauergeselle würde er durch das Land ziehen müssen, um sich seine Sporen zu verdienen. Sie würde ihn auf Jahre nicht sehen, und wer weiß, vielleicht würde er sie in der Fremde vergessen, weil ihn andere umgarnten, mit deren Reizen ein struppiges Kälbchen aus Bernau nicht mithalten konnte. Auf seine unauffällige Weise war er ein ansehnlicher Bursche, auch wenn er das allem Anschein nach nicht wusste. Er würde an jeder Straßenecke ein anderes Mädchen finden. Magdas Herz, das federleicht gewesen war, wurde in ihrer Brust zu einem Klumpen Blei.
„So lange würdest du niemals auf mich warten“, sagte Endres. „Und warum solltest du? Du bist die Enkelin von Seyfrid Harzer und du bist das pfiffigste, netteste Mädchen von Bernau. Du könntest jeden haben, der dir gefällt.“
Magdas Herz spielte vollends verrückt, begann zu hämmern und veranstaltete einen kleinen Hoppeldei in ihrer Brust. „Denkst du das wirklich von mir?“
Endlich blickte er auf, sein Gesicht ein Inbild der Verblüffung. „Ja, was soll ich denn sonst von dir denken?“
„Du bist ein Dummkopf, Endres Kannengießer!“, rief sie. „Ein regelrechtes Rindvieh bist du!“ Dann nahm sie sein Gesicht in die Hände und drückte ihm den nächsten Kuss mitten auf den Mund. Nur einen Herzschlag lang kostete sie seine Lippen, aber der Geschmack und die Fülle genügten, um sie zu berauschen. Sie wollte ihn wieder küssen und wieder und wieder! Es war wie mit dem Früchtebrot, das Barbara zum Weihnachtstag gebacken hatte, in das man wieder und wieder hineinbeißen wollte, weil man die Süße, wenn sie von Gaumen und Zunge verschwand, sofort noch einmal schmecken musste.
Sie setzte von Neuem an, doch er kam ihr zuvor und legte ihr sacht zwei Finger auf die Lippen. „Bist du dir denn sicher?“ Beinahe flüsterte er. „Magdalen, mein Schatz?“
Sie nickte heftig.
„Du könntest den Linhart bekommen“, wandte er ein.
„Und wer will den?“, rief Magda. „Der pfeift jedem Weiberrock hinterher und sein Atem stinkt nach Fisch.“
„Er kann tanzen. Und er erbt eine Brauerei.“
„Endres“, sagte sie, „willst du mich zur Frau oder willst du hin und her reden, bis wir hier beide mit dem Hintern festfrieren? Wenn du das willst, dann sag’s mir, denn dann gehe ich heim zu Großvaters verbranntem Kraut und meinem warmen Bett. Andernfalls sei ein Mann und fass dir ein Herz. Schwör mir, dass du mir auf der Wanderschaft die Treue hältst, und dann sprich mit dem Großvater. Der wird dir deinen Kopf schon nicht vom Hals reißen.“
Sie zwang ihn, ihrem Blick standzuhalten. Erst rutschte er noch auf seinem Stein hin und her, doch als sie ihr Gesicht dem seinen näherte, wich er nicht zurück. Dieses Mal währte ihr Kuss ein wenig länger und er schmeckte, fand Magda, noch süßer als Barbaras Früchtebrot.
3
Im Frühjahr wurde das Brauverbot aufgehoben, aber es gab kaum Getreide zu kaufen. Für das wenige, das an Weizen und Gerste angeboten wurde, verlangten die Händler Wucherpreise, die die Brauer nicht bezahlen konnten. Wie es Utz gelang, dennoch Korn zum Mälzen aufzutreiben, blieb ein Rätsel und ein kleines Wunder. Sie besaßen kein Fuhrwerk mehr, aber Utz fand Wege, sich eine halb blinde Mähre zu leihen. Die spannte er vor seinen Karren und fuhr die Panke hinauf bis zu deren Mündung in die Spree. Dort lag die geheimnisvolle Doppelstadt, über die die Frauen auf dem Markt munkelten, sie werde bald Bernau und alle anderen Städte in Brandenburg überflügeln.
„Wer eine Zukunft haben will, der geht nach Cölln-Berlin“, hatte auch Utz schon mehr als einmal bekundet.
„Und warum? Was ist an diesem Cölln-Berlin denn so besonders?“, hatte Magda gefragt, die sich eine schönere Stadt als Bernau nicht vorstellen konnte. Albrecht, der Bär, der erste Markgraf von Brandenburg, hatte sich sein Bernau erträumt, weil ihm gerade hier, in einer Schenke im finstersten Kiefernwald, das beste Bier seines Lebens eingeschenkt worden war. Was konnte irgendein Cölln-Berlin schon gegen den Traum eines Markgrafen aufzubieten haben?
„An Cölln-Berlin hat nie ein Mensch geglaubt“, erklärte Utz mit jähem Leuchten in den Augen. „Zwei bedeutungslose Nester, in den Sand irgendwelcher Inseln in der Spree gepflanzt – so wurden die beiden jahrzehntelang abgetan. Jetzt aber stecken die Spreestädte ihre Köpfe aus dem Uferschlamm wie der Phoenix aus der Asche und den Verächtern bleiben die Münder offen stehen. Cölln-Berlin liegt nämlich als Verkehrsknotenpunkt genau zwischen Ostsee und Erzgebirge, und das macht es zu einem Handelsstandort erster Güte.“
„Besser als unser Bernau?“
„Viel besser als Bernau, das einmal kein Mensch mehr kennen wird“, erwiderte Utz. „Aber das ist noch nicht alles. Darüber hinaus ist Cölln-Berlin genau an der Stelle gebaut, an der die Fernhandelsstraße die Spree durchquert. Das verschafft ihr das Stapelrecht, das in unseren Zeiten pures Gold wert ist.“
„Und was soll das sein, das Stapelrecht?“
„Das Recht, durchziehende Fernhändler mehrere Tage lang aufzuhalten“, erklärte Utz bereitwillig weiter. Er verlor nie die Geduld mit ihren Fragen wie die anderen, fuhr ihr nie über den Mund und behauptete auch nie, ein Mädchen brauche von alledem nichts zu wissen. Vielmehr schien er sich zu freuen, dass zumindest ein Mitglied der Familie für seine Kenntnisse Interesse zeigte. „Während dieser Tage sind die Händler verpflichtet, ihre Waren in Berlin anzubieten, und der Umsatz, der aus den Verkäufen erzielt wird, kommt der Stadt zugute“, erläuterte er weiter. „Die Doppelstadt auf den Spreeinseln hat damit einen unschätzbaren Vorteil. Glaub mir, sie wird schneller wachsen als das Gras im Mai und zu einer Größe gelangen, wie wir sie uns hier in unserem Hinterwald nicht einmal träumen lassen.“
„Bist du denn hier nicht glücklich, Utz?“, fragte Magda.
Der Bruder schnaubte, dann ballte er die Fäuste und hatte sich sogleich wieder in der Gewalt. „Glücklich, was heißt das schon, mein Herz?“, fragte er. „Natürlich bin ich glücklich, wenn wir beisammen sind und es keinem von uns an etwas fehlt. Hier aber, als kleiner Brauer aus Bernau, bleibt mein Glück doch ewig abhängig vom Willen anderer – ob von dem einer Krone, die mir mein Handwerk verbietet, oder von dem einer Kirche, die mir den letzten Tropfen Blut aussaugt.“
„Aber in deinem Berlin herrschen König und Papst doch genauso!“, rief Magda. „So ist nun einmal der Lauf der Welt.“
„Stadtluft macht frei“, erwiderte Utz bedeutsam. „Selbst in Bernau erkennt man das und versucht auf Biegen und Brechen, aus ein paar Hütten um eine Waldschenke eine ordentliche Stadt zu stampfen. In Berlin aber wird es gelingen. In gar nicht ferner Zeit werden die Bürger der Doppelstadt Cölln-Berlin selbst eine Macht darstellen, die so viel Gewicht besitzt, dass weder ein Papst noch ein König sie länger zu seinem Spielball machen kann. Glücklich der Mann, der dabei sein darf, wenn das geschieht! Glaub mir, mein Herz, wenn unser Herr Großvater nicht so geizig auf seinen Geldsäcken hocken würde, hätte ich längst unsere Habe gepackt, den Beitrag zum Eintritt in die Gilde entrichtet und uns in Berlin ein neues Leben aufgebaut.“
Auch wenn der Großvater schimpfte und auf sein Bernau nichts kommen lassen wollte, ließ sich nicht leugnen, dass Utz mit seinen Fahrten in die Spreestadt Erfolg hatte. Das Getreide, das er einkaufte, war zwar noch immer zu teuer, aber deutlich billiger als alles, was man in Bernau bekam, und die Qualität war ohne Vergleich.
Zumindest behauptete das Diether, als er, wie so oft nach dem Abendessen, noch auf einen Schwatz zu Magda in die Kammer kam. „Großvater hat geschäumt wie frisch gegärtes Jungbier, weil Utz so viel Roggen eingekauft hat“, berichtete er. „Roggen, der taugt als Futterbrei für Säue, nicht als Getränk für Christenmenschen, Christenmenschen“, ahmte er den Brummbass des Großvaters so gekonnt nach, dass Magda ihr Kissen nach ihm warf. „Aber dieser Roggen, den Utz gebracht hat, der ist feiner als so manche Gerste und der macht ein Bier, nach dem jeder Kenner sich die Finger leckt. Lass die Gecken und Stutzer über die dunkle Farbe ruhig die Nase rümpfen – die wissen ja nicht, was für ein gepfeffertes Feuerchen ihnen entgeht.“
Nicht zum ersten Mal dachte Magda, dass Diether vom Bier etwas verstand. Er hätte alles andere als einen üblen Brauer abgegeben, wäre er nur nicht so faul gewesen. Von klein auf hatte er lieber Flöte gespielt als Maische gerührt und statt Schweinsblasen abzufüllen mit dem Kopf in den Wolken gehangen.
„Ich wünschte, Utz nähme mich mal mit nach Berlin“, murmelte er jetzt. „Der Vater ist auch oft nach Berlin gefahren, wusstest du das? Beim Himmel, ich hab ihn angebettelt wie ein kuttentragender Franziskaner, dass er mich nur auf einer einzigen Fuhre einmal mitfahren lässt, doch da war Hopfen und Malz verloren. Hätte der Lentz gefragt, hätte er sicher gedurft, aber mich mochte Vater ja sowieso nicht leiden.“
„Das ist doch ausgemachter Kohl, Diether.“
„Ach, ist es das? Und wenn’s eins mit dem Haselstecken gab, wen hat er dann bitte schön hergenommen? Etwa einen von euch? Aber nicht doch, dafür hatte er ja Diether, den Taugenichts! Als Prügelknabe war ich ihm immer gut genug.“
Magda fuhr auf und sah ihn an, sein scharf geschnittenes Profil, in dessen Stirn das blonde Haar fiel wie im Versuch, es zu besänftigen. Er war ein ausnehmend schöner Mann, obgleich er noch lange kein Mann war, sondern sich noch immer gebärdete wie der trotzige Junge, der mit schmerzlich versohltem Hintern und noch schmerzlicher gekränktem Stolz von dannen stampfte. „Du redest Unsinn“, wiederholte sie. „Ja, vielleicht war Vater ab und an zu streng mit dir. Aber leiden – leiden mochte er dich mehr als uns alle, sonst hätte er sich die Mühe, dir deine Missetaten aufs Sitzfleisch zu klopfen, gar nicht erst gemacht.“
Manchmal wunderte Magda sich über sich selbst. Das, was sie gesagt hatte, traf den Nagel auf den Kopf: Die übrigen Geschwister – Lentz, Utz und sie selbst – hatten vom Vater keine Schläge bekommen, aber sie hatten auch sonst nichts bekommen. Lentz, der ja nie etwas falsch machte, ab und an ein Lob, und Magda, die eben die Kleinste war, ab und an ein Streicheln über den Kopf, doch ansonsten waren sie dem Vater gleichgültig gewesen. Wenn es überhaupt eines seiner Kinder geschafft hatte, ihn aus seinen Träumen von Ferne und Weite zurück auf den zähen Brandenburger Boden zu bringen, dann war es Diether gewesen. „Beklag dich nicht“, mahnte sie ihn und zupfte ihn am Ohr. „Wenn du unbedingt in dieses Berlin willst, dann zeig lieber Utz, dass du ihm dort zu etwas nütze sein könntest.“
„Pah.“ Diether warf den Kopf zurück wie ein herrschaftliches Pferd. „Und wie soll ich das anstellen, sagst du mir das auch? Der Utz schaut doch das, was ich mache, nicht mal mit dem Hintern an.“
„Das ist gewitzt von ihm, denn wer im Hintern Augen hat, zerquetscht sie sich beim Sitzen“, konterte Magda.
Wider Willen musste Diether lachen, und das ließ seinen Trotz zerschmelzen. Er beugte sich vor und zog Magda in die Arme. „Ach, Schwesterchen. Was würde eigentlich aus mir werden, wenn ich dich nicht hätte?“
„Ein grauseliger Prahlhans, der noch mehr Mädchenherzen bricht, als er’s ohnehin schon tut“, erwiderte sie. „Und dass du heut so trübsinnig und anhänglich bist, dahinter steckt schon wieder ein Mädchen, hab ich recht?“
Diether hob den Kopf von ihrer Schulter und sah sie unter aufgebogenen Wimpern an, um die jede Hübschlerin ihn beneidet hätte. „Was weißt denn du von Mädchen, Schwesterchen?“
„Ich bin eins, Hohlkopf.“
„Ja, du bist eins, das lässt sich nicht leugnen. Und die schwarz bezopfte Alheyt ist auch eins. Den ganzen süßen Sommer lang, im Schilf, unter der großen Weide, hat sie meinen Liedern gelauscht und dabei die Äuglein geschlossen und geseufzt. Den Winter lang hab ich ihr im Schnee ein Feuer gezaubert, das Eis aufgehackt und einen Aal gefangen, und sie hat wieder geseufzt, hat vom Aal mit ihren Zähnchen Fetzen gerissen und mich hinterher mit ihrem Aalmund geküsst. Aber heiratet sie mich? Weit gefehlt. Diether, sagt sie, du magst der entzückendste Bursche in der ganzen Mark sein, aber zum Braumeister bringst du es nie, und deshalb kann aus uns nichts werden. Und nun rate einmal, wen sie stattdessen erhört.“
Magda fiel niemand ein, aber Diether ließ ihr auch gar keine Zeit zum Raten. „Meinen Bruder heiratet sie!“, rief er aus. „Lentz, den Heiligen, der in seinem Leben nie eine Sünde beging. Und Utz reibt sich die Hände. Der trägt die saftige Mitgift nach Berlin, denn der Lentz schlägt ihm gewiss nichts ab. Und was bitte schön tut Diether, der Idiot? Der greint seiner Schwester die Ohren voll und lässt die süße Liebste ziehen.“
„Lentz heiratet?“, stammelte Magda ungläubig. „Lentz heiratet Alheyt vom Goldschmied?“ Ihr ältester Bruder war ein stilles Wasser, und ein Mädchen wie Alheyt, reiche Erbin und umschwärmte Schönheit zugleich, hätte sie ihm niemals zugetraut. Aber stille Wasser waren bekanntlich mehr als nur trübe, und wäre sie selbst Alheyt gewesen, hätte sie sich womöglich auch für Lentz entschieden, der sie in Ehren halten und nie betrügen würde. Inmitten der sprudelnden Gedanken begriff sie, dass wieder eine Frau ins Haus kommen würde, noch dazu eine, die sie von klein auf kannte und mochte. Alheyt konnte eine rechte Zierpuppe sein, aber sie war auch ein Spaßvogel und ein Kumpan, wie man ihn sich zur Schwägerin besser nicht wünschen konnte.
Etwas fiel von ihr ab. Der Druck, das einzige weibliche Wesen hinter der Tür mit dem sechszackigen Stern zu sein. Alheyt Goldschmiedin hatte das Herz auf einem ordentlichen Flecken und unter den niedlichen Fesseln zwei standfeste Füße. Gute Wahl; Lentz, sandte Magda ihrem ältesten Bruder einen stummen Gruß.
„Heda, edles Fräulein – ist Euer schnöder Bruder Euch keine Antwort mehr wert?“
Magda klaubte ihr Kissen vom Boden und schlug es Diether über den Kopf. „Was willst du? Ein bisschen Balsam auf deine Wunde oder eine ehrliche Antwort?“
„Am liebsten ehrlichen Balsam“, bekannte Diether kleinlaut.
„Einverstanden. Also, wenn ich die Alheyt wäre, tät ich auch den Lentz nehmen. Bei dem hat sie es warm und wohlig, was immer auch geschieht. Aber dich würde ich mein Lebtag nicht vergessen, und wenn ich mit dir am Tisch säße, schlüge ich über meiner Suppe die Augen nieder, damit keiner sieht, dass ich rot wie eine Rübe bin.“
Magda hörte Diether nach Luft schnappen. Im nächsten Augenblick brach er in sein glockenhelles Gelächter aus, zog sie an sich und küsste ihre Stirn. „Du bist Gold wert, Schwesterchen, weißt du das? Wen immer die Alheyt von uns Buben erhört – sie bekommt die beste Schwägerin der Welt.“
Schon am nächsten Abend lud der Großvater, der alles andere als ein begeisterter Gastgeber war, Nachbarn, Kunden und Bekannte in das schmalbrüstige Haus hinter dem Braustern ein, um die Neuigkeit zu verkünden: Sein Enkel Lentz, Erbe und künftiger Braumeister, sei verlobt und versprochen der Alheyt, Goldschmiedstochter, und was auch immer diese Zeit, in der das Wetter übler, die Pfaffen gieriger und die Biere dünner würden, für sie alle bereithielt, im September, zur Ernte, würde Hochzeit gehalten. „Und dazu“, rief der Großvater über die Köpfe seiner Gäste, „dazu schenkt Seyfrid Harzer euch ein Bier aus, wie sie’s weder im Bayrischen noch im Elysischen saufen, saufen!“
Im Tosen des Applauses bemerkte Magda ihren Bruder Lentz erst, als der hinter sie trat und sacht die Arme um sie legte. „Und? Was sagst du?“, fragte er auf seine vorsichtige Art.
„Zur Alheyt, Lentz?“ Magda fuhr herum und pflanzte einen Kuss in seinen Bart, den er sich stehen ließ, als wäre er schon ein alter Mann. „Ach, ich freu mich bis in den hohen Himmel. Und ich wünsch euch alles Glück zwischen Panke, Spree und Havel und so viele Kinder, wie Brandenburg Seen hat! Aber die werden mich dann alle gesittet ansprechen müssen, als Frau Tante Magdalen.“
„Frau Tante Magdalen? Du?“ Der Bruder lachte und hob Magda in die Höhe wie als Kind. „Was kommt denn als Nächstes? Ziehst du hinüber nach Chorin und behauptest, eine fromme Schwester zu werden?“
Sie lachten beide. Dass Lentz so viele Worte machte und so weit aus sich herausging, kam kaum einmal vor, und als Magda das Glänzen in seinen Augen sah, erkannte sie, wie verliebt er war.
In all dem Jubeln und Johlen war untergegangen, dass der Großvater noch etwas hatte sagen wollen. Jetzt hieb er mit dem Messingstößel gegen seinen Mörser, dass es tönte wie die Glocke für die armen Sünder. „Ruhe sag ich!“ Das verkniffene Lächeln hinter seinem Bart bemerkten höchstens die, die ihn sehr gut kannten. „Ihr mögt ja denken, in dieser Familie gäbe es schon Grund genug zum Feiern, aber da habt ihr wieder mal zu schnell gedacht. Ich hab nämlich noch einen Grund, ob es euch passt oder nicht, ihr grüngesichtigen Neidhammel: Mein Ziehsohn und Lehrling, Endres Kannengießer, auf den ich stolz wie ein Pfau bin, hat nämlich vor der Zunft seine Prüfung abgelegt und mit fliegenden Fahnen bestanden.“
Magda wurde schwindlig vor Freude. In Lentz’ Armen reckte sie sich auf Zehenspitzen, um Endres in der Menge zu erspähen, aber der Liebste duckte sich wohl wie üblich hinter den nächstbesten breiten Rücken. Nachher würde sie seiner schon habhaft werden und dann würde er beidem nicht entgehen – weder dem Kuss zur Belohnung noch der Schelte, weil er ihr den Erfolg verschwiegen hatte.
Der Großvater hatte das letzte Wort nicht wiederholt – er war eindeutig noch nicht fertig. „Der Lentz ist mein Erbe“, rief er in die johlende Menge. „Aber in Harzers Brauerei, da ist noch immer für zwei Braumeister Platz, und wenn der alte Seyfrid unter seinem Dach noch etwas zu sagen hat, dann wird der zweite mein Endres, denn dieser Prachtkerl taugt mehr als der Diether und der Utz zusammen, zusammen.“
Mitten in der schäumenden Freude sprang Magda Bitterkeit an wie im Nachgeschmack von Bier: Weshalb musste der Großvater zwischen den Männern Zwietracht säen, weshalb hetzte er sie gegeneinander auf? Magda liebte ihn innig, aber dass er zuweilen Spaß an grundlosen Gehässigkeiten hatte, konnte sie nicht leugnen. Endres würde es die Freude an seiner Leistung rauben. Diether war sein Freund – lieber ließ er sich selbst schmähen, als dass Diether seinetwillen eine Schmähung. erleiden musste.
Und wenn er nun also bestanden hatte, ihr Endres, würde er sich dann nicht, noch ehe der Sommer das Gras ausblich, auf den Weg machen? Der Schmerz packte Magda so jäh, dass sie sich aus Lentz’ Armen losriss. Nur nach Diether verlangte es sie jetzt, nach dem Bruder, der gewiss um Alheyt trauern und verstehen würde, wie es in ihr aussah. Im selben Augenblick hoben Sackpfeifer und Fiedler zu spielen an und die Masse der Gäste teilte sich, um zu tanzen. Magda entdeckte Diether im Winkel, bei sich ein Mädchen, dessen Haar so rabenflügelschwarz wie das von Alheyt war.
„Diether“, rief sie und bahnte sich einen Weg zu ihm. Ehe der Bruder sie hörte, hörte das Mädchen sie. Es zuckte zusammen, löste sich und eilte davon. Gerade als es durch die Tür ins Freie entfloh, bemerkte Magda, dass es keine Schuhe trug, dass der Saum seines Rockes ausgefranst war und dass sie es nie zuvor gesehen hatte.
„Wer war das?“, fragte sie atemlos, als sie sich an den Tanzenden vorbei zu Diether vorgekämpft hatte.
„Wer?“, fragte Diether. „Die Kleine? Ach, niemand.“
„Du stehst und trinkst und sprichst mit ihr, aber mir erzählst du, sie ist niemand?“ Magda liebte ihren Bruder, doch seine Art, mit Frauen umzugehen, brachte sie zur Weißglut.
„Eine von den Wendischen“, murmelte Diether. „Aus einer Kate vor der Stadt. Jetzt denk nicht gleich wieder das Schlimmste von mir. Ich hab mich eben trösten müssen, weil Alheyt mich hat sitzen lassen. Da kam die kleine Worša mir gerade recht.“
„Und wenn sie dir nicht mehr recht ist, schickst du sie zum Teufel, ja?“
„Beim Himmel, sprich doch leiser. Soll jeder dich hören?“
„Ich habe nichts dagegen. Vielleicht wird es Zeit, dass ganz Bernau erfährt, was für ein Lump mein Bruder sein kann.“
„Die Worša sieht das anders“, giftete er zurück. „Die ist gern mitgegangen, und mein Bier hat sie auch gern getrunken – hätte, wenn du nicht aufgetaucht wärst, auch gern noch ein zweites gehabt.“
„Das kann ich mir vorstellen. Das arme Ding hatte wahrscheinlich seit drei Tagen nichts im Magen.“ Die Wenden, so hieß es, hatten in Brandenburg gelebt, lange bevor die Deutschen gekommen waren und sie aus Städten und Dörfern in die Wälder und ins Ödland vertrieben hatten. Dort hausten sie in zugigen Katen, verdingten sich als Tagelöhner oder rangen dem störrischen Boden einen Ertrag ab, von dem in Bernau kein Stück Vieh lebte. „Und das nutzt du aus, Diether? Die Not dieser Leute nutzt du ohne Skrupel aus?“
„Jetzt hör doch auf, dich zu ereifern – du bist ja schon purpurrot im Gesicht wie Propst Nikolaus“, sagte Diether und hielt sie an den Armen fest. „Ich nutze gar nichts aus, ich hab der Kleinen geholfen, das ist alles. Was habe ich eigentlich verbrochen, dass ihr alle grundsätzlich das Schlimmste von mir denkt?“
„Was soll das heißen, du hast ihr geholfen?“
„Es heißt, was es heißt“, entgegnete Diether gekränkt. „Sie war eben mit dem jungen Linhart unterwegs und wollte nicht so, wie er wollte. Er hat sie geschlagen – da habe ich ihm eine gepfeffert, ihm das Mädchen weggerissen und es mitgenommen, damit es in Sicherheit ist und etwas in den Bauch bekommt. Und – bin ich nun der Wüstling, den du so gerne in mir sehen möchtest, oder bin ich vielleicht doch dein Bruder Diether, den du als leidlich netten Kerl kennen solltest?“
„Ach Diether – warum sagst du das denn nicht gleich?“
„Hast du mich bitte schön zu Wort kommen lassen? Du hast doch losgeschimpft, dass unser Propst daneben blass geworden wäre.“
„Und hatte sie damit etwa unrecht?“, erhob sich eine Stimme neben Magda. Sie wandte den Kopf und entdeckte Endres, der lautlos an ihre Seite getreten war.
„Ach, unser Prachtkerl“, höhnte Diether. „Das war ja klar, dass der sich einmischen muss.“
„Hör damit auf!“ Verlegen senkte Endres den Blick. „Dein Großvater hat das frische Starkbier nicht vertragen, er wusste nicht mehr, was er spricht. Aber Utz weiß es, und der hat dir immer wieder gesagt, du sollst mit dem jungen Linhart keinen Streit anfangen. Den Linharts steht das Wasser bis zum Hals, die würden nach jedem Strohhalm greifen. Und einer dieser Strohhalme könnte sich bieten, wenn sie uns, ihre Rivalen, in Verruf bringen. Ich bin sicher, der junge Linhart würde dich nur allzu gern wegen dieses Mädchens vor den Rat zerren und deinen Ruf beschmutzen.“
„Aber deshalb kann doch Diether das Mädchen nicht seinem Schicksal überlassen“, rief Magda. „Wenn der Linhart es schlägt – was hättest du denn getan?“
Endres schwieg. Sie schwiegen alle drei, sodass auf einmal die Pfeifen und Fiedeln wieder hörbar wurden. „Vielleicht erzählst du deiner Schwester besser, wie es wirklich war“, sagte Endres endlich, drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort davon.
Die Geschwister sahen einander an. Diethers Blick begann zu flackern, aber Magda erlaubte ihm nicht, ihr auszuweichen. „Herr des Himmels“, stöhnte er schließlich, „also zugegeben, die Maulschelle, die der Linhart ihr verpasst hat, die hat sie bekommen, weil sie ein klein wenig mit mir geschäkert hat. Eine Wendin, ich bitte dich – wenn sich der Linhart beträgt, als gehöre die ihm allein, ist er doch selber schuld. Und wenn er dem Rat vorheult, ich hätte ihm die Kleine gestohlen, dann halten die versammelten Würdenträger sich die Wänste vor Lachen.“