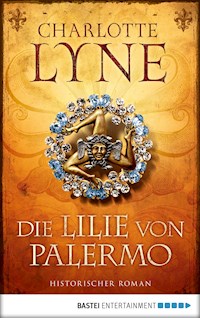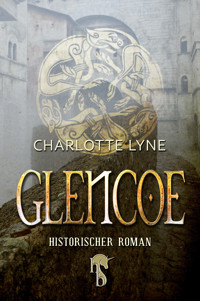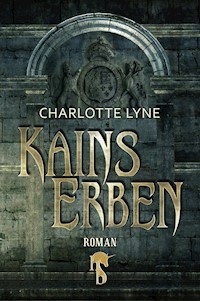6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London 1938: Sie sind das Traumpaar der swingenden Themsestadt: Amarna, Archäologin aus Berlin, und Arman, genialer Bildhauer armenischer Herkunft. Bewunderer und Neider ahnen jedoch nicht, dass ein dunkler Schatten ihre Liebe belastet: Durch den Völkermord an den Armeniern hat Arman seine Familie verloren und kann nicht tatenlos zusehen, wie in Deutschland von Neuem ein mörderisches Regime erstarkt. Eine Mauer scheint zwischen den Liebenden zu wachsen, und als der Krieg ausbricht, meldet Arman sich freiwillig zur Royal Air Force. Amarna muss sich ihren schlimmsten Ängsten stellen, um ihren Mann nicht zu verlieren. Am Fuß des Ararat, dem Schutzberg des armenischen Volkes, wird sich erweisen, was stärker ist – die Liebe oder der Hass.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1035
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charlotte Lyne
Niemand wartet in dieser Stadt
Roman
To „the few“Thank you. Still owing you so much.Im Gedenken anPrimo Levi, Komitas Vardapet, Jean Améry, Jean Moulin, Missak Manouchian.Bewundernd. Traurig.
„Was geschehen ist, ist eine Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld.“
Karl Jaspers„Pour toi, Arménie.“
Charles Aznavour
Erster TeilBerlin und London
„Es wartet niemand in dieser Stadt.“
Mascha Kaléko
1
Eva
Vor Berlin. Juni 1937
„Weißt du, was noch widerlicher ist, als mit Schweinen zu verkehren?“
Die Stimme ihres Geliebten schreckte Eva aus ihrer Betrachtung. Sie stand über die Halbtür des Kobens gebeugt, der Gestank war zum Gotterbarmen, und der Anblick kein bisschen erfreulicher. Dennoch musste sie sich zwingen, den Blick von den zwei Tieren abzuwenden. Mit den aufgetriebenen Leibern der Schweine erging es ihr wie mit allem, das aus der Masse hervorstach und ihren Blick einfing. Ihre Augen saugten sich fest. Ihr Hirn nahm Maß und fertigte eine Skizze an.
„Ich habe dich etwas gefragt“, sagte Martin. „Aber dass du eine Frage, die derart absurd klingt, ignorierst, wundert mich nicht.“
Statt zu antworten, nahm Eva ihn in Augenschein. Sein Gesicht hätte zu einem asketischen Mönch des Mittelalters gehören können. Sandhell und fein wie Kinderflaum tanzten Haarsträhnen über seiner Stirn und ließen die Haut auf dem markanten Schädel schimmern. Von seinen Augen schwärmte die halbe Nation. Ihr vages Graublau war die einzige Farbe, die nicht in der Tierwelt, sondern nur bei Menschen vorkam.
Eva lebte seit fünf Jahren mit ihm, sie neigte eher zum Spötteln als zum Schmachten, doch der Schnitt seiner Züge weckte noch immer die Schwärmerin in ihr. Sie war Künstlerin, Ästhetin, sie hatte das Recht, sich einen Mann zum Gefährten zu wählen, nach dem der Rest der weiblichen Bevölkerung mit umwölkten Blicken lechzte. Der schöne Martin. Etwas erschrocken lachte sie auf, weil eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schweinen sich nicht leugnen ließ. Die rosige Nacktheit. Die Borsten, die aus der Schwarte wuchsen.
Beschimpften Menschen einander deshalb als Schweine? Weil die Ähnlichkeit sich aufdrängte?
„Darf ich wissen, was so lustig ist?“, fragte Martin.
„Darf ich wissen, was dir die Petersilie verhagelt hat?“, fragte Eva zurück.
„Das alles hier.“ Martins Lippen wurden schmal. „Dieser traurige Zirkus.“ Er zog sie an sich und küsste sie, als wollte er im Schweinestall mit ihr ins Bett. „Lass uns nach Hause fahren, ja? Jetzt gleich.“
„Ohne das heilige Abendbrot?“ Eva zog die Brauen hoch und äffte den leidenden Tonfall von Martins Mutter nach: „Jetzt habe ich extra meinen feinen Kartoffelsalat gemacht, soll ich den etwa wegschmeißen?“
Martin verzog keine Miene. „Mir egal“, sagte er. „Ich will zurück nach Berlin.“
Aber Eva war noch nicht fertig. Während der Wochenendbesuche bei Martins Eltern fühlte sie sich stets, als müsste sie rund um die Uhr die Luft anhalten, und irgendwann platzte es dann aus ihr heraus. „Unsereins hat’s nicht so dicke“, wimmerte sie, die Stimme der Mutter weiter imitierend. „Bei uns wird die ganze Woche gekratzt, damit’s am Sonntag zu Buletten reicht, aber ihr seid natürlich was Feineres gewöhnt. Mit einfacher Hausmannskost kann man solchen wie euch ja nicht kommen.“
Wen Hildchen Serner mit „solchen wie euch“ meinte, brauchte sie Eva nicht zu erklären. Ihren Zorn lebte sie an ihrem Haarknoten aus und rupfte daran, bis die Nadeln sich lösten. Auf der Schulter spürte sie schwere, streichelnde Strähnen, und ihr Hirn produzierte das Bild, das sich Martin bot: Eva, die Versucherin, den Verlust des Paradieses wert. So erging es ihr ständig: Immer sah sie das Bild, das andere von ihr hatten, so, als hätte sie die Augen ihrer Mitmenschen im Kopf.
„Meine Schädelinnenwand muss als Leinwand für mein ewiges Selbstporträt herhalten“, hatte sie Wilma erklärt, der göttlichsten Freundin, die eine Frau nur haben konnte.
Wilma hatte gelacht. „Das kann ich deiner Schädelinnenwand nicht verdenken, bijou.“ Sie lachten so viel, wenn sie zusammen saßen, vor sich die hohen Tassen mit Wilmas Kaffee, in denen sie je nach Weltlage den Anteil an Pernod erhöhten, und eingenebelt in Wolken von Wilmas schwarzem Zigarettentabak. An manchen Tagen lachten sie die ganze Nazi-Partei, deren tausendjähriges Reich und alles, was daran kaputtging, weg.
Martins Miene war noch immer unbewegt. Er hielt Eva bei den Schultern und blickte sie mit seinen Menschenaugen an. Sie wollte auch weg. Weg von Schweineställen und Bouletten, Blicken voll Argwohn und der Düsternis in Brandenburgs Dorfstraßen. Zurück nach Berlin, in ihr brausendes Meer von Lärm und Lichtern, zurück in ihre weltschönste Straße, die selbst die Nazis nicht kleinkriegten, und auf einen Pernod in Wilmas Bistro.
Zurück zu Chaja.
Eva gehörte nicht zu den Frauen, die es kein Wochenende ohne die kostbare Frucht ihres Leibes aushielten. Sie gehörte nicht einmal zu den Frauen, die sich eine solche Frucht gewünscht hatten. „Ich male Bilder, von mir bleibt genug auf der Welt“, hatte sie denen entgegnet, die sich mit gekrauster Stirn erkundigt hatten, ob sie sich denn keine Kinder wünsche.
Sie hätte noch immer das Gleiche gesagt. Gegen ihre Sterblichkeit malte sie wie besessen an, dafür brauchte sie kein Kind. Sie war auch noch immer wild auf durchliebte Wochenenden ohne Chaja. Nicht gerade im Brandenburgischen, bei Hildchen Serners Schlachtschweinen, aber in Florenz oder am liebsten in Paris, diesem Schmelztiegel, der sämtliche Sinne zum Überkochen brachte. Es war ein köstliches Vergnügen, auf die Kulturschätze einer Traumstadt zu pfeifen und zwei Tage nur im Bett zu vertrödeln, ohne dass eine goldige Vierjährige ihre Himbeerbonbons in die Besucherritze zwischen den Matratzen klebte.
Aber zu Chaja nach Hause zu kommen, war nicht weniger köstlich. Irgendwann während des Heimwegs stellte sich unweigerlich der Chaja-Hunger ein, die Gier, diesen kleinen Körper an den eigenen zu pressen, die zarten Glieder zu spüren und die Nase in den Duft nach Honigmilch und Seife zu tauchen. Dem Vogelstimmchen zu lauschen, der atemlosen Folge von Liebeserklärungen. Chaja liebte den Postboten, den Sprecher der Funkstunde, den Hund des Eiermanns, Martins Agenten Hagen Fidelis, Wilma, die sie ma tante nannte, sämtliche Kinder, die sie kannte, und ihre Kinderfrau, das Fräulein Podewils. Inniger als all jene zusammen liebte sie jedoch Martin und Eva, und am allerinnigsten liebte sie sich selbst.
Ich bin Chaja Löbel, das zuckersüße Zentrum des Universums.
Eva musste noch einmal lachen.
„Darf ich jetzt vielleicht wissen, was so komisch ist?“, fragte Martin gereizt.
„Nichts“, sagte Eva. „Ich habe nicht gelacht, weil etwas komisch wäre.“
Die Schweine wühlten im Breischleim und gaben röchelnde Geräusche von sich. Als das fettere zu schmatzen begann, kapitulierte Evas Magen.
Martin fixierte sie. „Fahren wir nach Hause?“
Eva nickte und trat schon zum Ausgang. Der Gestank war auf einmal nicht mehr auszuhalten.
Die meisten Menschen, die aus dem brandenburgischen Kaff, in dem Martins Eltern lebten, nach Berlin reisten, nahmen den Zug. Martin hatte einen Chauffeur, den die Reichskulturkammer ihm stellte, aber während dieser Wochenendbesuche fuhr er selbst, um von niemandem gesehen zu werden. Er tat es, weil er das Kaff samt den Eltern, die ihn dort aufgezogen hatten, tunlichst verschwieg. Der schöne Martin verschwieg so manches.
Sie kamen rasch voran. Seit die Nazis ihre Reichsautobahnen bauten, als müssten alle Straßen nach Berlin führen, war die Strecke nur noch ein Katzensprung. Obendrein war es Sommer und der Abend hellgolden.
Eva war eine Stadtpflanze, süchtig nach menschlicher Schönheit und blind für die Reize von Landschaften. Sie malte Straßenschluchten, Hinterhöfe, Irrenhäuser, Gefängnisse und Leichenhallen, doch vor allem malte sie die Gestalten, die darin herumgeisterten. Gesichter, die im steinernen Dschungel verloren gingen, wenn niemand sie auf eine Leinwand bannte. Dinge, die unvergänglich waren, malte sie nicht. Keine Sonnenuntergänge über sandigen Urstromtälern, kein Gelb von Rapsfeldern, über die sich Nachtschwere senkte, keinen blühenden Holunder zwischen Tannenzweigen.
Dass auf dieser Reise in den Abend dennoch ein Zauber wirkte, überraschte sie. Jäh sehnte sie sich danach, die Geschwindigkeit zu drosseln, in der Schläfrigkeit des Ackerlandes dahinzuzockeln, statt Berlin entgegenzurasen, als könne keine Naturgewalt den Zwölfzylinder aufhalten. Als warte daheim, auf ihrer Insel in der Bleibtreustraße, eine Katastrophe auf sie.
Die letzten Male schon, als sie von einem Besuch bei Gerhard und Hildchen Serner zurück nach Berlin gefahren waren, hatte Eva einen Anflug von Beklommenheit verspürt, aber der hatte sie nie so eisig gepackt wie heute. Lass uns anhalten, hätte sie gern zu Martin gesagt, und im hohen Frühsommergras ein Picknick teilen, das nur aus Champagner besteht. So wie damals, als wir uns gerade gefunden hatten, als unsere Liebe uns derart einzigartig schien, dass alles, was wir taten, ebenfalls einzigartig sein musste.
Unsere Liebe ist einzigartig. Ich war die wilde Eva, der Sündenfall auf langen Beinen, in der Berliner Boheme gab es keinen einzigen hübschen Kerl, der nicht wusste, wie ich im Hotelbett schmeckte. Mit dir bin ich nicht in ein Hotel gegangen, sondern in mein Turmzimmer über der Kunsthandlung, in mein gläsernes Traumkabinett. Um deinetwillen bin ich weitergezogen, fort aus dem Turmzimmer, in deine Bleibtreustraße. Für dich bin ich sesshaft geworden und so gut wie treu, von ein paar Nächten, die nicht zählen, abgesehen. Von dir habe ich mir ein Kind machen lassen, einen dicken Bauch, in dem ein Tropfen Du und ein Tropfen Ich zu einem Ganzen schmolzen. Meine Liebe zu dir ist einzigartig, ob ich hundert Kerle vor dir hatte oder tausend. Ich habe von keinem ein Kind. Nur von dir.
Und deine Liebe zu mir?
Damals hast du, besoffen vom Kirschwein, behauptet: „Meine Liebe hält alles aus.“
Ich habe dich geküsst, bis es wehtat, und in die flimmernde Abendluft gebrüllt: „Meine nicht. Wenn du dir Speck am Hintern zulegst oder röhrende Hirsche in Stuben hängst, fliegst du raus.“
Sie betrachtete ihn von der Seite, das anbetungswürdige Profil und die Linien des Körpers, der seine Drahtigkeit bewahrte, obwohl die Hüften inzwischen merklich gepolstert waren. Es machte ihr nichts aus. Sie liebte ihn. Über schlechten Geschmack zerrissen sie sich noch immer die Mäuler, auch wenn er in letzter Zeit Zugeständnisse machte, die ihr den Appetit verdarben.
Wenn einer behauptete, seine Liebe halte alles aus – fragte der sich in dem Moment, was das bedeuten konnte, über dicke Hintern, schlechten Geschmack und ein, zwei Treuebrüche hinaus?
Evas Herz schlug heftig. Sie wollte Martin bitten, den Wagen am Straßenrand abzustellen und mit ihr in die Felder zu laufen, sich irgendwo zwischen die Halme fallen zu lassen und alles zu vergessen, was in Berlin auf sie warten mochte.
Zugleich setzte der Chaja-Hunger ein. Die Sehnsucht nach dem Kind, das sie gemacht hatten, damals in Babelsberg, im Schatten himmelhoher Filmkulissen. Chaja war in den Tagen entstanden, in denen ihre Liebe so neu und blank gewesen war wie eine leere Leinwand. Eva hatte immer darauf geachtet, nicht schwanger zu werden, seit sie mit siebzehn ihrer Familie im Taunusstädtchen Niedernhausen davongelaufen war, um sich im Hinterzimmer eines Frankfurter Varietés entjungfern zu lassen. Bei Martin vergaß sie die Überzieher und dachte später: Ich wollte ein Kind von ihm. Ich habe es nur nicht gewusst.
Das Licht wurde schwerer. Die Dunkelheit lauerte sprungbereit auf den Moment, sich herabzusenken. Berlin war schon nahe. Einst war es die einzige Stadt gewesen, in der Eva hatte sein wollen, überzeugt, nur dort, im Strudel der Metropole, malen, lernen, atmen zu können. Die Avantgarde der ganzen Welt zog es ja dorthin, jeden, der nach Neuem, Wildem, Unerhörtem strebte, der sich das Alte, Überholte, das ihn am Boden hielt, von den Fesseln schütteln wollte. In der Enge des Frankfurter Vororts, in dem Evas Familie ihr wohlanständiges Leben fristete, wäre Eva erstickt. Ihre Hitze gehörte in den Schlund des Vulkans. Nach Berlin.
„Was willst du denn da?“, hatte ihr Vater gefragt. „In dieser Stadt wartet doch kein Mensch auf dich.“
„Das ist mir egal“, hatte Eva gesagt. Dass kein Mensch auf einen wartete, bedeutete Freiheit ohne Grenzen, aber das hätte ihr Vater als Frechheit abgetan. In seiner peinlich auf Anpassung bedachten Spießbürgerwelt kam keine Freiheit ohne Grenzen vor. „Wenn du uns das antust, wartet auch hier niemand mehr auf dich, Eva.“
Sie war gegangen und hatte Niedernhausen nie wiedergesehen. Komme ich in Berlin nicht zurecht, gehe ich eben anderswohin, hatte sie gedacht. Ich bin frei, auf mich wartet nirgendwo ein Mensch.
Heute war das anders, und Eva erschrak, als sie begriff, wie verletzlich sie das machte: Heute warteten Wilma, eine Straße voller Freunde und ein Atelier voller Bilder. Bilder von Menschen, die niemand anderer als Eva hätte festhalten können und die sie brauchten, wie Eva sie brauchte, weil sie einander Unsterblichkeit verliehen. Heute wartete Chaja. Ein Kuss, der nach Himbeerdrops schmeckte. Es gab keine Freiheit mehr – und keine andere Stadt.
„Woran denkst du?“, fragte Martin.
„An Chaja“, antwortete Eva.
Für gewöhnlich lächelte er bei dieser Antwort, wie es kein Mensch bei dem gefeierten Star der UFA kannte. Er spielte feurige Liebhaber. Keine lächelnden Väter. Heute lächelte er jedoch nicht.
„Du hast vorhin meine Frage nicht beantwortet“, sagte er.
„Welche Frage?“
Seine Hände krampften sich um das Steuer. „Weißt du, was noch widerlicher ist, als mit Schweinen zu verkehren?“
Evas Herz schlug schmerzhaft gegen den Brustkorb. Wie mit einem Eispickel. Dass er von den Schweinen sprach, die seine Eltern in ihrem Koben mästeten, um sie irgendwann für Buletten durch den Fleischwolf zu drehen, wagte sie nicht zu hoffen.
Sie musste sich beherrschen, um sich nicht an ihn zu klammern wie ein verhuschtes Mäuschen, das sie nie gewesen war. Sie hatte Männer gewollt, die sie erregten, reizten, herausforderten, und Martin gelang all das wie keinem vor ihm. Einen Mann, der sie beschützte, hatte sie nicht gebraucht, sie konnte bestens auf sich selbst aufpassen. Wer hätte auch eine streitbare Amazone wie Eva Löbel beschützen wollen – und vor allem: wovor?
Aber eine Amazone, der ein Kind am Bein hing, kämpfte mit verminderter Kraft, und ein Feind, der von allen Seiten näher rückte, ließ sich nicht frontal mit einer scharfen Zunge besiegen. Beschütze mich und dein Kind, wollte etwas in ihr zu Martin hinüberwispern. Sag mir, dass uns nichts geschehen kann, was immer in Berlin auf uns wartet.
„Du antwortest mir noch immer nicht“, beharrte Martin, der über die leere Autobahn der Stadt entgegenjagte.
„Zum Teufel, ich habe keine Ahnung, was für eine Antwort du hören willst! Was ist denn noch schlimmer, als mit Schweinen zu verkehren?“
„Ein Schwein zu sein“, sagte Martin und raste in die anbrechende Nacht.
2
Berlin. Juni 1932
Eva und Martin hatten sich bei der Arbeit an dem Film kennengelernt, der ihm schließlich seinen Durchbruch bescherte. Bekannt war er zuvor schon gewesen, ein Talent, dem nur das passende Sprungbrett fehlte. „Er spielt in öden Filmen, aber er sieht umwerfend gut aus“, schwärmten die Kundinnen bei Evas Friseur. „Einen Blick hat der – erhaben wie ein junger Gott.“
Wenn der erhabene Junggott dennoch hinter seinen Konkurrenten zurückblieb, dann lag es daran, dass sich Blick und Gesichtszüge nicht für die neckischen Komödien eigneten, in denen Willy Fritsch und Heinz von Cleve brillierten. Martin Serner, das war pure Leidenschaft, das Dunkle, Überlebensgroße, das einen Monumentalfilm brauchte, ein Epos von zeitloser Gültigkeit. Und ein solches hatte sein Agent für ihn aus dem Boden gestampft.
An einem Samstagabend im Frühsommer hatte er auf der neu gelegten Telefonleitung in Evas Turmzimmer angerufen. Eva, die im Begriff stand, sich ins Nachtleben der Stadt zu stürzen, hatte vor dem Spiegel gestanden, um ihr naturgegebenes Gesicht in ein ureigenes Werk zu verwandeln. Das war das Beste am Eintauchen in den Strudel der Berliner Nächte: die Masken, die sie sich anlegen konnte, für jeden Zug um die Häuser eine neue, wonach immer ihr der Sinn stand. Paul, der reizende Akademiker, mit dem sie derzeit schlief, behauptete: „Ich habe nie etwas Intimeres gesehen als dich beim Schminken.“
Der Anruf verdarb Eva die Laune wie alles, was sie beim Gestalten störte. Entsprechend unwirsch hatte sie sich gemeldet, ohne ihren Namen zu nennen.
„Einen angenehmen Abend wünsche ich.“ Der Anrufer schnaufte beim Sprechen. Seine Stimme beschwor das Bild eines possierlichen Nagetiers herauf. „Spreche ich mit Fräulein Eva Löbel?“
„Wen erwarten Sie denn sonst, wenn Sie sich mit meinem Anschluss verbinden lassen?“
„Ich bitte um Entschuldigung“, sagte der Nagetiermann betulich. „Ich habe Ihre Ausstellung in der Galerie Renke-Levin gesehen. Gesichter des Wahnsinns. Höchst beeindruckend. Alfred Renke-Levin war so freundlich, mir Ihre Nummer zu geben, nachdem ich ihm versichert hatte, dass Sie die Frau seien, nach der ich mir die Finger wund suche.“
„Das nenne ich einen Frontalangriff.“ Evas schlechte Laune zerschmolz. „Zu den Männern, die um den heißen Brei reden, gehören Sie offenbar nicht. Leider bin ich heute Abend schon vergeben, aber ich setze Sie gern auf meine Warteliste.“
„Um Gottes willen, gnädiges Fräulein! Sie missverstehen mich. Hätte ich je daran gedacht, mich zu verheiraten, dann könnten Sie gut und gern meine Tochter sein. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen, ehe ich auf mein Anliegen zu sprechen komme: Mein Name dürfte Ihnen nichts sagen, ich bin die notorische graue Eminenz, die im Hintergrund an Fäden zieht. Den meines Klienten haben Sie dagegen mit Sicherheit schon gehört. Sie sprechen mit Hagen Fidelis, dem Agenten von Martin Serner.“
Zufällig war Eva an jenem Tag beim Friseur gewesen. Den Namen Serner hatte sie noch im Ohr. „Ist das dieser Schauspieler, der angeblich aussieht wie ein junger Gott?“
„Er sieht nicht nur so aus“, erwiderte Hagen Fidelis todernst. „Er ist einer.“
„Oha“, machte Eva. „Wenn man Ihnen etwas vorwerfen wollte, dann keinesfalls Tiefstapelei.“
„Im Fall von Martin wäre Tiefstapeln sinnlose Heuchelei“, entgegnete Hagen Fidelis.
Schwul, dachte Eva. Der junge Gott ebenso wie sein possierlicher Agent. Sie hatte gern mit schwulen Männern zu tun, weil die ihrer Arbeit längere Blicke gönnten, ehe sie unweigerlich auf ihren Körper umschwenkten.
„Nach dem Film, um den es mir geht, wird es am Himmel über diesem Land keinen helleren Stern mehr geben als Martin“, fuhr Hagen Fidelis fort. „Zumindest wenn es mir gelingt, den Rahmen zu zimmern, in dem ein solches Talent sich entfalten kann. Das Sujet hat mir eine Suche abverlangt, die den stärksten Mann zermürbt hätte: Semiramis. Sagt Ihnen das etwas? Eine große Geschichte, Fräulein Löbel. Groß genug, um die Welt zu umarmen.“
„Einer von diesen monumentalen Schinken wie Fritz Langs Nibelungen?“, fragte Eva. „Alles auf Effekte ausgerichtet, einstürzende Himmel, verschlingende Ozeane, explodierende Riesenbauten? Tut mir leid, Herr Fidelis. Ich weiß zwar noch immer nicht, was Sie eigentlich von mir wollen, aber ich fürchte, Ihr zermürbend gesuchtes Sujet interessiert mich nicht.“
„Bitte warten Sie.“
Eva glaubte vor sich zu sehen, wie der Nagetiermann sich den Hörer zwischen Ohr und Schulter klemmte und beschwörend die Hände rang. „Semiramis braucht einen Himmel, der einstürzt, damit liegen Sie richtig, aber Sie wollen mir doch wohl nicht erzählen, dass Sie das abschreckt? Ich habe Ihre Bilder gesehen, Gesichter des Wahnsinns. Würde nicht in jedem Gesicht, das Sie malen, ein Himmel einstürzen, hätte ich Sie nicht angerufen.“
Eva war so überrumpelt, dass sie nichts zu erwidern wusste. Sie lebte von den bitterbösen Karikaturen, die sie für die Satirezeitschrift Der Wahre Jakob zeichnete und über die ihre Freunde in hämisches Gelächter ausbrachen. Ihre Gemälde – verwischte Aquarelle und schweres, dunkles Öl – fanden kaum je Erwähnung. Den meisten waren sie zu kompliziert, zu wenig eindeutig für eine Zeit, in der es Plakate brauchte, klare Aussagen, die dem Betrachter ins Gesicht sprangen.
Die Zeichenlehrerin an dem Mädchengymnasium, das ihre Eltern für standesgemäß gehalten hatten, hatte Evas Bilder vor den Augen der Klasse zerrissen. „Du hast nicht aufgepasst“, hatte sie sie getadelt. „Ansonsten könntest du auch so nette Gesichter zeichnen wie Gertrud und Sybille, nicht solche scheußlichen, kaputten Fratzen.“
Eva hatte sich die Lippen zerbissen, um sich keine Blöße zu geben, aber der Druck war zu stark. Unter dem Gekicher der Mitschüler hatte sie um die geschmähten Gesichter geweint. Ich hätte sie nicht malen dürfen, dachte sie. Es ist meine Schuld, dass sie zerrissen wurden und dass jetzt niemand mehr von ihnen weiß.
Einen Menschen, mit dem sie darüber hätte sprechen können, gab es nicht. Ihre Eltern fanden die Bilder ebenso abscheulich wie die Lehrerin. Ihr Vater wollte einmal eines davon mit Reißzwecken an der Wand befestigen, und als Eva schrie, sagte er: „Was machst du für ein Theater um die Krakelei?“ Die Mutter beauftragte ihn, ein Porträt, das Eva ihr zum Geburtstag gemalt hatte, vor den Augen der Tochter in den Abfall zu stopfen.
„Ich habe mich entschieden, meine Kinder nicht zu schlagen“, hatte der Vater gesagt. „Ansonsten bekämst du ein halbes Dutzend Schläge mit dem Rohrstöckchen auf die Hand, die diese Scheußlichkeit verfertigt hat. Du solltest dich schämen, die Schönheit des Menschen zu missachten und deiner lieben Mutter mit diesem Schmutz das Herz schwer zu machen.“
In Wirklichkeit hatte er Eva sehr wohl geschlagen. Mitten aufs Herz, das mindestens so schwer war wie das der Mutter. Und ihren Mut hatte er kurz und klein geschlagen, mit dem sie es gewagt hatte, das Gesicht der Mutter aufs Papier zu bannen: so schön, wie sie es sah, und voll der Achtung, die sie dafür empfand. Ein Gedanke war in ihr aufgeblitzt: Wenn die Mutter starb, wer würde nun, wo ihr Bild zerstört im Abfall lag, noch von ihr wissen?
Nach diesen Schlägen hatte sie sich nicht länger beherzt und mutig gefühlt. Wie konnte sie sich anmaßen, Menschen zu malen, wenn sie mit jedem Strich ihre Schönheit in Scheußlichkeit verkehrte? Wie konnte sie es wagen, das Wunder eines Gesichtes nachzugestalten, wenn es anschließend in Fetzen gerissen oder zerknüllt in den Abfall gestopft wurde?
Sie war schließlich den Lehrern und Eltern davongerannt, war mit siebzehn Jahren mutterseelenallein nach Berlin geflohen und hatte sich an der Kunstakademie in Charlottenburg beworben. „Sie sind begabt“, hatte Professor Breuer, der ihre Bewerbung prüfte, gesagt. „Auch wenn Sie sich mehr ins Zeug legen müssen.“
Peter Breuer galt als der Mann, der den Bildhauern der Berliner Schule den Weg in die Moderne geebnet hatte. Dass eine solche Koryphäe sie für begabt hielt, gab Eva Herz und Mut zurück. Sie legte sich ins Zeug. Hier, wo ihre Bilder vor zerstörerischen Händen in Sicherheit waren, tobten und wirbelten ihre Pinsel gegen die Dummheit der Spießbürger an. Zuweilen aber lähmte deren Macht sie noch immer: Was, wenn sie doch recht hatten? Wenn sie wirklich nicht imstande war, mit ihren Bildern die Erinnerung an Menschen festzuhalten, sondern ihre Schönheit in den Schmutz zog?
Sie ließ es niemanden merken, sondern trat auf, als wären Zweifel ihr fremd. „Eva Löbel strotzt vor Selbstbewusstsein“, behauptete einer der wenigen Kritiker, die ihre Bilder überhaupt erwähnten. „Sie ist forsch und frech wie ihre Karikaturen, aber ihre Arbeiten in Öl und Aquarell sind anders: Die fragile Schwäche der Modelle scheint zu so viel Forschheit nicht zu passen.“
Ich muss so sein, hatte Eva gedacht. Wer schützt die schönen, fragilen Gesichter, wenn nicht meine freche Forschheit, die meine Schwäche tarnt?
Erst an jenem Frühsommerabend, am Telefon mit einem ihr unbekannten Theateragenten, begriff sie, was ihre gemalten Gesichter für die Spießer von Niedernhausen so erschreckend machte: Sie waren nicht scheußlich. In ihnen stürzte ein Himmel ein. Der Agent hatte mit einer Handvoll Worte erfasst, was sie sich seit Jahren vergeblich zu erklären suchte.
„Fräulein Löbel?“, fragte er schließlich leise. „Kann ich Sie für unseren Film gewinnen?“
„Meine Bilder handeln von Menschen“, wehrte Eva ab. „Nicht von Göttern.“
„Semiramis handelt auch von Menschen“, erwiderte der Agent. „Es ist das Epos von Assyriens Königin, die das strahlende Ninive begründete und den Turm von Babel erbauen ließ. Und die doch scheiterte und aus göttlicher Höhe in Abgründe stürzte, als sie sich in einen Menschen verliebte. In Ara, den König von Urartu.“
„Wo ist Urartu?“, fragte Eva.
„Das Reich der Urartäer erstreckte sich am Fuß des Berges Ararat“, erklärte Hagen Fidelis. „Dort, wo Noahs Arche nach der Sintflut auf Land gestoßen sein soll.“
„Ist das in der Türkei?“
„Im Osten von Anatolien“, präzisierte Hagen Fidelis. „Umgeben von Gebirgszügen, die die Assyrer schreckliche Berge nannten, wie Dolchspitzen, die in den Himmel ragen. Das Gebiet gehört heute zur Türkei, das ist richtig. Die wahren Nachfahren der Urartäer sind jedoch die Armenier, die auf diesen hohen Ackerflächen ihre Dörfer hatten, bis …“
„Bis was?“
„Nichts“, sagte Hagen Fidelis. „Vergessen Sie’s. Unser Film spielt vor viertausend Jahren, der hat damit nichts zu tun. Semiramis ist eine der vier Frauen, die die Welt beherrschen. Ihre Macht ist unverwundbar, bis sie vor Ara, dem König der Armenier, steht und seiner Schönheit verfällt. Ihr Leben lang hat sie nach allem, was sie begehrte, nur die Hand ausstrecken müssen, also streckt sie nun die Hand nach Ara aus.“
Insgeheim fand Eva diese Semiramis beneidenswert. Das Paulchen, mit dem sie schlief, war hübsch, noch hübscher als das Hänschen vor ihm, aber wo zum Teufel fand sich Schönheit, der man verfallen konnte?
„Aras Schönheit ist jedoch zerbrechlich“, fuhr Hagen Fidelis fort. „Und Semiramis weiß mit Zerbrechlichkeit nicht umzugehen. Als der Armenierkönig sie abweist, um weiter sein stilles Mädchen zu lieben, überzieht die Rasende sein Land mit Krieg. Mäht sein Volk nieder, lässt Weiber, Kinder, Greise metzeln und am Ende auch den Mann, den sie liebt. Erst als die Götter ihr verweigern, ihn wieder zum Leben zu erwecken, muss sie innehalten und – viel zu spät – lernen, was Demut ist.“
Ein paar Augenblicke lang schwieg er, geradezu lauernd. „Und nun?“, fragte er dann. „Wollen Sie mir immer noch erzählen, dass das kein Stoff für Sie ist, Fräulein Löbel?“
Es war ein Stoff für sie. So sehr sogar, dass sie Angst bekam. „Ich habe keine Ahnung“, behauptete sie. „Was hätte ich denn überhaupt dabei zu tun?“
„Ich brauche jemanden, der die Gestaltung der Filmbauten in die Hände nimmt“, sagte Hagen Fidelis.
„Ich bin kein Bühnenbildner.“
„Der würde mir auch nichts nützen. Leute, die eine Kulisse zusammenzimmern können, habe ich wie Sand am Meer. Was mir fehlt, ist ein künstlerischer Leiter, jemand der imstande ist, eine versunkene Welt zum Leben zu erwecken – beängstigend fremd und zugleich für uns Menschen von heute erkennbar. Und deshalb umso beängstigender. Sie verstehen, was ich meine, nicht wahr?“
Eva war nicht sicher, ob sie verstand, was er meinte, aber sie sah diese Welt bereits vor sich: eine riesenhafte steinerne Welt, aufragende Mauern mit in Stein geschlagenen Gesichtern.
„Stein“, sagte Hagen Fidelis. Er kam Eva vor wie Hanussen, der Gedankenleser in der Scala. „Diese Armenier hauen alles in Stein – Festungen, Bethäuser, Standbilder. In Urartu herrschte der Glaube, die Seele eines Menschen ließe sich in einem Steinbildnis bewahren, und für König Ara schuf der Stein das Bildnis selbst: Der Legende nach faltete sich die Erde auf, wo die weinende Semiramis mit dem Leichnam des Geliebten in die Knie brach, und formte den Berg Ararat. Das ist doch großartig, finden Sie nicht?“
„Allerdings“, entfuhr es Eva. Die Geschichte mochte ein aus mythischen Fetzen zusammengestrickter Unsinn sein, wie die meisten Sujets der neuen Tonfilme, aber das minderte nicht ihre Größe. Dunkle Leidenschaft. Eine Welt, die in Stücke brach, weil Menschen an ihrer Einsamkeit zugrunde gingen. Wenn es überhaupt einen Stoff gab, der für Eva Löbel gemacht war, dann war es dieser.
„So eine Welt will Martin“, fuhr Hagen Fidelis fort. „Überlebensgroß. Steinern. Ewig. Er hat irgendeinen Türken aufgetan, der solche Sachen in Stein haut, nicht nach einem Modell, sondern einfach so drauflos.“
„Direct Carving“, sagte Eva.
„Ganz richtig. Sie kennen sich ja aus. Die Sachen, die dieser kleine Türke macht, sind überwältigend. Wucht und Zartheit in einem, das berührt einen auf ganz seltsame Art. Und nun will Martin von mir, dass ich ihm einen Zauberkünstler auftreibe, der solche Sachen in Filmbauten umsetzt. Was tut man nicht alles für ein Genie? ‚Du willst einen Zauberer von mir‘, habe ich zu ihm gesagt, ‚also finde ich für dich einen Zauberer‘, und voilà, ich habe einen gefunden.“
„Mich?“
„In der Tat“, bestätigte Hagen Fidelis. „Sie haben völlig freie Hand. In Babelsberg stellt die UFA uns ein Außengelände zur Verfügung, auf dem können Sie die gesamte Türkei nachbauen, wenn Sie wollen.“
„Warum beauftragen Sie eigentlich nicht Ihren kleinen Türken damit?“, fragte Eva.
„An den ist kein Drankommen“, antwortete Hagen Fidelis. „Niemand vertritt ihn, niemand weiß, wo er steckt. Am Ende ist er nur ein anatolischer Bergbauernbursche, in dem zufällig diese archaische Begabung schlummert. Unseren Anforderungen wäre der gar nicht gewachsen. Aber Sie wären es, Fräulein Löbel. Wollen Sie ein Engel sein und nach Babelsberg kommen, um sich unser Urartu einmal ohne jede Verpflichtung anzusehen?“
„Ein Engel ist das Letzte, was ich sein will“, gab Eva zurück. „Aber ansehen kann ich es mir, wenn es sich einrichten lässt.“
„Wunderbar!“, jubelte Hagen Fidelis. „Ich schicke Ihnen einen Wagen, der holt Sie in einer Viertelstunde ab.“
„Was, noch heute Abend?“ Eva warf einen Blick zum Fenster. Draußen funkelte Berlins erleuchtete Nacht, und die Scheibe reflektierte ihr erst zur Hälfte geschminktes Gesicht. Sie hatte keine Zeit. Im Schwimmerbassin des Romanischen Cafés wartete Paulchen, ein Fremdkörper zwischen Rauchschwaden, blinden Spiegeln und bunten Vögeln. Er war Akademiker, Professor für Vorderasiatische Archäologie, und unter ihren Künstlerfreunden fühlte er sich wie der sprichwörtliche Storch im Salat. Er kam nur ihretwegen dorthin, und er war ein wirklich netter Mann. Auch wenn die Anziehungskraft schon nachließ, verdiente er nicht, dass sie ihn versetzte.
„Ich hätte diese Sache gern so schnell wie möglich unter Dach und Fach“, drängte Hagen Fidelis.
„Das ist aus Ihrer Sicht verständlich“, entgegnete Eva. „Aber was bringt das mir?“
„Ich schicke den Wagen und zeig’s Ihnen“, erwiderte der Agent und legte auf.
Eva war skeptisch gewesen, geradezu ein Bündel geballter Skepsis, das in den beflissen aufgehaltenen Wagenschlag der Limousine gar nicht erst hatte einsteigen wollen. Wem die UFA seit ihrer Krise vor fünf Jahren gehörte, wusste jeder: Alfred Hugenberg, dem Medienzar, der die Hitler-Partei unterstützte. Ein Mogul mit Buchhaltercharme. Für die Filme, die er bei seiner UFA durchwinkte, hatte Eva nur Verachtung übrig, und wenn ihre Freunde hundertmal schwärmten, der Blaue Engel sei ein Meisterwerk. Wozu also mitfahren, bis hinaus nach Babelsberg? Sollte sie wirklich ihren herzigen Archäologen versetzen, um sich anzusehen, wie ein Möchtegern-Filmgott sich zwischen den Kulissen eines türkischen Bergbauern in Szene setzte?
Sie sah es sich an. Und verliebte sich.
Zuerst in die Fotografien, die Martin Serner in Istanbul von den Skulpturen geschossen hatte. Steinerne Götter, in Felsblöcke geschlagen, schlicht und streng wie aus namenloser Vorzeit, wuchtig im Ausdruck, bedrohlich, allmächtig – und doch mit einem Schmerz in den Zügen, der über Raum und Zeit gültig blieb.
Dann in Martin.
„Das ist unglaublich!“, platzte es aus ihr heraus. „Seit dem verfluchten Krieg versucht ein Bildhauer nach dem anderen zum Ausdruck zu bringen, was dieser Türke einfach so kann.“
Martin Serner blickte von den Fotografien auf. In seinem schönen Gesicht fand Eva keine Selbstverliebtheit, keine Göttlichkeit und kein jugendliches Heldentum, sondern pure Melancholie.
„Sagen Sie mir, was das ist?“, fragte er. „Das, was der Türke kann.“
Eva starrte auf seinen Mund. Dann wieder zu den steinernen Mündern auf den Fotografien. „Schmerz“, sagte sie und erschrak darüber. „Schönheit, die über ihre Zerstörung nicht einmal weinen kann.“
„Röslein auf der Heide“, sagte Martin Serner, ohne den Blick von Eva Löbel zu wenden.
„Wie bitte?“
„Röslein wehrte sich und stach“, zitierte er mit halb gesenkten Lidern. „Half ihm doch kein Weh und Ach. Musst’ es eben leiden.“ Er strich sich über die Stirn, auf der ein wenig Schweiß glänzte. „Danke. Jeder, dem ich diese Bilder zeige, bricht in Ekstase aus: O mein Gott, diese schönen Linien, diese Wucht, diese Kraft, wo kann man denn das kaufen? Sie sind die Erste, die versteht, was ich darin sehe: Schönheit, die verloren ist.“
Von seinem Mund, den sie küssen wollte, blickte Eva wieder auf die steinernen Münder, die sie nicht zu berühren wagte, und verliebte sich in beide.
„Sie wollen, dass ich Ihnen so etwas nachbaue? Für Ihren Film?“
Er nickte. „Diese Götterbilder verfolgen mich, seit ich im Archäologischen Museum in Istanbul auf sie gestoßen bin. Sie sind mächtig, sie sind unantastbar, und doch sehen sie aus, als hätten sie eine Qual erlebt, die Stein im Innern zerbricht. So will ich meinen Armenierkönig: nicht als einfältigen Musterknaben, sondern als Mann, der weiß, dass seine Welt dem Untergang geweiht ist. Und der sich nicht durchringen kann, sich aus ihr zu befreien, weil dann von ihm nichts übrig wäre.“
Ich will mit dir schlafen, hatte Eva gedacht. Martin Serner sah aus wie aus einem Traum aufgeschreckt, und sie wollte mit ihm dorthin zurück.
„Tun Sie’s?“, fragte er.
Sie fuhr zusammen. „Was?“
Flüchtig lächelte er. „Mein Urartu nachbauen. Die Welt, die untergeht.“
Eva überlegte. „Ich bin Malerin“, sagte sie. „Kein Filmarchitekt. Ich habe noch nie eine Kulisse entworfen, aber wenn Sie mir helfen, Ihren Türken zu finden, bekommen wir es vielleicht hin.“
„Ich helfe Ihnen bei allem, was Sie wollen“, sagte Martin Serner. „Ich will, dass Sie das hinbekommen. Ich will, dass Sie bleiben und mich lieben, Eva.“
Es war kein Sommer ohne Probleme. Aber es war der Sommer, in dem sie am wenigsten Fragen stellte. Eva hatte nie einen Liebhaber aufgegeben, nur weil der nächste es von ihr verlangte. Martin verlangte es nicht von ihr – sie gab Paul aus freien Stücken auf. Der Archäologe war der einzige ihrer Männer, der ihr Freund blieb, auch als sie nicht mehr mit ihm schlief.
„Ich sollte es mir wohl als Ehre anrechnen, von einem künftigen Weltstar aus dem Feld geschlagen worden zu sein“, sagte er mit Augen wie ein Bassethund, und damit war das Thema auch schon abgehandelt. Er half ihnen sogar, den Türken zu finden.
„Die kenne ich“, sagte er, als er Martins Fotografien von den steinernen Göttern sah. „Das heißt, ich kenne einen Mann, der so etwas macht.“
„Einen Türken?“
„So ungefähr“, antwortete Paul.
Es war der richtige Türke. Nachdem er die Skulpturen für das Museum in Istanbul fertiggestellt hatte, war er nach England gezogen und nicht bereit, nach Deutschland zu reisen, obwohl die UFA ihm über Hagen Fidelis ein mittleres Vermögen anbot.
„Er hat Angst“, erklärte Paul.
„Wovor?“
„Für seinen Geschmack laufen bei uns zu viele Nazis herum.“
„Für meinen auch“, brummte Martin. „Aber mit denen verfährt man am besten wie mit Schmeißfliegen: Man schenkt ihnen keine Beachtung und lässt sich nicht daran hindern, seinen eigenen Stiefel zu leben.“
Schmeißfliegen erschlägt man, dachte Eva flüchtig. In diesem Sommer aber betrug sie sich genau so, wie Martin gesagt hatte: Sie lag mit ihrem Liebsten im Gras, schenkte Nazis und Schmeißfliegen keine Beachtung, stampfte mit ihm seinen Film aus dem Boden und salbte sich die von der Liebe wundgeschürften Schenkel.
Die Nazis, das war in diesem Sommer ein Haufen Tölpel, über die man sich im Schwimmerbassin, dem rauchblinden Teil des Romanischen Cafés, der Stammgästen vorbehalten blieb, kaputtlachen konnte, wenn man nichts Besseres zu tun hatte. Der erdrutschhafte Zuwachs an Wählerstimmen, den sie bei der Reichstagswahl errangen, war unappetitlich, und gegen ihr Gepöbel in den Straßen musste etwas unternommen werden. Doch das ließ sich auf später verschieben, auf Tage, an denen der Himmel trüber wäre, und auf Nächte, in denen man zwischen tausend Küssen zu Atem käme.
Eva wollte nicht zu Atem kommen. Sie war der Schönheit verfallen wie Semiramis. In den Armen hielt sie einen herrlichen Mann, und im Überschwang nach der Liebe planten sie einen herrlichen Film. Eva war schön, das war ihr nicht neu. Der Sündenfall auf langen Beinen, an dem Männer wie an Fliegenpapier kleben blieben. Nah kam ihr dennoch keiner, weil die wirkliche, die lichtscheue, die ihrer selbst nicht sichere Eva sich nicht in Worten, Mimik und Körperformen verbarg, sondern allein in ihrer Arbeit. Sie verfiel Martin, während ihre Liebe sie in Rausch und ihre Arbeit sie in Ekstase versetzte. Zwischen Liebe und Arbeit verwischten die Grenzen. Martin war der eine, der die ganze Eva bekam – die Eva, die todesmutig genug war, einen Mann zu lieben, und die bei der Arbeit an Semiramis spürte, worum es ihr ging.
Der Türke, der Angst vor den Nazis hatte, konnte auch keine Entwürfe senden. Er fertige gar keine Entwürfe an, ließ er ausrichten, er schlage aus dem Stein, was ihm gerade in den Sinn komme. Alles, was er zu bieten habe, sei ein Haufen Fotografien und Skizzen, die er Kritzeleien nannte und für die er kein Geld wolle.
„Dass wir ihm angeboten haben, diese erstaunlichen Arbeiten zu bezahlen, hat er gar nicht verstanden“, berichtete Hagen Fidelis.
„Sollte es das wirklich geben?“, fragte Martin. „Den edlen, unverbildeten Wilden, der Kunst um der Kunst willen schafft?“
Bei jedem anderen hätte Eva solche Banalität mit einer beißenden Bemerkung kommentiert, doch bei Martin besaßen selbst Plattitüden noch Charme.
„Er spricht immerhin hervorragend Deutsch“, sagte Hagen Fidelis. „Völlig ungebildet kann er nicht sein.“
Ungebildet oder nicht – die Kohlezeichnungen, die der Deutsch sprechende Wilde Kritzeleien nannte, waren phänomenal. Striche wie Schnitte in Glas, Linien, die in harscher Schärfe ein Gesicht ins Blatt ritzten. So ungemildert, dass man glaubte, das Papier müsse Blut lassen. „Er zeichnet gar nicht“, sagte Eva. „Er schlägt in das Papier wie in Stein.“ Die Augen der Kohlegesichter starrten ihr blicklos entgegen.
„Was denkst du?“, fragte Martin, tauchte mit dem Gesicht unter ihr Haar und küsste ihren Nacken.
„Dass dein Wilder ein Genie ist. Und dass er einen Schmerz mit sich herumschleppt, den du und ich uns nicht einmal vorstellen können. So wie einer von den armen Teufeln, die im Schützengraben gelegen haben. War die Türkei im Krieg? Ich bemerke gerade, dass ich davon keine Ahnung habe.“
„Und ich werde eifersüchtig“, säuselte Martin. „Was ist unwiderstehlicher für eine Frau als ein Mann, der leidet?“
Sie drehte sich um und ließ es ihn spüren. „Eifersucht schadet dir gar nichts – Konkurrenz belebt das Geschäft.“
„Dein Wort im Ohr der Göttin, Semiramis. Meinst du, du bekommst es hin? Mein Königreich in Stein?“
Eva sah wieder auf die Zeichnungen. „Wenn ich es nicht versuchen wollte, hätte ich besser auf meinen Vater gehört und wäre Hausmütterchen geworden.“
Sie versuchte es, und es wurde nicht nur gut, sondern großartig. Genau richtig. Als Torpfeiler zum Palast des Armenierkönigs ließ sie zwei drei Mann hohe Gerüste hochziehen und mit Holz und Pappmaschee in steinerne Götterstandbilder verwandeln. Gigantisch, eisgrau, bedrohlich und dennoch gebeugt wie unter Leid und Unverstand der Welt. Auf einer Art Himmelsleiter stand sie in glühender Augusthitze und formte mit klebrigen Händen die Unvergänglichkeit eines Gesichts. Die Skizzen des türkischen Steinbildhauers trug sie dabei im Gürtel, und wenn ein Windstoß ihr die Blätter entriss und zu Boden segeln ließ, stieg sie die endlose Sprossenreihe hinunter und sammelte sie wieder ein.
Nachts zwängte sie sich mit Martin in das schmale Bett ihres Turmzimmers, und kaum kamen sie nach der Liebe wieder zu Atem, steckten sie über den Zeichnungen schon wieder die Köpfe zusammen. Nicht eines der Gesichter lächelte, aber bei mehreren verzogen sich die Münder zu einer Art Grinsen, das Eva als sardonisch bezeichnete.
„Das möchte ich unseren zwei Steinriesen geben“, sagte sie. „Dieses sardonische Grinsen, das nichts Amüsiertes hat, nicht einmal etwas Beißendes, sondern grimmigen Schmerz.“
Aus Martins Asketengesicht verzog sich der Schmelz der Liebe. „Weißt du, warum wir das so nennen: risus sardonicus, sardonisches Grinsen?“
„Nein.“ Eva sah, wie Martins Mund zuckte, und hatte gleich danach den Eindruck, der Mund auf der Zeichnung zucke ebenfalls.
„Angeblich herrschte unter den Ureinwohnern der Insel Sardinien das Gesetz, jeden Alten, der der Gemeinschaft nicht länger von Nutzen war, zu töten. Im Morgengrauen zwang man Söhne und Töchter dazu, ihre Eltern vor die Grenzen der Siedlung zu führen, um sie abschlachten zu lassen. Dabei weinte niemand – weder die greisen Opfer noch ihre Kinder, die sie in den Tod führten. Vielmehr lachten sie. Krampfhaft, grimmig und voller Häme über die eigene Qual.“
Das war es, was sie in den skizzierten Gesichtern des Türken gesehen hatte: versteinerte, zu qualvollem Grinsen verzerrte Münder von Menschen, die im Morgengrauen vor die Grenzen der Stadt zogen und ihre eigene Vergangenheit abschlachten ließen. Sie musste an ihre Eltern in Niedernhausen denken, stellte sich ihren Vater in seinem den Hals umschließenden Hemdkragen vor und ihre Mutter, bei der trotz aller Manierlichkeit ein Fettfleck auf der gestärkten Bluse prangte. Sie dachte an die Schläge, die ihr Vater ihr auf Herz und Mut gegeben hatte, und die verächtlich himmelwärts verdrehten Augen ihrer Mutter.
Am nächsten Tag legte sie alles, was ihr zur Verfügung stand, in den Versuch, den beiden Göttern aus Pappmaschee das sardonische Grinsen zu verleihen, das Mundverkrampfen derer, die ihre Eltern den Mördern ausgeliefert hatten.
Als sie sich völlig erschöpft die Leiter hinunterhangelte, stand Martin an deren Fuß und schloss sie verschmiert, wie sie war, in die Arme. „Ich rechne es mir an, eine solche Doppelbegabung entdeckt zu haben“, sagte er und küsste ihren Scheitel. „Eva Löbel, Meisterin der Liebe und Meisterin der Kunst.“
Das Steinriesentor, die Kulisse für den Film Semiramis, war die erste von Evas Arbeiten, mit der sie rundum zufrieden war. Sie hatte im Bildwerk mehr eingefangen, als sie in Worten hätte formulieren können, hatte ein Werk geschaffen, das klüger war als die Künstlerin. Die sardonisch verkrampften Münder der fremden Götter brachten die Stimme ihres Vaters zum Schweigen.
Sobald die Steinriesen fertig waren, feierte die Schar der Menschen, die an dem Film beteiligt waren, in den langen Abendschatten eine Party. Erich Pommer, der Produzent, der auch den Blauen Engel produziert hatte, schirmte sie vor Hugenbergs Zensoren ab. In jener Nacht ließ er ihnen allen Champagner bringen und nannte die Kulisse, die in den Himmel ragte, einen Triumph, obwohl er sonst kein überschwänglicher Mann war.
„Ich darf Sie einmal küssen, nicht wahr, Fräulein Löbel?“ Staubtrocken wie eine ältliche Tante küsste Hagen Fidelis Eva auf die Wange. Er war kleiner als sie und bleckte die Zähnchen. „Sie haben einen Genius entfesselt, meine Teure. Martin wird in Ihren Bauten spielen, wie die Welt keinen Menschensohn je spielen sah.“
Nicht jeder sprudelte so über wie der kleine Agent, doch das Filmprojekt versetzte alle in einen Höhenflug. Auf dem Gelände herrschte Ausnahmestimmung, die von der Gewissheit herrührte, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Sie wuchsen zu einer Einheit zusammen. In diesen Wochen im Hochsommer 1932 wurden sie unzertrennlich, ob Hauptdarsteller oder Charaktercharge, ob Maskenbildner, Regieassistent oder Kabelträger, ob man sich hitzig liebte oder nichts miteinander anfangen konnte: Sie würden immer die Leute sein, die zusammen Semiramis gedreht hatten. „Weißt du noch, damals in Babelsberg?“, würde ihre geflüsterte Parole lauten, die den Rest der Welt ausschloss.
Im Herbst dann begannen die Dreharbeiten. Längst hatten sie Zeitplan und Budget überzogen, und Erich Pommer hatte schon einmal wegen eines zu teuren Films seine Stellung verloren. Dennoch hielt er ihnen unbeirrt den Rücken frei. Thore Kierling, der künstlerische Beirat der UFA-Geschäftsleitung, der umherscharwenzelte, ohne dass jemandem seine Funktion klar war, schien ihnen ebenfalls wohlgesonnen. „Natürlich liegt unsere babylonische Königin nicht ganz im – wie soll ich sagen – Zeitgeist.“ Wenn Kierling sprach, klang es, als knirsche er zwischen den Worten mit den Zähnen. „Aber Sie haben ja mich, damit es da keine Reibungen gibt. Mit ein wenig gutem Willen auf beiden Seiten werden wir das Kind schon schaukeln.“
Das erste zu schaukelnde Kind waren die weichen blonden Haarsträhnen auf Martins Kopf. Martin wollte sie schwarz. „Der Mann, den ich spiele, ist ein armenischer König“, beschwor er Karin, seine Maskenbildnerin, die der gesamte Stab nur Anna Karenina nannte. „Ein Sohn des Mittleren Ostens – da gibt es nichts Blasses und keine harmlose Blondheit.“
Anna Karenina lachte sich tot. „Wenn ich versuche, dir deine paar Fusseln zu färben, läufst du mit schwarzem Schädel herum wie ein Hottentott.“
Ein wenig gönnerhaft bemühte sich Martin, Anna Karenina zu erklären, dass Hottentott ein Spottname sei und dass die Bewohner der einstigen deutschen Kolonie in Südafrika Koikoin hießen, was so viel wie Mensch bedeute.
„Das ist mir piepegal“, beschied ihn Anna Karenina, die auf mütterliche Weise in ihn verliebt war. „Mit bemalter Kopfhaut kannst du auf keinen Fall rumlaufen.“
„Schlimm genug, dass die sie uns weggenommen haben“, murmelte Ede, der Friseur, den sie sich als Assistenten heranzog. „Die Kolonien meine ich. Als hätte die deutsche Rasse nicht vor allen anderen ein Recht auf Grund und Boden.“ Ede war blutjung, sah aus wie ein Balletttänzer und war hoffnungslos verliebt in John Schultz, den Requisiteur mit der Statur eines Preisboxers. Er war der Einzige im Filmstab, der deutschnational wählte. Alle hätschelten ihn, aber kein Mensch nahm ihn ernst.
„Ich erlaube das nicht“, sagte Martin. „Rassenhass ist ein Zeichen von fehlender Bildung, Ede. Wir drehen hier einen Film über die Auslöschung eines Volkes, wir erzählen diese Geschichte, damit nie wieder ein Volk ein anderes vernichtet, und wie sollen wir diesem Anspruch gerecht werden, wenn wir nicht weiter denken als die Schreihälse der Nazi-Partei?“
„Ach, wirklich?“ Anna Karenina zog Scheitel über Martins Kopfhaut. „Und ich dachte, wir drehen einen Film über eins von den armen Häschen, die ihr kleines Herz an dich verlieren und ihre Welt gleich mit.“
Die Umstehenden lachten. Eva lachte mit und zog den Kopf des stöhnenden Martin aus Anna Kareninas Händen an ihre Brust. „Das eine schließt das andere nicht aus“, sagte sie, ehe sie seinen lichten Schopf küsste. „Wenn Semiramis nicht mehr als ein Liebesgeschichtchen zu erzählen hätte, könnte sich Pommer das Geld für meine zwei Steinriesen sparen.“
Anna Karenina, die Eva zwanzig Jahre Leben voraushatte, nahm ihre Schere und zog die Schneiden über einen Schleifstein. „Das mag alles so sein“, sagte sie. „Aber wenn solch ein Film voller Steinriesen und ausgelöschter Völker nicht auch ein Geschichtchen von Liebe ist – wer soll dann an der Kinokasse seine Piepen dafür rausrücken? Was kratzt mich ein Hansi, der stirbt, wenn’s keine Fritzi gibt, die um ihn heult?“
Martin küsste Eva. All das Gerede in diesem Sommer – hatten sie je länger als zwei Atemzüge darüber nachgedacht?
„Egal, um wen du Sturzbäche heulst, die Haare musst du mir färben“, hatte Martin zu Anna Karenina gesagt. „Ich bin kein Hansi, sondern Ara, der Armenierkönig – ich brauche Düsternis, nächtliche Tiefe!“
Sie alberten weiter, ohne zu bemerken, dass Thore Kierling zu ihnen getreten war. Der besaß dafür ein Talent – sich anzuschleichen, ohne sich bemerkbar zu machen. „Ich bin sicher, Sie werden unsere Zuschauerinnen in Schwarz genauso zum Schmelzen bringen wie in Blond“, sagte er. „Nur ein Anliegen hätte ich, eine klitzekleine Bitte: Dieser nächtlich düstere König, den Sie spielen – muss der unbedingt ein Armenier sein?“
Einige in der Gruppe hielten inne, weil die Frage so unverständlich war. Auch Martin tappte im Dunkeln. „Das Königreich von Ara dem Schönen erstreckte sich über die Vorgebirge um den Berg Ararat“, sagte er. „Das ist nach heutiger Kenntnis nun einmal das Siedlungsgebiet der Armenier.“
„Ja, ja“, beeilte sich Kierling einzulenken, „nach heutiger Kenntnis ganz ohne Zweifel. Aber wann spielt denn unsere Semiramis? Irgendwann in grauer Vorzeit, richtig?“
„Mit ungefähr tausend Jahren vor Christi Geburt liegen Sie ziemlich richtig“, erwiderte Martin.
„Und das Königreich, über das unser Held herrschte – wie hieß das gleich?“ Thore Kierling strahlte wie ein Klassenprimus. „Doch sicher nicht Armenien.“
„Urartu“, sagte Martin.
„Wunderbar“, befand der künstlerische Beirat von Hugenbergs UFA. „Das nehmen wir.“
„Was soll das heißen – das nehmen wir?“
Thore Kierling trat vor ihn und zupfte ihn an der Hemdbrust, als sei er so schwul wie Ede, der Friseur. „Tun Sie mir einen Gefallen, mein Guter: Wenn die Wochenschauen und Hochglanzmagazine ihre Fragen stellen, erzählen Sie denen, Sie seien der schöne König von Urartu. Lassen Sie feurige Blicke sprechen. Erwähnen Sie einfach das Wort Armenien nicht, und diesen Berg verschweigen Sie am besten auch.“
Das war eine leichte Übung: Worte verschweigen, mit denen man keinerlei Bedeutung verband. Die Mannschaft hielt sich an Kierlings Bitte und vergaß den Vorfall.
Szene für Szene wurde der Film abgedreht, und Szene für Szene wuchs die Begeisterung. „Wir sind Götter!“, rief Renée Vasari, die die Semiramis spielte und von der Eingeweihte glaubten, sie habe das Zeug, der Dietrich den Rang abzulaufen. „Und du bist ein Schatz und teilst deinen Martin mit uns, habe ich recht? So ein Herzblatt darf man doch nicht für sich allein behalten wollen.“ Schnalzend drückte sie Eva einen Kuss auf die Lippen. Sie sah zwar aus wie Carmen oder Francesca da Rimini, aber Männer küsste sie nur vor der Kamera. In ihrer Garderobe lag Die Freundin, eine Zeitschrift für Frauen, die Frauen liebten. „Zu schön fürs Treusein seid ihr doch beide – unser Martin und du, mein Schätzchen.“
Über Treue hatte Eva nie nachgedacht. Sie hatte keinen Grund dafür gehabt und war nicht sicher, ob sie jetzt einen hatte. Im November, als es noch ein paar klare Nächte gab, brach der Lattenrost ihres Bettes im Turmzimmer. Martin lachte, versprach, einen neuen zu kaufen, und vergaß es. Im Dezember, als der Film abgedreht war und es nur noch regnete, stellte sie fest, dass sie schwanger war.
3
Amarna
London. Januar 1938
Ich bin eine glückliche Frau, dachte Amarna, drängte sich zwischen Körpern in Wintermänteln hindurch und sprang aus dem Bus. Ich habe keinen Grund für flaue Gefühle im Bauch, sondern habe alles, wovon andere träumen. Den Beruf, den ich wollte und noch immer will. Das schönste Haus der Stadt. Und eine solche Sehnsucht nach dem Mann, der es mir geschenkt hat, dass ich jeden Abend auf dem Heimweg rennen muss.
Sehnsucht nach ihrem Mann – das waren Bilder, die sich allzu schnell übereinanderlegten, wie bei einem Album, das jemand in Eile durchblätterte, und bei jeder Seite wollte man rufen: Halt an, halt doch bitte nur einmal an! Die Sehnsucht aber begnügte sich nie mit dem Betrachten. Sie wollte zugreifen und war tief enttäuscht, wenn sie an der Oberfläche der Bilder, die keinen Duft verströmten, abglitt.
Amarna war Archäologin und arbeitete für das Middle East Department des British Museum. Ihr Haus stand am Regent’s Canal, in der übersprudelnden Mitte von Londons Osten: Es war ein einstiges Lagerhaus, das ihr Mann nach dem Traumbild in seinem Kopf restauriert hatte. Seit sie vor bald sechs Jahren in dieses Land gekommen waren, hatte er alles getan, um den perfekten Briten aus sich zu machen. Er trug Tweed und schlang seine Krawatten zum Windsor-Knoten, schnitt sein Haar und seinen Rasen und ging samstags mit den Nachbarn zum Cricket. Nur das Haus war nicht britisch. Es war das Haus aus seinem Kopf.
Unterm Laufen zog sich Amarna die Kapuze ins Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Seit die Skulpturen ihres Mannes und sein leerer Sockel in der Royal Academy of Arts ausgestellt waren, sprachen sie auf der Straße ständig Leute an: „Sind Sie nicht die Frau von Arman Artsruni? For heaven’s sake, Kindchen, wissen Sie eigentlich, wie sehr wir alle Sie beneiden?“
Ja, weiß ich, zischte Amarna in Gedanken den Sprecherinnen zu. Ich beneide mich selbst, auch ohne Kind, und das flaue Gefühl im Bauch rührt nur daher, dass zwei Männer im Bus ein Wort benutzt haben, das mir auf den Magen schlägt. Sie rannte schneller. Flimmernde Straßenlaternen färbten die Dunkelheit gelb. Menschen hasteten ihr entgegen und wichen erst kurz vor ihr aus. Kein einziger trödelte, alle hatten es eilig. War denn niemand einsam in dieser Stadt, hatte jeder einen Liebsten, der auf ihn wartete?
Als sie damals angekommen waren, am Parkeston Quay von Harwich, hatte Arman sich all ihr Flüchtlingsgepäck auf die Schultern geladen und war die Rampe des Schiffes hinuntergerannt. Amarna hatte zu lachen versucht: „Warum hast du es denn so eilig?“
„Ich will nach London.“
„Und warum so schnell? In London wartet doch kein Mensch auf uns.“
Sie waren beide verstummt, weil der Satz so wehtat. Auf sie wartete kein Mensch. Sie waren fremd. Ich werde dieses Gefühl nie wieder haben, sagte Amarna zu sich. Ihr Haus kam in Sicht. Es war uralt, riesengroß und im Winkel an den Hang gebaut, der hinunter zum Kanal führte. Es war ein stilles Haus in einer Stadt, in der es nie still war, und wer immer es betrat, fragte Arman, ob er es nicht verkaufen wolle.
„Es gehört meiner Frau“, erwiderte Arman gleichmütig, doch in Wahrheit war das Haus womöglich noch mehr sein Werk als jede seiner gefeierten Skulpturen. Es war untrennbar von ihm wie sein leerer Sockel.
Im überfrorenen Uferschlamm glitt Amarna aus und rutschte die letzten paar Schritte. Durch das Glas in der Vordertür fiel das Licht wie eine Hand, die einen in den Schutz des Hauses winkte. Die Tür schwang auf, ehe Amarna läuten oder ihren Schlüssel aus der Tasche fischen konnte. Ein winziger Greis mit weißer Mähne stand vor ihr, Hemd und Weste umschlossen einen Körper wie aus Glas. „Sevgilim.“
Mein Liebling.
Er hieß Bülent. Amarna nannte ihn ihren Schwiegervater, kayınpeder, obwohl Armans leiblicher Vater tot und verscharrt war. Sie hielt ihn im Arm, wie man einen Vogel in der Hand gehalten hätte: Zärtlich und beherrscht, um den fragilen Knöchlein keinen Schaden zuzufügen. Arman dagegen war recht groß für einen Mann seines Volkes und hatte hübsche, kräftige Schultern. Manchmal mischte sich in Amarnas Verlangen nach ihm dennoch der Wunsch, auch mit ihm so behutsam zu sein, die gleiche Furcht, allzu Zartes zu verletzen.
„Alles gut, sevgilim?“, fragte Bülent.
Ihr Nicken war eine Lüge. Einen zerbrechlichen Greis zu lieben, half dem flauen Gefühl im Bauch nicht ab, sondern heizte es an. Bülent war nicht nur zerbrechlich, er war ein Greis, der seine Heimat verloren hatte und dem somit die ständig lauernde Furcht des Flüchtlings innewohnte. Nachts schlief er schlecht, weil er noch immer von Männern in Uniformen träumte, die mit Schlagstöcken an seine Tür hämmerten, um ihm Arman wegzuholen.
Amarna drückte ihn fester.
„Au weh“, jaulte er. „Willst du mir die Rippen brechen, du verrücktes Mädchen?“
Sie küsste ihn auf den Flecken nackter Kopfhaut, den das Alter in sein wattedichtes Haar gegraben hatte. „Arman?“, murmelte sie.
„Oben“, erwiderte Bülent und wies zur Decke.
„Hat er gegessen?“
Betrübt schüttelte der Greis den Kopf. „Einen Rüffel hat er von mir schon bekommen, aber der hat nichts bewirkt. Er braucht einen von dir.“
„Der bewirkt auch nichts.“ Sie gab ihm noch einen Kuss. Das flaue Gefühl in ihrem Bauch verstärkte sich weiter.
„Wie steht es bei dir, sevgilim?“
„Ich habe im Museum gegessen.“
Das war noch eine Lüge. Sie hatte mit Wally gegessen, doch Bülent so etwas zu erklären, war vergebliche Liebesmüh. Er mochte winzig sein, aber er war ein Adler. Sobald er fürchtete, jemand könne seinem Findling ein Leid zufügen, hackte er mit seinem scharfen Schnabel zu.
„Ihr solltet zusammen essen“, knurrte er. „Wenn du dich mit ihm an den Tisch setzen würdest, könntest du ihm auf die Finger sehen.“
„Und was soll das nützen? Davon, dass ich ihm zuschaue, wie er drei Gabeln voll Gemüse säuberlich von einem Tellerrand zum anderen schiebt, bekommt er nichts in den Bauch.“ Sie sah Arman gern zu, wenn er etwas säuberlich mit seinen Fingern erledigte, doch beim Essen war es pure Qual.
Bülent rollte seine zierlichen Schultern. „Da, wo wir herkommen, setzen sich Mann und Frau nun einmal miteinander zu Tisch. Ihm würde das guttun, gerade jetzt, wo er so viel nach da draußen muss. Das da draußen, das ist nichts für Arman, weißt du?“
Das da draußen war London, das Bülent unheimlich bleiben würde, auch wenn er seit bald sechs Jahren hier lebte. Dass Arman in der vor Menschen wimmelnden Metropole Istanbul, die damals noch Konstantinopel geheißen hatte, geboren worden war, ignorierte er. Für ihn war er der Sohn, also musste auch er aus einem anatolischen Dorf namens Boğazköy stammen, in dem jeder jeden kannte und jeder gewusst hatte, dass der bis aufs Blut geprügelte Zwölfjährige, den er in sein Haus gezerrt und zurück ins Leben gepflegt hatte, kein muslimischer Türke war. Boğazköy, wo jeder ihn angespuckt, mancher ihn getreten und geschlagen, aber niemand ihn verraten hatte.
Arman hatte nach London gewollt. In eine Stadt, in der er seinen Namen nennen konnte und die Leute seufzten: „Wie exotisch.“ Sonst nichts.
„Für die Kleine wär’s auch besser“, sagte Bülent.
„Die Kleine heißt Rehan und ist ihrem Pass nach sechsundzwanzig Jahre alt.“
Bülents Schultern rollten erneut. „Was juckt mich ihr Pass? Sie ist ein Kindchen.“
Dagegen ließ sich nichts einwenden. Rehan war ein Kind und würde immer eines bleiben. Eins von den sogenannten Todesmarsch-Kindern, das Arman aufgelesen und zu seiner Schwester erklärt hatte. Arman litt an einer Störung der Impulskontrolle: „Was ich will und nicht habe, stehle ich mir.“ Von all dem, was er nicht hatte, wollte er nichts so sehr wie eine Familie.
Amarna zauste Bülents Wattehaarmähne. „Ich gehe nach oben, ja?“
„Es ist doch alles in Ordnung mit euch, sevgilim? Es geht euch doch gut?“
Hastig nickte sie und löste sich von ihm. Es war alles in Ordnung. Es ging ihnen gut. Sie lief die drei Treppen hinauf bis unters Dach. Als sie die Tür ihres Schlafzimmers, das sich über den gesamten Dachstuhl erstreckte, aufstieß, ging es ihr sekundenlang so gut, wie es einer Frau nur gehen konnte.
Ihr Schlafzimmer war der letzte Raum im Haus, den Arman hergerichtet hatte. Arman verlieh Stein eine Seele, das war sein Beruf, und die Seele ihrer Liebe hatte er diesem Raum verliehen. Der Raum war weit, schmiegte sich in den Schutz schräger Wände, duftete nach Holz und besaß ein Fenster in den Himmel. Das Fenster ließ Arman fast immer offen, obwohl er noch schneller fror als Amarna und beim Arbeiten auf ewig kalten Sohlen barfuß ging.
Das Licht im Zimmer ergoss sich nicht im Schwall, sondern bildete Inseln. Auf dem Bett, das sie teilten, lagen gewebte Decken, zu beiden Seiten stapelten sich Bücher, und an Balken an den Wänden hingen ihre Kleider. Keine Schränke, weil Arman Amarnas Kleider gern ansah und seine Nase hineinsteckte. Amarna sah Armans Kleider auch gern an, legte sich seine Hemden, die er auf der Haut trug, aufs Gesicht, und strich über die Beulen, die seine Schultern in die Jacketts bohrten. Sonst gab es kaum Möbel. Nur das Grammofon, ein eisernes Tischchen für Wein und Gläser, auf dem Arman ein Mosaik restaurierte, und die Staffelei, die er zum Zeichnen benutzte.
An der Staffelei stand er auch jetzt, sein geschmeidiger Rücken Amarna zugewandt. Als sie eintrat, unterbrach sein Kohlestift den Strich, und er drehte sich um. Er hörte schlecht, aber sie hörte er. Was sich über sein Gesicht legte, war schmeichelhafter als jedes Kompliment. Als hätte einer, der seine Tür verschlossen hielt, sie eingeladen, sein Herz zu betreten.
Ich will dir entgegenlaufen, Arman. Wir sind jetzt beide über dreißig, wir führen seit bald sechs Jahren unser Leben zusammen, und wir schlagen uns dabei nicht schlecht. Ich bin kein verliebtes Mädchen mehr, aber für dich, im gedämpften Licht, mit deinem Leuchten im Gesicht, das nie ganz Lächeln wird, will ich noch immer eines sein. Du alterst wie Wein. Ich will dir entgegenlaufen wie damals in Hattuša. Wir beide, als hätten wir nichts vor und nichts hinter uns.
„Amarna“, sagte er.
„Nein“, sagte sie und blies ihm einen Kuss zu. „Unterbrich nicht.“
Er schob sich den Kohlestift in die Hosentasche und kam zu ihr. Das war Nachhausekommen. Sein Duft. Sein Hemd, aus dessen Kragen er die Nadel entfernte, sobald er hier oben allein war. Seine Umarmung, in der sie dachte: Alle Männer sollten Steinbildhauer sein. Arme, an denen noch der schmalste Muskel fühlbar war, Hände, die nicht streicheln konnten, ohne einer Form nachzuspüren. Ich will mit dir schlafen, Arman. Er küsste sie mit trockenen Lippen, sie streichelte ihm den Rücken und ertastete, wie weit er von ihr entfernt war.
Etwas in ihrem schönen Mann war ohne Ruhe. Etwas in diesem Heimatlosen, der sich nichts mehr gewünscht hatte, als sesshaft zu werden, schlug keine Wurzeln. Der einzige Überlebende streunte haltlos durch Leere. Manchmal nahm sie ihn so fest in die Arme, dass es ihm wehtat, damit er sie spürte. Er aber starrte an ihr vorbei und gab keinen Laut von sich.
Einmal, ganz am Anfang, hatte sie zu ihm gesagt: „Ich will dich nicht unter einem Schleier von Traurigkeit lieben.“
Er hatte sie losgelassen. „Und wenn es nicht anders geht?“
Dieselbe Antwort wie damals hätte sie ihm heute noch einmal gegeben: „Dann doch.“
Sie schob ihn von sich. „Zieh Leine, Herr Artsruni. Mach, dass du an deine Staffelei kommst.“
Er wölbte die Brauen. „Ich muss nicht …“
„Und ob du musst.“ Amarna lachte und verpasste ihm eine Reihe von zarten Stößen vor die Brust. „Nun geh schon. Ich kann warten.“
„Bist du sicher?“ Noch einmal zuckte eine seiner Brauen, doch die Finger tasteten bereits nach dem Kohlestift. „Wie war dein Tag?“
„Der kann auch warten“, sagte Amarna. Ihr Tag war Arbeit gewesen, auf die sie sich gern besser konzentriert hätte, ein Gespräch mit Wally und ein flaues Gefühl im Bauch. Wenn sie darüber sprechen wollte, brauchte sie ihn nahe bei sich. „Kümmere du dich um deine Zeichnung. Ich sehe dir so lange zu.“
Sie sah ihm liebend gern zu. Er wusste Kleidung zu tragen, auf den Leib geschneiderte Gesellschaftsanzüge wie verlotterte Hemden für Ziegenhirten, wirkte selbst in Unterwäsche noch elegant, unnahbar und unverschämt zugleich. Beim Zeichnen wippte er auf nackten Sohlen, und unter den Hosenbeinen spannten sich die Schenkel.