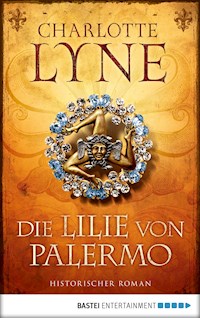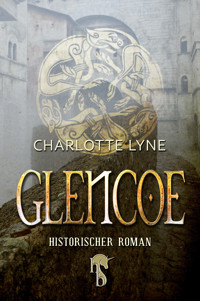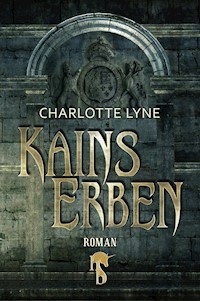6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Mündung des Flusses Deben liegt in der rauen und düsteren Marschlandschaft Suffolks. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte hier auf Hengist Hall die Familie Treyane. Rund um das heute heruntergekommene, verlassene Herrenhaus spielten sich Tragödien ab, die nie komplett aufgeklärt wurden, in den Legenden aber noch präsent sind. Die junge Archäologin Iris aus London soll in der Nähe Grabungen leiten, in Sutton Hoo, dem Mekka angelsächsischer Forschung. Als sie versucht herauszufinden, warum ihr Kollege Caleb die Leitung plötzlich aufgegeben hat, stößt sie auf eine Mauer des Schweigens, entdeckt dann aber, dass er von Hengist Hall ebenso fasziniert ist wie sie. Gemeinsam kommen sie Familiengeheimnissen auf die Spur, die Vergangenheit und Gegenwart verbinden, auch ihre eigene …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charlotte Lyne
Das Haus an der Mündung
Roman
Dieses Leben des Menschen erscheintfür nicht mehr als einen Augenblick.Was ihm folgt oder was ihm vorangeht,wissen wir nicht.
Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum
Prolog
Orford, Suffolk, März 1903
„Kommt zurück!“, schrie Me-Me so laut, dass ihre Lungen schmerzten, „Theo, Fabia – kommt zurück!“
Wie von selbst verfiel sie ins Laufen. Der enge Rock zwang sie zu winzigen Schritten und der feuchte Sand blieb ihr an den Absätzen kleben. So langsam, wie sie vorankam, würde sie die beiden nicht einholen, ehe die schaumigen Klauen des Flusses sie erfassten. Me-Mes zwei ältere Kinder waren für gewöhnlich brav und wussten, dass sie sich im Mündungsgebiet bei den Erwachsenen zu halten hatten. Theodore, ihr Sohn, war viel zu zart für einen Jungen von sechs Jahren; er fror leicht und hielt sich am liebsten im Haus auf. Fabia hingegen war stämmig und kräftig, doch sie war ein gehorsames Mädchen und tat, was man ihr sagte.
Nicht so heute. Fabia stürmte voran und der Bruder folgte ihr auf das tief ins Land gegrabene Bett zu, in dem der Fluss sich dem Meer entgegenwarf wie eine sittenlose Frau. Me-Me schrie noch einmal ihre Namen, doch je näher sie dem tosenden Wasser kamen, desto hoffnungsloser wurde ihr Versuch, gehört zu werden.
Der Wind schlug ihr ins Gesicht. Gleich würde ihr Junge, ihr schwächlicher einziger Sohn, dem Ufer so nahe kommen, dass die reißenden Kräfte des Wassers seinen Körper packen und mit sich zerren konnten. Hatten sie ihn einmal erwischt, so war er verloren. Me-Me konnte nicht schwimmen, und selbst jemand, der es gekonnt hätte, wäre gegen die Gewalt, mit der es den Fluss zum Meer trieb, machtlos gewesen.
Ihr kleiner Junge würde auf die endlose Wasserfläche hinausgeschwemmt werden, von ihm würde nichts bleiben, so als hätte es ihn nie gegeben. Fabia, die voranlief, würde es noch vor ihm erwischen. Sie war nur ein Mädchen und weder das einzige noch das wertvollste, aber sie war dennoch Me-Mes Kind, unter Schmerzen empfangen, unter Schmerzen geboren – wie durfte das seelenlose Meer sie einfach fortreißen?
Hatte Me-Me nicht genug Furcht durchgestanden, mehr als ein Menschenherz ertragen konnte? Nacht für Nacht hatte sie wach gelegen, neben sich Felicity, ihr Herzenskind, ihre Jüngste, deren Atemzüge klangen, als hingen die winzigen Lungen in verrosteten Ketten. Das kleine Mädchen hatte die Bräune. Ihr zarter Hals war geschwollen, das Gesicht unkenntlich verzerrt. Ihre Geschwister durften nicht zu ihr, weil die Krankheit wie ein Lauffeuer von einem zum anderen sprang. Auch Me-Me hatte Dr. Albingham den Umgang mit der Kranken verbieten wollen: „Überlassen Sie das der Pflegerin, Mylady. Diese Krankheit ist eine Mörderin und Sie werden hier noch gebraucht.“
Sie hatte ihn angeschrien: „Wie können Sie so mit mir reden? Soll ich etwa zulassen, dass die Mörderin mein süßes Zauberkind bekommt?“
Er hatte sie grob an den Schultern gepackt. „Was wollen Sie? Einen Handel mit Gott abschließen, ihm Ihr Leben für das der Kleinen anbieten? Dann gehen Sie zu Vater Elias. Für Handel mit Gott besitze ich keine Befugnis.“
Vater Elias hatte Me-Me getraut, wie ein Viehhändler ein Zicklein dem Schlachter verkauft. Er war der Letzte, zu dem sie hätte gehen wollen, aber ihren Handel mit Gott hatte sie trotzdem geschlossen. Sie war bei der todkranken Felicity geblieben und hatte nächtelang gebetet: „Allmächtiger Gott, wenn du mein Kind rettest, rette ich eines von deinen.“ Dass die Waisen und kleinen Bettler Gottes Kinder waren, hatte die Großmutter ihr beigebracht. „Herr im Himmel, nimm mir nicht mein Liebstes, ich habe doch sonst nichts, was mich hält! Wenn du sie mir lässt, rette ich das erste deiner Kinder, das du mir vor die Füße wirfst.“
Damals, in der Nacht vor ihrer Hochzeit, hatte sie auch zu Gott gefleht, doch nichts war geschehen. Diesmal aber schien der Allmächtige sich zu erbarmen. Eines Nachts wachte sie auf und stellte mit einem Blick auf die Standuhr fest, dass sie vier Stunden lang geschlafen hatte. Neben ihr lag Felicity, die schweißnassen Löckchen auf ihrer Wange getrocknet. Ihr Atem ging ruhig. Am Morgen sah Dr. Albingham ihr in den Hals und sagte: „Sie wird lange brauchen, um auf die Beine zu kommen. Aber sie wird gesund.“
Me-Me, die seit ihrer Hochzeit geglaubt hatte, von Gott verlassen zu sein, hatte sich jäh unverwundbar gefühlt. Ihr Kind war gerettet, es würde ihr bleiben. Was konnte ihr noch geschehen?
Und jetzt rannten ihre anderen Kinder, an die sie während Felicitys Krankheit kaum gedacht hatte, auf den Fluss zu, den der Wind ins Meer peitschte. „Theodore!“, rief sie über das flache Grasland hinweg. „Fabia!“ Die Kinder hörten sie nicht und rannten weiter: Theo, dem der Wind die Kappe vom Kopf riss, und Fabia mit fliegenden Röcken. Gleich kamen sie an die Stelle, wo das Ufer abschüssig wurde und die Füße im feuchten Sand ins Gleiten gerieten. Theo rutschte und stürzte. Fabia schloss zu ihm auf und fiel ebenfalls in den Sand.
Me-Me rannte, wie sie noch nie im Leben gerannt war. Das hohe Schilfgras zerschnitt ihr die Strümpfe, der Schlicksand gab nach und brachte sie zum Straucheln. Als sie den Kopf hob, sah sie noch immer die Silhouetten ihrer Kinder, die sich aus dem dunstigen Zwielicht schälten. Sie knieten am Boden, zwischen sich etwas Schwarzes: ein totes Tier oder ein Büschel Treibgut.
Heftig atmete Me-Me auf. Ihr Lauf verlangsamte sich, bis sie in Schritt fiel. Theo und Fabia waren nicht fortgerannt, weil eine tückische Macht sie zum Wasser zog, sondern weil sie am Ufer dieses Etwas entdeckt hatten. Alles war gut, sie würden im Sand sitzen bleiben, bis ihre Mutter kam und sie außer Gefahr brachte. „Theodore, Fabia!“, rief sie, sobald sie nahe genug war, um gehört zu werden. „Geht von dem Ding weg, fasst es nicht an!“ Der Gedanke an einen Tierkadaver ließ Me-Me schaudern. Ihre Kinder konnten davon krank werden.
Theo und Fabia wandten die Köpfe.
„Kommt hierher“, rief Me-Me und blieb stehen. „Zu mir.“ Alles in ihr sträubte sich, weiterzulaufen, als ginge ein Unheil von dem schwarzen Ding aus, das reglos im Sand lag. Theo und Fabia waren ängstliche, folgsame Kinder, aber heute widersetzten sie sich und blieben hocken. Schlick und Uferschilf waren feucht, womöglich überfroren. Sie würden sich erkälten. „Wollt ihr wohl gehorchen?“, rief Me-Me. „Lasst das liegen, ein totes Tier fasst man nicht an.“
Theo öffnete den Mund, sagte aber nichts und rappelte sich auf. Seine Schwester saß noch immer am Boden. „Es ist kein Tier, Mutter!“, rief sie entrüstet. „Es ist ein Mensch!“
Me-Me zwang sich, weiterzugehen. Im Schritt betrachtete sie ihre ältere Tochter, die derb und sommersprossig war, wie ihrem Vater aus dem Gesicht geschnitten. Sie sah kein bisschen hübsch aus und vermutlich gab es im ganzen Haus keinen Menschen, der über sie nachdachte, doch in diesem Augenblick fand Me-Me sie reizend. Ihre Augen blitzten. „Es kann doch kein Mensch sein, Fabia.“
„Und ob es einer ist, und ob und ob!“
Der Wind begann zu brüllen und das Tosen des Wassers rauschte Me-Me in den Ohren. Sie trat vor ihre Tochter und gab ihr einen Wangenstreich. „Jetzt rede nicht frech daher, sondern komm.“
„Mutter“, murmelte Theo so leise, dass es unter dem Gebrüll der Naturgewalten kaum zu hören war.
Me-Mes Blick fiel auf das Ding am Boden. Schwarz war nur das Haar, das durchnässt um den Kopf klebte. Der Körper war winzig, nicht mehr als bleiche Haut und Knochen, die Kleider in Fetzen, die dürren Arme und Beine nackt. Ein totes Kind, das der Fluss heraufgespült hatte wie den Wilden Mann, von dem die Leute im Dorf sich ihre Schauergeschichten erzählten. Ihr wurde übel. Sie packte ihre Kinder und wollte davonlaufen, zurück ins Haus, um so zu tun, als wäre nichts geschehen.
Aber das tote Kind war kein wilder Mann aus finsterer Zeit, sondern ein Mensch, der nach Christenart bestattet werden musste. Auf einmal hallten ihr die Worte ihres Versprechens in den Ohren: Herr im Himmel, wenn du mir meine Kleine lässt, rette ich das erste deiner Kinder, das du mir vor die Füße wirfst.
Und wenn sie es nicht rettete? Wenn sie dieses arme Körperchen nicht aufhob und dafür sorgte, dass es ein Grab erhielt – würde die Krankheit erneut nach Felicity greifen, würde sie stattdessen ihrer Tochter ein Grab bereiten müssen?
Sie hatte keine Wahl. Mühsam bückte sie sich und drehte das Gesicht zur Seite, während ihre Hände in Handschuhen nach dem ausgemergelten Leichnam tasteten.
„Wir nehmen ihn mit“, sagte Fabia. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
„Lauft voraus“, forderte Me-Me die Kinder auf. „Ich bringe es zu Vater Elias, der für ein Begräbnis sorgen wird.“ Sie unterdrückte ein Würgen und hob das nasse, fast gewichtslose Bündel in die Höhe.
„Er ist kein Es“, sagte Fabia und vertrat ihr den Weg. „Er ist ein Junge und er braucht kein Begräbnis. Wir müssen ihn mit nach Hause nehmen.“
Erster Teil
Iris
London, Mai 2012
1
„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“, sagte Iris, schaltete den Projektor aus und klappte die Mappe mit ihren Unterlagen zu. „Ich hoffe, dieser Einblick war interessant für Sie. Und wenn Sie das nächste Mal dem Helm von Sutton Hoo einen Besuch abstatten, verwenden Sie vielleicht einen Gedanken auf die Männer und Frauen, denen seine Rettung zu verdanken ist.“
Die kleine Schar von zehn, zwölf Zuhörern spendete höflich Beifall, ehe sie sich zerstreute. Vermutlich würden sie den Helm von Sutton Hoo als „gesehen“ abhaken und zur nächsten Attraktion weitereilen, dem Stein von Rosette oder der Statue von der Osterinsel. Iris entfuhr ein Seufzen. Wie gern hätte sie ihre Begeisterung für dieses Fundstück aus versunkener Zeit den Besuchern vermittelt! Sie war Archäologin geworden und hatte sich auf das Frühmittelalter spezialisiert, weil das Leben der Angelsachsen sie von klein auf faszinierte. Seit sie als Sechsjährige mit ihrem Großonkel das Schiffsgrab von Sutton Hoo besucht hatte, kam es ihr vor, als wäre diese geheimnisvolle Welt ein Teil ihrer selbst.
Solange sie denken konnte, hatte sie sich eine große Familie, einen verzweigten Stammbaum und fest verankerte Wurzeln gewünscht. Stattdessen war sie nach der Trennung ihrer Eltern allein mit ihrer Mutter aufgewachsen und außer einer mürrischen zweiundneunzigjährigen Großmutter, die mit ihrem Bruder in Essex lebte, hatten keine Verwandten existiert. Jener Bruder aber war mit ihr nach Sutton Hoo gefahren und hatte ihr die versunkene Geschichte ihres Volkes als Ersatz geschenkt.
Hinterher hatte er ihr im Souvenirshop der Anlage eine kindgerechte Ausgabe der Historia ecclesiastica gentis Anglorum, der Kirchengeschichte des englischen Volkes gekauft, die sie noch immer besaß. Dieses vielleicht erste Geschichtsbuch Englands hatte der angelsächsische Benediktinermönch Beda Venerabilis im 8. Jahrhundert verfasst, und mit ihm hatte Iris’ Liebe zu dieser lange entschwundenen Epoche begonnen. „Das Leben des Menschen währt nur einen Augenblick“, hatte Beda Venerabilis geschrieben. Sich mit Geschichte zu beschäftigen, bedeutete für Iris, diesen Augenblick in ihren Händen festzuhalten.
Sie gab sich alle Mühe, etwas von dem Zauber an ihre Zuhörer weiterzugeben und ihnen deutlich zu machen, dass jenes fast vergessene Zeitalter der Angelsachsen so etwas wie die Geburtsstunde ihrer eigenen Kultur darstellte. In einem halbstündigen Vortrag, bei dem es nicht einmal Sitzplätze gab, war das jedoch kaum möglich. Wer nicht länger stehen konnte, zog weiter und vergaß den Helm von Sutton Hoo.
Seit Beginn des Jahres hielt Iris diese Galerievorträge im angelsächsischen Saal des British Museum, und inzwischen hatte sie ihre Arbeit gründlich satt. Aber Stellen für Archäologen waren dünn gesät, und wenn sie das Traumhaus halten wollte, das sie und Gareth gekauft hatten, musste sie nehmen, was immer sich ihr bot. Gareth stöhnte ohnehin, weil auf ihm die finanzielle Hauptlast lag. Im Gegensatz zu ihr hatte er bezweifelt, dass die Anschaffung eines Lagerhauses aus dem 18. Jahrhundert eine vernünftige Entscheidung war. „Das schaffen wir schon“, hatte Iris seine Bedenken beiseitegewischt. Sie hatte sich in das Haus verliebt wie in Gareth – auf den ersten Blick. Wo er Mängel und Schwächen sah, sah sie Potenzial.
Das änderte nichts daran, dass das Haus Unsummen verschlang und sie beide inzwischen recht zermürbt waren. Gareth hatte vorgeschlagen, Iris solle sich nach fachfremder, besser bezahlter Arbeit umsehen, aber das kam für sie nicht infrage. Sie hatte um diesen Beruf gekämpft, sie musste an ihm festhalten, oder es würde ihr nie gelingen, darin Fuß zu fassen. Also blieb ihr nichts übrig, als weiterhin gähnenden Museumsbesuchern Vorträge zu halten. Es gab Schlimmeres. Die aufregenden Grabungen, mit denen sie ihre Laufbahn begonnen hatte, waren nun einmal kostspielig und fanden nicht häufig genug statt, um das Heer der Archäologen zu ernähren. Sie packte ihre Sachen zusammen und machte sich daran, den Projektor aus dem Saal zu rollen.
„Ah, Irene. Gut, dass ich Sie noch erwische.“
Iris blickte auf und sah Andrew Sterne, den Kurator der Abteilung, im Durchgang lehnen. „Iris“, verbesserte sie und fragte sich, warum sie sich die Mühe machte. Der Mann verdrehte ihren Namen, solange er sie kannte.
„Ach, natürlich. Iris. So schnell, wie hier inzwischen die Gesichter wechseln, kann man sich die Namen dazu kaum noch merken. Versöhnt es Sie, wenn ich mit guten Nachrichten komme?“
Iris fand seine Miene gönnerhaft. Andrew Sterne gehörte zu jenen Akademikern alter Schule, die den Einzug von Frauen in ihre Gefilde noch immer nicht verkraftet hatten. „Für eine gute Nachricht heiße ich von mir aus auch Irene“, bemühte sie sich um einen Witz.
Sterne lächelte dünn. „Ich hätte einen Job für Sie“, sagte er. „Allerdings brauche ich eine schnelle Entscheidung.“
Iris hatte Mühe, sich ihre Erregung nicht anmerken zu lassen. „Worum geht es denn?“
„Der National Trust braucht eine Vertretung für einen Grabungsleiter, der einen Unfall hatte“, erwiderte Sterne. „Einen Spezialisten fürs Frühmittelalter. Sichtungsgrabung. Von jetzt sofort bis zum Ende des Sommers – mit Ihren Erfahrungen in Kent hätten Sie so ziemlich die passenden Referenzen.“
Es klang zu gut, um wahr zu sein. Wenn diese Stelle keinen gehörigen Haken hatte – weshalb bot Sterne sie dann ihr und keinem männlichen Kollegen an? Dass er von ihr und ihrer Geschichtsauffassung nicht sonderlich viel hielt, hatte er bereits mehr als einmal deutlich gemacht.
„Und? Was ist?“ Sternes Fingernägel trommelten gegen den Türrahmen.
„Darf ich fragen, wo die Grabung stattfindet?“
„Sutton Hoo“, erwiderte der Kurator gleichmütig. „Zwei Grabhügel, die zur Sichtung ausgehoben werden. Das Projekt läuft bis Ende des Jahres, aber im September sollte der Leiter wieder auf dem Posten sein.“
Sutton Hoo. Das Mekka angelsächsischer Forschung, der Flecken in Suffolk, von dem sämtliche Kollegen ihres Fachgebiets träumten. Wenn sie dort drei Monate eine Grabung beaufsichtigte, hatte sie einen Fuß in der Tür, besaß den Trumpf im Lebenslauf, der ihr bisher gefehlt hatte. Drei Monate ohne Gareth waren allerdings ein hoher Preis. Ihre Ehe war jung, die Probleme mit dem Haus belasteten sie und Iris hatte Hoffnungen auf diesen Sommer gesetzt: Sie hatte sich lange Abende auf ihrer Terrasse am Kanal ausgemalt, Windlichter, Wein aus Korbflaschen und die Wiederentdeckung der Nähe, die ihnen im Alltag abhandengekommen war. Aber Gareth war Dozent an einer Wirtschaftsfachschule und hatte den Sommer über Semesterferien. Warum sollte er sie also nicht nach Sutton Hoo begleiten?
Suffolk war schön. Nicht sacht und lieblich, sondern wild und düster – weites Marschland, schwarze Wälder und die zerklüftete Küste der Nordsee. Iris war nur noch einmal, während ihres Studiums, dort gewesen, und damals hatte sie kaum Zeit gehabt. Jetzt sah sie sich und Gareth Hand in Hand durchs Schilf des Flussufers streifen, während die Nebel über den Gräbern versunkener Jahrhunderte sich lichteten. Viel zu selten hatte sie bisher Gelegenheit gehabt, mit ihrem Mann zu teilen, was sie an ihrem Beruf liebte. Außerdem würde ihr Verdienst ihm ein Stück Last von den Schultern nehmen – war es nicht das, was er sich seit Monaten von ihr wünschte?
„Wie gesagt, es ist ein Job für schnell Entschlossene.“ Andrew Sterne ließ noch immer hübsch manikürte Fingernägel auf das Holz des Türrahmens klopfen. „Allzu oft kommt es schließlich nicht vor, dass der National Trust uns um Schützenhilfe bittet. Wie Sie wissen, gibt es da gewisse Animositäten wegen dieses illustren Herrn.“ Mit dem Ellbogen wies er auf den Helm im Glaskasten. Der National Trust forderte seit Langem, der Kunstgegenstand müsse nach Sutton Hoo überführt werden, während das British Museum, das ihn während des Krieges in einem Londoner U-Bahn-Schacht in Sicherheit gebracht hatte, sich berechtigt fühlte, ihn zu behalten.
„Die Bedingungen werden Sie mir schon erläutern müssen“, hörte Iris sich sagen. „Aber wenn sie akzeptabel sind, hätte ich Interesse.“
2
Sie hatte Mühe, wie eine Frau von zweiunddreißig aus dem Bus zu steigen, statt wie ein kleines Mädchen vor Freude zu hüpfen. Der Bezirk, in dem sie lebte, war ein Brennpunkt – aufstrebende Akademiker, die alten Baubestand aufkauften, trafen auf Problemfamilien in zu engen Sozialwohnungen. Immigranten aus den ärmsten Teilen der Erde fanden sich Tür an Tür mit Langzeitarbeitslosen, die für ihr Elend einen Sündenbock suchten. Gerade deshalb aber liebte Iris diese Gegend. Sie platzte aus allen Nähten, war randvoll von jenem Leben, bei dem sie sich wie ein Zaungast fühlte. Sie sehnte sich danach, daran teilzuhaben, doch im nächsten Moment jagte es ihr auch Angst ein und scheuchte sie in sichere Entfernung.
Sie überquerte die Brücke und stieg die hölzernen Stufen zum Kanal hinunter. Dort unten wartete ihr Zuhause – ein einstiges Lagerhaus, das geschützt genug lag, um ihr Geborgenheit zu bieten. Wenn sie und Gareth die Rollläden herunterließen, wurde das Haus ihre Auster, und die Welt blieb ausgesperrt. Die Restaurierung kostete mehr als erwartet und würde Jahre in Anspruch nehmen, doch das änderte nichts daran, dass Iris lächeln musste, sobald sie ihr Haus erblickte.
„Es ist zu groß“, war das Erste, was Gareth gesagt hatte. Im Grunde war es das nicht, denn es besaß nur drei Schlafzimmer und einen einzigen Wohnraum, und dennoch hatte er recht: Es war zu groß für London, wo selbst Kleinstwohnungen ein Vermögen kosteten, zu groß für zwei Menschen mit mittleren Einkommen, die von niemandem ein Erbe zu erwarten hatten. Wäre es nicht so baufällig gewesen, hätten sie nicht einmal im Traum an einen Kauf denken können.
„Es ist groß genug“, hatte Iris gesagt. „Deshalb will ich es haben.“ Es war kein gleichgültig erbautes neues Haus, sondern eines mit Geschichte, und es sollte das Haus voller Leben werden, das sie sich ihr Leben lang erträumt hatte.
Über die Holzbohlen der Terrasse lief sie zur Tür. Es war ein heller, dunstiger Maiabend, die Platanen warfen gezackte Schatten übers Wasser und aus einem der Nachbargärten drang der würzige Duft nach Grillfleisch, eingelegt in Knoblauch und Rosmarin. „Gareth!“, rief Iris, ehe sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Die Vorfreude ließ ihr Herz in hohen Hüpfern schlagen.
In den ersten Wochen ihrer Ehe war Gareth ihr entgegengekommen, doch inzwischen hatte er es sich abgewöhnt. Iris schob die Tür auf und trat in den weiten Raum mit den schrägen Deckenbalken, der Küche und Wohnraum zugleich war und das gesamte Erdgeschoss einnahm. „Gareth?“
Für gewöhnlich saß er hinten, im Erker, wo sie zwei kleine Sessel und den Fernseher aufgestellt hatten. Manchmal erwiderte er ihren Gruß von der Küchenzeile her, wo er sich einen Imbiss aufwärmte. Iris hätte lieber mit ihm zusammen zu Abend gegessen, hätte gern Kerzenleuchter und halb welke Rosen zwischen die Gedecke gestellt, doch ihre unterschiedlichen Arbeitszeiten durchkreuzten solche Pläne. In diesem Sommer, dachte sie. Der National Trust stellte ihr ein Cottage zur Verfügung, von dessen Veranda sie das Meer sehen konnten.
Noch einmal rief sie den Namen ihres Mannes. Das Licht im Wohnraum brannte, also musste er zu Hause sein. Gerade als sie sich anschickte, oben nachzusehen, kam er die Treppe herunter, die große Sporttasche mit dem Aufdruck seines Karateklubs in einer Hand. Wie immer wirkte er elegant und gepflegt. Er trug sein helles, auf Figur geschnittenes Leinensakko über einem blauen Hemd, das seine Augen betonte. Ein Mann, der sich anziehen kann, hatte ihre Freundin Helen, die Modedesignerin, ihn genannt. „Iris“, sagte er, als verwundere ihn ihre Anwesenheit. „Du bist ja ganz durch den Wind – was gibt es denn?“
„Das hier!“ Mit der Geste einer Zauberkünstlerin langte Iris in ihre Tasche und zog die Flasche heraus. Kein Champagner, das wäre Verschwendung gewesen, aber immerhin spanischer Sekt. „Ich habe einen Job! Zwar nur über den Sommer, aber es ist der tollste Job der Welt und richtig Geld bringt er auch.“
Gareth ließ seinen Blick an ihr hinauf- und hinuntergleiten. „Schön“, sagte er. „Das freut mich für dich.“
„Für uns beide!“, rief sie. „Ich soll für drei Monate nach Suffolk, genauer gesagt nach Sutton Hoo, mit dem ich dir ständig in den Ohren liege! Ich kann es nicht erwarten, es dir zu zeigen, Gareth, ich kann es nicht erwarten, das alles mit dir zu teilen.“
„Schön“, sagte er noch einmal, stellte die Tasche ab und strich sich das sandfarbene Haar aus dem Gesicht. „Aber was habe ich damit zu tun?“
„Wir fahren zusammen“, antwortete sie. „Ich verdiene fast doppelt so viel wie jetzt, das heißt, du brauchst im Sommer keine Privatstudenten und die Isolierung des Kellers kann warten. Wir werden endlich einmal Zeit haben Zeit für uns.“
„Ob du Zeit hast, wird man dann ja sehen“, sagte er und wandte den Blick zum Fenster, wo der milchige Himmel sich bezog. „Mich sollte es wundern. Bisher hattest du, wenn es um deinen Beruf ging, jedenfalls keine. Höchstens noch ab und an für dieses Haus.“
„Das musst du doch verstehen“, versuchte sie ihm ins Wort zu fallen, aber er schüttelte den Kopf.
„Ich muss gar nichts mehr, Iris. Ich gehe.“
„Zum Karate?“ Er betrieb diesen Sport schon sein ganzes Leben, hatte ihn vor Kurzem jedoch aufgegeben, weil ihm Zeit und Geld für genügendes Training fehlten.
Gareth schüttelte den Kopf, sodass das eben zurückgestrichene Haar ihm wieder in die Stirn fiel. Sooft er das tat, hielt Iris inne, als hätte sie ihn gerade erst kennengelernt. In seine jungenhafte Attraktivität, die Sorglosigkeit, die er ausstrahlte, hätte sie sich jederzeit aufs Neue verlieben können. „Nein, nicht zum Karate“, sagte er. „Ich ziehe für ein paar Tage zu Janis. Danach wird man sehen.“
Janis war eine seiner Schwestern. Die Geschwister waren einander eng verbunden, aber Janis hatte drei Kinder und war gewiss nicht scharf darauf, in ihrem zu kleinen Haus obendrein ihren Bruder zu beherbergen. Iris verstand nicht, was er ihr sagen wollte. Der Raum mit seinen vertrauten Möbeln begann vor ihren Augen zu verschwimmen. „Zu Janis“, wiederholte sie sinnlos. „Was ist mit dir los, Gareth?“
„Was mit mir los ist?“ Er verzog den Mund zu einem seltsamen Lächeln. „Ich hätte nicht gedacht, dass du mich das doch noch fragst. Jede andere Frau wäre längst hellhörig geworden. Wir laufen in dieser Hausruine aneinander vorbei wie auf einem Verschiebebahnhof. Wenn wir überhaupt Worte miteinander wechseln, drehen sie sich um Geld, das wir nicht haben, oder um Termine mit den Handwerkern. Morgens im Flur schnalzen wir uns wie Bruder und Schwester ein Küsschen auf die Wange, und dass wir noch wissen, wie Sex funktioniert, wage ich zu bezweifeln.“
„Oh, Gareth.“ Sie hob die Arme und setzte einen Schritt auf ihn zu, doch er wich zurück. Erschrocken blieb sie stehen. Sie war in einem Haushalt aufgewachsen, in dem körperliche Zärtlichkeit nicht stattfand, und hatte bis heute Mühe, sich ihrem Mann zu öffnen. Dass er sie zurückwies, wenn sie sich ihm zuwandte, hatte sie nie erlebt. „Es ist der Stress“, murmelte sie. „Die Geldsorgen. In Suffolk können wir zur Ruhe kommen. Du brauchst dich nicht mit deinen Studenten herumzuquälen und ich mich nicht mit meinen Museumsbesuchern. Ich leite eine Grabung. Würde es dir nicht gefallen, dabei zuzusehen?“
Schnaufend lachte er auf. „Natürlich, Iris: Die ganze Welt ist genauso besessen von alten Pötten und verbeultem Blech wie du, und seine Beziehungsprobleme löst man am besten, indem man gemeinsam Löcher in die Erde buddelt. Oder indem man sich eine verfallene Bruchbude kauft, die einen langsam, aber sicher auffrisst. Hast du eigentlich gehört, was ich gesagt habe? Ich fahre nicht mit dir in irgendein Paradies für Altertümer. Ich ziehe zu meiner Schwester, weil ich dich verlasse.“
Iris tastete nach Halt. Ihr Blick flog durch den Raum, über die Rückwand aus unverputzten Ziegeln und die Dielen aus naturbelassenem Holz. „Aber …“, brachte sie erstickt heraus, „aber was wird denn mit dem Haus …“
Wieder lachte er auf. „Weißt du, dass ich darauf hätte wetten können? Dein Mann sagt dir, dass er dich verlässt, und deine erste Sorge gilt dem Haus. Nun, um es frei heraus zu sagen, mich kratzt herzlich wenig, was aus dem Haus wird. Wenn du meine Hälfte der Hypothek übernehmen willst, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Wenn nicht, lass uns dieses Fass ohne Boden lieber heute als morgen verkaufen.“
„Das ist nicht dein Ernst!“
„Was? Dass ich dich verlasse oder dass ich dein kostbares Haus verscherbeln will? Weißt du was? Solche Sachen lassen sich nie gut in der Hitze des Augenblicks regeln. Ich fahre zu Janis, und du machst, was immer du vorhattest, und wenn wir uns beruhigt haben, besprechen wir alles in Ruhe.“ Mit einer Hand hob er die Tasche auf, mit der anderen angelte er sich seine Jacke vom Haken.
„Du kannst doch jetzt nicht gehen“, rief sie und kam sich vor wie die Hauptfigur in einer Seifenoper.
Gareth zuckte die Achseln. „Ich wüsste nicht, warum nicht.“ Gleichmütig schob er Iris zur Seite und ging zur Tür. Als er die Klinke schon in der Hand hatte, drehte er sich noch einmal um. „Du glaubst, du wünschst dir das alles – Beziehung, Liebe, Nähe, aber in Wirklichkeit lässt du lebende Menschen nicht an dich heran. Dieses Haus, auf das du so verrückt bist, ist nichts als die Kulisse für ein Stück, in dem du gar nicht spielen willst. Wenn du mich fragst, bist du mit deinem Beruf verheiratet, Iris. Leben reißt dich nur vom Hocker, wenn es bereits seit Hunderten von Jahren vorbei ist.“
Er zog die Tür auf und ließ den milden Abendwind herein, den süßen Maiduft und einen Schwarm von Mücken. Iris stand wie gelähmt. „Ich wünsche dir alles Gute“, sagte Gareth, der bereits zur Hälfte aus dem Haus verschwunden war. „Ich hoffe, dass du bei deinen vermoderten Schiffsgräbern findest, was du dir so dringend wünschst.“
3
Das kleine Haus war weiß getüncht und mit Schindeln gedeckt. Vor der schmalen Veranda erhob sich der grasbewachsene Wall, der den Küstenstreifen vor dem Zorn einer Sturmflut schützen sollte. Dahinter führte ein Streifen sumpfiges Grasland ans Ufer des Flusses Ore, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit seiner Mündung zuströmte.
Von dem versprochenen Meerblick war nichts zu sehen. Außerdem stand das Cottage keineswegs in Orford, wie Andrew Sterne zugesichert hatte, sondern einen ordentlichen Fußmarsch durch menschenleeres Marschland vom Ortsrand entfernt. Nach Sutton Hoo würde Iris eine Viertelstunde mit dem Auto brauchen, was umso ärgerlicher war, als sie kein Auto besaß. Londoner brauchten kein Auto. Und Archäologinnen, die von ihren Männern verlassen worden waren und mit Fehlkäufen von Häusern dastanden, konnten sich keines leisten.
„Fährt hier ein Bus?“, hatte sie Dinah gefragt, die junge Frau mit dem zum Zopf geflochtenen Karottenhaar, die sie in Ipswich vom Bahnhof abgeholt hatte. Die ganze Zeit über, während sie Iris in ihrem Mini durch flaches, fast menschenleeres Land fuhr, hatte Dinah freiwillig kein Wort gesprochen. Stattdessen pfiff sie eine immer gleiche Folge von fünf Tönen oder kaute auf dem Ende ihres roten Zopfes.
„Bus?“, fragte sie jetzt. Es klang, als hätte Dinah sie gefragt, ob in der Gegend Dinosaurier herumstreiften.
„Irgendwie muss ich morgens ja an meinen Arbeitsplatz kommen“, erklärte Iris mit erzwungener Geduld.
„Im Auto“, schlug Dinah vor.
„Ich habe keines.“
In der Fahrt wandte Dinah ihr das Gesicht zu und musterte sie, als könnte sie das Auto irgendwo an sich versteckt haben. Als der Wagen auf dem nassen Asphalt ins Schlingern kam, wandte sie sich wieder der Fahrbahn zu und zuckte mit den Schultern.
Im stetig strömenden Regen hatte die Landschaft etwas Trostloses, Gottverlassenes. Das lange Gras, das der Wind bog, schien so grau wie der Himmel und das Band des Flusses. Nur die Wälder schnitten Streifen von Schwarz dazwischen. Vielleicht bin ich es, die Suffolk grau macht, dachte Iris. So wie andere die Welt durch eine rosarote Brille betrachteten, mochte sich die Netzhaut ihrer Augen durch trübe Gedanken grau verfärbt haben.
Sie fuhren weiter den Fluss entlang, der sich mit jeder Meile zu verbreitern und zu beschleunigen schien. Jäh tauchte das Meer auf, ein silbernes Glitzern am Ende des grauen Einerleis. In das Glitzern schnitt eine bucklige Landzunge, auf deren Kamm sich ein rot-weiß gestrichener Leuchtturm erhob. Das Orford Ness, die Nehrung, die jahrzehntelang als militärisches Versuchsgebiet genutzt und erst vor Kurzem wieder für Besucher freigegeben worden war. An der vorgelagerten Küste scharte sich eine Handvoll Häuser um die Ruine von Orford Castle. Erleichtert registrierte Iris, dass es hier doch so etwas wie Zivilisation und damit sicher auch Busverkehr gab. Gleich darauf bog Dinah in eine Seitenstraße ein und die tröstliche Menschensiedlung geriet außer Sicht.
„Wohin fahren wir denn?“ Der Regen wurde dichter, die Scheibenwischer kamen kaum noch nach.
Dinah unterbrach ihr Pfeifen und wandte erneut den Blick von der Straße, um Iris zu mustern. „Hengist Place“, murmelte sie und blickte wieder nach vorn.
Das war der Name des Cottage, wie Iris ihn aus dem Vertrag kannte. Ein passender Name, wenn man bedachte, dass es sich bei Hengist um einen König der angelsächsischen Legende handelte. Mit der Fahrtrichtung dagegen konnte etwas nicht stimmen. „Das Dorf liegt doch dort hinten“, rief Iris. „Weshalb fahren wir denn von da weg?“
Dinah gab keine Antwort. Aus den Schleiern des Regens schälte sich eine Silhouette, die Iris im ersten Augenblick für ein verlassenes Kloster hielt. Das hohe Gemäuer war eisengrau, es hob sich gegen den Himmel kaum ab. Mit seinen zwei Türmen hätte es auch eine Festung sein können oder noch eher die Kulisse eines Gruselfilms. Ein Schauder stahl sich ihren Rücken hinunter. Sie wünschte sich, Dinah möge den Wagen wenden und zurück in Richtung Dorf fahren, irgendwohin, wo Menschen waren, wo aus dem Fenster eines Pubs Licht in die Trübnis drang. Die Frau aber fuhr unverwandt weiter und kaute auf ihrem Zopfende.
„Was ist das?“, frage Iris kaum hörbar.
Dinah zuckte die Achseln. „Das steht leer. Schon immer.“
Hinter der Biegung war die Straße zu Ende, und die Weite des Marschlandes dehnte sich aus. Das kleine weiße Haus duckte sich hinter den Uferwall. Von dem grün gestrichenen Gartenzaun blätterte die Farbe, ein Pfahl war umgebrochen und der Wind bewegte eine leere Schaukel.
„Nicht hier“, entfuhr es Iris.
Auf dem knirschenden Kiesweg hielt Dinah den Wagen an. „Wie?“
„Hier kann ich nicht wohnen.“ Sie hasste es, in der Dunkelheit fern von Menschen zu sein. Schon als Kind hatte sie sich allein halb zu Tode gefürchtet, und selbst in London schreckte sie seit Gareths Auszug jede Nacht aus dem Schlaf. Weit und breit gab es kein Verkehrsmittel, mit dem sie nach Sutton Hoo gelangen konnte, keine Einkaufsmöglichkeit, keinen Pub, um an den langen Abenden der Stille und Einsamkeit zu entfliehen.
Dinah entnahm dem Handschuhfach ein Schlüsselbund und wies damit auf das Haus. „Hengist Place. Das ist es.“
„Ich kann da nicht wohnen“, wiederholte Iris. Entsetzt stellte sie fest, dass ihr Tränen in die Augen quollen. Sie hatte selten eine Person so unsympathisch gefunden wie diese Dinah, und dennoch wollte sie sie anflehen, sie nicht in der Einöde zurückzulassen, über die sich jetzt zudem die Schwärze des Abends senkte.
„Darüber müssen Sie mit dem National Trust reden“, sagte Dinah.
„Aber Sie sind doch vom National Trust!“, rief Iris.
„Ich?“ Dinah löste das Gummi aus ihrem Zopfende und zwirbelte die Strähnen um ihren Finger. „Nein, bin ich nicht. Ich habe Sie nur abgeholt, weil Caleb mich darum gebeten hat.“
„Caleb?“
„Vom National Trust“, erwiderte Dinah gleichgültig. „Hier haben Sie die Schlüssel. Ich muss jetzt fahren.“
Iris’ Protest erstarb. Keine Minute später fand sie sich mit ihrem Gepäck im Regen wieder und versuchte, mit einem Arm die Laptoptasche unter ihrer Jacke zu schützen, während die freie Hand mit dem Schlüssel im Schloss stocherte. Wind riss ihr an Haaren und Kleidern, als wäre November, nicht Mai.
Endlich gelang es ihr, die Tür zu entriegeln. Das schwindende Tageslicht fiel in einen holzgetäfelten Wohnraum mit niedriger Decke, aus dem ihr ein Duft nach Harz und Salzluft entgegenschlug. Auf dem Tisch in der Zimmermitte stand ein großer Korb und daneben lag ein Zettel. Zielsicher strebte Iris darauf zu und entdeckte, was sie erhofft hatte: handgeschriebene Anweisungen zum Gebrauch von Wasser, Gas und Elektrizität. Der Sicherungskasten befand sich gleich neben dem Eingang, und im Nu war das Zimmer in ein warmes Licht getaucht.
Wäre ich mit Gareth hergekommen, hätte ich dieses Haus geliebt, durchfuhr es sie. Der Wohnraum besaß einen Kamin, neben dem Feuerholz gestapelt lag. Eine Tür führte in eine altmodische Küche, deren Fenster auf windgepeitschtes Marschland hinausging, und über die hölzerne Treppe gelangte man ins Dachgeschoss. Oben gab es ein Bad mit Oberlicht und einer in den Boden eingelassenen Wanne sowie einen winzigen Alkoven unter den Dachbalken, gerade groß genug, um sich zu zweit vor der Welt zu verkriechen. Die Versuchung, nach ihrem Handy zu tasten und Gareths Nummer zu tippen, war eine Sekunde lang überwältigend. Noch immer stand sie fassungslos vor der Tatsache, dass ihr Mann ihrer Ehe keine Chance mehr gab. Was für eine Frau war sie, dass sie sämtliche Warnzeichen übersehen hatte?
Im Innern fühlte sie sich wie schockgefroren: Wenn sie sich bewegte, hatte sie das Gefühl, das Eis knirschen zu hören, als könnten ihr Herz und ihre Eingeweide jederzeit zerbrechen. In ihrem Freundeskreis sprach sich die Nachricht von ihrer Trennung in Windeseile herum. Nach ein paar Tagen, während Iris verzweifelt mit Bankangestellten um ihr Haus kämpfte, hatte ihre Freundin Helen angerufen. „Hast du denn gar nichts gemerkt?“, hatte sie gefragt.
Nein, Iris hatte nichts gemerkt. In welchem Wolkenkuckucksheim hatte sie gelebt? Für sie war die Ehe, die sie mit Gareth geschlossen hatte, eine Entscheidung für den Rest des Lebens wie die für ihr Haus und ihren Beruf.
„Vielleicht liegt es ja daran, dass du ohne Vater aufgewachsen bist“, hatte Helen laut vor sich hin gedacht. „Woher sollst du armes Ding denn wissen, wie eine Ehe funktioniert?“
Offenbar hatte Iris es nicht gewusst. Sie war auch ohne Großväter, Brüder und Onkel aufgewachsen, ihre einzige männliche Bezugsperson war ein Großonkel, der nie verheiratet gewesen war. In dem traurigen Häuflein, das sie ihre Familie nannte, gab es keine Ehen. War ihre eigene wirklich deshalb gescheitert, ohne dass sie die warnenden Zeichen gespürt hatte?
Sie schüttelte sich. Jetzt war nicht der Moment, um den Schmerz zuzulassen, der ihr jedes Mal aufs Neue das Gefühl gab, ein verlassenes Kind zu sein, das niemand haben wollte. Ihr Magen knurrte nicht nur, er stimmte geradezu ein Gebrüll an. Es war bald acht Uhr, der düstere Tag erstarb und das Wetter wurde zusehends scheußlicher. Die Vorstellung, sich noch einmal hinauszuwagen und den endlosen Weg ins Dorf anzutreten, um etwas Essbares aufzutreiben, ließ Iris schaudern.
Aber vielleicht gab es ja irgendwo einen Pizzaservice, der sich übers Handy erreichen ließ. Und womöglich hatte der freundliche Mensch, der ihr den Zettel geschrieben hatte, auch gleich ein paar entsprechende Nummern notiert?
Iris wandte sich zum Tisch und bemerkte den Korb. Neben einer Baguette-Stange ragten zwei Flaschenhälse über den Rand. Rotwein, schwerer, dunkelroter Rioja, von dem ein Glas genügte, um die allzu scharfen Konturen der Welt ein wenig weicher zu zeichnen. Zudem war der Korb bis obenhin gefüllt mit köstlichen Lebensmitteln, wie Iris sie sich nie geleistet hätte. In braunes Papier gewickelte italienische Käsestücke, dünn geschnittener Schinken, junger Feldsalat, rotwangig glänzende Äpfel, gelbe schmelzende Fassbutter und ein schimmerndes Stück Schokoladentorte. Dazu Orangensaft, Mineralwasser und ein ganzes Pfund brasilianischer Kaffee.
Das Hühnchen, das sie mit dem National Trust zu rupfen hatte, wurde ein bisschen zahmer. Immerhin hatten sie jemanden – zweifellos eine Frau – zum Einkaufen geschickt, der sich darauf verstand. Natürlich würde sie ihren Arbeitgebern trotzdem klarmachen müssen, dass sie ohne Auto nicht meilenweit von der Grabungsstätte entfernt wohnen konnte, aber das ließ sich heute Abend nicht mehr regeln. Iris beschloss, das Nachdenken wie das Auspacken auf morgen zu verschieben. Stattdessen würde sie sich mit Käse, frischem Brot und einem Glas Wein in ein schäumendes Bad verziehen und anschließend versuchen, über den erfundenen Schicksalen eines Romans ihr eigenes Leben vorübergehend zu vergessen.
4
Das Minicar, das Iris nach zahlreichen Fehlversuchen endlich ergattert hatte, kam eine halbe Stunde zu spät. Wenigstens hatte der Regen aufgehört, wenn auch die farblosen, tief hängenden Wolken und die Nebel, die aus dem feuchten Gras aufwallten, zum Frühsommer so wenig passten wie die klamme Kälte, die ihr unter die Kleider kroch.
Sie fühlte sich zerschlagen. Der Erschöpfung zum Trotz hatte sie gestern Nacht nicht in den Schlaf gefunden. Der Wind, der die Fensterscheibe im Rahmen erzittern ließ, schien in einen Hitchcock-Film zu gehören, und den Kopf unter der Bettdecke zu verstecken, half nicht. Schließlich hatte sie versucht, Helen anzurufen, die ein bekennender Nachtmensch war, doch sie hatte nur die Mailbox erreicht. „Ein Königreich für eine Menschenstimme“, hatte sie auf das Band gesprochen. „Komme mir vor wie das letzte Wesen nach dem Weltuntergang. Ruf mich an, egal, wie spät es ist.“
Helen aber hatte sich nicht hören lassen. Ein Mann, vermutete Iris, und der Gedanke tat weh. Die Leichtigkeit, mit der die Freundin Männerbekanntschaften einging, war ihr fremd, doch vermutlich hätte ihr ein wenig davon gutgetan. „Andere Mütter haben auch schöne Söhne“, lautete Helens Motto, mit dem sie Enttäuschungen im Handumdrehen wegsteckte. Nach einer festen Beziehung verlangte es sie nicht. Mit Eltern, die noch immer verliebt Händchen hielten, und drei glücklich verheirateten Brüdern hatte sie in ihrem Leben Bindung genug.
Im Vergleich dazu war Iris ein Stück Treibgut, das nicht ahnte, woher es stammte. Ein einziges Mal hatte sie versucht, sich in einem Hafen zu verankern, und war kläglich gescheitert. Sie fühlte sich wund, wenn sie nur daran dachte. Einen zweiten Versuch konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen.
Der Fahrer des verbeulten Minicars entschuldigte sich nicht für die Verspätung und hielt es auch sonst nicht für nötig, mit seinem Fahrgast ein Gespräch zu führen. Waren alle Menschen in diesem leer gefegten Flecken Erde derart wortkarg? Iris starrte aus dem Fenster und hing ihren Gedanken nach, als wie aus dem Boden gewachsen das graue Gemäuer wieder auftauchte. Im diesigen Licht des Morgens hätte es noch immer die Kulisse eines Gruselfilms abgegeben. Es war verwahrlost, die Fensterscheiben trüb und zersprungen, der Putz schadhaft und der Zufahrtsweg von Gras überwuchert. Kein einladender Anblick, sondern einer, vor dem man schnellstens das Weite suchte.
Etwas aber rief die Archäologin in Iris wach, die ganz anderes sah: Das Gebäude war in dem geradlinigen, großzügigen Stil der Neo-Renaissance errichtet, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgekommen war. Ohne Zweifel war es ein herrschaftlicher Familiensitz gewesen und hatte seinen Inhaber mit glühendem Besitzerstolz erfüllt. Wenn man die heruntergekommene Fassade außer Acht ließ und sich auf die klaren Linien konzentrierte, konnte man sich vorstellen, wie hochwohlgeborene Gäste in ihren Wagen vor dem Portal eintrafen, um einem Ball oder einem festlichen Dinner beizuwohnen, und von Bediensteten der Familie in Empfang genommen wurden.
Gebäude erzählten Geschichten. Sekundenlang wünschte sich Iris, auszusteigen und sich von der grauen Ruine in die Geheimnisse ihrer lange vergessenen Glanzzeit einweihen zu lassen. Warum stand ein architektonisches Juwel wie dieses dem Verfall anheimgegeben in der Landschaft? Warum waren keine Erben da, die sich um eine Restaurierung bemühten?
Ihr eigenes Haus fiel ihr ein, das nicht mehr lange ihr eigenes sein würde. Würde der Käufer, nach dem der Makler derzeit suchte, es liebevoll restaurieren, wie sie selbst es vorgehabt hatte, oder würde er schnellstens die Genehmigung zum Abriss einholen, um sich ein neues bauen zu lassen, das zwar nicht geschichtsträchtig, aber dafür keimfrei und praktisch war? Iris war in den charakterlosen Wänden einer Neubauwohnung aufgewachsen und hatte sich ein Haus gewünscht, dessen Mauern Schicksale bargen, Geschichten von Liebe und Leben, von Geburt und Tod. Wäre ihr ein Haus wie dieses als Erbe in den Schoß gefallen, hätte sie mit allen Kräften um seinen Erhalt gekämpft. Die Hypothek aber überstieg ihre Mittel. Sie wollte an das letzte Gespräch, in dem der Kreditberater ihrer Bank endgültig den Kopf geschüttelt hatte, nicht noch einmal denken.
„Was ist das?“, fragte sie stattdessen, ohne viel Hoffnung, von dem Taxifahrer mehr zu erfahren als gestern von Dinah.
„Was?“
„Das Herrenhaus.“
„Warum?“, knurrte der Mann, der jenem Schlag von Menschen angehörte, die mit zwanzig bereits aussahen wie Fünfzigjährige und danach nicht mehr alterten. „Denken Sie dran, es zu kaufen?“
„Vielleicht“, hörte Iris sich antworten. Gut gelogen ist schon halb erforscht, hatte der Wahlspruch von Stephen, ihrem Lieblingsdozenten an der Uni, gelautet.
„Rufen Sie Caleb an. Ich geb Ihnen nachher die Nummer.“
„Caleb?“ Es war das zweite Mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden, dass ihr der Name begegnete. Entweder war er in der Gegend der Renner unter den männlichen Vornamen oder der Typ fungierte als eine Art Mädchen für alles.
„Caleb kümmert sich für die Erben drum“, erklärte der Taxifahrer. „Ist vielleicht nicht der beste Moment, aber er war immer scharf drauf, dass der Kasten in gute Hände kommt.“
„Warum ist es nicht der beste Moment?“
Der Mann brummte etwas Unverständliches. Auf Iris’ Nachfrage wiederholte er lediglich einen Namen, „Deirdre“, ehe er sich eine Zigarette ansteckte und das Wageninnere mit beißendem Rauch füllte. „Rufen Sie ihn mal trotzdem an“, sagte er dann. „Er ist ja ein Kerl, kein Milchmädchen. Und für den alten Kasten reißt er sich seit sonst wann den Arsch auf.“
Der alte Kasten sah nicht aus, als risse sich irgendwer für ihn den Arsch auf. Er war längst aus ihrem Blickfeld verschwunden und Iris wandte sich wieder nach vorn. In kurzer Entfernung entdeckte sie die seltsamen Bodenwellen, die aussahen, als hätte die Natur sie so gewollt. Erst im vergangenen Jahrhundert hatten Archäologen einer vagen Ahnung nachgegeben und erkannt, dass sie von Menschenhand stammten. Die Schiffsgräber von Sutton Hoo. Iris’ Herz schlug schneller und für den Augenblick waren sämtliche alten Häuser, zerbrochenen Ehen und Sorgen vergessen. Die bedeutendste Fundstätte der angelsächsischen Welt breitete sich vor ihr aus.
Der Taxifahrer bog in den verschlammten Zufahrtsweg ein und fuhr hinauf zum Besucherzentrum.
5
Der Fluss, der sich zwischen den Hochufern entlangschlängelte, war nicht der Ore, der sich bei Orford ins Meer stürzte, sondern der Deben. In diesem Teil Suffolks wimmelte es von Flüssen, als wäre die Nordsee eine jener Frauen, die nur die Arme auszubreiten brauchte, damit ihr Männer wie Motten entgegenströmten.
Zu diesen Frauen hatte Iris nie gehört. Auf Partys war sie meist die gewesen, bei der Männer sich ausgeweint hatten, nachdem sie bei der anderen Sorte abgeblitzt waren. Hässlich war sie nicht, eher unauffällig. Mittelgroß, aschblond und ausgestattet mit einer Figur, die in Jeans und vernünftige Allwetterjacken passte. Als sie in ihrem Freundeskreis mit Gareth aufgetaucht war, hatte es große Augen und hochgezogene Brauen gegeben. „Es hat einfach niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet du dir eine solche Luxusausführung schnappst“, hatte Helen ihr die verblüfften Blicke erklärt.
„Du meinst, wir passen nicht zusammen?“
„Das würde ich so krass nicht sagen“, hatte die Freundin erwidert. „Er sieht aus, als wäre er knapp an einer Model-Karriere vorbeigeschrammt, und du fühlst dich am wohlsten im Parka und mit der Schaufel in der Hand, aber ich wette, das ergänzt sich perfekt.“
Helen hatte sich geirrt, es hatte sich nicht perfekt ergänzt. Wäre Gareth bei ihr geblieben, wenn sie versucht hätte, mehr aus sich zu machen? Ihr Parka und die Schaufel in den Händen halfen ihr jedoch, sich sicher und am richtigen Platz zu fühlen. Auf einer Grabungsstätte vergaß sie ihre Menschenscheu und war in ihrem Element. Dass das Team aus vier Feldarchäologen, einem Geophysiker, einem Zeichner und einem Fotografen, dem sie vorstehen sollte, ausschließlich männliche Mitglieder hatte, machte ihr nichts aus, und dass niemand für die Probleme mit ihrer Unterbringung zuständig sein wollte, vergaß sie. Der Taxifahrer, der sich nach einiger Diskussion bereit erklärt hatte, sie am Abend wieder abzuholen, hatte ihr die Handynummer des ominösen Caleb aufgeschrieben, aber Iris vergaß auch das verfallene Herrenhaus. Sie war in Sutton Hoo. Sie leitete eine Grabung. Nichts anderes zählte.
Das gesamte Land, das sich vom Besucherzentrum bis zum Ufer des Deben erstreckte und die Grabhügel umfasste, hatte einst Edith Pretty gehört, einer respektablen Majorswitwe, die sich durch ihre mutige Entscheidung einen Platz in der Geschichte gesichert hatte. Es war 1939 gewesen, womöglich der heißeste Sommer des Jahrhunderts, und ganz Europa zitterte vor einem neuen Krieg. In diesem denkbar unmöglichsten Augenblick entdeckte Basil Brown, der Bauernsohn, der sich selbst zum Archäologen ausgebildet hatte, in einer Erhebung auf Edith Prettys Land die Abdrücke eines hölzernen Schiffs, das einst hier gelegen haben musste. Er hatte sich über die seltsamen Hügel gewundert, die sich in regelmäßigen Abständen aus der Ebene hoben wie Buckel auf einem Drachenrücken.
Was zunächst für eine Hinterlassenschaft der Wikinger gehalten wurde, entpuppte sich als das prachtvolle, mit reichsten Beigaben ausgestattete Schiffsgrab eines angelsächsischen Herrschers. König Raedwald, so vermutete man. Er hatte im 7. Jahrhundert über das Königreich East Anglia geherrscht, hatte sich christlich taufen lassen und doch den heidnischen Tempel bewahrt, damit ein jeder seiner Untertanen beten konnte, zu wem er wollte. Dafür hatte Iris ihn zu ihrem Helden erkoren. Er war ihr Lieblingskönig, seit sie in der Chronik des Beda Venerabilis, die Onkel Marcus ihr geschenkt hatte, zum ersten Mal von ihm gelesen hatte.
Kein anderer Fund hatte die Erforschung angelsächsischen Lebens um einen solchen Siebenmeilenschritt vorangebracht. Und kein anderer Fund hatte die Engländer derart bezaubert und ihnen die Geschichte ihrer Vorfahren nähergebracht. Der Helm von Sutton Hoo gehörte zu den populärsten Stücken des British Museum, er wurde geliebt wie die ägyptischen Mumien und die Götterstandbilder aus Ninive.
Hier, auf diesem von Marschgebieten umgebenen Land mit den Hügeln, hatte Basil Brown vor seinen Schätzen gestanden, während sich auf dem Festland ein Krieg zusammenbraute, der keinen Stein auf dem anderen lassen würde. Was sollte aus den kostbaren Artefakten werden, nachdem eine Kommission entschieden hatte, dass sie Edith Pretty gehörten, die damit verfahren durfte, wie es ihr beliebte? Vielleicht hatte Basil Brown sich insgeheim gewünscht, die Stücke einzusacken und bei Nacht und Nebel damit zu fliehen, statt sie am Fundort ihrem Schicksal und damit der Zerstörungswut des Krieges zu überlassen.
Edith Pretty aber traf eine Entscheidung, die den Grabschatz von Sutton Hoo rettete und ihr den Respekt ihres Landes eintrug. In einem Akt einzigartiger Großzügigkeit übereignete sie die Funde dem British Museum. Dieses schickte unverzüglich Experten, die den Schatz nach London schafften und in einem Schacht der U-Bahn sicher aufbewahrten, bis der Krieg vorüber war.
Wenn Iris über das Land blickte, glaubte sie, die Menschen vor sich zu sehen, die hier vor gut siebzig Jahren um die Rettung der Grabbeigaben gekämpft hatten: Edith Pretty, die das Ende des Krieges nicht mehr erlebt hatte, und Basil Brown, der nach dem Waffenstillstand an der Freilegung des Schiffsgrabes weitergearbeitet hatte. Der Gedanke, ihr Werk fortzusetzen, erfüllte sie mit Stolz.
Bei ihrer ersten Inspektion hatte sie feststellen können, welch hervorragende Arbeit ihr Vorgänger geleistet hatte. Die beiden Grabhügel, denen die neue Untersuchung galt, lagen etwa eine Drittelmeile nördlich von der Hauptfundstätte. Das gesamte Gebiet war von Gräbern übersät, sodass es schlichtweg unmöglich war, die Kosten für eine umfassende Freilegung aufzubringen. Für archäologische Forschungen war nie genug Geld da. Wie üblich entscheiden Finanzen darüber, was bewahrt wird und was verloren geht, dachte Iris bitter. Zumindest aber waren Mittel für eine Erforschung dieser beiden Hügel bereitgestellt worden, nachdem geophysikalische Tests Hinweise auf Metallgegenstände in den tieferen Erdschichten ergeben hatten.
Der linke Hügel war bereits in einer Abfolge von Stufen abgetragen worden, behutsam, damit die Seiten nicht einbrachen und Artefakte zerstörten, die in den untersten Schichten verborgen lagen. Iris nahm sich Zeit, den Grabungsverlauf samt den erstellten Plänen zu studieren. Bei einer. Sichtungsgrabung wurde die Stätte nach gründlichen Untersuchungen wieder in ihren alten Zustand zurückversetzt. Dr. Ashmore, der Grabungsleiter, der durch den Unfall ausgeschieden war, hatte auch die Sondierung durchgeführt und vermutet, dass sich in einem der beiden Hügel ein weiteres Schiffsgrab befand. Die Umsicht, mit der er vorgegangen war, verriet nicht nur einen Meister seines Fachs, sondern mehr noch einen Mann, der das, was er tat, innig liebte.
Solche Schlüsse können nur Frauen ziehen, hätte Gareth gesagt. Iris rief sich zur Ordnung und ging hinüber zum zweiten Hügel, der unter ihrer eigenen Leitung freigelegt werden sollte. Das Gebiet war bereits mit Schnüren und Steckpfeilern in Planquadrate eingeteilt worden, damit später jeder Fundort verzeichnet werden konnte. Vermutlich hatte Dr. Ashmore gerade mit der Abtragung des Mutterbodens – der obersten Erdschicht – beginnen wollen, auch wenn ein Hinweis auf eine genaue Stelle für den ersten Graben fehlte. Stattdessen hatte jemand aus dem Team die Entscheidung getroffen, die Iris ein wenig willkürlich schien.
Es musste wehtun, eine Grabung vollständig vorbereitet zu haben und sie dann nicht durchführen zu können, dachte Iris. Fühlte Dr. Ashmore sich vielleicht ähnlich wie sie, wenn sie an ihr Haus am Kanal dachte?
Damals, nach dem Kauf, hatte sie es in jedem Winkel untersucht, um es kennenzulernen wie einen geliebten Menschen. Sie hatte Grundrisse studiert und Pläne für eine Restaurierung geschmiedet, die nun nie stattfinden würde. In ihrem eigenen Interesse musste sie hoffen, dass Dr. Ashmore möglichst lange außer Gefecht war, doch wie konnte sie so etwas einem Kollegen wünschen? Die gesamte Ausgrabungsstätte trug die Handschrift eines Mannes, der es verdient hatte, vor Ort zu sein, falls hier eine bedeutende Entdeckung gemacht wurde.
Michael, einer der Feldarchäologen, hatte ihr die Berichte von den bisherigen Grabungen übergeben und das Nötigste erklärt. „Darauf hätte ich wetten können, dass uns die aus London eine Frau schicken“, hatte er gesagt.
„Warum das?“ Iris begriff noch immer nicht, warum der Kurator den Posten keinem Mann gegeben hatte.
„Welcher Mann geht in diesem Sommer schon freiwillig aus London weg?“, hatte Michael zurückgefragt. „Ist doch Olympiade. So was lässt sich eben kein Mann entgehen.“
Iris fühlte sich ertappt. Gareth hatte ihr ständig vorgeworfen, dass sie mit dem Kopf in den Wolken steckte und für das Leben um sie herum kein Interesse aufbrachte. Natürlich hatte sie mitbekommen, dass London Austragungsort der Olympischen Spiele sein würde, doch sämtliche Einzelheiten waren an ihr vorbeigerauscht. „Wie kommen Sie darauf, dass Frauen sich die Olympiade entgehen lassen?“, fragte sie, um ihr Gesicht zu wahren.
Michael grinste. Es war das erste Mal, dass einer der Männer in ihrer Gegenwart den Mund verzog. „Frauen machen so was eben“, sagte er. „Ansonsten wären Sie ja wohl kaum hier.“
Den Rest des Tages arbeiteten sie mehr oder weniger schweigend nebeneinanderher. Iris kam zu dem Schluss, dass es sich bei der Bevölkerung des Küstenstrichs um einen ungewöhnlich verschlossenen Menschenschlag handeln musste. Bei den Grabungen in Kent, an denen sie teilgenommen hatte, waren ständig Beobachtungen ausgetauscht, Vermutungen erörtert und Witze gerissen worden. Die Archäologen hatten Begeisterung und Enttäuschung geteilt und waren in den langen Wochen zu einer Art Familie zusammengewachsen. Hier hingegen tat jeder das Seine, als hätte er mit den anderen nichts zu tun. Kein Lachen wurde laut, kein Ruf, kein Gemurmel. Wir legen ein Grab frei, dachte Iris. Aber wir benehmen uns, als würden wir eines ausheben.
Vielleicht trug das Wetter seinen Teil zu der bedrückten Atmosphäre bei. Der Himmel hing tief, wie um jeden Augenblick zu platzen. Die feuchte Luft machte die Erde schwer, ab und an brachen Regenschauer los, und böiger Wind trieb Iris Nässe in den Jackenkragen. Bis zum Abend hatten sie den Mutterboden abgetragen und zwei Probegrabungen durchgeführt. Auf einen Schlag wurde die Kälte schneidend. „Beeilen wir uns mit der Besprechung“, sagte Kieran, der Geophysiker. „Die Leute wollen nach Hause, ehe es richtig zu schütten anfängt, und man muss ja nicht jedes Meeting unnötig ausdehnen.“
Wie auf Befehl wurde der Regen dichter. Hintereinander flüchteten sie alle ins Besucherzentrum, das seine Pforten inzwischen geschlossen hatte. In dem Café, das zum Komplex gehörte, bekamen sie heißen Tee in Styroporbechern und Käse-Sandwiches aus überraschend frischem, dunklem Brot. Es hätte gemütlich sein können, um den Tisch zu sitzen und über getane Arbeit zu schwatzen, doch stattdessen herrschte lastendes Schweigen. Iris bemühte sich, die Ergebnisse des Tages zusammenzufassen. Sie war sich nicht sicher, was sie erwartet hatte – ein anerkennendes Wort vielleicht, ein Lächeln, das ihr signalisierte, dass sie ihre Sache ordentlich machte, doch nichts dergleichen geschah.
Was war mit diesen Kerlen los? Waren sie samt und sonders Frauenfeinde, machte sich die alte Rivalität zwischen dem National Trust und dem British Museum bemerkbar oder richtete sich die Feindseligkeit gegen sie persönlich? Da niemand eine Frage stellte, erklärte sie die Besprechung für beendet. Wie ein Mann erhoben sich die fünf Teammitglieder. Der Fotograf war schon früher gegangen. „Augenblick“, rief sie erst, als der Letzte, ein etwas älterer Mann, der sich als Simon vorgestellt hatte, aus der Tür schlüpfen wollte.
Simon drehte sich um. „Miss?“
„Ich heiße Iris“, verbesserte sie. „Und ich habe ein Problem, bei dem ich Hilfe brauche.“
„Da werde ich Ihnen kaum helfen können.“
„Vielleicht sollten Sie mich erst einmal anhören, bevor sie ablehnen“, blaffte Iris. Das Gefühl, gegen Wände zu laufen, brachte sie allmählich zur Verzweiflung. „Der National Trust hat mich in ein Haus einquartiert, in dem ich nicht bleiben kann …“
„Hengist Place, oder?“, unterbrach er sie.
Iris nickte.
„Und warum können Sie da nicht bleiben?“, fragte der Mann geradezu empört. „Sind Sie etwa abergläubisch? Ich dachte, Sie wären aus der Stadt.“
„Was hat das mit Aberglauben zu tun?“
„Womit denn sonst?“, gab der Mann zurück. „Das Häuschen ist doch reizend, solange einem niemand Schauergeschichten vom Wilden Mann von Orford in die Ohren bläst.“
„Wer ist der Wilde Mann von Orford?“, fragte Iris.
„Niemand. Eine von diesen Altweiber-Geschichten, an denen sich die Touristen ergötzen. Sie haben in London Ihren Jack the Ripper und wir haben eben unseren Wilden Mann. Aber was stört Sie denn jetzt an Hengist Place? Haben Sie etwa nicht allen Komfort dort, den Sie brauchen könnten?“
„Doch“, musste Iris zugeben. Über den Komfort hatte sie sich selbst gewundert: Von dem Wasser, das selbst am frühen Morgen siedend heiß aus der Dusche rauschte, über die seidige Bettwäsche bis zu den dicken, flauschigen Handtüchern war das ganze Haus ausgestattet wie für einen Ehrengast. „Es liegt zu weit ab“, nannte sie den einzigen Kritikpunkt, der sich vorbringen ließ. „Ich kann nirgendwo einkaufen, komme morgens nicht hierher und abends nicht zurück …“
„Wieso denn das nicht? Mit dem Auto sind Sie doch in fünf Minuten in Orford.“
„Ich habe aber kein Auto.“
„Kein Auto?“ Simon sah sie an, als wäre es ein Verbrechen, sich ohne Auto in die Welt zu wagen. „Ja, aber wie wollen Sie das denn machen?“
„Ich hatte nicht erwartet, in völliger Einöde untergebracht zu werden“, versetzte Iris. „Und ich habe nicht vor, in dem Haus zu bleiben. Man hat mir gesagt, ich müsse mich deswegen an einen gewissen Caleb wenden. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich den finde?“ Die Handynummer eines Caleb hatte ja der Taxifahrer ihr gegeben, aber um denselben Mann würde es sich wohl kaum handeln.
„Meinen Sie wirklich, Sie sollten Caleb damit belästigen?“ Der Gleichmut des Mannes war verschwunden, seine Miene wirkte besorgt und bedrückt. „Ich kann Sie nach Hengist Place fahren, wenn Sie wollen. Ich kann Sie auch morgens abholen. Und wenn Sie mir eine Liste geben, bringt meine Frau Ihnen das, was Sie brauchen, vom Einkaufen mit.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen“, rang Iris sich ab. „Aber es ist keine Lösung. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Calebs Nummer geben würden, damit ich die Sache mit ihm regeln kann.“
„Wie Sie meinen.“ Er wandte sich ab, entnahm seiner Aktentasche einen Schreibblock und begann, ein paar Zahlen aufs Papier zu kritzeln. „Der Mann hat weiß Gott andere Sorgen und von uns wäre jeder bereit, Ihnen behilflich zu sein. Aber da mit Ihnen offenbar nicht zu reden ist …“ Er riss den Zettel mit der Nummer ab und hielt ihn ihr hin. Es war dieselbe Handynummer, die der Taxifahrer ihr gegeben hatte.
„Aber mit mir redet hier doch niemand!“, rief Iris, doch sie stieß auf taube Ohren. Ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, ließ er sie stehen und verließ den Raum.
6
Statt den mysteriösen Caleb anzurufen, unternahm Iris in den nächsten Tagen mehrere Versuche, mit ihren Kollegen ins Gespräch zu kommen. Sie wollte herausfinden, was so schlimm daran war, wenn sie den Mann um Hilfe bat, doch es war, als bisse sie auf Granit. Sobald sie den Namen auch nur erwähnte, verfielen die Männer wie auf Verabredung in Schweigen. Gegen dieselbe Mauer rannte sie mit der Frage, warum es im Team keinen Computerexperten gab. Für die Erstauswertung von Funden war ein solcher Spezialist dringend notwendig.
„Wir haben eben keinen“, hatte die lapidare Antwort von Michael gelautet.
„Was soll das heißen, Sie haben keinen?“ Allmählich hatte Iris die Maulfaulheit dieser Leute satt. „Aus den Unterlagen geht klar hervor, dass für diese Ausgrabung ein Computerexperte eingestellt worden ist.“
Michael zuckte die Achseln. „Er ist eben wieder weg.“
„Wieso ist ein Mann, der hier einen Auftrag übernommen hat, auf einmal wieder weg? Erzählen Sie mir nicht, er ist nach London gefahren, um sich die Olympiade anzusehen.“
Michael kniff ein Auge schmal, als müsse er sich genau ansehen, mit was für einer Idiotin er es zu tun hatte. „Die Olympiade ist Ende Juli.“
„Herrgott, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wo der Computerexperte abgeblieben ist, der mir für diese Grabung zur Verfügung stehen sollte.“
„Es war kein Mann von hier“, erklärte Michael endlich. „Er hat eben plötzlich abreisen müssen. Ein Unfall …“
„Der Computerexperte hatte auch einen Unfall?“
„Genaues weiß ich nicht“, antwortete Michael. „Er ist eben weg.“ Damit drehte er sich um und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
Auch aus den anderen war nichts herauszubekommen. Die Männer wirkten wie eine geschlossene Kette von Verschwörern und genauso enttäuschend verlief die Arbeit. Während in Stufen die ersten Schichten des Hügels abgetragen wurden, erwischte sich Iris dabei, dass sie wie eine Amateurin auf eine Sensation hoffte, einen einzigartigen Fund, der ihr den Respekt der Männer verschaffen würde, als hätte sie ihn persönlich in der Erde vergraben. Umgekehrt kam es ihr wie ihr persönliches Versagen vor, dass sie nichts fanden.
Dabei war das albern. Wenn überhaupt jemand schuld war, dann war es Dr. Ashmore, der die geophysikalischen Untersuchungen ausgewertet hatte. Im anderen Hügel waren ebenfalls nur ein paar metallene Haushaltsgegenstände gefunden worden, die zwar gut erhalten, aber keineswegs spektakulär waren. Da das üble Wetter anhielt, ließ Iris in den folgenden Tagen die Arbeit frühzeitig abbrechen und verbrachte die Abende über Grafiken und Berichten, um sich ein besseres Bild von den Ergebnissen zu verschaffen. Beim Blättern durch die Dokumentation konnte sie sich einen leisen Fluch nicht verkneifen. Die Computerausdrucke waren unvollständig. Offenbar hatte der Experte tatsächlich einen Unfall gehabt, denn anders ließ sich der abrupte Abbruch der Untersuchung nicht erklären.
Sie musste dringend für Ersatz sorgen. Wenn sie vom National Trust niemanden zu fassen bekam, würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als Andrew Sterne in London zu kontaktieren, und was der sich denken würde, konnte sie sich lebhaft vorstellen: Das war doch zu erwarten, dass eine Frau allein mit einer solchen Grabung überfordert ist. Die Blöße wollte sie sich nicht geben, also würde sie weiter darum kämpfen, hier vor Ort ein Bein auf den Boden zu bekommen.
Der Versuch, ihre Einsamkeit mit Arbeit zu überdecken, misslang gründlich. Windböen und Regenschwaden rüttelten an den Fensterscheiben und gaben ihr das Gefühl, inmitten tobender Naturgewalten mutterseelenallein zu sein. Selbst das Eintauchen in die Chronik des Beda Venerabilis, das sie sonst oft von allem ablenkte, blieb diesmal wirkungslos. Immer wieder griff sie nach ihrem Handy, tippte Helens Nummer ein und lauschte der monotonen Ansage der Voicemail. Hatte die Freundin sich etwa entschlossen, mit ihrer neuesten Eroberung zu verreisen? Aber so mitteilungsbedürftig, wie sie war, hätte sie Iris doch zumindest per SMS davon erzählt!
Auch bei dem ominösen Caleb meldete sich lediglich eine Mailbox. Eine computerisierte Stimme teilte ihr mit, der Teilnehmer könne ihren Anruf leider nicht entgegennehmen, sie solle bei Bedarf eine Nachricht hinterlassen. Der Kerl war offenbar noch zugeknöpfter als seine Landsleute – nicht einmal seinen Namen oder einen Gruß gönnte er seinen Anrufern.
Irgendwann entschied sie sich, die zweite Flasche Rotwein aus dem Korb zu öffnen. Iris trank sonst nie allein, aber die düstere Einöde zerrte ihr an Nerven und Gemüt. Als sie sich das zweite Glas einschenkte, wurde die Versuchung, Gareth anzurufen, übermächtig. Ehe sie sich daran hindern konnte, hatte sie die vertraute Nummer gewählt. Gareth gehörte wie Iris zu den Menschen, die grundsätzlich an ihr Handy gingen, weil sie Angst hatten, etwas zu versäumen. Jetzt aber hallte ihr dieselbe quäkende Computerstimme entgegen wie bei Caleb. Nur bekundete diese nicht, dass der Teilnehmer verhindert, sondern dass der Anschluss überhaupt nicht mehr vorhanden sei.