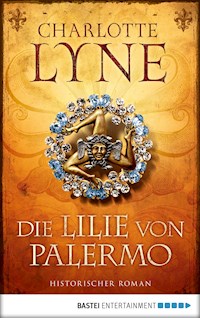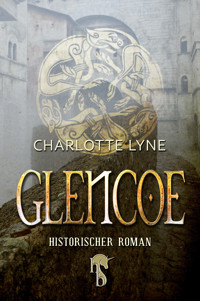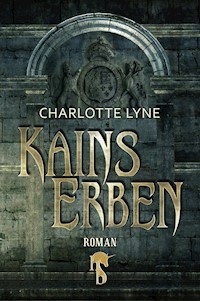
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Isle of Wight, im Jahr 1283: Das einsame Klosterleben der jungen Amicia endet jäh: Der Abt, unter dessen Obhut sie in Quarr Abbey aufwuchs, schickt sie auf eine gefährliche Reise nach England. Begleitet wird sie von einem undurchschaubaren Ritter König Edwards und seinem Tross. Ein vielschichtiger Roman vor dem Hintergrund der grausamen Familienzwiste, Machtkämpfe und Verfolgungen im mittelalterlichen England. Unterstützung bekommt Amicia von den ihr ans Herz gewachsenen Gefährten des Ritters. So kommt sie den schrecklichen Geheimnissen näher, die hinter den immer gleichen Bildern ihrer Albträume und verlorenen Erinnerung verborgen liegen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charlotte Lyne
Kains Erben
Historischer Roman
Prolog
Carisbrooke Castle, Isle of Wight, am Palmsonntag des Jahres 1273„Currite, dum lumen vitae habetis, ne tenebrae mortis vos comprehendant.“„Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes euch nicht überwältigen.“Benediktsregel, Prolog, 13
Es war still im Brunnenhof. Solch erhabene Stille gab es hier nur an hohen Feiertagen, und genau diese Stille brauchte Amicia heute. Sie hatte den Tag mit Umsicht gewählt.
Es war Palmsonntag. Tag des Triumphes und zugleich ein Tag voll bitterem Ernst. Am Morgen waren sie mit langen Eibenzweigen zur Kapelle St. Nicholas in Castro gezogen, allen voran die Priester in ihren Prunkgewändern, die Messdiener und die Jungen, die den Palmesel führten. Sie hatten Hymnen gesungen, die in den Morgen hallten, bis die Nebel sich klärten und verhaltenem Sonnenlicht Raum gaben. Heil dir, Festtag! Jesus, der Herr, zog in seiner Stadt Jerusalem ein.
Sobald aber die Messe vorüber war, senkte sich Schweigen auf die Gemeinde, denn mit dem Palmsonntag begann die Leidenszeit des Herrn. Auf lärmende Freude folgte finsterer Schmerz. Jedes Spiel war verboten, doch Amicia und ihre Freunde trieben kein Spiel. Was sie taten, war des Palmsonntags würdig.
Amicia würde an diesem Tag ihre Verlobung feiern.
So umsichtig wie den Tag hatte sie den Ort gewählt: Der Brunnenhof lag innerhalb des Donjons, des Wohnturms der Burg, von verstärkten Mauern umgeben und geschützt hinter einer bewachten Vorhalle. Der Burgherr hatte ihn einst dort angelegt, damit die Bewohner an Wasser kamen, falls die Burg belagert wurde. Für gewöhnlich aber schöpften die Mägde ihr Wasser am Hauptbrunnen bei den Stallungen, und an hohen Feiertagen wie diesem ging überhaupt niemand schöpfen. So hatten Amicia und ihre Freunde den Brunnenhof für sich.
Niemand würde sie erwischen. Hinter der Mauer zur Rechten lag das private Gemach der Burgherrin, doch diese benutzte es nur, um allein zu sein oder – gelegentlich – um mit Amicia am Fenster zu sitzen und ihr den Reichtum der Insel zu zeigen. Heute war Isabel nicht allein und hatte auch keine Zeit für Amicia. Nach der Messe war Adam gekommen und Isabel war mit ihm fortgeritten, einerlei, ob es sich am Feiertag schickte oder nicht. Amicia und ihre Freunde hatten unbemerkt durch ihr Zimmer in den Brunnenhof entschlüpfen können.
Jetzt standen sie hier, in zwei Paare geteilt, rechts Amicia und Abel und links Aveline und Vyves. Wann immer sie an ihre Freunde dachte, erfüllte es Amicia mit Stolz: Waren sie nicht die besten Gefährten, die ein Mädchen von acht Jahren, das nichts Besonderes, sondern nur ein Findling war, sich wünschen konnte? Ihr Bruder Abel. Ihre Freundin Aveline. Ihr Liebster, Vyves.
Gemeinsam waren sie etwas Besonderes. Sie waren die Kinder von Carisbrooke. Die letzten vier.
Noch im Herbst waren sie zu fünft gewesen. Dann war Thomas, Avelines Bruder, über Nacht gestorben. Isabel, seine Mutter, war nicht auf der Burg gewesen, doch die ärmste Aveline hatte alles miterlebt.
Mitleid überfiel Amicia. Sie könnte es nicht ertragen, ihren Bruder zu verlieren. Sie und Abel waren Zwillinge. Als Säuglinge in einem Korb beim Torhaus gefunden, von der Burgherrin Isabel aufgezogen; sie waren ohne Wissen um ihre Herkunft und doch nicht wurzellos, weil sie einander hatten. Amicia brauchte keinen Spiegel, wenn sie wissen wollte, wie sie aussah, denn sie sah aus wie Abel: Haar wie das Gefieder eines Amselweibchens, schräge, schmale Augen, ein grünes Blitzen zwischen schweren Lidern, breite Wangenknochen und ein forsches Kinn.
Jäh schmiegte Amicia sich in Abels Arm, obwohl der Bruder eine Handbreit kleiner war als sie. Zum Ausgleich war er der Klügste von allen. Er würde Priester werden, wenn er alt genug war, und schon heute sollte er die Rolle des Priesters übernehmen. Zuvor schloss er als Amicias nächster Verwandter für sie die Verlobung. Hätte sie einen Vater gehabt, so hätte der den Brautvertrag unterzeichnen müssen, doch wo der Vater fehlte, war ein Bruder der beste Ersatz.
Vyves hingegen, Amicias Bräutigam, hatte einen Vater. Er war der Sohn von Herrn Elijah, Isabels Finanzier, der unter ihrem Schutz innerhalb der Burgmauern lebte. Ihn aber hatten sie nicht bitten können, den Vertrag für seinen Sohn zu unterzeichnen.
„Es geht nicht“, hatte Abel zu Vyves gesagt. „Weißt du nicht selbst, dass es auf diese Weise nie möglich wäre?“
Auch die Ketubah, die Vyves hatte abfassen wollen, um nach jüdischem Brauch die Rechte der Braut festzulegen, hatte Abel ihm verwehrt. „Wenn du Amicia heiraten willst, musst du dich von alldem trennen, Vyves.“
„Aber das kann ich nicht!“, hatte Vyves ausgerufen. „Ich kann doch kein anderer werden, als ich bin.“
Bekümmert hatte Abel den Kopf gewiegt. „Das wirst du müssen. Du kannst nur Amicia wählen oder dein Volk.“
Starr vor Angst hatte Amicia dabeigestanden, überzeugt, sie werde es nicht überleben, wenn Vyves sich gegen sie entschied. Und er musste sich gegen sie entscheiden! Schließlich konnte kein Mann seinem Volk und der Ordnung, in die er geboren war, den Rücken kehren. Ratlos hatten sie einander angesehen, Amicia voll Zorn auf sich selbst, weil ihr die Tränen kamen.
Vyves rettete ihr das Leben, indem er schlicht aufstand, und erklärte: „Wenn es sein muss, wähle ich Amicia.“
Ich vergesse es dir nie, schwor ihm Amicia stumm. Solange ich lebe, ich vergesse es dir nie.
Wind wehte ihr den Schleier übers Gesicht. Sie hatte ihn aus Isabels Truhe genommen. Woher hatte wohl Vyves seinen blauen Surcot? Obwohl Vyves schon zehn Jahre alt und so gut wie ein Mann war, war er ihm zu groß, aber schön sah er trotz dem darin aus. Seine schwarzen Locken glänzten wie gelackt. Vyves, Vyves, Vyves! Ihr Freund, ihr Herzensgeliebter.
In seinen Augen blitzte ein Lächeln, und just in diesem Augenblick drang fahles Sonnenlicht durch die Wolken, und der Wind, der bis in den geschützten Hof drang, legte sich. Amicia spürte ihr Herz schlagen. Sie hatte ein Heim, sie hatte eine Familie, und sie würde ihr Leben mit dem besten Mann der Welt teilen. Konnte ein Mädchen auf Erden glücklicher sein?
Neben Vyves stand Aveline und blickte hilfesuchend hinüber zu Abel. Wie üblich wusste sie nicht, was zu tun war. Kein Mensch hätte erraten, dass dieses verlorene Wesen die Älteste von ihnen war. „Aveline wird immer ein Kind bleiben“, hatte Amicia Adam de Stratton sagen hören, und sowenig sie Adam mochte, darin musste sie ihm recht geben. Aber selbst wenn Aveline ein Kind blieb, so war sie nach Thomas’ Tod dennoch die Erbin der Burg. Deshalb kam es ihr zu, für Vyves den Vertrag zu unterzeichnen, auch wenn er ihr dabei die Hand führen musste.
Amicia warf einen Blick über die Brunnenmauer. Wie oft hatte sie mit Abel hier gestanden, um Steine in die schwarze Tiefe zu werfen. Hundertfünfzig Fuß tief war der Brunnen, sie hatten gezählt, bis der Stein mit einem Platschen ins Wasser tauchte: sieben, acht, neun, zehn. Sie würde es nie wieder tun. Die Zeit für solche Albernheiten war vorbei. Sie war kein Kind mehr, sondern eine Braut.
Abel nickte Aveline zu, dann trat er vor und senkte den Blick auf den Vertrag. „Ich, Abel von Carisbrooke, grüße Euch, Aveline de Fortibus. Ich geleite meine Schwester Amicia, die Amsel von Carisbrooke.“ Amsel von Carisbrooke – den Namen hatte Vyves ihr gegeben, weil sie amselbraunes Haar hatte und das Lied, mit dem in der Brunft ein Vogel dem anderen Antwort gab, täuschend nachahmen konnte.
Aveline warf sich in die magere Brust. „Ich, Aveline de Fortibus, geleite meinen Untertan, Vyves Chantor.“
„Vyves ben Elijah“, flüsterte Vyves, aber er lächelte und nahm es Aveline nicht übel, dass sie sich den schwierigen Namen nicht merken konnte.
Amicia sah ihn an. Sie und Abel besaßen überhaupt keinen Familiennamen, weshalb man sie bei dem Ort rief, an dem sie geboren worden waren, doch letztlich zählte nur, was heute verbindlich besiegelt wurde: Vyves und sie gehörten zueinander.
Vyves und Amicia. Amicia und Vyves. Um den Brunnen herum trat er auf sie zu und übergab ihr mit verschwörerischem Lächeln sein Brautgeschenk. Der Stein lag glatt in ihrer Hand – golden wie ihre Zukunft, klar wie ihre Bindung aneinander und in ihm eingeschlossen das Zeichen für Hoffnung und Geduld.
„Euer heutiges Versprechen ist bindend“, beendete Abel seine Ansprache. „Wenn einer von euch einen anderen nimmt, begeht er die Sünde der Bigamie. Ehe ich aber das Versprechen siegele, muss ich um Gottes Segen und Beistand beten.“ Er reichte Aveline den Vertrag, trat vor den Brunnen und kletterte auf die Mauer, als sei diese eine Stufe zu einem Altar.
Im nächsten Atemzug zerbarst die Stille. Metall klirrte, Holz splitterte, und mit dumpfem Krachen stürzte etwas zu Boden. Ein Schrei gellte in den Hof. Hufgeklapper und schwere Schritte folgten. Dann übertönte Avelines Schrei den Rest.
Amicias Gedächtnis fand keine Zeit, um Bilder zu speichern, nur zerstückelte Fetzen und Laute. Die Torflügel der Vorhalle brachen donnernd auf. Einen Wachmann, der zu fliehen versuchte, traf ein Schwerthieb in der Leibesmitte. Mit einem schwappenden Laut ergoss sich Blut auf den Stein, ehe der Tote zusammensackte. Zwei Reiter sprengten in den Hof, der vordere mit offenem Helm. Amicia sah ein junges, sommersprossiges Gesicht, dann schoss das Pferd an ihr vorbei, und eine Schar gerüsteter Männer stürmte hinterdrein. Im Nu war das schmale Viereck gefüllt. Vor verbeulten Brustpanzern hoben sich Lanzen, im blassen Licht glänzten Schwertklingen. Zwei Bewaffnete packten Aveline, die brüllte wie am Spieß. Der eine hielt sie bei den Schultern, der andere bei den Fußgelenken. Amicias Ehevertrag entglitt ihrer Hand und flatterte im Wind davon.
Was wollt ihr von uns?, versuchte Amicia zu schreien, wir sind doch nur Kinder, die am Palmsonntag ein harmloses Spiel spielen! Ihre Kehle aber war trocken wie Stroh, und eine Lähmung ergriff von ihren Gliedern Besitz. Es war Vyves, der zwischen Aveline und ihre Peiniger sprang, mit einem Todesmut, der unerträglich war. Einer der Männer packte sein Schwert bei der Klinge und schlug ihm den Knauf des Schaftes auf den Kopf. Vyves stürzte, blieb liegen, und der Mann hieb nach, als dresche er Korn. Über das Pflaster rann ein dünner Strom Blut. Von Neuem ergriffen die Männer Aveline, die jetzt nur noch wimmerte.
Zwei weitere Männer hatten ebenfalls die Schwerter gezogen, Anderthalbhänder, mit denen sie auf Abel zueilten. Der kniete noch immer auf der Brunnenmauer, hielt den Nacken gebeugt und bat Gott um Segen für Amicias Ehe. Steckte er so tief in seiner Austernschale mit Gott, dass er von alldem um sich herum nichts bemerkte? Erneut wollte Amicia schreien und konnte es nicht. Nicht Abel. Nicht ihn! Er war ein kleiner Junge, der den ganzen Tag Bücher studierte und niemandem etwas zuleide tat. Ihr Zwilling war er, die andere Hälfte, ohne die sie nicht vollständig war. Oft gab er sich lebensklug, doch in Wahrheit war er ein Kind und würde noch Jahre brauchen, um zu lernen, dass die Welt voll Übel war. Sie durften Abel nichts tun!
Das Schreien und Rasseln schwoll in Amicias Ohren zum Orkan. Einen Wimpernschlag lang, als der Reiter mit dem offenen Visier sein Pferd zur Seite lenkte, sah sie ein Gesicht. Neben dem Pferd stand ein Mann ohne Helm. Nein, kein Mann, sondern ein Junge, älter als Vyves, aber jünger, als der arme Thomas geworden war. Das Gesicht war von kalter, ebenmäßiger Schönheit, seine Augen brannten sich Amicia ein. Ungerührt stand der Junge dort, derweil ringsum Männer Amicias Leben in Stücke schlugen. Einer von ihnen stand vor dem betenden Abel auf der Brunnenmauer. Mit beiden Händen packte er den Schwertgriff und schwang die Waffe über seinen Kopf, doch ein anderer gebot ihm lässig Einhalt. Klirrend schob er das Schwert in die Scheide und stieß mit behandschuhten Händen Abel in den Rücken. Abel schrie nicht einmal. Er fiel vom Brunnenrand wie ein Apfel vom Baum.
Wie oft hatten sie in diesem Hof gestanden, endlose, sonnige Tage lang, hatten Steine in den Brunnen geworfen und gezählt, wie oft ihre Herzen schlugen, ehe die Steine ins Wasser platschten! Amicia konnte nicht anders, sie musste zählen: sieben – acht – neun – zehn. Das Geräusch tat ihren Ohren weh, und ihre Finger umklammerten ihr Brautgeschenk. Ihr Schrei gefror ihr in der Kehle.
Das Letzte, was sie erkannte, war das verzerrte Gesicht des fremden Jungen unter einem Himmel, der sich schwarz zuzog. Dann wurde sie von fremden Händen gepackt. Der Schlag gegen die Schläfe tat nicht einmal weh, sondern nahm ihr nur den Atem. Noch einen Schmerzensschrei hörte sie, markerschütternd und so lang gezogen, als würde er nie mehr enden. Funken sprühten vor ihr auf, winzige Drachen, die Feuer spien, und gleich darauf spürte sie Sackleinen, das ihr die Wangen aufschürfte. Als ein zweiter Schlag ihre Stirn traf, ließ sie sich endlich fallen und sah nichts mehr als gnädige Schwärze.
Erster Teil:Torhaus von England
Isle of Wight, Quarr Abbey,im späten Sommer des Jahres 1283„Sciatque abbas culpae pastoris incumbere, quidquid in ovibus paterfamilias utilitatis minus potuerit invenire.“„Auch wisse der Abt: Die Schuld trifft den Hirten, wenn der Hausvater bei seinen Schafen mangelnden Ertrag feststellt.“Benediktsregel, 2.7
1
Seit dem Ende des Winters war Magdalene mit ihrem Herrn Matthew unterwegs. So nannte sie ihn, ihren Herrn Matthew, und er nannte sie Mag, weil er ihren Namen zu pompös für sie fand. Wer ihr den Namen gegeben habe, hatte er gefragt und vermutet, sie hätte ihn von Gilles, dem Frauenwirt, weil sich Mädchen mit klangvollen Namen teurer verkauften. Magdalene aber hatte ihren Namen schon, solange sie denken konnte, auch wenn es mit dem Denken bei ihr nicht weit her war, und woher sie ihn hatte, das wusste sie nicht.
„Nun schön“, hatte ihr Herr Matthew gesagt, und dasselbe sagte er auch an dem Morgen, an dem er abreisen wollte und sie mit blau geschlagenem Auge bei seinem Pferd gefunden hatte. Sie müsse mit ihm gehen, sagte sie. Gilles habe sie aus dem Haus geprügelt, um des Herrn Matthew willen, denn dass eine von seinen Hübschlerinnen so viel Gefallen an einem Kunden finde, das dulde er nicht. In Wahrheit hatte sie sich selbst aufs Auge gedroschen, so kräftig sie konnte. „Nun schön“, sagte ihr Herr Matthew und seufzte. „Was bleibt mir anderes übrig?“ Seither waren sie zusammen unterwegs.
Zuerst war sie neben ihm zu Fuß gegangen wie sein Diener Hugh, der eigentlich zu alt und zu versoffen war, um der Diener eines so grandiosen Herrn zu sein. Über die Schmerzen hatte sie tapfer kein Wort verloren, doch ihr Herr Matthew hielt irgendwann einfach das Pferd an, sprang ab und befahl ihr: „Zeig mir deine Füße.“ Widerstrebend hatte Magdalene ihm die eiternden Blasen auf ihren Sohlen gezeigt, und im nächsten Marktflecken kaufte er ihr ein Maultier, das er fortan bei seinem Pferd führte. Ohne einen Grund dafür zu nennen, schnitt er ihr das Haar wie einem Jungen, gab ihr Kleider von Hugh und rief sie Mag. Magdalene war damit zufrieden. Er hätte sie Idiotin rufen und eine Narrenkappe tragen lassen können, sie wäre noch immer zufrieden gewesen.
Ihr Herr Matthew war beauftragt, Schulden einzutreiben. Kein schöner Auftrag für einen so schönen Ritter, fand Magdalene, aber das Geld, das er eintrieb, gehörte dem König, und der brauchte es für einen heiligen Krieg. So waren sie vom Norden, wo der Wind schneidend tobte, Meile um Meile nach Süden gezogen, auf London zu, wo der König auf das Geld wartete. Im Moment zogen sie über die Insel. Es würde Magdalene von Herzen wehtun, die Insel zu verlassen, denn sie hatte, solange sie denken konnte, nie einen so goldenen, sonnigen Ort gekannt und nirgendwo so wenig gefroren. In der Nacht, ehe sie einschlief, hörte sie das Meer rauschen, als flüstere es ein Nachtgebet, und bei Tag bekam sie im Überfluss zu essen. Mit ihrem Herrn Matthew aber wäre sie überall hingegangen, selbst in die Hölle oder in den ewigen Winter.
Sosehr Magdalene aufblühte, seit sie auf der Insel waren, so sehr verfiel Herr Matthew dem Ingrimm und der schwarzen Galle. Auf seiner schönen Stirn stand eine steile Falte, er aß kaum, schlief noch weniger und sang auch nicht. Magdalene, die das Gras wachsen hörte, vernahm, wie ihr Herr Matthew in den Nächten schlaflos umherging. Als sie ihn danach fragte, gab er unwirsch Antwort: „Was geht das dich an? Kümmere dich um das, was im verdammten Kochtopf schmort, und stiehl mir nicht die Zeit.“
Eines Morgens, als der versoffene Hugh ihm die Waffen nicht schnell genug anreichte, versetzte er ihm eine Ohrfeige.
Magdalene erschrak bis ins Mark. Dass Herren ihr Gesinde schlugen, war der Lauf der Welt, doch bei Sir Matthew hatte sie es nie erlebt. Er mochte wild und ungebärdig sein, und gefährlich war er ohne Zweifel, denn sonst hätten nicht all die säumigen Zahler ihm das Geld für den König ausgehändigt, aber er hatte nie einem von ihnen Schmerz zugefügt. Er hatte die Blasen an ihren Sohlen verarztet und Hugh Arznei gekauft, als der sich den Magen verdorben hatte. Er teilte sein Fleisch mit ihnen und ließ sie in seiner Nähe und unter wollenen Decken schlafen. Mit dem alten Hugh sprach er wie ein Mann zum anderen, obgleich jener ihm nicht antworten konnte. Hugh konnte auch jetzt, als er die Ohrfeige einstecken musste, nicht schreien. Hugh war stumm. Er hatte keine Zunge.
Sir Matthew starrte erst seine Hand an, dann die gerötete Wange des Dieners. Er fuhr herum und entdeckte hinter sich Magdalene, der Tränen aus den Augen strömten. „Hör auf zu heulen!“, fuhr er sie an. „Oder willst du dir auch eine fangen?“
Ja, mein Herr, dachte Magdalene. Wenn es dir hilft, deinen Frieden zu finden, will ich auch das. Vor allem will ich, dass dich die Scham nicht so quält – schon gar nicht für etwas, das jeder andere Herr schon längst getan hätte.
Kurz schien es, als hole Sir Matthew tatsächlich aus, dann ließ er die Hand schwer in den Schoß fallen. „Geht hinauf in die Kammer“, sagte er. „Lasst euch zum Abend vom Braten geben. Ich komme erst spät zurück.“
Hugh und Magdalene tauschten einen Blick. Der Diener wollte seinem Herrn zu Hilfe eilen, aber Matthew winkte ab, beendete die Arbeit mit den Waffen und ging, um sein Pferd zu holen. Das Pferd war ein heller Fuchs; die leuchtende Farbe seines Fells ähnelte der von Sir Matthews Haar. Über hundert Pfund sei es wert, tuschelten die Leute, und wie sein Reiter war es ein Wesen, von dessen Schönheit man den Blick nicht abwenden konnte.
Es trug einen seltsamen Namen, den Magdalene tagelang hatte üben müssen: Althaimenes. „Es ist verrückt, einem Pferd einen so langen Namen zu geben!“, war es ihr entfahren. Statt ihr böse zu sein, hatte Sir Matthew gelacht, was er kaum je tat, und behauptet, sein Pferd sei auch verrückt und dafür liebe er es. Magdalene wäre auch jetzt gern mit ihm gegangen, aber sie wusste: Wenn ihm überhaupt jemand helfen konnte, dann war es das Pferd. Von keinem Menschen sagte Sir Matthew je, dass er ihn liebte.
In allen Teilen des Landes, die Magdalene auf der Reise gesehen hatte, wüteten Mangel und Hunger, aber auf der Insel herrschte Fülle. Das Korn stand hoch, die Kronen der Bäume hingen schwer von Früchten, und das Gasthaus, in dem sie logierten, war eines Ritters würdig. Der Spießbraten, den der Wirt anbot, duftete hinaus in den Spätsommerabend. Er wurde mit gebackenen Äpfeln und Zwetschgen serviert, und wie so oft kippte Hugh sich dazu krugweise starkes Ale in den Schlund.
Magdalene stand der Sinn nicht nach Essen, denn ihre Gedanken kreisten um Sir Matthew. Als der Diener mit schwerem Kopf in Schlaf fiel, streifte sie die Männerkleider ab und zog sich ihr Kleid mit den Ziermünzen an, von dem Sir Matthew nicht wusste, dass sie es aufbewahrte. Mit dem gestutzten Haar ließ sich nicht viel anfangen, aber sie striegelte es mit dem Hornkamm, bis es unter ihren Fingern knisterte. Dann verbarg sie sich unter ihrer Decke und wartete auf ihren Herrn.
So lautlos, wie er ins Zimmer kam, so lärmend schleuderte er Helm und Kettenhemd fort. Statt sich erschöpft aufs Bett zu werfen, setzte er sich auf den Rand und starrte in die Finsternis.
Magdalene steckte die Kerze an und legte ihm zart die Hand auf den Mund. „Erschreckt nicht, Mylord.“ In den Jahren, in denen sie vom Verkauf ihrer Liebe gelebt hatte, hatte sie gelernt, so mit Männern umzugehen. Herr Matthew hatte ihr verboten, sich wie eine Hure zu betragen, doch das zählte jetzt nicht. Sie wollte ihn trösten, und sie kannte keinen besseren Weg.
Sie kämmte sein Haar mit den Fingern aus, bis es im zuckenden Licht der Flamme wieder schimmerte. Sie liebte die Farbe, das zugleich ins Rötliche und ins Goldene spielende Braun. Angesichts des hellen Haars verblüffte die Schwärze seiner Augen. Magdalene wollte sie unentwegt ansehen und lernte doch nie, sie zu lesen und Sir Matthews Geheimnis zu ergründen. Magdalene wusste nur eines: dass sie ihn lieben würde, ganz gleich, was er vor ihr und vor aller Welt verbarg.
Ihre Hand fuhr seinen Hals hinunter und strich ihm den verschwitzten Hemdstoff von der Schulter.
„Lass das bleiben, Mag“, sagte er, doch seine Stimme war voll müder Nachsicht.
Magdalene gehorchte ihm nicht. Seine Schulter und der halbe Rücken waren von den Narben eines Schwertkämpfers gezeichnet. Magdalene liebkoste jede einzelne, dann küsste sie sein Handgelenk, das immer wund war, weil er es sich gnadenlos mit den Fingernägeln zerkratzte. Warum er das tat, wusste Magdalene nicht, aber es zerriss ihr das Herz.
Er fing ihre Hand und hielt sie fest. Im rußigen Schein des Talglichtes sah er sie an. „Schluss jetzt. Wie oft habe ich dir gesagt, ich habe dich nicht mitgenommen, damit du mir allerorts verfügbar bist?“
„Warum habt Ihr mich dann mitgenommen?“
Matt lachte er auf. „Weil du mir keine Wahl gelassen hast. Wenn wir zurück nach Yorkshire kommen, bringe ich dich auf meines Vaters Burg. Gewiss findet sich dort eine Stellung als Magd.“
Magdalene wurde elend bei dem Gedanken. Sie wollte auf keine Burg gebracht werden. „Werdet dann auch Ihr bei Eurem Vater leben?“, fragte sie mit wenig Hoffnung.
„Ich? Gott bewahre. Zum sesshaften Leben tauge ich nicht.“
„Dann nehmt mich mit“, flehte sie ihn an.
Wieder lachte er. „Was soll ich mit dir denn anfangen?“
„Was immer Ihr wollt.“
„Du kannst nicht eben viel. Was du kochst, ist ungenießbar, und was du flickst, platzt am nächsten Tag wieder auf.“
„Ich kann Euch die Welt vergessen machen.“ Sie befreite ihre Hand und begann wieder, ihn zu streicheln, löste die Bänder an seinem Halsausschnitt und versuchte, die gespannten Muskeln seiner Brust zu lockern.
Er schob ihre Hand beiseite. „Glaubst du, dass ich das tun sollte? Die Welt vergessen?“
Sie nickte heftig. „Ja, das sollt Ihr, weil Euer Herz noch schwerer ist als Eure Rüstung, und weil mir bange wird, dass Euch die Last erdrückt.“
Sein Gesicht mit den schwarzen Augen wurde ernst. „Du nimmst mir übel, was heute Morgen geschehen ist, nicht wahr?“
„Nie im Leben!“, rief Magdalene. „Jeder andere Herr würde Hugh viel öfter schlagen.“
„Da hast du recht“, erwiderte er streng. „Und jeder andere Herr würde dir ein paar Rutenstreiche geben, weil du ihn von der Nachtruhe abhältst.“
„Nein, Mylord“, sagte Magdalene und fing mit flinken Fingern an, sich den Brustlatz aufzuknoten. „Jeder andere würde mich in die Arme nehmen und lieben, auch wenn er hundert Schöne haben kann und ich nur ein zerrupfter Hund bin. Aber er würde sich eben bescheiden, wenn keine zur Stelle ist, die mehr hermacht.“ Sie beugte sich vor und küsste ihn auf den Mund.
„Du bist ein unbelehrbares Ding“, sagte er. Seine Augen funkelten. Dann ließ er zu, dass sie ihn umarmte, sich mit ihm niederlegte und ihm die Bruche von den Hüften streifte. Er war müde, und Magdalene wusste, dass sie nicht gut genug für ihn war. Doch kein Mann hatte sie je so gut geliebt wie er: wild und ungebärdig, zu schnell und dennoch mit einer gedankenverlorenen Zärtlichkeit, die alles in ihr berührte. Von seiner Schönheit bekam sie nicht genug, so gab sie ihm noch Küsse auf jeden Zoll seiner Haut, als er längst eingeschlafen war.
Am Morgen erwachte Magdalene von der Sonne, die in die Fensterluke schien. Am Boden schnarchte der betrunkene Hugh, doch sie selbst fand sich selig zusammengerollt auf dem Bauch von Sir Matthew, der wach war und auf sie hinuntersah. „Oh, Mylord!“, rief sie erschrocken und bekämpfte zugleich die unbändige Lust, an dem Haar auf seiner Brust zu zupfen.
„Ach Mag“, sagte er, „du Siebenschläferin mit deinen kleinen Äuglein – was habe ich mir mit dir nur aufgehalst?“ Seine Stimme klang belustigt, doch Magdalene vernahm in ihr schon wieder Sorge und Verdruss.
Ehe sie ihn küssen konnte, schob er sie weg. „Jetzt mach, dass du aus den Federn kommst. Weck den schnarchenden Faulpelz, und dann schnürt das Gepäck.“
„Gehen wir denn heute auf See, Mylord?“ Der Gedanke, die Insel zu verlassen, schmerzte, doch um seinetwillen musste es sein.
Er wand seinen sehnigen Leib unter ihr hervor, setzte sich auf und streckte die langen Beine aus dem Bett. „Nein“, er widerte er, „wir ziehen nur ein Stück landeinwärts und bleiben ein paar Nächte in einem Kloster.“
Magdalene lehnte sich gegen seinen Rücken. „Mylord, sollten wir nicht besser heute als morgen gehen? Die Insel quält Euch doch so.“
Erstaunt blickte er über seine Schulter. „Ja, sie quält mich. Aber was hilft’s? Es gibt Geschäfte, die erledigt werden müssen.“
„Und warum quält sie Euch? Für mich ist sie das schönste Stück Land, das ich kenne. Ich habe nirgendwo besser zu essen bekommen und zufriedenere Menschen getroffen.“
„Genau so ist es!“ Wie ein Insekt schüttelte er Magdalene von sich ab. „Und was meinst du, wem all dieser Reichtum, die fruchtbaren Felder, die Fischgründe, die Ebenen voller fetter Schafe gehören sollten? Dem König von England, oder nicht? Diese verfluchte Insel ist ein Teil von England, sie liegt sogar so günstig vor Englands Küste, als hätte Gott uns ein Torhaus geben wollen, mit dem wir Angriffe von der Meerseite abfangen können.“
„Gehört sie dem König denn nicht?“, fragte Magdalene und bedauerte sogleich, dass sie weder vom König noch von anderem etwas verstand.
„Nein“, knurrte er. „Zumindest nicht auf dem Papier. Sie gehört einem verfluchten Weib namens Isabel de Fortibus. Sie sitzt auf ihrer Burg und lässt das Volk ringsum prassen, derweil der König jeden Schilling für seinen Kreuzzug braucht.“
Magdalene wollte eine Frage stellen, doch in diesem Augen blick drang Lärm in ihre Stube. Scharfes Gebell mischte sich mit Geschrei, eine Tür schlug, und Schritte hallten auf dem Weg. Im Nu war Sir Matthew in seine Kleider gesprungen und stürmte aus der Kammer. Magdalene brauchte ein wenig länger, um ihre Männerkluft wieder anzulegen und ihm zu folgen.
Es war, wie sie vermutet hatte: Der Hund des Wirts, eine abscheuliche Bestie von einem Mastiff, hatte sich von der Kette gerissen und die Frau eines Reisenden angegriffen. Der Wirt, die Wirtin und ihr Knecht hatten offenbar gepackt, was sie an Waffen erwischen konnten, und drangen mit Heugabel und Spaten auf den Höllenhund ein. Immerhin gelang es ihnen, das Tier von der schreienden Frau wegzutreiben. Dass sie es damit am Maul verletzten, machte es jedoch nur noch rasender.
Die Leute, die das Geschrei herbeigelockt hatte, wichen bis an die Mauer des Hauses zurück und versuchten, sich den Hund mit ihren Waffen vom Leib zu halten. Während der auf die Wirtin und den Knecht zupreschte, gelang es dem Wirt, zur Seite zu entwischen und eine Sichel zu packen, die an der Hauswand lehnte. Von hinten näherte er sich und hob die Sichel vor der Brust, ohne Zweifel in der Absicht, die Bestie zu töten.
„Halt!“, brüllte da Sir Matthew von der Tür her.
Der Mann erstarrte im Schritt.
Atemlos sah Magdalene zu, wie ihr Herr unbewaffnet, nur in Hemd und Hosen, auf das Untier zuging. Leise sprach er auf es ein, eine Flut von zärtlichen Worten, von denen sie keines verstand. Schon wandte ihm der Hund, der ausgesehen hatte, als wollte er der Wirtin an die Gurgel springen, den massigen Kopf zu. Sir Matthew ging dessen ungeachtet weiter, kniete vor dem Tier nieder, hob die Hand und klopfte ihm behutsam den eisengrauen Hals. Auf seine Knie troff blutiger Schaum von den Lefzen des Tieres.
„Armer Kerl“, sagte Herr Matthew und kraulte es hinter den Ohren. „Armer, wackerer Kerl.“
Der Wirt wagte beherzt einen Sprung und holte mit der Sichel aus. Ein starker, schneller Hieb auf den bulligen Nacken, und Sir Matthew wäre in Sicherheit. Der aber rief noch einmal, wenn auch sacht, um das Tier nicht zu erschrecken: „Nein. Bringt den Hund nicht um, ich zahle Euch gutes Geld für ihn.“ Mit der rechten Hand liebkoste er weiter das Tier, mit der linken nestelte er an dem Beutel, den er an einer Lederschnur um den Hals trug. „Was soll er kosten? Sind drei Pfund genug?“
Magdalene stockte der Atem. Kein Mensch bezahlte drei Pfund für einen Hund, schon gar nicht für eine Bestie, die erschlagen gehörte. „Aber nein, Mylord“, stotterte denn auch der Wirt, ließ jedoch die Sichel sinken. „Das ist zu viel, und ich kann Euch auch den Hund nicht verkaufen – er ist toll, er fällt nicht zum ersten Mal einen Menschen an. Ihm ist nicht zu trauen.“
„Ich traue ihm“, sagte Sir Matthew und warf dem Wirt die Münze zu. „Behaltet den Rest. Wie heißt er?“
„Wie er heißt? Er hat keinen Namen.“
„Armer Namenloser“, murmelte Sir Matthew und umfasste den Kopf des Mastiffs. „Ich wäre auch nicht gut zu haben, wenn ich meinen Leuten nicht einmal einen Namen wert wäre.“
Er stand auf, fasste den Hund am Halsband und führte ihn mit sich fort. Wenig später brachen sie auf – Sir Matthew zu Pferd, der Hund, dessen Wunden er im Stall mit Althaimenes’ teurer Salbe versorgt hatte und den er Nameless rief, lief an seiner Seite. Magdalene folgte auf dem Maultier und Hugh in gebührendem Abstand zu der grauen Bestie.
Anfangs konnte Magdalene an kaum etwas anderes denken als an ihre Angst, der Hund könne Sir Matthew angreifen, doch mit der Zeit nahm die Schönheit des Weges ihre Gedanken für sich ein. Sie durchquerten eine dichte Waldung, und da der Pfad handschmal und von knorrigen Wurzeln geädert war, tat Magdalene es ihrem Herrn gleich, sprang ab und führte ihren Maulesel am Zügel. Weich und federnd lag ein Teppich aus Nadeln unter ihren Füßen. Wenn sie den Kopf in den Nacken legte, konnte sie Flecken von Blau durch die Wipfel himmelhoher Tannen erahnen, und immer wieder schüttete die Sonne ihr Gold zwischen die Zweige, dass es schwer wie Honig daran heruntertropfte.
Das Laub zwischen den Nadelgewächsen färbte sich hier und da schon kupferrot, die Luft war wie schmeichelnde Seide und erfüllt vom Duft nach Harz. Magdalene freute sich am Anblick von Sir Matthews Schultern und spürte im ganzen Leib, wie sehr sie ihr Leben liebte. Das wohlige Gefühl blieb, als sie den Wald verließen. Sie saßen wieder auf und ritten zwischen Feldern hindurch, deren Ähren im Wind wogten, und über Koppeln, auf denen Schafe und gedrungene, zottige Pferde grasten.
Magdalene ließ ihren Blick über das weite Land schweifen.
Die Gebäude tauchten auf, als seien sie aus der Stille gewachsen, für die Ewigkeit erbaut in graugelbem Stein. Die zahllosen Häuser, die Magdalene auf der Reise durch das Land gesehen hatte, standen alle miteinander in Verbindung wie die Menschen, die sie gebaut hatten: die Katen der Bauern, die ihr Korn zur selben Mühle trugen, und die Behausungen der Dörfler, die aus demselben Brunnen Wasser schöpften, die Kapellen, gebettet in Nester aus Wohnstätten, und die Burg, die über alles wachte. Dieser Komplex von Gebäuden jedoch stand für sich allein und genügte sich selbst. Lediglich zur Rechten duckten sich ein paar Hütten in den Schutz der schweigenden Mauern. Über dem steinernen Ring ragte das Dach einer Kirche ohne Turm auf.
„Wir sind da“, sagte Herr Matthew, ohne sich nach Hugh und Magdalene umzudrehen. „Ihr wartet hier.“
So war es immer, wenn sie ein neues Quartier bezogen: Er ging allein voraus, um mit den Wirtsleuten über den Preis zu verhandeln, und holte dann Hugh und Magdalene nach. Heute aber war etwas anders. Mit dem Hund an seiner Seite ritt er auf die steinerne Front zu, als füge er sich in ein dunkles Schicksal. Der Gebäudekomplex war ein Kloster, hatte er gesagt. Weshalb um alles in der Welt waren sie hierhergekommen?
„Ich sorge mich um den Herrn“, sagte Magdalene zu Hugh, als sie nach Mittag noch immer warteten. „Ich denke, ich gehe dort hinüber und sehe nach, wo er ist. Du, achte mir auf das Maultier.“
Heftig schüttelte Hugh den Kopf und versuchte, Magdalene aufzuhalten. Sie aber befreite sich und lief los, ohne auf seine kaum menschlichen Laute zu achten. Sie rannte auf das Torhaus zu, in dem ihr Herr verschwunden war, zuerst durch hohes Gras, dann über einen Kiesweg, der unter ihren Sohlen knirschte. Je näher sie dem Tor kam, desto sicherer war sie, dass die eisenbeschlagene Tür, die hoch genug war, einen Reiter einzulassen, verschlossen sein würde. Ein Mensch, den sie um Einlass hätte bitten können, war weit und breit nicht zu entdecken.
Furcht erfasste Magdalene. Sie war nicht fähig, klar zu denken. Mit beiden Händen packte sie den riesigen Messingklopfer und ließ ihn donnernd gegen die Tür krachen. Als sich auch beim dritten Mal nichts rührte, ergriff sie die Klinke und rüttelte daran. Die Tür war viel schwerer als erwartet und bewegte sich kein Stück. Regte sich hinter dem Holz überhaupt Leben, oder hatte eine schweigende Totensiedlung ihren Herrn verschluckt? Magdalene rüttelte weiter, bis die Erschöpfung sie zum Innehalten zwang. Sie hörte Rufe, fuhr zusammen und blickte zu ihrer Rechten.
Hatte sie der Stimme nach auf eine Frau geschlossen, so entdeckte sie jetzt einen Burschen, der ihr aus Richtung der Hütten entgegenlief.
„Heda! Was tust du? Du kannst doch dort nicht hinein!“ Außer Atem blieb er stehen, beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie, um Luft zu schöpfen.
Er war ein hübscher Bursche. Für die Schönheit von Menschen hatte Magdalene einen Blick. Er war sehr schlank, und zwar größer als sie, doch gewiss einen vollen Kopf kleiner als Sir Matthew. Er trug das grobe Hemd und die Beinkleider der Bauern am Leib, dazu kurze Stiefel und eine lederne Kappe. „Was fällt dir ein?“, fragte er und richtete sich auf. „Was immer dein Anliegen ist – dort gibt es keinen Eintritt für dich.“
„Warum denn nicht?“
Der fremde Junge lachte auf. „Nun, warum wohl nicht? Was meinst du wohl? Was treibt dich überhaupt her, ich habe dich hier noch nie gesehen. Hast du Hunger? Dann komm mit, ich gebe dir ein Säckchen Korn.“ Er wies in die Richtung, aus der er gekommen war, und zog sich die Kappe vom Kopf.
Magdalene stockte der Atem. Die Züge seines Gesichts mochten kantig und hager sein, doch es bestand kein Zweifel: Vor ihr stand kein Bursche, sondern ein Geschöpf wie sie selbst: ein Mädchen in Jungenkleidern, mit lieblos abgesäbeltem Haar.
Dabei hätte das Haar recht schön sein können. Es war dicht wie ein Pferdeschweif und braun wie Amselgefieder. Die Augen allerdings waren seltsam: grünlich und hell und dennoch ohne Glanz.
„Tust du das immer?“, fragte die Fremde barsch.
„Tue ich was?“
„Einen Menschen, der dir seine Hilfe anbietet, zum Dank wie eine Missgeburt anglotzen.“
Schuldbewusst schlug Magdalene sich auf den Mund. Sir Matthew hatte sie deswegen auch schon getadelt: Sie starrte Menschen ins Gesicht, wie gebildete Leute in Bücher starrten, um darin zu lesen. „Tut mir leid“, sagte sie. „Hab Dank, dass du mir Korn geben willst. Es muss euch wohlergehen, wenn ihr das Korn so einfach verschenken könnt, aber mir ergeht es auch wohl. Mein Herr Matthew ist ein adelig geborener Ritter, und er sorgt für mich, wie ich es mir besser nicht wünschen könnte.“
„Wie freundlich von ihm. Darf ich erfahren, was du dann hier suchst?“
„Meinen Herrn“, platzte Magdalene heraus. „Er ist dort hineingegangen und nicht wiedergekommen. Er kommt sonst immer wieder, wenn er es uns sagt.“
„Uns?“
Magdalene wies auf Hugh, der vor dem Kiesweg mit dem Maultier wartete. „Seinem Diener und mir.“
Die Fremde nickte. „Anfangs habe ich auch dich für einen Diener gehalten.“
„Und ich dich …“
Einen Herzschlag lang flog ein offenes Lachen zwischen ihnen, dann verschloss sich das Gesicht der Fremden erneut. „Du musst jetzt gehen“, sagte sie. „Warte mit deinem Gefährten, bis euer Herr zurückkommt.“
„Ich gehe ihn lieber suchen.“
„Das tust du nicht.“ Die Fremde hob die Hand wie zum Zeichen, dass sie Magdalene notfalls mit Gewalt zurückhalten würde. „Wie töricht bist du? Weißt du nicht, dass keine Frau dieses Tor durchqueren darf?“
Töricht wohl, dachte Magdalene, aber eine von meiner Art geht durch so manches Tor, das für eine wie dich verboten bleibt.
Sie setzte einen Schritt und fühlte sich grob am Arm gepackt.
„Bei der heiligen Muttergottes, hat dir niemand gesagt, wer hinter dieser Pforte lebt? Die weißen Mönche. Die der Welt entsagenden Brüder von Quarr Abbey.“
Ehe Magdalene dazu kam, noch eine Frage zu stellen, wurde das Tor zurückgezogen, dass die Angeln ächzten. Sie wollte zur Seite hüpfen, um einen Blick ins Innere zu werfen, doch als Sir Matthew erschien, war alles andere vergessen. Er führte Althaimenes am Zügel, und der Hund lief an seiner Seite.
Wie so oft war Magdalene verblüfft, dass ein Mann so breite Schultern und eine Rüstung aus vierundzwanzig Teilen haben und dennoch so verwundbar wirken konnte. Sie musste den Wunsch niederzwingen, zu ihm zu eilen und ihre knochigen Arme um ihn zu schließen. Er wirkte geistesabwesend, versunken.
Die Fremde schien er nicht wahrzunehmen. Aber der Hund sah sie. Mit einem Satz preschte er auf sie zu, stieß einen grollenden Laut aus und bleckte die Zähne. Das Mädchen schrie und wollte weglaufen, doch der Hund war schneller. Wuchtig sprang er ihr an die Brust und warf sie nieder. Magdalene sah das Gebiss über der Gurgel des Mädchens und kniff die Augen zu.
„Zurück!“, rief Herr Matthew. „Nameless! Zurück!“
Ungläubig vernahm Magdalene das Tappen der Pfoten. Dennoch ließ sie mehrere Herzschläge verstreichen, ehe sie es wagte, die Augen zu öffnen. Sir Matthew kniete am Boden und liebkoste den Hals des Hundes, während Althaimenes an seiner Seite wartete.
Das fremde Mädchen rappelte sich auf. „Was fällt Euch ein?“, herrschte es ihn an. „Wenn Ihr verrückt genug seid, solch eine Bestie zu halten, legt sie gefälligst an die Kette!“
Gleichgültig hob Sir Matthew den Kopf „Der Hund greift niemanden an“, sagte er. „Es sei denn, derjenige zappelt und fuchtelt herum wie ein Idiot.“
Magdalene hörte die Fremde vor Empörung schnaufen. „Ich habe weder gezappelt noch gefuchtelt. Zudem frage ich mich, wer hier das Hausrecht hat – ich oder Ihr?“
„Abt Randulph von Quarr Abbey“, erwiderte Sir Matthew. „Ich bin sein Gast, und seine Gastfreundschaft schließt meine Gefährten ein.“ Dass er damit Althaimenes und den Hund ebenso meinte wie Hugh und Magdalene, machte er mit einem Nicken in Richtung des Tieres deutlich.
„Ihr seid“, fuhr das Mädchen auf, stockte und musste überlegen, mit welchen Worten Sir Matthew sich beschimpfen ließe. „Ihr seid die fleischgewordene Unverschämtheit!“ In ihren glanzlosen Augen glomm Zorn.
„Soso. Trifft das nicht eher auf dich zu? Bei mir zu Hause spricht keine Bauernmagd so verdreckt mit einem Herrn.“
Mit erhobener Hand sprang sie auf ihn zu, als wollte sie sich wahrhaftig erdreisten, ihn zu schlagen. Ein Schrei entfuhr Magdalene, der Hund knurrte, und auch Hugh eilte endlich herbei. Das Mädchen hielt inne. Hochmütig reckte es den Kopf. „Eure Regeln gelten für mich nicht“, erwiderte es ruhig. „Ich stehe außerhalb Eurer Ordnung und darf tun, was ich will, weil es mich im Grunde gar nicht gibt.“
Sir Matthew, der noch immer den Hund liebkoste, hielt ebenfalls inne und sah zu dem seltsamen Wesen auf. Dann erhob er sich. Die Blicke der funkelnden schwarzen und der leblosen grünen Augen trafen aufeinander. Magdalene, die ein törichtes Ding war, aber viel von Menschen verstand, begriff sofort, dass hier zwei Ebenbürtige einander maßen.
Sir Matthew brauchte lange, ehe er Worte fand. „Wie auch immer“, sagte er schließlich. „Ich habe keine Zeit, mich mit vorlauten Gören abzugeben. Ich suche eine Kreatur, die sich Amsel von Quarr nennt und mir ein Quartier für meine Leute anweisen soll.“
„Ich nenne mich nicht so“, erwiderte das Mädchen. „Amsel von Quarr ist mein Name, und wenn das Elfchen und der Tollpatsch Eure Leute sind, so sind sie mir willkommen, denn sie sind besser erzogen als Ihr.“
„Du bist die Amsel?“
„Habt Ihr etwas dagegen? Und darf man erfahren, wer Ihr selbst seid?“
Wieder verstummten beide.
„Matthew de Camoys“, sagte er endlich und deutete eine Verbeugung an, obgleich er die einer Bauernmagd nicht schuldete. Etwas in Magdalenes Brust begann zu brennen. Sie hatte sich nie etwas mehr gewünscht, als Sir Matthews würdig zu sein, und sie hatte sich damit getröstet, dass auch keine andere Frau, so hochgeboren sie sein mochte, seiner würdig war. Jetzt stand dieses Mädchen mit dem schief geschnittenen Haar vor ihm, beleidigte ihn und war seiner würdig. Und das Schlimmste war: Magdalene mochte sie und wusste nicht, warum.
„Welche Ehre“, bemerkte die Fremde spöttisch. „Und wie schade, dass Ihr an einen Ort gekommen seid, an dem ein klangvoller Name nicht halb so viel zählt wie ein frommes Herz.“
„Dein Gerede kratzt mich nicht. Wie steht es nun mit dem verdammten Quartier?“
„Zum Besten.“ Sie hob ihre Brauen. „Zumindest für bescheidene Menschen, die sich an schlichten Gottesgaben zu freuen wissen und nicht fluchen.“
Er zuckte zusammen, wie ein Junge, der sich unvermutet einen Klaps gefangen hat. Aber er fasste sich schnell. „Hugh. Mag. Ihr geht mit ihr“, befahl er. „Um mein Pferd und den Hund kümmere ich mich selbst.“
Die Kate des Amselmädchens, in der nun auch die Gäste der Abtei Obdach fanden, stand inmitten eines Gemüsegartens, den es allein bestellte. Darüber hinaus sorgte es für das Hühnerhaus, den Bienenstock und ein halbes Dutzend Schweine, die zu St. Martin geschlachtet werden sollten. Zwar durften die Mönche für gewöhnlich kein Fleisch essen, hatte die Amsel Magdalene erklärt, aber sie gaben es Kranken und Gästen und verdienten mit dem Verkauf von Wurst und Schinken Geld für den Unterhalt der Abtei. Das kleine Haus wirkte zugig und windschief, war jedoch aus solidem Fachwerk und Lehmbewurf gezimmert und erstaunlich gut beheizt. Im Gebälk hingen Würste zum Räuchern, und auf der Leine, die um das Haus gespannt war, trockneten silbrig glänzende Fische.
Die Amsel zeigte Magdalene einen Hain voller Obstbäume, der hinter den Gebäuden der Abtei lag. Ein Korb voll Äpfel stand im Haus auf dem Tisch. „Nimm dir, so viel du willst“, sagte sie. „Ich habe sie heute früh auf dem Friedhof gepflückt.“
„Auf dem Friedhof?“
„Es gehört zu den Lebensregeln der weißen Mönche, sich selbst zu erhalten. Deshalb nutzen sie das Land, so gut es geht, und ein Friedhof taugt zugleich als Obstgarten. Wer will, kann im Kreislauf von Winterruhe, Blüte und Frucht ein Sinnbild für Leben, Tod und Auferstehung erkennen.“
Magdalene sah sich um. Vor allen Katen waren Männer bei der Arbeit, doch trugen sie keine Kutten, sondern Bauernkittel.
„Die Mönche verrichten ihren Teil der Arbeit“, erklärte die Amsel, der Magdalenes fragender Blick nicht entgangen war. „Doch weil Gebet und Gottesdienst in ihrem Leben den größten Raum einnehmen, kümmern sich die Laienbrüder auf den Grangien um das Land.“
Magdalenes Blick wanderte an ihrer Gestalt hinauf und hinab. Er blieb an dem goldenen Stein hängen, den die Amsel an einem Band um den Hals trug. „Du siehst nicht wie ein Laienbruder aus.“
Die Amsel lachte auf jene freudlose Weise, die Magdalene von Sir Matthew kannte. „Ich habe es schon dem unsäglichen Menschen erklärt, mit dem du gekommen bist“, sagte sie. „Ich bin etwas, das es nicht gibt.“
„Herr Matthew ist kein unsäglicher Mensch!“, fuhr Magdalene auf. „Er hat eine dunkle Traurigkeit in seinem Leben, und sie hat mit dieser Insel zu tun, doch keine Faser an ihm ist schlecht.“
Auf ihre spöttische Weise verzog die Amsel den Mund. „Eine dunkle Traurigkeit? Nun, wenn du mich fragst, sind es Männer wie dein Herr, die den Menschen erst dunkle Traurigkeiten bringen. Er ist ein Eintreiber des königlichen Exchequers, oder nicht? Kein Ritter, der die Schwachen und Hilflosen schützt und für das Wohlbefinden der Allgemeinheit kämpft, wie mir über den Ehrenkodex eines Ritters berichtet wurde. Er soll machen, dass er seines Weges zieht; auf unserer Insel hat er nichts zu suchen!“
„Aber der König braucht doch Geld für seinen Kreuzzug …“
Die Amsel schüttelte den Kopf. „Was auch immer er braucht, er soll es sich holen, wo es ihm zusteht. Die Isle of Wight aber hat einer seiner Vorfahren den Baronen von Redvers für ihre Treue geschenkt, damit sie ohne Steuer und Scutage über sie regieren. So ist es noch heute. Auch wenn es keine Barone von Redvers mehr gibt.“ Sie brach ab. Offenbar hatte sie bemerkt, dass sie ihren Gast überforderte. „Na komm“, sagte sie und nahm Magdalenes Arm. „Richten wir dir ein Lager her, ich mag über diesen Widerling nicht mehr sprechen.“
„Du solltest ihn singen hören“, sagte Magdalene traurig. „Dann würdest du anders über ihn denken. Er singt ein Lied, davon zuckt es mir im Herzen, und auf einmal weiß ich, dass wir in dieser Welt beschützt sind. Verstehst du, was ich meine, oder spreche ich allzu dumm?“
„Nicht allzu dumm“, sagte die Amsel. Es klang, als lächle sie.
„Kein Mensch, der böse ist, kann so singen“, fuhr Magdalene eifrig fort. „Aber leider – seit wir auf der Insel sind, singt er keinen Ton mehr und rührt seine Laute nicht an.“
Die Amsel hörte ihr nicht länger zu, sondern wandte sich ab und schlug ihr ein Bett auf. Wie bequem es war, erlebte Magdalene in der folgenden Nacht: Sie hatte selten so fürstlich geschlafen. Auch hatten ihr Käse, Zwiebeln, Brot und saurer Wein nie so köstlich geschmeckt wie in dem kleinen Haus, doch sie hatte auch noch nie ihren Herrn so vermisst. Er kam nicht wie sonst am Morgen, um nach ihnen zu sehen. Magdalene bekam ihn lediglich von Weitem zu Gesicht, als er in der Frühe mit dem Hund davonritt. Er wirkte grimmiger und entschlossener denn je.
Sie machte sich in den Tagen, die sie in der Hütte verbrachten, nützlich, lernte von der Amsel, wie man Obst zu Sirup kochte. Keine andere Arbeit hatte ihr je so viel Freude bereitet. Es musste schön sein, in einem eigenen Häuschen zu wohnen, vom Land zu ernten, was man gesät hatte, und die Früchte seiner Arbeit auf den Tisch zu stellen. Wäre die Sorge um ihren Herrn nicht gewesen, hätte sie hier glücklich sein können.
„Warum gehst du nicht schlafen?“, fragte die Amsel, wenn sie vor Kälte schlotternd vor der Tür kauerte und auf seine Rückkehr wartete.
Magdalene schüttelte den Kopf. Sie würde nicht schlafen können, solange sie nicht wusste, dass auch ihr Herr hinter den schweigenden Mauern, die ihr den Zutritt verwehrten, schlief. Erst wenn sie Hund, Pferd und Reiter unter Sternen und Wolken vorbeifliegen sah, beruhigte sich ihr Herz.
Dann kam die Nacht, in der der Hund allein zurückkehrte. In der Finsternis heulte er so grauenvoll, als hätte er den Tod eines Freundes zu beklagen. Magdalene vergaß alle Furcht vor dem Tier. Wie vom Teufel gehetzt jagte sie zu ihm und schrie vereint mit dem wilden Geschöpf.
2
„Der Prior führe respektvoll aus, was ihm von seinem Abt aufgetragen wurde.“ So stand es im fünfundsechzigsten Kapitel der Benediktsregel, so war es an diesem Morgen im Kapitelhaus verlesen worden.
Während die Brüder gemessenen Schrittes aus dem Saal zogen, warf Abt Randulph seinem Prior einen Blick zu. „Respektvoll“ war wohl kaum das erste Wort, das einem zu Bruder Francis einfiel. Der Bruder brach zwar keine Regel, doch er dachte sich seinen Teil. Dennoch oder gerade deshalb hatte Randulph mit ihm die richtige Wahl getroffen, als er ihn zu seinem Prior gemacht hatte. Er brauchte einen Mann neben sich, keine Puppe an Schnüren.
Über das Wohl der Brüder zu wachen erforderte Entscheidungen, die Randulph an seine Grenzen trieben. Er betete täglich um Stärke, doch ohne den Austausch mit einem Mann wie Francis hätte die Bürde ihn zerbrochen. In seiner Jugend hatte er solch einen Ratgeber schon einmal gehabt – und ihn verloren. Er würde nie aufhören, ihn zu vermissen.
Für das Problem, das Randulph auf der Seele lastete, konnte auch der Prior unmöglich eine ideale Lösung wissen, aber Randulph brauchte eine Rückversicherung. Als Francis sich zum Gehen wandte, bedeutete er ihm daher durch einen Wink mit dem Krummstab aus Buchenholz, dem Zeichen seiner Abtswürde, ihm zu folgen.
Ohne ein Wort zu sprechen, verließen sie den Kapitelsaal und durchquerten den östlichen Flügel des Kreuzgangs, der das Herz der Abtei darstellte. Die herbe Frische des Morgens verriet, dass der Herbst schon in der Tür stand und dahinter der Winter mit seinen bitterkalten Nächten.
In den Lesenischen, die in der Mauer eingelassen waren, hatten sich Mönche die Kapuzen schützend in die Gesichter gezogen. Manche, so wusste Randulph, kauten dabei auf Pfefferkörnern, damit das Dunkel sie nicht in Schlaf lullte. Wegen der zerrissenen Nächte und der harten Arbeit am Tag waren sie ständig müde.
Randulph öffnete die Tür des Sprechzimmers neben der Tagestreppe und ließ den Prior ein. In seiner Schlichtheit war der Raum normalerweise geeignet, aufgewühlte Gemüter zu beruhigen. Warum meines nicht?, haderte Randulph. Er wusste, dass seine Unruhe für die Gemeinschaft gefährlich war. Er hatte seine Kindheit in den Mauern einer Burg verbracht, und auf seine eigene Weise war auch ein Kloster eine Burg: Eine einzige Schwachstelle konnte alle Stärke zu Fall bringen, und eine menschliche Schwäche war verheerender als jede andere.
„Ihr wolltet mich sprechen, Vater?“
Man erschrak stets aufs Neue, wenn man nach stundenlangem Schweigen die Stimme eines Mitbruders hörte. Randulph deutete mit dem Stab auf den einzigen Schemel im Raum. „Setzt Euch, Prior.“
Der andere tat, wie ihm geheißen. Er stellte keine Frage, sondern wartete ab.
Randulph hatte ebendies von ihm erwartet. Die Verpflichtung zu schweigen kam viele Brüder härter an als der Verzicht auf das Übrige: das Prassen, das Lieben, das Streben nach den Belohnungen der Welt. Prior Francis jedoch war seit frühester Kindheit im Kloster und im Schweigen aufgewachsen. Seiner undurchdringlichen Miene sah niemand die geschliffenen Worte an, die sich hinter seiner Stirn formten. Ein wenig glich er darin Randulphs verlorenem Gefährten, der einen Entschluss erst ausgesprochen hatte, wenn er unumstößlich war.
„Ich habe mit Euch zu reden“, sagte Randulph. „Den Grund dafür könnt Ihr Euch denken.“
Prior Francis sagte noch immer nichts, sondern wartete, bis Randulph ihm den Befehl erteilte: „Sprecht!“
„Ich kann mir mindestens zwei Gründe denken.“
„Dann nennt mir einen.“
Die Züge des Priors verfinsterten sich. „Der Teufel“, sagte er. „Adam de Stratton.“
Mahnend hob Randulph einen Finger. „Wenn ich es für nötig hielte, über das Wirken des Bösen zu sprechen, dann gewiss nicht ohne die vorherige Stärkung durch das Gebet. Adam de Stratton ist nur ein Mensch. Womöglich einer der schlechtesten und obendrein der gerissenste, der herumläuft, doch ewig wird er seiner Strafe nicht entgehen. ‚Mein ist die Rache‘, spricht der Herr. Was weltliche Gerichtsbarkeit nicht vermag, vollstreckt die himmlische umso sicherer.“
Mein ist die Rache. Wie oft hatte Randulph sich mit diesem Satz aus dem Deuteronomium zur Ordnung gerufen, und wie oft waren die Worte ungehört verhallt!
„Derzeit nützt uns das wenig“, bemerkte Francis. „Stratton hat unser Siegel von der Urkunde geschnitten, und damit gehen uns Gelder verloren, die die Abtei dringend braucht. Und wie damals, als er uns um die Ländereien bei Newport betrogen hat, schanzt er unseren Besitz seiner Bienenkönigin auf Carisbrooke zu.“
„Prior Francis“, fuhr Randulph ihm scharf ins Wort. „Es behagt mir nicht, Euch zurechtzuweisen, doch ich habe deutlich erklärt, dass ich über Adam de Stratton nicht sprechen will.“
Der Prior senkte den Kopf. „Ich bitte um Vergebung, Vater.“
Die Hoffnung, Francis werde das Thema von selbst anschneiden, war zunichte. So blieb Randulph nichts übrig, als es selbst zu tun. „Es geht um die Amsel.“
Prior Francis nickte.
„Ihr habt mich mehr als ein Mal sagen hören, dass ich sie keinen weiteren Winter auf dem Land der Abtei behalte, habe ich recht?“
Prior Francis zögerte, dann nickte er erneut. „Ich denke, in etwa zehnmal, mein Vater.“
„Ich sage es Euch jetzt noch einmal, und diesmal folgt den Worten eine Tat. Erinnert Ihr Euch noch an jenen ersten Tag? Palmsonntag. Der Himmel war wie mit Blei gefüllt, und als er aufbrach und sich über uns ergoss, glaubte man an den Weltuntergang. Nass bis auf die Knochen stand ich am Tor, wartete auf einen Knaben und bekam ein Mädchen. Vom ersten Blick auf es wusste ich, dass ich es fortschaffen musste, wenn ich den Frieden der Abtei nicht gefährden wollte. Aber wie hätte ich es dem grausamen Schicksal ausliefern können, das ihm zugedacht war? Es bleibt ein Geschöpf des Herrn.“
„Und wie konntet Ihr es Euch mit Adam de Stratton verderben? Er schneidet sich ohnehin von jedem Schinken, der Euch zukommt, seinen Batzen.“
„Ich gestatte Euch solche Reden nicht!“ Randulph sprang auf und hielt, ehe er sich versah, den bleiernen Kerzenhalter in der Faust. Der Jähzorn, die Familienkrankheit, die ihn letztlich zur Buße an diesen Ort verbannt und jede andere Hoffnung in ihm erstickt hatte, brach sich wieder einmal Bahn. Rasch vollzog er die Venia, die tiefe Verneigung, bis seine Knie und die Knöchel seiner Hände den Boden berührten. Sein Leib bat für ihn inniger um Vergebung, als sein Geist es vermochte.
„Adam de Stratton bat mich um einen Gefallen unter Glaubensbrüdern“, erklärte er, sobald er sich erhoben hatte. „Ich willigte ein, weil kein Zisterzienser einem Menschen in Not die Tür weist. Ich denke auch jetzt, nach mehr als zehn Jahren noch, ich habe das Einzige getan, das möglich war.“
„Ich hatte nicht vor, das zu bestreiten, Vater.“
„Das glaube, wer will. In jedem Fall kommt das Mädchen fort. Ich gebe es Matthew mit, wenn er aufbricht. Er will vor Einbruch des Winters in Yorkshire sein, und er kann mir das Mädchen nach Fountains Abbey schaffen.“
Der Prior verzog einen Mundwinkel. „Wenn Ihr ein Lamm fortschaffen wollt, gebt Ihr es einem Wolf in die Fänge?“
„Matthew ist ein christlicher Ritter, er folgt einem Ehrenkodex. Zudem weiß er nicht, wer sie ist. Er wird es schlicht als seine Pflicht betrachten, ein Mädchen, das ich ihm anvertraue, heil ans Ziel zu bringen.“
„Ich bitte um Vergebung, mein Vater – glaubt Ihr das wirklich?“
„Ihr kennt Matthew nicht!“
„Und Ihr?“
Eine Antwort saß Randulph auf der Spitze der Zunge, doch dort blieb sie und versiegte. Der Prior hatte recht. Matthew war ein Rotzbengel von acht Jahren gewesen, als Randulph ins Kloster eingetreten war. Dass er den Jungen damals gemocht hatte, zählte nicht, und dass er in seinem Gesicht die Züge wiederfand, die er einst geliebt hatte, erst recht nicht. Was Randulph von dem Mann, der Matthew geworden war, wusste, war alles andere als angenehm. Dennoch blieb ihm nichts übrig, als ihm zu vertrauen. Die Amsel musste weg. Dass Adam Siegel von Urkunden schnitt und nichts unterließ, um seine Feinde zu reizen, war nur eines der Zeichen dafür, dass die Schlinge um das Mädchen sich zuzog. Carisbrooke war nach wie vor ohne Erben, und Cyprian hatte Matthew auf die Insel gesandt – längeres Zögern konnte zum tödlichen Versäumnis werden.
Randulph unterdrückte ein Seufzen.
Cyprian. Der Name war und blieb der Refrain seines Lebens. Der Versuch, ihn aus seinem Wortschatz zu bannen, war sinnlos; er war mit dem Brandeisen in sein Gedächtnis geprägt: Cyprian, Cyprian, Cyprian.
„Ich habe keine Wahl“, sagte er zu Francis.
„Sie wird in Fountains ebenso wenig bleiben können wie hier.“
„Nicht für immer“, räumte Randulph ein. „Aber die Abtei ist größer und verfügt über mehr Verbindungen. Es soll dort sogar eine Zelle von Schwestern begründet worden sein, der sie sich anschließen kann.“
Dass er auch um seiner selbst willen das Mädchen fortschicken musste, behielt er für sich.
„Mein Vater“, sagte Francis leise.
„Prior?“
„Glaubt Ihr, die Amsel ist für ein Leben im Orden geschaffen?“
Randulph schloss kurz die Augen und behauptete: „Ja.“
Von Neuem schwieg der andere, bis Randulph wagte, ihn wieder anzusehen. Francis erschien ihm in diesem Augenblick unerbittlich – wie der Mann, der über seine Jugend gewacht hatte und lieber gestorben war, als im rechten Augenblick seinen Standpunkt zu leugnen. „Sagt mir, was Ihr denkt.“
„Ich denke, dass Ihr das Mädchen hierbleiben lassen solltet. Es sind so viele Jahre vergangen. Wer immer sich anfangs an seiner Gegenwart störte, hat sich inzwischen daran gewöhnt. Wenn einer der Männer, die einen Groll gegen Adam hegen, von ihm weiß, ist es überall in Gefahr, nicht nur hier. Und es betrachtet Quarr als sein Zuhause – zumindest soweit es einem aus dem Nest gefallenen Wildvogel möglich ist.“
„Es geht nicht, Prior! Sie war ein Kind, als sie herkam, doch sie ist keines mehr. In Fountains herrschen andere Verhältnisse. Nicht nur, dass man dort Schwestern die Gründung einer Zelle ermöglicht, sie haben auch Frauen auf den Grangien, zur Hilfe für die Konversen. Hier hingegen verstößt die Anwesenheit einer Frau gegen die Ordnung.“
„Tut sie das? Ist nicht die Geschichte der Amsel ein Fall, der außerhalb jeder Ordnung steht? Letztlich nennen wir sie deshalb doch die Amsel, statt sie bei ihrem Taufnamen zu rufen. Unsere Gemeinschaft hatte bisher die Kraft, damit fertigzuwerden. Bitten wir den Herrn, sie uns auch weiterhin zu verleihen und die Amsel in unserem Schutz zu belassen.“
Einen Herzschlag lang hasste Randulph seinen Prior in all seiner Selbstgerechtigkeit: Wie viel leichter war es doch, christliche Liebe und Mitleid zu zeigen, wenn das eigene Herz nicht beteiligt war! Besaß Francis überhaupt eines, hatte er die Versuchung der Gefühle je gekannt? Und wusste er, welches Glück er hatte, weil er als Knabe nach Quarr gekommen war, nicht als Mann, der bereits ein Leben geführt hatte? Francis hatte sein Torhaus zum Himmel gefunden, keine Vergangenheit hing ihm an, und kein Mensch zweifelte je an seiner Berufung. Für Randulph aber war es nie so gewesen. Es schien, als müsse er die Festigkeit seines Entschlusses jeden Tag und mit allem, was er tat, neu beweisen.
In sein Grübeln drang das Getöse, mit dem Fäuste an die Tür trommelten. Eine Beratung zwischen Abt und Prior störte man nicht, und war es doch einmal nötig, so klopfte man so zaghaft wie nur möglich an. Wenn jemand sich derart vergaß, musste es um Leben und Tod gehen.
„Ja!“ Randulph riss die Tür auf.
Im Gang stand Timothy, einer der Laienbrüder, die vor den Toren der Abtei lebten und für die Pferde sorgten. Im ersten Augenblick glaubte Randulph, der Mann werde ihm verletzt in die Arme stürzen, denn sein Hemd war vom Bund bis zum Hals mit Blut durchtränkt. „Die Mädchen, Vater“, stammelte er, „das Amselchen und die kleine Braune, sie sind in der Nacht mit dem teuflischen Hund los, weil der Herr der Kleinen nicht zurückgekommen ist. Am Waldsee haben sie ihn schließlich gefunden.“
„Gefunden“, wiederholte Randulph sinnlos. Dann begriff er. „Was ist mit ihm?“, fuhr er den Mann an. „Tot?“
Über seiner blutbefleckten Brust schlug Bruder Timothy das Kreuz.
3
Das Heulen des Höllenhundes hatte auch Amicia geweckt. Sie war es gewohnt, von viel leiseren Geräuschen aufzuschrecken, und jedes Mal saß sie kerzengerade auf dem Lager und presste die Hände auf ihr rasendes Herz. Amicia unterstützte die Mönche seit Jahren in der Krankenpflege, weil Abt Randulph befunden hatte, für ein Mädchen in ihrer Lage sei dies noch das Schicklichste. Sie wusste, dass es für ihr Herz gefährlich war, bei der kleinsten Störung zu jagen, aber was hätte sie dagegen tun sollen? So still und fern jeder Aufregung sie ihr Leben auch führte, es blieb für ihr Herz immer gefährlich.
Das Heulen des Hundes verhieß wirkliche Not, nicht nur die, die ihr Hirn ihr vorgaukelte. Sie sprang auf und stieg im Laufen in die Kleider. Die Tür der Hütte stand offen, die kleine Magdalene, deren herzzerreißendes Weinen sich mit dem der Bestie vereinte, musste vergessen haben, sie zu schließen. Herzzerreißend. Warum konnte sie keinen Menschen weinen hören, ohne das Gefühl zu haben, der Schmerz zerfetze ihr die Brust?
Es war Neumond, doch die Sternenfülle streute Lichter ins Dunkel. Amicia sah Magdalene hinter den Koppeln neben dem wilden Hund am Boden knien. Mit aller Kraft rannte sie und schrie: „Komm von dem Tier weg, du verrücktes Ding! Er ist toll!“
Magdalene hörte sie nicht. Erst als Amicia bis auf fünf Schritte herangekommen war, wandte sie ihr das Gesicht zu. Im Sternenlicht glänzte es tränenüberströmt. „Hilf uns, Amsel! Mein Herr Matthew – etwas Furchtbares muss ihm zugestoßen sein!“