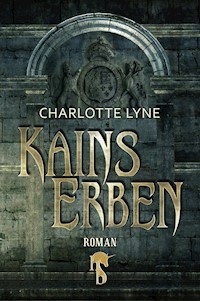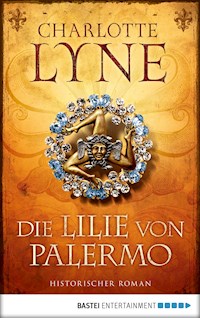
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem Viertel gilt die junge Aita ob ihrer Schönheit als Lilie von Palermo. Doch als sie sich beim Tanz in den Falschen verliebt, ihn gar küsst, wird sie vom begehrtesten Mädchen der Stadt zur Ausgestoßenen. Erst recht, als sie den, den sie alle >>il Diavúlu<<, den Teuflischen, nennen, auch noch zum Mann nimmt.
Aita könnte trotz allem glücklich sein, denn ihr fehlt es an nichts. Ihr Mann hat sich inzwischen einen Ruf als geschickter Schmied erarbeitet, fertigt für die Reichen und Mächtigen. Doch die Zeiten sind unruhig, immer mehr Sizilianer stemmen sich gegen die Herrschaft des Hauses Anjou. Können Aita und Emidio ihre Liebe auch in schweren Zeiten bewahren? Oder werden sie und ihre Familien im Streit der konkurrierenden Mächte zerrieben?
Ein berührender, mitreißender Palermo-Roman aus der Zeit der Sizilianischen Vesper
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
CHARLOTTE LYNE
Die Lilie von Palermo
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
In diesem Roman enthaltene Übersetzungen stammen von der Autorin.
Originalausgabe
Ein Projekt der ava international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: BestPix | Roberto Castillo | Tairy Greene | Marco Ossino | Vitalii
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3014-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Lola
No man is an island.
JOHN DONNE
OUVERTÜRE
Neapel, 29. Oktober 1268
In cor’ par ch’eo vi porti
Pinta come parete,
E non pare difore.
Im Herzen halte ich dich,
Dein Bild, wie es dir gleicht
Und wie es sich außen nicht zeigt.
Giacomo da Lentini, Begründer der Scuola Siciliana,Schöpfer des Sonetts, um 1230
1
Ihre kleinen Sohlen klopften aufs Pflaster wie Hämmer, die Kupfer trieben. Emidio, der dem Tumult auf dem Campo zusah und in Gedanken eine Zeichnung machte, erschrak und hielt inne. Er musste sich täuschen. Im Brausen des Menschengetümmels konnte nicht einmal das von Sehnsucht geschärfte Gehör eines Verliebten einen einzelnen Schritt erkennen. Dennoch war er sich sicher. Die schnellen Schritte gehörten Marianna, und so wie er die Zeichnung im Geiste vor sich gesehen hatte, sah er jetzt sie: ihre fliegenden Röcke, die feinen Flechten, die sich aus dem Gebände lösten, den fast noch kindlichen Brustkorb, der sich mit ihren Atemzügen hob und senkte.
Im Frühjahr war sie oft so gerannt, im Zickzack durch halb Neapel bis auf den belebten Platz, wo Emidio an Markttagen seine Arbeit zum Verkauf anbot. Er hatte es ihr verboten. Der Campo del muricino galt zwar neuerdings als Herz der Stadt, doch gelegen war er an ihrer kalten Schulter, die die Verführerin Neapel all jenen zeigte, die mit ihrem atemberaubenden Höhenflug nicht mithalten konnten: den Gottlosen und den Gottverlassenen, den Entrechteten und jenen, denen jedes Mittel recht war.
Emidio wollte nicht, dass Marianna sich allein durch das Spinnennetz dieser Gassen schlug. Es war keine Gegend für eine wie sie, und allein der Gedanke, ihr könne etwas zustoßen, schnürte ihm die Kehle zu. Er hatte zornig auf sie sein wollen, doch sooft er das Getrappel ihrer Sohlen vernommen und ihr vom Laufen erhitztes Gesicht erkannt hatte, war sein Zorn verraucht wie das Feuer beim Amboss, und seine Arme hatten sich geöffnet wie von selbst.
Wenn sie sich hineinwarf, war sie wieder das Mädchen, das bei ihm alles suchte: Schutz und Liebe und den Duft des wahren Lebens. Statt sie zurechtzuweisen, hatte er lächeln und sie in seinen Armen einschließen müssen, so fest und sicher wie in ihres Vaters Haus.
Nicht so heute.
Heute war kein gewöhnlicher Tag, und Marianna hätte sein Verbot nicht missachten und herkommen dürfen. Sie war zart, und ihre Brust mochte kindlich wirken, aber der geschwollene Leib ließ keinen Zweifel daran, dass sie kein Kind mehr war. Sie kam schon in Hörweite, außer Atem rief sie nach ihm, doch zwischen ihnen toste das Menschenmeer. Köpfe schnellten wie Wellenkronen in die Höhe, und eine sich bäumende Woge aus Leibern versperrte Marianna den Weg.
»Midiú! Ahime, Midiú!«
Sie sprach seinen Namen anders aus als jeder sonst in Neapel. Mit ihrer Art, den Vokal am Ende zu verdunkeln und in die Länge zu ziehen, verriet sie, dass sie beide fremd waren, dass sie nur zueinander und sonst zu niemandem gehörten. Auch nicht zu dem, den Beamte des Franzosenkönigs gleich durch die Menschenmenge und die Stufen hinauf auf das Holzgerüst schleifen würden, um ihn hier, vor den Augen der Gaffer, ums Leben zu bringen.
Sie waren Sizilianer, echte, nicht solche vom Festland, die lediglich demselben König untertan waren, aber von Sizilien nichts verstanden. Sie kamen von der Insel, ihre Sprache war dunkel und abgeschliffen wie Küstenfelsen, und die Stadt, in der sie geboren worden waren, hieß in dieser dunklen Sprache Paliemmu. Wenn man sich nach ihr sehnte, duftete sie nach Pinienharz und vor Reife geplatzten Orangen, wenn man in ihr erwachte, stank sie nach Pisse und verfaultem Fisch. Rot war ihre Farbe – rot für Feuer, Wein und Blut.
Die Sizilianer, so ging das Gerede, waren wie Stacheln im Fleisch der französischen Besatzer, stählerne Stacheln, die sich nicht beugen ließen, sondern sich einfraßen und Gift ins Blut träufelten, als säße dem verhassten König, Karl von Anjou, ein Seeigel auf der Schulter.
Was man nicht beugen konnte, zerbrach man. Emidio war Schmied, er wusste, wie groß die Versuchung war, störrischem Material mit brachialer Gewalt zuzusetzen, es nicht geduldig zu recken und auszuschmieden, sondern ihm blindwütig Hammerschläge zu verpassen, bis das Werkstück für alle Zeit verdorben war. König Karls Bewaffnete, die in zwei Reihen das Gerüst umstanden, hielten statt der Hämmer Schwerter und Lanzen. Wenn sie einen Sizilianer sprechen hörten, der sich keine Mühe gab, seinen Zungenschlag zu verbergen, horchten sie auf und umfassten ihre Waffen fester. Ein Rest verhangener Sonne ließ ihre Klingen blitzen.
Wäre einer dieser Wachleute unbewaffnet vor seinen Scharren getreten, hätte Emidio sich mit ihm auf ein Gespräch eingelassen. Glaubst du das wirklich, compagno?, hätte er ihn fragen wollen. Glaubst du wirklich, der kleine Deutsche, der Staufer, dem ihr den Kopf abschlagen wollt, wäre uns als König lieber als der Franzose, der uns knechtet? Schon recht, unter den Deutschen war unser Palermo eine strahlende Hauptstadt, während der Franzose es verkümmern lässt und seine Würde der Kurtisane Neapel vor die Füße wirft, doch warum sollte uns das scheren? Wir sind kleine Leute, wir knirschen unter der Steuerlast des Franzosen mit den Zähnen und haben genauso unter dem Deutschen geknirscht. Fremd sind sie uns beide, und wir auf Sizilien sind an Fremde gewöhnt. Byzantiner, Sarazenen, Juden, Griechen, Normannen, Deutsche – ihr Zeichen haben sie uns alle aufgebrannt. Der unglückselige Staufer gäbe nichts um uns – weshalb also sollten wir um ihn und sein Elend mehr als eine saure Feige geben?
Aber um solche Gespräche zu führen, war jetzt nicht die Zeit. Vor Emidios Scharren stand kein Unbewaffneter, der Lust zum Schwatzen hatte, sondern eine dicht gedrängte Horde, die Marianna den Weg abschnitt. Ihre verzweifelten Rufe verloren schon an Kraft.
»Midiú, hilf mir! Ich muss doch zu dir, Midiú!«
Jemand versetzte ihr einen Stoß, sodass sie ins Taumeln geriet und um ein Haar gestürzt wäre. Mit einem Satz sprang Emidio hinter dem Scharren hervor und stieß wie ein Rammbock in die Menge. Die brach auseinander, kreischend und zeternd flohen die Gaffer beiseite.
Emidio machte von der Kraft, die in seinem Körper ruhte, nur am Amboss gern Gebrauch, doch wenn jemand Marianna anrührte, kannte er kein Halten. Sie war sein Liebstes, niemand durfte ihr ein Haar krümmen, und Opfer hatte sie um seinetwillen schon genug erbracht. Einen Kerl, der nicht schnell genug aus dem Weg floh, stieß er beiseite, dass ihm die Kiepe vom Rücken kippte und ein Hagel von Zitrusfrüchten sich über den hart gebackenen Boden ergoss. Es klang wie einer der Trommelwirbel, mit denen die Steuereintreiber in Paliemmu die Leute aus der Deckung ihrer Häuser scheuchten.
»Midiú!«
Mariannas Rufen ging in Weinen über, und im nächsten Augenblick lag sie in seinen Armen. Entsetzen schüttelte ihn, während er vergeblich versuchte, die Bilder niederzukämpfen, die ihm durchs Hirn schossen: Marianna, seine kindlich schmale picciotta, zu Boden gestoßen, von einer Heerschar trampelnder Sohlen überrannt, der Leib vornübergekrümmt, um das zu schützen, was darin heranwuchs – den Funken Leben, noch schmaler, noch wehrloser, noch zerbrechlicher als sie. Emidio war nicht zart besaitet. Er war ein Schmied, ein robuster Bursche, der sich nie gescheut hatte, dem Leben ins Auge zu blicken, auch da, wo es wenig appetitlich war. Seine Liebe zu Marianna aber machte ihn verletzlich, und seit sie sein Kind erwartete, fühlte er sich an manchen Tagen, als hätte jemand die Haut auf seinen kräftigen Schultern mit dem Schabeisen dünn gewetzt.
Er hielt sie fest und spürte, wie sie in seinen Armen zusammenfuhr, weil er ihr wehtat. »Geschieht dir recht«, murmelte er und hielt sie noch fester. »Wozu rede ich überhaupt mit dir? Wozu erkläre ich dir geduldig wie ein Esel, was alles passieren kann, wenn du dir denkst: ›Dem, was der Dummkopf schwatzt, brauche ich nicht zuzuhören, und meine Ohren habe ich ohnehin nur, weil ihre Muscheln hübsch sind.‹«
Zaghaft hob sie den Kopf und sah mit weiten Augen zu ihm auf. »Findest du das wirklich? Dass meine Ohrmuscheln hübsch sind?«
»Darüber reden wir nicht. Lass die Koketterie.« Das war Unsinn. Koketterie war ihr fremd, und er fand alles an ihr hübsch, jede Haarsträhne, jede helle Wimper.
»Ich habe noch nie gedacht, dass du ein Dummkopf bist«, sagte sie. »Du bist der klügste Mann, den ich kenne, ich höre jedes Wort, das du sagst, und bitte sei mir doch nicht mehr böse, Midiú.«
»Ich bin dir aber böse!«, herrschte er sie an. »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben und die Tür verriegeln, weil heute in dieser Stadt der Teufel los ist?«
Die flache Hand, mit der sie ihm über die Brust gestrichen hatte, hielt still. Unter ihrer Handfläche vernahm er sein Herz. So war es vom ersten Tag an gewesen: Seit er sie kannte, spürte er sich selbst.
»Ich hab’s in der Wohnung nicht ausgehalten«, sagte sie. »Wenn der Teufel los ist, muss ich doch bei dir sein, amuri.«
Emidio empfand einen Anflug von Schwäche. Der Lärm um ihn schwoll an, der Tumult schien sich wie bei einem Wasserstrudel zur Mitte hin zu verdichten. Die Umschlingung, in der er Marianna hielt, wurde weicher, ohne sich zu lösen. Mit den Lippen zog er ihr das verrutschte Gebände, das sie von Rechts wegen nicht hätte tragen müssen, vom Kopf, ließ es fallen und küsste den milchblonden Schopf. »Nicht weinen, Marinuzza. Ist schon gut.«
»Wirklich, amuri? Bist du mir nicht mehr böse?«
»Aber ja doch. Was denn sonst?«
Er hatte ihr schließlich nichts vorzuwerfen. In dem Loch in Napoli sotterranea, das sie ihre Wohnung nannten, weil sie es unmöglich ihr Zuhause nennen konnten, ließ es sich nicht aushalten. Hätte er selbst den ganzen Tag über darin eingesperrt bleiben sollen, hätte er den Verstand verloren oder wäre ausgebrochen. Und dabei war Marianna viel weniger als er für einen solchen Ort gemacht.
Napoli sotterranea, Neapel unter der Erde, das war das Gewirr von Gängen, Kammern und Kanälen unter Neapels erhabenen Bauten, die zweite Welt, die sich unter der ersten verbarg wie das Reich eines dunklen Märchens, das man Kindern erzählt, um sie das Fürchten zu lehren. Es war schändlich, dass er Marianna kein angemessenes Heim bot, sondern sie in ein Nest für Ratten verbannte, seine Prinzessin, die für einen Palast geboren war. Eine Strandlilie, die man im Finstern hielt, verlor die zarten Blätter, und das Grün ihrer Stängel wurde grau.
Marianna aber beklagte sich nicht. Sie tat noch immer, als hätte sie nie einen Herzschlag lang bereut, ihrem behaglichen Heim, ihren fürsorglichen Verwandten, ihrer beschützten Welt entflohen zu sein, aus keinem Grund, nur weil sie Emidio Maniscalco liebte. Wann immer er in ihr Gewölbe zurückkehrte, flog sie ihm um den Hals. Sie hatten alles aufgegeben, sie viel mehr als er, und sooft er sie zögernd fragte, ob sie wahrhaftig ihre Entscheidung nie anzweifelte, hielt sie ihm den Mund zu.
»Sag nichts mehr, Midiú, sag kein Wort. Mir kommen solche Gedanken wie Sünde vor. Wo wir zusammen sind, wo uns das Kind geschenkt ist, wie kann es da etwas anzuzweifeln geben?«
Er grub das Gesicht in ihr Haar. Recht hatte sie, und sie beschämte ihn damit. Wie so oft. Sie war die gute, die zärtliche Hälfte von ihm, über die er manchmal lachen musste, weil er nicht an sie glauben konnte. Die Welt war nicht gut und zärtlich, sondern wild und gefährlich, sie zerbrach in Stücke: Der Heilige Stuhl in Rom, der Kaiserthron im Deutschen Reich – keiner der beiden Hüter, die dieser Welt Verlässlichkeit verliehen hatten, stand mehr fest auf seinen Beinen. Wer es heute mit dem einen hielt, schlug sich morgen auf die Seite des andern und half, seinem einstigen Herrn das Licht auszublasen. Emidio passte in diese Welt, er nahm es mit ihr auf. Er hatte stets gewusst, was er wollte, hatte an Stolpersteinen seine Kräfte erprobt und Unwägbarkeiten auf die leichte Schulter genommen.
Marianna war anders. Sie glich wahrhaftig keiner Lilie, die wild und widerstandsfähig am Strand wuchs, sondern einer kostbaren Rose, die behütet wie unter einer Haube aufgezogen worden war. Emidio schloss sie ganz in seine Umarmung ein, damit ihr nichts, das um sie tobte, etwas anhaben konnte, und spähte über die Köpfe hinweg nach dem Meer, das trügerisch wie falsches Silber glitzerte. Wenn er den Kopf leicht wandte, sah er statt des Meeres den Berg Vesuvio, von dem die Weiber, wenn der Priester sie nicht hörte, munkelten, er sei ein Tor zur Hölle, eine Schmiede des Teufels wie Siziliens Ätna. Andere schworen Stein und Bein, im Ätna, den die Sizilianer ihren Mungibeddu, ihren »schönen Berg« nannten, liege der große Staufer, Federico, das Staunen der Welt, und schlafe bis zum Tag seiner Wiederkehr.
Emidio sah seinen Gedanken zu, die mit den bleigrauen Wolken über den Krater des Feuerbergs hinwegschweiften – über den Himmel und durch die Zeit zurück, bis zu dem Tag, an dem Marianna ihm geschenkt worden war.
2
Mariannas Onkel, Ruggiero Tusco, war einer der streitbaren sizilianischen Barone, dessen Geschlecht auf rätselhaften Wegen alle Machtwechsel und alles Gemetzel überlebt hatte. Seinem Normannenblut war der Franzose Karl sogar lieber als die gesammelte Brut von Friedrich, dem Staufer, und seit Karl vom Papst mit Sizilien belehnt worden war, hatte er Boden zurückgewonnen und sich dem neuen Herrn als Justiziar angedient. Vermögen war Ruggiero und seiner Sippe kaum geblieben, der Samt ihrer Kleider war räudig wie Hundefell, doch ihr Stadthaus am Cassaro, der breiten Hauptstraße hinauf zum Palazzo Reale, das sie nach Normannenart ihr Palais nannten, führten sie noch immer in Glanz und Gloria.
Ruggiero Tusco hatte eine Gattin nach der anderen in ein frühes Grab getrieben, war dabei kinderlos geblieben und hatte daher zu seiner Bequemlichkeit und in Hoffnung auf einen Erben seine Schwester und seinen verarmten Schwager ins Haus genommen. Der alten Familie war offenbar der Saft der Fruchtbarkeit verdorrt, denn auch Schwester und Schwager brachten nicht mehr als ein einziges Kind zustande, eine einzige kostbare Tochter – Marianna. Fein und süß und vollkommen, als wäre in Generationen alles Grobe und Hässliche aus dem edlen Blut herausgefiltert worden, um diese eine Perle hervorzubringen.
Aber auch alles Stabile, Lebensfähige, dachte Emidio. So, wie sie sich jetzt in seinen Arm schmiegte, kam sie ihm wieder einmal zu zart vor, um den leisesten Sturm zu bestehen.
Dabei war das Unsinn. Marianna, die Erbtochter der Tusco, hatte einen Sturm bestanden, vor dem viel Stärkere die Waffen gestreckt hätten. Ihr Weg war ihr vorgegeben worden wie in Eisen geschmiedet: Den Gatten hatte ihr Onkel ihr ausgesucht, als sie noch in der Wiege lag; er hatte für sie ein gültiges Verlöbnis mit einem Adelssohn aus Catania geschlossen, der Geld und Ansehen zurück ins Palais der Tusco bringen sollte. Stattdessen hatte die stille, gefügige Marianna sich in einen hergelaufenen Burschen verliebt, den Sohn des Helmers, der im Auftrag seines Vaters Eisenhüte für Ruggiero Tuscos Wachleute auslieferte.
Ein Helmer, der den unentbehrlichen Kopfschutz der Ritter schmiedete, war ein angesehener Handwerker, ganz anders als ein gewöhnlicher Schwarzschmied, der am Stadtrand zu hausen hatte und als Schoßkind des Teufels galt. Die Werkstatt von Emidios Vater florierte, sie hielt drei Lehrlinge und zwei Gesellen in Lohn und Brot. Dennoch blieb ein Handwerker eben ein Handwerker, einer, dessen Sohn man im Hof abfertigte, den man bestenfalls noch an die Tür des Küchenhauses schickte: »Na, geh schon, sag den Mägden, sie sollen dir vom Mandelgebäck ein bisschen Bruch zustecken.«
Emidio wollte kein Mandelgebäck. Und dass er das, was er nicht wollte, auch nicht schluckte, hatte er bewiesen, so lange er denken konnte. Er war ruhig, wirkte besonnen, niemand vermutete den Rebellen in ihm, doch er hatte von klein auf, vom ersten Tag, an dem sein Vater ihn mit in die Schmiede genommen hatte, gewusst, dass er kein Helmer werden wollte. Statt die Arbeit zu tun, die der Vater ihm auftrug, hatte er das teure Pergament vergeudet, um zu zeichnen. Hatte der Vater ihn erwischt, hatte er vor dem versammelten Haushalt den Hintern hinhalten müssen und wäre gern gestorben, doch den Bildern in seinem Kopf hatte selbst das nichts an. Sie halfen, es durchzustehen. Jedes Mal, wenn der Stecken auftraf, hatte er fest auf seine Hände gesehen, die schnellstmöglich weiterzeichnen wollten, so, als hätte der Körper, der unter dem Gelächter der Lehrlinge wie ein wertloses Ding verdroschen wurde, nichts mit ihm zu tun, als bestünde er nur aus dem Kopf, in dem die Bilder erstanden, und den Händen, die ihnen Wirklichkeit verliehen.
Der Vater erfasste, was vorging, zerrte Emidio in die Höhe und befahl ihm, seine Hände auszuliefern. Statt des Steckens nahm er das Halfter seines Gauls, dessen eiserne Schnallen er selbst geschmiedet hatte, und zielte auf Emidios Fingerknöchel. »Dich werde ich lehren, dich zu fügen, bonu a nulla. Ziegenhaut und Tintenhörnchen sind für Kunden, die einen Entwurf verlangen, nicht für Bürschlein, die sich zu fein sind, um brav ihr Handwerk zu erlernen.«
Emidio hätte sich gern gefügt und brav sein Handwerk erlernt. Die Schläge taten so weh, dass er sich die Hosen nass machte, und die Demütigung machte ihn sich selbst zuwider. Eine Wahl hatte er trotzdem nicht: Die Bilder waren in ihm gewesen, so lange er denken konnte, sie ließen ihn nur los, wenn er sie bannte, und seit er die Höhle in der felsigen Flanke des Pellegrino entdeckt hatte, war er besessen davon. Alles in ihm konzentrierte sich darauf, sie festzuhalten.
Solange seine Finger zu verschwollen waren, um eine Feder zu führen, lernte er, sich die Bilder ins Gedächtnis zu zeichnen. Das war ein Notbehelf, doch er sparte Pergament. Später stellte ihn der Vater an den Amboss, und er erkannte, dass sich Bilder aus Eisen schmieden ließen – Bilder, wie man sie niemandem schildern konnte, ja, wie man sie nicht einmal selbst erahnte, ehe das Metall erglühte und nachgab und der erste Hammerschlag ihm eine brandneue Form verlieh.
Die Sarazenen, die Paliemmus Gesicht nicht weniger gezeichnet hatten als die Christen, prägten Bilder in ihre Moscheelampen, Rauchgefäße, Wärmebecken. Ihr Glaube verbot ihnen, die Schöpfung ihres Gottes auf Papier zu bannen, wie sein Vater es Emidio verbot, doch in ihrer Schmiedekunst lebten sie ihre schillerndsten Visionen und ihre dunkelsten Träume aus. Ohne es zu bemerken, hatte Emidio, der in La Kalsa zur Welt gekommen und wie ein Köter durch die muselmanischen Quartiere der Stadt gestreunt war, sich ihren Weg zu eigen gemacht.
Er lernte, das Eisen zu lieben, auch wenn er noch lieber Kupfer gehabt hätte, weil es weicher und formbarer war und weil die Farbe ihn an den rötlichen Wandstein in der Höhle erinnerte. Manchmal stahl er aus der Kasse der Schmiede eine Münze und kaufte eine Platte, trieb sie mit dem Hammer oder erwärmte sie und versuchte, in ihre schimmernde Oberfläche seine Bilder einzugraben.
Wenn er ganz und gar vermessen war, träumte er davon, Silber zu benutzen.
Es setzte härtere Prügel, Drohungen; am Ende hätte sein Vater ihn um ein Haar hinausgeworfen. Er schleuderte ihm ein Bündel auf die Schwelle und schlug ihm vor Lehrlingen, Gesellen und seinen drei Schwestern ins Gesicht. Dann aber, gerade als Emidio sich mit bleischweren Gliedern zur Tür schleppen wollte, besann sich der Vater und hielt ihn zurück. Ein respektabler Handwerksmann zerstritt sich nicht mit seinem Erben, schon gar nicht Pietro Maniscalco, der Helmer, der Siziliens Königshaus belieferte, und gewiss war kein Vater – nicht einmal der große Pietro Maniscalco – völlig frei von Gefühl für seinen Sohn, selbst nicht für eine Enttäuschung wie ihn. Emidio gab sich redlich Mühe, dem Vater gefällig zu sein, doch gegen die Bilder, die sich in seinem Kopf verbreiteten wie Pilze auf dem lehmigen Boden der Pinienwälder, vermochte er nichts auszurichten.
Seine Gefühle für die Nichte des Barons wollte er dagegen niederkämpfen, noch ehe sie in ihm Wurzeln schlugen. Sein Gewissen verlangte es von ihm. Bei allen Heiligen hätte er geschworen, dass er dem zauberhaften Mädchen, das an einem glutheißen Tag an die Küchentür des Palais gekommen war, um ihm einen Becher Wein zu geben, kein Leid tun wollte.
Mit dem schweren Eisenzeug, das er zu liefern hatte, war er die Anhöhe hinaufgerannt. Unter dem Hemd lief ihm der Schweiß in Strömen, und doch wäre niemand auf den Gedanken gekommen, der grobschlächtige, linkische Sohn des Schmieds könne Erholung oder gar Erfrischung nötig haben.
Niemand außer Marianna.
»Wollt ihr unser Haus beschämen?«, hatte sie die Mägde angefahren. »Ihr lasst den Mann in der Hitze stehen, ohne ihm etwas zu trinken anzubieten? Bringt Wein! Auf der Stelle! Nicht von dem sauren Zeug zum Kochen, sondern vom Schwarzen, den der barone trinkt.« Ihre Stimme war fein wie Grillenzirpen, und Emidio hatte lachen müssen, weil dieses feine Stimmchen die Mägde zum Kuschen brachte.
»Hier. Nehmt das mit meiner Bitte um Vergebung, Signur’.« Ihre Hand schien zu klein, den schweren Becher zu halten.
»Ich bin kein Signur.«
Ihre hellen Augen hatten sich erstaunt geweitet. »Ihr seid ja wohl ein Mann, oder sehe ich schlecht?«
Mit Erschrecken hatte Emidio gespürt, dass er in der Tat einer war. »Aber kein Herr.«
»Für mich schon.« Sie schob ihm den Becher in die Hand. »Jetzt trinkt. Wein aus schwarzen Trauben von den Hängen des Pellegrino. Er ist tiefgründig, finde ich. Die Sonne bäckt seine Erde hart, und die Pinien geben ihm Schatten, Duft und Seele.«
Verblüfft umfasste Emidio das Gefäß. Er hatte drei Schwestern, von denen keine ein Blatt vor den Mund nahm, aber kein Mädchen, das er kannte, hätte von einem Wein gesagt, er habe Seele. Das Mädchen hatte blaue Augen. Nicht meerblau, sondern wie eine Schattierung in Perlmutt. Auch das kannte er nicht. Er trank einen Schluck und hätte ihn um ein Haar wieder ausgespuckt. »Santa Matri di Diu! Trinken Eure Leute dieses Bullenblut immer unverdünnt? Und einer kleinen Grille wie Euch geben sie es auch?«
Das Mädchen mit den Perlmuttaugen sah zu ihm auf. »Ich bin keine Grille, sondern ein Mensch, und dass ich kleiner bin als Ihr, macht mich nicht rechtlos. Wenn ich Wein trinken will, dann schenke ich mir welchen ein.«
Schwach lachte er auf. Er fühlte sich in die Schranken gewiesen und trank um Worte verlegen seinen Wein. Dabei sah er über den Becherrand nach dem Mädchen, dessen Haut so blass war wie der Wein voll Farbe, und doch schien in beiden gleich viel Kraft zu stecken.
Jetzt, wo er hier, auf Neapels belebtestem Platz mit ihr stand und sie an sich zog, um sie vor dem Ansturm der Menge zu bewahren, empfand er noch einmal dasselbe. Sie mochte zerbrechlich gebaut und unscheinbar sein, aber ihre Willensstärke konnte sich mit der seinen messen. Nein, das war falsch – ihre Willensstärke stellte die seine in den Schatten. Vielleicht, so versuchte er sich zu erinnern, hatte er sich damals in sie verliebt. Ohne Zögern. Er hatte sie angesehen und sich in seinem Kopf ein Bild von ihr gemacht, das unauslöschlich war.
Umso brüsker hatte er ihr den Becher zurückgegeben und war gegangen. Was hätte er sonst tun sollen? Sie war für ihn nicht bestimmt, daran ließ sich nicht rütteln. Kein Baron Siziliens gab seine Nichte im weißen Spitzenkleid dem Sohn eines Schmieds, schon gar nicht einem, der nichts taugte, schon gar nicht einem bilderspinnenden Verrückten, der in einer ungelenken Masse von Körper steckte. Marianna aber hatte darüber anders gedacht. Am Abend stand sie in Schwaden von stinkendem Qualm vor der Hintertür der Schmiede.
»Das war nicht nett«, sagte sie. »Einfach zu verschwinden und mich stehen zu lassen. Bei der Küche hast du mich so lange angesehen – also dachte ich, ich gefalle dir.«
Sein Vater war bei einem Herrn in Monreale, um dessen Reisigen Helme und Halsbergen anzupassen. Emidio hatte der Versuchung nicht widerstehen können und an einem Kerzenleuchter geschmiedet, obwohl Cammelú, der als Lehrling am längsten in der Werkstatt war, der Luft einen Hieb verpasst und ihn gewarnt hatte: »Gutes Schmiedeeisen verderben? Oh weh, ich fürchte, das setzt Saures, Midiú. Besser, du verkneifst es dir.«
»Willst du mich verraten?«
»Ich bin dein Freund«, gab Cammelú empört zurück. »Das hat man gerne – ich mache mir die Mühe, dich zu warnen, weil mich die Schläge, die du bekommst, am eigenen Leib schmerzen, und dafür muss ich mich als Verräter beleidigen lassen. Dabei habe ich mir eingebildet, du wüsstest, dass ich mir lieber selbst Prügel von deinem Alten einhandeln würde, als dich ihm auszuliefern.«
So war Cammelú. Wer mit ihm sprach, musste auf seine Worte achten, denn er fing die kleinste Bemerkung auf wie ein gegen sich gerichtetes Schwert. In jedem Winkel der Welt witterte er Feinde, die nichts anderes im Sinn hatten, als ihn zu kränken. Emidios Liebe zu ihm tat das keinen Abbruch. Sie waren Freunde, umso mehr, als sie beide zu verschlossen und unbeholfen waren, um im Kreis der Gleichaltrigen ihren Platz zu finden.
Zuweilen versuchte er, Cammelús Empörung zu besänftigen, doch an jenem Nachmittag hatte Emidio unbeirrt weitergeschmiedet. Jetzt hielt er das fertige Werkstück in der Hand, um es zu verbergen, bevor der Vater nach Hause kam. Er blickte auf das schlanke Gebilde aus Eisen, dann hob er den Kopf und sah das Mädchen, und auf einmal schämte er sich. Es war würdelos, sich wie ein kleiner Junge oder ein Verbrecher zu betragen und eine gute Arbeit zu verstecken.
Und seine Arbeit war gut. Nicht ganz, was er gewollt hatte, aber dem Bild in seinem Kopf doch ähnlich. Zu erkennen, woher das Bild stammte, trieb ihm die Hitze ins Gesicht: Der zierliche Leib des Leuchters war der ihre, ihre Grazie hatte ihm die Idee verschafft. Bemerkte sie es? Sein Herz jagte.
Sie sah ihn an, lachte, und er fuhr sich erschrocken an die Wange. In seiner Verlegenheit über den Leuchter hatte er vergessen, dass sein Gesicht schwarz vom Ruß sein musste und dass ihm die Kleider dreckig und verschwitzt am Leib klebten. Er wandte sich ab.
»Ach nein!«, rief sie. »Sieh nicht weg. Was habe ich dir denn getan?«
»Geh nach Hause«, sagte er, noch immer, ohne sie anzusehen. »Du beträgst dich dumm.«
»Willst du das wirklich? Dass ich gehe?« Sie streckte die Hand aus und strich ihm über die verdreckte Wange. »Bitte schick mich nicht weg.«
»Ich muss mich waschen«, murmelte er. »Ich stinke.«
Sie hörte nicht auf, ihn zu streicheln, und ihm kam es vor, als könnte er unter den Kuppen ihrer Finger seine Haut spüren.
»Für mich stinkst du nicht.« Sie reckte sich und roch an seinem Hals, da, wo Hemd und Haar einen Streifen Haut unbedeckt ließen. »Ich mag deinen Duft. Ich stelle mir vor, dass so das Leben duftet.«
War in dem Augenblick der Wunsch erwacht, sie zu beschützen? Sie war weich und offen und voll gutem Glauben – alles, was man nicht sein durfte in einer Stadt wie Paliemmu, die seit dem Tag ihrer Gründung umkämpft war, und in einer Zeit, in der Vertrauen Leichtsinn war und kein Stein auf dem anderen blieb.
Emidio schloss die Arme noch fester um Marianna, hier, auf dem Platz in Neapel, wie er es hinter seines Vaters Schmiede gern getan hätte. Sie hatten sich damals beide entschieden, aus der Ordnung auszubrechen, den Platz zu verlassen, an den ein göttliches Gericht sie gestellt hatte, und nichts mehr zu haben als einander. Für ihn war es leichter gewesen als für sie, er hätte diesen Weg ohnehin gehen müssen, denn in seines Vaters Haus konnte er das, was er wollte, nicht tun.
»Vergiss mich, häng dich nicht an mich«, hatte er zu Marianna gesagt, nachdem sie sich wochenlang wie zwei Besessene zueinandergeschlichen hatten und es längst kein Vergessen mehr gab.
»Warum nicht? Du bist der Sohn des Helmers, das ist ein angesehener Beruf, der einen Mann vielleicht besser ernährt als der Adelsstand meines Vaters.«
»Dein Vater wohnt in einem Palast.«
»Und hat im Winter kein Geld, ihn zu heizen.«
Das war der Augenblick gewesen, in dem seine Beherrschung den Kampf verloren hatte. Er hatte sie geküsst. Warum war Lippenaufeinanderpressen so anders als Händeschütteln oder Schulterklopfen? Warum war es, als hätten zwei Menschen nur noch einen Atem? Warum wurden Lippen zu Magneten, die fortan zu vernünftigem Sprechen kaum noch zu gebrauchen waren, weil sie beständig zueinanderstrebten? Damals hatte er sich trotzdem ein letztes Mal zusammengenommen und versucht, sie zur Besinnung zu bringen: »Du wärst eine Geächtete, Marinuzza. Wer seinen Platz in der Ordnung verlässt, wird gehetzt, bis Blut fließt, denn sonst käme womöglich die halbe Welt auf die Idee, dasselbe zu tun.«
»Und wenn ich es trotzdem will? Wenn mich das nicht schreckt?«
Emidio hörte sich bis heute stöhnen – es war ein Stöhnen, das verriet, wie süß und unwiderstehlich er die Vorstellung fand, sie bei sich zu behalten, und wie sie ihn quälte, weil sie um etwas kämpfte, das nicht sein durfte. »Marinuzza.« Er hatte die Hände um die kleine Halbkugel ihres Hinterkopfs geschlossen. »Ich weiß, du bist ein mutiges Mädchen …«
»Nein, ich bin keines, aber ich habe meinen schönen Mann sehr lieb.«
Sie presste ihm die Hand auf den Mund, und wieder einmal verblüffte ihn die Kraft, die in dieser kleinen Hand steckte. Er hatte Mühe, sich zu befreien und weiterzusprechen. »Du bist ein mutiges Mädchen, und du hast mich lieb. Das ist mehr wert als Augustalen in Gold, griddu. Aber davon können wir nichts kaufen. Wenn ich meinen Vater beerben und Helmer werden wollte, nähme ich dich beim Wort und würde mich die paar Jahre bis zur Meisterprüfung ducken, damit ich dir ein Heim zu bieten hätte, aber …«
Ehe er weitersprechen konnte, landete ihre Hand wiederum auf seinem Mund. »Habe ich von dir verlangt, dich zu ducken? Du bist nicht wie andere Männer. Deshalb bin ich dir an diesem Tag im August nachgelaufen, und deshalb laufe ich dir nach, wohin du auch gehst. Ich bin stolz, Midiú. Als ich noch nicht über meines Onkels Tisch schauen konnte, habe ich schon beschlossen, nie zu heiraten und nichts zu tun, nur weil ein Mensch, der dümmer ist als ich, es mir befiehlt. Aber du bist nicht dümmer als ich. Wenn ich wollte, dass du dich duckst, hätte ich es selbst tun können. Sei so klug, wie du sein kannst, Midiú.«
»Ich kann nicht hierbleiben«, brach es aus ihm heraus. »Ich weiß nicht, warum, aber ich bin kein Schmied wie all die anderen. Ich habe diese Bilder in meinem Kopf, die mir keinen Frieden lassen.«
»Ich weiß«, sagte Marianna ruhig. »Du bist ihr Gefangener, wie die Gezeichneten in deiner Höhle am Pellegrino gefangen sind. Du bist ein Künstler und musst bei einem Künstler in die Lehre gehen.«
»Hier wird mir keiner die Tür aufmachen. Mein Vater ist Pietro Maniscalco; in der Schmiedezunft von Paliemmu ist sein Wort Befehl. Um Kunstschmied zu werden, muss ich nach Neapel oder noch weiter gehen, und vielleicht bin ich alt, bis ich wiederkomme. Und ich werde arm sein, griddu.«
»Ja, du wirst arm sein.«
»Begreifst du jetzt, dass ich kein Mann für dich bin, selbst wenn du tollkühnes Menschlein alles, was dir zusteht, in den Wind wirfst?«
»Nein.«
»Santa Matri di Diu, warum denn immer noch nicht?«
»Weil ich mit dir komme. Was immer du redest. Wenn ich dich nicht gewinnen kann, was habe ich dann zu verlieren?«
Einen Tag lang hatte er mit sich gerungen, hatte sich beschworen, er dürfe ihr unglaublich nobles Geschenk nicht annehmen. Sein Gewissen kämpfte. Im Herzen, in den Lenden und im ganzen Körper aber hatte er längst die Waffen gestreckt. Seit er Marianna kannte, seit sie ihn liebte und es ihm mit den Händen zeigte, konnte er seinen Körper nicht länger von sich wegdenken. Es war alles eins – Körper, Herz und Gedanken, es war alles er, Emidio Maniscalco, und keinen Teil davon wollte er sich mehr wegnehmen, misshandeln und entwürdigen lassen. Schon gar nicht den Körper, den Marianna berührte, als hätte sie einen Schatz entdeckt.
Sein Gewissen zog den Kürzeren, weil die Entscheidung längst gefällt war, vielleicht schon seit jenem Tag im August, als sie zum ersten Mal die Arme nacheinander ausgestreckt hatten. Deine Augen sind mein Spiegel. Seit du mich ansiehst, sehe ich mich. Er nahm ihr Geschenk an.
Sie flohen in der grauen Morgenstille, bezahlten mit Mariannas Armreif einen Schiffer, der sie nach Neapel übersetzte, ließen alles hinter sich und blickten nur nach vorn. Im ersten Licht des Tages schälte sich das trutzige Castel dell’Ovo aus den Nebeln, das der Normanne Roger zu seiner Residenz gemacht hatte und das Karl von Anjou nun nicht mehr gut genug war. Das Eiland Megaride und die Hafenanlagen, die Karl seinen provenzalischen Gefolgsleuten wie eine Morgengabe übergeben hatte, ragten abweisend auf, als wollten sie die Reisenden zurücksenden, zurück übers Meer, auf ihre Insel, die Rivalin, deren Blütezeit vorüber war. Neapel hieß die Stadt am Golf, doch die, die ihr verfallen waren, nannten sie Parthenope – nach der Sirene, die Odysseus mit ihrer süßen Stimme bezirzt hatte, ohne zu ahnen, dass seine Ohren verstopft waren. Neapel bezirzte niemanden und würde sich nicht vor Liebesschmerz in die sachten Fluten ihres Golfs stürzen. Ihre Stimme war kalt, ihre Ohren taub.
Die erste Zeit war hart wie Eisen, nur ließ sie sich nicht schmieden, sondern blieb starr. Das bisschen Geld, das Emidio erspart hatte, war im Handumdrehen verbraucht, und die Hand musste man in Neapel allzu oft umdrehen. Anstelle ihr den Palast bieten zu können, den er Marianna gerne gebaut hätte, bezahlte er einen Wucherpreis für ein lichtloses Loch, dem der Lärm der Stadt aufs Dach hämmerte. Zum Kochen versammelten sich die Frauen von Napoli sotterranea an Feuerstellen vor dem Ausgang. Irgendwann würde irgendwer das Feuer zu hoch schüren oder nicht gründlich genug löschen, und das ganze Gewölbe würde ihnen um die Ohren fliegen.
Marianna war so stolz gewesen, weil sie sich von den Küchenmägden ihres Onkels hatte zeigen lassen, wie man Farsumagru zubereitete – ihr Gesicht hatte vor Begeisterung geglüht, als sie es Emidio erzählte: »Das essen die Armen von Paliemmu, nicht wahr? Sie füllen mageres, zähes Fleisch, das sonst niemand kaufen mag, mit allem, was die Speisekammer hergibt, und stellen am Ende doch noch ein Gericht, das sättigt, auf den Tisch.«
Emidio hatte sie halten und küssen müssen. Sie war ein solches Geschenk. Kein Mann verdiente sie. »Das ist schon richtig, griddu. Aber selbst wenn es aus deinen Kreisen niemand kaufen mag – das magere Fleisch wird nicht verschenkt. Und unsere Speisekammer, fürchte ich, gibt gar nichts her. Noch schlimmer: Wir haben keine und auch keinen Tisch, auf den du etwas stellen könntest.«
Dieses eine Mal war sie erzürnt und gab ihm so etwas wie eine Ohrfeige. »Mach dich nicht lustig über mich.«
Der Schlag – viel eher eine aufgebrachte Liebkosung – war der erste seines Lebens, der weder wehtat noch kränkend war. Sie hätte ihn niemals gekränkt, und in ihrem Zorn war sie so reizend, dass er lachen musste, auch wenn er dabei gegen die Tränen kämpfte. »Farsumagru ist kein Gericht für arme Leute, Marinuzza.«
»Aber du hast mir doch erzählt, wie oft deine Schwester Calogera es euch vorsetzt …« Sie brach ab und sah ihn an, als hätte sie ein Verbrechen begangen. »Ahime, Midiú. Ich bin so dumm, mir sollte verboten werden, den Mund aufzutun.«
»Darüber wäre ich traurig«, erwiderte er. »Du bist meine liebste Grille, die mit ihrem kleinen Grillenkopf arabische Bücher liest, und dass du dir ärmere Leute als die Familie eines gutgestellten Handwerksmeisters nicht vorstellen kannst, macht dich nicht dumm. Es tut mir nur leid, dass du selbst jetzt einer von diesen ärmeren Leuten bist. Das hast du nicht verdient, mein Menschlein – so ein Leben im Nichts.«
»Ich lebe doch nicht im Nichts.« Sie hielt sich an ihm fest. »Ich lebe in deinen Armen.«
»Vom Umarmen wirst du nicht satt.«
»Ich bin mein Leben lang satt geworden und hatte immer Hunger«, sagte Marianna. »Jetzt fehlt’s mir an Essen, und ich habe keinen mehr. Und wenn wir spindeldürr werden wie die Gräten von gegessenem Fisch, so macht es mir auch nichts aus.«
Emidio lachte, obwohl er traurig war. »Spindeldürr werden kann nur ich. Du bist es ja schon.«
Sie schmiegte sich an ihn, legte die Hand auf seine Bauchdecke. »Du bist schön. So wie Queis.« Hell auflachend streichelte sie ihn weiter und zitierte aus ihrer liebsten Dichtung: »›Es wurde ihm ein Knabe geschenkt, der aussah wie das Lachen eines Granatapfels, wie ein Edelstein, der die Dunkelheit des Erdentags in lauteres Licht verwandelt.‹ Das bist du, mein Midiú. Wenn wir ein bisschen Geld haben, backe ich Küchlein aus Feigen und Mandeln und füttere dir jede Unze von deiner Schönheit, die du verloren hast, wieder an.«
Emidio hatte auch lachen müssen, denn außer seiner Mutter, die an seinem fünften Jahrestag gestorben war, hatte ihn nie ein Mensch schön genannt. Doch vor ihren Augen schmolz die Verachtung für seinen Körper und er konnte alles sein, was sie wollte. Zur Antwort gab er ihr ein Zitat aus derselben Dichtung, die sie ihn nachts, bei der Liebe, lehrte: »›Wer hätte gedacht, dass eine solche Fülle von Süßigkeit aus einem so kleinen Mund strömen könnte? Kann man mit Zucker denn Heere zerbrechen?‹«
Sie küsste seine Lippen und zerbrach mit ihrem Zucker, was immer in ihm auf Krieg gerichtet war. Die Zeit war hart gewesen, und dennoch fühlte sich alles in ihm weich an, wenn er daran dachte. Ihre Fibel, eine schöne Arbeit aus Silber und eines der letzten Geschenke ihres Onkels, die sie besaß, gab sie her, um einen Tisch zu kaufen, auf den sie ihm sein Essen stellen konnte. Zu Mandeln und Feigen reichte es so wenig wie zu zähem Fleisch, doch Bohnen, Zwiebeln und die mehligen Kichererbsen, die Sizilianer für alle Welt unaussprechlich Ciciri nannten, trieb Marianna an so gut wie allen Tagen auf. Das Maccu, das ihre kleinen Hände mit ein wenig Knoblauch daraus stampften, schmeckte Emidio so gut, dass er es ohne Ende hätte essen können.
Einmal, als sie gar nichts hatten, das zum Essen getaugt hätte, hatte Marianna ihm mit einem Stück Kohle Schüsseln und Platten voll Fleisch und Früchten, Gebäck und maccaruni auf das Holz des Tisches gezeichnet. Sie konnte nicht zeichnen. Was all die Kringel und Striche darstellen sollten, konnte er nicht erraten, aber sie erklärte es ihm, und davon wurde er satt.
Mit dem Tuffstein, der aus der Erde gehoben worden war, um Neapels Pracht zu errichten, ließ sich zur Not beinahe wie mit Kreide zeichnen. Emidio sammelte graue, gelbe und rote Brocken und zauberte Marianna Festmähler an die feuchten, nackten Wände. Ein wenig sah es bei ihnen jetzt aus wie in seiner Höhle am Hang des Pellegrino, nur dass es in ihrer Höhle, so elend sie sein mochte, keine Gefangenen gab.
Es gab dort nichts als zwei Menschen, die trotz der Bedrängnis, in der sie lebten, frei waren. Über die Kostbarkeit von Freiheit hatte Emidio nie nachgedacht, und wie sehr er sich danach gesehnt hatte, erfasste er erst, als er sie besaß.
Frei zu sein bedeutete, sich loszureißen wie eine Insel vom Festland, keinen Halt mehr zu haben als den in sich selbst. Das war nicht einfach, es machte Angst, aber es rief die eigenen ungekannten Kräfte wach. An einem Morgen, ehe Emidio zur Arbeitssuche aufbrach, schob Marianna ihm einen abgegriffenen metallenen Gegenstand in die Hand, ein Pilgerabzeichen des heiligen Vito. »Wenn du hier bist, halte ich dich. Wenn du dort draußen bist, halte dich daran fest.«
Er hatte Arbeit als Lastenträger gefunden, brachte ein wenig Geld heim, und ihre Abende wurden schön. Ihre Nächte waren es ohnehin, auch wenn sie die Decken, in denen sie schliefen, kaum vor Schimmel schützen konnten. In den Armen der Frau zu liegen, die ihn so liebte, wie er gemacht war, verlieh Emidio ungeahnte Kräfte. Wenn er in der Frühe erwachte, lag er in völligem Dunkel und klammer Kälte, und doch kam es ihm vor, als könnte er diese ganze Stadt bewegen und aus ihren Angeln reißen, sodass sie sich über ihm und Marianna erhob und ihnen Luft zum Atmen ließ. Die Aussicht, am Abend in der Tür von ihr empfangen zu werden, beflügelte seinen Schritt.
Nach endlosen Streifzügen fand er im Stadtteil Pendino einen Kesselmacher, der ihn in seine Werkstatt nahm. Nicht als Lehrling, sondern als nicht viel mehr als einen Knecht, den er herumstieß und ausnutzte. Sobald er bemerkte, dass dieser Knecht bei Weitem der bessere Schmied war, legte er sich auf die faule Haut und ließ Emidio die bestellten Werkstücke fertigen. Er gab ihm wenig Geld, manchmal gar keines, sondern Reste von seinem Tisch. Marianna genügte es. Sie machte Maccu und Farsumagru aus nichts. Emidio genügte es ebenfalls, denn der Kesselmacher war ein Säufer vor dem Herrn, der Emidio am Amboss freie Hand ließ und nie nachwog, wie viel Kupfer gekauft und verwendet worden war.
Emidio nahm nicht mehr, als ihm seiner Meinung nach zustand, und er schmiedete an seiner eigenen Arbeit erst, wenn er die für den Kesselmacher erledigt hatte. Er hatte ohne Plan begonnen, einen Becher verwendet, der seinem Brotgeber misslungen war, und nach und nach die Bilder, die aus seinem Kopf herausdrängten, in die schillernden Wände des Werkstücks getrieben. Figuren entstanden. Gesichter, wie er sie in ihrem Gewölbe unter der Erde tagtäglich zu sehen bekam, gezeichnet von einer Lebenserschöpfung, die selbst von der Ewigkeit nur Schmerz und Mühsal erwartete. Und Mariannas Gesicht. Es war, als gäbe es kein Bild mehr ohne sie.
Am Ende hatte er aus dem Becher ein Ziborium gemacht und die Reihen von Figuren zu Szenen aus dem Leben der heiligen Agata erklärt, weil unweit der Schmiede eine Agata geweihte Kirche stand. Deren Geistlicher kaufte ihm das Ziborium ab und bestellte zwei Bilder für einen Reisealtar, die er im Voraus anzahlte. Auf dem Heimweg kaufte Emidio alles, was ihm in den Sinn kam: eine fette Taube und Mandeln und Feigen, um sie zu stopfen, einen Batzen faserigen weißen Käse aus der Milch von Wasserbüffeln, einen Tonkrug, den er mit schwarzem Wein füllen ließ, und eine samtene Schleife für Mariannas verschlissenes Kleid. »Von jetzt an bringe ich richtiges Geld nach Hause«, sagte er zu ihr. »Mehr als den Hungerlohn, den der Kessler mir bezahlt. Du musst dich nicht länger sorgen.«
»Ich habe mich nie gesorgt«, sagte sie. »Nicht mit einem Mann wie dir. Ich erwarte dein Kind, Midiú.«
3
Emidio liebte Bilder mehr als Worte, weil Worte nie genügten. So hätte es ein eigenes Wort geben müssen für den Schrecken, der nicht geschah.
Seit Mariannas viel zu schmaler Leib sich blähte, weil sein Kind darin wuchs, kam sie ihm noch schutzloser vor. Er hatte sich aus ein paar Brettern einen Scharren gezimmert und stellte sich an den wichtigen Markttagen mit seinen Arbeiten auf den Campo del Muricino. Ohne Lizenz war das verboten, aber der Marktmeister ließ sich mit einem Schwarzpfennig bestechen, und die Geldausgabe lohnte sich. Nicht nur verkaufte er stets alles, was er anbot, sondern er kam auf diese Weise auch an Auftraggeber, die ihm das Material im Voraus bezahlten. Der Kessler soff weiterhin seinen Branntwein, und solange die Arbeit beizeiten erledigt wurde, bemerkte er kaum, ob Emidio zur Stelle war oder nicht.
Alles war gut. Sie konnten ihr Leben bestreiten und Geld beiseitelegen. Noch ein Jahr oder zwei, dann würde er genug beisammen haben, um sich den Eintritt in die Zunft zu erkaufen und eine Werkstatt zu suchen, ein kleines Haus entlang der Hafenmauern mit einem luftigen, trockenen Zimmer im Obergeschoss, in dem ihr Kind es gut haben würde. Ein Dach, unter dem seine Familie geborgen sein würde, bis der Tag kam, an dem sie auf ihre Insel zurückkehren konnten. Nach Paliemmu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!