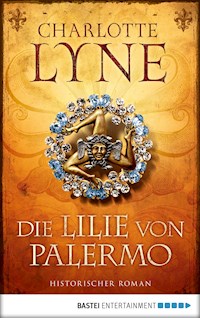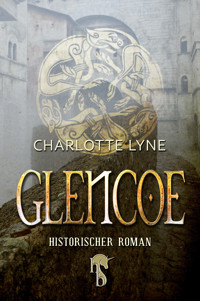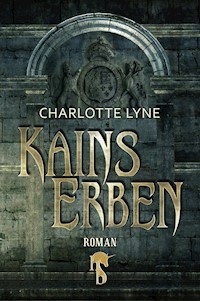6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin 1931: An ihre verstorbene Mutter hat die junge Amarna keine Erinnerung, und ihr Vater, einst ein namhafter Archäologe, spricht nie auch nur ein Wort über sie. Auch verschweigt er, warum er sich völlig aus seinem Beruf zurückzog und Amarna verbietet, selbst in die versunkene Hethiter-Stadt Hattuša zu reisen, wo er vor Jahren seinen größten Triumph feierte. Von grauenhaften Visionen gequält versucht Amarna, herauszufinden, was damals auf der Expedition geschehen ist. Als ein geheimnisvoller Fremder auftaucht und ihr anbietet, sie nach Hattuša zu begleiten, zögert sie nicht, sondern reist mit ihm durch die einerseits exotische und doch seltsam vertraute Türkei. Was als Erfüllung eines Traums beginnt, entpuppt sich jedoch bald als Albtraum, und auf einmal ist alles bedroht, was Amarna je geliebt hat. Die Geschichte findet ihre Fortsetzung in Charlotte Lynes Roman „Niemand wartet in dieser Stadt“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charlotte Lyne
Die Stadt der schweigenden Berge
Roman um ein Familiengeheimnis
Für Detlef,der ein Recht auf seinen Namen hat
„Wer sich der Vergangenheit nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen.“
George Santayana, The Life of Reason„Drei Äpfel fielen vom Himmel: der erste für den, der erzählt, der zweite für den, der zugehört, der dritte für den, der verstanden hat. So schließen die meisten armenischen Märchen.“
Ossip Mandelstam, Die Reise nach Armenien
ERSTER TEIL
„Wer ist denn der, der sich mit ihm an Königswürde messen könnteUnd zu sagen vermag wie Gilgamesch:Ich, ja, ich bin der König?“ Gilgamesch-Epos, Erste Tafel, Verse 45–47
1
Berlin
November 1930
„Verflucht, so komme ich nicht weiter!“
Als sie die Seite umblättern wollte, bemerkte Amarna, dass sie keine Ahnung hatte, was sie in den letzten fünfzehn Minuten gelesen hatte. Abrupt schlug sie die kostbare Faksimile-Ausgabe mit den Abschriften der Tontafeln zu. Der Knall war so scharf, dass der einsame Kommilitone, der fünf Lesetische weiter vorn saß, zusammenzuckte. Pikiert drehte er sich um und schob seine Brille auf dem Nasenrücken auf und ab.
Was er dachte, konnte Amarna hinter der bleichen Haut seiner Stirne lesen: Wer ist nur auf die Schnapsidee gekommen, Frauen in die Universität zu lassen?
Nun schön. Mit derlei Gedanken war das Milchgesicht weder sonderlich originell noch mehr wert als ein Achselzucken. Spätestens seit die Physikerin Lise Meitner vor vier Jahren zur Professorin ernannt worden war, waren Frauen aus der Berliner Universität nicht mehr wegzudenken. Amarna hatte andere Sorgen. Sie schrieb an ihrer Magisterarbeit und trat seit einer geschlagenen Woche auf der Stelle. Seit sie in einem archäologischen Fachartikel, der aus der Zeit vor dem Krieg stammte, jenen Hinweis entdeckt hatte, war sie besessen davon.
Sie konnte an nichts anderes mehr denken. Es war, wie wenn sie Appetit auf die zarten, mit Zitronencreme gefüllten Pfannkuchen der Bäckerei Thomke hätte – das Gefühl, sonst nichts schlucken zu können und verhungern zu müssen, solange sie keinen solchen Pfannkuchen bekam. „Du bist wie dein Vater“, pflegte Merten, ihr Taufpate, mit eingekniffener Wange zu sagen. „Als er noch aktiver Archäologe war, hob er nie mehr als ein einziges Loch aus, an dem er grub und grub, bis er etwas fand oder in die eigene Grube stürzte. Es schlicht an einer anderen Stelle zu versuchen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen.“
Mit einem Seufzen stand Amarna auf. Merten hatte recht. Eher würde sie in ihre eigene Grube stürzen, als von diesem Loch zu lassen, also sah sie besser zu, dass sie etwas fand. Ihre Magisterarbeit drängte. Merten konnte sie nicht selbst dabei betreuen und Professor Geest, der Kollege, der auf sein Drängen eingesprungen war, hatte für Frauen an seiner Fakultät so wenig übrig wie das pikierte Milchgesicht. Wenn Amarna die gesetzten Termine nicht einhielt, würde er ihr mit Vergnügen einen Strick daraus drehen.
Amarna studierte Altorientalistik und Archäologie. Andere Fächer waren für sie nie infrage gekommen, denn diese waren ihre Welt, solange sie denken konnte. Sie war ein Archäologenkind, aufgewachsen zwischen Tonscherben und Folianten voller Landkarten des Vorderen Orients. Ihre Mitschülerinnen verschlangen Mädchenbücher wie die „Nesthäkchen“-Bände von Else Ury und die „Trotzkopf“-Reihe von Emmy von Rhoden, Amarna hingegen las unter der Bettdecke von den Abenteuern halb göttlicher Helden aus Uruk und Babylon. Andere Kinder spielten mit ihren Eltern „Domino“ und „Mensch ärgere dich nicht“, während Amarna und ihr Vater ihre Sonntage über dem jahrtausendealten Brettspiel aus der sumerischen Stadt Ur verbrachten.
Dass sie Archäologin werden und in die Frühgeschichte des Vorderen Orients eintauchen wollte, hatte immer festgestanden. Nach dem Vorstudium hatte sie sich der Erforschung der Keilschrift zugewandt. Über fünftausend Jahre alt war dieses erste System von Schriftzeichen, das Menschen entwickelt hatten, um in der Welt eine Spur zu hinterlassen. Auch jetzt, nach vier Studienjahren, durchliefen Amarna Schauder, sooft sie die Hände auf jene Spuren legte, selbst wenn es nur Abschriften waren, mit denen sie in Berührung kam. Mit ihren Griffeln hatten die Schreiber versunkener Epochen ihr Stück Unsterblichkeit in Ton geritzt. Amarna konnte sich keine schönere Berufung vorstellen, als einen Funken dieser Unsterblichkeit zu bewahren.
Ihre Magisterarbeit schrieb sie über das Gilgamesch-Epos, eine Sammlung von Texten aus Babylon, die als eine der ältesten erhaltenen Dichtungen galt. Amarna liebte Gilgamesch. Sie war eine tüchtige Studentin, die darum kämpfte, in der von Männern beherrschten Sphäre ernst genommen zu werden, doch bei den Geschichten um den jungen König, der auszog, um sich selbst und das Geheimnis des Lebens zu finden, fühlte sie sich noch immer ein wenig wie ein Kind in einer Märchenwelt. Sie konnte sich nicht erinnern, dass jemand ihr je Kinderlieder vorgesungen hatte, aber sie hatte das Zauberlied jener uralten Geschichten gehabt. Dass Merten Professor Geest bewegt hatte, sie über Gilgamesch schreiben zu lassen, war ihr Glück.
Sie würde das Glück wieder genießen, sobald der Zitronenpfannkuchen aus dem Weg war. Vorsichtig legte sie das Buch mit den Faksimile-Drucken auf einen der Stapel, die ihren Arbeitsplatz umringten. Seit Wochen schienen diese Stapel beständig aufzuwachsen wie Berge um ein Tal, das immer schmaler wurde. Amarna hatte Berlin nie verlassen und solche Berge nie gesehen, aber der Gedanke daran machte für Sekunden ihre Kehle eng. Sie knipste die Lampe aus und verließ mit schnellen Schritten den Raum.
So spät am Abend war die Philosophische Fakultät der Berliner Universität leer gefegt und auf den Gängen brannte kein Licht. Amarna hasste die Dunkelheit. Sie rannte die Flure entlang und hatte das beklemmende Gefühl, vor dem Echo ihrer eigenen Schritte zu fliehen. Glücklicherweise war es bis zu Mertens Büro nicht weit. Viel zu heftig klopfte sie an seine Tür.
„Herein?“
Amarna schob die Tür auf und sah Merten am Schreibtisch sitzen. Er war ausgesprochen lang und besaß den trainierten Körper eines leidenschaftlichen Bergsteigers, den er auf abenteuerliche Weise verbiegen konnte. Gewandt schwang er auf dem Stuhl herum und kniff beim Lächeln eine Wange ein. „Sieh an, die Studentin Amarna Brandstätter, drei Stunden nach Vorlesungsschluss. Das kann nur bedeuten, dass ich etwas gestatten soll, was ein normaler Mensch in meiner Position verbieten würde, habe ich recht?“
„Würde ich so nicht sehen.“
„Wirklich nicht?“ Merten fuhr sich ins Haar und blieb hängen. Als Kind hatte Amarna ihm einmal einen mit Glitzersteinchen verzierten Kamm geschenkt, über den er sich völlig unangemessen gefreut hatte. Benutzt hatte er ihn allerdings nicht. Sein Haar, das schon damals schlohweiß gewesen war, stand ihm in wirren Wolken um den Kopf.
„Nun schön“, gab sie zu, „ich brauchte eine Genehmigung, um mir drüben im Museum, in den Katakomben, etwas anzusehen, aber warum sollte ein normaler Mensch mir die nicht geben? Schließlich geht es um meine Arbeit, mit der ich irgendwie weiterkommen muss.“
„Um Gilgamesch?“ Über der Nasenwurzel trafen sich Mertens Brauen.
„Um wen wohl sonst?“
„Und dein Vater wäre damit, dass ich diese Genehmigung ausstelle, einverstanden?“
„Warum nicht?“, gab Amarna zurück. „Er hat dich gebeten, mich bei meinen Studien zu unterstützen, wie er selbst es täte, wenn er noch aktiv wäre.“
„Wenn er noch aktiv wäre“, wiederholte Merten. „Ich darf also wieder einmal ausbaden, dass mein Freund Tilman sich aus jeglicher Aktivität zurückgezogen hat.“
Amarna schwieg. Ihr Vater war Altorientalist wie Merten, auch wenn beide ihre bedeutendsten Entdeckungen auf dem benachbarten Gebiet der Ägyptologie gemacht hatten. In der Orient-Gesellschaft gab es Stimmen, die behaupteten, er sei noch begabter gewesen als sein Freund, einer der Großen seines Fachs, dessen Rückzug einen herben Verlust darstellte. Auf die Frage, warum er in seinem Beruf nicht mehr tätig sei, hatte ihr Vater ihr nie eine Antwort gegeben. Amarna war die endlosen Fragen ohne Antworten leid. Sie brauchte Hilfe. Hier und jetzt.
Merten gestand freimütig zu, dass sein Talent an das von Amarnas Vater nicht heranreichte. Doch auf ihn hatte sie sich immer verlassen können. „Also Nägel und Köpfe“, sagte er und langte nach einem Schreibblock. „Gegen den Besuch in den Katakomben ist nichts einzuwenden, aber mir ist nicht wohl dabei, dass du in der Dunkelheit allein zur Museumsinsel radelst. Ich sage Paul, er soll Feierabend machen und dich begleiten, in Ordnung?“
Hastig schüttelte sie den Kopf. Paul Vollmer war Mertens Assistent und für Amarna das, was für andere junge Frauen die beste Freundin war. Außerdem teilte er ihre Leidenschaft für die Frühgeschichte des Vorderen Orients. Amarna war dennoch entschlossen, allein zu gehen, auch wenn sie die Gründe dafür nicht benennen konnte.
„Das ist nicht nötig“, sagte sie. „Was soll mir auf den paar Metern denn passieren?“
Merten verengte die Augen. „Das Volk, das sich da draußen herumtreibt, gefällt mir nicht.“
„Was für Volk? Studenten, die auf ein Bier in eine Kneipe ziehen?“
„Du weißt so gut wie ich, dass ich von dem braunen Abschaum rede, dem man neuerdings nirgendwo in dieser Stadt mehr ausweichen kann.“
Amarna wusste, dass Merten die Nazi-Partei, die er braunen Abschaum nannte, mit allen Mitteln bekämpfte, weil der Rassenhass, den sie mit ihren Parolen anstachelte, ihm zutiefst zuwider war. Er hatte sogar ein Buch gegen den Hass zwischen Völkern geschrieben, obgleich Amarna sich bisher nicht hatte durchringen können, es zu lesen.
Von Politik versuchte sie sich fernzuhalten. Sie verstand nichts davon, und die verwirrenden Vorgänge, die zu Straßenkämpfen, Wirtschaftskrisen und Scharen von Arbeitslosen führten, machten ihr Angst. Sie war in der versunkenen Welt orientalischer Großreiche aufgewachsen wie in einer Stadt mit himmelhohen Mauern.
„Der braune Abschaum ist wohl kaum an einem Blaustrumpf interessiert, der zum Arbeiten in ein Museum radelt“, sagte sie zu Merten.
„Täusch dich da nicht.“ In seiner Stimme schwang ein bedrohlicher Unterton. „Diese Leute haben bei Weitem mehr Feindbilder als Gehirnmasse. Juden, Kommunisten, Armenier und Leute, die sich dem dritten Geschlecht zurechnen, sind nicht die Einzigen, deren Blut sie spritzen sehen wollen.“
„Wieso Armenier?“
„Was weiß ich.“ Merten vollführte eine wegwerfende Geste. „Frauen, die kurze Haare tragen und Männern die Studienplätze wegnehmen, sind ihnen jedenfalls ein Dorn im Auge.“
„Man kann auch Teufel an Wände malen“, versetzte Amarna patzig. „Was soll ich deiner Meinung nach also tun? Mein Studium an den Nagel hängen, weil es für mich zartes Pflänzchen zu gefährlich ist, mir im Museumsarchiv eine Tafel anzusehen?“
„Wenn du mich fragst, sollst du auf Paul warten“, erwiderte Merten ungerührt. „Aber du fragst mich ja nicht, und du hast sicher auch nicht vor, mir zu erzählen, was für eine ominöse Tafel du dir um jeden Preis um diese Uhrzeit ansehen musst.“
Amarna hätte ihm sagen können, nach welcher Tafel sie suchte, sie hatte eine völlig plausible Erklärung zu bieten. Warum sie stumm blieb, war ihr ein Rätsel. So albern es war, scheute sie sich, den Namen der Stadt auszusprechen, aus der die Tafel stammte.
Merten kritzelte ein paar Zeilen auf seinen Block, riss das Blatt ab und reichte es ihr. „Tu, was du nicht lassen kannst. Versuch nur gelegentlich daran zu denken, dass dein Vater es nicht überleben würde, wenn dir etwas passiert.“
„Mir passiert nichts.“
„Das ist die ewige Überzeugung der Jugend.“
„Du bist ein Schatz, Merten.“ Sie blies ihm eine Kusshand zu und war im nächsten Moment aus der Tür.
2
Die Museumsinsel, ein Streifen Land in der Spree, auf dem sich ein Museum ans andere schmiegte, war für Amarna der schönste Ort in ganz Berlin. Das neueste Gebäude war gerade fertiggestellt worden, das Pergamonmuseum, ein Prunkbau, der würdig genug war, die Kunstschätze, die deutsche Archäologen aus dem Vorderen Orient nach Berlin geschafft hatten, zur Schau zu stellen.
Bereits in den letzten Jahren des Kaiserreichs hatte der Architekt Alfred Messel, der auch das Kaufhaus Wertheim in der Leipziger Straße entworfen hatte, mit der Planung des ehrgeizigen Baus begonnen. Es war jedoch eine Zeit, in der die Weltgeschichte sich zu überschlagen schien, und ihre Ereignisse hatten die Arbeiten immer wieder aufgehalten. Krieg und Regierungswechsel sorgten ebenso für Unterbrechungen wie die Wirtschaftskrise und der ständige Geldmangel. Nur drei der vier geplanten Flügel waren schließlich verwirklicht worden, aber das Museum bot dennoch Raum genug, um sowohl das Ischtar-Tor aus Babylon als auch den Altar von Pergamon in ihrer ganzen imposanten Größe zu beherbergen.
So monumental, wie sie einst in ihrer Heimat die Landschaft überragt hatten, türmten sie sich jetzt unter der Glaskuppel des Pergamonmuseums. Seine Eröffnungsfeier im Oktober war das Kulturereignis des Jahres gewesen, zu dem führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft zusammengeströmt waren. Paul und Amarna, die in den Genuss von Mertens Einladungskarte gekommen waren, hatten sich auf den Stufen des Riesenaltars wie Ameisen gefühlt.
Würden Menschen jemals wieder so gigantisch, so einschüchternd bauen wie vor Jahrtausenden im Vorderen Orient? Paul hatte Amarna in den Gloria-Palast am Ku’damm geschleppt, um ihr den Film Metropolis zu zeigen – Hochhäuser wie moderne Türme von Babel, die an den Toren des Himmels kratzten und das Gewölbe zum Einsturz bringen mochten. Amarna hatte das Kino verlassen, hatte Unwohlsein vorgetäuscht, um die Wahrheit vor Paul zu verbergen. Die Wolkenkratzer machten ihr Angst, sie riefen die Bilder der Albträume wach, die sie in etlichen Nächten quälten.
Die Monumentalbauten der Vergangenheit flößten Amarna ebenfalls Furcht ein, aber zugleich war sie nach ihnen süchtig. Auf seltsame, beinahe gespenstische Weise fühlte sie sich zwischen ihnen zu Hause, während die vor Menschen wimmelnden, grell beleuchteten Straßen ihrer Heimatstadt ihr fremd blieben.
Der Novemberhimmel war wolkenverhangen, und weder Mond noch Sterne zeigten sich. Dennoch wurde es in Berlin nie dunkel, schon gar nicht im vor Leben sprudelnden Bezirk Dorotheenstadt, der das Herz der Metropole bildete. Die ersten Nachtschwärmer traten in lärmenden Trauben ihren Zug durch Lokale und Amüsierstätten an, während die letzten Arbeiter von ihrer Schicht in den Fabriken nach Hause trotteten. Amarna, die leidenschaftlich gern Rad fuhr, trat kräftig in die Pedale und überquerte die Brücke über die ölschwarz glänzende Spree. Noch in der Fahrt sprang sie vom Rad und lehnte es an die Mauer neben dem Eingangsportal des Museums.
Sie hatte das altersschwache Gefährt ihrem Postboten abgeschwatzt, da ihr Vater ihr in seiner ewigen Sorge keines hatte kaufen wollen. Das Postbotenrad war zu klapprig, um gestohlen zu werden, was ihr die Mühe mit einem Schloss ersparte.
Der Pförtner döste mit halb geschlossenen Augen in seiner Loge. Von dem Zigarettenstummel, der ihm von den Lippen hing, flockte Asche. Amarna kannte ihn von früheren Besuchen und hätte ihn gern mit Namen angesprochen, doch ihr Namensgedächtnis war die reinste Katastrophe. So grüßte sie ihn lediglich knapp, hielt das Papier, das Merten ihr gegeben hatte, vor das Sichtfenster und wollte die Stufen hinaufhasten. In dem Moment aber schreckte der Mann aus seinem Dämmerzustand.
„He, Männekin, habense mal jekiekt, wie spät es ist? Kommense morgen wieder. Das alte Gelump wird Ihnen schon nich’ wegflitzen.“
Amarna drehte sich um.
„Ach du liebe Zeit“, sprudelte der Pförtner heraus. „Det is ja ’n Mädchen.“
„Und eines mit Sondergenehmigung“, versetzte Amarna und zeigte ihm noch einmal ihr Papier.
Schwerfällig stemmte der Mann sich vom Schemel und trat aus dem verglasten Kasten. Er zupfte Amarna das Papier aus der Hand, stellte sich unter die Laterne am Logendach und begann mit übertriebener Beflissenheit die paar Zeilen zu lesen. „Runter in die Unterwelt wollense“, brummte er endlich. „Und dit kurz vor zehne. Na wat soll’s, muss ja schließlich ooch Verrückte geben. Aber das Haupttor mach’ ick dafür nich’ noch mal auf.“ Er bedeutete Amarna, ihm zu folgen, und schlurfte schlüsselklappernd um den Gebäudeflügel herum. Der Hof war menschenleer und die Gaslaternen von der Straße spendeten kaum Licht. Umständlich entsperrte er eine niedrige Tür. „Bitte sehr. Da hamse unsere Katakomben janz für sich alleene. Aber nachher wieder abschließen, verstanden? Nich’ dat uns einer über Nacht den alten Krempel klaut.“
Er löste den Schlüssel vom Bund und drückte ihn Amarna in die Hand. Dann drehte er sich um und schlurfte den Weg zurück. Amarna atmete tief durch, setzte einen Schritt in das stockfinstere Gebäude und tastete an der Wand nach dem Kippschalter. Ihre Angst vor der Dunkelheit war ihr genauso zuwider wie ihre übrigen sinnlosen Ängste. Sie passten nicht zu dem Bild, das sie von sich hatte, zu der forschen Studentin, die sich in einer Männerwelt nicht die Butter vom Brot nehmen ließ.
Den Kippschalter fand sie nicht, wohl aber das Geländer über den Stufen, die hinunter in die Kellerräume führten. Dort unten waren jene Gegenstände archiviert, die im Museum nicht gezeigt wurden, weil es an Platz fehlte, weil sie der Restauration bedurften oder weil ihre Erforschung nicht abgeschlossen war. Von vielen kannte man nicht mehr als den Fundort, und ob es je gelingen würde, ihnen ihre Geheimnisse abzutrotzen, stand in den Sternen.
Der Name Katakomben, den die Berliner dem Kellergewölbe verpasst hatten, traf wie die Faust aufs Auge. Gänge und Säle mit niedrigen Decken, unter denen Heizungsrohre verliefen, bildeten ein Labyrinth, in dem ein Besucher sich im Handumdrehen verirren konnte. Für Archäologen war dieser Irrgarten jedoch eine Schatztruhe, ein Hort, in dem unschätzbare Fundstücke, die aus den entlegenen Grabungsorten nach Berlin gelangt waren, aufbewahrt wurden. Sich vor diesem Ort zu fürchten, war lachhaft! War sie nicht hier wie nirgendwo sonst in ihrem Element?
Amarna ignorierte das Hämmern ihres Herzens und zwang sich, die Stufen hinabzusteigen. Auf der letzten stolperte sie, fing sich an der Wand ab und ertastete den ersehnten Schalter. Trübes Licht verbreitete sich im Raum. Konturen von Schubschränken und Regalen schälten sich aus verblassendem Dunkel. Dazwischen ragten Fragmente von Reliefs, Säulen und Skulpturen auf. Ein mannshoher Falke aus schwarz glänzendem Marmor hob die Stümpfe zerbrochener Flügel. Jahrtausendealte Augen aus grellrotem Karneol starrten Amarna entgegen.
Seit der Eröffnungsfeier vor sechs Wochen war sie mehrmals hier gewesen, aber noch nie nach Toresschluss, wenn Wärter und Schaulustige das Museum sich selbst überließen. Der Gedanke, mit dem Objekt ihrer Begierde allein zu sein, jagte ihr einen Schauder über den Rücken. Die Tafel barg eine Bedrohung, war ein Schlüssel in eine Kammer, von der sie nicht wusste, ob sie sie betreten wollte. Dennoch musste sie sich ihr stellen. Wie in ihren Albträumen hatte sie keine Wahl.
Wenn sie Pech hatte, war der Gegenstand nicht einmal katalogisiert, obwohl er vor dem Weltkrieg gefunden worden war. Durch Krieg und Revolution war das Gefüge durcheinandergeraten. Die Museumsinsel, die ein Lieblingskind des Kaisers gewesen war, hatte neu organisiert werden müssen. Dabei waren die berühmtesten Stücke, allen voran die ägyptische Sammlung, als Erstes erfasst und geordnet worden, während die Zeugnisse weniger bekannter Kulturen sich in Geduld fassen mussten.
Die Kultur, nach der Amarna suchte, schien vollständig auf der Strecke geblieben. War es nicht unglaublich, dass ihr dieses Volk in all den Jahren, die sie sich mit der Geschichte des Vorderen Orients beschäftigte, nie über den Weg gelaufen war? Warum sprach ihr Vater nicht darüber, warum hatte Merten sie nie auch nur mit einem Wort erwähnt? Es kam ihr vor, als wäre das Weltreich, das es an Macht und Größe mit dem ägyptischen aufnehmen konnte, sang- und klanglos in der Vergessenheit versunken, aus der es gerade erst für eine Handvoll Sekunden aufgetaucht war.
Die Archäologin in Amarna erwachte, und Neugier errang den Sieg über die Furcht. Sie hastete durch den schlecht ausgeleuchteten Saal, schob sich an Regalen vorbei, die ihr die Sicht versperrten, und gelangte an eine Tür, die nach links in einen Nebenraum führte. Hier waren an deckenhohen Schienen die Katalogbögen der einzelnen Objekte eingehängt. Wenn die gesuchte Tafel erfasst war, musste sie in diesem Verzeichnis aufzufinden sein. In dem Augenblick, in dem Amarna das Licht einschaltete, spürte sie hinter sich eine Bewegung. Sie erschrak bis ins Mark.
Das Huschen war so leise, dass es auch von einer Maus hätte stammen können. Aber es stammte von keiner Maus. Amarna fuhr herum und der Schrei blieb ihr in der Kehle stecken. Auf der anderen Seite des Saales machte sie eine Gestalt aus, die hinter einem Metallschrank verschwand. Stockstarr blieb sie stehen und vernahm nichts als ihren rasenden Herzschlag. Auch der Mensch, der ihr gegenüber im Zwielicht lauerte, musste in Reglosigkeit erstarrt sein. Von seinem Körper war nichts mehr zu sehen, doch sein langer, schmaler Schatten fiel in den Gang zwischen den Regalen.
Amarna saß in der Falle, wie es ihr so oft in ihren Albträumen geschah. Sie wollte sich zur Kugel zusammenrollen und wusste doch, sie konnte dem Grauen nicht entgehen. Nur würde sie diesmal nicht schweißnass und keuchend vor Erleichterung aufwachen, sondern gefangen bleiben. Sie konnte den Mann nicht sehen, war aber sicher, dass er sie sah. Ob sie nach vorn oder hinten zu fliehen versuchte, er würde in jedem Fall schneller sein.
Zwei Gänge weiter überragte eine assyrische Götterskulptur mit Kinnbart und drohend geweiteten Augen alle übrigen Objekte. In ihrem von Angst gepeinigten Hirn nahm der Fremde dieselbe Gestalt an – überlebensgroß und von einer Kraft, die nicht menschlich war. Sie musste etwas tun. Ihr Herz hämmerte wie ein kleines lebendiges Tier in ihrer Brust und würde andernfalls zerspringen.
„Was machen Sie hier?“, hörte sie sich rufen. Ihre Stimme klang vor Angst verzerrt, doch die Worte waren immerhin verständlich. Auf den Regalbrettern erzitterten die Scherben von Tongefäßen. „Ich bin nicht allein“, rief Amarna. „Meine Kollegen kommen gleich nach. Wenn Sie nicht auf der Stelle verschwinden, holen wir die Polizei.“
Amarna hielt den Atem an und wartete. Einen Herzschlag lang geschah nichts, dann bewegte sich der Schatten, und die Gestalt löste sich von dem Schrank, hinter dem sie versteckt gewesen war. Der Mann hob die Hände. „Ich habe nur etwas gesucht. Von mir droht Ihnen keine Gefahr.“
Lautlos durchquerte er den Gang in Richtung Treppe. Dabei hielt er die Hände erhoben, wie um seine Wehrlosigkeit zu unterstreichen, und sah Amarna unverwandt an. Von der Schwere des Götterbildes hatte er nichts an sich, eher von der sehnigen Schlankheit einer Jünglingsdarstellung aus dem klassischen Griechenland. Fremdartige Schönheit, die wehtat, weil sie in all ihrer Stärke zerbrechlich war.
Ihre Feststellung ließ sie stutzen. Es gab durchaus Männer, die sie attraktiv fand, aber dass er schön war, hatte sie nie zuvor von einem Mann gedacht. Schön waren Bauwerke, Texte und Kunstgegenstände vergangener Epochen, Tutenchamuns Totenmaske und der bronzene Jüngling von Antikythera, aber kein Mann aus Fleisch und Blut.
Der Fremde trug keinen Mantel, nur einen dunklen Anzug, der den klaren Linien des Körpers, den geraden Schultern und den langen Beinen stand. Von seinen Zügen konnte Amarna sich nicht lösen. Schräg gestellte Brauen und Lider über weit geöffneten Augen, hohe, geschwungene Jochbeine, der Mund groß, die Lippen wie mit der Feder gezeichnet. Sein Haar war sehr schwarz, sein Deutsch von einem leicht singenden Akzent gebrochen, aber fehlerfrei.
„Warten Sie!“
Vor der Tür zur Treppe blieb er stehen.
„Was haben Sie hier gesucht?“
Er ließ die Hände sinken, fuhr aber fort, Amarna geradewegs ins Gesicht zu sehen. Solche Direktheit hatte etwas Unverschämtes, und dennoch wich sie nicht aus. Sein Blick aus weiten Augen flackerte, berührte sie und brannte sich ein. „Etwas, das mir gehört“, sagte er.
„Sie reden Unfug. Die Gegenstände, die hier aufbewahrt werden, gehören den Berliner Museen. Wenn Sie etwas gestohlen haben, muss ich Sie der Polizei melden.“
„Natürlich!“ Wie zum Lachen warf er den schönen Kopf auf. Aber er lachte nicht. „Meinesgleichen ist Diebsgesindel, ohne Ansehen der Person, nicht wahr?“
„Was glauben Sie denn?“, herrschte Amarna ihn an. „Sie dringen unbefugt bei Nacht in ein öffentliches Gebäude ein und wollen behandelt werden wie ein Ehrenmann?“
„Aber nicht doch“, erwiderte er seidenweich und bedrohlich zugleich. „Ich weiß nicht einmal, was ein Ehrenmann ist. Trotzdem ist mir mein Hals lieb. Wenn ich mich strafbar mache, dann nicht ohne Grund.“
„Und wer sagt Ihnen, dass Ihr Grund gut genug für mich ist?“ Amarna verstand sich nicht. Weshalb debattierte sie mit diesem Eindringling herum, statt ihm ins Gesicht zu werfen, er solle sich zum Teufel scheren?
„Mein Grund ist gut genug“, erwiderte er. „Und wie steht es um Ihren?“
„Ich habe eine Genehmigung“, versetzte Amarna und hielt Mertens Schreiben in die Höhe.
Der Fremde zupfte sich am Ohrläppchen. Etwas an der Geste erschien Amarna vertraut. „Ich verstehe. Wer in Deutschland ein Papier vorzeigen kann, braucht keine Gründe mehr.“
„Ich suche eine Tontafel!“, fauchte sie und verstand sich noch weniger. Vor Merten blieb sie stumm wie ein Fisch, vor Paul hatte sie die Tafel mit keinem Wort erwähnt, und vor einem dubiosen Fremden verspürte sie den Drang, sich zu erklären? „Sie enthält eine Version des Gilgamesch-Epos“, fuhr sie fort. „Keilschrift in einer Sprache, die erst vor fünfzehn Jahren entschlüsselt worden ist. Ein paar Jahre zuvor wurde diese Tafel gefunden. Sie stammt aus einer nahezu unbekannten Riesenstadt in Zentralanatolien …“
„Hattuša“, sagte der Fremde mit seiner Stimme, die etwas Einlullendes, Gefährliches hatte und die Amarna schön fand. Sie hätte sich im Klang dieser Stimme zusammenrollen wollen wie in einer Kuhle im sonnenwarmen Sand.
„Woher wissen Sie das?“
„Wir suchen dasselbe“, sagte er und sandte ihr einen weiteren Blick unter halb gesenkten Lidern, an dem sie sich festhalten wollte, aus welchen Gründen auch immer. In der Dunkelheit wirkten seine Augen beinahe schwarz.
„Weshalb interessiert Sie die Tafel?“
Er zuckte eine Schulter. „Sie finden sie im nächsten Saal. Hinter dem steinernen Flügel der Sphinx steht ein Schubschrank, und im dritten Schub von unten liegt die Tafel. Gehen Sie sorgsam damit um. Ich weiß, es klingt ziemlich pathetisch, aber sie ist in Blut bezahlt.“
„Bleiben Sie stehen!“, rief Amarna, als sie sah, wie er einen Fuß auf die Treppe setzte, sodass die Hälfte seines geschmeidigen Körpers hinter der Wand verschwand. Hatte sie nicht alles getan, um ihn zu vertreiben? Warum versuchte sie jetzt ihn aufzuhalten? Sie hätte laufen und ihm am Jackett packen wollen, so dringlich wünschte sie sich, dass er blieb. Ein verrückter Drang erfasste sie. Sie wünschte sich, diesem Fremden zu erzählen, was sie denen, die zu ihr gehörten, verschwieg, ihre Albträume, ihre Ängste, sie war auf einmal sicher, das alles habe mit der Stadt namens Hattuša zu tun.
„Kommen Sie zurück!“, rief sie. „Erzählen Sie mir, was Sie von Hattuša wissen!“
„Dasselbe wie Sie“, sagte er und tauchte im Treppenhaus unter. „Gute Nacht.“
3
„Amarna ist wo?“
„Sie sind nicht taub, Paul“, erwiderte Merten Schobert, ohne von seinem Skript aufzublicken. „Sie haben perfekt verstanden, was ich gesagt habe: Amarna ist ins Pergamonmuseum gefahren, um einen Verweis zu prüfen.“
Paul ballte die Fäuste, um dem Zittern, das seinen Körper befallen hatte, Einhalt zu gebieten. Merten Schobert war sein Doktorvater, sein Vorgesetzter und sein Idol. Auf keinen Fall wollte er ausgerechnet vor diesem Mann die Kontrolle über seinen Jähzorn verlieren. „In Ordnung“, entgegnete er so beherrscht wie möglich. „Ich verstehe nur nicht, weshalb Sie ihr nicht gesagt haben, sie solle auf mich warten.“
„Ich habe es ihr gesagt“, erwiderte Schobert. „Und was hätte ich Ihrer Ansicht nach tun sollen, als sie sich weigerte? Sie in Ketten legen?“
Von Neuem durchlief Pauls Körper das Zittern, gegen das er sich machtlos fühlte. Warum war er mit diesem Übel geschlagen? Er war Doktorand der Altorientalistik und vorderasiatischen Archäologie, zivilisierter Westeuropäer des 20. Jahrhunderts, Pazifist und Gegner der Todesstrafe. Sooft ihn jedoch dieser Jähzorn überfiel, fühlte er sich seinen Vorfahren, die Konflikte mit Fäusten und Äxten gelöst hatten, beängstigend nahe. Er hasste den Dämon in sich, das Erbe seines verhassten Vaters, die Furcht, nicht einschätzen zu können, zu welchem Wahnsinn er fähig war. Davon abgesehen war Merten Schobert der letzte Mann, der solchen Zorn von ihm verdiente.
Der Professor machte keinen Hehl daraus, dass er ihn anderen Studenten vorzog, obwohl Paul keiner Familie von Akademikern entstammte und sich sein Studium mühsam verdienen musste. Nach dem Magister hatte Schobert ihn als Assistenten eingestellt und es ihm dadurch ermöglicht, sich zur Promotion zu melden. Paul hatte sich auf assyrischen Städtebau spezialisiert, und auf diesem Gebiet war Schobert eine anerkannte Größe, obwohl er als Archäologe lediglich in Ägypten unterwegs gewesen war. Mit seiner Förderung verschaffte er Paul Einblick in Forschungsergebnisse, die ihm andernfalls versperrt geblieben wären.
Trotz alledem stand Paul jetzt in Schoberts Büro und zitterte vor Zorn. Der Grund dafür hatte mit Archäologie nichts zu tun. Es ging nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um das älteste Gefühl der Menschheit. Paul Vollmer liebte Amarna Brandstätter.
Unter seinen Kameraden galt er als schwerblütig und nüchtern. Während er über die Schönheit der Nofretete-Büste ins Schwärmen geriet, ließen lebende Schönheiten ihn unberührt. Mit Amarna aber stand die Sache anders. Amarna war seine Gefährtin, die Hälfte seiner Seele, die er verloren und wiedergefunden hatte. Er wollte keinen Flirt, sondern ein Leben mit ihr, eine Zukunft, in der er seine trübselige Kindheit vergessen konnte. Merten Schobert war klarsichtig genug, um das zu spüren, und Paul wurde die Furcht nicht los, dass er ihn zwar als Archäologen schätzte, dass er ihm als Bewerber um seine Patentochter jedoch nicht gut genug war.
Amarna war Tilman Brandstätters Tochter. In Fachkreisen hieß es, Schobert habe nie verwunden, dass sein gefeierter Freund sich aus der Orient-Gesellschaft zurückgezogen hatte. Zum Ausgleich stellte er sich als selbst ernannter Hüter vor dessen Tochter wie die Sphinx vor die Chephren-Pyramide. Was versprach er sich davon? Hoffte er, irgendein morgenländischer Märchenprinz werde in den Hof der Universität einreiten und Amarna zur Braut begehren? Nun, dann würde er begreifen müssen, dass Amarna eine moderne Frau von 1930 war, die sich ihren Ehemann selbst wählen würde, wie sie ihr Studienfach gewählt hatte.
„Ich fahre Amarna nach“, sagte Paul. „Sie können mich nicht daran hindern.“
Schobert machte sich eine Notiz auf seinem Skript. „Und wie kommen Sie darauf, dass ich Sie hindern möchte?“
„Nun …“ Mehr als die kümmerliche Silbe fiel ihm nicht ein.
„Sie irren sich“, erklärte Schobert. „Mir wäre es ganz recht, wenn Sie sich ansehen würden, was sie da eigentlich treibt. Um es geradeheraus zu sagen: Ich mache mir Sorgen um sie.“
„Weil sie drüben auf der Insel einen Verweis prüft?“, fragte Paul. „Das Pergamonmuseum ist wohl kaum ein Sündentempel, in dem ihr unaussprechliche Gefahren drohen.“
Endlich blickte Schobert von seinen Notizen auf. „Meine Sorge ist fachlicher Natur“, erwiderte er. „Ich habe die Befürchtung, sie könnte das Wesentliche aus dem Fokus verlieren. Meiner Ansicht nach geht sie nicht systematisch genug vor, sondern lässt sich von spontanen Einfällen leiten. Was will sie zum Beispiel jetzt im Museum? Wenn sie Originale der Gilgamesch-Tafeln einsehen möchte, müsste sie ja wohl nach London fahren, denn bei uns wird sie dazu schwerlich etwas finden.“
„Amarna ist jung“, sagte Paul, der siebenundzwanzig und damit vier Jahre älter war. „Sie braucht mit ihrer Arbeit doch nicht morgen fertig zu werden, sondern kann sich Zeit nehmen und ein bisschen herumstöbern, ehe sie sich entscheidet, was sie will.“
„Professor Geest ist anderer Meinung“, erwiderte Schobert. „Vergessen Sie nicht, dass Amarna eine Frau ist.“
Paul hatte Mühe, nicht aufzulachen. „Sie können mir glauben, das vergesse ich nicht.“
„Die Freiheiten, die wir Männer uns als Studenten nehmen durften, bleiben den Frauen versagt“, fuhr Schobert fort, als hätte Paul nichts gesagt. „Wenn Amarna keine Ergebnisse vorweist, wird ihr der Ast in Windeseile abgesägt.“
„Ich verstehe“, murmelte Paul. „Wenn ich ihr bei ihrer Arbeit helfen kann, tue ich das natürlich gern. Gilgamesch ist ja keine allzu komplizierte Materie.“
„Zumindest solange man keine daraus macht“, brummte Schobert. „Ich stelle Ihnen für das Museum eine Genehmigung aus, auch wenn Pförtner Gruber mich demnächst in seiner Pfeife rauchen wird.“ In seiner großen, lässigen Schrift warf er ein paar Zeilen aufs Papier. „Halten Sie Ihr Herz im Zaum“, sagte er, als er Paul den Bogen übergab.
„Ich glaube, ich verstehe Sie nicht.“
„Und ich glaube, das tun Sie sehr wohl“, erwiderte Schobert. „Sie sind der begabteste Student, der mir in zwanzig Jahren untergekommen ist, und Sie haben das Zeug, ein ausgezeichneter Archäologe zu werden.“
„Vielen Dank.“ Das Kompliment rutschte die Kehle hinunter wie Öl, aber der Stachel blieb. „Darf ich fragen, was das mit meinem Herzen zu tun hat?“
„Die Frage können Sie sich selbst beantworten“, sagte Schobert. „Amarna ist eine gut aussehende Frau, und niemand verübelt Ihnen, dass Sie ein Auge auf sie werfen. Ich rate Ihnen lediglich, auf dem anderen nicht zu erblinden.“
4
Auf dem Weg zum Museum wurde Paul Zeuge eines Zwischenfalls, wie er sich neuerdings in Berlins Straßen immer häufiger zutrug. Eine Horde angetrunkener Männer in braunen Hemden torkelte grölend aus einem Lokal am Spreeufer. Mitten auf der Straße blieben sie stehen und ließen ihre Blicke schweifen, sichtlich darauf aus, Krawall zu stiften. Die drei Männer, die ihnen von der Museumsinsel her entgegenkamen, gaben die perfekten Opfer ab. Sie hatten schwarzes Haar und waren bereits durch ihre Kleidung als fremd zu erkennen. Zwei von ihnen trugen Kaftane mit kurzen Jacken, einer dazu eine hohe, auffällige Pelzmütze. Lediglich der Jüngste war in einen schäbigen Straßenanzug gekleidet. Ostjuden, war Pauls erster Gedanke, den er jedoch wieder verwarf. Die Aufmachung der Männer rief eine vage Erinnerung wach, die er nicht zuordnen konnte.
Im Nu hatten die Braunhemden sich über die Breite der Straße verteilt und verstellten den Fremden den Weg. Die waren in der Unterzahl und unbewaffnet, während in den Händen der Angreifer Metall blitzte. Schlagringe. Ketten. Die Klinge eines Messers, das mit einem Schnapplaut aufsprang. „Verreck doch, Judenpack“, grölte einer. Wie auf einen Befehl stürmten die Übrigen auf die Fremden los.
Das Licht der Straßenlaterne fiel dem Jüngsten direkt ins Gesicht. Paul sah dunkle, vor Angst geweitete Augen und Züge, die sich ihm innerhalb eines Herzschlags ins Gedächtnis brannten. Rührte die bestürzende Schönheit dieses Gesichts in den Schlägern nichts an, lähmte sie ihnen nicht die Fäuste?
Der Mann mit der Pelzmütze schrie etwas in einer Sprache, die er noch nie gehört hatte. Flüchtig glaubte Paul, es sei Griechisch, doch dann hätte er zumindest Brocken verstehen müssen. Die drei wirbelten herum und versuchten in eine schlecht ausgeleuchtete Seitenstraße zu entfliehen. Johlend nahmen die Angreifer ihre Verfolgung auf.
Paul schüttelte sich, um sich aus seiner Benommenheit zu reißen. So schnell er konnte, trat er in die Pedale und fuhr den Männern hinterher, auch wenn ihm klar war, dass er nichts würde ausrichten können. Von allen Seiten wurde geraten, sich mit den Anhängern der Nazi-Partei auf keinen Streit einzulassen. Die meisten von ihnen gehörten zu den drei Millionen Arbeitslosen, die die Wirtschaftskrise hervorgebracht hatte. Ihre Zukunft war düster, Hoffnung hatte ihnen niemand zu bieten, und was ihnen blieb, war die Suche nach dem Sündenbock. Paul hatte einen Studienkameraden, den rechte Randalierer krankenhausreif geschlagen hatten, weil er versucht hatte, im Scheunenviertel einem jüdischen Buchhändler zur Seite zu stehen.
„Das nächste Mal würde ich die Beine in die Hand nehmen“, hatte er gesagt, und derselbe Wunsch erfasste Paul.
Aber durfte man das? Hilflose Menschen ihrem Schicksal überlassen, weil man Angst hatte, selbst Prügel zu beziehen? Nichts tun und den Blick zur Seite wenden, statt zu versuchen ein Leben zu retten? Der junge Mann mit dem schönen Gesicht konnte nicht älter sein als er selbst. In der Fahrt blickte Paul sich nach jemandem um, den er zu Hilfe hätte rufen können, doch in den Schatten der Hauseingänge regte sich kein Leben.
Sein Denken setzte aus. „Heda!“, brüllte er, so laut er konnte. Der Anführer der Nazis, der eben die Hand ausstreckte, um den Mann mit der Pelzmütze am Kragen zu packen, blieb stehen und schwang herum. Seine Kumpane taten es ihm nach. Der Augenblick der Verwirrung genügte ihren Opfern. Sie rannten aus Leibeskräften weiter und schlugen einen Vorsprung heraus, der sie in Sicherheit brachte. Vorn an der Hauptstraße herrschte zu viel Betrieb, dort würden die Nazis keinen Angriff wagen. Vor der Biegung wandte der junge Mann den Kopf, und Paul sah noch einmal sein erschütternd schönes Gesicht. Für den Bruchteil einer Sekunde traf ihn sein Blick aus dunklen, weiten Augen. Dann warf Paul sein Rad herum und fuhr los, als hätte er Hermann Buse, den Sieger der Deutschlandrundfahrt, in den Schatten stellen wollen.
Erst auf der Brücke, wo ihm Trauben von Menschen entgegenkamen, wagte er es, die Fahrt zu verlangsamen und Atem zu schöpfen. Herz und Puls rasten. Gehörten solche Überfälle jetzt zur Tagesordnung? Bei den Wahlen im September waren die Nazis zur zweitstärksten Partei geworden, und seither betrugen sie sich, als gehörte ihnen die Stadt. Hemmschwellen, die zivilisierte Menschen vor Gewalt zurückschrecken ließen, schienen ihnen fremd. Paul mühte sich, die Gedanken abzuschütteln. Erleichtert entdeckte er Amarnas unverkennbares Klappergestell, das am Portal des Museums lehnte.
Willi Gruber, der Pförtner, überließ ihm grummelnd einen Schlüssel, und wenig später stieg er hinunter in die Katakomben. Aus dem zweiten Saal drangen gedämpfte Geräusche. Paul rannte den Gang entlang und sah Amarnas rötlich schimmerndes Haar, halb von einem steinernen Flügel verborgen. Sie kniete vor einem der Schubschränke, die der Aufbewahrung von Tontafeln dienten. Kaum hörte sie seine Schritte, schreckte sie zusammen und schrie gellend auf. Als sie herumfuhr, sah Paul in furchtgeweitete Augen, die ihn an die des schwarzhaarigen Fremden denken ließen. Amarna starrte ihn an, als würde sie ihn nicht erkennen.
Paul ging zu ihr und kniete sich neben sie. „Amarna“, sprach er sie an. „Ich bin es. Paul.“
Sehr langsam, wie man eine Maske vom Gesicht zieht, wich der Schrecken. Amarnas Lächeln wirkte bemüht, doch ein wenig tat es das immer. Paul fand ihr Lächeln bezaubernd, aber es war nie ganz frei. Ein Lächeln auf dem Sprung, bereit zur Flucht.
„Was ist denn passiert?“, fragte er und lächelte zurück. „Aussehen tust du, als wäre dir der Geist von Ramses II. begegnet.“
„Passiert ist gar nichts“, murmelte sie, noch immer weit weg. Und wie kommst du auf Ramses II.?“
Noch immer lächelnd zuckte Paul mit den Schultern. „Es war der erste Pharaonengeist, der mir einfiel. Lässt du mich sehen, was du dir da herausgezogen hast?“ Er beugte sich über den Schub und sah unter dem schützenden Glas die Scherben einer Tontafel. „Ist es das, was du überprüfen wolltest?“
Amarna nickte. „Merten hat mit dir gesprochen, ja?“
Unwillkürlich streckte er die Hand aus, um ihr Haar zu berühren. „Er hat mir nur gesagt, dass du ins Museum wolltest, um einen Verweis zu prüfen. Bitte erzähl es mir, Amarna. Du weißt, wie gern ich dir bei deiner Arbeit helfe.“
Sie wandte ihm das Gesicht zu. „Ist das nicht unglaublich? Wir haben eine Version des Gilgamesch-Epos hier liegen, ein Original, gut erhalten und lesbar, und ich Tränentier hocke seit sechs Monaten über dem Thema und habe keine Ahnung davon.“
Paul lachte und wies auf die Scherben. „Findest du gut erhalten und lesbar nicht ein bisschen geprahlt?“
„Warum? Nun schön, die Tafel ist nicht vollständig, aber von dem Text ist so viel erkennbar, dass sich der Rest ergänzen lässt.“
„Und dessen bist du dir sicher? Kannst du den Text denn lesen?“
„Ich hasse es, wenn du diese gönnerhafte Miene auflegst.“ Von dem Schrecken, der eben noch ihr Gesicht gezeichnet hatte, war nichts mehr übrig. „Fühlst du dich stark, wenn du mit mir sprichst, als hättest du irgendein blauäugiges Dummchen vor dir?“
„Du bist doch blauäugig.“ Die idiotische Bemerkung war ihm entfahren, ehe sie ihn reuen konnte. Er fand Amarnas blaue Augen unglaublich schön. Als sie den Arm hob, um sich mit wütender Geste das Haar fortzustreichen, fiel der Ärmel ihrer Bluse zurück und gab das Armband frei, das sie immer trug – ein Band schillernder Perlen in verschiedenen Tönen von Blau. Vermutlich waren die Perlen aus Glas, aber hübsch war das Schmuckstück trotzdem. Die Blauschattierungen glichen denen in Amarnas Augen. Zu ihren dunklen Brauen und dem Schnitt ihres Gesichts bildete diese leuchtende Farbe einen eigentümlichen Kontrast.
„Entschuldige“, sagte er, „ich wollte nicht gönnerhaft sein, höchstens ein bisschen flapsig, um dich zu beruhigen.“
„Du brauchst mich nicht zu beruhigen. Ich habe dir gesagt, mir ist nichts passiert“, versetzte sie. „Dass ich die Tafel nicht lesen kann, weißt du selbst, denn sie ist weder auf Sumerisch noch auf Akkadisch abgefasst.“
„Ja, das weiß ich“, erwiderte Paul, der sich seine dürftigen Kenntnisse von Keilschrift nicht gern anmerken ließ. „Wirklich, Amarna, ich habe nur einen Witz machen wollen, sonst nichts.“
„Vergiss es.“ Sie wandte sich wieder dem Schub zu. „Wie merkwürdig es ist, vor Keilschrift zu stehen, die Zeichen entziffern zu können und dennoch kein Wort zu verstehen. Es fühlt sich falsch an. Alles in mir ist überzeugt, ich müsste es lesen können.“
Gleichzeitig beugten sie die Köpfe über die Scherben der Tafel. Trotz des spärlichen Lichtes waren die mit dem Griffel in Ton gekerbten und anschließend gebrannten Zeichen klar erkennbar. Die Schrift war schön und regelmäßig, was auf einen Schreiber schließen ließ, der diese Tätigkeit als Beruf ausübte. Die Faszination, die Amarna hergetrieben hatte, griff auf Paul über. Wie von selbst landeten seine Finger auf der Scheibe und strichen ehrfürchtig über die fast viertausend Jahre alten Schriftzüge.
Spuren einer versunkenen Welt.
Er war Archäologe geworden, weil ihm nichts so viel Halt und Zuversicht gab wie das Wissen, dass vor Jahrtausenden Menschen auf diesem Planeten gelebt hatten, dass sie geliebt und gelacht, gekämpft, geweint und sich vor dem Tod gefürchtet hatten wie er selbst. Vielleicht fand die Archäologie aus eben diesem Grund in ihrer Zeit der Ungewissheit so viel Zulauf. Wenn man Angst hatte, die Welt könne untergehen, half es, sich anzusehen, was sie samt ihres zähen Menschenvolkes schon alles überlebt hatte.
Er war kein Abenteurer, gehörte nicht zu den Pionieren seiner Zunft, die wie Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, und sein Freund, der wilde Enkidu, durch gottverlassene Wüsten, Wälder und Gebirge streiften, um der verschwiegenen Erde ihre Geheimnisse abzutrotzen. Merten Schobert, der in Ägypten selbst zu diesen Eroberern gehört hatte, nannte ihn mit leisem Spott einen Schreibstubenhengst. Dennoch kannte er die Erregung, die von einem Altertumsforscher Besitz ergriff, sobald er ein Teilchen des Welt-Puzzles in den Händen hielt.
„Du weißt, was es ist, nicht wahr?“
Amarna nickte. „Hethitisch.“ Ihre Augen leuchteten, und er hätte ihr Gesicht in die Hände nehmen und küssen wollen. „Paul, als du ein Kind warst, hast du da je davon geträumt, Atlantis zu entdecken?“
„Natürlich“, antwortete er. „Tut das nicht jeder Junge, der Archäologe werden will?“
„Jedes Mädchen auch.“
„Entschuldige.“ Er deckte seine Hand über ihre. „Wolltest du gern Atlantis entdecken, als du ein kleines Mädchen mit einer weißen Kittelschürze warst?“
„Ich hatte keine weiße Kittelschürze, aber eine Spitzhacke, mit der ich an der Krummen Lanke sämtliche Ufer nach Atlantis umgegraben habe.“
„Der Schrebergarten meiner Großeltern erlitt dasselbe Schicksal.“
Ihre Blicke trafen sich in stummem Verstehen.
„Weißt du, was so umwerfend ist?“, fragte Amarna. „Ich habe das Gefühl, ich habe es gefunden.“
„Atlantis?“
„Hattuša.“ Amarna nickte und berührte das Glas über der Tontafel. „Das Großreich, das von der Welt vergessen worden ist. Wenn wir von den herrschenden Mächten jener Epoche sprechen, nennen wir nur Ägypten, Assyrien und Babylon. Dabei gab es eine vierte, die die Geschichte totschweigt, als hätte sie nie existiert. Sag, Paul, kennst du jemanden, der hethitische Keilschrifttexte entziffern kann?“
„Allzu viele wirst du da nicht finden“, erwiderte er. „Die Sprache ist ja überhaupt erst vor ein paar Jahren von diesem tschechischen Sprachwissenschaftler entschlüsselt worden.“
„Bedřich Hrozný. Ich habe davon gelesen. Du glaubst also nicht, dass es hier in Berlin jemanden gibt, mit dem ich deswegen sprechen könnte?“
„Das brauchst du doch nicht“, antwortete Paul. „Ich bin sicher, gehört zu haben, dass die hethitische Fassung von Gilgamesch verknappt und nicht weiter von Bedeutung ist. Wenn dir aber etwas daran liegt, kann ich dir eine Übersetzung besorgen.“
„Die habe ich selbst“, sagte Amarna. „Und du hast richtig gehört, die hethitische ist keine der bedeutenden Gilgamesch-Versionen.“
„Wozu brauchst du dann jemanden, der Hethitisch lesen kann?“
„Weil ich es lernen will“, antwortete Amarna und stand auf.
„Du willst Hethitisch lernen? Eine Sprache, die auf der Welt nur eine Handvoll Menschen verstehen und in der es kaum bedeutende Texte gibt?“ Perplex blickte Paul zu ihr auf. „Aber warum denn, wenn du es für deine Arbeit nicht brauchst? Solltest du nicht lieber nach London fahren und dir die Elf-Tafel-Version von deinem Gilgamesch im British Museum ansehen? Das ist sowieso ein Erlebnis, das du niemals vergessen wirst …“
„Nun schön …“ Amarna warf den Kopf zurück, dass das kurze Haar ihr über die Wange strich. „Jetzt sind wir also wieder bei deinen Schwärmereien vom British Museum, von der perfekten Zivilisation der Engländer und von ihren Heldentaten überhaupt. Spar dir deinen Atem. Wie du weißt, würde mein Vater mir nie im Leben erlauben, nach London zu reisen.“
„Ich könnte mit deinem Paten sprechen“, schlug Paul vor. Auf einmal konnte er sich nichts Schöneres vorstellen, als mit ihr durch London zu streifen und ihr das British Museum zu zeigen, das ein Mekka für Archäologen war. Merten Schobert hatte ihm seinerzeit die Reise ermöglicht, und gewiss würde er sich auch für Amarna einsetzen, wenn Paul die richtigen Argumente fand. „Weißt du, was Schobert vorhin zu mir gesagt hat? Er macht sich ein bisschen Sorgen, du könntest den Fokus verlieren. Wenn ich ihm nun erklären würde, dass du einfach eine Anregung brauchst, die Begegnung mit dem Original aus Ninive …“
„Dann würde mein Vater trotzdem sein Veto einlegen“, fiel Amarna ihm ins Wort. „Er hat Angst, ich würde in einen Abgrund des Verderbens stürzen, sobald ich seinen Dunstkreis auch nur drei Schritte weit verlasse.“
„Vertraut dein Vater, was dein Studium betrifft, nicht seinem Freund Merten?“, fragte Paul. „Ich bin sicher, er lässt sich überzeugen, wenn Schobert ihm klarmacht, dass die Londonreise für deine Arbeit unentbehrlich ist. Lass es mich wenigstens versuchen, ja?“
„Willst du das wirklich für mich tun?“
„Und ob.“ Behutsam schloss Paul den Schub und stand ebenfalls auf. „Ich fange gleich morgen an ihn zu bearbeiten. Und jetzt gehen wir bei Mutter Wiechert auf eine deftige Kartoffelsuppe, einverstanden?“
„Bei Mutter Wiechert bekommen wir doch um die Zeit keine Kartoffelsuppe mehr.“
„Ich schon.“ Er reichte ihr seinen Arm. „Mutter Wiechert mag mich.“
Amarna hakte sich bei ihm unter und lachte. „Gibt es eigentlich auch Frauen, die dich nicht mögen?“
Er suchte ihren Blick und fasste sich ein Herz. „Jedenfalls gibt es nur eine Frau, die ich mag“, sagte er. „Sie heißt Amarna Brandstätter, und ausgerechnet bei der habe ich nicht die geringste Ahnung, was sie von mir hält.“
In der Weite des Saales hallte ihr Lachen silbrig. „Von dem Mann, der versucht, es mit meinem Starrkopf von Vater aufzunehmen? Was soll ich von dem denn halten? Der ist ein Held wie Gilgamesch.“
„Dafür bringe ich deinen Vater dazu, dir einen Flug zum Mars zu gestatten“, sagte Paul. „In einer dreibeinigen Kampfmaschine wie bei H. G. Wells.“
Vor der Treppe blieb Amarna stehen. Paul blieb auch stehen und schaltete das Licht aus. Sacht legte er die Arme um sie und suchte im Dunkeln ihren Mund.
Ihre Lippen waren fest und trocken. Sein Kuss war eine Frage, und sie gab ihm darauf eine hauchzarte Antwort, die ein Versprechen barg. Wie eine heiße Woge schoss ihm das Glück durch den Leib.
„Paul?“
„Ja, Blauauge?“
„Auf den Mars will ich nicht. Aber wenn du dir die Mühe schon machst, dann sag Merten, mein Vater soll mich nach Hattuša fahren lassen.“
5
Amarna hätte glücklich sein sollen. Von dem, was sie besaß, konnten die meisten Frauen nicht einmal träumen.
Mit ihrem Vater teilte sie sich die behaglich verschlampte, viel zu große Wohnung in Charlottenburgs Westen, die bis an die hohen Stuckdecken mit Büchern gefüllt war. Amarna und ihr Vater schleppten Bücher selbst auf die Toilette mit. Anders als von den meisten Töchtern wurde von ihr nicht erwartet, dass sie ihren verwitweten Vater umsorgte. Den gesamten Haushalt erledigte Frau Ziethen, die schon seit ihrer Kindheit bei ihnen war, sodass Amarna sich auf ihr Studium konzentrieren konnte. Mehr verlangte ihr Vater nicht von ihr. Sie war sein Augapfel. Für ihr Wohlergehen hätte er alles gegeben, was er hatte.
In einer Zeit, in der Millionen von Menschen um das Nötigste bangten, kannte Amarna keinerlei Geldsorgen, sondern lebte in einem behüteten Kokon. Ihr Vater war der einzige Erbe des Strumpffabrikanten Brandstätter. Kaum war sein Vater gestorben, hatte er das Unternehmen verkauft, um sich mit Haut und Haar der Archäologie zu widmen. Zwar hatte seine Passion den Löwenanteil des Erbes verschlungen, doch der Rest genügte, um ihnen auf absehbare Zeit ein komfortables Auskommen zu sichern.
Obendrein hatte Amarna in Paul einen Mann an ihrer Seite, der ihre Interessen teilte. Der hochgewachsene Doktorand, dem sein Blondhaar in einer Tolle in die Stirn wuchs, gehörte zu den Männern, nach denen Frauen die Köpfe drehten. Amarnas weibliche Bekannte machten aus ihrem Neid keinen Hehl. „Du weißt gar nicht, was für ein Glück du hast“, hatte Helene, eine Studienkameradin, erst kürzlich zu ihr gesagt. „Dein Paul sieht nicht nur umwerfend aus, er hat auch Stil, und von dem Kleinbürgermief, aus dem er stammt, hängt ihm nichts an.“
Vielleicht weiß ich wirklich nicht, was für ein Glück ich habe, dachte Amarna. Vielleicht musste man, um sein Glück zu fassen, in der Nacht ruhig schlafen, sodass einem am Morgen nicht der Kopf wie zum Zerspringen schmerzte. Konnte man Glück zu schätzen wissen, solange man fürchten musste, dass man langsam, aber sicher den Verstand verlor?
Amarna litt an Albträumen. Der erste hatte sie in der Nacht vor ihrer Einschulung heimgesucht, in der ersten Nacht, an die sie sich bewusst erinnern konnte. Sie hatte sich auf den Tag gefreut, denn Frau Ziethen hatte versprochen, ihr für die Feier das Haar zur Krone zu flechten, und zum Frühstück hatte sie bei Thomke Zitronenpfannkuchen bestellt, eine Geschenkschachtel, in der das köstliche Gebäck auf Spitzendeckchen lag.
„Ich wünschte nur, du würdest Gertrud heißen“, hatte die Haushälterin, die zugleich als Concierge fungierte, mit einem Seufzen bekundet.
„Ist Gertrud schöner als Amarna?“, hatte Amarna gefragt.
„Gertrud, Erna, Käthe, das ist alles schöner als Amarna. Ein Kind, das Gertrud heißt, wird wenigstens nicht verspottet, und außerdem ist Gertrud ein Name und Amarna nicht.“
„Was ist Amarna denn dann?“, fragte Amarna, die diesen Namen, der keiner war, schließlich trug.
„Das habe ich deinen Vater auch gefragt“, schimpfte Frau Ziethen. „Er hat gesagt, es ist eine Stadt, die in der Wüste versunken liegt, und ich soll ihn nie wieder danach fragen. Dabei hätte ich ihn nur allzu gerne gefragt, ob er selbst vielleicht Lust hätte, Versunkene-Stadt-in-der-Wüste zu heißen.“
In dieser Nacht träumte Amarna von einer Stadt, die in einer Art Wüste versunken lag. Schwarzgrau und riesenhaft erhob sie sich aus Sand und Staub und drohte, ihre Umgebung zu verschlingen. Ihre Mauern waren von schwarzen, schweigenden Bergen umringt und wuchsen über deren Gipfel hinaus, ragten ohne Einhalt und Grenze dem Himmel entgegen. In ihr Gestein waren weit über lebensgroße Figuren eingemeißelt, die ihr entsetzliche Angst einjagten. Über ihrem Kopf schlossen die Mauern sich zu einem Dach und raubten ihr die Sicht. Unter ihren Füßen begann die Erde zu beben, dann brach mit einem gewaltigen Donnern die Stille, und die Mauern und Türme stürzten nieder. Gesteinsbrocken prasselten zu Boden und begruben Amarna unter sich.
Sie rollte sich zusammen, umklammerte ihre Knie und presste das Gesicht in das zerliebte Kinderkissen mit dem Bild eines Löwen, von dem sie sich in keiner Nacht trennte. Winzig klein machte sie sich, doch das half nichts. Die Trümmer trafen sie auf Stirn und Wangen. Ihr Schrei, der in der Felsenstadt ungehört verhallte, riss sie aus dem Schlaf.
Seither träumte sie denselben Traum wieder und wieder, zuweilen mit monatelangen Pausen, dann hingegen zweimal in derselben Nacht. Etwas hatte sie davor zurückscheuen lassen, ihrem Vater davon zu erzählen, und dabei war es geblieben. Sie war mit den Träumen allein und hatte nie mit einem Menschen darüber gesprochen.
Völlig unvermittelt sah sie das Gesicht des Fremden aus dem Museum vor sich. In jener Nacht hatte sie eine Sekunde lang das Gefühl gehabt, sie müsse bersten und einem Unbekannten erzählen, was sie ihr Leben lang allein mit sich herumgetragen hatte. Glücklicherweise war sie im letzten Augenblick daran gehindert worden. Ihr Vertrauen hatte kein zwielichtiger Fremder verdient, sondern der Mann, der ihr zur Seite stand.
Wenn sie tun wollte, was Paul sich so sehr wünschte, ihre Beziehung vertiefen, ein Datum für die Verlobung festsetzen, dann musste er von ihren Albträumen erfahren. Sie war es ihm schuldig. Die Träume mochten ebenso wie ihre seltsamen Ängste Symptome einer Gemütskrankheit sein, die eine Heirat unmöglich machte. Keinem jungen Mann konnte eine Ehe mit einer Frau zugemutet werden, die an einer Art von Wahnsinn litt und ihn an ihre Kinder weitergeben würde.
Schon gar nicht einem jungen Mann wie Paul. Amarna wusste, wie sehr er unter seiner Herkunft litt. Er hatte erbittert darum gekämpft, der geistigen Enge seines Elternhauses zu entfliehen und eigenen Kindern einmal eine andere Zukunft zu bieten. Von einer Wohnung wie der ihren in der Marburger Straße träumte er, von einem Familienleben, das von Kultur, Bildung und Weltoffenheit geprägt war. Geisteskrankheit hatte darin keinen Platz, und Amarna hatte kein Recht, ihm seinen Traum zu zerstören. Wenn sie ernsthaft daran dachte, seine Frau zu werden, musste sie ihm die Wahrheit sagen: Ich spiele die nüchterne Akademikerin, die sich an Fakten hält, doch in der Nacht bin ich ein Spielball meiner dunklen Träume. Ich spiele die Unerschrockene, die sich in der Männerwelt durchboxt, aber ich zittere vor jedem Schatten an der Wand. Ich heimse Lob für mein Gedächtnis ein, doch ich habe alles vergessen, was mir vor dem Jahr meiner Einschulung geschah.
Dieses Letzte war vielleicht das Beklemmendste. Wann immer sie versuchte ein Bild aus jenen Jahren in sich wachzurufen, wurde ihr Gedächtnis zur leeren Fläche, zur Tontafel, aus der sämtliche Schriftzeichen mit dem Meißel getilgt worden waren. Es war, als wäre sie ein Jahr vor Kriegsausbruch als Schulmädchen zur Welt gekommen. Ihren Vater brauchte sie nicht danach zu fragen. So wenig wie nach ihrer Mutter, von der es in der ganzen Wohnung kein Foto, sondern nur einen altmodisch-eleganten Lederkoffer mit dem Namensschild Nora Brandstätter gab.
„Wir waren jahrelang auf Reisen“, war alles, was ihr Vater ihr dazu gesagt hatte, als sie zehn Jahre alt gewesen war. „Deine Mutter zog sich eine dieser Krankheiten zu, die in jenen Ländern ganze Dörfer innerhalb von Tagen entvölkern. Damals gab es ja noch Cholera-Epidemien, die über ein Land hinwegfegten wie die Plagen des Exodus. Sie ist gestorben, und ich habe sie vor Ort begraben lassen.“
„In Ägypten?“
„Du bist kein kleines Kind mehr, Amarna“, erwiderte ihr Vater. „Begreifst du nicht, dass ich darüber nicht sprechen will?“
In seine wasserhellen Augen, deren Blick sie nur klug und sachlich kannte, trat eine Qual, die sie erschreckte.
„Aber was war mit mir?“, entschlüpfte ihr dennoch die Frage, die in ihr brannte.
„Mit dir?“ Der Blick ihres Vaters flackerte, als hätte er Mühe, ihn stetig zu halten. „Du warst hier, in Berlin. Solche Reisen eignen sich ja nicht, um kleine Kinder mitzunehmen. In diesen Gebieten gibt es weder Krankenhäuser noch sanitäre Anlagen, und außerdem schleppt man Kinder nicht auf Ausgrabungsstätten herum. Sie verwildern dabei. Kinder brauchen Aufsicht, Fürsorge und ein Zuhause.“ Er roch nach Pfeifentabak und dem Ahornsirup, den er zu jeder Mahlzeit aß. Wenn es überhaupt etwas gab, das Amarna ein Gefühl von Zuhause verlieh, dann war es dieser Geruch. Ihr Vater machte eine Pause, rieb sich die Augen und sah sie noch einmal an. „Ich mag dir in jenen Jahren kein guter Vater gewesen sein, Löwenkind. Ich war erfüllt von meiner Laufbahn, von Abenteuern und Entdeckungen, bei denen ich mich beweisen wollte, und ich habe wohl geglaubt, die Aufzucht von Kindern sei Frauensache. Aber ich habe danach versucht es gutzumachen. Ich liebe dich, Amarna. Außer dir zählt für mich gar nichts mehr.“
Damit war das Thema abgetan, und die Qual in seinen Augen verbot ihr, noch einmal daran zu rühren. Immerhin hatte er ihr erzählt, dass die Wüstenstadt, nach der sie benannt worden war, in Ägypten lag, Tell el-Amarna hieß und einst Achet-Aton, die Hauptstadt des Pharaos Echnaton, gewesen war. Seine Liebe hatte der damals noch kaum etablierten Vorderorientalistik gegolten, doch als sich die Gelegenheit ergab, an einer Expedition nach Ägypten teilzunehmen, hatten weder er noch Merten gezögert. In Tell el-Amarna war Tilman Brandstätter zum Leiter der Expedition aufgestiegen, was seinen Ruf als Archäologe begründet hatte.
Auf ihre Bitte hin hatte ihr Vater ihr ein Foto gezeigt, auf dem er strahlend im Wüstensand kniete und mit einer Spitzkelle einen Kanopenkrug freilegte. Amarna war stolz darauf gewesen. Seit sie das Foto aus Tell el-Amarna kannte, hatte sie sich nie mehr gewünscht, Gertrud, Erna oder Käthe zu heißen.
Sie hieß nicht wie andere Mädchen, und ihre Familie war nicht wie andere Familien. Sie besaß an die Zeit vor ihrer Einschulung keine Erinnerung, aber war das wirklich ein so schwerwiegendes Problem? Vielleicht hätte sie sich damit abgefunden und sich auf ihre Beziehung mit Paul konzentriert, wäre die Sache mit den Träumen nicht schlimmer geworden. Seit sie in den Katakomben des Pergamonmuseums die Tontafel aus der Stadt namens Hattuša entdeckt hatte, verging kaum mehr eine Nacht, ohne dass der Traum sie im Innersten durchrüttelte. Am Morgen fühlte sie sich zerschlagen und verbrachte die Tage wie in Trance.
Sie hätte glücklich sein müssen, aber wer Angst um seinen Verstand hatte, fand selten Raum für Glück.
An einem feuchtkalten Nachmittag Mitte Januar ging sie von der Universität zum Hackeschen Markt, um zu ihrem Sprachunterricht zu fahren. Überfrorener Schneematsch bedeckte die Straßen, und für ihr altersschwaches Rad war es zu glatt. Mit der S-Bahn aber waren es nur zwei Stationen bis zum Bahnhof Jannowitzbrücke, wo die Lektionen stattfanden.
Amarna hatte die Hoffnung schon aufgegeben, als sie doch noch jemanden gefunden hatte, der bereit war, sie im Hethitischen zu unterweisen. Trotz Pauls Warnung hatte sie sich die Suche so schwer nicht vorgestellt. Die Orient-Gesellschaft war die größte archäologische Grabungsgesellschaft der Welt, und sie war sicher gewesen, dass es dort Mitglieder gab, die sich Grundzüge der noch weitgehend unerforschten Sprache angeeignet hatten. Auf einen Aufruf, den sie ins Mitteilungsblatt setzen ließ, meldete sich jedoch niemand. Beim Institut für Archäologie und am Schwarzen Brett ihrer Fakultät blieb sie ebenfalls erfolglos. Eines Abends hatte Merten sie im Lesesaal aufgesucht und zu einem Gespräch auf den Gang gebeten.
„Ich höre, du durchsuchst die halbe Stadt nach jemandem, der dich lehrt, Hethitisch zu lesen“, hatte er gesagt.
„Allerdings“, erwiderte Amarna. „Sag jetzt nicht, du kannst es mir beibringen, und ich habe mir die ganze Mühe umsonst gemacht.“
„Nein“, verwies Merten sie knapp. „Ich bringe es dir nicht bei, und es gibt auch keinen Grund, es lernen zu wollen.“
„Keinen Grund?“, fuhr Amarna auf. „Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet du so etwas sagst. Da draußen in Anatolien liegt die Hauptstadt eines vergessenen Weltreichs, und wir haben schon jetzt etliche Tontafeln hier, die auf Entzifferung warten. Mir ist unbegreiflich, weshalb nicht die halbe Fakultät darauf brennt, diese Sprache zu erlernen.“
„Nach Hattuša hat seit 1912 kein Archäologe mehr seinen Fuß gesetzt“, sagte Merten, und das Wort Hattuša klang dumpf aus seinem Mund. „Der Krieg kam dazwischen, die Kämpfe auf dem Balkan, der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Darüber geriet das bisschen, was dort unten gefunden worden ist, in Vergessenheit, und der ewige Wind bläst Erde darüber.“
„Dann wird es höchste Zeit, sich zu erinnern“, rief Amarna. „Warum stattet die Orient-Gesellschaft keine Expedition aus, um die Grabungen wieder aufzunehmen?“
Merten zuckte mit den Schultern. „So leicht, wie du dir das vorstellst, bekommt man da unten keine Grabungslizenz. Vor dem Krieg hatten wir gute Karten, weil der Kaiser an Beziehungen zum Osmanischen Reich ein Eigeninteresse hatte. Aber für solche Beziehungen zahlt man letztlich immer einen Preis.“
„Ich verstehe nur Bahnhof“, bekannte Amarna. „Wer hat wofür einen Preis bezahlt?“
„Vergiss es“, erwiderte Merten. „Es war nur so dahingeredet und hat mit dieser Sache nichts zu tun. Inzwischen sieht die Lage in Anatolien völlig anders aus, und außerdem wäre es die Mühe nicht wert. Wenn wir als Archäologen nicht auf ewig den Engländern hinterherhinken wollen, dürfen wir uns nicht auf Nebenschauplätzen verlieren. Babylon, Ninive, Uruk – in Mesopotamien reiht sich eine Schatztruhe an die andere, weshalb sollten wir uns also mit ein paar kruden Resten in Anatolien herumschlagen?“
Amarna hatte noch einmal versucht aufzubegehren, doch Merten verwies sie mit einer Schärfe, die sie erschreckte.
„Stiehl uns mit dieser fixen Idee nicht die Zeit, Amarna. Paul hat mich bereits deswegen angesprochen. Der Junge ist treu wie ein Hütehund und würde um deinetwillen um die Welt hecheln. Meiner Ansicht nach hast du kein Recht, solche Treue auszunutzen.“
„Und meiner Ansicht nach hast du kein Recht, so mit mir zu sprechen“, schoss sie zurück. „Wenn Paul sich ausgenutzt fühlt, wird er ja wohl Manns genug sein, mir die Stirn zu bieten, statt sich an deinem Hemdzipfel auszuweinen.“
„Ach, Fräulein Brandstätter.“ Merten lächelte mit eingekniffener Wange. „Wie viele Männer sind schon Manns genug, der Frau, die sie lieben, die Stirn zu bieten?“
„Sprichst du aus Erfahrung?“, fragte Amarna erstaunt. Soweit sie wusste, hatte es in Mertens Leben nie eine Frau gegeben, und für gewöhnlich war dies kein Thema, das er anschnitt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: