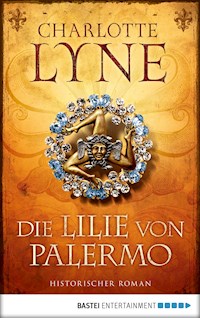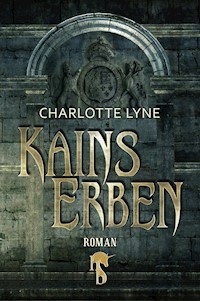6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die mitreißende Geschichte der letzten Gemahlin Heinrich des Achten. England im 16. Jahrhundert, in den Wirren der Reformation. Catherine Parr hegt zwei Herzenswünsche: Eines Tages will sie ein Buch schreiben – für eine Frau unvorstellbar. Und sie will Tom Seymour heiraten. Schon seit ihrer Kindheit wissen die beiden, dass sie füreinander bestimmt sind. Die stürmische Epoche aber hat etwas anderes im Sinn mit Catherine und Tom: Am Hofe König Henry des Achten geraten sie in den Strudel der Reformation. Dem draufgängerischen Tom droht das Fallbeil, und von Catherine wird ein übermenschliches Opfer verlangt. Während England sich für immer verändern soll, kämpft die mutige Frau darum, sich ihre beiden größten Wünsche doch noch zu erfüllen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 982
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Charlotte Lyne
Die zwölfte Nacht
Ein Tudor-Roman
Für meine Kinder.Klaus, Lynn und Raúl
On the first day of Christmas my true love gave to meA partridge in a pear tree.
On the second day of Christmas my true love gave to meTwo turtle doves.
On the third day of Christmas my true love gave to meThree French hens.
On the fourth day of Christmas my true love gave to meFour calling birds.
On the fifth day of Christmas my true love gave to meFive gold rings.
On the sixth day of Christmas my true love gave to meSix geese a-laying.
On the seventh day of Christmas my true love gave to meSeven swans a-swimming.
On the eighth day of Christmas my true love gave to meEight maids a-milking.
On the ninth day of Christmas my true love gave to meNine ladies dancing.
On the tenth day of Christmas my true love gave to meTen lords a-leaping.
On the eleventh day of Christmas my true love gave to meEleven pipers piping.
On the twelfth day of Christmas my true love gave to meTwelve drummers drumming.
Englisches Weihnachtslied; 16. Jahrhundert
Prolog
OxfordMärz 1556
»Da kommt er! Der Ketzer Cranmer kommt!« Wie ein massiges Tier, ein Fabelwesen mit zahllosen Köpfen, bäumte die Menge sich auf. Maggie, an der Hand ihrer Patin, hüpfte, so hoch sie konnte. Für ihre sieben Jahre war sie ein großes Mädchen, aber der Männerrücken vor ihr erwies sich als unüberwindliches Hindernis. Das Graubraun seiner Kutte verschwamm in Tränen der Enttäuschung. Seit Stunden stand sie im feinen Regen am Hang des Stadtgrabens, ließ sich begaffen, gar befingern, und wartete. Ein fettes Weib hatte an dem Umschlagtuch aus königsblauem Samt, Maggies prächtigstem Kleidungsstück, gezupft, und ein Kerl hatte ihr ins Haar gelangt. »Oh, eine Herrschaftliche. Und was für hübsches Fell auf dem Köpfchen sprießt.«
Allem Ekel zum Trotz harrte Maggie aus. Nie zuvor hatte sie eine Hinrichtung erlebt und war entschlossen, sich diese durch nichts verleiden zu lassen. War nicht Kate, die sie Tante Kate nannte, obgleich sie einander nicht verwandt waren, eigens dazu mit ihr in die Stadt Oxford gereist? Gestern, in der noch nachtkalten Herrgottsfrühe, hatte sie Maggie aus dem Schlaf gerissen: »Kleide dich an. Wir reisen ein Stück, der Wagen wartet schon.«
»Aber weshalb, was tun wir?«
»Frag nicht, eil dich. Wir fahren zu einer Hinrichtung.«
Hinrichtung, so hatte Guy, der Sohn des Stallmeisters, erklärt, ist, wenn sie einen vom Leben, dessen er nicht wert ist, einem gewaltigen, grausamen Tod zuführen. Da graust es einem Christenmenschen, und im Grausen reinigt es ihn.
Auf den langen Stunden der Fahrt vergrub Tante Kate sich in gewohnter Wortkargheit. Von ihr war keine Auskunft zu erwarten, doch in dem Gasthaus, in dem sie schließlich einkehrten, schwatzten Wirt und Zecher sich die Köpfe heiß: Ein vorzügliches Spektakel sollte es geben, eine geweihte Versammlung vor dem Scheiterhaufen, für den Holz und Reisig längst aufgeschichtet waren. Maggie erträumte sich Bischöfe in leuchtenden Messgewändern, Gardisten der Krone im Prunk roter Schauben, Jongleure mit wirbelnden Keulen, Fiedler und Sänger, Stelzengänger und womöglich einen Bärenführer. Was hätte sie daheim in Chelsea zu berichten! Guy, der sie ständig verhöhnte, weil sie die Namen ihrer Eltern nicht kannte, wäre stumm vor Neid.
Doch statt der Märzsonne, die Maggies Festtag vergolden sollte, fiel seit dem Morgengrauen dünner Regen. Von Bäumen getriebene Blüten klebten zertreten auf Pflastersteinen, in den Nebel duckten sich die Bauten des Balliol College, und die Versammlung wurde in eine Kirche verlegt, zu der Frauen und Kinder keinen Zutritt hatten. Zwischen Leiber in stinkenden Kleidern gezwängt, warteten Maggie und ihre Patin ab, bis man den Ketzer brachte. Tante Kate stand wie üblich still, als könne kein Sturm sie erschüttern, Maggie aber hätte vor Erregung zappeln wollen. Hatte der Unhold wüstes Haar, glühten seine Augen vom Höllenfeuer? War er ein Riese wie die Ringer auf dem Fischmarkt, zerrte er an Ketten und stieß Flüche gegen die Zuschauer aus? »Sie kommen!«, schrie eine Frau. »Das ist der Mann, dem unsere Königin ihr Unglück dankt!«
»Brennen soll der Gotteslästerer!«
»Lang lebe Königin Mary!«
Noch einmal versuchte Maggie sich an einem Sprung, doch ohne Erfolg. Zornig stampfte sie mit dem Fuß, dass der Schlamm der Uferwiese der Patin den Mantel bespritzte. Ihren Trauermantel. Tante Kate trug niemals lichtere Farben. Gleich darauf fühlte Maggie sich an den Armen gepackt und in die Höhe gestemmt. »Recht so, kleine Mistress. Einen Satansbraten wie den bekommst du dein Lebtag nicht noch mal zu sehen.«
Der Mann, der hinter ihr gestanden und sie aufgehoben hatte, setzte sie sich auf die Schultern. Ihr Herz polterte dumpf, derweil die Worte des gehässigen Guy ihr an die Schläfen hieben: Warum wohl spricht die Patin nie von deinen Eltern? Weil sie Satansbraten sind, die in der Hölle schmoren. Die Brut von Ketzern bist du. Über der Kappe des Mannes ballte Maggie die Fäuste. Dann sah sie die Prozession.
Die Straße hinunter kamen sie, vorbei an der Reihe umnebelter Gebäude, umsprungen von einem Buntgekleideten, der eine kleine Flöte blies. Vorneweg tanzte ein wenig Volk, trippelten ein paar Kinder, dann folgten die Trommler, die spanischen Mönche, deren Kutten in der Nässe schleiften, dahinter der Pulk des Klerus und schließlich die Wachen mit dem Verurteilten. Maggie entfuhr ein Laut der Überraschung, den das Wutgeheul der Menge schluckte. Sie hatte einen Riesen mit höllischen Augen erwartet, doch die Gestalt, die sich stolpernd schleifen ließ, war ein Greis mit zerzaustem Bart.
»Verbrennt ihn, Rache für More und Fisher!«
»Gott schütze unsere gute Königin!«
Der Greis trug nichts als einen Kittel am Leib und eine Bundhaube um den geschorenen Kopf. Er friert, durchfuhr es Maggie. Aber an Kälte würde er nicht sterben. Entschlossen packte sie ihren Träger bei den Ohren und beugte sich vornüber. Jetzt sah sie den schmächtigen Alten deutlich, jede Furche in dem wohl hundertjährigen Gesicht. Am Arm riss einer der Schergen ihn voran. »Na wird’s bald, Eminenz. Da vorn wartet ein wackeres Feuerchen auf Eure Frostbeulen.«
Gelächter. Johlen. Eine Frau reckte die Faust und schleuderte dem Greis eine Verwünschung entgegen. Der Ketzer, in dem doch kein Funken Kraft mehr zu stecken schien, blieb so ruckartig stehen, dass er die Schergen zum Halt zwang.
»Ja, flucht mir, gute Frau«, rief er. »Ich bin ein schändlicher Sünder, denn ich habe mein Wort verleugnet. Aber alles gilt, alles gilt! Meinen Widerruf schrieb ich in Todesangst, und meine Hand soll dafür brennen.«
Die Versammelten heulten vor Empörung auf. Ein rot gekleideter Hüne sprang hinzu und versuchte, dem Greis den Mund zuzuhalten. Dieser aber kämpfte sich einen Herzschlag lang frei. »Wenn es den Antichristen auf Erden gibt, so ist es der Papst mit seiner klobigen Kirche, die uns den Blick in den Himmel versperrt.«
Ehe die Wachen ihn niederrangen, schien es Maggie, als hefte sich sein Blick auf ihr Gesicht. »Gott schaue auf Euch«, hörte sie seine Stimme. Im nächsten Moment hatte Tante Kate sie an den Beinen gepackt und von den Schultern des Mannes gezerrt.
Sie landete unsanft auf einem Fuß und fand sich eingekeilt zwischen Leibern in feuchter Wolle. »Ich sehe nichts mehr«, begehrte sie auf. »Was tun die, ich muss doch sehen, was sie tun!«
»Sie schlagen ihn. Das musst du nicht sehen, wie eine haltlose Horde auf einen alten Mann einschlägt.« Die Patin zog Maggie an sich, begrub des Kindes Gesicht in den Mantelfalten. So standen sie still, und die Welt schien auch stillzustehen, an Maggies Wangen die Wärme nassen Stoffes, die Geborgenheit des Leibes, der darin eingewickelt war. Dann ließ die andere sie los. Maggie blinzelte. Die Menschenmenge hatte sich rings um die Richtstätte verteilt, in die Länge gezogen, so dass sie beide sich zwischen zwei Körpern nach vorn drängen konnten. Alle Köpfe waren starr geradeaus gewandt.
Holz und gebündelter Reisig umgaben den Pfahl, der in den steingrauen Himmel ragte. Geschrei und Gejohle waren verstummt. In die Stille platzten die Flöte des Buntgekleideten und die Frauenstimmen, die neben Maggie tuschelten. »Wenn’s weiter so aus Kübeln schüttet, wird’s wie bei dem Ridley, den sie letzthin geröstet haben.«
»Ihr sagt es. Bei dem Hundewetter hat es eine Ewigkeit gedauert, bis der Teufel den geholt hat, und wie Vieh verreckt ist der.«
»Wie ein Mann gestorben ist er.« Der hellen Mädchenstimme folgte das Klatschen einer Ohrfeige. Über das Reisig schleiften die Wachen den Greis hinauf an den Pfahl. Einer riss ihm die Haube vom Kopf, zwei weitere bogen ihm die Arme nach hinten und schlangen eine Kette um seinen Leib. Der Regen war nicht stärker geworden. Er fiel dünn wie verschlissenes Tuch. Das Spiel der Flöte brach ab. Die Wachen hakten die Kette am Pfahl fest. Dann sprangen sie zu Boden und ließen den alten Mann allein.
Ins Flüstern des Regens fiel der verhaltene Wirbel der Trommeln. Hinter dem Scheiterhaufen traten zwei Henker hervor, die Köpfe gesichtslos, umschmiegt von schwarzem Leder. Die Fackeln, die sie in die Höhe hielten, loderten kraftvoll genug, um dem kümmerlichen Niederschlag zu trotzen. Der rot gewandete Hüne hob den Arm. »Für Gott, für England, für die Königin!« Am Pfahl stand reglos der Greis. Er sieht mich an, durchfuhr es Maggie, von all den Menschen mich. Die zwei Henker gingen in Stellung und senkten die Fackeln auf das Reisig.
»Schließ die Augen, Kind.«
Maggie versuchte es, doch ihre Lider schlugen immer wieder auf. Die Patin starrte unverwandt nach vorn.
»Wenn ihr das Abendmahl empfangt, so gedenkt dabei Christi, unseres gütigen Herrn! Er wird bei euch sein. Als euer Bruder. Nicht als Brot der Hostie.« Was redete der Alte im Angesicht des Todes? Es war, als riefe seine Stimme Maggie zu sich. Wie befürchtet, fing das Reisig nur stockend Feuer. Schwarzer Rauch quoll auf, und erste Flammen leckten nach den Füßen des Gefesselten. Seine Stimme klang dennoch wie ein Frohlocken. Er stand aufrecht, das Gesicht himmelwärts, in den Regen gewandt.
Ein Windstoß trieb Qualm herüber, hüllte die Menge in beißendes Dunkel. Maggie schlug sich ihr Tuch vor den Mund, schmeckte pelzigen Samt. Als der Schwaden sich lichtete, entdeckte sie eine einzelne Flamme, die vor dem Greis in die Höhe flackerte. »Ich sehe den Himmel offen, und Christus sitzt zur Rechten Gottes!« Die letzte Silbe ging in ein Schrillen über, das sich in die Höhe schraubte und kein Ende nahm. Kein Menschenlaut mehr. Schmerz, der das Menschsein wie einen Vorhang zerriss. Lohen zuckten. Gestank verdickte die Luft. Frauen kreischten, Männer brüllten. »Eine Kerze für England!« Kraftvoll drang eine einzelne Stimme durch das Getöse an ihr Ohr. »Unser Erzbischof Cranmer wird leben!«
Maggie keuchte, würgte, hörte ihren Blutstrom rauschen. Finsternis zog vor ihre Augen. War der Mann schon tot? Noch immer meinte sie, seinen Blick auf sich zu fühlen, und seine Worte gellten ihr in den Ohren: Gott schaue auf Euch! Ihr Leib krümmte sich. Sie würde fallen. Als laste ihr Gewicht nicht auf Beinen, sondern hinge an Schnüren, knickten ihr die Knie weg. Das Letzte, was sie spürte, war die Liebkosung des Samtes, der ihr den Rücken hinunterglitt. Dann nahte der Boden. Sie hob die Hände zum Schutz vor ihr Gesicht, aber ehe sie hinschlug, fingen die Arme der Patin sie auf.
Als sie zu sich kam, hatte die Menge sich aufgelöst. Die Patin half ihr auf, schlang ihr das verschmutzte Umschlagtuch mit Sorgfalt um die Schultern und führte sie die Straße hinunter. Der Himmel hing bleiern, es regnete nicht mehr, und in der Luft klumpte der beißende Geruch von versengtem Fleisch. »Dreh dich nicht um.« Eilig strich die Patin über ihren Rücken. Nie, solange Maggie sich erinnerte, war diese Frau mit ihr zärtlich gewesen. Wer mochte es ihr verdenken? Mit solchem Kind, dem Balg von Namenlosen, war man so wenig zärtlich wie mit Ratten.
Ihre Beine schleppten sich müde, als wäre sie schon weit gegangen. »Ich lasse den Wagen anspannen«, sagte Tante Kate. »Wenn du nicht hungrig bist, brechen wir gleich auf.«
Am Rand der Straße stand ein einzelner Baum, der aus der Ferne kahl wirkte und erst im Näherkommen die winzigen Blattknospen preisgab, mit denen jeder Zweig gesprenkelt war. Auf einem Ast, der sich über die Straße neigte, hockte ein Vogel, eine Kohlmeise mit schimmerndem Gefieder. Vielleicht von den Menschenschritten erschrocken, flatterte sie auf und flog davon. Der Ast, auf dem ihr Leichtgewicht gelastet hatte, federte nach. Maggie blieb stehen. »Warum seid Ihr mit mir hierhergefahren?«
Die Patin blieb ebenfalls stehen. Auf ihren Wangen glänzten Rinnsale wie Schneckenspuren. »Verzeih mir, Margery. Ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen.«
Niemand in dem Haus in Chelsea hatte je Tränen vergossen und niemand hatte sie je Margery genannt. »Wer war der alte Mann?«
»Komm weiter.« Die Stimme der Patin klang erstickt.
»Nein.« Ehe sie sich besann, war Maggie in eine Lache gestampft. »Keinen Schritt weiter gehe ich, bis Ihr mir sagt, wer der Mann war und warum Ihr um ihn weint.«
»O Margery.« Unverhofft hockte die Patin sich nieder und legte einen Arm um sie. »Dieser Mann war der gütigste Mann meiner Zeit. Er war der Letzte von uns.«
»Er war … Euer Freund?«
Die Patin nickte. »Ja. Er war mein Freund, vor Jahren, als ich noch Freunde hatte. Ich denke, er wäre gern auch der deine gewesen.«
»Warum?«
»Er war ein Freund deiner Eltern.«
Maggie schüttelte sich frei. »Erzählt mir von meinen Eltern. Mich schreckt ja nicht, dass sie Ketzer waren, denn das weiß ich längst.«
Fassungslos sah Maggie, wie die Patin eine Hand vor ihr nasses Gesicht schlug und auflachte. »Was ist zum Lachen daran?«
»Ja, was ist zum Lachen daran, was ist zum Lachen an diesem Leben? Dass du aussiehst wie dein Vater, wenn du so stampfst und schnaubst. Er hätte seine Freude an dir, dein schöner Unhold von Vater. Im nächsten Jahr, zu Zwölfnacht, würde er die Gaillarde mit dir tanzen.«
Einen Herzschlag lang vergaß Maggie allen Schrecken. »Ich will die Gaillarde tanzen! Ich will Zwölfnacht feiern.«
»Wie du weißt, hat Königin Mary solche Ausschweifungen verboten.«
»Erst in diesem Jahr. In Eurem Haus gab es noch nie ein Fest.«
»Ja, du hast Recht.« Ihre Kleiderfalten raffend, stand die Patin auf. »Für mich gibt es kein Fest zu Zwölfnacht mehr. Menschen wie ich überleben ihre eigene Zeit.«
Maggie biss sich auf die Lippen. Als die Patin sie weiterziehen wollte, schüttelte sie den Kopf.
Die Ältere packte sie bei den Händen und zwang sie zu sich herum. »Du hast Recht, Margery. Sie steht dir wohl zu.«
»Was steht mir zu?«
»Die Geschichte deiner Eltern. Wenngleich ich nicht weiß, ob ich sie erzählen kann. Es scheint ja alles ein Leben und einen Tod lang her und kaum noch wahr.« Sie langte in ihren Beutel und hielt Maggie auf dem Handteller ein kirschgroßes Stück Silber hin.
»Was ist das?«
»Eine Zwölfnachtsbohne. Sie hat deiner Mutter gehört.« Die Patin nahm die silberne Bohne zwischen Daumen und Zeigefinger und legte sie dann Maggie in die Hand. Dann strich sie ihr das blaue Samttuch um die Schultern glatt. Über ihre Wangen strömten fortwährend Tränen. »Wir fahren nicht nach Hause. Ich weiß einen anderen Ort, heute Abend können wir schon dort sein. Und gewiss bleiben, bis die Geschichte erzählt ist. Ich fürchte, ich werde zwölf Nächte dazu brauchen. Aber ich schulde sie dir. Und ihm auch.«
»Wem?«
»Cranmer. Meinem Erzbischof.« Ohne Maggie noch einmal zu berühren, ging die Patin voraus. Sacht und lautlos begann es wieder zu regnen. Maggie gab der Bohne, deren Versilberung matt und zersprungen war, einen letzten Blick, dann schloss sie die Faust darum und folgte mit gesenktem Kopf.
Die erste Nacht
Wulf Hall1518In der ersten Nacht des Christfestesschenkte mir mein Liebsterein Rebhuhn in einem Birnbaum.
Wo die Sonne auf den Abhang fiel, da leuchtete das Gras. Zartgrün wie das Laub der Weißbirken. »Wart auf mich, Janie!«, rief Catherine und rannte los. »Ich will dich fliegen sehen.« So schnell sie konnte, stürmte sie den Hügel hinunter, stolperte, schlang blitzschnell die Arme um die Knie und rollte einer Kugel gleich bergab.
Vom Fuß des Hügels erstreckte sich einer der drei Gärten, die das Haus umgaben, eine Wiese bis an den Saum der Waldung, auf der sich ein Obstbaum an den nächsten reihte. Schwer von Früchten neigten sich die Zweige, und die Luft schleppte sich an einem Duft, der süßer und sämiger als Honig war.
Schmerzhaft schlug Catherine mit dem Hinterteil auf einem Feldstein auf. Erdbrocken aus Haar und Kleidern schüttelnd, rappelte sie sich auf. Keine zwanzig Schritte weit sah sie die anderen Kinder im Halbkreis um den höchsten Birnbaum stehen. Ihren Bruder William, ihre winzige Schwester Anne, Nan genannt, und die kaum größere Liz Seymour, die einander verängstigt an den Händen hielten, dazu die Seymour-Söhne Thomas und Henry. Sie alle hatten die Köpfe in die Nacken gelegt und starrten hinauf. Janie hätte auf die Kleineren, Will, Liz und Nan, Acht geben sollen, doch stattdessen war sie auf diesen Baum geklettert, um ihrem Bruder zu beweisen, dass sie fliegen konnte.
»Komm da runter, Janie.«
»Wie denn? Wenn sie springt, bricht sie sich den Hals.« Die Stimme des neunjährigen Henry klang erregter, als man es von ihm kannte. Er war ein dicklicher, leutseliger Bursche, den für gewöhnlich nichts aus der Ruhe brachte. Sein Bruder Thomas hingegen war ruppig und kräftig und hatte Haar so rot wie dunkle Kirschen.
»Und was kratzt mich das? Die Närrin ist aus freiem Willen dort hinaufgestiegen, oder etwa nicht?«
Die kleine Nan, braunlockig, hübsch, kaum vier Jahre alt, brach in ein schrilles Weinen aus.
»Flieg, Janie! Zeig es ihm!« Atemlos schob sich Catherine zwischen Will und Liz und sah nach oben. Wie ein todesfürchtiges Tier hing ihre Freundin an den Stamm geklammert. Der Ast, schwer von goldgelben Früchten, der ihr wohl als Tritt gedient hatte, war unter ihren Füßen weggesplittert. Ein Blick ließ Catherine begreifen, dass Janie so wenig fliegen konnte wie sie selbst. »Nur Geduld, Cathie. Still sein und warten muss ich wie Vater, wenn er Barben fängt.«
»Und dann?«
»Dann fliege ich.«
»Aber Janie, woher weißt du denn, dass du es kannst?«
»Gott hat es mir gesagt. Letzte Nacht im Traum. Gott weiß, dass Tom mich Feigling schimpft, weil ich mich fürchte, auf Bäume zu steigen. Steig in den Birnbaum, Janie, hat Gott gesagt. Warte geduldig ab, und ich lehre dich fliegen.«
»So ein Unsinn.« Das war Tom. »Meinst du, Gott hat nichts Besseres zu tun, als mit einem dummen Ding wie dir Maulaffen feilzuhalten?«
Catherine schoss zu ihm herum. »Jane ist kein dummes Ding. Es ist deine Schuld, dass sie da oben hockt.«
Er würde sie schlagen. Die Kinder der Pächter, der Dienstleute, sie alle hatten Angst vor ihm. Catherine verschränkte die Arme vorm Gesicht. Mit einem Sprung war er bei ihr, traf der warme Atem ihre Stirn. Er roch nach Leder, Gras und etwas, das sie nicht kannte. Feste Finger umschlossen ihr Kinn. »Du weißt, dass sie nicht fliegen kann, oder?«
Sie wusste es, seit sie Jane an dem Stamm hatte kleben sehen. Was sie zuvor geglaubt hatte, behielt sie tunlichst für sich. Seine Finger wanderten ihre Wange hinauf. »Erde im Haar? Sag bloß, auch dir hat Gott eingeschwatzt, dass du ein Vogel bist, und du hast’s ausprobiert?«
Toms Lachen klang, als schlüge man zwei Schlägel aus Silber aufeinander. »Klug bist du.«
Über ihren Köpfen knackte ein Zweig. Lange würde Janie dort oben nicht durchhalten. Stumm zählte Catherine bis drei, dann riss sie sich los und jagte davon, um Hilfe zu holen.
Durch kniehohes Gras eilte sie den Hügel hinauf. Oben angekommen, öffnete sie das Gatter und rannte den Pfad unter den Ulmen entlang auf das Haus zu. Wulf Hall Manor. Wenn sie einmal verheiratet war, wollte Catherine ein Haus wie dieses besitzen, aus weiß verputztem Geflecht und mächtigen Eichenbalken, deren Duft sie allabendlich in den Schlaf lullte. Das Haus schmiegte sich in ein Baumkronendach. Ihm zur Seite stand eine riesige Scheune, in der die Seymours ihren Taubenschlag hatten, ihr Heu und im Gebälk die in Sträußen aufgehängten Kräuter.
»Sir John«, rief Catherine und lief durch das Tor in den Hof. Die Augustsonne badete ihr den Rücken in Schweiß. »Sir John, Ihr müsst kommen!«
Der gepflasterte Hof war eine stille Insel. Reben des purpurfarbenen Weines trieben auf den Mauern ihr Schattenspiel. In der Mitte stand ein kreisrunder Tisch, an dem die Seymours aßen, so lange das Wetter es erlaubte. Catherine liebte die Mahlzeiten auf Wulf Hall. Die süße Butter, das würzige Brot, das Lamm in seiner Thymiankruste, die Taubenpastete, die gekräuterten Suppen. Am meisten aber liebte sie, dass dabei alle Seymours und ein halbes Dutzend Gäste um diesen Tisch gedrängt saßen, lärmten und lachten, einander die Schüsseln entrissen und Bissen aus den Fingern stibitzten. In dem Haus in Blackfriars, in der großen Stadt London, wo sie und ihre Geschwister bis vor Kurzem unter Aufsicht ihrer Erzieherin gewohnt hatten, aßen die Kinder allein in einer kühlen Halle, es ging gesittet zu, und das Essen lag im Mund wie Stroh.
Jetzt saß der bärtige Sir John, der Herr von Wulf Hall, an jenem Tisch beim Wein. Gesellschaft leisteten ihm sein Freund Francis Bryan mit der Augenklappe und ein Fremder in dunkler Reisekleidung. Im Winkel, auf einem Schemel, kauerte Edward, der älteste der Seymour-Söhne, und las in einem Buch. So versunken war er, dass er nicht wie die anderen aufblickte, als Catherine in den Hof stürmte. »Sir John«, wollte sie noch einmal rufen, aber die Stimme versagte ihr. Schwer atmend musste sie stehen bleiben.
»Kleine Cathie, wie gut sich das trifft. Schau, wer auf Besuch gekommen ist.« Sir John stand auf und wies nach dem blassen Fremden, der sich ebenfalls erhob. »Erkennst du den Herrn nicht?«
Catherine, deren Atem noch immer in Stößen ging, ließ unschlüssig Blicke fliegen. Am Tisch brach Francis Bryan in sein bärenhaftes Gelächter aus. »Da seht Ihr’s, Kamerad. Ihr mögt mit Lordkanzler Wolsey speisen und Schach um Europa spielen, aber Euer eigenes Völkchen kennt nicht einmal Euer Gesicht.«
»Kardinal Wolsey«, berichtigte der Fremde matt. »Seit der Ernennung durch den Papst lautet die Anrede Kardinal.«
»Nun hört schon auf, ihr macht die kleine Cathie ja wirr.« Sir John trat zu ihr und nahm sie bei der Hand. Catherine lehnte sich gegen sein Bein. Er roch nach Heu und Augustwärme. Zuweilen erträumte sich Catherine, Sir John und seine Frau, Lady Margery, wären ihre Eltern.
»Begrüße unseren Gast, Cathie.«
Sie rührte sich nicht.
»Es ist mein Freund Thomas Parr. Dein Vater, Kind.«
Ein Gedanke durchzuckte sie: Ist er hier, um uns wegzuholen? Sonst nichts. Kein Erkennen, kein Erinnern, nichts als ein Ziehen in der Brust, ein Schmerz ohne Namen. Sie sah den Fremden nicht an. »Ich komme nicht mit Euch. Ich will auf Wulf Hall bleiben.«
Bryan lachte noch lauter. Catherine fielen Jane und der Baum wieder ein. »Ihr müsst kommen, Sir John.« Sie zerrte ihn am Ärmel. »Jane ist in einen Birnbaum gestiegen, weil sie Tom zeigen wollte, dass sie fliegen kann. Aber sie kann es ja gar nicht, und der Ast ist gebrochen, und lange dauert’s nicht mehr, bis sie fällt.«
Sir John sah auf sie hinunter, als habe er von ihrem Redeschwall kein Wort verstanden. Gleich darauf erhob sich in seinem Winkel Edward, tauchte auf aus seiner fernen Welt.
»Sir Thomas, gestattet Ihr eine Frage?« Sein Buch in die Höhe haltend, trat er an den Tisch. Er war hoch aufgeschossen wie ein Schilfhalm. »Ihr kennt Kardinal Wolsey, nicht wahr, Ihr arbeitet mit ihm an dem Friedensabkommen? Stimmt es, dass er allmächtig ist wie König Henry selbst?«
»Wer stellt denn derlei abenteuerliche Behauptungen auf?«, fragte der fremde Vater zurück.
»Desiderius Erasmus«, kam es triumphierend von Edward. »Der Gelehrte, dessen Werk ich lese. Ich glaube, er ist der klügste Mann meiner Zeit.«
»Hört, hört. Und das kannst du beurteilen, Herr Siebenschlau?« Bryan schnappte ihm das Buch aus der Hand und musterte es mit seinem einen Auge. »Lob der Torheit. Unglaublich, womit die Jugend sich dieser Tage den Kopf verstopft. Als ich in deinem Alter war, las ich Brieflein, die mir verliebte Jungfern schrieben.«
»Das war eine andere Zeit.« Edward riss Bryan das Buch weg und presste es an seine Brust. »Unter dem guten König Henry soll England ein Garten der Gelehrsamkeit werden. Deshalb lädt er sich Männer wie Erasmus und Thomas More an den Hof. Einen Liebesbrief könnte wohl auch ein brünstiges Tier schreiben, wenn es die Fingerfertigkeit besäße. Dies hier aber«, er schwenkte das Buch, »zeichnet einzig den Menschen aus.«
Eines Tages werde ich auch ein Buch lesen, dachte Catherine. Woher kam ihr solcher Wunsch, was lag ihr an dem Buch, dass sie es anstarren musste und um ein Haar Janie vergaß? Sie schüttelte sich. »Ihr haltet Reden, und Janie bricht sich den Hals!« Damit ließ sie Sir Johns Hand los und wirbelte herum.
»Warte, Cathie! Was sagst du von Jane?«
Catherine aber war schon losgerannt. Diesmal bewältigte sie den Hügel ohne Sturz. »Ich komme, Janie, halte aus, ich komme.«
Die Kinder standen noch immer um den Baum. Der dreiste Tom hatte die Hände in die Hüften gestemmt. »Na los, worauf wartest du? Schwing dich in die Lüfte.«
»Halt den Mund«, fuhr Henry ihn an.
Sie haben Angst, erkannte Catherine. Sogar Tom, das Großmaul, hat Angst. Stockstarr krallte Jane sich an den Stamm. Sie war ein schmächtiges Mädchen, bleich wie Leinen. Gewiss waren ihr die Kräfte längst erlahmt.
»Zur Hölle, jetzt habe ich genug von diesem Ulk.« Tom sprang vor, packte den Stamm und begann, sich nach Katzenart hinaufzuziehen. Eine rote Katze war er, ein Kater, der Gefahr brachte, so schön sein geschmeidiger Leib auch anzusehen war.
An Catherine vorbei drängten Sir John und Edward. Dann schien alles in der Zeitspanne eines Herzschlags zu geschehen. Toms Hand hangelte nach Janes Wade. Jane ließ den Stamm los, breitete die Arme wie Flügel aus und stürzte sich kopfüber in die Tiefe. Nan und Liz brüllten. Mit einem grauenhaft dumpfen Laut schlug der Körper auf dem Boden auf.
Sie war tot. Ihre Janie, ihre Herzensschwester, hatte sich den Hals gebrochen, und sie, Catherine, stand in der Welt allein. Von irgendwoher tauchten Francis Bryan und der fremde Vater auf und beugten sich mit Sir John über die reglose Gestalt.
Endlich hob Bryan den Kopf. »Dein Rebküken hatte mehr Glück als Verstand, John. Dieses Bein allerdings sollte sich der Arzt ansehen.«
Catherine wagte sich einen Schritt vor. Jane lag auf dem Rücken. Sie war nicht tot, sondern hatte die Augen geöffnet und kämpfte um ein Lächeln. Mit zitternden Fingern strich Sir John ihr über die Stirn. Dann erhob er sich und drehte sich von seiner Tochter fort zu seinem Sohn. Catherine hatte ihn nie zuvor so gesehen. Sein Gesicht erschien versteinert, die Haut rot wie von zu viel Wein. Von dem gesplitterten Ast, der am Boden lag, brach er einen Prügel. »Du Kreuz von einem törichten Bengel! Genügt es dir nicht, deinen eigenen Hals aufs Spiel zu setzen? Womit hat dieses Engelsgesicht einen Satan wie dich zum Bruder verdient?« Beidhändig holte er aus. Tom hielt still. Nur wer genau hinsah, bemerkte, wie ihm die Schultern bebten.
»Vater, nicht! Tut doch Tom kein Leid.«
Das war Jane. Sir Johns Arme sackten herunter wie Puppenglieder. Den Prügel wegwerfend, ließ er Tom stehen, bückte sich und hob Jane auf seine Arme. Vereint im Schweigen, folgten ihm die Übrigen zurück zum Haus. Bryan und der Vater, Henry und Will und der schlaksige Edward, der Liz und Nan an den Händen führte.
Catherine blickte ihnen nach, bis sie das Gatter auf dem Hügelkamm erreichten. Dann sah sie zur Seite. Tom stand unter dem Birnbaum wie angeschmiedet. Sie glaubte zu spüren, wie ihm die Wangen brannten, wie sich in seiner Brust etwas ballte, ihm die Kehle hinaufkroch und zum Klumpen schwoll. Die Schläge, vor denen seine Schwester ihn bewahrt hatte, wären barmherziger gewesen als dies. Ehe sie sich’s versah, stand sie vor ihm.
»Janie ist dir nicht böse, sie wollte es ja so.«
Ihre Blicke trafen sich. Toms Augen waren weit. »Aber ich …«
»Aber du kannst gar nichts dazu. Wenn Janie wünscht, für dich zu fliegen, dann fliegt sie, und niemand hält sie auf. Deines Vaters Schelte war nicht gerecht.« Sie stockte. Dann fügte sie hastig hinzu: »Und meine auch nicht, vorhin.«
Ungläubig starrte er sie an, die weiten Augen funkelnd. Sie hatte noch nie ein Paar Menschenaugen so lange angesehen. Dann verzog sich sein Mund, und seine Braue hob sich in die Stirn. »Du bist ein kluges Mädchen, Mistress Catherine Parr.«
Beherzt hielt Catherine ihm stand. »Ich weiß.«
Wenn es etwas gab, das John Seymour so teuer war wie seine Familie, so war es der Wald, der seine Güter umgab. Sein König selbst hatte ihm das elfenbeinerne Horn mit den silbernen Beschlägen in die Arme gelegt und ihn damit zum Hüter über den sich weit erstreckenden Jagdgrund bestellt. John nahm seine Pflichten ernst. Sein Wald, der Savernake, war so geradlinig und dabei so reich an Facetten wie ein gutes Weib, wie seine Margery mit dem nussbraunen Haar.
Als der Bote aus London eingetroffen war, hatte er an einem Fluch schlucken müssen. Wie konnte man ihn jetzt von Wulf Hall fortrufen? Es war Erntezeit, und zudem ging das Gerücht, in der Umgebung grassiere das gefürchtete Schweißfieber. Des Königs Abkommen ging ihn im Grunde gar nichts an. Gesandte der Fürsten Europas, Franzosen, Spanier, Vertreter des Kaisers und des Papstes würden in der Hauptstadt zusammentreffen, um einen Vertrag zur Friedensordnung zu besiegeln. Monatelang hatten König Henry und sein Lordkanzler Wolsey darum gerungen, und zur Feier beriefen sie den gesamten Adel an den Hof. Für John jedoch mochte all dies ebenso gut auf einem jener weltentfernten Kontinente geschehen, die man letzthin überall entdeckt hatte. Die Insel, auf der sein Leben stattfand, hieß Wulf Hall.
Von den Hufen der Pferde aufgepflügt, stoben Erdbrocken gegen die Wagenflanken. »Armer John.« Francis Bryan beugte sich vor und patschte ihm aufs Knie. »Zum Hofleben sind wahrlich andere geschaffen als du.«
»Du selbst zum Beispiel.« Er zupfte Bryan am juwelenbesetzten Ärmel seiner Schecke. Der Freund gluckste.
Dass er mit seinen Freunden reiste, versüßte John das Unterfangen. Bryan war ihm vertraut wie ein Welpe aus eigenem Zwinger, derweil Thomas Parr, neben dem er als Jungspund in Frankreich gekämpft hatte, ihm rätselhaft blieb. Nichtsdestotrotz war er ihm zugetan, hieß ihn seinen fremden Freund und hatte seinen Sohn nach ihm benannt, den Zweitgeborenen, der mit dem beherrschten Parr leider nichts gemein hatte. Wie immer, wenn John an seinen Sohn Thomas dachte, beschlich ihn ein Schwarm dunkler Ahnungen, obgleich der Knabe kerngesund und mehr als wohlgestalt war. Wüste Alpträume zeigten ihm seinen Sohn auf den hölzernen Stufen zum Schafott. Der Unfügsame bedurfte zu seinem Schutz einer strengen Hand, die derb den Stock schnalzen ließ und ihm den Starrsinn ausklopfte. John hingegen war milde wie Pflaumenwein. Sosehr er sich mühte, seine Hiebe entlockten dem stämmigen Tom keinen Laut, und nach jeder Züchtigung funkelten ihm die Augen noch verstockter als zuvor.
»Woran denkst du?«, rief Bryan. »Wie üblich an deine Kinder? Du sorgst dich zu viel. Die tapfere Janie wird bis zum Frühjahr wieder hüpfen, und deine Söhne sind Prachtkerle, allen voran der wilde Tom, dem nur ein wenig Schliff fehlt. Edward hingegen, unserm kleinen Gelehrten, fehlt es an Lebensart.«
»Was willst du damit sagen, Francis?«
»Ach, weniger als nichts. Nur dass ich meinem Jungen Ablenkung verschaffte, ehe er die Schriften eines Aufrührers liest.«
»Ich denke, dieser Erasmus wird von König Henry geschätzt?«
»Das mag schon sein. Aber von den Eiern, die dieser Erasmus legt, ist’s nicht weit zu den Küken, die der deutsche Ketzermönch Luther ausbrütet. Der brave Edward hat zu viel Zeit zum Grübeln. Gib ihm Zerstreuung, Tanz, lass ihn Versuchungen erliegen. Und Tom, der rote Springbock, bekommt derweil einen Striegel übers juckende Fell.«
»Du meinst also, ich sollte meine Söhne an den Hof schicken?«
Bryan schüttelte den Kopf, dass seine Hutfeder wippte. »Nicht an unseren Hof. Sosehr sich der König und sein Wolsey ins Zeug legen mögen, was höfische Kultur betrifft, lebt England noch in der Barbarei. Schick Tom und Edward nach Frankreich, jetzt da wir Frieden haben und die Prinzessin mit dem Dauphin verlobt wird. Lass französische Kavaliere aus den beiden machen.«
»Prinzessin Mary wird mit dem Dauphin verlobt? Aber wer soll denn dann England regieren, ein König von Frankreich vielleicht?«
Das Licht verdüsterte sich, als der Wagen in dichteres Gehölz tauchte. Harsch streifte ein Tannenzweig Johns Gesicht. Mit seinem einen Auge sah Bryan ihn verständnislos an. »Weshalb sollte uns ein Franzose regieren? Prinzessin Mary und der kleine Louis werden das Thronfolgerpaar von Frankreich sein.«
»Wenn es erlaubt ist«, erhob sich die ruhige Stimme Parrs, »ich glaube zu wissen, was John zu sagen begehrt: Mary ist auch Englands Thronfolgerin. Heiratet sie einen fremden Monarchen, so werden auch wir künftig von jenem Fremden regiert.«
Daran ließ sich nicht rütteln. König Henry hatte keinen Sohn. Bryan langte nach der Lederflasche an seinem Gurt. »Hinfort mit euch Kleingläubigen. Ist Königin Catalina nicht gesegneten Leibes? Ich jedenfalls trink mir eins auf die Geburt von Englands Prinzen.« Als er die Flasche absetzte, klebte ihm Bierschaum im Bart.
»Gesegneten Leibes war die Königin schon oft«, wandte Parr ein und ließ ungesagt, was jeder wusste: Von all ihren Kindern hatte nur ein Mädchen, Mary, das Säuglingsalter überlebt.
»Bah, so viel Schwarzreden. Sind wir zu einem Freudenfest oder auf ein Begräbnis geladen?« Bryan reichte John die Flasche. »Trink, Freund. Auf alle stolzen Söhne Englands.«
»Und auf die Töchter«, ergänzte Parr leise.
»Mein fremder Freund, Ihr sprecht mir aus dem Herzen.« John trank ihm zu. »Meine Janie ist mir nicht weniger lieb als ihre Brüder, und Eure Cathie ist ein Sonnenschein. Was meint Ihr, würdet Ihr erwägen, sie einem meiner Jungen zur Frau zu geben? Edward ist ja bereits verlobt, doch da wäre mein Thomas. Ein wenig ungebärdig zwar, aber kein schlechter Kerl.«
Der Andere blieb stumm, seine Miene unlesbar. Hatte John ihn beleidigt? »Wulf Hall ist kein großer Besitz und Tom nur mein Zweitgeborener«, fügte er zögernd hinzu. »Vermutlich wollt Ihr mit Eurer Cathie höher hinaus.«
Parrs Lippen zuckten. »Sie ist nicht eben ein hübsches Kind.«
»Ist sie das nicht?« Dass an dem reizenden Springinsfeld etwas auszusetzen war, hatte John nicht bemerkt.
»Ein bisschen fad vielleicht«, mischte sich der Kenner Bryan, der in der Sechsjährigen gewiss schon die erblühende Frau erkannte, ein. »Lassen wir doch den Jungvögeln noch ein wenig Zeit.«
»Hoffen wir, dass ihr Leben ihnen Zeit lässt.« John lehnte sich zurück und spürte seine Gedanken abschweifen. Sollte er wirklich zwei seiner Söhne an den französischen Königshof senden? All das Gerede um Friedensverträge überstieg sein Fassungsvermögen. Mit seinen fünfunddreißig Jahren fühlte er sich zu alt, den Erzfeind Frankreich, gegen den er im Feld gestanden hatte, auf einmal als Verbündeten zu feiern. Die Welt aber, in der seine Söhne Männer sein würden, mochte eine andere sein, eine unermessliche Welt, in der England und seine Nachbarn nur mehr Zwerge unter Riesen wären. Und wie neue Länder Häuptern von Seeschlangen gleich aus dem Meer auftauchten, so wurde allerorten nie Gehörtes laut, das Begeisterte Neues Lernen nannten. Einer, der zur See fuhr, warf seine Karten weg, und einer, der an Land blieb, seinen guten Glauben.
John sah Edward mit dem seltsamen Buch vor sich und hörte Bryans Warnung über den Deutschen, Luther, den Rom zum Ketzer erklärt hatte. Vielleicht tat er das Beste für seine zwei Ältesten, wenn er ihnen erlaubte, ihre Nasen in den neuen Wind zu stecken. Henry hingegen, der sonnige Drittgeborene, bliebe den Eltern zum Trost auf Wulf Hall.
Nicht lange darauf erspähte John die Stadtmauern, die in der Abendröte rosig schimmerten. Hingestreckt wie zur Liebe, lag die Verführerin London. John war die Stadt zu eng, zu laut, zu atemlos. Sie stank nach Menschenleibern, zusammengequetscht wie Fische in der Reuse, nach Vergärendem und Verfaulendem, nach Brunft und Kot. Mühselig zwängte sich ihr Wagen durch Gassen, scheuchte schlenderndes Volk auseinander. »Ah, Stadtluft«, jubelte Bryan und sog hörbar durch die Nase ein. »Wir werden im Palast von Greenwich logieren, der sich recht hübsch herausgemacht hat. Seit du zuletzt hier warst, John, hat König Henry einen neuen Turnierhof, einen Waffensaal und eine Festhalle bauen lassen. Reizvoller als Greenwich wird allerdings …« Ein plötzliches Holpern des Wagens stieß den Hingerissenen auf den Sitz zurück.
»Reizvoller als Greenwich wird allerdings Hampton Court«, beendete Parr Bryans Satz. »Der neue Palast des Kardinal Wolsey, von dem ja mancher behauptet, dass er uns regiert.«
Den viel zitierten Wolsey bekam John am folgenden Vormittag zu Gesicht, als dieser in der Kathedrale von St. Paul als päpstlicher Legat das Hochamt zelebrierte. Die Unterzeichnung des Vertrages bedurfte der Absegnung durch den Allmächtigen. Erstmals gelobten die Herrscher Europas einander schweigende Waffen. In dem zum Bersten gefüllten Kirchenschiff ließ sich kein Raunen, kaum ein Atemzug vernehmen.
Kardinal Wolsey war ein aufgeschwollener Mann, der die Blüte seiner Jahre überschritten hatte. Die Sonne, die durch die hohen Fenster fiel, umgab den Würdenträger in seinem Habit aus roter italienischer Seide mit einer Gloriole aus Licht. An den Fingern, die die Hostie hoben, glommen juwelenschwere Ringe. Trotz alledem verspürte John mehr Andacht in seiner eigenen Kapelle auf Wulf Hall, wo der Priester James allmorgendlich die Messe las. Hier wie dort verstand er wenig, obgleich er den vertrauten Klang der Liturgie gern mochte. Das im Knabenalter erlernte Latein war ihm, seit er fern des Hofes lebte, entglitten. Für einen Mann in seiner Stellung gab es Wichtigeres zu behalten.
Seine Jungen studierten natürlich ebenfalls Latein, wie es sich für Söhne eines Landeigners gehörte. Als aber sein Edward ihn gefragt hatte, warum er nicht auch Janie und Liz unterrichten ließ, wie es in Mode kam, hatte er verwundert zurückgefragt, ob Frauen neuerdings Priester würden.
»Haben nur Priester Köpfe?«, war der unverschämte Tom dazwischengefahren. »Denken befreit.«
Daran hegte John keinen Zweifel, fragte sich aber, wie viel Befreiung seinen Kindern frommte und ob es nicht seinen Sinn hatte, wenn man das Lesen der Bibel seinem Priester überließ. Waren nicht all die Wagehälse, die versucht hatten, die Bibel gar ins Englische zu übersetzen, zu Asche verkohlt oder außer Landes gejagt worden? Über zu viel Wissen verlor sich leicht der Kopf. John und seine Margery lebten glücklich in den abgesteckten Grenzen von Wulf Hall, und er hätte seinen Kindern ein ähnlich unerschüttertes Glück gewünscht. Sein fremder Freund schien ihm Recht zu geben. Die kleine Cathie lernte auch kein Latein.
Nach der Feier wurden die Gäste in einer Reihe geschmückter Barken die Themse hinauf nach Greenwich gerudert. Der Himmel strahlte, und die Sonne setzte den Flusswellen Glanzlichter auf. Greenwich war eine in Grün getauchte Landzunge. Von der Anlegestelle führten Stufen zum Torhaus, und sodann ging es durch eine Allee junger Bäumchen im Herbstkleid zum Palast. »Was ist das?«, entfuhr es John, der jeden Baum in seinen Gärten liebte.
»Die Pfirsichbäume von Greenwich.« Bryan griente wie ein stolzer Vater. »König Henry hat sie sich aus Italien schicken lassen, weil kein anderer Baum so betörend duftet. Dereinst soll sein Töchterchen im Brautschmuck mit ihrem Dauphin darunter wandeln.«
Der Ruf der Silbertrompeten beendete ihr Gespräch. Das Bankett, dem sich Mummenschanz und Tanz anschließen würden, fand in der neu errichteten Festhalle statt. John hatte beiden Tudor-Königen, dem siebenten wie dem achten Henry gedient und in ihrer Gesellschaft gespeist. Der heutige Aufwand aber übertraf jede Erinnerung: Die Tische waren in blendendem Leinen gedeckt, und selbst auf denen für den niederen Adel, an dem John und seine Freunde Platz fanden, warteten Trinkpokale und Fingerschalen aus Gold. Sie teilten den Tisch mit mehreren Landedelleuten und Damen, darunter Parrs Frau, Lady Maud, die als Kammerfrau Königin Catalinas bei Hof lebte.
Einen sehnsüchtigen Herzschlag lang wünschte sich John, er hätte seine Margery bei sich. So wie der Freund hätte er nicht leben mögen, ständig in Missionen für den König unterwegs, von seiner Frau getrennt und dem eigenen Blut ein Fremder. Bryan zufolge sagte man Parr eine große, glänzende Karriere bei Hof voraus, aber wog das die zärtliche Liebe von Frau und Kindern auf? Laute Trompetenklänge unterbrachen sein Grübeln. Wie ein Mann sank die Schar der Gäste auf die Knie.
»Henry, König von England, und Königin Catalina!«
Bei seiner Thronbesteigung war der junge Henry als schönster Prinz der Christenheit bejubelt worden. Inzwischen regierte er England seit bald einem Jahrzehnt, doch John, der ihn vor fünf Jahren letztmals gesehen hatte, schien er kaum gealtert. Er trug ein Wams und eine pelzbesetzte Schaube in der Farbe von Südwein. Noch immer verblüfften sein Wuchs und seine von den Kleidern noch betonte Breite. Die Königin neben ihm schien winzig, eine Trockenpflaume an der Seite eines prallen Apfels. »Seid Uns gegrüßt, teure Gäste. Eure Gegenwart in dieser Freudenstunde erfüllt England mit Stolz.« Dem Brustkorb eines Ringkämpfers entwand sich der zitternde Sopran eines Knaben.
Sein Essen liebte John eher deftig als raffiniert. Von dem Überfluss, der hier aufgetischt wurde, vom Gewirr der Düfte, dem Summen der Stimmen und Klirren der Becher wurde ihm der Magen schwach. Kaum war ein Gericht aufgetragen, da paradierten die Aufwarter schon mit dem nächsten herein. Den Abschluss bildete ein dreistöckiger, von Marzipan überzogener Kuchen, den die rot-weiße Rose der Tudors zierte. Dazu wurde Wein nachgeschenkt, sooft ein Mann seinen Kelch absetzte.
Nach dem Essen trieben Narren ihre Possen, und vor einer blutroten Sonnenscheibe stellte ein Mirakelspiel den Hochzeitszug der Königin von Saba nach. Hernach begann der Tanz. Im Nu zerfloss die Ordnung des Saales in einen Strudel aus Farbe. Die Pavane, den Schreittanz, zu dem die Paare sich in Reihen stellten, tat John noch mit. Als sich zu den englischen Musikern jedoch französische gesellten und ein Sprungtanz ganz neuer Art, eine Gaillarde, angekündigt wurde, trottete er an seinen Platz zurück. Der Tag hatte ihn mehr erschöpft als eine Jagd im Wald von Savernake.
Eine Hand berührte seinen Arm. John fuhr herum. Hinter ihm stand Parr und schenkte ihm ein Lächeln. Seine Stirn war in Schweiß gebadet. »Ihr seid auch kein Tänzer, John?«
»Oh, daheim bei meiner Margery schwinge ich mein Tanzbein durchaus. Aber diese aus Frankreich hergebrachte Finesse stellt mich, fürchte ich, vor meine Grenzen.«
Das Lachen des Freundes klang, als zerbreche ein zierliches Gefäß. »Das geht mir nicht anders. Meine Frau und Euer Freund Bryan hingegen finden heute Nacht wohl ihre Meister nicht.«
Bryan und Maud tummelten sich einander gegenüber, schwangen die Arme und warfen die Beine im Takt. Weiter vorn tanzte das Königspaar. Die schwangere Catalina erinnerte an eine Barke im Seegang, König Henrys wirbelnde Gliedmaßen aber nahmen es mit den Schlägeln eines Trommlers auf. Von dem pfauenbunten Flimmern schmerzten John die Augen.
Parr ergriff ihn am Ärmel. »Hört, John, was Euren Antrag betrifft – ich will morgen mit Maud darüber sprechen. Wenn sie zustimmt, hätte ich von Herzen gern Euren Thomas als Bräutigam für meine Catherine.«
John umarmte ihn. Wacker harrte er aus, bis das Fest ein Ende fand, und begab sich dann bester Stimmung in das Kämmerchen, das er mit Bryan und weiteren Gästen teilte. In zwei Tagen würde er abreisen, mit froher Kunde für Margery. Parrs älteste Tochter war ein beherztes Geschöpf, das sich nicht scheuen würde, einem bockenden Kerl die Zügel stramm zu ziehen, und für John, den künftigen Schwiegervater, war die kleine Cathie ohnehin längst Teil der Familie.
Am anderen Morgen kam ein Bediensteter in die Schlafkammer, kaum dass John sich angekleidet hatte. Bryan schnarchte noch weinselig in den Kissen und ließ sich von dem erregten Mann nicht stören. Dieser brachte schlimme Kunde: Das Schweißfieber, der Mörder ohne Zaudern und Zagen, war im Palast. Thomas Parr hatte noch während der Nacht das Bewusstsein verloren und war in den Morgenstunden verstorben.
Janes Bein brauchte den ganzen Herbst und den Winter, um zu heilen. In dieser Zeit erledigte sie alle Näharbeit des Haushalts. In der Halle, auf eine Liege gebettet, stichelte sie Stunde um Stunde. Sie las nicht gern. Catherine wäre selig gewesen, hätte sie eines der Bücher besessen, die Edward für seine Schwester herbeischleppte. Janie aber sagte: »Danke, mein Edward«, und ließ die Bücher liegen. Stattdessen säumte sie Hemden und bestickte Kragen.
Wenn sie des Abends beim Feuer saßen, zog es Catherine mit einer Macht zu den Büchern, die sich kaum bezähmen ließ. Sie stapelten sich vor Janes Platz am Boden, und Catherine stellte sich vor, wie sich ihr lederner Einband in den Fingern anfühlen mochte, wie die Seiten beim Umblättern knisterten und ob die Lettern schwarz wie Onyx glänzten. Tagsüber aber gab es anderes als Bücher. Von der Frühe bis in die Dämmerung streifte sie durch winterliches Land, das geheimnisvoll leuchtete, mit spiegelndem Eis und Schneegestöber lockte, mit bereiften Zweigen und dem Rot von Beeren der Stechpalme, mit dem langen Fell der Ponys, das vor Kälte dampfte.
Er lehrte sie reiten. Galoppieren, dass Schnee ihr in die Augen stob. Er lehrte sie über das Eis des Waldsees gleiten, sich drehen wie zu Tanzmusik. Er lehrte sie Spuren lesen, einen Hasen erlegen, ohne Hunde und Jagdhelfer, ihn ausnehmen und rösten, auch wenn der Hase verbrannte und sie keinen Bissen davon aßen. Er. Tom. Sie war ein tapferes Mädchen gewesen, solange sie denken konnte. Will und Nan mochten weinen, aber Catherine war die Älteste und weinte nicht. Nicht im vergangenen Jahr, als die Erzieherin ihnen mitgeteilt hatte, ihr Vater habe sie einem Freund, John Seymour, zur Pflege anvertraut, und nicht in diesem, als Lady Margery sie alle drei an den rauen Stoff ihres Rockes zog und ihnen sagte, ihr Vater sei gestorben. Sie war ein tapferes Mädchen, sie zeigte keine Angst. Jetzt aber, mit Tom, war alles anders.
»Fürchtest du dich?« Es wurde dunkel, und sie ritten noch tiefer in den Wald, duckten sich unter schneeschweren Zweigen, derweil die Pferde durch knietiefes Weiß stapften. Keine Armlänge weit sah sie Toms roten Schopf. Sie fürchtete sich nicht. »Ich beschütze dich«, warf Tom über die Schulter zurück. »Oder etwa nicht?«
Als das Gehölz für die Ponys zu dicht wurde, stiegen sie ab und setzten sich auf eine aufgewölbte Wurzel, machten aber kein Feuer, weil Tom keinen Zunder bei sich hatte. Catherine war außer Atem und fror. Nach kurzem Zögern lehnte sie sich gegen ihn. Sein Leib hatte etwas Dampfendes, Warmes wie die Pferdeleiber. Er breitete den Arm um sie und zog sie näher zu sich. »So besser?«
Sie sah nach der Seite zu ihm auf. Sein Gesicht, das verschlossen und grimmig sein konnte, war jetzt ruhig und aufmerksam. Sie sah es gern an. Es gibt kein Gesicht, bemerkte sie, das ich besser kenne. Die Worte sprudelten, ehe sie sich besann: »Tom, glaubst du, ich habe kein Herz?«
»Weshalb sollte ich das glauben?«
»Ich hab’s Eure Magd sagen hören, die Bridget: Die kleine Nan ist honigsüß, hat sie gesagt, aber die Große, die Maushaarige, die hat kein Herz. Ihr armer Vater ist gestorben, und das kalte Ding zuckt kein Lid.« Kamen ihr Tränen, war sie kein tapferes Mädchen mehr? Hastig fuhr sie sich übers Gesicht. »Ich hab doch den Vater gar nicht gekannt«, warf sie hinterdrein und kniff die Augen zu.
Etwas fuhr ihr unter den Mantel. Toms Hand wie ein schmiegsames, zutrauliches Tier. Schob sich unter den Stoff. Blieb flach auf ihrer Brust liegen. Gleich darauf spürte sie, wie es in kraftvollem Gleichmaß gegen seine Finger schlug. »Bin kein Quacksalber«, sagte Tom, ihre Herzseite streichelnd. »Aber wenn du mich fragst, sitzt es genau da, wo es zu sitzen hat. Weshalb sollst du dich um Volk grämen, das du nicht kennst? Sind nicht wir deine Familie, und würdest du um uns nicht weinen?«
Man tat das nicht. Aber sie schlang die Arme um ihn und hielt sich an ihm fest. Sein Leib war voll Wärme und Stärke, und alles an ihm schien zu pochen. Sie saßen lange still, hörten dem Wald und dem Schnaufen der Pferde zu, ehe sie schließlich zurückritten.
Catherines Gesicht glühte, als sie ins Haus kamen, und ihre Finger, die sie ans Feuer hielt, kribbelten. In der Halle stand der runde Tisch, um den der Haushalt sich zum Essen scharte. Tom stürzte sich auf den Braten wie ein ausgehungerter Keiler. Kaum war die Schüssel, die er mit Edward und Henry teilte, leer, bediente er sich vom Anteil seiner Eltern. Mit beiden Händen rupfte er Fleisch von den Knochen und stopfte sich den Mund voll. Seine Mutter, ohne zu fackeln, versetzte ihm herzhaft zwei Backpfeifen. »Übe dich in Beherrschung, Thomas.« Das scharfe Klatschen, die Male, die auf seine Wangen traten, schmerzten Catherine.
Tom aber zuckte nur kurz mit den Lippen, dann langte er über den Arm seiner Mutter hinweg nach einem Hühnerschenkel. »Von Euren Schlägen werde ich nicht satt.«
Nach dem Essen räumten sie Tisch und Stühle beiseite, und es gab Spiel und Musik. Das Kaminfeuer flackerte in Rot- und Gelbtönen. Tom lehrte sie das Schachspiel. Tollkühn und schludrig waren seine Züge. Wenn der bedachtere Edward ihn zu besiegen drohte, stahl er ihm unter den Augen die Figuren. Er versuchte, sie eine Melodie auf der Laute zu lehren, aber zum geduldigen Lehrmeister taugte er nicht. Als Catherine sich allzu linkisch anstellte, nahm er ihr das Instrument, das aus schimmernder Fichte gefertigt und mit Kirschholz eingelegt war, von den Knien und schlug es selbst. Sein Gesang war nicht schön, aber strotzte vor Kraft, und seine Lieder waren samt und sonders unanständig.
In den zwölf Nächten des Christfestes glänzte Wulf Hall wie die polierten Äpfel in der Schale. Es wurde getanzt, gespielt und gesungen, bis die Ausgelassenheit in der zwölften Nacht ihren Gipfel fand. Die zwölfte Nacht war die Nacht, in der die Heiligen Drei Könige die Stadt Bethlehem erreichten, um ihre Geschenke darzubringen und ein Wunder zu bestaunen. Deshalb war die zwölfte Nacht noch immer voller Geschenke. Und voller Wunder. Dem Brauch gemäß übertrug Sir John einem Bediensteten, Rob, dem Pferdeburschen, für die Dauer der Feiern die Herrschaft über den Besitz. Das verkehrte Gesetz trat in Kraft: In der zwölften Nacht war alles möglich und alles, was möglich war, erlaubt. Alte und Kinder tanzten umeinander, unvermählte Paare schwelgten in Küssen, Kniffen, Liebesschwüren. Eine Nacht lang wurden Menschen zu Spielzeugfiguren, die aus ihren Kisten sprangen, sobald man diese einen Spalt weit aufzog. Man tauschte die eigene Rolle gegen eine andere, die niederste gegen die höchste, das Vertraute gegen das Verwehrte. Tom lehrte sie tanzen. Er trug Wams und Kappe eines Schäferknaben.
»Du bist meine Schäferin.« In der Drehung setzte er ihr die Kappe auf den Kopf.
Sie sah sein Haar gern unbedeckt. Mit Freuden hätte sie hineingefasst wie in die schimmernde Mähne ihres Pferdes. Vermochte die Kraft der zwölften Nacht nicht alles, was ein Mensch sich wünschte? Als er mit dem nächsten Flötenton sich wieder zu ihr drehte, griff sie flugs in sein Haar und hielt es fest. Keines Pferdes Schweif war dichter.
Unmäßig laut schrie er auf, brach in der Wendung ab und riss sich frei. Sie standen still. Er hielt sich den Kopf, sie blickte auf ihre Hand. Zwischen den Fingern glänzten kirschrote Fäden.
»Hast du deine Erbse von Verstand verloren? Du bist wohl doch zu klein, um Zwölfnacht zu feiern, und gehörst wie deine Schwester ins Bett.«
»Gehöre ich nicht. Ich werde sieben dies Jahr.« Sie sah zu ihm auf. »Wenn mein Verstand eine Erbse ist, dann ist der deine das Gran Salz obendrauf.«
Einen Augenblick lang starrte Tom sie aus weiten Augen an. Dann musste er lachen. »Ich sollte dir böse sein, oder nicht? Aber du machst mir solchen Heidenspaß.«
Catherine wünschte sich rasch etwas von der Kraft der zwölften Nacht, die nicht ganz heilig war und die man deshalb anrufen durfte, selbst wenn man kein Latein konnte: Ich will zu Zwölfnacht immer tanzen. Und immer soll Tom bei mir sein.
Er lehrte sie Pfeile zu schnitzen und sich an Rebhühner heranzuschleichen. Er lehrte sie, dass die Rebhenne sich selbst ausliefert, sobald sie ein Gelege zu schützen hat, dass sie im Winter aber schwierig zu erlegen ist. Er lehrte sie Reif von Winteräpfeln abzukratzen.
Dann kam der Frühling. Das Eis auf dem Waldsee knackte, dass die Ponys scheuten. Der Schnee schmolz über Nacht. Von den Dachrinnen stürzten Zapfen. Janies Arzt befreite ihr Bein von der Schiene, gab ihr eine Krücke aus Eichenholz und wies sie an, erste Schritte zu üben. »Sie wird wieder gehen lernen«, sagte er zu Sir John. »Auch wenn sie keine große Tänzerin abgeben wird.«
Janie, die an ihrer Krücke zwei Schritte weit gehumpelt war, drehte sich um. »Das schmerzt mich nicht.« Über den Winter war sie noch bleicher geworden und sah mit ihren knapp zehn Jahren schon erwachsen aus. »Ich tue alles so, wie ich es mit Gottes Beistand eben kann.«
Die Schmelze befreite die Zufahrtswege. Es trafen wieder Gäste ein, die sich mit Sir John zum Würzwein setzten, und Boten, die Nachrichten brachten. Oft stand Edward vor den anderen Kindern wie James, der Priester, und erklärte ihnen in umständlichen Sätzen, was es Neues gab: Ein Kaiser namens Maximilian sei gestorben und ein neuer würde gewählt. »Vielleicht wählen sie unsern Henry!«, rief Tom dazwischen. Von seinen Stiefeln tropfte Schlamm auf die tonroten Fliesen. Als Catherine an sich hinuntersah, entdeckte sie, dass ihr Kleidsaum schwärzlich verkrustet war.
Edward drehte sich nach ihnen um. »Das wäre ein Unglück für England, denn ein König gleicht ja dem Landmann, der seine Scholle mit seinen Händen beackern muss. Wenn er ihr fernbleibt, verkümmert sie. Auf der Insel Utopia betrachten die Landesherren sich als Bebauer, nicht als Beherrscher des Bodens.«
»Wo?«
»Oh, verzeih mir, Bruder. Ich dachte an das Buch des Thomas More, das ich just las.« Er bückte sich und suchte in dem Stapel vor Janies Pritsche. Catherine krallte die Nägel in Toms Hand, um nicht loszulachen. Mit seinen vierzehn Jahren überragte Edward bereits seinen Vater, blieb aber schmal wie ein Schilfhalm, und sein Gesicht sah aus, als müsse auf Wulf Hall jemand hungern. Offenbar fand er nicht das Erhoffte und richtete sich auf. Die Augen, halbblind von all dem Lesen, hatte er zu Schlitzen gekniffen. »Ohnehin hat König Henry sich um seine vornehmste Pflicht zu kümmern. Gott hat es gefallen, der Königin ihr Kind zu nehmen. Somit braucht England noch immer einen Erben.«
»Der zeugt sich in fremdem Bett vielleicht fröhlicher als auf der alten Ehevettel.« Immer wenn Tom so sprach, sah Catherine sich furchtsam um, als folge die Bestrafung auf dem Fuß. Unter den Seymour-Söhnen war Tom mit seinem schamlosen Mundwerk der Einzige, an dem der sanfte Sir John seinen Haselstock nicht zimperlich gebrauchte. Catherine schüttelte sich.
»Da magst du nicht Unrecht haben«, hörte sie Edward erwidern.
»Wie könnt ihr so sprechen?« Janie ließ ihre Handarbeit fallen. »Soll jemand euch hören?«
»Mich mag hören, wer will«, entgegnete Tom.
»Und wenn du Prügel bekommst?«
»Dann zwackt mir der Hintern, aber denken kann ich gottlob mit dem Kopf. Eine Frage noch, Ned: Was ist ein König wert, der seine Macht beweisen muss, indem er einem abgehalfterten Graubart den Kopf abschlägt?«
»Von wem sprichst du?« Edward, den einzig Tom bei der Kurzform Ned rief, hob die Brauen in die Stirn.
»Von diesem Steuereintreiber seines Vaters, Dudley, oder wie der Kerl hieß. König Henry hat ihn aufs Schafott geschickt, weil die Leute ihn nicht mochten. Kann so einer halten, was dein Erasmus sich von ihm verspricht, einen Garten der Gelehrsamkeit? Hat nicht in Wahrheit Erasmus längst enttäuscht das Weite gesucht?«
Edward hatte offenbar Janies entsetztes Gesicht bemerkt und schwenkte heftig die Arme, um das Thema zu beenden. Catherine fühlte sich betrogen. Die Antwort des Älteren würde sie nicht zu hören bekommen, die war für die Ohren von Mädchen nicht bestimmt. Sie sah die Brüder mit einem Zwinkern ihr Gespräch auf später verschieben und wünschte sich einen zornigen Herzschlag lang, als Knabe geboren zu sein.
Es war ein prächtiger Frühling, in dem sich Sonne und Regen die Hand reichten, so dass das wartende Grün die Erde platzen ließ. Nie hatte Catherine so viele Töne von Grün gesehen. Dass all diese Kraft eines Tages wieder verblassen, graugelb und schließlich welk werden würde, war unvorstellbar. Tom lehrte sie die Stimmen der Vögel nachahmen. Er saß mit gekreuzten Beinen auf der Wiese, legte den Kopf in den Nacken und trug ihr das Balzlied des Finken vor. Catherine malte sich aus, wie ein Schwarm liebestoller Finkenweibchen sich auf seinen Schultern niederließe, und lachte laut heraus. Tom hörte zu balzen auf.
»Cathie«, sagte er. »Ich bin bald zwölf, schon so gut wie ein Mann. Vater schickt Edward und mich nach Ostern an den französischen Hof.«
Catherine sah es mit einem Schlag: Die Verwesungsfarbe, die sich als Schimmel auf das frische Grün setzen würde, die Wolken, die schon bald die Sonne schluckten, das verlassene Gelege. Wulf Hall ohne Tom. Dann kam ihr ein Gedanke: »Nimmst du mich mit?«
»Du sprichst kein Französisch, oder?«
»Ich kann es lernen. Schneller als du, denke ich.«
Tom schüttelte den Kopf. »Du wartest auf mich auf Wulf Hall. Das ist, was Mädchen tun. Schau, Janie und Liz warten auch.«
Catherine sah auf das flach gedrückte Gras, dem der Duft feuchter Erde entstieg. Vielleicht war das Ganze nicht so schlimm. Sie bliebe auf Wulf Hall, und Tom wäre irgendwann wieder da, nicht auf immer verschwunden wie der Vater, von dem sie zuweilen nicht glauben konnte, dass es ihn überhaupt gegeben hatte. »So einfach wird es wohl nicht werden. Janie und Liz sind deine Schwestern, aber ich bin es nicht.«
Er überlegte. »Was können wir da tun?«
»Ich werde deine Braut sein müssen.«
Einen Menschen zu kennen, hieß, zu wissen, wann er eine Braue hob. Toms Augen weiteten sich, und Catherine entdeckte, dass sie grün waren. »Und du meinst, darauf lasse ich mich ein? Ich bin der schöne Tom, ich könnte eine Hübschere bekommen.«
»Eben drum. Hübsche kannst du viele bekommen. Aber mich nur einmal.«
Sie wusste auch, wann sein unmanierliches Gelächter aus ihm herausplatzen würde, aber diesmal täuschte sie sich. »Fein. Ich soll also dich zur Braut wollen. Und warum willst du mich?«
»Das ist einfach. Weil ich nirgendwo anders leben, sondern immer auf Wulf Hall bleiben will.«
An diesem Abend war es zum ersten Mal warm genug, den Tisch in den Hof zu tragen. Die Würze des Kanincheneintopfs mischte sich mit der Süße der Birkensäfte. Catherine beschloss, sich den Duft einzuprägen, denn es war der Duft ihres Verlobungstages. Als sie trotz der Kühle, die aufkam, bei einer Schale mürber Winteräpfel noch im Hof sitzen blieben, drangen von der Zufahrt Hufschläge her, und Sir John stand auf. »Wie es aussieht, bekommen wir späten Besuch.«
Den Hufschlägen folgten Stimmengewirr und das Schnauben erschöpfter Wagenpferde. Kurz darauf erschien Sir John mit den Gästen. Es waren ein Herr und zwei städtisch gewandete Damen, eine in Schwarz, die andere in Braun. Eine Amsel sang ihr Abendlied. »Ihr gestattet, meine Lieben? Ich habe die Ehre, euch Lady Maud Parr vorzustellen, die Gattin meines verlorenen Freundes.«
Jetzt erkannte Catherine die Dame in den steifen Witwenkleidern. Ihr Herz, von dem sie nun sicher war, dass sie es besaß, begann, dumpf zu hämmern.
»Sir William Parr von Horton.« Sir John wies auf den Herrn. »Der Bruder meines Freundes. Und seine Gemahlin, Lady Mary.«
Die Damen tänzelten an Catherine, Will und Nan vorbei und küssten sie auf die Köpfe. Catherine wünschte, sie hätte sich ducken, ihren Kopf zur Seite drehen dürfen. Die Frau war ihre Mutter, aber hatte sie wirklich etwas mit ihr gemein und ein Recht an ihr? Sie schüttelte sich. Sind nicht wir deine Familie, glaubte sie Toms Stimme über das allgemeine Gemurmel hinweg zu hören. Warum waren die drei gekommen, warum erklärte man ihr nichts? Unter dem Tisch trat Tom ihr in die Wade. »Deine Mutter sieht aus wie eine Krähe mit Brüsten«, flüsterte er so laut, dass Lady Margery ihm drei Plätze weiter mit dem Finger drohte.
Am nächsten Tag, in der Frühe, gingen sie alle zur Messe in die Kapelle. Wie üblich verstand Catherine kein Wort. Hernach, als sie hintereinander den Weg zum Haus zurückgingen, dachte sie: Wenn ich Latein könnte, würde ich zu Gott sprechen. Ich würde ihm sagen: Gott, ich bin wichtig. Deine Tochter Catherine bin ich. Tom Seymours Braut. Sie half Janie, die ihren Arm zur Stütze brauchte, und hing im Trotten ihren Gedanken nach.
Auf einmal blieb Sir John, der voranging, stehen. Er sagte etwas zu Edward, dann wandten beide sich um. Linkisch bot Edward seiner Schwester die Hand. »Komm, Janie, du gehst mit mir.«
Sir John legte einen Arm um Catherine und führte sie vom Weg fort, zwischen die frisch umgegrabenen Beete des Küchengartens. »Kleine Cathie. Ich habe ein Wort mit dir zu reden.« Catherine hatte sich auf ihr Frühstück gefreut, das dampfend im Haus auf sie wartete, aber im Arm von Sir John zu gehen, gefiel ihr gut. Ein jeder bekam somit zu sehen, wie bedeutend sie war.