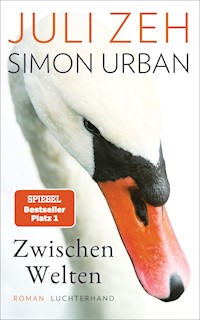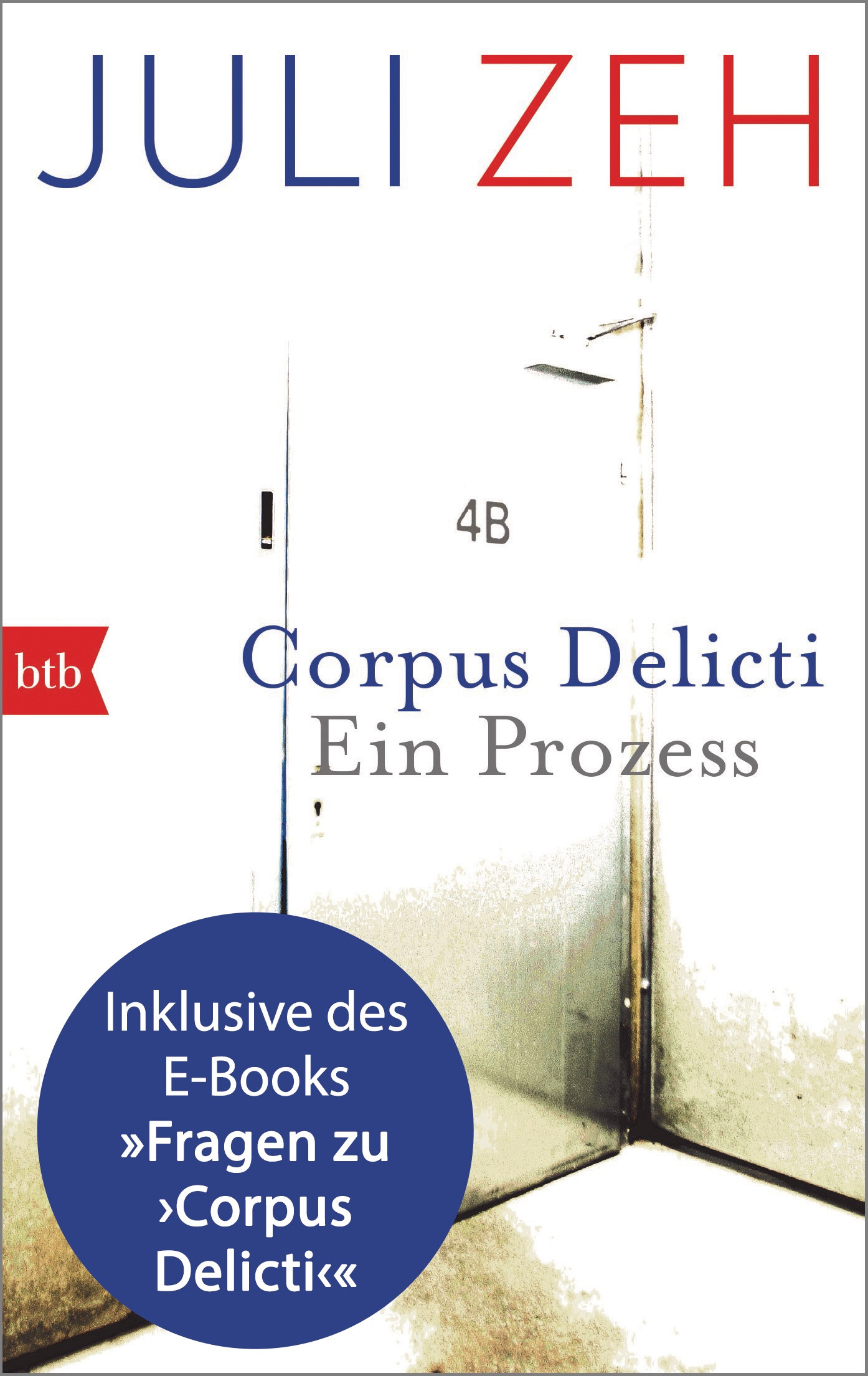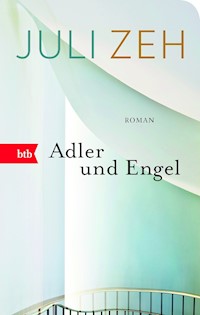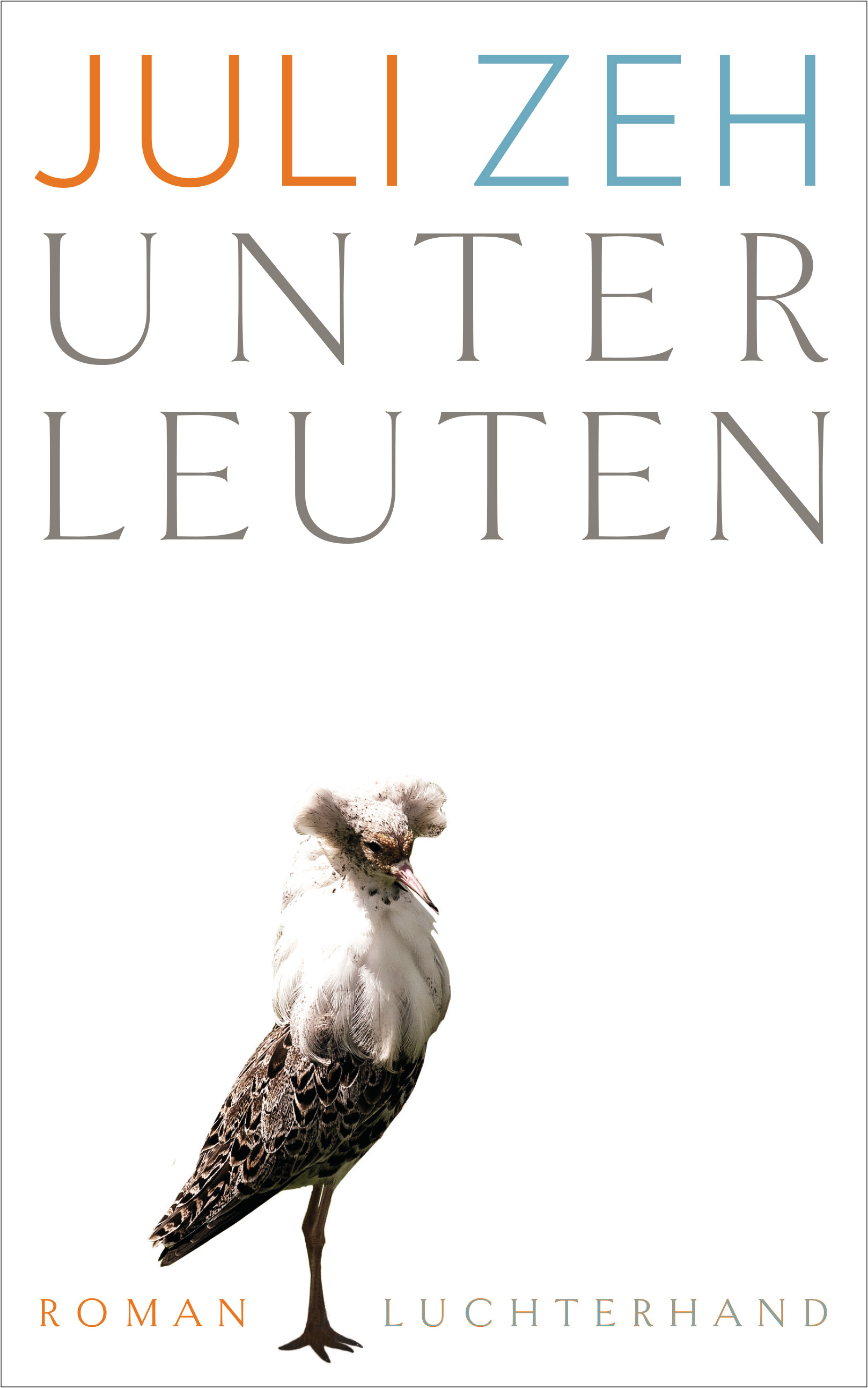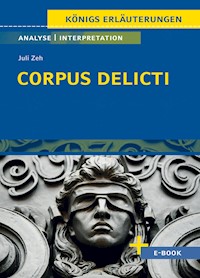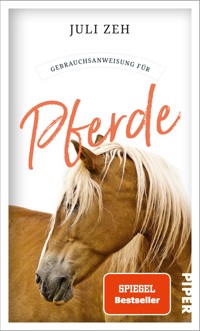9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pointiert, humorvoll, hintergründig …
Gibt es eine Demokratie ohne Nebenwirkungen? Finden sich auf dem Europäischen Markt noch Tabus made in Germany? Warum langweilt uns die Pornographie? Kann man schreiben lernen, hat die Literatur noch etwas zu erzählen, und worin liegt der psychologische Nutzen von Altpapier? Juli Zeh, eine der spannendsten und erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation meldet sich mit intelligenten, provokanten und amüsanten Essays zu Wort.
Ausgezeichnet mit dem Per-Olov-Enquist-Preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Titel
ALLES AUF DEM RASEN
POLITIK
Das Prinzip Gregor
Der Kreis der Quadratur
Sind wir Kanzlerin?
Deutschland wählt den Superstaat
Oma stampft nicht mehr
Verbotene Familie
Ersatzteilkasten
Es knallt im Kosovo
GESELLSCHAFT
Ficken, Bumsen, Blasen
End/t/zeit/ung
Prolog
§ 1: Print-Gymnastik
§ 2: Erkennungszeichen
§ 3: Altpapier
§ 4: Quellennachweis
§ 5: Einfalt
§ 6: Versteck
§ 7: Schimpfen auf die Presse
Epilog
Von Cowgirls und Naturkindern
Fliegende Bauten
Die Lehre vom Abhängen
RECHT
Recht gleich Sprechung oder: Der Ibis im Nebel
1. Sprache
2. Juristen
3. Griechen und Römer
4. Der Ibis im Nebel
5. Bibel und BGB
6. Gefahr, Genuss und Guter Glaube
7. Juristische Textrezeption
8. Sondern, zum Beispiel, so:
9. Entindividualisierung der Rede
10. Übersetzer gesucht
Justitia in Schlaghosen
Der Eierkuchen
Gipfel und Gegner
F. und Vogelperspektive
Weit und tief
Wirtschaft und Werte
Wunsch und Wirklichkeit
Mehr und weniger
Supranationales Glänzen
Eins
Zwei
Drei
Vier
Schluss
SCHREIBEN
What a mess
Marmeladenseiten
Genie Royal
Von der Heimlichkeit des Schreibens
Auf den Barrikaden oder hinterm Berg?
Sag nicht er zu mir
1. ICH schreibt ein Buch. ICH hat viel erlebt, deshalb kann ICH auch viel erzählen.
2. ICH findet sich selbst am interessantesten auf der Welt. Das hat ICH so gelernt. Vielleicht ist ICH Solipsist.
3. ICH drechselt nicht. ICH redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
4. ICH will nicht Gott sein. ICH ist Demokrat.
5. Weil ICH nervt. Weil ICH beschränkt ist wie die Menschen selbst.
6. ICH beschreibt, was ICH sieht. Was ICH nicht sieht, braucht der Autor nicht zu beschreiben.
7. ICH weiß, dass ICH nichts weiß.
8. ICH könnte mal Pause haben. ICH könnte den Mund halten, während andere reden.
REISEN
Fehlende Worte
Theo, fahr doch
Niedliche Dinge
Sarajevo, blinde Kühe
Jasmina and friends
Aus den falschen Gründen
Stadt Land Fluss, Stop: B
Stadt: Brenzlberg, Bauptstadt der BRD
Land: Barajevo in B-Land
Fluss: Bach
Nachweise
Zum Buch
Zur Autorin
Juli Zeh
Alles auf dem Rasen
Kein Roman
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2006.
Genehmigte Ebook-Ausgabe Juli 2018 im btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Design Team München
Umschlagfoto: David Finck
SK ∙ Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-24269-5V003
www.btb-verlag.de
Für David
ALLES AUF DEM RASEN
POLITIK
1 stadt- oder staatsgeschäfte, staatsangelegenheiten
2 regier- oder weltkunst
3 im engeren sinne dann auch die klugheit und verschlagenheit einzelner in erreichung ihrer zwecke
Das Prinzip Gregor
Früher gab es Gregor. Auf die Frage, was er an seinem Studium der Betriebswirtschaft gut finde, pflegte er zu antworten: Ich will eine goldene Kreditkarte mit meinem Namen darauf und einen Porsche 911 mit einer blonden Frau auf dem Beifahrersitz.
Das Prinzip Gregor war in der kleinen Universitätsstadt stark verbreitet. Seine Anhänger waren notorisch gut gekleidet und schon vor Markttauglichkeit des ersten Mobiltelephons in der Lage, jedes Kaffeehaus in das Büro einer Unternehmensberatung zu verwandeln, indem sie sich einfach nur hinsetzten. Es war nicht schwierig, Gregor unerträglich zu finden. Ein materialistischer Mensch in einer materialistischen Welt, ohne Begeisterung, ohne Ideen und Werte. Wenigstens machte er kein Hehl aus seinem umfassenden Desinteresse gegenüber Dingen, deren monetärer Gegenwert im Unklaren liegt.
Zum Prinzip Gregor gehörte auch Füsser. Er war die andere Seite, ohne die keine Medaille existieren kann. Füsser wusste nicht, ob er sein Philosophiestudium der Wissenschaft zuliebe in Tübingen beginnen sollte oder wegen des Biers in Köln. Seine Bücher bewahrte er in Haufen auf dem Boden auf, weil er in Regalen nichts wiederfand. Füssers Freunde waren zu dick oder zu dünn und mochten Geld, wenn es in einen Zigarettenautomaten passte. Das geisteswissenschaftliche Studium betrachteten sie als perfekte Vorbereitung auf die Arbeitslosigkeit. Man lernte von Anfang an, mit freier Zeiteinteilung, innerer Leere und sozialer Degradierung zurechtzukommen.
Gregor und Füsser begegneten sich nie, weil der eine aufstand, wenn der andere zu Bett ging; die Natur hatte ihnen unterschiedliche Lebensräume geschaffen. Trotzdem ähnelten sie sich wie die entgegengesetzten Enden einer Fahnenstange. Beide begehrten auf unterschiedliche Weise dieselbe Sache: Gregor die Anwesenheit, Füsser die Abwesenheit von möglichst viel Geld.
Nina und Nele waren mit beiden befreundet. Sie studierten Jura, weil man damit »alles Mögliche« machen kann, und Geld war ihnen egal, solange die Rotweinbestände gut gefüllt und Secondhandläden samstags bis sechzehn Uhr geöffnet waren. Aus purem Interesse lernten Nina und Nele drei Sprachen, belegten Doppel-, Zweit- und Aufbaustudiengänge, absolvierten Praktika in den globalen Machtzentren der Welt und sprachen auf Partys über die Osterweiterung der EU. Meisterhaft täuschten sie sich selbst und ihre Eltern darüber hinweg, dass die Paradeausbildung nicht auf eine Berufswahl hinauslief.
Nina und Nele fanden Gregor und Füsser rührend: Angehörige einer Gattung, die noch nicht weiß, dass sie vom Aussterben bedroht ist. Sie selbst nämlich waren Prophetinnen eines neuen Zeitalters. Sie konnten mit oder ohne viel Geld leben, weil sie sich selbst und ihre Umgebung über andere Dinge definierten. Ihre Lieblingssätze lauteten: Geld macht nicht glücklich. Zweitens: Glück macht nicht satt. Drittens: Denkt an unsere Worte.
Ein paar Dinge hatten sie alle gemeinsam. Sie sollten es im Leben besser haben als ihre Eltern und wurden gleichzeitig wegen Anspruchsdenken und Wohlstandskindertum verunglimpft. Sie waren hochintelligent, überdurchschnittlich begabt, körperlich bei Kräften, kurz: Musterbeispiele künftiger Leistungsträger, Hoffnungsschimmer einer gerade wiedervereinigten Republik. Orientierungslosigkeit hatte man ihnen schon nachgesagt, bevor sie auf die Welt kamen.
Oft markiert ein unscheinbares Ereignis die Sollbruchstelle im System. Die Jahrtausendwende war schon vorbei, und Gregor, Füsser, Nina und Nele hatten sich in alle Winde zerstreut, als der Reissack umfiel. Nicht in China, sondern auf einer der Gartenpartys, von denen die Elterngeneration nicht genug bekommt, seit die Kinder aus dem Haus sind.
Auf einem dieser Feste im Sommer 2002 stellte sich durch Zufall heraus, dass erstens der gesamte mitgebrachte Wein und Sekt von ALDI stammte und zweitens alle Anwesenden inklusive der Gastgeberin dies längst an den Etiketten erkannt hatten. Plötzlich erzählten die Mütter von Gregor, Füsser, Nina und Nele einander, wie sie drei Jahrzehnte lang beim ALDI-Einkauf hinter dem Gebäude geparkt, die Einkäufe in mitgebrachte Edeka-Tüten verpackt und für den Fall, dass ihnen ein Bekannter begegnete, den immer gleichen Satz bereitgehalten hatten: ALDI füllt teure Markenprodukte in billige Verpackungen – da wäre es doch idiotisch, mehr Geld auszugeben.
Die Erleichterung war groß, das ausbrechende Gelächter laut und lang. Es läutete eine Zeitenwende ein.
Zwei, drei Jahre später rief Gregor bei mir an. Er hatte meinen Namen im Internet gefunden und wollte erzählen, was er so macht. Nach seinen beiden Prädikatsexamen war er in die Hauptstadt gezogen und arbeitete bei Whoever & Whoever Incorporated.
»Wie schön!«, rief ich und freute mich ehrlich für ihn, »wie geht’s dem Porsche?«
»Weiß nicht«, sagte Gregor langsam, »plötzlich wollte ich doch keinen haben.«
Außerdem überlegte er, zum Jahresende zu kündigen. Und schwieg. Auch mir fiel nichts mehr ein. Als ich das Gespräch beendete, klang mir etwas in den Ohren. Es war das Echo eines langen Gelächters.
Kaum lag der Hörer auf der Gabel, nahm ich ihn wieder ab und begann eine Bestandsaufnahme. Ich rief Freunde an und deren Freunde, Bekannte und deren Bekannte, und stellte ihnen eine Frage: Braucht ihr Geld?
Die Ähnlichkeit der Antworten war verblüffend: Nö. Ein bisschen. Wenn ich was brauche, geh ich arbeiten. Nur für Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmtheit. Alles Wichtige ist unkäuflich. Meine Egoprobleme löse ich beim Sport. Verzicht schafft Freiraum. Nur eine Befragte antwortete: Ich habe mir einen hohen Lebensstandard erarbeitet und will ihn behalten. Sie kommt aus Russland.
»Freunde«, rief ich in die unendlichen Weiten des Telephonnetzes, »wir befinden uns in einer Wirtschaftsrezession. Wie wäre es, wenn ihr euch zusammenreißt, jede Menge Geld verdient und es wieder unter die Leute bringt?«
Keine Antwort. Jemand gähnte, ein anderer lachte.
»Herzchen«, fragte Nina, »fährst du eigentlich immer noch diesen schicken, sechzehn Jahre alten VW Polo?«
Wieso, das ist ein super Auto, 250000 km gelaufen und noch über ein Jahr TÜV.
Nach zwanzig Anrufen und einem Blick in den Spiegel wusste ich Bescheid. Wir sparen nicht, wir geben bloß kein Geld aus. Kreditkarten-Gregor ist die Galionsfigur einer sinkenden Handelsflotte. Die Besatzung hat sich ein Floß gebaut und treibt zu den Blockhütten an den Ufern einer Inselgruppe.
Was man weder mit autoritärer noch mit antiautoritärer Erziehung vermitteln kann, ist Existenzangst. Nach den Ergebnissen der Shell-Studie vom August diesen Jahres schaut die junge Generation trotz Börsenkrach, Pleitewelle, Massenarbeitslosigkeit und Terror optimistischer denn je in die Zukunft. Jeder in seine eigene, versteht sich. Nach wie vor fehlt es am ideellen Überbau – der wohlvertraute Werteverlust bleibt unausgebügelt. Trotzdem wäre der übliche Schluss auf frei flottierenden Egoismus und ich-bezogenes Meistbegünstigungsprinzip voreilig. Soziales Engagement ist den Befragten wichtig, viel wichtiger als politisches. Überschüssiges Geld würden sie lieber an eine private Hilfsorganisation abtreten als ans Finanzamt. Als »Gewinner« bezeichnet die Studie das Lager der »pragmatischen Idealisten«, während die »robusten Materialisten« auf der Verliererseite stehen. Nicht umgekehrt? Nein, so rum. Freundschaften, Liebe, Unabhängigkeit und Freizeit stehen als Ein-Mann-Werte hoch im Kurs. Und kosten nichts. Die junge Generation, als Vorbote einer künftigen Gesellschaft gern mikroskopiert, wendet sich entgegen der Prognosen nicht einem immer oberflächlicheren, konsumorientierten und sinnentleerten Dasein zu.
Das müsste all jene freuen, die in der Konsumversessenheit den ewig bevorstehenden Untergang des Abendlandes heraufdämmern sahen. Weniger froh wird sein, wer Konsum als notwendige Voraussetzung der Marktwirtschaft begreift. Das Nachkriegsmotto »Wer essen will, muss auch arbeiten« hat schon seit längerem an Durchschlagkraft verloren. Nun gerät auch ein zweites, ungeschriebenes Gesetz in Vergessenheit: Wer arbeiten will, muss auch essen. Und zwar etwas Teures. Oder anders: Ohne Konsumenten keine Investoren und keine Jobs.
Wie immer, wenn ich nicht weiterweiß, rufe ich meinen Freund F. an.
»F.«, sage ich, »seit ich dich kenne, schläfst du auf einer alten Matratze. Deine Kleider hängen auf einem fahrbaren Gestell, das Geschirr stapelst du auf der Fensterbank. Warum kaufst du nicht Bett, Schrank und Küchenregal?«
»Was!«, ruft F. entsetzt. »Modernität ist Mobilität, heutzutage braucht man Luftwurzeln. Eigentum verpflichtet, und zwar zum Möbelschleppen beim nächsten Umzug.«
Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Wer viel verdient, kann sich ein Umzugsunternehmen leisten.
»Stimmt«, gibt F. zu. »Aber große Summen für nichts auszugeben, hat etwas Unappetitliches.«
Deshalb trinkt F. auch keinen Cappuccino bei Mitropa. Nicht aus Geldmangel. Sondern aus Prinzip.
»Geldausgeben«, sage ich, »war mal ein nettes Hobby. Ist es dermaßen in Verruf geraten, bloß weil ein paar Konsumextremisten es eine Weile übertrieben haben? Stellen wir jetzt eine neue Kollektion auf dem Laufsteg der Weltanschauungen vor: die Neo-Askese? Was ist mit dem Prinzip Gregor passiert?«
Wer viel fragt, wird von F. mit einer Theorie bestraft. Es ist ganz einfach: Unsere Gesellschaft fällt sukzessive vom Glauben ab. Der Tod Gottes liegt lang zurück, auch die Trauerzeit ist vorbei. Der sogenannten Politikverdrossenheit sehen wir mit schreckgeweiteten Augen entgegen, während sie längst eingetreten ist und uns schon überholt hat. Die Abkehr vom Wirtschaftlichen ist die letzte Stufe eines logischen Dreischritts: Nach der Emeritierung von Religion und Politik verlieren nun die Götzen des Kapitalismus an sinnstiftender Kraft. Wir glauben nicht mehr, dass Mars mobil macht, Edeka besser als ALDI ist und in tollen Autos tolle Typen sitzen. Abgesehen von global organisierter Globalisierungsgegnerschaft gibt es eine stille, private und gerade deshalb ernst zu nehmende Verweigerung. Sie speist sich aus der Erkenntnis, dass, wer kein Geld verbraucht, auch keines verdienen muss. Irgendwann muss schließlich zu Ende geführt werden, was die Aufklärung angezettelt hat. Sich mit Ersatzsystemen durchschlagen – das kann jeder.
Fliegen wir also demnächst aus dem letzten transzendentalen Obdachlosenheim? Wenn ja, werden wir vielleicht feststellen, dass das Wetter draußen wärmer und trockener ist als befürchtet. Im Grunde sind wir dabei, Uneigentliches durch das Eigentliche zu ersetzen. Genau wie Religion und Politik dient der Wirtschaftskreislauf den sich gegenseitig bedingenden Essentialien menschlichen Zusammenlebens: Regulierung und Kommunikation. Durch das Verdienen und Ausgeben von Geld drückt der Einzelne seine Anerkennung oder Ablehnung bestimmter Produkte, Ideen und Entwicklungen aus und erfährt umgekehrt Wertschätzung oder Ablehnung seiner Person. Seit technische Mittel den Gedankenaustausch eines jeden mit jedem zu ermöglichen beginnen, wird Geld als Medium der Wertschätzung überflüssig. Inzwischen widmen Menschen Stunden um Stunden dem Erstellen einer Homepage oder dem Programmieren einer neuen Software, nicht um daran zu verdienen, sondern um zu hören, dass ihre Arbeit gut war und anderen weitergeholfen hat. Und bei ebay ist der beste Verkäufer nicht der mit den teuersten Produkten, sondern jener mit den meisten positiven Bewertungen.
»Stop«, unterbreche ich F., »erzähl mir nichts von der Einleitung des Postkapitalismus durch Internetkommunikation. Daran glaube ich, wenn die erste open-source-Bäckerei in meiner Nachbarschaft eröffnet hat.«
»Darum geht’s nicht«, sagt F. »Die Kommunikationstechnologie ermöglicht es, ein grundlegendes menschliches Bedürfnis zu befriedigen. Wenn dieses Bedürfnis nicht mehr über ökonomisches Verhalten vermittelt werden muss, verliert der Konsum seine Kompensationsfunktion und die Wirtschaft damit eine Triebfeder.«
»F.«, sage ich, »willst du mir erklären, dass du keinen Kleiderschrank besitzt, weil du E-Mails schreiben kannst?«
Sobald meine Telephonrechnung die Mietzahlungen übersteige, werde ich ihn verstehen, sagt F. und legt auf.
Wer oder was auch immer dabei ist, das Prinzip Gregor zu verabschieden – die endgültige Suspendierung hätte jedenfalls ein Gutes. Arbeitszeitverkürzungen als Job-Sharing-Maßnahme werden wir mit Freude entgegennehmen. Der bevorstehenden Senkung des Lebensstandards erwidern wir achselzuckend: Schon geschehen. Wir warten auf Nachricht, ob Gregor tatsächlich zum Jahresende bei Whoever & Whoever Incorporated kündigt. Danach werden wir uns Abend für Abend mit einem Lächeln auf den Lippen und einem recycelten Teebeutel in der Tasse auf unsere Strohmatten legen.
2002
Der Kreis der Quadratur
Müsste ich die Kapitalismusdebatte zeichnen, würde ich zunächst ein Quadrat malen und senkrecht in zwei Hälften teilen. Auf die eine Seite schriebe ich ein »L« für das linke, auf die andere ein »R« für das rechte politische Lager. Dann zöge ich mit geschlossenen Augen einen Zickzackstrich quer hindurch, die Buchstaben zerschneidend. Der Strich würde nicht einmal von Ecke zu Ecke reichen. Das wäre sie dann, die Kapitalismuskritik.
Nicht sein Inhalt macht den Kapitalismusstreit interessant, sondern vor allem sein symptomatischer Charakter für den Zustand unseres politischen Meinungsspektrums. Ein für seinen Konservatismus berühmter Professor wirft dem Marx zitierenden Müntefering aufgrund einer missglückten Metapher nationalsozialistisches Gedankengut vor. Kürzlich erst hat derselbe Professor die Folter im Kampf gegen mutmaßliche Terroristen für legitim erklärt. Der sozialdemokratische Münte hingegen verlangt plötzlich »Recht und Ordnung« auf den Märkten und ein Vorgehen »mit aller Härte« gegen die Beschäftigung osteuropäischer »Billigarbeiter« auf deutschen Schlachthöfen (sic!). Gleichzeitig gehört Münte einer Partei an, die eben erst durch Steuerbefreiungen zu einem rasanten Anstieg der Private-Equity-Praktiken von Firmenaufkäufern beigetragen hat und die seit Jahren an einer Verbesserung des »Standorts Deutschland« arbeitet – ein anderes Wort für kapitalismusfreundliche Wirtschaftspolitik. In dieser Partei wiederum finden seine Ansichten ebenso viele Freunde wie Feinde, und Gleiches gilt selbstverständlich in der CDU. Zu guter Letzt komplettiert das hauptberufliche Republikgewissen den Meinungswirrwarr mit der ebenso wohlklingenden wie inhaltslosen Forderung nach einer parlamentarischen Kontrolle der Märkte. Wenigstens bleibt Grass sich selber treu.
Markanterweise gilt für die Gesamtdiskussion: Altersfreigabe ab 50. Keiner der Disputanten entstammt der jüngeren Generation. Die steht stumm vor Staunen daneben und fragt sich mit offenem Mund: Glaubt hier wirklich irgendjemand, gekürzte Managergehälter würden die Arbeitslosenzahlen senken? Wird ernstlich behauptet, unser vom Wachstum abhängiges Wirtschaftssystem könne erhalten werden, wenn man gleichzeitig den Leithammeln das Verdienen und den größten Firmen das Gesundschrumpfen verbietet? Oder geht es nur darum, auf der Suche nach Ursachen für das Elend der Nation die sprichwörtliche Dummheit der Politiker gegen die ebenso sprichwörtliche Rücksichtslosigkeit der Wirtschaftsbosse auszutauschen?
Es ist nicht einmal so, dass bloß die zyklisch wiederkehrende Jammerei der Elterngeneration über den bösen Kapitalismus nerven würde. Die Debatte bezieht sich dem Ansatz nach auf wichtige Fragen, bleibt aber noch vor der Schwelle zum Eigentlichen in oberflächlichen Forderungen und Schuldzuweisungen stecken. Und es ist schwierig, sich in einer Diskussion zurechtzufinden, in der niemand, auch nicht Müntefering, die geringste Ahnung hat, was er will.
Versucht man nämlich, aus der Kapitalismuskritik praktische Konsequenzen zu ziehen, die über das leerformelhafte Einfordern von »mehr ethischer Verantwortung bei Unternehmern« hinausgehen, ergibt sich ein merkwürdiges Bild. Wir bräuchten Einkommensregulierungsgesetze für Spitzengehälter. Ein Abwanderungsverbot für deutsche Firmen, ein Mitarbeiterentlassungsverbot, vielleicht auch Importbeschränkungen für Billiggüter aus China. Weiterhin Ordnungsgesetze für die Kreditpolitik der Banken, ein Börsenspekulationsverbot sowie ein Verbot der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte aus Lohnkostengründen. Alle diese Gesetze kann man erlassen – wenn man vorher einen Teil der Grundrechte abschafft, die Europäische Union auflöst und sich klar macht, dass unser ökonomisches System, egal ob Turbokapitalismus oder soziale Marktwirtschaft, darunter zusammenbrechen würde. Das will niemand. In Wahrheit will man nicht einmal einen ökonomisch-deutschen Sonderweg. Was wollt ihr dann? – Ratlose Gesichter. Vielleicht Maoam.
Wirtschaftsnationalismus, Protektionismus und eine Stärkung staatlicher Eingriffsmacht in die Handlungsfreiheit des Einzelnen – die Kapitalismusdebatte macht die Rechts-Links-Schwäche im politischen Meinungsbild, Papa Marx hin oder her, endgültig zum vorherrschenden Normalzustand. Mit Heuschreckenmetaphern und an den Haaren herbeigezogenen Antisemitismusvorwürfen hat dieser Befund nicht das Geringste zu tun. Erst wenn man im oben gezeichneten Quadrat das »L« und das »R« ausradiert und durch ein »F« für Freiheit und ein »S« für Sicherheit ersetzt, lässt sich die Debatte in besser unterscheidbare Meinungslager teilen. Und das gilt, übrigens, nicht nur für diese. Ob Anti-Terror-Kampf vs. Datenschutz, Softwarepatente vs. open source, physische Selbstbestimmtheit vs. Gesundheitspolitik oder Sterberecht vs. Euthanasieverbot – hinter vielen politischen Diskussionen der Gegenwart verbirgt sich der Widerstreit zwischen dem Konzept individueller Freiheit auf der einen und jenem von staatlich herbeigeführter Sicherheit und Kontrollierbarkeit auf der anderen Seite. Diese beiden Werte ergänzen und begrenzen sich; bis zu einem gewissen Grad schließen sie sich sogar gegenseitig aus. Es scheint an der Zeit, sie zu einem neuen Ausgleich zu bringen. Solange der Kapitalismusstreit sich nicht selbst an dieser Wurzel packt, wird er unfruchtbar bleiben. Hinter dem Mangel an konkreten Vorschlägen steckt wie so oft das Fehlen einer grundlegenden Idee.
Denn natürlich geht es nicht um die genaue Höhe von Managergehältern. Die gegenwärtige Kapitalismuskritik ist bereits ein Kind der populärer werdenden Globalisierungsgegnerschaft. Auch hinter deren notorischer Schwammigkeit verbirgt sich die ungelöste Frage, wie unsere moderne Welt optimaler- oder gar utopischerweise gestaltet sein soll. Antworten auf derart grundsätzliche Fragen sind nicht durch das Erstellen von Sündenbocklisten, durch Einkommenskabbala und Meinungsumfragenpoker zu gewinnen. Sondern nur durch eine Reflexion auf unser Welt- und Menschenbild.
Es ist nicht der Mensch als Teil eines unmündigen, von Verkaufsstrategien manipulierten, ausgebeuteten und entmenschten Konsumentenkollektivs, der unsere Epoche prägt. Auch nicht der schafdumme Endverbraucher, den man zum Schutz vor sich selbst mit Verboten umstellen und erst wieder lehren muss, was der Sinn des Lebens ist. Viel eher leben wir doch in einem Zeitalter, das durch ein hohes Maß an allgemeiner Bildung und Aufgeklärtheit sowie durch eine weitgehende Verwirklichung von Freiheitsidealen gekennzeichnet ist. Aus der Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen folgt ein breit angelegter Individualismus, der (leider?) auch die ideellen Grundlagen für Mitgefühl, Verzichtwillen und eine Philosophie des Teilens schwinden lässt. Überindividuelle Wertvorstellungen, die sich aus den Ideen von Religion, Vaterlandsliebe oder Familie ergeben und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gemeinschaft befördern, haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung verloren.
Über Jahrzehnte hinweg wurde von den Menschen in allen Lebensbereichen Selbstbestimmtheit und Eigeninitiative verlangt. Das Ideal der Mobilität, ohne das der internationalisierte Kapitalismus nicht möglich wäre, wird durch einen lust- und leistungsorientierten Typus verkörpert, den man bis heute auf jedem Werbeplakat bewundern kann. Im Gegensatz zur Mobilität ist Moralität eine Form der Verantwortung für das eigene Handeln in Bezug auf andere. Sie gründet auf eine innere und äußere Verwurzelung in Kontexten, die nicht nur das Individuum selbst betreffen. Mobilität und Moralität sind keine Partner, sondern Kontrahenten. Das soll nicht heißen, dass ein Mensch unter keinen Umständen zugleich mobil und moralisch sein könnte. Für jenen Typus, den wir über so lange Zeit hinweg allein nach den Kriterien von Freiheitstauglichkeit und Beweglichkeit bewertet haben, stellt es jedoch eine Überforderung dar.
Anders gefragt: Wollen wir diesen Typus noch? Oder ist es jetzt so weit, dass wir verloren gegangene Werte durch staatliche Zwangsmechanismen ersetzen müssen? Wenn ja – geht das überhaupt? Und was bedeuten in diesem Zusammenhang die Grundrechte? Spielen sie eine untergeordnete Rolle, weil wir an einen Punkt geraten, an dem wir den Staat vor dem Bürger schützen müssen und nicht mehr den Bürger vor dem Staat? Sehnen wir uns nach einer kleinen, sicheren Welt, oder arbeiten wir weiter an dem Versuch, die Ränder der Chancengleichheit (und damit des Risikobereichs) möglichst weit auszudehnen, auch über staatliche Grenzen hinaus? Und wären wir bereit, für eins unserer alten oder neuen Ideale in materieller Hinsicht etwas aufzugeben? Wie wollen wir denn nun sein: stark, schön und erfolgreich – oder edel, hilfreich und gut?
Quod esset disputandum. Keine dieser Fragen wird bislang von der Kapitalismusdebatte vertieft diskutiert. Angesichts der allgemeinen Überzeugung, vielleicht in keiner guten, jedoch in der besten aller denkbaren Staatsformen zu leben, ist das möglicherweise verständlich. Man kann aber nicht Speck haben und das Schwein behalten – nicht die Freiheiten des Kapitalismus genießen und gleichzeitig nach einer sicheren Kuschelwelt verlangen. Wenn der aktuelle Streit, wie seine rasante Ausweitung vermuten lässt, tatsächlich Ausdruck eines tief- und weitgehenden Unbehagens gegenüber dem »Ob« oder »Wie« unseres wirtschaftlichen (und damit auch des politischen) Systems ist, wird das geheuchelte Bemühen um kosmetische Verbesserungen die Spannungen eher verschärfen als lösen. Man liest, die Menschen im Land seien verunsichert und hätten Angst. Wenn das stimmt, liegt etwas im Argen, das über Hartz IV und Ackermanns Renditeerwartungen hinausreicht. Wir, das heißt unsere Gesellschaft als Ganzes und jeder Einzelne von uns, sind kürzlich in eine jener Identitätskrisen geraten, die Jahrhundertwenden geradezu typischerweise mit sich führen. In solchen Situationen können eine Menge Dinge auf den Prüfstand gehören – Menschenbild, Wirtschaftssystem, Weltordnung, der Zuschnitt unserer parlamentarischen Demokratie. Und nicht ohne Grund: Änderungen der Verhältnisse, die nicht rechtzeitig zur Kenntnis genommen werden, tendieren zu unangenehmen Überraschungen.
Münteferings ungelenker Vorstoß hat immerhin einen ersten Zipfel des eigentlichen Themas gepackt. Wenn wir daran in die angedeutete Richtung – unter Zuhilfenahme der einen oder anderen jüngeren Hand? – kräftig ziehen, verwandelt sich das fruchtlose Zerlegen des Meinungsspektrums vielleicht noch in das, was wir wirklich gebrauchen könnten: eine gemeinsame Standortbestimmung des gegenwärtigen Menschen und seiner Rolle in der (deutschen) Gesellschaft und der (globalisierten) Welt. Dann wäre er gelungen, fernab von Heuschrecken, NRW-Wahl und neuem Klassenkampf: Der Kreis der Quadratur.
2005
Sind wir Kanzlerin?
Ein belebtes Café im Zentrum einer beliebigen europäischen Großstadt. Die Jung-Literatin (JuLi) sitzt in einer Ecke und rührt in einer großen Tasse Milchkaffee. Ihre Beine, die in abgetragenen Jeans stecken, hat sie übereinander geschlagen. Auf der anderen Seite des kleinen Tischs sitzt eine Journalistin im eleganten Kostüm und trinkt Tee. Ihr Haar ist sorgfältig zu einem blonden Helm frisiert. Irgendwie erinnert die Journalistin ein wenig an Margaret Thatcher (MT).
MT: Frau Zeh, Sie sind eine junge Frau …
JuLi: Dafür kann ich nix.
MT: … mit einigem beruflichen Erfolg.
JuLi: Ersparen Sie mir die Frage. Nein, ich habe mich noch nie im Leben diskriminiert gefühlt.
MT: Gehen wir zur Vermeidung des Dauerkonjunktivs einmal davon aus, dass Angela Merkel die nächste Kanzlerin wird.
JuLi: (erleichtert) Ach so, darum geht’s!
MT: Wie finden Sie das?
JuLi: Was? Eine deutsche Kanzlerin oder Angela Merkel?
MT: Ist das nicht dasselbe?
JuLi: Nein. Wissen Sie, als Helmut Kohl die heutige CDU-Vorsitzende aus dem ostdeutschen Zauberzylinder zog, taufte er sie »Das Mädchen«. Für mich und viele andere war sie von Anfang an »Das Merkel«. Konsequenterweise müsste das Merkel auch das Kanzler werden. Klingt das gemein?
MT: Ziemlich. Hat man Sie schon mal »Das Zeh« genannt?
JuLi: Nein, das wäre grammatikalisch falsch. In der Schule nannte man mich »Der Zeh« – entweder kleiner Zeh oder großer Zeh, je nachdem, welches Fach gerade unterrichtet wurde.
MT: Hängen Sie der These an, nach der es in Wahrheit drei Geschlechter gibt: Mann, Frau und Karrierefrau?
JuLi: Nein … Ich glaube nicht.
MT: Aber Sie sprechen Frauen in Führungspositionen die Weiblichkeit ab?
JuLi: Das fragen ausgerechnet Sie?
MT: Wie bitte?
JuLi: Entschuldigung … Sie erinnern mich an jemanden. Wie heißt Ihre Zeitung noch mal?
MT: Muttis und Tanten.
JuLi: Wirklich? Das muss ein Deckname sein. – Aber zurück zum Thema. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, eine öffentliche Protestnote gegen die Schizophrenie der Lage einzureichen: Über eine Kanzlerin würde ich mich durchaus freuen – aber nicht über diese! Das einzig Gute an Frau Merkel ist nämlich, dass sie keinen Doppelnamen trägt. Däubler-Gmelin, Leutheusser-Schnarrenberger oder sogar Wieczorek-Zeul wären mir trotzdem lieber.
MT: Was spricht gegen Angela Merkel?
JuLi: Vor allem Angela Merkel. Eine Frau, die …
MT: Es gibt da ein merkwürdiges Phänomen: Emanzipierte Frauen mögen emanzipierte Frauen nicht. Ich glaube, das heißt Stutenbissigkeit …
JuLi: Wieso? Haben Sie was gegen mich?
MT: So war das nicht gemeint.
JuLi: Jetzt lassen Sie mich erst mal ausreden. Eine Frau, die kurz vor dem Irakkrieg nach Washington fährt, um George Bush die moralische Unterstützung der deutschen Opposition zu versprechen, hat sich auf ewig diskreditiert. Und abgesehen davon, dass Frau Merkel ihr Meinungsfähnchen nach jedem Umfragewind hängt, sind aus ihrem Mund nur Nörgeleien statt konstruktiver Vorschläge zu hören. Jetzt will sie auch noch Günther Beckstein zum Innen- und Wolfgang Gerhardt zum Außenminister machen. Deshalb ist es hundsgemein, dass ich mich darüber freuen muss, wenn sie Kanzlerin wird!
MT: Müssen Sie ja nicht.
JuLi: Eben doch. Weil ich irgendwann einmal in einem Deutschland leben möchte, in dem ein weiblicher Kanzler kein besonderes Aufsehen mehr erregt. Ich hasse Quoten und Zwangsemanzipation. Ich will nicht öffentlich angegriffen werden, wenn ich mich selbst als »Jurist« und »Schriftsteller« bezeichne. Ich will lieber über das Programm eines Politikers reden als über sein biologisches Geschlecht. Deshalb ist es wichtig, dass Frau Merkel den Anfang macht und zur Kanzlerkandidatin avanciert – nicht als Quotenfrau, sondern weil sie noch härter, noch konservativer und noch opportunistischer ist als ihre männlichen Kollegen. Im Grunde ist das ein Normalisierungsprozess.
MT: Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In Wahrheit heißt meine Zeitung Matriarchat Total.
JuLi: Dachte ich’s mir doch. Jedenfalls will ich trotzdem niemanden wählen müssen, nur weil er, äh, sie eine Frau ist. Ist das verständlich?
MT: Nein.
JuLi: Sehen Sie, ich gehöre einer Generation an, die mit einem neuen, ja, man könnte sagen: beinahe ohne Rollenverständnis aufgewachsen ist. Als Kind habe ich weder mit Puppen noch mit Waffen gespielt. Mein Lieblingsspielzeug war ein Bagger. In der Schule führte ich eine Kinderbande und verprügelte aufmüpfige Klassenkameraden. Ich habe zwei juristische Staatsexamen und besiege noch heute Schriftstellerkollegen im Armdrücken. Alice und ihren Schwestern bin ich wirklich dankbar dafür, was sie quasi pränatal für mich getan haben. Aber das verpflichtet mich nicht, auf leeren Schlachtfeldern zu kämpfen.
MT: Nehmen wir folgenden Fall: Eine Frau arbeitet hochqualifiziert in ihrem Job. Sie ist erfolgreich und fleißig. Trotzdem ziehen bei allen Beförderungsrunden die männlichen Mitbewerber an ihr vorbei. Soll sie da nicht wütend werden?
JuLi: Theoretisch schon. Nur ist mir das nicht passiert. Es ist Ihnen nicht passiert, und wir kennen auch niemanden, dem es passiert ist.
MT: Woher wollen Sie das wissen?
JuLi: Alle, die öffentlich über Benachteiligung reden, sind selbst nicht benachteiligt. Sonst würde man sie nicht fragen.
MT: Das ist Zynismus.
JuLi: Das ist Diskurskritik. Ab einem gewissen Punkt gibt es nichts Diskriminierenderes als Diskriminierungsdebatten.
MT: Wie finden Sie eigentlich diese jungen, unpolitischen, egozentrischen Individualisten, die immer glauben, die Welt sei in Ordnung, solange es ihnen selber gut geht?
JuLi: Touché! Aber ich weiß eine politisch korrekte Antwort: Natürlich gibt es in Sachen Gleichberechtigung noch eine Menge zu tun. Aber diese Fragen lassen sich am besten aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wenn unser Land Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeiten nicht in den Griff bekommt, wird es seine Nachwuchsschwierigkeiten nicht lösen, das Rentensystem nicht retten und die Arbeitslosenzahlen nicht in den Griff bekommen. Wenn es keine Frauen in Führungspositionen holt, wird es im internationalen Kompetenzvergleich zurückfallen. Und so weiter.
MT: Wird Frau Merkel diese Probleme in Angriff nehmen?
JuLi: Ich fürchte, in diesem Sinn wird sie eher ein Kanzler als eine Kanzlerin.
MT: Wenn ich Sie bis hierhin richtig verstanden habe, dürfte Sie das eigentlich nicht stören?
JuLi: Nein. (hustet) Doch. Also … Die Frage verwirrt mich. Ich wähle den Publikumsjoker …
MT: Mehr als die Hälfte der deutschen Frauen würden sich für Frau Merkel als Kanzlerin entscheiden.
JuLi: Das ist schon fast eine klassische Tragödie. Sagen wir so: Wer erwartet, dass weibliche Hände immer sanfter, einfühlsamer und frauenfreundlicher regieren, der glaubt auch an den Osterhasen.
MT: Wäre Ihnen das Stoiber … ich meine: Herr Stoiber als Kanzlerkandidat lieber?
JuLi: (entsetzt) NEIN! – (nachdenklich) War das eine Fangfrage?
MT: Ja.
JuLi: Dann habe ich bestanden? Sie halten mich jetzt nicht mehr für eine Frauenfeindin?
MT: Ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis …
JuLi: Ihre Zeitung heißt in Wahrheit Müntes Talfahrt?
MT: Wie haben Sie das erraten?
JuLi: Weibliche Intuition.
MT: Was unsere Leser und Leserinnen interessieren würde: Soll es mehr Frauen geben in der Politik?
JuLi: (seufzt) Wissen Sie … (setzt eine Intellektuellenmiene auf und zündet sich eine Zigarette an) Es ist ja nicht so, dass Politik Spaß macht. Manchmal denke ich, wir können froh sein, dass sich noch ein paar dickfellige Kerle finden, die die Dreckarbeit erledigen. Wenn die bereit sind, sich für einen anachronistisch-maskulinen Machtbegriff bis ganz nach oben zu schinden, dann lassen wir sie doch einfach. Bald ist das Regieren auf nationaler Ebene ohnehin nur noch ein Verwaltungsjob. Die wirklich intelligenten, wirklich mobilen, wirklich kreativen Menschen gehen einstweilen nach Brüssel. Oder in die Wirtschaft.
MT: In deutschen Aufsichtsräten liegt der Frauenanteil bei drei Prozent.
JuLi: Ich meinte die ausländische Wirtschaft. Und was die Politik betrifft – sogar Pakistan, Indonesien und die Türkei hatten längst Frauen als Regierungschefs, und das sind muslimische Länder. Wenn Deutschland das Merkel braucht, um seine Rückständigkeit zu überwinden, dann kann ich nur sagen: Jedes Land kriegt die Staatsmänninnen, die es verdient.
MT: Jetzt möchte ich Ihnen noch die vier unoriginellsten Fragen zum Thema »Merkels Kanzlerkandidatur« stellen. Sind Sie bereit?
JuLi: Wenn Sie es sind.
MT: Ist Angela Merkel ein role model?
JuLi: In gewissem Sinne, ja. Es gibt nämlich nur zwei Geschlechter. Auf der einen Seite Karrierefrauen und -männer. Auf der anderen Seite der Rest der Menschheit.
MT: Können Sie sich mit Frau Merkel identifizieren?
JuLi: Da würde ich mich sogar Barbie näher fühlen.
MT: Das wird unsere Leserinnen freuen. Unser Magazin heißt nämlich …
JuLi: Miezen und Tussen, ich weiß.
MT: Was würden Sie von Frau Merkel wissen wollen, wenn Sie ihr eine Frage stellen dürften?
JuLi: Ob es ihr nicht peinlich ist, andere Leute zu kritisieren, während sie selbst keine besseren Ideen hat.
MT: Welche drei Politiker würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?
JuLi: Gustav Stresemann, Winston Churchill und Willy Brandt.
MT: Die sind ja alle tot.
JuLi: Eben.
MT: Können Sie zum Abschluss etwas Positives über Frau Merkel sagen?
JuLi: Hmm … Wenn ich mich zwischen einer Frau Merkel und einem Herrn Merkel entscheiden müsste und sie wären identisch bis auf das Geschlecht – dann würde ich Frau Merkel wählen!
MT: Nur unter diesen Umständen?
JuLi: Nur unter diesen Umständen.
MT: Wahrscheinlich danken wir Ihnen für dieses Gespräch.
Das fiktive Interview führte Juli Zeh mit Juli Zeh
2005
Deutschland wählt den Superstaat
D