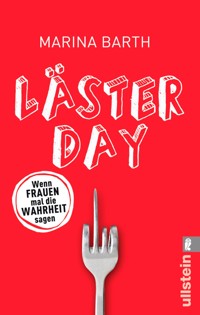10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Geschichte der Kölner Ikone Trude Herr, die so viel mehr war als eine Ulknudel. Ein biografischhistorischer Roman, detailgenau und mit vielen Originalzitaten. Geboren in einem Kölner Arbeiterviertel, träumt die junge Trude Herr von der ganz großen Bühne. Aber das Träumen reicht ihr nicht, und so sucht sie sich mit ihrem außergewöhnlichen Unterhaltungstalent einen Weg von der schäl Sick mitten hinein in die pulsierende Künstlerszene der fünfziger Jahre. Sie schließt sich einer Wanderbühne an, arbeitet als Statistin und als Bardame, bis ihr als weibliche Büttenrednerin endlich der Durchbruch gelingt: Trude Herr wird zur Ikone ihrer Zeit. Doch mit ihrem unvergleichlich entwaffnenden Humor schafft sie sich auch ein Korsett, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
Marina Barth, Jahrgang 1960, ist Kabarettistin und seit 2001 Chefin des Klüngelpütz-Theaters in Köln. Die Theater- und Buchautorin arbeitet zudem als Regisseurin, Moderatorin und historische Stadtführerin. 2014 schrieb sie ein Stück für das Kölner Hänneschen-Theater und begegnete dort der Protagonistin ihres ersten historischen Romans »Lumpenball«, mit dem diese Reihe begann: Fanny Meyer, einer jüdischen Puppenspielerin im Kölner Hänneschen-Theater in den 1930er Jahren.
Dieser Roman basiert auf dem Leben der Trude Herr, eingebettet in ihr zeitgenössisches Umfeld. Alle Personen haben gelebt oder leben noch. Die Schilderung der Charaktere und Handlungsweisen folgt so nahe wie möglich den dokumentierten oder überlieferten Fakten, erzählt wird fiktiv aus der Perspektive Trude Herrs. Die Autorin hat die Dinge nicht persönlich erlebt, doch die Geschichten haben sich so oder so ähnlich ereignet. Einige wurden mit künstlerischer Freiheit zum Leben erweckt, andere ergeben sich plausibel aus dem Kontext, könnten aber auch anders passiert sein. Der Roman stützt sich auf Sekundärliteratur, die Sie im Nachwort genannt finden, und zitiert immer wieder gekennzeichnet Trude Herrs O-Ton.
Analog zu Trude Herrs mindestens vier großen Abschieden von Köln kommt auch das Buch nicht mit einem einzigen Ende aus: Es gibt ein Ende, einen Epilog, ein Nachwort und ein Glossar.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von Rudolf Alert aus dem Buch »Trude Herr. Ein Leben«
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-194-2
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Trude Herr ist mir nie begegnet.
Ich habe sie niemals auf der Bühne erlebt.
Für mich gehörte sie zum Boulevard, wie Ohnsorg und Millowitsch, und das zu einer Zeit, in der ich mich eher für Zadek, Fassbinder oder Polański interessierte.
Sie sang Schlager, als meine Welt sich der Beatmusik zuwandte.
Ich bin froh, dass ich ihr durch dieses Buch
1
»Pass auf, du bist gleich dran!«
»Ja doch, Schätzelein. Ich muss dir was erzählen, Gustl!«, flüstere ich, so leise ich kann, zurück. Leider ist das nicht besonders leise.
»Schschsch!«, kommt es von irgendwoher zurück. Ich kann es kaum aushalten. Mein Herz möchte in tausend Stücken nach allen Seiten springen und die ganze Welt umarmen – wenigstens den Teil, den ich gut leiden kann.
»Die sind schon beim Schneider!« Gustl kann sehr leise flüstern.
»Sag du mir nicht, wann ich dran bin – ich hab noch Zeit! Und weißt du, was ich noch habe?«
Gustl hört mir gar nicht zu, sondern macht »Schschsch!« und lauscht auf die Schauspieler draußen vor dem Vorhang.
Wir kauern beide hoch oben in der nächtlichen Kulisse der Bühne, die von unten so viel größer aussieht, als sie in Wirklichkeit ist. Ich frage mich jedes Mal, wo sie den Schuhlöffel hingetan haben, mit dessen Hilfe ich auf meinen vorgegebenen Platz flutschen könnte.
Um uns herum sind lauter angedeutete Spitzgiebelhäuschen schwach von innen beleuchtet, damit man aus dem Zuschauerraum hübsch angeordnete Silhouetten eines nächtlichen Köln erkennen kann, das es so gar nicht mehr gibt. Der Mond wurde prächtig leuchtend in den Bühnenhimmel heraufgezogen. Ich habe ein fein gesäumtes Zipfelmützchen auf dem Haupt und sitze auf einer klitzekleinen Stufe ganz oben auf der Bühnentreppe, die Laterne fest in der Hand. Die Treppe führt quasi im Inneren eines der Häuser in den Keller, der sich unten auf der Bühne zum Zuschauerraum hin als Schneiderwerkstatt öffnet. Jedenfalls jetzt in der Nachmittagsvorstellung. Abends gehört die Treppe zum Bühnenbild vom »Stadtschreiber von Köln« und kennzeichnet einen hochherrschaftlichen Eingang.
Im Dunkel der Kindervorstellung hocken die Treppenstufen hinunter links und rechts lauter Heinzelmännchen. Ganz unten wartet meine kleine Nichte Gigi, während hier oben bei uns der Schneider auf der Pritsche liegt und schnarcht.
»Du glaubst es nicht – ich habe unser Theater gesehen!«
»Unser Theater? Du spinnst ja.«
»Das hat der Papa auch gesagt, als ich mit sechs Jahren in der Schule erklärte, Schauspielerin werden zu wollen – und was soll ich sagen … tataa!« Ich mache eine ausladende Geste und vergesse, dass an dieser Hand ja die Laterne baumelt, die durch den plötzlichen Ruck ordentlich scheppert.
»Schsch!«, macht der Schneider.
Gustl hält die Streichhölzer parat wie immer, um beim »… Bürgermeisters Rock bereits gemacht« die Kerze in der Laterne zu entzünden. Wir haben es schon hundertmal gemacht. Es ist ein furchtbar langweiliges Stück für ein furchtbar langweiliges Publikum, das vor lauter Vorfreude, weil es natürlich weiß, wie gleich die Heinzelmännchen die Treppe hinunterpurzeln werden, das Lachen kaum noch zurückhalten kann. Sogar Gisela giggelt unten schon wieder mit.
»Schsch!«, mache ich. Meine Nichte ist das kleinste Heinzelmännchen, und ich bin das größte. Genau genommen bin ich das dickste. Seit es wieder alles gibt, habe ich das unstillbare Bedürfnis, alles auch zu essen, und man sieht es fast ein bisschen.
»Ich stelle mir das anders vor auf dem Theater. Meinst du, ich will bis ans Ende meiner Tage mit der Laterne in der Hand diese Treppe als geölter Blitz in Moll runterkugeln?«
»Jeder muss klein anfangen.«
»Klein? Das sagst du mir? Guck mich an! Ich will spielen, die Leute wirklich zum Lachen bringen und im nächsten Moment zum Heulen. Ich will, dass sie klüger werden, dass sie lernen, dass Freude und Schadenfreude zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich …«
Der schnarchende Schneider verschluckt sich.
»Hier werde ich gar nix. Mal geht die kleene Dicke von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links. Mal kichert sie, mal knickst sie vorm Zigeunerbaron, und bei den Heinzelmännchen darf sie die Treppe runterfallen. Nee, Gustl – ich hab das Zeug zum ganz großen Star. Unser Kohlenhändler hat in Ehrenfeld eine Baracke auf dem Hinterhof, die will er vermieten, hat er gesagt, und ich habe sie mir angesehen. Da richten wir beide – du und ich – unser Theater her, und weißt du, wie es heißen wird? ›Kölner Lustspielbühne‹!«
»Kölner – was?«
»… bereits gemacht!«
»Gustl – die Laterne, schnell! Ich muss raus!«
»… Bürgermeisters Rock bereits gemacht!«, wiederholt der Kollege unten auf der Bühne, aber das hastig angerissene Streichholz ist Gustl runtergefallen und hat mir ein kreisrundes braunes Loch ins Heinzelmännchenwams gebrannt. Die Laterne ist immer noch aus.
»Der Rock ist gemahacht!«, ruft ein wenig verzweifelt der Kollege draußen zum dritten Mal in unsere Richtung herauf, als ich endlich mit brennender Latüchte und Loch im Gewand oben auf dem Treppenabsatz erscheine.
Im Schein meiner Laterne purzeln und kugeln, fallen mit Schallen, Lärmen und Schreien und Vermaledeien erwachsene Heinzelmännchen mit Zipfelmützen, grauen Bärten, ulkigen Schuhen, die ihnen viel zu groß sind, durcheinander die Treppe hinunter, als hätte Shakespeares Puck statt eines Sommernachts- einen ziemlichen Alptraum. Und das kleinste steht ganz unten und hält sich den Bauch vor Lachen, weil ich als Letzte herunterkegele. Den fleißigen Heinzelmännchen ist des Schneiders neugieriges Weib mittels hinterrücks ausgestreuter Erbsen mal wieder auf die Schliche gekommen! Das ist nun wirklich der Brüller – das Publikum tobt.
Geschafft. Nach dem Schlussapplaus eilen wir in die zugige Garderobe, um uns umzuziehen.
Ich beeile mich besonders, denn ich will Gustl heute noch zeigen, was ich meine. Er muss es mit eigenen Augen sehen. Es ist nämlich perfekt. Aber zuerst muss ich die kleine Gigi nach Hause bringen, sie ist nicht mal sieben, und es wird bald dunkel.
»Was war denn schon wieder los?«
Willy steht wütend und bereits in voller Stadtschreiber-Montur für die Abendvorstellung in der Garderobentür. Sein imposanter Schnäuzer bebt, und die – verbliebenen – Löckchen kräuseln sich unheilvoll um seine Stirn.
»Kannst du nicht einen einzigen Einsatz sicher nach Hause bringen, ohne dass man dich bis in die zehnte Reihe tuscheln hört?«
Er meint mich. Und ich denke, wie so oft, dass er doppelt so alt ist wie ich und dass man das sieht. Gustl und er sind zwar ein Jahrgang, aber dennoch so grundlegend verschieden wie Flönz und Appeltaart. Der eine feingliedrig, zart und sensibel, wenn auch groß, der andere mit dem Charme eines Bullenkalbes. Wie zufällig lege ich die Hand über das Brandloch in meinem Hemd. Wenn er das auch noch sieht, bin ich geliefert.
Und schon geht der übliche Sermon los, und zwar beifallheischend in die ganze Runde: »Die Leute haben bezahlt, es kann doch nicht sein, dass die die einfachsten Aufgaben nicht bewältigt, vielleicht muss sie einfach weniger essen und mehr zuhören! Ein hübsches Gesicht ist nicht alles! Da gibt man einem jungen Ding eine Chance, und dann das!«
Das junge Ding guckt mit demonstrativer Verzweiflung an die Decke und wagt nicht, weiter sein hart gekochtes Ei im Mund zu kauen. Was soll ich sagen? Ich habe halt immer ein Pausenbrot dabei.
»Die Streichhölzer sind feucht«, rettet mich Gustl. »Es war meine Schuld. Sie kann ja nicht rausgehen, wenn ich die Laterne nicht ankriege.«
Ein kurzer wütender Blick in meine Richtung. »Ihr seht doch, dass immer weniger Leute kommen! Nach der Währung haben alle kein Geld mehr. Und die paar, die noch kommen, vergrätzt ihr mir mit einer schlechten Vorstellung! Und wonach stinkst du zum Teufel noch mal so – bestialisch?«
Dann trollt sich der Theaterchef, ohne meine Antwort abzuwarten, er hat natürlich zu tun. Vor Gustl hat er Respekt, obwohl der im Augenblick kaum ernst bleiben kann.
Parallel zu seinem Vortrag habe ich hinter Willys Rücken ein paar klitzekleine willytypische Grimassen geschnitten: die Augenbrauen erzittern und schwindelerregende Höhen erklimmen lassen, den Finger tänzelnd wie eine Kobra in die Luft gereckt und bei »junges Ding« kräftig mit dem inzwischen wieder stattlichen Arsch gewackelt.
Was hätte ich ihm erzählen sollen? Dass meine Schwester letztes Silvester ein Schwein gewonnen hat und dieses seitdem bei uns auf der Etage wohnt, weil meine Mama Freundschaft mit ihm geschlossen hat, statt es zu verwursten? Das glaubt mir kein Mensch, aber man riecht es halt! Ich schicke Gisela zur Abendkasse, um ihre zwei Mark Gage abzuholen. Drei Zigaretten bekäme man für diese zwei Mark, muss ich sehnsüchtig denken, Gigi kauft sicher Schokolade.
»Nimm’s ihm nicht krumm, er hat mit seinen vierzig Jahren eine riesige Verantwortung und weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll!«, beschwichtigt mich Gustl, noch immer leise kichernd, und wir stehen draußen.
Adenauer, unser alter Oberbürgermeister, hatte Willy und seine Schwester Lucy direkt 1945 höchstpersönlich gebeten – das kann der Chef noch vier Jahre später gar nicht oft genug erzählen –, das Theater ihres verstorbenen Vaters bloß wieder aufzumachen, damit die Leute auf andere Gedanken kämen. Das scheint mir in der Tat bitter nötig, nachdem genau diese Leute den furchtbarsten Weltenbrand angerichtet haben, den man sich nur vorstellen kann. Die Millowitschs haben seither sieben Tage die Woche Vorstellung, nachmittags für Kinder und abends für Erwachsene, um die Leute möglichst durchgehend auf andere Gedanken zu bringen.
Der lange, dünne Gustl ist Schauspieler, aber vor allem Regisseur und Schreiber bei Millowitsch. Wie durch ein Wunder hat der Bombenhagel das Haus in der Aachener Straße fast verschont. Bloß im Augenblick pfeifen es die Spatzen von den Dächern: dass die Millowitschs nicht mehr weiterkönnen. Sie werden zum nächsten Ersten ihren Laden zumachen müssen, und damit sind Gustl und ich arbeitslos. Dabei gibt es keine bessere Zeit fürs Theater. Ich bin felsenfest davon überzeugt! Wenn ich allein daran denke, wie viele Leute zur Traber-Familie auf den Heumarkt gekommen sind! Hoch oben über unseren Köpfen balancierten die tollkühnen Seiltänzer. Die Menschen waren begeistert.
Die Leute wollen staunen und sich beeindrucken lassen. Überall schießen kleine private Bühnen wie Pilze aus den Schuttbergen! Der große Circusbau Williams macht glänzende Geschäfte mit seiner Revue »Rund um die Freude«. Man muss es halt richtig anfangen und nicht bloß Geschichten von gestern erzählen. Von verklemmten Grafen, die kleinen Dienstmädchen unter die Kittelschürze greifen. Nach meiner Überzeugung ist es dringend nötig, gerade den kleinen Leuten eine andere Welt zu zeigen. Eine friedliche, bunte und vor allem gerechtere Welt. Nicht eine rückwärtsgewandte Welt, in der die, die schon immer was hatten, alles behalten dürfen und die anderen auf Almosen warten oder für kostenlose Arbeit die Treppe runterfallen … Schon meine Lehrerin in der Schule wusste: Ich bin kommunistisch verseucht.
Ecke Aachener Straße/Ringe, vorbei an der Moritz-Oper, von der in den Sternen steht, ob und wann sie wieder aufgebaut werden kann, steigen wir in die Tram. Auf dem Perrong steht niemand mehr, aber der Schaffner weiß, dass wir wie jeden Abend mitfahren wollen, und wartet auf uns.
Es gibt Leute, die sagen, sie wird gar nicht wieder instand gesetzt, die Oper, obwohl sie gar nicht so sehr kaputtgegangen ist. Ein modernes Theater soll an anderer Stelle errichtet werden. Als Zeichen für das Neue. Für den Aufbruch in eine hellere Welt. Solange ist das Stadttheater in der Aula der Universität untergebracht, und eine kleine Kammerbühne hat im Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring eröffnet. Bis die ein richtiges neues Theater gebaut haben, kann ich nicht warten. Für mich klingt das wie Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir wissen doch alle, wie lange diese Stadt allein für den Dom gebraucht hat.
Selbst ist die Frau. Wir heißen nicht umsonst »Herr«!
Mama hat vorgemacht, wie eine Frau Herr allein durchkommt, ohne Beruf mit drei kleinen Kindern, nachdem sie Papa eingesperrt hatten. Was wäre ihr anderes übrig geblieben? Das dritte Kind, also genau genommen: ich, hätte nach ihrem Geschmack wirklich nicht auf die Welt kommen müssen. Papa Rudolf hatte einen kleinen Rudolf und Mama Agnes eine kleine Agnes. Eine Gertrud hätte sie nicht mehr unbedingt gebraucht, aber Frauen sind die Letzten, die da gefragt werden. Und dann war ich auch noch ein Sieben-Monats-Kind, klein, dünn, dauernd krank – nichts als Ärger.
Unser Bruder Rudolf hat es inzwischen zu etwas gebracht und eine eigene Familie gegründet. Meine große Schwester hat eine Spedition, eine Tochter und einen Lebensgefährten. Lkw-Fahrerin war eine ungewöhnliche Idee. Sie hat schon mit neunzehn den entsprechenden Führerschein gemacht und in Daun in der Eifel angefangen, Sand und Kies für den Autobahnbau zu fahren. Als »Herr Agnes« statt Agnes Herr ist sie später von der Wehrmacht eingezogen worden, um in Frankreich Straßen für die Infanterie zu räumen. Als sie mit dickem Bauch zurückkam, um ihr Baby daheim in Köln zu kriegen, hat sie gleich wieder Arbeit bei Ford gehabt.
Während der letzten Bombenangriffe ist ihr auf dem Ford-Gelände der erste Lkw »zugelaufen«. Damit konnte sie ihre Spedition aufmachen, denn in einer Stadt muss ständig etwas an einen anderen Ort transportiert werden als den, wo es gerade ist. Milch muss in die Molkerei gefahren, Flüchtlinge müssen aus der Stadt gebracht, die heil gebliebenen Steine aus den Trümmerbergen zu den Baustellen gefahren werden. Agi ist sehr tüchtig. Inzwischen hat sie sogar für Papa Arbeit und einen zweiten Laster. Du musst erfinderisch sein und furchtlos, niemand baut einer Frau eine goldene Brücke, außer vielleicht die in einen Käfig. Fehlt also in unserer Familie nur noch meine glänzende Karriere.
Ich werde ein eigenes Theater aufmachen. Ein Theater für die einfachen Leute. Ein reformiertes Volkstheater, und ich werde das schaffen. Hermann Hesse, Mamas Lieblingsschriftsteller, sagt: »Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich.« Damit kommen wir klar, wir Herrs, das sind wir gewohnt.
Die Straßenbahn fährt links den Ring herunter, an der Hahnentorburg und immer noch endlosen Trümmerhaufen vorbei, Ehrenpforte, weiter Richtung Rhein. Dunkel ragen rechts und links unseres Weges Häuserruinen in den Himmel wie hohle Backenzähne und haben so rein gar nichts mit der lieblichen Köln-Silhouette zu tun, die auf der Theaterbühne zu sehen ist. Dieser Geruch nach nassem Putz, nach Kalk, nach zerbröselten Ziegeln ist so allgegenwärtig wie der Brandgeruch. Überall gibt es offene Feuerstellen.
Immerhin fährt die Bahn wieder fast in der ganzen Stadt. Brücken gibt es auch wieder, so richtige aus Stein, nicht wie der alte provisorische »Tausendfüßler« in Deutz. Agi erzählt noch immer, wie die Brücke in den letzten Kriegstagen direkt hinter ihr in den Rhein gestürzt ist, als sie das rettende Deutz gerade erreicht hatte. Eine Menge Fahrzeuge hinter ihr sind in den Fluten untergegangen.
Am Ende des Ringes unmittelbar an der Bastei steht die imposante »Patton-Brücke«, benannt nach dem General der Amerikaner, Patton, obwohl die britischen Besatzer sie gebaut haben. Die erste feste Brücke nach dem Krieg, die hoch genug war, um den Schiffsverkehr durchzulassen. Sogar die Hohenzollernbrücke ist inzwischen befahrbar, obwohl sie immer noch streiten, ob man den Bahnhof nicht besser woandershin verlegen sollte, denn auch der scheint nicht an dem Ort zu sein, wo er sein sollte. Möglicherweise wird das ein neues Betätigungsfeld für Agi – Baumaterial in der Stadt an den richtigen Ort bringen, darin ist sie der Profi. Zum Glück spricht keiner mehr davon, gleich die ganze Stadt abzureißen.
In Nippes haben wir Wohnraum zugewiesen bekommen als Wiedergutmachung, weil unser Vater Kommunist ist und gleich 1933 ins KZ gesteckt wurde. Zusammen mit anderen Kommunisten und den wenigen Juden, die überlebt haben, wohnen wir jetzt recht ordentlich in der Mauenheimer Straße 62. Papa haben sie 1945 wieder rausgelassen, aber es ist schwer, mit ihm auszukommen, er will alles bestimmen, daran können wir uns nicht gewöhnen.
Wir haben jetzt sogar Strom und Gas, keine Petroleumleuchten mehr, aber wir sind die Enge nicht gewohnt, so mitten in der Stadt. Eigentlich waren wir auf der »Insel« in der Nähe der chemischen Kalkfabrik zu Hause, unser Papa war dort Lokführer. Auf der schäl Sick im Niemandsland zwischen Mülheim, Deutz und Kalk, wo es nichts gab bis auf die paar Arbeiterhäuser, die alle die »Insel« nannten. Hier gab es keine Nazis, nur Kommunisten, bis auf die Friseurfamilie, erzählt Agi gern. Ich war zu klein, um davon etwas zu verstehen.
In der Nähe der Insel wuchs zu Beginn der dreißiger Jahre bereits die »Weiße Stadt« im Buchforst heran, eine neue, moderne Siedlung, die ein junger Architekt namens Riphahn baute und die das Ende unseres Inseldaseins besiegeln sollte. Doch so weit war es da noch nicht. Papa wurde arbeitslos, und wir hatten zwar im Sommer keine Schuhe, aber unendlich viel Platz und Freiheit. Brachen, Wäldchen, ein Kiesloch zum Schwimmen mit lauter Kaulquappen drin und Richtung Mülheim den Strunder Bach. Und wir hatten Bücher.
Hesse sei genauso eigensinnig wie Mama, sagte Papa immer. Ihm komme es manchmal so vor, als schreibe der nur für sie.
»Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus eigenem Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte«, sagt Hesse, und wir finden das auch.
Dann haben sie Papa abgeholt, ich war sechs Jahre alt, und die nächsten zehn Jahre mussten wir uns allein durchschlagen. Nachdem wir ausgebombt waren, hat uns Agi mit ihrem Lkw nach Hessen gebracht, wo Opa und Oma wohnen. Die Leute in Nippes hocken so eng aufeinander, dass sie sich gegenseitig in den Suppentopf gucken können. Was sie auch sehr gerne tun!
Seit man in die Stadt zurückkehren darf, sind von überallher nicht nur die Kölner zurückgekommen, sondern jede Menge Flüchtlinge aus dem Osten, »Rucksackdeutsche«. Blasse, halb verhungerte Gestalten, die in Baracken wohnen, wenn sie Glück haben. Dreißigtausend Menschen hausen immer noch in Kellern, schreiben sie in der Zeitung. Besonders gern werden die nicht gesehen, die Flüchtlinge mit ihren slawischen Wangenknochen und den großen Ohren. Sie klauen, heißt es überall, sind verlaust und sprechen seltsames Deutsch. Man versteht kein Wort, wenn die sich unterhalten. Wir haben ja nicht mal genug Wohnraum für die Kölner, wie sollen da die ganzen Vertriebenen noch unterkommen? Wo sollen die Arbeit finden, wenn die keiner versteht?
Um sich ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen in Nippes, baut Mama im Hof Kappes an. Und hält ein paar Hühner. Und jetzt ein Schwein, unser Silvesterschwein Max. Das gefällt auch nicht jedem, aber es ist ihr egal. Was scheren sie andere Leute? Wenn sie die Hühner füttert, trällert sie die »Königin der Nacht«, und das Federvieh antwortet gackernd und gurrend, als kenne es die Partitur. Mama liebt die Oper. Sie ist überglücklich, dass es wieder Vorstellungen gibt, und spart eisern auf ein Billett.
»Die eine Hälfte des Menschen will fressen, saufen, morden und dergleichen einfache Dinge, die andere will denken, Mozart hören und so weiter«, zitiert Mama ihren Lieblingsschriftsteller.
Wir sind inzwischen ausgestiegen. Vor uns auf der Mauenheimer Straße huscht eine Ratte davon. Es gibt nicht mehr viele von ihnen. Im Hungerwinter sind die meisten im Kochpott gelandet, erzählen sich die Leute. Ich war zu der Zeit als Statistin mit der Wanderbühne »Hinterm Vorhang« in der Eifel unterwegs, und wir wurden oft in Naturalien ausgezahlt, was gar nicht so schlecht war. Man wurde einmal am Tag sicher satt. Aber zu rauchen gab es wenig. Was ich mir heute von meiner Gage kaufen werde, weiß ich genau … Außerdem platze ich vor Neugier, was er sagen wird, der Gustl, zu unserem Theater in der Ottostraße 32.
2
Am 26. Februar 1950 ist Premiere für das erste Abendstück auf unserer kleinen »Kölner Lustspielbühne« im Hinterhof der Ehrenfelder Kohlenhandlung, denn wir haben es wirklich gewagt. Bis jetzt haben wir nur Märchen für Kinder gespielt, aber damit verdient man zu wenig. Wir haben unseren Oberbürgermeister und den Bezirksbürgermeister eingeladen, beide lassen sich entschuldigen und wünschen uns alles Gute! Sie beglückwünschen unsere »Notgemeinschaft arbeitsloser Künstler«, die natürlich nur aus Gustl und mir besteht, aber das wissen sie ja nicht. Sie loben uns, dass wir Verantwortung übernehmen und uns selbst aus der Arbeitslosigkeit befreien. Salbungsvolle Worte haben »solche« immer in der Hosentasche.
»Worte, Worte, keine Taten, immer Soße, keinen Braten!«, um den guten alten Heinrich Heine diesmal zu bemühen.
Nicht nur Bürgermeister haben gerade eine Menge zu tun. Auch viele andere Leute sind offenbar stark beschäftigt, denn es kommen ganze vierundzwanzig Zuschauer zu unserer Premiere, die meisten sind Freunde, Familie und damit Gäste. So ergibt sich brutto eine Einnahme von achtzehn Mark. Die zweite Vorstellung ist noch schlimmer. Vielleicht liegt es am kalten Winter. Schon im Dezember lag jede Menge Schnee in der Stadt, und die zugeteilten Briketts reichen hinten und vorn nicht.
Am 8. März 1950 muss Gustl einen demütigenden Bettelbrief an den Bürgermeister Görlinger schreiben, weil wir schon jetzt nicht mehr weiterwissen. Wir haben zwei fürchterliche Pleiten erlitten, schreibt er, und bitten dringend um Hilfe.
Bürgermeister Görlinger erreicht für uns eine private Spende des Oberbürgermeisters Dr. Schwering über zweihundert Mark, die wir auch in Empfang nehmen dürfen, aber sie rettet uns nicht mehr. Über eine Art Notbudget für künstlerische Unternehmungen verfüge er zu seinem Bedauern nicht.
»In unserer Eigenschaft als alleinige Geschäftsführer der Notgemeinschaft arbeitsloser Künstler beantragen wir hiermit die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Kölner Lustspielbühne, Ottostraße 32 in Köln Ehrenfeld, Telefon 0221 73046. Gertrud Herr und Gustav Schellhardt.«
Vermögen? Die sind gut. Wenn da Vermögen wäre, müssten wir keinen Konkurs anmelden. Leider sind nur Schulden übrig. Ich könnte heulen, denn es ist nicht fair. Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen! Ein allererstes »Auswärts«-Gastspiel haben wir gemacht, in Brauweiler. Es hilft nichts – aus ist der Traum.
»Ach Gustlchen, es tut mir so leid, dass du dich jetzt als Nachtportier verdingen musst! Dabei waren wir gut. Und du hast alle diese Bittbriefe geschrieben. Ihr ergebenster Gustav Schellhardt!«
Was hat es genützt? Gar nichts! Wir können die Miete nicht mehr bezahlen.
Wir sitzen – wie so oft – bei uns zu Hause in der Küche und schmieden neue Pläne. Alle anderen schlafen längst. Mamas altes Büfett in der Küche ist übersät mit Theaterstücken, aufgeschlagenen Büchern, aus denen wir uns gegenseitig vorlesen, und Notizzetteln, auf die wir unsere Einfälle schreiben. Der Pfefferminztee in unseren angeschlagenen Tassen hinterlässt immer neue blassgelbe Ränder auf den Manuskripten – die Zettel mit den meisten kreisrunden Abdrücken weisen auf die interessantesten Ideen hin. Es kann einfach nicht sein, dass dies das Ende unserer künstlerischen Laufbahn sein soll!
Die Eltern machen einen Haufen Geschrei wegen dieser Pleite. Genauer gesagt der Papa. Mama hat ja ein Herz fürs Theater und zusammen mit meinem tüchtigen Schwesterlein Agi all unsere Schulden bezahlt. Natürlich nicht, ohne uns gleich wieder das passende Zitat unter die Nase zu reiben.
»Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.«
Sie liebt diese Weisheiten und will uns damit sagen: »Schluss mit den Flausen, werdet erwachsen und stellt euch dem echten Leben!«
Papa steht ständig mitten in der Nacht vor uns in der Küche wie ein Erzengel im Nachtgewand: Wir würden jetzt auch noch seinen Strom verbrauchen! Er ärgert sich vor allem, weil ich noch keine neue Arbeit habe. Ich soll mich nützlich machen und Geld nach Hause bringen, statt diese Wolkenkuckucksheime vom Theater zusammenzuspinnen. Sobald er sich wieder beruhigt hat, steckt aber auch er uns ein paar Mark zu, er ist ja ein Guter. Mama sagt, er sei nicht mehr derselbe Mann, seit er zurück ist.
Was ihn manchmal so verzweifeln lässt, sind vielleicht auch die Geschichten seiner ehemaligen Genossen, die nach dem Krieg in die neu gegründete Kommunistische Partei Deutschlands eingetreten sind. Durch den Adenauer-Erlass ist diese Partei quasi schon wieder verboten. Wenn du im öffentlichen Dienst bist und in der KPD, wirst du entlassen. Wenn du dagegen klagst, landest du bei dem gleichen Richter, der dich schon vor dem Krieg ins KZ eingesperrt hat. Und dann bekommst du noch zu hören, du hättest ja offenbar aus der Strafe nichts gelernt. Ich verstehe, dass er manchmal ungerecht ist und sein Ärger eigentlich gar nicht uns gilt.
Bei Willy brauche ich nicht vorzusprechen, obwohl ich gehört habe, dass die Millowitschs wieder aufgemacht haben. Lucys Mann, der Josef Haubrich, sitzt im Stadtrat, dennoch tut sich die Stadt auch bei denen schwer, sogenanntes »Amüsiertheater« finanziell zu unterstützen. Die Leute sollen sich langweilen im Theater oder mindestens nichts verstehen, sonst hat ein Theater keine Unterstützung verdient, denkt man sich wohl im Rathaus.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich mir mal den Adenauer zurückwünsche als Oberbürgermeister. Der wusste, dass auch die einfachen Leute für Kunst begeistert werden können, wenn dort ab und zu gelacht werden darf.
Die Millowitschs zeigen jetzt von Montag bis Donnerstag Kinovorstellungen mit »Wochenschau« und allem Drum und Dran und spielen nur noch samstags und sonntags Theater. Vermutlich ist Willy immer noch wütend und findet, dass es mir recht geschieht! Er hatte uns gewarnt, dass so ein Volkstheater nie und nimmer einfach so aus dem Boden gestampft werden kann. Seine Familie hätte damals schließlich auch kein Stockpuppentheater eröffnen dürfen, weil die Winters ja bereits das heutige Hänneschen-Theater in der Stadt betrieben. Man habe Jahre gebraucht und sich am Ende eine Alternative zum Puppentheater ausgedacht, mit richtigen Schauspielern. Und wie oft hätten selbst sie die Miete nicht mehr zahlen können und seien rausgeflogen! Apostelnstraße, Ehrenstraße. Erst als die Stadt ihnen die ehemaligen Coloniasäle in der Aachener Straße überlassen hätte, seien sie so einigermaßen über die Runden gekommen. Es könne sich doch nicht jede Hergelaufene einbilden …!
Ich denke, er fürchtet vor allem unliebsame Konkurrenz.
Wer das Maul so voll nimmt wie die, stolpert halt über die eigene Unterlippe, denkt er sich bestimmt und wird den Teufel tun, mir zu helfen. Gerade deshalb will ich nicht bei ihm zu Kreuze kriechen, niemals!
Papa verlangt jedoch, dass ich mir Arbeit suche. Überall suchen sie Leute, sagt er. Auf der Schildergasse haben jede Menge Verkaufsbuden aufgemacht, die können sicher wen gebrauchen. Und ich hätte doch schon als Bäckereiverkäuferin gearbeitet und als Schreibkraft. Sogar Telefondienst bei der Flak in Merheim habe ich gemacht – da gäbe es genug Berufserfahrung! Dass sie mich nach der Schule als Erstes zu einem Nazi in Stellung geschickt hatten, hat er geflissentlich weggelassen. Ausgerechnet der Kommunist schickt die eigene Tochter als Dienstmädchen zu den Folterknechten!
»Kannst du dir vorstellen, Gustlchen, dass ich in irgendeiner Telefonzentrale versauere? Als Fräulein vom Amt? Wo mich niemand sieht? Oder in einer Würstchenbude? Ich?«
»In der Barberina können sie eine tüchtige Bardame sicher sehr gut brauchen! Es wäre ein extravaganter Arbeitsplatz, und die bezahlen gut. Soll ich da mal fragen?«
Gustl ist ganz angetan von seiner Idee. Klar. Kann er jeden Abend sein Stammlokal besuchen, trifft mich automatisch und kriegt obendrein noch Rabatt oder Getränke frei Haus. So denkt er sich das bestimmt!
Bardame klingt in meinen Ohren sehr viel besser als Telefonistin. Oder Würstchenverkäuferin. Vorübergehend. Vorübergehend als Bardame. Das sollte gehen. Macht sich gut im künstlerischen Lebenslauf. Erst Wanderbühne, dann Millowitsch, dann eigenes Theater, dann Bardame. Ein kurzer Ausflug in die Halbwelt macht mich vielleicht interessant. Sogar sehr »interessangt«, wie die gebildete Kölnerin sagt.
Vorübergehend Bardame.
Wenn einer fragen geht, dann mache ich das selbst. Ich brauche keinen Fürsprecher. Wo kommen wir da hin? Ich überzeuge durch reine Physis, Putzilein! Was meinst du, wie der Millowitsch geguckt hatte, als ich mit lauter mottenzerfressenen Pelzen in seinem Büro aufgekreuzt bin und mit gespreizter Stimme erklärt habe, mein Fach sei das der komischen Alten, und genau so eine brauche er noch. Gut, weiter als bis zum dicken Heinzelmännchen habe ich’s nicht gebracht, aber immerhin.
Die Barberina hieß früher Café Prinzess, ein außergewöhnliches Caféhaus auf der zweiten und dritten Etage direkt über dem Waidmarkt an der Hohen Pforte. Vielleicht sage ich zu Hause einfach nur, dass ich in einem Café arbeiten werde. Gegen ein Café können sie nichts haben. Wenn die rauskriegen, dass es ein Café der besonderen Art ist, wo lauter Herren unter sich sein wollen, dann gibt es bloß Ärger. Dabei ist das für ein blutjunges Pummelchen wie mich vermutlich der sicherste Ort der Stadt. Ich kann jeden Tag ordentlich aufgeputzt zur Arbeit gehen, keiner stört sich dran. Im Gegenteil, es ist dort ganz normal.
Nicht wie in Nippes, wo das ganze Viertel zusammenläuft, wenn du mit gefärbten Haaren über die Straße gehst oder ein Kettchen ums Fußgelenk trägst wie neulich die Agi. Für unsere Nachbarn sind Frauen mit Kettchen am Fuß vermutlich Haremsdamen oder Schlimmeres! Und Agi ist nicht verheiratet! Mit Kind! Stell dir das mal vor!
»Wie Tiere leben sie zusammen«, erzählt der Pastor angewidert in der gesamten Nachbarschaft. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass er sich das dauernd vorstellt. In allen Einzelheiten. Barberina ist eine gute Idee.
Mit tiefschwarz geränderten Augen, aufgemalter Naht an den Nylons, kunstvoll aufgetürmten Haaren und riesigen Ohrringen wie die Königin von Saba klingele ich auf der Hohen Pforte. Jean, der Wirt, öffnet, ich klimpere zweimal mit den Wimpern und habe ab sofort Arbeit. An einer Frau mit Format kommt keiner vorbei …
Seit September 1949 residiert unser Adenauer – als Chef der ganzen Republik – mittlerweile ein Städtchen weiter oben am Rhein, in Bonn. Der richtige Rosenmontagszug ist in diesem Jahr das erste Mal wieder gegangen, und alle tun so, als wäre nichts gewesen.
»Wir sind wieder da und tun, was wir können«, hieß das Motto. Die Nazis sind wieder da? »Welche Nazis? Bei uns gab es keine Nazis. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien!«, hört man. Und basta. So einfach ist das. Diesen neuen Karnevalsschlager haben sie letzte Woche beim Radrennen im Stadion gespielt, und die Besatzungssoldaten haben salutiert. Adenauer ist fast in Ohnmacht gefallen, aber wir haben ja noch keine Nationalhymne. Die alte geht nicht mehr. Und die »Wacht am Rhein« kam für die Belgier auch nicht in Frage, weil sie der Deckname für die deutsche Ardennenoffensive war. Da haben sie lieber Karl Berbuer salutiert, dem Erfinder des lustigen Schlagers. Damit war man fein raus, aus dem Schützengraben.
Paragraf hundertfünfundsiebzig ist allerdings noch genauso in Kraft wie bei den Nazis. Nur dass die Homosexuellen nicht mehr vergast werden. Immerhin. Kriminell sind sie schon noch. Die meisten von ihnen legen deshalb allergrößten Wert darauf, bloß nicht aufzufallen, und kleiden sich äußerst bürgerlich.
Jeder in der Stadt weiß, dass es im Polizeipräsidium Listen der Lokale gibt, wo die »wohltemperierten Leute« sich treffen. Sie stammen noch von damals. Die Listen, nicht die Leute, und wie durch ein Wunder haben die Listen den Bombenhagel überstanden.
Deshalb hat die Barberina wie alle anderen einschlägigen Nachtbars außen eine Klingel. Wenn die Polizei kontrollieren kommt, haben wir Zeit, unsere Gäste zu warnen.
Als Mama und Agi erfahren, wo ich wirklich arbeite, ist es mit ihrer Großzügigkeit schlagartig vorbei. Gustl verteidigt mich wie immer. »Soll ihr Talent an einem Putzeimer verkümmern?« Aber diesmal fruchten seine Worte nicht.
»Wenn ihr Talent nur nicht in der Barberina verkümmert!«, schleudert Agi zurück und schämt sich zutiefst für mich. Das schmerzt. Meine unkonventionelle, starke Schwester und meine freigeistige Mutter halten eine Schwulenbar für einen Ort schlimmster Verderbtheit. Für den Eingang zur Hölle, an die sie als Atheisten nicht mal glauben. Ob sie wissen, dass es Gustls Stammlokal ist?
Er hat zum Glück für uns eine nette alte Dame auf der Lohsestraße kennengelernt, die allein in ihrem Häuschen lebt. Sie braucht Hilfe bei der einen oder anderen Arbeit rund ums Haus und vermietet uns im Gegenzug zwei möblierte Zimmer und eine kleine Kochküche für sehr kleines Geld. Für sie sind wir ein Paar, der Gustl und ich, und obwohl wir nicht verheiratet sind, lässt sie uns bei sich wohnen. Zu Hause bin ich fürs Erste achtkantig rausgeflogen.
Die Sache mit der Moral ist ungleichmäßig verteilt, nach welchem Muster, das werde ich wohl nie kapieren. Schwule sind Verbrecher, alte Nazis aber ganz normal. Gut, für unsere Familie nicht. Wir riechen Nazis – drei Meilen gegen den Wind. Aber für den Rest der Leute.
Hat Hesse denn keine Weisheit zum Thema Liebe unter Männern? Wenn ein vom Leben fast totgeschlagenes, geistig minderbemitteltes Mädchen des fünffachen Giftmordes überführt wird wie im letzten Jahr diese Irmgard Swinka, dann stürzt sich die ganze Stadt sensationslüstern auf das »Ungeheuer mit dem gefährlichen Zug um den Mund«. Hoho!
Die Gerichtsdiener werden der Menschenmassen überhaupt nicht mehr Herr! Alle wollen sehen, wie ihr Todesurteil verhängt wird, um sich mal so richtig zu gruseln. Hämisch berichten die neuen Zeitungen, wie fett die Bestie offenbar in der Haft geworden ist, wie gut dem Monster das Gefängnisessen geschmeckt hat. Und für mich schämt sich meine Familie? Weil ich in einer Nachtbar für Schwule süßen Wein ausschenke? Hier stimmt was nicht.
Am 7. Mai 1949 wurde vom Kölner Landgericht das Todesurteil gesprochen – mittels Fallbeil zu vollstrecken im Klingelpütz. Ja, im Klingelpütz, genau an der Stelle, wo sie bis vor ein paar Jahren noch Kommunisten und Juden vom Leben zum Tode befördert haben, aber die Swinka hat Glück. Zwei Wochen nach dem Urteil schafft unsere junge Republik die Todesstrafe ab, und sie wird in ihrem Fall in lebenslanges Zuchthaus umgewandelt. Die Enttäuschung unserer Mitmenschen war enorm.
Sie hatte für Lebensmittelkarten, Strickjacken und Zigaretten gemordet, das arme Mensch, aber das will keiner wissen! Ich bin nicht sicher, ob wir Theaterleute wirklich genug werden spielen können, um ein für alle Mal andere Gedanken in diese brutalen deutschen Stahlhelm-Köpfe zu pflanzen.
In die gehässigen Zaungäste.
In die, die ihre Hände in Unschuld waschen, aber jeden anschwärzen, der nicht ins Raster passt.
In die, die die Enthauptung des Schinderhannes immer wieder sehen wollen! Wenn ich nur schon wüsste, wo ich Theater spielen könnte!
Im Augenblick spiele ich Bardame und passe gut auf, wie unsere Kundschaft das eigentlich macht. Das mit dem äußeren Bild und dem inneren Bild eines Menschen, das mit den zwei Leben, das mit der Geheimnistuerei. Wie sie klarkommt mit der Welt da draußen, mit der Doppelmoral, mit dem kleinkarierten Bürgerlein, das dir das Leben ganz schön sauer machen kann.
Da kann ich viel lernen. Und vor allem viel lachen mit den Gästen der Barberina, denn ohne Humor und eine ordentliche Portion Selbstironie kommst du als Schwuler keinen Schritt weit. Das haben sie drauf. Ständig Witze auf eigene Kosten reißen. Und sehr gern sehr derbe Witze. Sie machen sich lieber selbst lächerlich, ehe ein anderer über sie herzieht. Das ist kein schlechtes Modell. Das kann man sich abgucken. Es macht einen deutlich gelassener und weniger verletzlich.
Und sie haben nichts gegen dicke Frauen. Wenn du selber einen Makel hast, bist du auch bei anderen etwas nachsichtiger. Alle lieben mich, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Leider werde ich dort den Mann meines Herzens nicht kennenlernen. Ich bin immer noch allein, und wenn ich ehrlich bin, kriege ich manchmal Angst, allein zu bleiben. Ich werde bald sechsundzwanzig.
Zu Hause fügen sich die Gemüter ins Unvermeidliche. Zumindest schon mal Agi. Sie war gestern tatsächlich mit Gerdheinz da, ihrem Bär, und der hat mit mir ein Tänzchen gewagt. In der Barberina. Der wird doch am Ende kein Bigamist sein, wo er schon vom Trauschein so lange nichts hielt …? Auch die Eltern sagen irgendwann nichts mehr. Ich gehe arbeiten, ich verdiene Geld, und wie es weitergeht, weiß ich nicht.
3
Manchmal braucht es einfach einen entschlossenen Sprung in die Tiefe, denke ich, als ich in der »Wochenschau« Bekanntschaft mit einer vollschlanken Elefantendame namens Tuffi mache. Sie hatte ein geregeltes Leben als Werbefachfrau beim Zirkus Althoff. Weil sie sich vor nichts fürchtete, weder vor Menschen noch vor unbekannten Herausforderungen, erhielt sie vielfältige Aufgabengebiete.
Sie ging im ersten Rosenmontagszug mit. Sie fuhr werbewirksam in Straßenbahnen. Sie soff geweihtes Wasser in Altötting, mutierte zu einem »Brauerei-Elefanten« in Solingen und ging auf Hafenrundfahrt in Deutschlands größtem Binnenhafen. Bei einem Besuch im Rathaus von Oberhausen nahm sie einen Blumenstrauß zum Frühstück und pinkelte auf Oberbürgermeisters Perserteppich. Sie ist einfach eine Wucht, und die Zirkuskasse der Althoffs klingelt dank ihres vielseitigen Einsatzes.
Doch jetzt ist ihr trotz umfänglicher Arbeitsmoral von den Menschen nur wenig Respekt entgegengebracht worden. Man löste vier Fahrkarten für sie, um mit dem Tier Wuppertaler Schwebebahn zu fahren und während dieser Reise auf ein Gastspiel des Zirkus hinzuweisen. Leider beachteten ihre Mitreisenden keineswegs, dass sie den Anspruch auf vier Plätze ehrlich erworben hatte. Es wurde ihr im Waggon schon bald zu eng. Sie wurde rücksichtslos bedrängt und geschubst, bis sie schließlich mit verzweifeltem Trompeten durch die Wand des Fahrzeugs brach und direkt in die Wupper sprang.
Es scheint das Schicksal von raumgreifenden Damen zu sein, sich selbst Platz verschaffen zu müssen, und wenn es dafür zehn Meter in die Tiefe geht. Zum Glück hat Tuffi bei ihrem Befreiungsversuch bis auf ein paar Schrammen am Hintern keinen Schaden davongetragen; die Wupper war an ihrem Landeplatz keine fünfzig Zentimeter tief.
Wohin wage ich den entschlossenen Sprung? Und wird das auch so glimpflich verlaufen? Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. In der Barberina spielt unser Pianist Zehnpfennig, den alle nur den »Groschen« nennen, für mich ein Lied von Zarah Leander und überredet mich, es in der Bar zu singen. Alle Gäste applaudieren begeistert. Das ist schön, nach so langer Zeit mal wieder Applaus. Vielleicht könnte ich Sängerin werden? Wie macht man das?
Wir wollen an diesem letzten Sonntag im Januar 1953 mit der ganzen Familie zusammen fernsehen, weil das jetzt der letzte Schrei ist und ich sonntags freihabe. Wo sind die letzten drei Jahre geblieben? Ich arbeite nachts und schlafe am Tag, das Leben rauscht irgendwo da draußen an mir vorbei.
Agis Spedition läuft prima, sie ist inzwischen verheiratet und hat sich mit ihrem Bär einen Fernsehapparat gekauft, einen Grundig Zauberspiegel. Wer hat, der hat! Begeistert hat sie mir vom Silvesterprogramm erzählt, wo der kleine Affe Petermann aus dem Kölner Zoo mit Frack, Zigarre und Sektglas auf das neue Jahr angestoßen hat.
Das niedliche Affenkind ist zurzeit die größte Attraktion der Stadt. Es kann Motorrad fahren, mit Messer und Gabel essen, und heute soll es wieder einen Fernsehauftritt haben. Da wir keine Schwebebahn mehr haben, sondern diese großartige Idee unseres Zuckerwerks nach Wuppertal verscherbelt wurde, wird unser Äffchen nicht im öffentlichen Personennahverkehr, sondern mit Uniform und Narrenkappe auf der Karnevalssitzung erwartet, die im Fernsehen übertragen wird.
Und tatsächlich führt sein Pfleger das Tierchen mit Tusch und Alaaf herein. Vielleicht könnte ich irgendwo als niedliches Äffchen anfangen und den ganzen Tag Bananen futtern. Ich denke, das würde ich hinkriegen.
Der Saal tobt. Der gesamte Kölner Adel, die Haute Volaute unserer rheinischen Metropole, sitzt im festlich geschmückten Saal, mit Frack, Orden und allem, was dazugehört. Die Herren Kommerzienräte saufen Sekt, schmauchen Zigarren und haben teure Eintritte bezahlt, als gäbe es kein Gestern, während ihre Damen auf etepetete machen, das ist urkomisch!
Wir sind wieder wer. Wer, wollen wir lieber nicht genau wissen. Hauptsache, wichtig, was die Herren angeht. Hauptsache, rausgeputzt und gehorsam, wenn du der Damenwelt angehörst. Dass diese Frauen völlig ohne Männer vor wenigen Jahren den ganzen Laden allein geschmissen haben, sieht man ihnen unter ihren seltsamen Frisuren nicht mehr an.
Was auf der Bühne an Reden und Liedern präsentiert wird, zieht sich dagegen wie alte Rahmkamelle. Nach der zweiten todlangweiligen Büttenrede steige ich auf den Couchtisch, hebe drohend den Zeigefinger und kreische launig in die Familienrunde: »Ein heiterer Abend wird das heute aber nicht!« Alle lachen los.
Ich soll recht behalten, zum Abgewöhnen ist so eine Sitzung mit jeder Menge preußischem Tschingderassassa, zu dem die Zuschauer im Takt klatschen. Wir sind kolossal überrascht! Wir haben alle noch nie eine Karnevalssitzung gesehen, niemand von uns hätte je das Geld gehabt, teure Eintrittskarten zu kaufen, die Eltern schon gar nicht. Wir haben ja gar nicht gewusst, was sich da abspielt! Ich hatte mir die Sache ungefähr so vorgestellt wie einen Abend in der Barberina. Alle schlagen vergnügt über die Stränge! Aber weit gefehlt.
»Hömma, Tutti!«, sagt die geschäftstüchtige Agi zu mir, als sie den Mund wieder zukriegt. »Das kannst du viel besser! Und wenn ich mir diese Gäste angucke, ist da jede Menge Kohle zu verdienen, du musst in die Bütt!«
Kein Wunder, dass sie so erfolgreich ist, sie hat einfach immer ein Näschen dafür, wo sich Geld verdienen lässt. Gibt es das überhaupt? Frauen in der Bütt? Will ich denn in die Bütt? Ich bin doch so klein – mich sieht hinter einer großen Bütt keiner mehr.
Aber natürlich kann Tutti das besser als die. Wenn es einen gibt, der weiß, ob es schon mal eine Frau in der Bütt gab, dann ist es Gustl. Und klar weiß er das!
»Gerti Ransohoff war eine bekannte Büttenrednerin in den zwanziger Jahren, aber sie hat sich umgebracht«, erklärt er. »Nachdem sich ihr jüdischer Mann das Leben genommen hatte, Anfang der Dreißiger, ist sie ihm gefolgt und im Severinsklösterchen an Gift gestorben. Sie hat einen Haufen Büttenreden vorgetragen, im Gürzenich, in der Wolkenburg, in der Flora und im alten Kaiserhof in der Salomonsgasse. Büttenreden, die der bekannte Karnevalist Hans Tobar geschrieben hatte, bevor er nach Amerika ausgewandert ist. Hans Tobar wieder war gut mit Willi Ostermann befreundet.«
Der Journalist Hans Schmitt-Rost hat ihm das alles erzählt, der war oft dabei. Gustl kennt ihn von den sogenannten Lumpenbällen vor dem Krieg. Die waren wohl eher so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte mit dem Sitzungskarneval. Gerti Ransohoff war also die erste Frau in einer Bütt, und der Kölner Stadt-Anzeiger war damals begeistert.
Ich bewundere wie so oft, was für Leute der Gustl alles kennt! Er ist ein richtiger Künstler und so klug!
»Aber das weiß keiner mehr«, sagt er im Brustton der Überzeugung. »Wir machen aus dir die erste Frau in der Bütt. Das ist die beste Reklame, die man sich vorstellen kann, und wenn doch einer fragt, dann sagen wir: Nach dem Krieg, die erste Frau in der Bütt nach dem Krieg meinen wir!«
Wie das mit der Reklame für eine Künstlerin geht, weiß der Gustl viel besser als ich. Ich fühle mich für einen Moment fast so wie Tuffi statt Tutti und suche nach dem Ausstieg aus der offenbar schon fahrenden Bahn. War denn schon sicher, dass ich in die Bütt will? Sind die Fahrkarten für mich schon gekauft? Zusammen mit Gustl und Thomas Maraun aus der dritten Etage in der Mauenheimer Straße tüftele ich nächtelang an einer Büttenrede. An einer Figur, die diese Rede vortragen soll. An einem Thema. Gar nicht so einfach. Was könnte ich denn für ein Thema nehmen?
Thomas wohnt seit der Zeit, als wir uns auf der Wanderbühne »Hinterm Vorhang« kennengelernt haben, auch in der Mauenheimer Straße.
Was haben wir beide die Kollegen von der Wanderbühne oft hereingelegt und ihnen herrliche Streiche gespielt! Oft wurden wir zu Strafzahlungen verdonnert, zum Beispiel, weil wir jeden Abend der Hauptdarstellerin eine andere Ungeheuerlichkeit ins Schmuckkästchen gelegt haben, das sie huldvoll zu öffnen hatte. Bloß – statt auf ein glitzerndes Geschmeide blickte sie mal auf eine tote Maus, mal auf einen Regenwurm, auf eine alte Socke oder auf ein Kondom … Thomas ist der lustigste Mensch, den ich kenne. Ein Possenreißer, wie er im Buche steht. Er weiß genau, welcher Witz funktioniert und welcher nicht.
Gustl und ich feilen sorgfältig an meiner »Figur«, wie der Gustl sagt. Wenn er nicht da ist, feile ich eifrig allein an derselben, mit Buttercreme, Reibekuchen und Kartoffelsalat – es ist schließlich meine Figur, und niemand soll mir nachsagen können, ich hätte mich nicht genug um sie gekümmert.
Thomas ist unser Publikum. Wenn der lacht, bleibt der Witz drin. Wenn nicht, ist er schlecht, der Witz, und wir müssen uns einen neuen ausdenken. Außerdem hat er die Hochschule der kölschen Sprache besucht, denn sein Vater arbeitete in den Markthallen am Heumarkt. Der kennt Wörter, die habe selbst ich noch nie gehört.
Es stellt sich nach einiger Zeit heraus, dass mir das dicke Döfchen am besten liegt, die Stadtrandpomeranze, die nicht auf den Mund gefallen ist und Unsicherheit immer mit Krawall quittiert.
Weiß auch nicht, wie wir gerade auf so eine gekommen sind …
Ich habe einen Hang zur unfreiwilligen Komik, sagt meine Familie. Schon beim Krippenspiel in der Volksschule sind die Leute vom Stuhl gefallen vor Lachen, nur weil ich mit heiligem Ernst im ersten Schuljahr lauthals deklamierte:
»Drum soll im rauen Krippelein das liebe heil’ge Kind auch meines Lebens Freude sein, bis mich der Tod einst find’.«
Ich bin oft überrascht, warum lustig ist, was ich mache, aber Thomas weiß, dass …