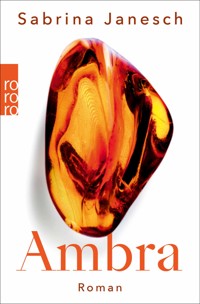
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Danzig hat wieder eine deutsche literarische Stimme.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Ein Roman über die seelischen Verletzungen einer Familie, die mit der schmerzvollen Geschichte einer Stadt korrespondieren. Der Herbstwind rast durch die Backsteinfluchten, als Kinga Mischa in der fernen Stadt am Meer ankommt. Hier in Danzig trifft sie nach dem Tod ihres Vaters auf ihre polnische Verwandtschaft. Im Gepäck ein Bernstein, in dem eine Spinne gefangen ist. Sie ahnt bereits, dass der Träger dieses Steins nicht bloß das Schmuckstück, sondern auch eine seherische Gabe geerbt hat: eine faszinierende wie dunkle Fähigkeit, die für Kinga zunehmend zur Qual wird. Denn als plötzlich zwei Menschen verschwinden, die ihr sehr nahestanden, gerät sie in Verdacht, ihre Kräfte auf grausame Art angewandt zu haben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sabrina Janesch
Ambra
Roman
Über dieses Buch
«Denn in dieser Stadt hat jeder ein Geheimnis und jeder ein Schweigen, das er darüberlegt.»
Der Herbstwind rast durch die Backsteinfluchten, als Kinga Mischa in der fernen Stadt am Meer ankommt. Hier in Danzig trifft sie nach dem Tod ihres Vaters auf die polnische Verwandtschaft. Im Gepäck ein Bernstein, in dem eine Spinne gefangen ist. Sie ahnt bereits, dass der Träger dieses Steins nicht bloß das Schmuckstück, sondern auch eine seherische Gabe geerbt hat: eine faszinierende wie dunkle Fähigkeit, die für Kinga zunehmend zur Qual wird. Denn als plötzlich zwei Menschen verschwinden, die ihr sehr nahestanden, gerät sie in Verdacht, ihre Kräfte auf grausame Art angewandt zu haben …
Ein beeindruckender poetischer Roman über die seelischen Wunden einer Familie, die mit der schmerzvollen Historie der Stadt Danzig korrespondieren.
«Danzig hat wieder eine deutsche literarische Stimme.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Sabrina Janesch vollbringt das Kunststück, ihre Stoffe auszugraben und wieder zum Leben zu erwecken.»
Süddeutsche Zeitung
«Ihr Erzählstoff hat mächtige Spannung und Kraft.»
Der Spiegel
«Sabrina Janesch erzählt mit hoher sprachlicher Sensibilität und poetischer Dichte.»
Hans-Ulrich Treichel
Vita
Sabrina Janesch, geboren 1985 in Niedersachsen, studierte Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. 2010 erschien ihr Romandebüt «Katzenberge», das u.a. mit dem Mara-Cassens-Preis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde. Über ihren Roman «Die goldene Stadt» (2017), der zum Bestseller wurde, schrieb Sten Nadolny: «Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht – plastisch, farbig und unvergesslich.» 2023 erscheint ihr neuer Roman «Sibir», für den sie aufwendig recherchierte und bis in ein kasachisches Steppendorf reiste. Sabrina Janesch war Stipendiatin des Ledig House, New York, und Stadtschreiberin von Danzig. Sie lebt mit ihrer Familie in Münster.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG.
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert vom Deutschen Kulturforum östliches Europa in Zusammenarbeit mit der Stadt Danzig, vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, vom Stuttgarter Schriftstellerhaus, vom Literarischen Colloquium Berlin sowie dem Ledig House, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Illustrationen im Innenteil Catharina Westphal
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Alex Shadrin/Adobe Stock
ISBN 978-3-644-01694-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Benjamin
Der Morgen
Es ist der Westwind. Im Morgengrauen zieht er vom Meer herüber in die Stadt und bringt den Geruch von Seegras, Meerampfer und Sanddorn in ihre Gassen, dort steigt er auf und vermischt sich mit den Geschichten der Stadt und der Menschen, die in ihr leben und jemals in ihr gelebt haben. Sprachwirbel unterschiedlichster Farbe und unterschiedlichsten Alters greifen hier ineinander, und das, was am Boden geschieht, ist nichts als eine Momentaufnahme des Lebens dieser Stadt, und kaum ist der Moment vergangen, steigt er schon auf und begibt sich unter all das, was vor ihm gewesen ist.
Der Westwind ist es, der über die Ostsee streicht und sich anreichert mit Salz und einer Idee Phosphor, denn seit Jahrzehnten lagern Sprengkörper im Brackwasser, Sand mischt sich bei, der vom Wind immer weiter fortgetragen und vorgelagert wird, gefolgt vom Geruch der alten Mole, in deren Unterbau mehrere Familien von Kormoranen und Lachmöwen leben.
Die Gischt umspült die Pfeiler der Mole, die Boote, die an ihr festgemacht sind, dümpeln knarzend im Wasser und stoßen ihre Rümpfe gegeneinander. Abgerissene Blätter von Salzmiere und Quecke treiben über die Boote hinweg und werden schließlich vom Wind mitgerissen in Richtung Stadt, vorbei an der Werft, wo Schweißer die verrostenden Schiffsteile passieren, die ersten Sonnenstrahlen treffen auf die Kräne.
Möwen stieben auf und teilen sich auf in solche, die ins Wasser des Flusses hinabstoßen und mit jungen Forellen im Schnabel wieder auftauchen, und jene, die wenige hundert Meter weiter nach Süden fliegen und ein paar Schülern auf dem Weg zum Unterricht die mit Rosenmarmelade gefüllten Hefeteilchen aus den Händen reißen, weiter geht es, vorbei am Archiv der Stadt, umweht vom Staub der Jahrhunderte und dem Kölnischwasser der Direktorin, weiter, weiter hinunter bis zum Fluss, dessen Ufer eingehüllt sind in die Dieseldämpfe der Motorboote und den Rauch der Holzbuden, über deren glimmenden Wacholderzweigen Makrelen, Sprotten und Heringe hängen.
Der Atem der Vagabunden, die die Nacht mit einigen Flaschen Wein und einer Gruppe von Schwänen am Ufer verbrachten, mischt sich mit der Brise, außerdem das ranzige Frittierfett der Bars, die sich auf der Promenade drängen, das Helium, das am Vortag beim Aufpusten der Luftballons entströmte und sich mit dem Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte vermengte, das Aroma von Knoblauch, das über den Pfannen der Garküchen schwebte, das Parfum, das sich gelöst hatte von den Hälsen der Frauen, und der Geruch aus hechelnden Hundemäulern.
Jeder Schlag auf jede Trommel und jeder Schrei, jedes zerbrochene Glas und jeder unlautere Gedanke findet Einlass ins Gedächtnis der Stadt, das Minute um Minute angereichert wird vom Wind. Bei Eintritt in die Innenstadt umfängt er die Menschen und umgarnt sie so lange, bis er ihnen ihr Geheimnis entlockt hat, denn in dieser Stadt hat jeder ein Geheimnis und jeder ein Schweigen, das er darüberlegt.
Etwa Frau Biwak, die das Häuschen mit den öffentlichen Toiletten aufsperrt und sich mit ihrem Chihuahua-Welpen an die Stelle setzt, die die Sonne als Erstes ausleuchten wird. Ein paar Moleküle Haarspray und abgestorbene Hautzellen fallen für den Wind dabei ab, er weht sie zwei Straßenzüge weiter, hinüber zu Pan Chong, dem Vietnamesen: Gerade schmeißt er die erste Portion Currynudeln in die Pfanne, bald schon wird sich vor seinem Imbiss eine Reihe von Bus- und Taxifahrern gebildet haben, und alle Gassen, die hinunter zum Herz der Stadt führen, werden widerhallen von tausend Absätzen, die ins Pflaster gestoßen werden.
Der Vorplatz des Theaters ist übersät mit Pfützen, ihr Wasser kräuselt sich und zieht einen Schwarm Tauben an, die auf der nahen Grünfläche übernachtet haben, ein paar Lkw fahren dazu und laden Versatzteile für Buden und Stände aus, ein Markt soll aufgebaut werden. Ein Greis mit Plastiktüte und geleimtem Gehstock bleibt stehen und besieht sich das Treiben, und oben auf dem alten Gefängnisturm paaren sich die Dohlen, es ist ein eiliges Geschäft, aber dafür haben sie von dort den besten Blick auf die dunklen Giebel, die hohen Fenster und die nebelumwobenen Türme der Stadt. Ein Schlüsselbund rasselt, und die Holztüren werden geöffnet beinahe im selben Moment wie die Türen des Theaters gegenüber, wo mittlerweile junge Frauen stehen und den Plan für den Tag besprechen. Die Arbeiter, die wenige Meter entfernt die Stände aufbauen, bemerken sie nur, wenn eine Eisenstange zu Boden fällt und Wasser aufspritzt.
Die erste Polizeistreife des Tages fährt ein paar Meter von ihnen entfernt vorbei und steuert auf die Insel im Fluss zu, ein Biotop, das zum Leben erwacht, wenn die Sonne aufgeht: Die Blüten des Wermuts und der Schafgarbe richten sich nach ihrem Licht aus und bewegen sich im Wind, die Insekten erwachen aus ihrer Starre und dann die Enten und die Tauchhühner und die Angler, die zu allen Tages- und Nachtzeiten zwischen ihnen sitzen und sich nicht regen, ab und zu nur rollt ihr Blick hinüber zu den Ruinen und den Fassaden der alten Speicher, die sich gegen den Wind gelehnt haben und von denen niemand weiß, worauf sie noch warten.
Östlich des Flusses: das kurze Aufheulen des Jaguar-Sportwagens, der sich mehrmals in der Woche durch die Gassen schiebt, vorbei an der ehemaligen Tabakfabrik, meterhohen Bechermalven und der Tierarztpraxis, vorbei am Jugendstilkino und den Garagen, wo Jugendliche kauern, die Inhalte ihrer Rucksäcke besehen und aus den Augenwinkeln das Fahrzeug verfolgen, wie es wieder entschwindet, knapp verfehlt von der Streife.
Die Polizisten starren gelangweilt auf die Jugendlichen, dann fahren sie weiter, es ist noch früh am Morgen, und über ihnen auf den Balkonen wird bereits Wäsche aufgehängt, die an ihrer Schnur leicht hin- und herpendelt im Wind, es riecht nach Waschpulver und dem Putz, der Stück für Stück von den Fassaden bröckelt, im Vorgarten einer Fabrikantenvilla sitzt ein kleiner Junge auf einer Rutsche und reibt sich verschlafen die Augen.
Auf der Schnellstraße hat sich ein Stau gebildet, ein Auto steht quer, so dass die Straßenbahn nicht fahren kann, laut rasselt sie und klingelt. Der Lärm dringt bis hinauf zur Anhöhe hinter den Schlaufen der Schnellstraße, der Westwind fegt nachlässig die Straßen hoch, die zum Wäldchen auf der Kuppe führen, Amseln singen dort gegen die Geräusche der Stadt an, ein Waschbär taumelt schlaftrunken über das Terrain der ehemaligen Polizeikaserne. Ein paar Marder rascheln im Laub vom Vorjahr, unter einer umgestürzten Buche liegt ein Zementsockel, auf dem, wenn er sich erwärmt, mit Vorliebe die alten Kater des Hügels liegen; unweit von ihnen fahren ein paar Züge in den Bahnhof ein, gelbblau und an jedem Wagen ein unfertiges Graffito. Die Züge bleiben stehen, die Passagiere strömen heraus, atmen den kühlen Schatten unter den Überdachungen und durchqueren den Tunnel, vorbei an Blumenverkäuferinnen, Ständen mit Zeitschriften, bunter Unterwäsche, Schuhen in allen Formen und Größen und dem Bettler, der schon seit dem Morgengrauen an seiner Stelle rechts neben der Treppe steht und seinen Bart sorgfältig mit etwas Schuhpolitur zum Glänzen gebracht hat. Ein paar Münzen klingeln in dem Becherchen, das er den Menschen hinhält, jedes Mal verbeugt er sich und sagt, Dank sei Gott in der Höh’, und über ihm in der Höh’ thront das Hauptportal des Bahnhofs mit seinen fein ziselierten Streben, auf denen Spatzen hocken; gierig starren sie hinab, der Wind kitzelt einen von ihnen am Brustflaum und trägt ihn hinüber zu den preußischen Kasernen, lässt ihn über die Figuren im Innenhof des kleinen Zeughauses gleiten; Kunststudenten stehen dort herum, Werkzeuge in ihren Händen, und sehen zu dem versiegten Brunnen, der in der Mitte des kleinen Platzes steht: Über Nacht hat jemand eine Sesselgruppe aufgestellt und einen Tisch und eine Wohnzimmerlampe.
Bald schon beginnt das übliche Hämmern und Pochen, vom letzten bisschen Wind weitergetrieben, längs der Bastionen, längs der Steinschleuse, an ein paar Garagen vorbei, über der Straße ist es nur noch ein laues Lüftchen, das da geht, mühsam schleppt es sich voran, bis es schließlich vor einem blinden Holzfenster in sich zusammenfällt.
1.
Ich stemme mich gegen das Fenster. Splitter der Lackierung bleiben an meinem Handballen haften, aber weiter als einen Spaltbreit lässt es sich nicht öffnen. So oder so liegt das Zimmer im dritten Stock, und wenn ich herausspringe, riskiere ich mindestens ein gebrochenes Bein, und damit komme ich nicht weit. Wenn ich das täte, wäre alles bewiesen, man würde mich für schuldig befinden, noch bevor ich ein Wort gesagt hätte. Also lasse ich vom Schloss ab und hole tief Luft. Da draußen ist die Stadt, hier drinnen bin ich, nur: Wo ist Bartosz?
Vor fünf Tagen war seine Mutter Bronka in meiner Wohnung erschienen, mit dem Zweitschlüssel, von dem ich nicht wusste, dass sie ihn überhaupt besaß, hatte mich in die Küche gedrängt, an den Haaren gezogen und geschrien, dass ich endlich die Wahrheit sagen solle, sagen, was mit Bartosz geschehen sei. Ich hatte den Küchentisch gepackt und zwischen uns geschoben, sie hatte eines der Fleischmesser von der Anrichte genommen, es in die Tischplatte gerammt und gesagt, ich würde nun mit ihr mitkommen, ansonsten würde sie augenblicklich die Polizei rufen, auch die Polizei könne mit mir dieses Gespräch führen, aber das hier sei doch eine Familienangelegenheit, nicht wahr, Kinga, das klären wir unter uns, bei uns zu Hause. Bevor du irgendjemand anderem etwas sagst, sagst du es vorher mir, und zwar alles, von Anfang an.
Ein Mensch kann sich nicht einfach in Luft auflösen, hatte Bronka geschrien, und zwei Menschen auf einmal noch viel weniger. Ich hatte sie gewähren lassen. Ich kann ihr unmöglich schon jetzt von meinem kleinen Problem erzählen, dann, da bin ich mir sicher, würde sie mich ausliefern oder einweisen lassen, und alles nur, weil mein kleines Problem nicht in ihren Kopf hineinpassen würde. Also vorerst kein Wort davon.
Bronka hatte die Tür hinter mir geschlossen und verbarrikadiert, ich nehme an, sie hatte die Riegel an der Tür angebracht, bevor sie zu mir kam und mich abholte, vorher waren doch keine Riegel an der Tür gewesen, wofür denn auch: In Bartosz’ altem Kinderzimmer befinden sich bloß ein paar halbleere Regale, in die Bronka Kunstblumen und Tiere aus Porzellan gestellt hat, auch ein paar Häkeldeckchen finden sich dort und verstaubte Fotos von der Familie, und, natürlich, auf dem Schreibtisch Bartosz’ alter Rechner, den er vorsorglich für seine Besuche bei den Eltern hierhergebracht hatte. Während drüben, im Wohnzimmer, Tee getrunken wurde, konnte hier, am Bildschirm, der Feind zurückgedrängt, in die Enge getrieben und endlich erschossen werden, denn hier herrschte Krieg, und wo Krieg herrscht, ist keine Zeit für Tee.
Unter der Tür sehe ich zwei Schatten hin und her wandern, Bronka steht vor der Tür, ich höre ihr mühsam unterdrücktes Schluchzen. Sie wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um wieder hereinzukommen, vielleicht traut sie sich nicht oder glaubt, noch nicht die richtigen Worte gefunden zu haben. Dabei kann ich sie verstehen. Es handelt sich um ihren einzigen Sohn, seit über fünf Tagen ist er nun verschwunden und seine Freundin Renia obendrein.
Bartosz’ altes Kinderzimmer misst kaum zehn Quadratmeter, das schmale Bett, das in Wirklichkeit ein ausklappbares Sofa ist, passt hinein, dann die Regale, in die der Schreibtisch eingelassen ist, das war’s, mehr nicht. Keine drei Schritte kann ich gehen, ohne an seine Grenzen zu stoßen, das ist kein Zimmer, das ist eine Zelle, in der er aufwachsen musste. Wer wäre da nicht in die Armee eingetreten und hätte sich weit, weit wegschicken lassen, wo die Sonne heiß brennt und der Raum unendlich ist, mit dem bisschen Krieg, musste er gedacht haben, würde er schon fertig werden, der Krieg, so hatte man ihm gesagt, das sei vor allem eine Menge Sand, der sich gerne in die Uniform und hinein in die Unterwäsche stiehlt, in die Fältchen der Genitalien legt und so lange scheuert, bis man wund ist wie ein Baby und sich anstrengen muss, sich nicht andauernd in den Schritt und ins Gesäß zu fassen.
Mein Sohn ist Soldat gewesen, hatte Bronka gesagt, als sie mich ins Zimmer hineingestoßen hatte, er ist zweimal aus der Wüste zurückgekehrt, und jetzt soll er hier, in unserer Stadt, verschwunden sein?
Bronka zittert am ganzen Leib, ihr Gesicht ist aufgequollen. Sie sagt, mein Schweigen würde mich nur noch verdächtiger machen, wer unschuldig ist, müsste doch reden wie ein Wasserfall, nichts zu verbergen habe der und könne sich seiner Sache sicher sein – aber ich? Seit fünf Tagen habe ich mich nicht mehr aus meiner Wohnung herausbewegt und würde den Mund nicht aufbekommen, außer, um zu sagen, was sowieso offensichtlich war, aber das würde niemanden interessieren. Übrigens sei es ebenfalls meine Schuld, dass der Hausarzt Brunon direkt ins Krankenhaus überwiesen habe, nein, nicht wegen seiner Lungen, sondern wegen eines schweren Tobsuchtsanfalls.
Mit dem Handrücken fährt sie sich über die Nase. Ich antworte, dass ich nichts zu verbergen habe, anderenfalls wäre ich doch wohl kaum in der Stadt geblieben, ich wäre nach Brasilien geflohen oder wenigstens in Richtung Deutschland, aber was sollte ich da schon, wenn doch hier mein Zuhause war und meine Familie. Und ich könne doch nichts erfinden, wo nichts gewesen sei! Sicher, ich bin den beiden begegnet, nach dem Törn, aber das war ein Zufall, versichere ich ihr, unsere Wege hatten sich gekreuzt, das war alles, und dann war ich ihnen ein Stückchen gefolgt, und dann waren sie an der Stelle angekommen, unten, bei den Bastionen, und …
Hör auf damit, sagt Bronka. Ihre Stimme klingt jetzt etwas fester.
Hundertmal habe ich das jetzt schon gehört, deswegen habe ich dich nicht hierhergebracht. Ich will alles wissen, jedes Detail, vom Anfang bis zum Ende. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis hast, bitte schön. Hier sind zwei Hefte und ein Stift, da kannst du alles festhalten. Jedes Heft hat mehr als hundert Seiten.
Mehr als hundert Seiten. Mein Kopf schmerzt von Bronkas lauter, aufdringlicher Stimme. Draußen, vor dem Fenster, höre ich Stimmen, ein Hund bellt, kurz erwäge ich, laut um Hilfe zu schreien, dann komme ich mir lächerlich vor und lasse die Stirn in meine Hände sinken. Bronka steht vor mir, die Arme in die Seiten gestemmt, sie riecht nach Schweiß und dem billigen Puder, den sie mehrmals pro Tag auf ihrem Gesicht und ihrem Ausschnitt verteilt. Ihre schlaffen Wangen zittern, sie wartet darauf, dass ich etwas sage, dass ich endlich ihre albernen, mit Blümchen und Marienkäfern verzierten Hefte in die Hand nehme. Entschlossen hält sie sie mir vor die Nase und sagt, ich solle mich ruhig an die Arbeit machen, der Kröger nämlich habe auch schon begonnen und sei bestimmt nicht so zögerlich wie ich, immerhin sei der Schriftsteller und habe alles genauestens mitbekommen.
Der Kröger hat was?, frage ich, und zum ersten Mal gleitet so etwas wie ein Lächeln über Bronkas Gesicht. Ja, das habe sie sich gedacht, dass mich das erschrecken würde, aber an sich sei das doch eine feine Sache. Gestern Abend sei er mit einem Blumenstrauß vorbeigekommen, sehr freundlich und mitfühlend sei er gewesen, und kurz bevor er gegangen sei, habe er gesagt, man müsse alles genau festhalten, und dass ich mich sträuben würde, das habe er auch vorausgesehen. In Krögers Kladde stehe alles, was relevant sei, Informationen über alle Beteiligten, Lagepläne, Zeitläufe, sogar Skizzen und Stammbäume, er habe es ihr ja gezeigt.
Wenigstens einen gebe es also, der ihr behilflich sein wolle, nicht so wie ich oder meine Mitbewohnerin Albina. Kein Kommentar sei aus der herauszubekommen, geschweige denn irgendeine Information zu dem, was in den Tagen vor Bartosz’ Verschwinden geschehen sei. Wer bei uns in der Wohnung ein und aus gegangen sei, was wir getrieben hätten. In Wirklichkeit, sagt Bronka, steckten wir doch alle unter einer Decke. Auch dass Albina kein Wort über die Geschehnisse verlieren würde, habe Kröger vorausgesehen.
Ich bin mir sicher, Bronka hat längst mit der Polizei gesprochen, wahrscheinlich schon am Tag, nachdem Bartosz verschwunden ist. Das abfällige Schnaufen des Polizisten kann ich mir gut vorstellen, vielleicht hat er sie sogar ausgelacht und gesagt, dass es nicht strafbar sei, sich länger als 24 Stunden nicht bei seiner Mutter zu melden. Wenn es das wäre, müsste man ja die halbe Nation als vermisst erklären.
Beim Hinausgehen legt Bronka die Hefte auf den Schreibtisch, auf die Tastatur des Computers. Ich höre, wie sich der Schlüssel in der Tür herumdreht, dann werden die Riegel vorgeschoben.
Der Kugelschreiber ist leicht und transparent, er kratzt, als ich ihn auf dem Papier aufsetze, und hinterlässt nicht die geringste Spur, so wird das nichts. Wo anfangen? Wenn ich die Wahrheit sagen soll, wird es länger dauern, als Bronka sich vorstellen kann, ich werde sie etwas hinhalten müssen, um Zeit zu gewinnen, ich muss mich richtig erinnern, an jedes Detail des vergangenen Jahres, mich erinnern an alles, was ich sah, was ich hörte und was ich, sagen wir: bemerkte, und worum es sich auch immer dabei handelt, ich werde es einfügen, der Vollständigkeit halber.
Ich recke den Hals nach vorne, schüttle den Kopf, und aus dem Ausschnitt meiner Bluse rutscht der Anhänger heraus, der dicke, honigfarbene Bernstein. Milchige Schwaden ziehen sich hindurch, und in seiner Mitte liegt deutlich sichtbar der stecknadelkopfgroße Punkt mit den kleinen Beinchen. Warm liegt der Stein in meiner Hand. Ich stehe auf und klopfe gegen die Tür, schlage gegen das Holz, aber nichts geschieht, außer dass sich nach ein paar Minuten der Schlüssel im Schloss bewegt und Bronka in der Tür steht: Was?
Weißt du, was das ist? Ich halte ihr den Anhänger vor die Nase.
Wie könnte man in dieser Stadt wohnen und nicht wissen, was das ist. Sie nimmt den Bernstein und wiegt ihn prüfend in ihrer Hand.
Nein, erwidere ich, das meine ich nicht. Das ist der Bernstein, der euch gestohlen wurde. Bronka stutzt, ich sehe, sie ist verwirrt, muss nachdenken, ihr wurde doch nie etwas gestohlen, jedenfalls kein Anhänger, nein … Plötzlich sieht sie auf, alarmiert. Der Anhänger meines Schwiegervaters? Ich nicke: Er ist in der Familie geblieben, die ganzen sechzig Jahre lang. Jetzt ist er zurückgekehrt. Und das ist der Punkt. Alles, was geschehen ist, hängt mit dem Anhänger zusammen. Mein Vater hat mir als Kind jeden Abend Märchen erzählt, Gutenachtgeschichten, wie die Spinne gewandert ist, von Kasimir zu Konrad zu Emmerich. Ich habe immer geglaubt, er habe sich Märchen ausgedacht.
Schreib’s auf, sagt Bronka. Über ihre Wange rinnt eine Träne und hinterlässt eine feuchte Spur.
Schreib es auf. Von Anfang an.
Sie legt den Anhänger auf die Tischplatte neben mir. Gegen den hellen Hintergrund erkenne ich den kleinen Körper, die Beinchen, die er von sich streckt, und schließlich auch den Faden, der sich entspinnt.
Hinter den sieben Bergen, in einem von sieben unversehrten Fachwerkhäusern eines niedersächsischen Städtleins, wohnten Vater und Tochter einmütig beisammen. Die Mutter – Marta – war kurz nach der Geburt des Kindes verstorben, das war beinahe vierzig Jahre nach dem Ende des letzten großen Krieges, und so war das Einzige, was sie ihrem Kind mitgeben konnte, ein Name: Kinga, nach der heiligen Kunigunde von Polen, geboren ins Königsgeschlecht der Árpáden, eine Prinzessin, die ihre Heimat verlassen musste, um ihr Lebtag in der Fremde zu verbringen.
Die Geschichte der heiligen Kinga hatte Marta Mischa sehr berührt, und auf geheimnisvolle Weise schienen ihre Leben miteinander verbunden zu sein: Auch sie hatte als Kind ihre alte Heimat verlassen müssen – allerdings nicht, weil sie einem hohen Herrn versprochen war, sondern weil die Stadt am Meer, aus der sie stammte, plötzlich einem anderen Land gehören sollte. Marta wanderte mit ihrer Familie tausend Kilometer westwärts, über grüne Hügel und Wiesen und Bäche, aber all das war lange her, und übrig geblieben war nur ein Name für ein noch längst nicht geborenes Kind.
Emmerich Mischa, der wie Marta ebenfalls aus der fernen Stadt stammte, ließ seine Frau gewähren, auch wenn ihm etwas Eingängigeres wie Heidi oder Berta besser gefallen hätte, als seine Frau starb, beglückwünschte er sich dazu, sich einmal nicht durchgesetzt zu haben, und verbat Kinga, sich über ihren Namen zu beschweren.
Das junge Mädchen wuchs in dem Glauben auf, tatsächlich eine ins Exil verbannte Prinzessin zu sein. Eines Tages, nahm sie sich vor, würde sie in ihr Reich zurückkehren, und alle würden ihren Namen kennen und sie würde durch die Straßen gehen und die Leute würden sich verbeugen und Blumen werfen, denn sie wäre die rechtmäßige Gebieterin über die Stadt mit den goldenen Toren und den Kirchtürmen und den Speichern, die sich stolz in ihrer Mitte erhoben, ihre Stadt war ein prächtiger Ort, so viel wusste Kinga aus den Büchern ihres Vaters.
Dass ihr Vater kein König war, sondern lediglich ein Schweißer in Frührente, störte Kinga wenig. Keiner der anderen Väter hatte so viel Zeit wie Emmerich, kein anderer kaufte jede Woche ein neues Kleid, in dem das Töchterlein abends durch das Haus stolzieren und die Ratten, die Katzen und die wunderliche Mutter des Alten aufschrecken konnte, die mit ihnen unter einem Dach wohnten.
Die Wohnstatt der drei war wenig königlich, und nur wegen der undichten Fenster, der lehmverputzten Wände und der wurmzerfressenen Balken konnten sie sich überhaupt die Miete leisten. Nach und nach erst entwickelte der alte Mischa Techniken, wie er streichen und tapezieren und Dielen abziehen konnte, ohne sich zu überanstrengen. Tagsüber, wenn Kinga in der Schule war, schimpfte und fluchte er dabei so laut, dass der Nachbar Marek Przybylla jedes Mal zusammenzuckte. Nie wäre es dem alten Mischa in den Kopf gekommen, ihn um Hilfe zu fragen, ihn, den Polen, dessen Deutsch schnarrte und knarrte.
Bald schon befand sich das Häuschen in einem so ordentlichen Zustand, dass Kinga sich nicht mehr schämte, ihre Freundinnen einzuladen und mit ihnen in allen Ecken und Winkeln des Hauses Verstecken zu spielen, so, wie Emmerich es ihr beigebracht hatte: Bernstein, Brennstein, alles muss versteckt sein! Eins, zwei, drei, vier, fünf …
Eines Tages aber fand der Alte unter einem der Tapeziertische seine Tochter, wie sie die Hände von Beata hielt, der Tochter Przybyllas, und wie sie ihr verschämt einen Kuss auf den Mund drückte.
Die nächsten Wochen wurden sehr einsam für Kinga Mischa. Sicher war es keine Lösung ihr jeglichen Umgang mit Mädchen zu verbieten, aber es war die einzige Idee, auf die Emmerich Mischa gekommen war.
Mit der Zeit verdrängte er, was er gesehen hatte, und Vater und Tochter fanden wieder zusammen. Jeden Abend, wenn der Alte seinen Tee ausgetrunken hatte, den Kandiszucker mit einem Löffel aus der Tasse herausgekratzt und sich in den Mund gesteckt hatte, bat Kinga Emmerich darum, den Bernstein hervorzuholen.
Er ist alles, was wir aus der Stadt retten konnten, hatte der Alte einmal gesagt. Kinga war er als der wichtigste Beweis dafür erschienen, dass sie hier nur zufällig war, gestrandet, und dass es anderswo einen Ort geben müsse, der freundlich war und von einem inneren Leuchten, genauso wie jenes, das von dem Stein ausging.
Lange ließ sich der Alte für gewöhnlich nie bitten, und wenn Kinga im Wohnzimmer das Licht der Stehlampe aufdrehte und die Motten erschrocken von den meterbreiten Fensterbänken aufflatterten, holte er den Stein aus seinem Hemd und legte ihn zwischen Kinga und sich auf den wurmstichigen Weichholztisch.
Das ist er, sagte Emmerich, schau, er begleitet die Mischas von Anfang an. Vor Jahrhunderten waren Steine wie dieser mehr wert als Gold. Ein geheimnisvoller Stoff, gelbe Ambra, die nur an Meeresstränden gefunden wurde. Lange Zeit wusste kein Mensch, worum es sich eigentlich handelte. Alles, was man wusste, war, dass es sich elektrisch aufladen konnte und gut roch, wenn man es verbrannte. Siehst du die Spinne? Sie hat sich alles gemerkt, alles, was jemals um sie herum geschehen ist.
An dieser Stelle widersprach Kinga, denn wie konnte man sich denn alles merken, was um einen herum geschah. Der alte Mischa lenkte ein und sagte, dass sie sich nur die speziellen Dinge merkte, und eines Tages würde sie, Kinga, schon dahinterkommen, was das sei: die speziellen Dinge. Dann steckte er den Bernstein zurück in sein Hemd, und Kinga wusste, dass es Zeit war, ins Bett zu gehen, hinauf in ihr klammes Zimmer, das nur über eine kleine Elektroheizung verfügte und über eine Familie hungriger Holzwürmer, die die heranwachsende Kinga mit ihren Mahl- und Schabgeräuschen in den Schlaf wiegten.
Am Abend, als Kinga die letzte Prüfung ihres Studiums der Kunstgeschichte und der Philosophie in einer nahen Großstadt abgelegt hatte, lag auf dem Wohnzimmertisch der Bernstein.
Kinga wohnte noch immer bei ihrem betagten Vater, der sich kaum mehr selber versorgen konnte. Die Ameisen, die er zeit seines Lebens erfolgreich aus dem Haus hatte fernhalten können, begannen, sich wieder Einlass zu verschaffen, bildeten Straßen, auf denen sie die Krümel und Kandisbröckchen des Alten abtransportierten, ganze Schuhe klauten oder sie zu ihrem angestammten Wohnsitz erklärten. Kinga bemerkte einen Igel, der aus einem Berg achtlos ineinandergeworfener Zeitungen und Zeitschriften herausschaute und ihren Blick zwinkernd erwiderte. Sie seufzte und griff nach dem Schmuckstück, das ihr Vater anscheinend auf dem Tisch vergessen hatte. Wie sehr sie die eingeschlossene Spinne als Kind fasziniert hatte! Wer einen solchen Anhänger besaß, hatte sie gedacht, benötigte keine Krone mehr. Kinga lächelte kaum merklich, nahm ihn an sich und ging hinüber zum Zimmer ihres Vaters, die Tür war angelehnt, dahinter war leise Musik zu hören, Smetana, dachte Kinga, die Moldau, und klopfte an, bevor sie eintrat.
Der Alte saß in seinem Ohrensessel. Vor ihm, auf der Fensterbank, kauerte eine Maus und putzte ihr Gesicht. Ein Speichelfaden hing Emmerich Mischas Kinn hinab, die Zunge lag zwischen die Lippen geschoben da, er bewegte sich nicht. Sie erschrak so sehr, dass sie für einen kurzen Moment ein hohes Sirren hörte. Sie stürzte zum Sessel und packte ihren Vater bei den Schultern. Mit einem lauten Was? schreckte der Alte auf. Kinga zitterte, aus ihrer linken Hand baumelte der Bernstein, wie ein Pendel bewegte er sich über das Gesicht des Alten. Er starrte ihn an und fuhr sich über den Mund, der Speichelfaden versickerte im Stoff seiner Baumwollstrickjacke.
Ist doch alles gut, alles gut, sagte der Alte und tätschelte Kingas Kopf, die angefangen hatte zu weinen und von ihm abließ. Er setzte sich auf und reckte seinen Kopf nach der Maus, die raschelnd hinter dem bunt bemalten Nachttischchen verschwand.
Der Stein? Der alte Mischa stand aus seinem Sessel auf, schwankte und ließ sich wieder in die Polster fallen. Kinga drehte ihren Kopf zum Fenster. In der Dämmerung sah sie Przybylla auf seiner Terrasse stehen, auch er längst ein gebeugter und alter Mann. Das Rosengebüsch, das er vor Jahren gepflanzt hatte, bildete eine Art Sicherheitsstreifen zwischen den beiden Gärten, die ursprünglich zusammenhingen. Zu oft war Emmerich in der Vergangenheit über den Rasen hinübergegangen und hatte versucht, Przybylla davon zu überzeugen, dass die alte Linde vor dem Haus gefällt werden müsse, alles lasse er verlottern, man sei hier schließlich nicht in Polen.
Der Stein, wiederholte der Alte. Du hast ihn genommen. Ja, antwortete Kinga, er lag ja da. Warum hast du ihn abgelegt?
Weil er jetzt dir gehört. Die Stimme des alten Mischa klang brüchig und fast so heiser wie der Ruf der Eule, die sich seit einiger Zeit im Schornstein des Hauses eingenistet hatte. Es sei einfach so weit gewesen, sagte der Alte und beugte sich vor, hustete etwas. Nun sei ihre, Kingas, Zeit gekommen. Was er denn da reden würde, unterbrach ihn Kinga, das sei sein Schmuckstück, die einzige Verbindung zurück, das wisse er doch, für sie sei das doch lediglich ein etwas überdimensionierter Anhänger …
Still! Mit einem Mal hatte sich der Alte aufgerichtet und die Tochter mit seinen hellblauen Augen fixiert. Eine Geschichte muss ich dir noch erzählen. Eine noch.
Als mein Vater starb, verließ ich drei Tage und Nächte lang nicht das Haus. Ich erwog es nicht einmal, als der Bestatter im Wohnzimmer stand, einen Kaffee wollte – schwarz – und ich keinen hatte. Wortlos drückte ich ihm eine Tasse Tee in die Hand, woraufhin er sich in dem Sessel niederließ, in dem Emmerich immer gesessen hatte. Von da an hatte man den besten Blick hinaus auf den Hof, die Mülltonnen und die Nachbarn, die heimlich Papier in die Restmülltonne stopften, worauf man sie lautstark beschimpfen und immer wieder die Polizei rufen konnte, die natürlich nie kam.
Jemand anderes als ich wäre bestimmt erleichtert gewesen, zumindest heimlich. Endlich niemand mehr, dem man die Brote zerschneiden und dessen Wäsche man waschen musste, das hatte meine Kommilitonen immer geekelt, wirkliche Freunde waren das nicht gewesen, nein. Wenn wir zusammen im Café waren, hatten sie nie gewusst, worüber mit mir reden, und ich war zu müde gewesen, um dem Gespräch zu folgen. Jetzt, da Vater tot ist, fangen die Dörthes und die Franziskas und die Annikas an, Kinder zu bekommen, werden bald selber Brote schneiden und Wäsche waschen, aber das, sagen sie, sei etwas anderes, das habe etwas mit Aufbau, Zukunft und einer Art von Selbsterfüllung zu tun. Für mich war diese Zeit ein für alle Mal vorbei. Familie hatte vor allem zu tun mit Traurigkeit, die sich früher oder später einstellte, meistens natürlich früher, wenn man merkte, dass man einander doch nicht mehr war als vertraute Fremde, und dann kam der Tod, und es gab nichts mehr zu berichtigen.
Was ich mir denn vorstellen würde, wollte der Bestatter wissen, als Sarg für meinen Herrn Papa: Fichte, Eiche, lackiert ja oder nein, und dann war da der Grabstein, ich nickte, den brauchte man ja wohl, gleichzeitig aber brachte ich Emmerichs Anblick nicht aus meinem Kopf heraus und konnte dem freundlichen Herrn nicht weiter folgen.
Emmerich, wie er in seinem Sessel gehangen hatte, als ich morgens mit einem Tellerchen Leberwurstbrot zu ihm reingegangen war und gedacht hatte, das Väterchen habe es wieder nicht in sein Bett geschafft, das gebe doch bloß wieder Rückenschmerzen, aber als ich laut Guten Morgen, Papa, gesagt hatte, da hatte es bloß auf der Fensterbank geraschelt, und Papa hatte sich nicht gerührt, und ich hatte das Tellerchen fallen lassen und war hinunter ins Wohnzimmer gerannt, wo das Telefon stand, mein Herz hatte gegen den Brustkorb gehämmert. Nie zuvor hatte ich eine Leiche gesehen.
Um mich von der Erinnerung abzulenken, ließ ich den Bestatter alleine im Wohnzimmer sitzen – immer wieder zuckte er zusammen, wenn irgendwo das Trippeln von kleinen Füßchen zu hören war – und ging in die Küche, um mir ein Glas eiskaltes Leitungswasser zu holen.
Der Herr vom Beerdigungsinstitut beherrschte sich und rührte so lange in seiner Tasse Tee herum, bis ich mir alle erforderlichen Entscheidungen abgerungen hatte: Stein, Gravur, Foto ja oder nein, und am Ende sagte er tatsächlich, er habe meinen alten Herrn oft bei sich an der Auslage vorbeispazieren sehen, vor ein paar Jahren, daran könne er sich gut erinnern. Da wollte ich etwas sagen von wegen Aasgeier oder warum er ihn nicht direkt unter Vertrag genommen habe, dann wäre mir ja jetzt einiges erspart geblieben, aber ich presste die Lippen ganz eng aufeinander und verbat mir, pampig zu werden, so hatte Emmerich es immer genannt pampig, und plötzlich fiel mir ein, dass ich nun so etwas wie die Letzte meiner Art war. Nicht, dass das schlimm wäre, nein. Auf dem Weg zur Ausgangstür blieb er nochmals stehen und fragte, ob ich sonst noch Hilfe gebrauchen könne, aber ich winkte ab. So oder so könne ich froh sein, sagte er zum Abschied und fuhr mit seinen Fingernägeln den verzogenen Türrahmen nach. In vielen Fällen habe man es mit Sonderwünschen zu tun, seitens der Verstorbenen, und das sei doch ein viel größerer Aufwand: etwa jemanden im Ausland zu beerdigen, in der Heimaterde, ich wisse schon.
Nein, sagte ich, wir sind hier zu Hause, aber die Worte blieben mir in der Kehle stecken. Beata Przybylla stand draußen im Garten ihres Vaters und winkte. Seit Jahren hatte ich sie nicht mehr gesehen, noch immer hatte sie die Sommersprossen, die ich als Kind so geliebt und heimlich in meinem Tagebuch kartographiert hatte. Ich hob kurz die Hand, dann schloss ich die Tür und ließ mich auf das Sofa fallen. Von der Decke seilte sich eine Spinne ab. Als sie den Esstisch erreicht hatte und auf dessen Platte umherkrabbelte, spürte ich, dass ich diesen Ort verlassen musste, um nicht durchzudrehen.
Die Beerdigung war kaum mehr als eine unangenehme Unterbrechung meiner Klausur. Es regnete, daran erinnere ich mich, meine trockengeföhnten Haare waren innerhalb von wenigen Minuten wieder nass, von der Ebene her wehte eine scharfer Wind, und außer mir und dem erkälteten Pfarrer war niemand da, ich hatte keinen meiner Bekannten benachrichtigt.
Als ich eine Handvoll Erde auf seinen Sarg fallen ließ, hielt ich meine Augen geschlossen, lächerlich das dumpfe Geräusch, und als ich meine Augen wieder öffnete, trieb der Wind die Tränen in senkrechten Bahnen hin zu meinen Ohren. Ich wollte Emmerich nicht hier draußen lassen, er hätte es gehasst, hier, mit all den fremden Menschen um sich herum, tot oder lebendig. Wieder einmal hatte ich alles falsch gemacht, Vater war tot, das Studium längst beendet und nichts Neues in Sicht, zu viele Dinge waren zu Ende gegangen und zu wenige hatten ihren Anfang genommen.
An der Pforte hatten Przybylla und Beata auf mich gewartet, zum Grab selber hatten sie nicht kommen wollen, sie seien doch nur die Nachbarn gewesen und überhaupt … Ich hatte schnell genickt und mir die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Przybylla hatte weiter geredet, ich habe vergessen, was, ich hatte an meine Kommilitonen denken müssen, die früher als ich mit dem Studium fertig geworden und in andere Städte gezogen waren. Bei mir, hatte ich gedacht, wies alles abwärts, meine Erwartung an die nächsten Jahre war so grau und erdrückend wie der Himmel über der norddeutschen Ebene.
Als mich der Notar anrief und sagte, wir müssten über die Wohnung reden, die Emmerich mir vermacht habe, lachte ich laut auf und erschrak über die Stille, die sich danach im Erdgeschoss ausbreitete. Emmerichs Zimmer hatte ich verschlossen und vermied es, hineinzugehen. Seit der Beerdigung kannten die Mäuse kein Halten mehr und hatten sein altes Refugium zu ihrem Kerngebiet erklärt, jedes Auslegen von Gift oder Fallen war zum Scheitern verurteilt: Es waren einfach zu viele kleine Leiber, die sich nachts wie tags auf und unter dem Bett tummelten und sich durch Emmerichs alte Federwäsche fraßen.
Das muss ein Missverständnis sein, sagte ich zu der sonoren Stimme im Telefon, wir wohnen zur Miete, und das Einzige, was mein Vater mir vermacht hat, ist eine Rumpelkammer voll mit Insektiziden und morschen Gartengeräten.
Hat er Ihnen nie von dem Eigentum erzählt? Der Notar, ein Herr Kiesemöller, von dem ich nie zuvor gehört hatte, klang verwundert. Unter diesen Umständen sollten wir uns vielleicht doch besser bei ihm im Büro treffen. Er habe das Testament hier auf seinem Tisch, und da stehe alles ganz deutlich: Tochter Kinga – das sei doch ich? –, Art der Wohnung Name der Stadt. Ich wiederholte, dass es sich dabei um ein Missverständnis handeln müsse, und nach einer kurzen Pause fragte ich ihn, ob nicht er vorbeikommen könne, seit der Beerdigung litte ich unter einer gewissen Unbeweglichkeit. Ich könne mich einfach nicht aufraffen, seelisch wie körperlich.
Schon gut, sagte Herr Kiesemöller. Ich komme.
Ich fand den Atlas im untersten Regalfach. Emmerich hatte ihn mit Klebefolie eingeschlagen, die überall Blasen geworfen hatte. Als ich ihn aufschlug, fielen mir etwa zwei Dutzend ausgeschnittene und mit blauem Kugelschreiber datierte Zeitungsausschnitte entgegen, die sich allesamt mit der Stadt beschäftigten. Ich überflog sie kurz und legte sie auf den Tisch, etwas verwundert, dass Emmerich noch in diesem Jahr Ausschnitte gesammelt hatte. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er noch Zeitung las. Ich hatte angenommen, er war lediglich zu eitel oder zu vergesslich gewesen, sie abzubestellen.
Das Meer auf dem Papier war von einem kräftigen Cyanblau, über das sich mehrere Fingerabdrücke verteilten. Als Kind war mir die Stadt wie ein unvorstellbar weit entfernter Ort vorgekommen, es enttäuschte mich ein wenig, zu sehen, dass sie kaum tausend Kilometer entfernt lag. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Stadt wie jede andere, ein bisschen Altstadt, ein bisschen viel Vorstadt, das Übliche eben. Ich seufzte.
Kaum hatte ich den Atlas zugeschlagen, klingelte es bereits, und der Notar wartete auf Einlass. Auf dem Tisch stand noch immer die Tasse des Bestatters, aber wie gesagt, die Unbeweglichkeit. Kiesemöller schlug sofort seine Unterlagen auf.
Höchst interessant, sagte er, das Ganze, höchst interessant, so eine Immobilie im Ausland. Seine Familie stamme übrigens aus derselben Gegend. Städte am Meer hätten doch das gewisse Etwas, auch wenn sie so arg im Krieg gebeutelt worden waren wie jene … Ob ich schon einmal dort gewesen sei, überhaupt? Herr Kiesemöller schob mir Emmerichs Testament über den Tisch, zusammen mit ein paar Dokumenten, auf denen Grundrisse und Quadratmeterzahlen zu sehen waren.
Das ist unmöglich, sagte ich, und dann sagte ich für einen Moment gar nichts mehr.
Wenn mein Vater Immobilien besessen hätte, hätte er mir davon erzählt. Dann wäre doch mehr Geld in der Kasse gewesen, dann hätten wir nicht so knapsen müssen, nein, Wohnungen tauchten nicht einfach so auf, und schon gar nicht in der Stadt am Meer, Emmerich hatte mir so oft von ihr erzählt, da wäre doch irgendwann mal ein Wort über eine Wohnung gefallen.
Nein, keinesfalls, antwortete Kiesemöller. Ihr Herr Vater hat übrigens vorausgesehen, dass Sie so reagieren würden. Er bittet – nachträglich, wenn Sie so wollen – um Verzeihung, aber er habe den Mietzins den Verwandten überlassen wollen. Hatte ein gutes Herz, Ihr Vater. Sie müssen ihn verstehen. Eigentlich hatte er die Wohnung längst der Verwandtschaft überschreiben wollen. Zurückgeben, gewissermaßen. Er hatte sie selber erst vor wenigen Jahren geerbt. Lassen Sie mich nachsehen – von einem gewissen Marian Mysza. Erstaunlich, nicht wahr? Letztendlich wollte er diesen Schritt aber Ihnen überlassen.
Ich stierte auf die Tasse und dann auf die Fensterscheibe. Eine Hummel war mit einem lauten pock dagegengeflogen und wuselte draußen auf dem Sims, vom Zusammenstoß mit dem Glas betäubt.
Welche Verwandtschaft?, fragte ich, und Herr Kiesemöller sah mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob ich mich noch immer auf dem Planeten Erde befände.
Das mit dem Telefonat erledigte Herr Przybylla. Einmal ins Haus gelassen, wollte er gar nicht wieder gehen, es erfüllte ihn wahrscheinlich mit tiefer Genugtuung, plötzlich zu erfahren, dass sein Widersacher selber polnische Familie hatte, sie aber lieber verschwiegen hatte – wahrscheinlich, sagte er, habe für meinen Vater das traurige Häuflein, das nach dem Krieg beschlossen hatte zu bleiben, nicht gezählt. Genauso wenig interessierte sich der polonisierte Teil für die Abtrünnigen, die nichts Besseres zu tun gehabt hatten, als nach Deutschland zu fliehen. Ausgerechnet! Mischa, sagte er, dieser Name sei ihm doch gleich verdächtig vorgekommen, natürlich, das sei es: Mysza! Herr Mäuseherz hatte sein letztes Geheimnis offenbart, und Herr Przybylla konnte seine Großmut dadurch beweisen, dass er dem Töchterlein aus der Patsche half. Ich hatte ihm verschwiegen, dass ich seit drei Semestern einen Polnischkurs an der Universität belegt hatte, aus Protest meinem Vater gegenüber, aber telefonieren, nein, das traute ich mich nicht. Wahrscheinlich aber hätte ich mich auch nicht auf Deutsch getraut, den Anruf zu erledigen. Ich recherchierte – es handelte sich wirklich um eine Nummer aus dem richtigen Land und der richtigen Stadt. Es war Zeit, dass sich etwas tat, wollte ich nicht wie Emmerich Wurzeln in diesem Haus schlagen und auf dem fruchtbaren Boden der Bördelandschaft verkümmern. Ich schleppte mich also aus dem Haus, kaufte Streuselkuchen, eine Packung Kaffee und lud den Przybylla ein.
Was wollen Sie denn jetzt machen, fragte er, nachdem ich ihm die Geschichte erzählt hatte. Die Zuckerschicht des Kuchens knisterte zwischen meinen Zähnen.
Was würden Sie denn machen, wenn Sie plötzlich herausfänden, dass in einer anderen Stadt ein anderes Leben auf Sie wartet? Ich muss es mir wenigstens anschauen. Es ist ja nicht für immer.
Verlegen nahm ich einen Schluck Kaffee.
Herr Przybylla nickte und schaute nachdenklich auf das Telefon und den Zettel, den ich ihm hinschob. Bitte, sagte ich und dass ich nicht wisse, wer rangehen würde, Kiesemöller hatte etwas von einem Cousin meines Vaters gesagt, mehr wusste er selber nicht. Przybylla wählte, es klingelte. Seine Hand fuhr nervös über die Zeitungsartikel, die nach wie vor auf dem Tisch lagen. Es klingelte noch immer.
Am Morgen jenes verhangenen Septembertages verließ eine Brise irgendwo bei Luleå in Nordschweden den Bottnischen Meerbusen. Auf den vierhundert Kilometern über die Ostsee, die sie zurücklegen musste, gewann sie binnen weniger Tage genug Antrieb, um erst die Åland-Inseln, dann Gotland und endlich, wenn auch nur am Rand, die Insel Öland zu passieren, einigen Krüppelkiefern endgültig den Todesstoß zu versetzen und ein, zwei Fischerdörfer zu verwüsten. Bevor die Cumulus-Wolken, die den Sturm ankündigten, allerdings die polnische Küste erreichten, schienen sie innezuhalten. Noch blieb der Stadt am Meer etwas Aufschub gewährt.
Irgendwo am Rande des Viertels, das unmittelbar an das Zentrum anschloss, klingelte ein Telefon. Als das Geräusch ertönte, zuckte Renia Fiszer zusammen, stellte die Musik, die aus dem kleinen Küchenradio drang, leiser und strich sich eine Strähne ihres langen, ebenholzfarbenen Haars hinters Ohr. Auf ihrem Gesicht lag noch immer der Schleier des Schlafes. Das Klingeln war noch nicht verklungen, und so erhob sich Renia schließlich, zurrte den Bademantel um ihre schmale Taille und öffnete ratlos die Tür zu der kleinen Kammer. Ihre Schönheit war von der Art, die auf alles um sie herum einen lichten Schimmer warf, und sie versagte nicht einmal vor dem desolaten Zustand der Wohnung. Das Telefon klingelte noch immer.
Verflucht seiest du, in der Hölle ersonnener Apparat, sagte Renia. Sofort nahmen ihre Augen die Farbe eines Seerosenteiches bei Regenwetter an. Es war unabwendbar. Sie war dabei, schlechte Laune zu bekommen.
Der Flur lag da im Halbdunkel, die Jalousien waren nicht hochgezogen worden, nur ein paar Fenster waren geöffnet, durch die das tru-tru-truu der Schwäne und das Geschrei von Kindern drang. In der Küche stapelte sich das Geschirr, ein paar Fliegen summten an der Decke und ließen sich alle Weile auf das abgewetzte Parkett fallen.
Die winzige Klinke der Kammertür lag kühl in Renias Hand. In den letzten Jahren hatten sie und ihre wechselnden Mitbewohner alle Gegenstände, die sie nicht mehr brauchten, hineingestellt, aber mittlerweile war die Kammer so voll, dass man ohnehin nichts mehr hineinbekam, und so hatte man sie vergessen, und nur ab und zu, wenn etwas in der Wohnung rumpelte oder knarzte, sagte man sich: Es muss sich wohl etwas in der Kammer getan haben.
Nun aber dieses Klingeln, ein durchdringendes, schepperndes Geräusch, das klang, als hätte es ein derangiertes Museumsobjekt von sich gegeben. Unmöglich, es zu ignorieren, immer weiter klingelte es, und gerade als Renia dachte, dass es aufgehört hatte, nahm es neuen Anlauf und klingelte, um eine Spur verstimmter, weiter.
Einen weiteren Fluch ausstoßend, stellte sie ihre Tasse auf der Kommode ab und begann, die auf den Boden gestürzten Gegenstände abzutragen und sie im Flur zu verteilen, eine Schicht nach der anderen: Ausrangierte Skibekleidung kam zum Vorschein, ein alter Hamsterkäfig samt Einstreu und mumifiziertem Nager, ein brasilianisches Karnevalskostüm, ein unbehauener Fünf-Kilo-Speckstein-Block, elf verschiedene Schuhe ohne Pendant, in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben, ein Emaille-Topfset, eine alte Schreibmaschine aus Gusseisen, eine Fellmütze, ein antikes Hochzeitskleid, Kreidemalstifte, ein Moskitonetz und ein wackelnder Melkschemel, auf dem ein schwarz glänzendes, knapp dreißig Zentimeter hohes Telefon stand, das Renia nie zuvor gesehen hatte.
Jetzt nimm schon endlich ab!, schrie jemand aus der Nachbarwohnung und hämmerte gegen die Wand. Renia zuckte nochmals zusammen, dann nahm sie ab. Ein paar Minuten war Stille. Dann hörten die Nachbarn, wie sie sagte, das Ganze müsse ein Missverständnis sein, ihr würde die Wohnung doch gar nicht gehören, sie miete sie bloß, oder so etwas in der Art. Was das heißt, geht Sie überhaupt nichts an, wer sind Sie überhaupt, woher haben Sie diese Nummer, nein, unmöglich, also das ist ja, da müsste sie sich erst einmal beim Vermieter erkundigen oder, besser gesagt, seinem Sohn. Wie? Bartosz Mysza, wieso wissen Sie das nicht? Also. Wie auch immer. Ja. Auf Wiederhören.
Renia legte den Hörer zurück auf die Gabel und setzte sich neben das Karnevalskostüm auf den Boden. Das kann ja was werden, flüsterte sie und angelte nach ihrer Tasse. Der Kaffee war kalt geworden. Sie nahm den letzten Schluck und machte sich auf den Weg zu Bartosz Mysza.
Renia Fiszer fand ihn im Garten eines einfachen Arbeiterhauses auf der anderen Seite des Flusses. Dort, zwischen Fliederbüschen und einer Mülltonne aus Blech, stand Bartosz, knapp zwei Meter groß, den breiten Rücken in eine beige Tarnfarbenjacke gehüllt, und machte sich daran, einen fast hüfthohen Wolfshundmischling zu kämmen. Das Blut war ihm zum kahlrasierten Kopf gestiegen und ließ seine vor Jahren doppelt gebrochene Nase hell hervortreten. Als er die zierliche Gestalt vor dem Haus sah, fuhr er sich über die Stirn. Schweiß perlte ihm in die Augen. Seit er aus der Wüste zurück im nasskalten Polen war, schwitzte er bei der geringsten Anstrengung, merkwürdig war das. Dabei hatte er damals nur wenig unter der Hitze gelitten, und das, obwohl manchmal über vierzig Grad herrschten und weit und breit kein Schatten war. Bartosz Mysza, hatte der Offizier immer gebrüllt, wenn du so weitermachst, wirst du am Hitzschlag krepieren. Schwitze? Aber er schwitzte nicht, und er krepierte auch nicht am Hitzschlag.
Das Geräusch der Bartstoppeln, über die seine Hand fuhr, ließ den Hundekopf hochschnellen. Die Gestalt stand noch immer vor dem Zaun, auch wenn der Hund nicht bellte. Aber sie war da. Real. Bartosz atmete auf, sein Puls hatte sich beschleunigt, aber wenigstens ging es ihm nicht wie Socha oder Lysiecki, die immerfort Stimmen hörten und dachten, neben ihnen stünde jemand. Nein, ihm ging es vergleichsweise gut, er war doch gesund, es war alles in Ordnung.
He, Soldatenjunge, rief Renia. Du hast ein Problem.
Bartosz dachte nach, einen ganzen Tag lang, und konzentrierte sich auf den Gedankengang fast so sehr wie auf die Runde Counterstrike am PC, mit der er sich abends vor dem Zubettgehen beruhigte. Immerhin hatte er noch siebzig Lebenspunkte und ausreichend Granaten. Am Ende des Tages wusste er noch immer nicht, was das Richtige sein würde, und so beschloss er, seinen Eltern alles zu verschweigen. Das war das Mindeste, was er ihnen schuldete.
Als er aus dem Fenster blickte, hatten sich hohe Wolkenberge über die Stadt geschoben, weiter entfernt am Strand ging der Wind bereits so stark, dass Hafer und Sanddorn flach auf den Boden gepresst wurden. Die Möwen flohen unter die Dächer und beobachteten misstrauisch die Gischt und die Wellen, die gegen die Mole brandeten und gefährlich nah an die Dünen heranschwappten. Der Wind fuhr in die Stadt hinein und ließ die Fensterscheibe erbeben. Bartosz drückte kurz mit seinem Finger dagegen, Stille, dann ließ er sie wieder los. Seine Hände zitterten nach der durchspielten Nacht und dem durchspielten Tag so stark, dass er das Handy nicht einschalten konnte und es auf sein Bett schmiss. Es prallte von der Matratze ab und flog gegen die Wand. Cudny, der Hund, der die ganze Zeit geduldig und gekämmt unter seinem Stuhl gelegen hatte, schaute auf und deutete ein Schwanzwedeln an. Dann apportierte er das Handy. Bartosz überprüfte nicht, ob es noch funktionierte. Er holte sich stattdessen eine Cola aus dem Kühlschrank, warf einen Blick aus dem Küchenfenster, nahm einen Schluck und spülte damit seinen Mund. Es kribbelte in seiner Hand. Verdammt, dachte er, es kribbelt in meiner rechten Hand. Eines Tages werde ich ein Beil nehmen, und dann wirst du sehen, was du davon hast, Hand. Er spuckte die Cola in die Spüle, kurz schäumte sie auf. Seit dem zweiten Einsatz, ja, eigentlich seit dem Abflug aus Babylon kribbelte es in seiner Hand. Am Anfang hatte er es ignoriert, doch mit der Zeit war es stärker und stärker geworden, manchmal war es so stark, dass er kein Glas halten konnte, ohne dessen Inhalt zu verschütten.
Was hatte Renia gesagt? Ihnen blieben zwei Tage Zeit.
Bartosz entschied sich für die Schuhe, die man nicht schnüren musste, schlüpfte hinein, nahm Cudny an die Leine und verließ die Wohnung, ohne sich zu verabschieden. Nur weil er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, alle paar Tage bei seinen Eltern zu übernachten, hieß das nicht, dass er sie über jeden seiner Schritte informieren musste.
Achtundvierzig Stunden darauf lösten sich erste Tropfen aus der Wolkendecke und prallten auf die Windschutzscheibe von Bartosz Myszas Mazda. Er ließ den Motor an und fuhr los. Die kleine Tour würde nicht ohne werden, dafür würde er schon sorgen.
Er parkte den Mazda unweit Renias Wohnung und fand sie im sperrangelweit geöffneten Küchenfenster sitzend. Sie starrte auf die dunkle Front, die sich am Horizont abzeichnete. Zeit zu gehen, magic woman, sagte er, aber sie machte sich nicht einmal die Mühe, ihren Blick vom Himmel abzuwenden.
Hast du es deinen Eltern gesagt? Sie rutschte von der Fensterbank herunter, Cudny bellte kurz auf.
Damit mein Vater einen Herzinfarkt bekommt? Bist du wahnsinnig? Und jetzt zieh dir was über, sie kommt gleich an.
Renia seufzte und verschwand im Inneren der Wohnung. Sie hatte sich verkniffen zu fragen, warum er seine – was war diese Frau denn eigentlich? Seine Cousine? – überhaupt abholen wollte, und vor allem, was sie, Renia, mit der ganzen Sache zu tun hatte. Aber es rührte sie, dass derselbe Typ, der im Irak gewesen war, Angst bekam vor deutschen Verwandten. Rasch zog sie sich an. Eine halbe Stunde später waren sie am Bahnhof angelangt. Die Anzeigen waren ausgefallen und mit einem glänzenden, feuchten Film überzogen. Als der Zug aus Szczecin endlich einfuhr, flüsterte Renia Bartosz zu: Reden wirst du aber mit ihr.
Wird sowieso nicht viel geredet werden, sagte Bartosz und kniff seine Augen zusammen. Die Hand, die Cudnys Leine hielt, verbarg er hinter seinem Rücken. Das Zittern war wieder stärker geworden. Die ersten Passagiere stiegen aus und zogen sich ihre Kapuzen über.
Kaum hatte ich das Gleis betreten, rammte mir jemand von hinten einen Koffer in die Kniekehlen. Ich sackte ein, in meinen Schenkeln kribbelte es, das Blut hatte sich nach der langen Zugfahrt darin gestaut. Seit Stettin hatte ich mich nicht besonders viel bewegt. Blöd war das gewesen. Aber wer in zehn Stunden zehn Fortgeschrittenen-Lektionen einer Fremdsprache lernen und sich daneben noch ein paar passende Sätze zur Begrüßung und Erklärung zurechtlegen will, der hat viel zu tun.
Die Sonne ging gerade unter, irgendwie stickig war es, eine diffuse Helligkeit lag über den Köpfen der Menschen und dem Bahnhof. Ab und zu fiel ein Tropfen auf meinen Scheitel, ein Schwarm Tauben stieg auf, ein paar Kinder schmissen ihnen Kieselsteine hinterher, die zwei Sekunden später auf die Gleise prasselten. Neben einer Bank stellte ich meinen Koffer ab, knöpfte meine Jacke zu und wartete darauf, dass sich die Menschenmenge etwas lichten würde, ich wusste ja nicht einmal genau, wer mich abholen kam und ob man mich nicht vielleicht doch in letzter Sekunde vergessen hatte, wie eine unliebsame Hausarbeit. Vor Aufregung hatte ich nasse Handflächen, ich dachte, mir würde jemand entgegentreten, der mir etwas über mich selber offenbaren würde, der nah genug mit mir verwandt war, um mir zu ähneln, aber doch weit genug entfernt, um sich völlig anders ausgebildet zu haben. Dutzende Male hatte ich mir vorgestellt, wie ich die Familie Mysza in die Arme schließen würde, und sogar da, bei der Bank, schnürte es mir noch die Kehle vor lauter Rührung zu, und ich musste mich darauf konzentrieren, nicht wütend auf Emmerich zu werden, der mich mitgerissen hatte in sein Einsiedlerdasein, in diese Höhle, die er sich hinter seinen sieben Bergen gegraben und in der er so lange ausgeharrt hatte, bis das Leben an ihm vorbeigezogen war.
Nach ein paar Minuten waren zwei Gestalten auf dem Gleis übrig geblieben, ein Mann und eine Frau. Als ich sie sah, dachte ich: Die gehören unmöglich zusammen. Der Typ mit dem riesigen Köter, seiner Militärjacke und den Regentropfen auf seiner Glatze, der war bestimmt Kampfhundzüchter oder Boxer oder was weiß ich, und das Feenwesen neben ihm musste einem Märchen entflattert sein, mit seinen hüftlangen Haaren, die sich im Wind kräuselten, den mandelförmigen Augen und dem merkwürdigen Umhang, den es sich übergeworfen hatte. Beide starrten mich an, und als sie sich nicht rührten – nur der Hund war vom Boden aufgestanden und hatte seinen Schwanz aufgestellt –, nahm ich meinen Koffer und ging zu ihnen.
Hallo, sagte ich und streckte die Hand aus, ich bin Kinga Mischa.
Statt meine Hand zu nehmen, kraulte der Typ lieber seinen Hund, und als er sich wieder aufrichtete, sagte er laut und deutlich Heil Hitler!
Was für ein Trottel, dachte ich, und die Frau neben ihm stieß ihn in die Rippen, aber der lachte bloß und sagte, dass das ein Witz gewesen sei, sein Deutsch sei halt, na ja, bruchstückhaft, das da sei übrigens Renia, und er sei Bartosz Mysza.
Ohne meine Antwort abzuwarten, packte er meinen Koffer und ging los. Renia blieb einen Moment länger stehen als er, deutete kurz auf seinen Rücken und zeigte ihm einen Vogel. Ich nickte, als ob ich verstehen würde, aber natürlich verstand ich überhaupt nichts. Bartosz rief etwas vom Vorplatz des Bahnhofs herüber. Wir schlossen zu ihm auf, und ich
sah hoch am Himmel einen Geier kreisen, daran erinnere ich mich, und hätte der Beschuss nicht angedauert, ich schwöre, ich hätte das Vieh abgeknallt, weil es mich wahnsinnig machte, wie es da oben schwebte und geduldig kreiste, als würde es tatsächlich davon ausgehen, dass, wenn alles vorbei war, man Jarzębiński einfach im Wüstensand liegen lassen würde.
Verdammt, Mysza, schrie Socha zu mir herüber, aber ich reagierte nicht, denn als ich endlich den Blick von dem Geier lösen konnte, sah ich nur Jarzębińskis Blut, das im Sand versickerte und





























