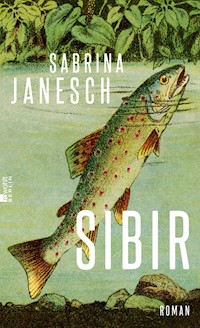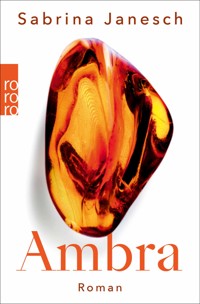4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
«Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht – plastisch, farbig und unvergesslich.» Sten Nadolny über «Die goldene Stadt» «Sabrina Janesch hat einen großen Abenteuerroman geschrieben, phantastisch anmutend und doch historisch wahr – eine Hommage an die Grenzenlosigkeit der menschlichen Neugier.» Alberto Manguel über «Die goldene Stadt» Peru, 1887. Das ganze Land redet nur von einem Mann – und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die verlorene Stadt der Inka gefunden haben. Das Medienecho reicht von Lima bis London und New York. Doch wer ist der Mann, der vielleicht El Dorado entdeckt hat? Alles beginnt mit einem Jungen, der am Rhein Gold wäscht und sich in erträumten Welten verliert, der später in Berlin den glühend verehrten Alexander von Humboldt befragt, um bald darauf einen Entschluss zu fassen: Er, Berns, will die goldene Stadt finden. Berns wagt die Überfahrt nach Peru, wo er eher zufällig zum Helden im Spanisch-Südamerikanischen Krieg wird, dann als Ingenieur der Eisenbahn Mittel für seine Expedition sammelt. Mit dem Amerikaner Harry Singer besteigt er die Höhen der Anden und schlägt sich durch tiefsten Dschungel – um schließlich an einen Ort zu gelangen, der phantastischer ist als alles, was er sich je vorgestellt hat. Erst seit kurzem weiß man, dass das sagenumwobene Machu Picchu in Peru von einem Deutschen entdeckt wurde. Sabrina Janesch hat sich auf die Spuren des vergessenen Entdeckers begeben und erzählt seine aufregende Geschichte. Ein Roman von großer literarischer Kraft, der uns in eine exotische Welt eintauchen lässt – und zeigt, was es bedeutet, für einen Traum zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Ähnliche
Sabrina Janesch
Die goldene Stadt
Roman
Über dieses Buch
«Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht – plastisch, farbig und unvergesslich.»
Sten Nadolny über «Die goldene Stadt»
«Sabrina Janesch hat einen großen Abenteuerroman geschrieben, phantastisch anmutend und doch historisch wahr – eine Hommage an die Grenzenlosigkeit der menschlichen Neugier.»
Alberto Manguel über «Die goldene Stadt»
Peru, 1887. Das ganze Land redet nur von einem Mann – und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die verlorene Stadt der Inka gefunden haben. Das Medienecho reicht von Lima bis London und New York. Doch wer ist der Mann, der vielleicht El Dorado entdeckt hat? Alles beginnt mit einem Jungen, der am Rhein Gold wäscht und sich in erträumten Welten verliert, der später in Berlin den glühend verehrten Alexander von Humboldt befragt, um bald darauf einen Entschluss zu fassen: Er, Berns, will die goldene Stadt finden. Berns wagt die Überfahrt nach Peru, wo er eher zufällig zum Helden im Spanisch-Südamerikanischen Krieg wird, dann als Ingenieur der Eisenbahn Mittel für seine Expedition sammelt. Mit dem Amerikaner Harry Singer besteigt er die Höhen der Anden und schlägt sich durch tiefsten Dschungel – um schließlich an einen Ort zu gelangen, der phantastischer ist als alles, was er sich je vorgestellt hat.
Erst seit kurzem weiß man, dass das sagenumwobene Machu Picchu in Peru von einem Deutschen entdeckt wurde. Sabrina Janesch hat sich auf die Spuren des vergessenen Entdeckers begeben und erzählt seine aufregende Geschichte. Ein Roman von großer literarischer Kraft, der uns in eine exotische Welt eintauchen lässt – und zeigt, was es bedeutet, für einen Traum zu leben.
Vita
Sabrina Janesch, geboren 1985 in Gifhorn, studierte Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim und Polonistik an der Jagiellonen-Universität Krakau. 2010 erschien ihr Roman «Katzenberge», 2012 «Ambra» und 2014 «Tango für einen Hund». Für ihr Schreiben wurde Sabrina Janesch mehrfach ausgezeichnet: Sie erhielt den Mara-Cassens-Preis, den Nicolas-Born-Förderpreis, den Anna-Seghers-Preis, war Stipendiatin des Ledig House, New York, und Stadtschreiberin von Danzig. Sabrina Janesch lebt mit ihrer Familie in Münster.
Impressum
Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. und der Kunststiftung NRW gefördert.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: Martin Chambi/VU/laif
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-12331-1
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Benjamin und Mila
Till a voice, as bad as Conscience, rang interminable changes
On one everlasting Whisper day and night repeated – so:
«Something hidden. Go and find it. Go and look behind the Ranges –
Something lost behind the Ranges. Lost and waiting for you. Go!»
Rudyard Kipling, The Explorer
Lima, Stadt der Könige
Mit rasendem Herzen und Tintenflecken auf den Händen tritt Augusto Berns aus dem Portal des Hotel Maury. Es ist sieben Uhr morgens, die Nacht war kurz. Die Sonne steht bereits am Himmel; ihre Strahlen dringen durch die letzten Nebelbänke und lassen die Ausläufer der Anden gleißend hell aufleuchten.
Berns stützt sich auf die Knie. Feiner Pazifikdunst dringt in seine Lunge, gierig atmet er ihn ein, schmeckt Salz und Staub. Sofort wird er durstig. Den Dreiteiler nach Kleingeld abgeklopft: Wie viel ist noch da? Die Münzen werden gezählt und gleiten zurück in die Hosentasche, dann läuft Berns los.
Vor der Calle de Villalta kreuzt eine Pferdebahn, Berns tritt unter die Krone eines ausladenden Flammenbaums. Hier, im Schatten, überkommt ihn einer dieser Momente, in denen alles, was er in den vergangenen Jahren getan hat, auf seinen Schultern lastet. Er setzt sich auf eine nahe Bank und harrt aus, eine halbe Stunde lang, eine ganze Stunde lang. Die ersten Geschäfte öffnen bereits, Kaufmänner hasten zu den Kontoren an der Kreuzung mit der Calle de Nuñez. Brotverkäufer ziehen vorbei, immer gefolgt von sehnigen Nackthunden, die nach allem schnappen, was von ihren Karren fällt.
Um Berns herum segeln die feuerroten Kelche des Flammenbaums zu Boden, ein Kolibri schwirrt auf ihn zu und bleibt kurz vor seinem Gesicht in der Luft stehen. Berns macht keine Anstalten, den Vogel zu vertreiben. Als er wieder freier atmen kann, das Gewicht von ihm weicht, steht er auf und begibt sich zum Hauptplatz der Stadt.
Auf dem weitläufigen Gelände vor der Kathedrale und dem Präsidentenpalast verteilen sich Fächerpalmen; Tauben wuseln um die Füße der Passanten, die zu den Geschäftsstraßen und Regierungsgebäuden eilen. Ein- und zweispännige Kutschen passieren die Arkaden und die Stände der Kräuterhändler, Schreiber, Wahrsager, Wunderheiler, Hexer und Affenzähmer.
Berns lenkt seine Schritte zum Brunnen in der Mitte des Platzes. Noch immer liegt der Geschmack von Salz und Staub auf seiner Zunge. Er beugt sich hinab, als wolle er sein Taschentuch anfeuchten, und führt etwas Wasser zu seinem Mund. Danach wäscht er seine Hände. Als Berns aufblickt, bemerkt er neben sich eine verschleierte Frau. Sie zwinkert ihm zu und fragt, was denn da sprudle: Schnaps der Helden? Welchen Gegner er denn heute schon bezwungen habe? Lachend geht sie davon, an ihrem Handgelenk blitzt ein goldenes Armband.
Berns fallen die Investoren ein, die Kapitalisten, die er angeschrieben hat. Was, wenn sie morgen nicht erscheinen, weil er ein wichtiges Detail übersehen oder den falschen Zeitpunkt gewählt hat? Bei dem Gedanken krampft sich etwas in ihm zusammen, so stark, dass er meint, das panamaische Fieber sei zurückgekehrt.
Ein Blick auf die Uhr: Noch immer bleibt mehr als eine Stunde. Eine Stunde bis zu seiner Verabredung, das ist nichts – aber dreißig Stunden bis Huacas del Inca, wie soll man das aushalten?
Der Kiosk am Eingang zur Calle Mantas führt über ein Dutzend verschiedener Zeitungen und Magazine. Berns greift in die Auslage, überfliegt die Titelseiten von El Nacional, El Comercio, El País, El Ateneo und einiger anderer Blätter. Er findet fünf Artikel, die von ihm, Berns, und seiner Entdeckung berichten. Seiner Entdeckung! Da lässt er die Zeitung sinken, sein Blick gleitet hinüber zu den Ausläufern der Anden. Berns spürt, wie seine Handflächen feucht werden, vielleicht ist es die Aufregung, oder die pralle Sonne. Er bedankt sich beim Kioskbesitzer, lässt sich vom Schuhputzer nebenan die Stiefel polieren und geht schließlich zum Café Tortoni an der Calle Valladolid.
Zwanzig Centavos für Kaffee und Zuckerkringel, mehr als doppelt so viel wie in jeder anderen Bar der Stadt. Berns trinkt und seufzt kaum hörbar, als er in das Gebäck beißt. Er lässt sich ein Glas Eiswasser bringen, zögert den letzten Schluck Kaffee endlos hinaus, tippt noch die kleinsten Zuckerkrümel vom Teller.
Eine halbe Stunde später biegt Berns in die Calle de Espaderos ein, an deren Ende sich der Club Nacional befindet. Korallenbäume säumen das Portal, es ist nicht zu verfehlen. Vor der Treppe bleibt Berns stehen, rückt seine Krawatte zurecht, dann erst wagt er es, die Stufen hinaufzusteigen. Zweimal ist er schon hier gewesen, jedoch beide Male in Begleitung eines Clubmitglieds.
Im Empfangsraum fällt der Schein venezianischer Lampen auf Wandgemälde, gusseiserne Säulen und Brüsseler Teppiche. Die Lobby erstreckt sich über den gesamten vorderen Teil des Erdgeschosses; Marmortreppen führen in die oberen Räume, eine weit offen stehende Doppeltür erlaubt den Blick in den blauen Salon. Dort sitzen Herren auf Polstermöbeln und rauchen Zigarre. Berns kneift die Augen zusammen, kann aber auf Anhieb niemanden ausmachen, den er kennt.
In einer Nische zwischen Haupteingang und blauem Salon sitzt wie gewöhnlich der Portier Ignacio Ortiz, berüchtigt für seine Humorlosigkeit und den betrübten Gesichtsausdruck derer, die am Magen leiden.
«Heute findet kein Publikumsverkehr statt. Diplomatischer Besuch. Sie haben eine schriftliche Einladung, Señor?»
«Augusto Berns. Ich habe eine Verabredung.»
«Ist das so.» Der Blick des Portiers flackert über Berns’ Anzug, die Tasche, den Hut, irgendetwas scheint nicht zu passen. Er zögert, noch bittet er Berns nicht herein. Hinter Berns betritt eine Gruppe von soignierten Herren den Empfangsraum. Die Herren nesteln vielsagend an ihren Jacketts herum. Sie räuspern sich.
Da ist er wieder, der Gedanke an den morgigen Tag, und mit ihm kehrt die Nervosität zurück. Berns fährt sich über die Stirn, die Stimmen aus dem Salon werden lauter.
«Darf ich fragen, mit wem?»
Jetzt kommt Leben in die Gruppe am hinteren Ende des blauen Salons. Man erhebt sich von den Polstermöbeln; wenn Berns sich nicht täuscht, handelt es sich um die bolivianische Delegation, die seit gestern in der Stadt ist. Inmitten der gedrungenen, penibel gekleideten Bolivianer erkennt er seine Verabredung. Langsam bewegt sich die Gruppe auf den Empfangsraum zu.
«Allerdings», sagt Berns und nimmt den Derby ab, ordnet sein Haar.
«Nun?»
«Ich treffe den Präsidenten.»
«Was Sie nicht sagen.» Ortiz fängt an, in seinen Papieren zu wühlen, aber da ist es schon zu spät. Das Geflüster der Männer hinter Berns verstummt, denn nun betritt die Delegation die Lobby, und in ihrer Mitte, einen Kopf größer als die Bolivianer um ihn herum, schreitet der Präsident der Republik Peru, Andrés Avelino Cáceres. Alle Blicke sind auf seine stattliche Erscheinung geheftet: die blau-weiße Uniform mit den Epauletten, der ausladende Backenbart, das leicht hervorstehende linke Auge, das markante Kinn. Die Zeit der Bolivianer ist um, Cáceres muss zum nächsten Termin, aber noch immer reden sie auf ihn ein. Cáceres lächelt, Berns denkt: präsidial.
«Señor el Presidente», sagt Berns. Da erst bemerkt ihn Cáceres, lacht auf und schiebt sich an den Bolivianern vorbei.
Die beiden Männer umarmen sich und klopfen einander auf die Schultern.
«Augusto!», sagt Cáceres. «Ich dachte schon, du kommst nicht mehr.»
«Ich wurde aufgehalten.»
Ortiz hat jetzt plötzlich viel Papier, das er sortieren muss. Da scheint Präsident Cáceres etwas einzufallen. Er bittet um Aufmerksamkeit, schart die Bolivianer in einem Halbrund um sich und Berns.
«Meine Herren, wissen Sie, was ein Held ist?»
Stille. Niemand rührt sich.
«Ein Held ist einer, der Glück hat. Der sich mit den richtigen Menschen zu umgeben weiß. Auch wenn Sie das vielleicht nicht glauben – aber ein Held steht niemals allein. Als wir vor über zwanzig Jahren Callao gegen die Spanier verteidigten, wer rettete mir da das Leben? Dieser Mann hier! Und danach, wer erkundete dieses Land wie kein Zweiter, vermaß es und verband seine Städte mit der Eisenbahn? Dieser Mann hier! Wer verbrachte Jahre in den Bergen und im Dschungel, wo er eine unglaubliche Entdeckung machte? Meine Herren, dieser Mann hier ist Augusto Berns – ein Mann der Tat, ein Macher, ein ganz großer Realist!»
I. Teil
1.Flussgold
Als Kind wäre Rudolph August Berns beinahe an einer Fliege erstickt, die in seine Luftröhre gelangt war. Stundenlang konnte er mit weit geöffnetem Mund und glasigen Augen dasitzen: Legionen von Römern zogen dann an ihm vorbei und überquerten den Rhein ungefähr an der Stelle, an der gerade die Fähre nach Mündelheim ablegte.
Die Römer – was war das jedes Mal für ein Spektakel! Der Rhein war plötzlich kein bleierner Fluss mehr, sondern ein reißender Strom, und drüben, auf der anderen Seite, wohnten nicht die Mündelheimer Bauern, sondern wilde Germanen, die ihr Land verteidigen würden – und Klipper Eu, unten am Ufer, mit seinem zerrissenen Mantel und der Goldpfanne, war nicht Klipper Eu, sondern Gaius Julius. Gaius Julius und seine Männer hatten ganz Gallien unterworfen, doch nun stießen sie auf den Fluss, vor dem sie gewarnt worden waren. Rhenus hieß das Wasser, das sie jetzt überqueren mussten; auf dem Land dahinter lag ein Fluch, und wer es betrete, so hieß es, sei dem Tode geweiht.
Hinter Gaius Julius ging ein Soldat mit Brustschild, der die römische Standarte trug. Der goldene Adler funkelte und glänzte in der Sonne. Das Trampeln Hunderter Pferde und Männer war zu hören; von irgendwoher drang ein Lied, sonderbar fern und fremd. Und da: Einige der Soldaten führten Pferde, beladen mit kostbaren Schatullen, Schätze mussten sich darin befinden, Gold- und Silbermünzen, schwer genug, einem einfachen Mann ein Loch in die Hosentasche zu reißen – und Perlenketten, Edelsteine, Goldreife, ganze Barren!
Als Gaius Julius auf die Brücke ritt, flatterte und bauschte sich sein Umhang im Wind. «Barbaricum», sagte er und legte seine Stirn in Falten. Obwohl er es nur flüsterte, drang es bis herüber zum Apfelbaum, auf dem Rudolph saß und hinunter zum Rhein schaute. Dann warf Gaius Julius einen Blick zurück nach Westen und überquerte schließlich die Rheinbrücke. Auf der anderen Seite angekommen, drehte er sich ein letztes Mal um und winkte Rudolph zu. Eine kaum wahrnehmbare Bewegung der Hand war das, unbemerkt von den Soldaten und dem Standartenträger; Rudolph aber wusste, dass die Geste einzig ihm galt, über zweitausend Jahre hinweg, und dass Gaius Julius ihn mindestens so klar sah wie er ihn.
Aber bevor Gaius Julius sich wieder abwenden konnte, um mit wehendem Umhang nach Germanien zu reiten, war da diese Fliege. Die überreifen Früchte des Apfelbaums lockten Schwärme von Insekten an. Schmetterlinge, Bienen, Wespen und Fliegen tummelten sich auf den Äpfeln und stoben hoch bis zu Rudolphs Platz auf dem Ast. Die Arme schlaff, der Mund trocken, war sein Blick in eine andere Welt gerichtet; eine Welt ohne Fliegen, ohne empörtes Aufsummen, plötzlichen Schmerz und Hustenreiz.
Rudolph hustete sich vom Baum herunter, fuhr mit seinem Finger in den Mund und weiter in den Rachen, aber da war nichts zu holen, da war nur die Atemnot, das Röcheln – und plötzlich war da Gaius Julius, der ihn packte und nach oben hievte. Dann kam die Schwärze, die sich nach einer Zeit in die Stimme der Mutter verwandelte, in etwas Kühles unter seinem Hinterkopf, ja, in den Geruch von Bohnensuppe mit Speck und sogar in das Geheul von seinem kleinen Bruder Max. Am Ende aber verblasste auch das, und über Rudolph kreiste nur noch der goldene Adler der Legion.
Rudolph August Berns war das erste Kind des Kaufmanns Johann Berns und seiner Frau Caroline. Die beiden hatten sich in Solingen kennengelernt, wohin der junge Kaufmann geschäftlich gereist war. Neben einigen vorzüglichen Messern und anderen Stahlwaren hatte er das Bild eines Mädchens mitgebracht, das, wie er seinen Eltern versicherte, protestantischer und häuslicher kaum sein konnte. Man heiratete schnell. Der junge Mann war nicht ganz, was sich die Eltern des Mädchens vorgestellt hatten. Aber immerhin führte er gemeinsam mit seinem Vater erfolgreich eine Weinhandlung, und so hatte man zugestimmt. Das junge Ehepaar zog in Johanns Elternhaus in Uerdingen. Es lag umgeben von Obstfeldern, die der Familie Berns seit Jahrhunderten gehörten. Kaum einen Steinwurf entfernt floss der Rhein an dem kleinen, wohlhabenden Städtchen vorbei, aus dem immer mehr Fabrikschlote gen Himmel ragten.
Das obere Geschoss des Hauses teilten sich Johann und Caroline mit Johanns Vater Wilhelm, der sich die meiste Zeit in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss aufhielt. Die Mutter war schon lange verstorben.
«Das Geschäft kommt zuerst», sagte der alte Berns, wann immer man ihn aufforderte, mit der Familie eine Mahlzeit einzunehmen. Meist brachte das Dienstmädchen dem alten Mann einen Teller vom Mittagessen hinunter ins Erdgeschoss, wo er hastig zwischen Bottichen und Flaschen aß.
Was wäre die Weinhandlung Berns gewesen ohne den Alten, der über das Treiben wachte und die Kundschaft in Gespräche verwickelte? Nach einem Leben in Uerdingen kannte er alles und jeden, eines jeden Eltern, Kinder, Großeltern und Haustiere, ja sogar ihre Gebrechen, Vorlieben, Nöte und Sorgen. Gesprochen wurde nur von Wein.
Schon bald nahm Johann Berns zu, ließ sich einen Vollbart wachsen und verkehrte häufiger in den Schänken des Ortes. Aus dem jungen Berns wurde der Berns, der endlich von den anderen Kaufmännern beachtet und respektiert wurde. Man besuchte ihn im Geschäft, lud ihn zum Abendessen ein, und selbst der alte Melcher, Besitzer der größten Destillerie Uerdingens, schlug ihm eine Zusammenarbeit vor. Seitdem führte Berns hauptsächlich Weinbrände aus dem Hause Melcher, und natürlich den Uerdinger Doppelwacholder. Mehrere Dutzend der braunen Flaschen standen jederzeit im Regal; die vorbeiziehenden Arbeiter waren durstig und er, Berns, ein guter Verkäufer. Das Geschäft lief besser denn je. Nur eines fehlte, und das war ein Sohn.
Rudolph August kam im Jahre des Herrn 1842 auf die Welt. Rudolph, weil der Vater es so wollte, und August, weil so der Lieblingsbruder der Mutter hieß. Schon nach wenigen Jahren aber, in denen Elise und Max nachfolgten, zeigte sich, dass Rudolph August wenig vom Temperament seines Onkels an sich hatte; auch seiner pragmatischen, nüchternen Mutter glich er nicht. «Vielleicht kommt er mehr nach deiner Familie», sagte Caroline zweifelnd zu ihrem Mann, aber wirklich vorstellen konnte sie sich das nicht.
«Hans Guck-in-die-Luft» nannte ihn sein Großvater, nach der Figur aus einem Buch, das er dem Jungen geschenkt hatte. Rudolph hatte es studiert und schnell zur Seite gelegt. Ihm war nur das lieb, was er selber fand und für sich entdeckte. Nur dann, so kam es ihm vor, hatte er wirklich Anspruch darauf, nur dann war es sein und real.
Die meiste Zeit saß der Junge verträumt da und stierte unablässig auf irgendeine Sache, die seine Aufmerksamkeit fesselte. Weckte man ihn aus diesem Zustand und befragte ihn nach seinem Tag oder dem Grund für die dreckige Hose oder das fehlende Geld im Portemonnaie, so bekam man die haarsträubendsten Dinge zu hören. Von schwarzen Reitern war da die Rede, von Irrlichtern, die ihn hinausgelockt hätten, von Geistern, die ihm den Weg weisen wollten zu den Verstecken römischer Schätze, von Seeungeheuern, Drachen und dergleichen mehr. Tatsächlich verspürte Rudolph eine sonderbare Verbindung zu den Legenden vergangener Zeiten und ihren sagenhaften Reichtümern. Er konnte es weder sich selber noch sonst irgendwem erklären, aber manchmal kam es ihm vor, als sei die Welt in seinem Kopf wesentlicher als die, die ihn umgab.
«Lügen», sagte die Mutter. «Ach was», sagte der Vater. «Der Junge hat Phantasie!» Aber es half nichts. Auch nicht die Erklärung des Vaters, dass Einfallsreichtum für einen Geschäftsmann mindestens genauso wichtig sei wie sorgfältige Buchhaltung und die Fähigkeit, kritisch zu denken. Die Mutter antwortete bloß, dass er dem Jungen nicht noch mehr Flausen in den Kopf setzen solle, es sei so schon schlimm genug.
Rudolph spürte, wie etwas Scharfes seine Kehle hinabfloss. Vielleicht schmeckt so der Tod, dachte er. Scharf und süß und zugleich ein wenig nach Wacholder. Ein Ruck ging durch seinen Körper; er meinte, die Augen zu öffnen, und erkannte Vater und Mutter neben sich auf dem Boden. Auch Max und Elise waren da, heulten und versteckten sich hinter den gebeugten Rücken der Eltern. Auf der Eckbank hinten in der Stube saßen Großvater und Klipper Eu. Klipper Eu hielt ein Glas Weinbrand in der Hand, sein Atem hatte sich noch immer nicht beruhigt, so schnell war er mit dem Jungen auf den Armen ins Berns’sche Haus gerannt.
Alles schien wie immer, und doch stimmte etwas nicht: das Haar der Mutter etwa, das beständig die Farbe wechselte; der Großvater, der plötzlich ganz jung aussah; der Bruder, der sich immer wieder in seine Schwester verwandelte. Außerdem war da ein Soldat, der seelenruhig auf dem Kaminsims saß und die Beine baumeln ließ. Rudolph hatte ihn nie zuvor gesehen, und dabei kannte er doch mittlerweile so gut wie jedes Gesicht aus der römischen Legion. Es gab schmale Gesichter mit hohen Wangenknochen, breite Gesichter mit kräftigem Kinn, olivfarbene Teints, tiefbraune, bleiche; Legionäre mit schwarzen Haaren, blonden, braunen, es war alles dabei. Die meisten trugen rundliche Helme und Kettenhemden, die von groben Gürteln zusammengehalten wurden. Aber der hier? Der merkwürdige Herr auf dem Kaminsims schien so gar nicht zu ihnen zu gehören. Die tiefliegenden Augen, der graue Bart und die scharf geschnittene Nase wären Rudolph aufgefallen, auch trug der Mann einen länglichen Helm, der von einer breiten Krempe umgeben war. Seine Vorderseite lief spitz zu, obenauf prangten gelbe und rote Federn. Woher kam der Mann, und was machte er auf dem Kaminsims? Aber sosehr Rudolph sich auch anstrengte, er schaffte es nicht, den Mund zu öffnen und ihn zu fragen.
Über all der Verwunderung bemerkte Rudolph erst spät, dass er längst seinen Körper verlassen hatte und sich neben ihm befand. Wie sonderbar das war! Ohne jede Anstrengung stand er auf, ließ seinen Körper hinter sich und betrachtete den Raum: das Sofa, auf dessen Sauberkeit die Mutter allergrößten Wert legte, die Stickarbeit, die noch auf der Fensterbank ruhte, die Geranien, die zu sehr in der Sonne standen und bereits rötliche Blätter bekommen hatten. Das war der Raum, wie er ihn kannte, aber gleichzeitig waren da noch zehn andere Räume – Variationen desselben Raumes, andere Möglichkeiten seiner selbst. Mal war er winzig klein, dann wieder unendlich groß, mal erschien er wie auf ein Blatt gemalt, dann wieder bogen sich die Wände wie Kautschuk. Plötzlich verwandelte sich das Haus in das Haus der Kradepohls nebenan, dann in Melchers Villa, in Klipper Eus Kate, wurde zu einem Zirkuszelt, einer mongolischen Jurte, einem Mauseloch – nichts stand fest, alles war möglich.
«Die Wirklichkeit», sagte auf einmal der merkwürdige Herr auf dem Kaminsims, «ist in Wirklichkeit nichts weiter als der kleinste gemeinsame Nenner beschränkter Geister.» Da erkannte Rudolph, dass es sich bei dem Herrn unmöglich um einen Römer handeln konnte. Der Oberkörper des Mannes war ja fest eingeschlossen in eine silberne Schale, und anstelle grober Hosen aus Leinen bauschte sich rot gestreifter Stoff über engen Stiefeln. Und dann diese Sporen! Sie klirrten, wenn sie einander streiften. Plötzlich war es Rudolph, als hätte er den Mann bereits irgendwo gesehen, doch dieser Eindruck verflog, bevor er ihn ganz fassen konnte.
«Das verstehe ich nicht», wollte Rudolph sagen, aber schon überkam ihn ein weiterer Hustenanfall. Da war es wieder, das Gefühl, im eigenen Körper zu stecken: Blut, das aus Nase und Mund fließt, Luft, die in die Lungenflügel dringt. Er spürte, wie sich dünne Ärmchen um seinen Hals klammerten. Rudolph stemmte sich hoch, dann erst öffnete er die Augen.
Als Erstes schaute er zum Kaminsims. Der merkwürdige Herr war verschwunden. Nur Klipper Eu saß noch immer in der Ecke, das leere Glas vor sich auf dem Tisch. Großvater war eingeschlafen. Max hielt Rudolph noch immer eng umklammert, so eng, dass der Vater seinen Griff vorsichtig lösen musste. Rudolph schmiegte den Kopf in die nach Staub und Kernseife riechende Armbeuge seines Vaters. An der Tür erkannte er seine Mutter, die Doktor Lewin hereinließ.
«Atmet er?», fragte der Doktor.
«Tut er», sagte Rudolph. Dann übergab er sich.
Den Rest des Tages verschlief Rudolph. Später wurde ihm berichtet, dass er großes Glück gehabt hatte. Die Fliege war nicht in seiner Luftröhre stecken geblieben, sondern bis in die Lunge eingesogen worden. In den nächsten Tagen, so Doktor Lewin, würde Rudolph sie stückchenweise aushusten. Vorsichtshalber verschrieb der Doktor ihm Eierlebertran. Von Fliegen und anderen Insekten solle er sich vorerst fernhalten.
«Da hast du’s», sagte die Mutter, als Lewin mit zwei Flaschen Cognac unterm Arm gegangen war. «Fernhalten soll er sich. Vielleicht wird es Zeit, dass du ihn zu dir ins Geschäft nimmst, Johann.»
«Ja, vielleicht wird es Zeit», sagte Johann Berns. Jede andere Antwort wäre sinnlos gewesen. Ab morgen würde der Junge seine Tage in der Weinhandlung verbringen, jedenfalls dann, wenn Caroline im Hause war und aus dem Fenster der Stube sehen konnte, ob er sich auf der Obstwiese oder am Rhein herumtrieb. Als Rudolph davon hörte, stieg ein Schluchzen die Kehle hinauf, und er musste sich sehr konzentrieren, es nicht entweichen zu lassen. Er liebte seinen Vater, aber seine Freiheit liebte er noch ein wenig mehr.
Ein bisschen verhielt es sich wie mit dem Kaleidoskop. Vater hatte es ihm geschenkt, seither war es Rudolphs liebstes Spielzeug. Auf der Hülle der kleinen Röhre waren Kinder zu sehen, die auf Pferdchen ritten oder Drachen steigen ließen. In ihrer Mitte aber, größer als sie alle, stand ein Kind, das in ein Kaleidoskop blickte. Rudolph spürte, dass dieses Kind mehr wusste und mehr sah als die anderen, die in ihr Spiel vertieft waren. Sie waren so stark mit ihrer Umgebung verbunden, dass sie gar nicht begriffen, dass die Welt unzählige Formen annehmen und in unterschiedlichen Varianten gleichzeitig existieren konnte. Dabei genügte doch ein Blick in das Kaleidoskop, um zu verstehen. Sah man durch die Röhre und bewegte sie ein klein wenig, verwandelte sich sofort, was man sah, es bog sich und nahm eine neue Gestalt an. Das Spiel der Formen und Farben war so reich und mannigfaltig, dass sich nur ein einfältiges Gemüt mit einer einzigen Variante zufriedengeben konnte.
Natürlich brauchte Rudolph das Kaleidoskop schon bald nicht mehr; wann immer er es wünschte, konnte er die Welt vor seinen weit aufgerissenen Augen zum Verschwimmen bringen und ihre zahllosen anderen Entwürfe studieren. Und was gab es dort nicht alles zu sehen! Rudolph blickte stets ein wenig mitleidig auf die anderen Kinder von Uerdingen. Sie spielten Fangen, Verstecken und ahnten nichts von dem Reichtum, der sie umgab.
Dann aber kam die Anweisung der Mutter und die Verbannung in das Geschäft des Vaters. Die Weinhandlung war ein unerträglich langweiliger Ort für einen Jungen wie Rudolph. Für einen Erwachsenen, dessen Ambitionen und Interessen weit über Uerdingen und die Rheinprovinz hinausgingen, allerdings auch. Seit Johann Berns die Weinhandlung vergrößert hatte und bei Melchers Destillerie ein- und ausging, schien ihm das Leben plötzlich einfallslos und kalkulierbar. Nur der Großvater hing an den alten Geschäftsräumen und klagte über jede Veränderung.
Es war, wie Rudolph sagte: «An diesem Ort steht selbst mein Kopf still.» Denn während Max und Elise mit der Kinderfrau im Garten spielen durften, war Rudolph in den ewigen Schatten der Eichenvertäfelungen und Schnapsbottiche gefangen. Selbst das Kaleidoskop vermochte kaum gegen die Braun- und Schwarztöne, die hier vorherrschten, anzukommen.
Wenn keine Kundschaft im Geschäft war, las der Vater Rudolph die Fortsetzungsgeschichten aus der Zeitung vor. Der alte Berns steckte währenddessen seine Nase in die Geschäftsbücher und tat so, als würde er sie prüfen. Natürlich waren seine Augen schon längst zu schlecht dafür. Von den Geschichten hatte vor allem eine das Interesse des Jungen geweckt: die Reiseberichte aus Peru von Johann Jakob von Tschudi.
Das Vorlesen dauerte entsetzlich lange, denn wann immer der Vater an eine Stelle kam, über die er sich sehr wunderte, legte er die Zeitung zur Seite und fuhr sich gedankenverloren durch den Bart. Wenn er das tat, zwirbelten sich danach die Härchen auf der linken Seite etwas schiefer empor, Rudolph kannte das bereits. «Der Mann hat sich was getraut», sagte der Vater für gewöhnlich, bevor er kurz seinen alten Herrn betrachtete und etwas leiser wiederholte: «Der hat sich wirklich etwas getraut.»
Die meisten der Geschichten handelten von den wundersamen Zuständen in den Städten und Dörfern der Anden; von schier unerschöpflichen Silberminen und dem verborgenen Gold der Inka. Gold! Viele der Berichte schienen Rudolph erfunden, so eigentümlich und frei wie seine eigenen Tagträume.
«Kann denn das alles wahr sein?», fragte er manchmal, und sein Vater wiegte den Kopf, fuhr sich ein weiteres Mal durch den Bart und sagte, dass man diese Dinge schwerlich überprüfen könne; so gesehen seien es einfach passable Geschichten, wahr oder nicht. Eines jedenfalls stehe fest, und das sei, dass sich der Mann etwas getraut habe.
Einmal belauschte Rudolph ein Gespräch seines Vaters mit dem alten Melcher. Der Großvater war nicht dabei; er lag oben in seinem Bett, Doktor Lewin war bei ihm. Lewins Sorgenfalten wurden immer tiefer, je öfter er bei ihm vorbeisah. Eigentlich wollte Rudolph seinen Vater nicht belauschen, das meiste, was besprochen wurde, war sowieso langweilig und betraf nur den Alkohol – aber dieses Gespräch war anders. Schon wie Melcher in das Geschäft gekommen war und dem Vater vertraulich auf die Schulter geklopft hatte. Sofort hatte der Vater Rudolph fortgeschickt und einen seiner besten Weine hervorgeholt. Melcher, das wussten alle, hasste Spirituosen und trank selber nur französischen Weißwein.
«Worüber wir neulich sprachen», sagte Melcher und nahm einen Schluck. Es gehörte durchaus nicht zu seinen Angewohnheiten, die Sätze zu vollenden. Jetzt raschelte Zellophanpapier; der Vater hatte eine Packung teures Früchtebrot aus Frankreich geöffnet.
«Ich erinnere mich sehr gut», hörte Rudolph seinen Vater sagen. Er selber versteckte sich hinter der angelehnten Tür, die zum Lager führte. Aber war das wirklich die Stimme des Vaters? Plötzlich klang sie angespannt, aufgeregt sogar. Ein bisschen wie Rudolphs eigene Stimme, nur älter, tiefer.
«Hast du mit deiner Frau gesprochen?»
Rudolph hörte, wie etwas auf den Boden fiel. Das Miauen einer der Katzen, ein Poltern, der Vater fluchte – was er daraufhin zu Melcher sagte, drang nicht bis hinter die Tür zum Lager. Worum ging es? Melcher stellte sein Glas auf den Tresen. Er sprach jetzt etwas lauter, wie mit einem Schwerhörigen. Aber Vater hatte sehr gute Ohren. Ihm entging selten etwas.
Melcher redete immer lauter und lauter auf Vater ein, seine Stimme überschlug sich, man verstand ihn kaum. Es ging, so viel ließ sich heraushören, um die Welt, bessere Möglichkeiten und größere Märkte. Uerdingen! Was sei schon Uerdingen!
«Melcher!», sagte der Vater schließlich. «Es ist noch nicht so weit. Geht das in deinen Schädel hinein?»
Rudolph wusste nicht, dass sein Vater sich traute, so mit dem alten Melcher zu sprechen. Ebenso wenig wusste er, was es mit den größeren Märkten auf sich hatte. Eines aber lernte er an jenem Tag, und das war, dass sein Vater mit ihm nicht über alles sprach.
«Redest du nicht mehr mit mir?», fragte der Vater später, als Rudolph stundenlang schweigend neben der Tür saß.
«Nein, tue ich nicht. Geht das in deinen Schädel hinein?», fragte Rudolph zurück. Und weil er den Blick des Vaters nicht ertrug, packte er seine Mütze und rannte aus dem Haus.
Kurz überlegte er, zum Rhein zu laufen, dann entschied er anders. Anstelle der Straße hinab zum Rhein ging er die Niederstraße hinauf, in Richtung des Marktplatzes. Der Platz war ihm bisher so weitläufig vorgekommen, dass er sich, wann immer er ihn betrat, verloren vorkam. Etwas hatte sich verändert. Melchers Stimme tönte in seinem Kopf: Uerdingen! Was war schon Uerdingen!
Um auf den Markt zu gelangen, musste man an der Kolonialwarenhandlung Herbertz vorbeigehen. Rudolph stockte und blieb stehen. Säcke voller Kaffee lagen dort hinter dem Schaufenster; Schokoladentafeln türmten sich auf einem Tischchen, und über alldem hing ein ausgestopfter Affe von der Decke. Ein echter Affe! Seine Glasaugen waren auf einen unbestimmten Punkt vor dem Schaufenster gerichtet.
Sie hätten ihm wenigstens ein Stück Schokolade in die Hand geben können, dachte Rudolph und drehte sich erbost um. Dann fasste er sich ein Herz und ging zur Mitte des Marktplatzes. Jetzt stand er genau den Häusern der Gebrüder Herbertz gegenüber. Ach was, Häuser – Paläste! Drei identische Prachtbauten reihten sich da aneinander, mit drei prunkvollen Eingangstüren und drei ausladenden, schmiedeeisernen Balkonen darüber. Sein eigenes Elternhaus war ungleich schmaler und bescheidener. Rudolph drehte sich einmal um die eigene Achse. Die Reichtümer der Neuen Welt, von denen Vater gesprochen hatte, kamen ihm in den Sinn. Wo wäre einst Platz für seinen Palast? Es war ja schon alles verbaut, überall wohnte, verkaufte, lebte man bereits. Vielleicht hatte Melcher recht, und es gab irgendwo größere Märkte als in Uerdingen.
Die Gebrüder Herbertz gehörten zu den reichsten und wichtigsten Familien in Uerdingen, das wusste Rudolph. Der Älteste von ihnen, Balthasar Napoleon Herbertz, hatte für sich und die beiden Jüngeren die Häuser erbaut. Das wollte Rudolph auch. Max und Elise sollten die schönsten und größten Häuser am Platz bekommen, dafür würde er schon sorgen. Max mit seinem Sommersprossengesicht – immer schaute er stumm zu seinem großen Bruder auf und versuchte, ihm in allem nachzueifern. Und Elise: Elise war ein zartes Mädchen, der geringste Windstoß konnte sie umwerfen, auf sie musste man besonders achtgeben.
Natürlich war es einfacher, reich und wichtig zu werden, wenn man einen Namen wie Balthasar Napoleon trug. Aber Rudolph August? Es war, als hätten die Eltern nicht bedacht, welche Wege sein Leben nehmen könnte, als wären sie nicht alle denkbaren Szenarien durchgegangen. Wahrscheinlich hatten sie sich nicht einmal vorstellen können, dass er später einen wohlklingenderen Namen benötigen würde. Ja, die Eltern von Balthasar hatten sich freilich etwas einfallen lassen. Nur waren die ja auch auf die Idee gekommen, mit fremdländischen, eigenartigen Produkten zu handeln, und nicht mit Wein und Cognac, so wie alle. Was war nur los mit seinen Eltern? Rudolph wollte es nicht ganz glauben, aber vielleicht litt auch sein Vater an dieser sonderbaren Krankheit, die die meisten Leute im Laufe ihres Lebens befiel: diesem steifen Verharren in der unmittelbaren Umgebung, in all dem, was man seit jeher kannte. Darüber hinaus schien es für sie nichts zu geben; es wurde nichts gesehen, nichts entdeckt, nichts erfunden oder erdacht. Wie ein entstellender Mangel kam dies Rudolph stets vor, wie ein tierisches Verbleiben im Ausgangszustand, mochte er noch so mickrig und erbärmlich sein.
Nachts lag er häufig wach. Selbst wenn seine Augen bleischwer vor Müdigkeit waren und er Max und Elise bereits in ihren Betten tief atmen hörte, fand er nicht in den Schlaf. Für gewöhnlich zogen sich auch die Eltern bald in ihr Schlafzimmer zurück, nachdem sie die Kinder zu Bett gebracht hatten. Stille kehrte daraufhin im Haus ein. Dann war Urdingis Zeit gekommen.
Urdingi, das war das alte Uerdingen der Merowinger. Es lag nicht weit entfernt vom heutigen Uerdingen – mitten in den Fluten des Rheins. Nach Überschwemmungen und schweren Wintern mit viel Eisgang hatte der Fluss sein Bett nach Westen verlagert, und so war das Urdingi der Germanen in den Fluten des Rheins versunken.
Rudolph stellte sich vor, dass eines Nachts, ganz plötzlich, noch bevor jemand Alarm schlagen oder sich retten konnte, der Rhein über das Dorf gekommen war und jeden lebendigen Körper bis zum Bersten mit Wasser gefüllt hatte. Und weil der Rhein seine Sedimentmassen über das Dorf und alles und jeden hatte rollen lassen, lag noch immer alles an derselben Stelle, an der es sich seit Hunderten von Jahren befunden hatte.
Von seinem Fenster aus war es nur ein Steinwurf bis zu den ersten Häusern Urdingis, tief unten, im Wasser. In der Nacht, das wusste Rudolph, erwachten die Bewohner Urdingis zum Leben, und je weiter die Nacht fortschritt, desto schwieriger wurde es zu entscheiden, welches Uerdingen das realere war: das Uerdingen der Gebrüder Herbertz oder Urdingi, die Siedlung der Merowinger. Vieles glich sich, stellte Rudolph verwundert fest. Ähnlich wie auf dem Markt kamen beim Thing die wichtigsten Männer des Dorfes zusammen; und auch in Urdingi lebte eine Familie, die eine besondere Hütte besaß und reicher war als alle anderen.
Es gab viele große Familien – eine von ihnen zählte mindestens sieben rothaarige Kinder –, einen Verrückten, der von den anderen gemieden wurde, einige ältere Frauen, die etwas außerhalb lebten, und eine Familie mit drei Kindern und einem Greis, die ganz nah am Rhein wohnte. Der älteste Sohn – ein kräftiger Junge, blitzgescheit, hochgewachsen und stets bei der Sache – musste nur zur Tür hinaustreten und durch den Obstgarten gehen, schon befand er sich am Ufer des Flusses. Dort traf er sich häufig mit dem Verrückten, seinem besten Freund.
Der Name des Jungen war Thorleif, auch das wusste Rudolph. Überhaupt kannte er mittlerweile Thorleif und seine Familie sehr gut. Der Vater war Jäger und liebte seine Kinder über alles. Er und Thorleif gingen oft zusammen auf die Jagd, streiften über die Felder und sprachen in ihrem kehligen, wundersamen Dialekt miteinander. Die Mutter war streng und achtete auf Ordnung in der Hütte, so gehörte sich das wohl. Thorleifs Geschwister waren noch klein, er musste auf sie achtgeben, sonst gingen sie verloren. Sein Vater und er, sie waren die Männer im Haus. Es war ein ruhiges Leben in Urdingi. Thorleif wuchs heran in dem Bewusstsein, einst der Anführer seines Dorfes zu werden, wichtige Schlachten zu schlagen, Schätze zu heben und Land zu entdecken, das keiner vor ihm entdeckt hatte. Auch die anderen im Dorf schienen es zu fühlen und zollten Thorleif den gebührenden Respekt. Wenn er an den Mädchen vorbeiging, schlugen sie die Augen nieder; lief er durch den Wald, verstummten die Vögel, nur um kurz darauf noch lauter und schöner zum Gesang anzuheben.
Das war Thorleif, dem ein aufregendes Schicksal in die Wiege gelegt worden war – aber Thorleif wohnte in Urdingi, und nicht in Uerdingen, so wie Rudolph.
Die Tage, an denen Vater mit hinunter an den Rhein kam, gehörten zu den schönsten. Kurz nach Sonnenaufgang gingen sie los. Rudolph trug die gusseiserne Pfanne, deren Griff er abmontiert hatte. Seiner Mutter gegenüber hatte er behauptet, die Zigeuner, die durch Uerdingen gezogen waren, hätten sie gestohlen – zusammen mit ein paar Gläsern Marmelade, die ebenfalls aus Mutters Küche verschwunden waren. Sie hatte ihm kein Wort geglaubt.
Vater trug den Korb mit drei belegten Broten und einer Flasche Weinbrand, eine Schaufel und einen Eimer. Wenn er und Rudolph am Fluss ankamen, war Klipper Eu meist schon seit Stunden auf der Kiesbank zugange. Den Flitter ließ er in eine leere Sardinenbüchse rieseln.
«Goldwaschen is wie Fischen», sagte Klipper Eu immer. «Du weißt nie, was du kriegst, und am Ende sind deine Füße kalt.»
Vater gehörte zu den wenigen, die sich mit Klipper Eu unterhielten – zumindest wenn es niemand außer Rudolph bemerkte. Er wusste, wie viel dieser sonderbare Mann seinem Sohn bedeutete. Während Rudolph sich in Gegenwart anderer Kinder anstrengen und zusammenreißen musste, konnte er mit Klipper Eu so gedankenverloren sein, wie er wollte. In seiner Gegenwart lag nur Gutes, nie hätte er den Jungen verspottet, geschubst oder verprügelt. Klipper Eu war ein verlässlicher Freund.
Klipper Eu, hatte Vater einmal erzählt, sei jahrelang auf einem großen Schiff gefahren, und nicht bloß auf dem Rhein, sondern auf allen Meeren der Welt. Irgendwann habe er es da draußen nicht mehr ausgehalten, und deshalb sei er nach Uerdingen zurückgekehrt. Hier aber habe er es genauso wenig aushalten können, und so sei er eben verrückt geworden. Wenn man keine anderen Möglichkeiten mehr habe, dann gebe es immer noch diese eine: verrückt werden. Rudolph hatte versucht, seinem Vater zu erklären, dass es immer und zu jedem Zeitpunkt eine unvorstellbare Anzahl von Möglichkeiten gab, aber schon nach einigen wenigen, unzusammenhängenden Sätzen hatte er aufgegeben. Eines aber war ihm klargeworden – wenn er jemals den Eindruck hätte, keine anderen Möglichkeiten mehr zu besitzen, dann würde er lediglich falsch denken. Dachte man richtig, sah man die anderen Versionen deutlich vor sich. «Es ist alles eine Sache der Einstellung», hatte er seinem Vater noch gesagt, aber der war längst nicht mehr bei der Sache gewesen.
Die Kiesbank war der beste Platz auf der Welt. In einer Biegung des Flusses gelegen, bestand sie aus dunklem Kiesel und Sand, der schwerer war als der Sand, den man andernorts finden konnte. Während Vater Klipper Eu das Brot und die Flasche hinlegte, fingerte Rudolph die kleine Phiole aus seiner Jackentasche. Melcher hatte sie ihm einmal aus der Destillerie mitgebracht. Sie war kaum so groß wie Rudolphs Daumen, besaß einen bronzenen Verschluss, und in ihrem Innern glitzerte Goldstaub.
Rudolph lehnte die Phiole gegen Klipper Eus Sardinenbüchse. Das war das Startsignal. Vater begann mit der Schaufel, ein Loch in den Kies zu graben, und wenn er die Lage mit Sand erreicht hatte, befüllte er damit den Eimer. Rudolph zog seine Schuhe aus, nahm eine Pfanne voll Sand und ging hinab ans Wasser. Das Auswaschen war eine schwierige Angelegenheit. Wenn die Strömung sehr stark war, riss sie alles Material sofort aus der Pfanne heraus. War sie zu schwach, musste man alles Schwenken und Auswaschen selber erledigen, und nach kürzester Zeit schmerzten die Handgelenke.
Bei Klipper Eu sah es unendlich leicht aus. Seine riesigen Hände ließen die Pfanne mühelos im Wasser kreisen, ganz so, als wöge sie nicht das Geringste. Auch konnte er eine ganze Pfanne sehr schnell abziehen – meist war er schon fertig, wenn Rudolph noch nicht einmal den groben, hellen Sand aus seiner Pfanne herausgewaschen hatte. War nur noch schwarzer Sand übrig, nahm ihm der Vater die Pfanne aus der Hand und wusch ihn vorsichtig aus. Zu wertvoll sei der, um aus Versehen davongespült zu werden, sagte er seinem Sohn und kehrte ihm dabei den Rücken zu. Er war sehr geschickt. Wann immer er mit Rudolph Goldwaschen ging, befanden sich am Ende einige Körnchen Gold in der Pfanne – ganz anders, als wenn Rudolph alleine ging.
«Dein Vater is ein guter Mann», kommentierte Klipper Eu jedes Mal das Schauspiel. «Aber vom Goldwaschen hat er keine Ahnung.» Mit Blick auf die Phiole protestierte Rudolph. Auf seine Nachfrage hin schwieg Klipper Eu. Er war wohl wirklich so verrückt, wie alle sagten.
Einmal schenkte Klipper Eu ihm ein daumennagelgroßes Stück Katzengold. Vor der Tür zum Berns’schen Haus hatte er den Jungen abgefangen.
«Is nicht echt», hatte Klipper Eu gleich dazugesagt. «Sieht bloß so aus. Kenn eine Stelle, da is alles voll davon. Is aber nicht echt.»
Bis auf die Größe war es wirklich fast unmöglich, einen Unterschied zu den Goldpartikeln in Rudolphs Phiole zu erkennen. Vielleicht war der Glanz etwas kühler, etwas silbriger – aber wem würde das schon auffallen? Sicher nicht einem Fünfjährigen, dachte Rudolph. An diesem Tag würde er nicht zu seinem Vater ins Geschäft gehen und auch nicht hinauf zu seinem Apfelbaum. An diesem Tag wollte er Max eine Freude machen. Der Kleine war noch nie auf der Kiesbank gewesen! Was würde er für Augen machen, wenn er unter dem Stein, den Rudolph ihm zeigen würde, ein Stück Gold fände … Rudolph spürte ein Kribbeln im Bauch, wenn er daran dachte. Max würde sehr, sehr glücklich sein.
Den Stein fest in der Hand umschlossen, lief Rudolph zur Kiesbank. Er hatte sie ganz für sich alleine. Es war Mittwoch, Markttag, und niemandem würde es ausgerechnet heute einfallen, Gold zu waschen. Es galt, ein gutes Versteck für das Nugget zu finden. Es durfte weder zu offensichtlich sein – Max sollte keinen Verdacht schöpfen – noch zu abgelegen, sonst würde Rudolph es vielleicht selber nicht wiederfinden. Vor allem durfte es nicht zu nah am Wasser sein, für den Fall, dass es den Boden plötzlich wegriss. An jeder Stelle hatte Rudolph etwas auszusetzen, es war, als gäbe es auf der gesamten Kiesbank kein geeignetes Versteck. Da bemerkte er, dass Klipper Eu seine Schaufel neben einem großen Stein hatte liegenlassen. Vielleicht war das ein Zeichen.
Rudolph nahm die Schaufel und hob vorsichtig ein kleines Loch neben dem Stein aus. Er hockte sich hin, wühlte aus Vergnügen ein bisschen mit den Händen darin und verlor darüber fast das Katzengold. Er bekam es wieder zu fassen und pfiff durch die Zähne. So beschäftigt war er, dass ihm gar nicht aufgefallen war, wie sich ein feiner Herr von der Böschung aus genähert hatte. Vielleicht ein Spaziergänger? Denn wie ein Goldwäscher sah er nun wirklich nicht aus. Rudolph wusste, wie der aussah: wie ein Düsseldorfer. Die Düsseldorfer, die nach Uerdingen kamen, trugen alle hohe Hüte, weiße Kragen und lange, schwarze Mäntel, und an ihren Fingern blitzten schwere Goldringe.
«Na, was hast du denn da, Junge?» Der Herr war in seinen schwarzen Lackschuhen doch wirklich auf den Kies getreten!
«Nichts», sagte Rudolph und drehte das Katzengold verlegen in seiner Hand.
«Ich glaube doch, ich habe etwas in deiner Hand gesehen.»
Rudolph konnte nicht anders, er musste dem Herrn das Katzengold zeigen.
«Das ist kein Gold», sagte Rudolph. «Das ist nichts weiter, das habe ich nicht gefunden, ich wollte es nur für meinen Bruder …»
«Papperlapapp», sagte der Herr. Er nahm Rudolph das Nugget aus der Hand und hielt es vor sein rechtes Auge.
«Ganz bemerkenswert … Wo genau hast du das gefunden?»
«Nein, der Herr», stotterte Rudolph verwirrt. «Hab ich nicht! Das ist doch gar nichts, das ist nur ein Stein, den mir der Klipper Eu geschenkt hat!»
Jetzt wollte er am liebsten losheulen. Schon spürte er, wie sich seine Kehle zusammenzog. Der Herr wollte einfach nicht begreifen.
«Wo kommt es her, Junge? Wie viel willst du dafür haben? Na los, sag schon!»
Es war zum Verzweifeln, der Herr redete einfach immer weiter. Als könnte er gar nicht hören, was Rudolph sagte. Der Wunsch zu weinen wurde immer stärker. Schon verzog es Rudolph den Mund, die Nasenflügel blähten sich – aber da passierte etwas Seltsames: Der Mann steckte das Nugget in seine Manteltasche und drückte Rudolph einen Taler in die Hand. Dann hastete er die Böschung hoch.
Rudolph blieb noch eine Weile auf der Kiesbank stehen und sah auf das Geld in seiner Hand. Er konnte noch immer nicht ganz begreifen, was geschehen war. Was würde nun aus seinem Geschenk für Max? Erst nach einiger Zeit fasste er einen neuen Entschluss. Sobald seine Schuhe wieder trocken wären, würde er in die Herbertz’sche Kolonialwarenhandlung gehen und Max den Affen kaufen.
Und dann kam der Tag, der die Zukunft brachte. Am 29. September 1849 las Vater morgens aus der Zeitung vor: «Die Zukunft ist da! Die Eisenbahn kommt! Was lange vorbereitet wurde, wird morgen endlich wahr und in die Geschichte eingehen. Nicht die Revolutionäre, die Eisenbahn schafft’s! Dies wird schon bald das Ende der morastigen Landwege sein, der betrunkenen Postillione und überladenen Kutschen. Uerdingen wird angeschlossen an die Bergisch-Märkische-Bahn, und bald schon an ganz Preußen! Gott segne König Friedrich Wilhelm IV.!» Was der König mit der Eisenbahn zu tun hatte, verstand Rudolph nicht ganz.
In der Schule hing eine Daguerreotypie, von der aus der Monarch triefäugig und stumpf auf die Wand gegenüber stierte. Unmöglich, dass so jemand die Zukunft brachte. Die Zukunft, das wusste Rudolph, hatten Männer gebracht, die wochenlang auf den Obstfeldern gearbeitet hatten. Nur dass das jetzt keine Obstfelder mehr waren, sondern Teile der Eisenbahnstrecke. Rudolph hatte die Arbeiten von seinem Apfelbaum aus genau verfolgt. Einer der Männer stach besonders hervor. Anders als die übrigen schleppte er keine Schwellen hin und her oder verlötete Gleisteile, sondern stand mit einem Heft in der Hand daneben, kratzte sich ab und zu an der Stirn und brüllte Befehle, so laut, dass sie bis an Rudolphs Versteck im Baum drangen.
Das, so erklärte Vater später, sei der Ingenieur. Und die Ingenieure, so fügte er hinzu, nähmen die Welt nicht hin, wie sie war, sondern bauten sie sich so zurecht, wie es ihnen passte.
Darüber hatte Rudolph lange nachgedacht. Jetzt wusste er, was er dem Lehrer das nächste Mal sagen musste, wenn der die Kinder fragen würde, was sie einmal werden wollten. «Schatzsucher» schien kein anerkannter Beruf zu sein, der Ohrfeige nach zu urteilen, die diese Antwort Rudolph beim letzten Mal eingehandelt hatte.
Rudolph behielt jenen Tag, der die Zukunft brachte, vor allem als ein Beben in Erinnerung, das durch die Erde und die Dinge ging. Schon während des Frühstücks war es ihm aufgefallen: Ein Kitzeln stahl sich von den Fußsohlen bis hinauf in die Haarspitzen. Niemand am Tisch konnte stillsitzen, auch Vater und Mutter schienen aufgeregt und sprangen immer wieder auf. Selbst Großvater, der kaum noch gehen konnte, hatte Vater gebannt zugehört, die Augen weit aufgerissen, als könne er kaum glauben, was gerade geschah.
Vater trug seinen schwarzen Anzug, sogar die goldene Uhr hatte er angelegt; Mutter eilte in einem blassrosa Spitzenkleid umher und suchte nach der Perlenkette ihrer Großmutter. Auch die Kinder waren hergerichtet worden: Rudolph steckte in einem schon etwas eng sitzenden, dunkelblauen Hemd, Max trug einen der neumodischen Matrosenanzüge, und Elise thronte da in ihrem bauschigen weißen Sonntagskleidchen. Es war ein ungewöhnlich warmer Tag; sie alle rutschten auf ihren Stühlen hin und her, schwitzten und meinten doch, von einem Beben nichts zu merken. Als Rudolph sie darauf ansprach, verneinten sie bloß, und die Mutter fragte, was er schon wieder ausheckte. Sie erwartete keine Antwort, das wusste Rudolph.
Draußen auf der Straße erzitterte das herbstwelke Laub der Linden, und durch die Erde ging ein Vibrieren, das sich auf die Häuser und ihre Wände übertrug. Max und Elise bekamen keinen Bissen hinunter, und er, Rudolph, war ganz damit beschäftigt, das Fensterbrett zu umklammern und aus dem Fenster zu starren, zu dem das Getrappel der Passanten heraufdrang. Dann hielt er es nicht mehr aus.
«Wir müssen los!», schrie Rudolph endlich. Max und Elise krähten es ihm nach und verschütteten ihre Milchnudeln, niemand scherte sich darum. Großvater lachte. Es war wirklich ein besonderer Tag.
Noch nie hatte Rudolph so viele Menschen auf den Straßen gesehen. Sie alle zogen zum neuen Bahnhof, an dem in Kürze die Eisenbahn eintreffen sollte. Und man ging zu Fuß! Mutters Wangen waren gerötet, das Haar spätestens an der Kreuzung von Nieder- und Bahnhofsstraße in Unordnung geraten. Max und Elise gingen brav an Vaters Händen. Vor lauter Staunen bekam Max den Mund nicht zu: Durch die Bahnhofsstraße wogte ein Meer aus schwarzen Anzügen, Zylinderhüten und festlichen Kleidern.
Die Familie geriet in eine Gruppe von Schlossern, davor liefen die Gebrüder Herbertz mit ihren Gattinnen, außerdem waren da Kaufmann Holdinghausen, Brauereibesitzer Wienges, Doktor Lewin, die Arbeiter aus den Destillerien, die Schmiede – sie alle gingen zusammen.
«Also doch Revolution», sagte der Vater leise, aber außer Rudolph, der nicht von seiner Seite wich, und Bäcker Stinges, der neben ihnen lief, hatte ihn niemand gehört.
«Der Zukunft entgegen!», brüllte ein junger Mann mit senfgelbem Mantel und einer Mütze, die aussah wie ein aufgeweichtes Brot. Als sich ein Gendarm nach ihm umdrehte, hantierte er umständlich an seiner Pfeife und ließ sich etwas zurückfallen.
Der Platz vor dem Bahnhof war in einen riesigen Biergarten verwandelt worden. Man nahm auf den Bänken Platz, trank Wienges’ Bier und aß Stinges’ Brötchen. Die Kapelle spielte auf, der Bürgermeister sprach zu seinen Bürgern, aber es half alles nichts – die Bahn ließ auf sich warten. Wienges war vorbereitet. Mehrere Bierkutschen standen abseits, immer bereit, einen Engpass zu überbrücken. Nach kurzer Zeit schon spielte die Kapelle lauter, der Bürgermeister hielt aus dem Stegreif eine bierselige Rede, in der es um Napoleon, Napoleons Bauch und seinen lächerlichen Hut ging. Natürlich erinnerte er auch an den Besuch des Franzosen in Uerdingen. Das sei aber gar nichts gewesen gegen den heutigen Tag! Die Menge johlte, längst gab es keine Sitzplätze mehr, die Brötchen waren ausverkauft.
Dafür war das feine Oszillieren der Erde nun deutlich zu spüren. Rudolph packte seine Geschwister und rannte mit ihnen am Bahnhofsgebäude vorbei, hin zu einer Stelle an den Gleisen, an der noch nicht so viele Menschen standen. Jetzt hielt es auch die Erwachsenen, die bis dahin auf den Bänken sitzen geblieben waren, nicht mehr an ihren Plätzen: Alles drängte und schubste in Richtung Gleise.
Auch der Vater war aufgestanden und versuchte, zu den Kindern vorzudringen, aber die Menschen standen zu eng beieinander, es ging weder nach vorne noch zurück. Die Vögel in den Linden schrien, die Hunde jaulten, die Schindeln auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes klapperten; hinten, bei den Biertischen, hörte man lautes Lachen und das Schreien einer Frau, wieder jaulte ein Hund – nein, es war kein Hund, diesmal war es die Bahn, die Bahn am Horizont.
Rudolph ließ seine Geschwister los und ballte die Hände zu Fäusten. Das, was wie ein Jaulen geklungen hatte, wurde zu einem ohrenbetäubenden Brüllen; in einiger Ferne sah man eine Rauchwolke aufsteigen, aus der sich langsam die Lokomotive herausschob. Aber genau in diesem Moment wälzte sich der uniformierte Bahnwärter in Rudolphs Blickfeld. In seiner Verzweiflung stieß Rudolph den Mann zur Seite und rannte auf die Schienen. Jetzt konnte er sie sehen: die Lokomotive, sie war es wirklich!
Rudolph fiel es später schwer zu erklären, warum er sich nicht hatte fortbewegen können. Es war, als hätte der Anblick der sich nähernden Lokomotive ihn gelähmt: ein feuer- und wasserspeiender Koloss, der die ganze Welt um ihn herum in Rauch und Dampf hüllte.
Die Kupplung starrte ihn wie aus zwei aufgerissenen Augen an, immer näher kam die Lokomotive, das Stampfen der Räder, das verzerrte Gesicht des Lokomotivführers auf dem Führerstand, die Rauchkammer, das aufblitzende Spitzensignal, der Aufschrei der Menge! Schon türmte sich die Esse hoch in den Himmel – da packte jemand Rudolph am Arm und zog ihn von den Gleisen. Im nächsten Moment schob sich die Lokomotive über die Stelle, an der Rudolph eben noch gestanden hatte, und kam am Bahnhof mit ohrenbetäubendem Quietschen zum Stehen.
Rudolph löste sich aus dem Griff seines Retters, drängte vor zu den Rädern, sie zu berühren, sie zu umarmen, aber schon kam der Lokomotivführer vom Stand heruntergesprungen.
«Das Grinsen werd ich dir austreiben!»
Er schrie noch etwas, ein goldener Schneidezahn blitzte auf, dann schlug er Rudolph ins Gesicht – einmal, zweimal, dreimal. Blut spritzte, aber Rudolph war es ganz egal, Rudolph war glücklich. Mit einem Lächeln auf den Lippen verlor er drei Milchzähne. Dann schritt sein Vater ein, im Hintergrund spielte die Kapelle wieder auf.
Das Beben hatte nachgelassen.
Von Berlin hörte Rudolph das erste Mal an dem Tag, an dem sein Großvater beerdigt wurde. Spät am Abend, die Kinder waren längst im Bett, tönte es aus dem Schlafzimmer der Eltern: Berlin, Berlin, immer wieder Berlin. Das war der Bass des Vaters. Max und Elise schliefen einfach weiter, die beiden hatten viel geweint, so etwas strengt an. Rudolph hatte stumm neben dem offenen Sarg gestanden und darauf gewartet, dass es passierte: dass er den Großvater sah, wie er war, und gleichzeitig, in einer anderen Version, als einen gesunden jungen Mann voller Kraft und Tatendrang – aber nichts dergleichen geschah. Großvater hatte alle anderen Versionen von sich mit in den Tod genommen.
Dabei hätte Doktor Lewin ihm durchaus noch ein paar Monate zollfrei, wie er sich ausdrückte, zugebilligt, Nierenleiden hin oder her. Doch es hatte nichts geholfen. Erst war Großvater blass geworden, dann hatte er unter Schwindel und Übelkeit gelitten, und am Ende war er nicht einmal mehr die Treppe ins Geschäft hinuntergekommen. So sehr hatte es ihn in den Beinen gejuckt, dass er Rudolph aufforderte, ihn mit einer Gabel zu kratzen. Dann aber waren die Krämpfe gekommen, und die Zeit der Gabeln war vorbei. Vater hatte am Fenster gestanden, und die Mutter war ständig hin und her geeilt. Einzig Rudolph hatte die ganze Zeit auf dem Stuhl neben Großvaters Bett gesessen. Als Großvater anfing, nach Luft zu schnappen, wusste Rudolph, dass es bald vorbei sein würde. Die letzten Worte, die Großvater sagte, waren «Hans Guck-in-die-Luft», was danach kam, verstand Rudolph schon nicht mehr. Der Tod hatte Großvater an der Angel, und er ließ ihn so lange zappeln, bis alle Kraft aus ihm gewichen war. «Hans Guck-in-den-Tod», flüsterte Rudolph, als es vollbracht war. Die Gabeln hatte die Mutter später alle fortgeschmissen.
Und nun also der Streit. Warum mussten Erwachsene immer in der Nacht streiten? Wieder dieses Wort: Berlin. Jetzt hatte es auch die Mutter ausgesprochen. Merkwürdig anders klang es aus ihrem Mund, wie etwas Unfeines, etwas, über das man mit niemandem sprach, weil es sich einfach nicht gehörte. Rudolph schlich sich an seinen schlafenden Geschwistern vorbei und hinaus in den Flur.
«Hast du gar kein Schamgefühl?», hörte er da seine Mutter fragen. Beinahe hätte er geantwortet, aber die Schlafzimmertür der Eltern war noch immer geschlossen, sie konnte ihn unmöglich bemerkt haben.
«Das Geschäft kommt zuerst», sagte Vater. «Aber wir machen’s anders als der Alte. Wir trauen uns was.»
Rudolph presste sein rechtes Ohr so eng an die Tür, dass er das Mahlen eines Holzwurms hören konnte. Als sich in das Mahlen des Wurms das Weinen der Mutter mischte, begriff Rudolph, dass eine Entscheidung gefallen war. Warum nur konnte er sich nicht darüber freuen? Berlin klang wie eine große Stadt, viel größer als Uerdingen. Aber wie er da vor der Tür der Eltern stand, überkam ihn das Gefühl, dass etwas unwiederbringlich zu Ende gehen würde, etwas, das sich nie wieder herstellen ließe. Verwirrt wischte er sich eine Träne ab, lief zurück in das Kinderzimmer und weckte Max. Zusammen saßen sie bis zum Morgen auf Rudolphs Bett und zählten die Münzen, die sie mit dem Verkauf von Katzengold verdient hatten. Nach Berlin durfte man nicht mit leeren Händen fahren, das war klar.
In den nächsten Wochen gab es viel zu tun. Melcher ging bei ihnen nun ein und aus.
«Eine eigene Vertretung in Berlin, das ist doch –!» Der Sauerbraten der Mutter schmeckte Melcher besonders gut. Wann immer er kam, schob ihm Rudolph eine von Großvaters Gabeln hin. Kaum hatte die Mutter sie nach dessen Tod fortgeschmissen, hatte Rudolph sie wieder aus dem Müll hervorgeklaubt. Niemand schien es bemerkt zu haben.
Die Eltern waren damit beschäftigt, mit Melcher und dem Notar die Bedingungen eines Kaufvertrags auszuhandeln. Melcher wollte nicht nur für den Umzug aufkommen, er würde ihnen sogar das Berns’sche Haus samt Geschäft zu einem guten Preis abkaufen. Natürlich verpflichtete sich der Vater im Gegenzug, Melchers Waren anzubieten. Sogar ein Lokal mit darüberliegender Wohnung hatte Melcher in Berlin aufgetan: ein kleines Geschäft in der Friedrichstadt, und wer etwas von Berlin verstand, wusste, was das hieß.
«Das heißt Profit!», sagte Melcher. «In der Friedrichstadt, mein Freund, da geht die bessere Gesellschaft einkaufen. Und was will die bessere Gesellschaft? Sicher kein trübes, stinkendes, gepanschtes Bier, was, Frau Berns!»
Aber Caroline Berns sah bloß auf ihre Hände und seufzte. Melcher griff Rudolph am Arm und zog ihn zu sich heran. Ob der kleine Herr denn eine Vorstellung von Berlin habe? Von der großen Stadt? Das sei etwas anderes als Uerdingen, darauf könne er sich gefasst machen. Eigentlich sei das gar keine Stadt, sondern eine lebendige Kreatur, die sich ständig verändere, sich selber immerfort neu erfinde. Er werde schon sehen!
Klipper Eu saß wie immer auf der Kiesbank. Rudolph erkannte ihn schon von weitem an seinem zerschlissenen Mantel. Bei der umgestürzten Weide hatte er es sich bequem gemacht. Anders als sonst rannte Rudolph aber nicht das Ufer entlang, sprang nicht über die Weidenäste und rutschte auch nicht die Böschung hinab. Seine Füße wogen Zentner, und jeder Schritt kostete unendlich viel Kraft. Dabei hatte er sich doch genau zurechtgelegt, was er Klipper Eu erzählen wollte: Die Stadt Berlin sei so groß, bis zum Horizont und hinauf zum Himmel reiche sie! Riesige Paläste baue man dort, Tunnel, Kanäle, einfach alles! Berlin würde von Leuten mit Phantasie erbaut und bewohnt, und deshalb, so wollte er sagen, sei Berlin ein besserer Ort für ihn, Rudolph. Klipper Eu musste es einfach begreifen.
Aber dann war da bloß Klipper Eus wissender Blick, der Schlapphut, der darüber hing, und plötzlich war alles vergessen.
«Wir müssen weg», sagte Rudolph.
«Ich weiß», sagte Klipper Eu.
«Ich hab Angst.»
«Ich weiß.»
Stumm reichte Rudolph ihm die Phiole, auf deren gläsernem Boden sich der Goldflitter hin und her schob. Klipper Eu steckte sie wortlos in die Innentasche seines Mantels. Dann nahm er Rudolphs Hand und steckte etwas hinein. Als Rudolph sie öffnete, fand er darin eine silberne Münze. Sie war uneben und ihre Ecken so scharf, dass man sie als kleines Messer hätte benutzen können. Auf einer der Seiten erkannte Rudolph eine Kornähre, auf der anderen vielleicht einen Kopf, aber mit Sicherheit ließ sich das nicht sagen.
«Hat Gaius Julius hier für dich liegen lassen», sagte Klipper Eu. «Als er den Fluss überquerte. Is aber schon was her.»
Rudolph umarmte Klipper Eu so heftig, beinahe rutschte er vom Weidenstamm herunter. Er schmiegte sich an Klipper Eus Hals, dorthin, wo sich Falten tief in die Haut gruben und ein verzweigtes Netz bildeten. Wie eine Landkarte, dachte Rudolph. Wie eine Landkarte, die keiner lesen kann außer mir.
Zum Abschied sagte er Klipper Eu, dass er ihm ganz sicher schreiben werde, und er solle ihm auch ganz sicher schreiben, und zwar nach Berlin, nach Berlin, ob das in seinen Kopf hineingehe? Sicherheitshalber, für den Fall, dass es nicht in seinen Kopf hineinging, steckte er Klipper Eu einen Zettel in die Manteltasche. Darauf stand: Weinhandlung Berns, Leipziger Straße 72, Berlin.
2.Drei Briefe ohne Antwort
War die Leipziger Straße nach der Ankunft der Familie noch genauso beschaulich wie das Wohnviertel, das sie umgab, so entwickelte sie sich schon bald zur Hauptverkehrsader der Friedrichstadt. Die Revolution und die Barrikadenkämpfe waren an ihr vorbeigezogen, ohne Schäden zu hinterlassen. Erst noch ganz aus Schotter, wurde die Fahrbahn wenig später gepflastert; die Bürgersteige ließ man mit Granitplatten auslegen, den Rinnstein darunter verbergen, die Zahl der Gaslaternen erhöhen. Passierten in der ersten Zeit nur vereinzelt Droschken und Kutschen das Berns’sche Haus, so wurde der Verkehr rasch immer dichter, Pferdeomnibusse fuhren umher, und unweit des Potsdamer Bahnhofs hörte man das Pfeifen der Verbindungsbahn, die zwischen den Kopfbahnhöfen Berlins hin- und herpendelte.
Kaum zwei Blocks entfernt von der Berns’schen Weinhandlung befand sich das Palais Hardenberg, in dem der Preußische Landtag zusammenkam. Die Adligen, die dort ein und aus gingen, wohnten in den Häusern nahe der Zollmauer, die den Warenschmuggel verhindern sollte. Die prächtigen Ministergärten, die sich gleich davor erstreckten, eigneten sich aufs beste für den Konsum von französischem Wein und allerlei Spirituosen. Nur zu gern belieferte Johann Berns seine Kundschaft persönlich. Die Herrschaften schätzten seinen politischen Sachverstand – das Abonnement der Vossischen Zeitung machte sich bezahlt.