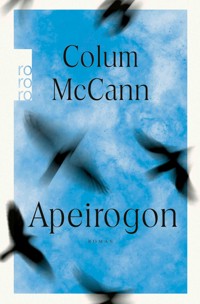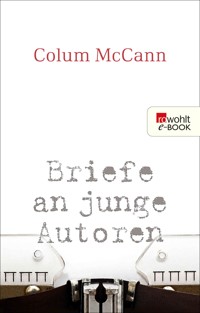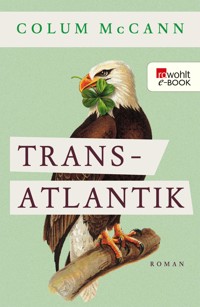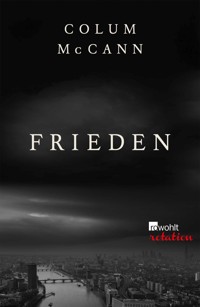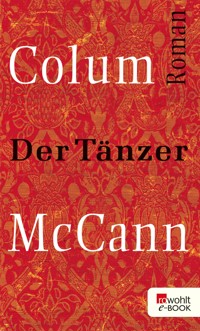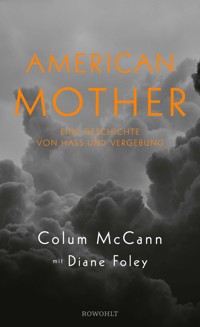
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
2021 sitzt Diane Foley, Mutter des 2014 durch den IS enthaupteten US-Journalisten James Foley, im Gefängnis einem Briten namens Alexanda Kotey gegenüber, der sich soeben des Kidnappings, der Folter und der Ermordung ihres Sohnes in Syrien schuldig bekannt hat. Mit dieser ungeheuerlichen Begegnung beginnt «American Mother», Colum McCann hat Diane Foley für dieses Erinnerungsbuch seine Stimme geliehen. Gemeinsam lassen sie das Leben des Getöteten Revue passieren und setzen einem Mann ein Denkmal, der als Journalist über die Killing Fields dieser Welt berichtete, angetrieben vom Streben nach Wahrheit. Diane Foley will sich nicht im Hass verlieren, will nicht im Schmerz verharren. Sie kämpft für die Angehörigen von Geiseln, gegen die Trägheit der Institutionen, und ruht nicht, bis sie am Ende dem Mörder ihres Kindes ein Eingeständnis entlockt hat – und ihm die Hand reicht. «Diane Foleys Glaube und Mitgefühl kommen einem Wunder sehr nahe. Und als der Mörder ihres Sohnes am Ende ihre Hand schüttelt, scheint er so sehr von Ehrfurcht erfüllt vor ihrem Mut, wie es die Leser ihres Buches sein werden.» The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Ähnliche
Colum McCann • Diane Foley
American Mother
Eine Geschichte von Hass und Vergebung
Über dieses Buch
2021 sitzt Diane Foley, Mutter des 2014 durch den IS enthaupteten US-Journalisten James Foley, im Gefängnis einem Briten namens Alexanda Kotey gegenüber, der sich soeben des Kidnappings, der Folter und der Ermordung ihres Sohnes in Syrien schuldig bekannt hat. Mit dieser ungeheuerlichen Begegnung beginnt «American Mother», Colum McCann hat Diane Foley für dieses Erinnerungsbuch seine Stimme geliehen. Gemeinsam lassen sie das Leben des Getöteten Revue passieren und setzen einem Mann ein Denkmal, der als Journalist über die Killing Fields dieser Welt berichtete, angetrieben vom Streben nach Wahrheit. Diane Foley will sich nicht im Hass verlieren, will nicht im Schmerz verharren. Sie kämpft für die Angehörigen von Geiseln, gegen die Trägheit der Institutionen, und ruht nicht, bis sie am Ende dem Mörder ihres Kindes ein Eingeständnis entlockt hat.
Dieses so bemerkenswerte wie berührende Buch ist ein Thriller, eine Biographie, das Erinnerungsbuch einer kämpferischen Mutter, eine literarische Auseinandersetzung mit Hass und Vergebung.
Vita
Colum McCann wurde 1965 in Dublin geboren. Er arbeitete als Journalist, Farmarbeiter und Lehrer und unternahm lange Reisen durch Asien, Europa und Amerika. Für seine Romane und Erzählungen erhielt McCann zahlreiche Literaturpreise, unter anderem den Hennessy Award und den Rooney Prize for Irish Literature. Zum internationalen Bestsellerautor wurde er mit den Romanen «Der Tänzer» und «Zoli». Für den Roman «Die große Welt» erhielt er 2009 den National Book Award. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in New York.
Volker Oldenburg lebt in Hamburg. Er übersetzte unter anderem Colum McCann, Oscar Wilde, T Cooper und Dinaw Mengestu. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis.
Diane Foley ist die Mutter des Kriegsjournalisten James Wright Foley, der 2012 vom IS gekidnappt und nach langem Leiden 2014 vor der Kamera ermordet wurde. Foley wurde in der Folge eine leidenschaftliche Stimme der Angehörigen von Opfern politischer Entführung, sie trieb Gelder auf, betrieb Lobbying, gründete mehrere Organisationen. Ursprünglich hatte Diane Foley Pflegewissenschaften studiert; fast 20 Jahre lang arbeitete sie als Familienkrankenpflegerin. Sie steht seit deren Gründung der James W. Foley Legacy Foundation vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «American Mother» bei Etruscan Press, Pennsylvania.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«American Mother» Copyright © 2024 by ColumMcCann and Diane Foley
Foto Buch 1: Colum McCann; Fotos Buch 2 und 3: Familie Foley
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Adobe Stock
ISBN 978-3-644-01844-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In den Herzen derer weiterzuleben, die wir zurücklassen, heißt, nicht zu sterben.
Thomas Campbell
Dieses Buch ist Kayla, Peter, Steven und Jim gewidmet.
Und auch Rita.
Sowie Müttern überall.
Buch eins
Sie erwacht im dunklen Hotelzimmer. Ein Lichtschimmer durch die dünnen Vorhänge. Dort, in der Ferne, Washington, D.C. – Stadt der Wahrheiten, Halbwahrheiten, Doppelwahrheiten, Lügen. Eine sichere Wahrheit: Ihr Sohn ist seit sieben Jahren tot, und heute Morgen trifft sie einen seiner Mörder.
Diese Vorstellung löst Beklemmungen in ihr aus. Nicht nur, weil sie nicht weiß, was sie von ihm zu erwarten hat: Ebenso wenig hat sie eine Vorstellung davon, was sie von sich selbst erwarten kann. Eine Sinfonie der Verwirrung. Mitgefühl. Rache. Verbitterung. Barmherzigkeit. Verlust. Gnade.
In der Nacht hat sie gebetet, noch mehr als üblich. Die höchsten Mächte angefleht. Das Dunkle durchforstet und auch das Helle. Stundenlang darüber nachgedacht, wie sie ihn ansprechen soll. Alexanda. Alexe. Alex. Kotey. Mister Kotey. Nein. Nicht Mister. Ausgeschlossen. Schließlich ist sie mit ihren dreiundsiebzig fast doppelt so alt wie er.
Aber es gibt Umgangsformen. Anstand. Jeder verdient einen Namen, auch die, die anderen ihren Namen genommen haben.
Sie macht das Licht an. Das Hotelzimmer ist groß und spärlich möbliert. Sie öffnet den Schrank. Darin hängen ordentlich die Kleidungsstücke, die sie ausgewählt hat. Das lange, gemusterte Kleid. Ein grauer Rollkragenpullover für darunter. Ein schicker Schal, den Jim ihr vor vielen Jahren, nach seiner ersten Geiselhaft, aus Libyen mitgebracht hat. Die hochhackigen Schuhe, die weder zweckmäßig noch bequem sind. Auf der Ablage im Badezimmer liegen goldene Creolen und die goldene Halskette aus Ecuador, die sie tragen will: ein Amulett mit der heiligen Gottesmutter. Ein Rosenkranzarmband aus Kroatien. Geschenke ihrer Mutter.
Ihr Make-up ist dezent. Sie trägt einen Hauch Lippenstift auf. Ihr dunkles Haar gehört zu ihren letzten Eitelkeiten: Sie geht mit Händen und Bürste hindurch, fächert es zu den Seiten auf.
Sie begutachtet sich im Spiegel. Ihre Erscheinung besteht aus Schichten. Selbstsicher, elegant sogar, aber darunter ist sie dünnhäutig, angespannt, verletzlich. Wie soll sie vorgehen? Wie ihrem gepeinigten Herzen zu seinem Recht verhelfen? Wie den Schmerz unterdrücken? Wie ihm in die Augen sehen? Wie den Hass ausschalten? Wie die Maschinerie ihres Denkens steuern?
Sie geht zum Bett zurück, kniet sich noch einmal hin. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Lass mich barmherzig sein. Gib mir Kraft.
Der Raum im Gerichtsgebäude ist groß. Fensterlos. Das Licht kalt. Die Tische bilden zusammen ein großes Rechteck. Kotey sitzt allein im vorderen Teil des Raums, den Kopf gesenkt. Er ist Ende dreißig, breitschultrig, das Haar kurz geschoren. Borstiger, mittellanger Bart. Er trägt einen grünen Overall mit kurzen Ärmeln. Seine Füße sind gefesselt, die freien Hände liegen gefaltet auf dem Tisch. Sogar im Sitzen wirkt er groß und kräftig – viel kräftiger, als sie erwartet hat.
Sie geht sicheren Schrittes durch den Raum. Die Stühle sind so platziert, dass sie ihm gegenübersitzt. Keine Glasscheibe. Kein Gitter. Nur ein Konferenztisch. Die Corona-Abstandsregeln wurden eingehalten, sodass sie sich keine Sorgen darüber machen muss, sie könnte aus einem Impuls heraus über den Tisch langen, um ihm die Hand zu geben. Dieser Gedanke hatte ihr Angst gemacht: Sie wollte ihn nicht berühren. Sie nimmt die Maske ab: Alle im Raum sind geimpft. Kotey bleibt sitzen, den Kopf noch immer leicht gesenkt, die Hände unruhig. Seine Fingernägel, fällt ihr auf, sind lang und sauber.
Sieben weitere Menschen sitzen im Raum, um das Gespräch zu verfolgen. Drei von der Verteidigung. Drei von der Staatsanwaltschaft. Eine Freundin der Familie, die ihr bei den Fragen zur Seite stehen soll. Doch im Grunde sind da nur sie und er.
«Guten Morgen, Alexanda», sagt sie, als sie Platz nimmt.
Sie wirkt heiter, das tut sie immer, auch in den schwierigsten Zeiten. Das ist Teil ihrer natürlichen Tarnung. Man kennt sie für ihr Lächeln, ihre gewinnende Art, die ruhige Gelassenheit.
Sie betont seinen Namen in der Mitte, zieht die Silbe lang wie ein Gummiband. «Alex-aahn-da.» Ihr Akzent ist reines New England. Sie wollte ihn nicht Alexe nennen, der Name, den er bevorzugt und den die Verteidigung gebraucht, seit er vor vier Monaten nach Amerika gebracht wurde. Auch die Kurzform Alex, mit der ihn die Staatsanwaltschaft bei den Vernehmungen anspricht, wollte sie nicht verwenden.
Alexanda. Der Name, den ihm seine Mutter gegeben hat. Wenigstens das sollte man ihm zugestehen. Es liegt eine gewisse Würde darin.
Er hebt leicht den Blick, nickt kaum merklich. Seine Augen sind kompliziert, dunkelbraun, mit tiefen Ringen. Es ist schwer zu sagen, was sich darin verbirgt.
«Guten Morgen», sagt er.
Sie richtet sich noch einmal auf, zieht den Schal zurecht. Er soll sofort merken, dass sie sich nicht im Mindesten vor ihm fürchtet. Sie legt die Hände auf den Tisch: Ihr Armband klimpert. Er bewegt die Füße, und die Titanfesseln machen ein leises Geräusch. Armband und Fußfesseln.
Sie wird nicht weinen. Das letzte Mal hat sie am Tag von Jims Tod geweint. Vor sieben Jahren. Stattdessen lächelt sie: stählern und doch warm. Sie ist eine entschlossene Frau. Ihre große Leistung ist, dass sie ihren Schmerz nicht nach außen dringen lässt.
«Sie können mich Diane nennen.»
Er nickt, schiebt die Finger über den Handrücken: als ob seine Hände gleichzeitig offen und geschlossen wären. Er erscheint ihr wie ein dunkler Eingang: Irgendwo dort, direkt gegenüber, wartet ihr Sohn.
Er hat sich in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, einschließlich der Verschwörung zum Mord an James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig und Kayla Mueller. Für jeden Anklagepunkt bekommt er eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Die heutige Begegnung ist Teil eines besonderen Deals zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Er sitzt in einem Gefängnis in Virginia und hat eingewilligt, vor der endgültigen Urteilsverkündung, falls gewünscht, mit den Familien der Opfer zu sprechen. Sie war die Erste, die den Wunsch geäußert hat, ihn zu treffen, und vielleicht bleibt sie am Ende die Einzige.
Doch sogar in ihrer eigenen Familie gibt es Zweifel, Unmut, Zorn, Enttäuschung. Warum Kotey ein Podium geben? Warum ihm unnötig Bedeutung verleihen? Hat er nicht schon gestanden? Warum ihn nicht in seiner Zelle verfaulen lassen? Warum sich gegenüber einem Terroristen öffnen? Warum ihm Zeit schenken? Ist jeder Funke Respekt nicht schon zu viel? Wissen wir denn nicht, was für ein Mensch er ist? Die schwarze Kapuze. Die Augen. Der Wüstensand. Der orange Overall. Die kniende Gestalt. Das Durchschneiden der Kehle. Dann der groteske Anblick des abgetrennten Kopfes auf dem Rücken ihres Sohnes. Warum die Qualen der Vergangenheit zurückholen?
Andere finden es mutig, dass sie sich mit ihm trifft, eine außergewöhnliche Tat. Aber es handelt sich nicht um Mut, nein, nicht für sie, ganz und gar nicht. Es handelt sich auch nicht um einen Gnadenakt oder um Vergebung. Nein. Vielleicht weigert sie sich einfach, Angst zu haben. Vielleicht ist das ihr Weg, ihm zu sagen, dass er ihren Sohn eigentlich gar nicht getötet hat. Vielleicht ist es tatsächlich so elementar: Ich bin seine Mutter, und du hast ihn nicht ermordet, und ich bin hier, um dir das zu sagen.
«Ich hoffe», sagt sie, «man behandelt Sie gut.»
Im Raum knistert die Spannung des Unausgesprochenen. Er nickt flüchtig.
«Ihr Name», sagt sie. «Alexanda. Das bedeutet ‹Beschützer des Volkes›.»
Später wird sie erfahren, dass sein Nachname, Kotey, aus Ghana stammt und ursprünglich «gute Seele» bedeutet.
Alexanda Kotey. Ehemaliger britischer Staatsbürger. Ehemaliger IS-Kämpfer. Ehemaliges Mitglied der Gruppe, die von der Presse die «Beatles» genannt wird. Ehemaliger Drogendealer. Jetzt in Haft. Staatenlos. Ein Mann, der den Rest seines Lebens in einem kleinen Raum verbringen wird, aus dem es kein Entkommen gibt.
Auch er lächelt. Es ist ein dünnes Lächeln, aber die frühzeitige Zuversicht darin entwaffnet sie. Dennoch behält sie ihr eigenes Lächeln bei, ihr stets höfliches, stählernes, warmes Lächeln. Es überdauert die Stille, in der sie ihre Notizen vor sich ausbreitet.
Immer wieder hat man sie gewarnt: Sieh dich vor, Diane, dieser Mann ist ein Lügner.
Sie hat ihn im Gerichtssaal gesehen, hier in Virginia, vor zwei Monaten, aus der Ferne. Die Todesstrafe war in den Verhandlungen zwischen der britischen und der US-amerikanischen Regierung ausgesetzt worden, mit Zustimmung der Opferfamilien. Er hatte sich in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, unter anderem der Verschwörung zum Mord in vier Fällen. Damals hatte er nicht die geringste Regung gezeigt. Er hatte in ihre und die Richtung ihres Mannes John geblickt, aber da war nichts. Sein Geständnis war einstudiert. Er war ein zugefrorener See. Völlig unbewegt. Freunden hat sie anvertraut, dass sie nicht hier ist, um ihm zu vergeben oder sein Gewissen zu erleichtern. Nein – sie ist aus einem anderen Grund hier. Aus welchem, weiß sie selbst noch nicht genau. Es ist ein Gefühl tief in ihrem Bauch. Und alles Mögliche könnte passieren. Er könnte ihr ausweichen. Er könnte versuchen, sie mit Rhetorik und Spott zu verhöhnen. Sogar der Psychopath könnte aus ihm hervorbrechen: Man hat sie darüber informiert, wie gefährlich er ist. Aber sie muss sich ihm stellen. Es geht nicht anders. Auch gegen den Rat ihrer Freunde und ihrer Familie. Jetzt ist sie hier. Es gibt kein Zurück mehr. Jim hätte dasselbe getan, um dem Ganzen etwas Sinnvolles abzugewinnen. Um zu erfahren, wer. Um zu erfahren, warum. Jim hätte sich ohne jeden Zweifel als Erster angeboten, mit ihm zu reden. Dennoch ist sie sich unsicher, ob sie etwas Wertvolles herausbekommen wird. Vielleicht reißen nur die alten Wunden wieder auf. Vielleicht ist das alles. Vielleicht begeht sie gerade einen Riesenfehler. Vielleicht haben die anderen recht: Sie hätte zu Hause im Nordosten bleiben sollen. Sie muss sich um so viele Menschen kümmern. Sie ist Ehefrau, Mutter, Großmutter und auch Tochter. Ihre Mutter Olga ist fünfundneunzig. Ihr Enkel Colin ist gerade mal eine Woche alt. Und gibt es etwas Schöneres auf der Welt, als sein Enkelkind im Arm zu halten?
Dennoch hat sie sich auf diesen Moment eingelassen. Zu wissen, wie ein geliebter Mensch gestorben ist, heißt, das Leben dieses Menschen besser zu verstehen. Ihn noch inniger zu lieben. Dieses Leben am Leben zu erhalten.
Die ersten Fragen entscheiden über den Gesprächsverlauf. Sie will ihn entwaffnen, aus dem Gleichgewicht bringen, zu dem Menschen hinter der Person vordringen, die er zu sein vorgibt.
«Nun, Alexanda», sagt sie. «Möchten Sie mich etwas fragen?»
Ein leichtes Zittern geht durch den Raum.
«Nein», sagt er nach einem Augenblick. «Ich bin nur für Sie hier. Um Ihre Fragen zu beantworten.»
Sein Akzent ist reines London. Schroff. Direkt. Weniger Cockney, als sie erwartet hätte. Fast glaubt sie, eine gewisse Bildung herauszuhören, obwohl sie weiß, dass er nicht über die Sekundarstufe hinausgekommen ist, dass sein Leben in Shepherd’s Bush jahrelang von Drogenhandel, Kokain, Schlägereien und Gangs geprägt war, bevor er schließlich zum Islam konvertierte und die Reise ins Verderben antrat.
Er hatte viel Zeit, über seine Antworten nachzudenken: zwei Jahre in einem nordsyrischen Gefängnis und mehrere Monate hier in Virginia, wo man ihm ein starkes Anwaltsteam und einen ordentlichen Strafprozess gegeben hat. Das, weiß sie, ist das Gute am amerikanischen Justizsystem. Ihr hingegen hat dieses System in der Vergangenheit schlecht gedient. Auch James und den anderen toten Geiseln hat es nicht gedient. Aber jetzt dient es dem Volk, und sie ist der Staatsanwaltschaft dankbar dafür, dass sie ihr diesen Moment ermöglicht hat, der irgendwo zwischen Verdammnis und Erlösung liegt.
«Aber ich habe Sie nach Ihren Fragen gefragt», sagt sie. «Was möchten Sie mich fragen?»
Er hebt kurz den Blick, sieht sie an. In einer Schachpartie hätte sie vielleicht einen Läufer gezogen, und er dächte jetzt darüber nach, ob er mit einem Springer- oder einem Bauernzug reagieren soll.
«Über James?», fragt er. «Darf ich ihn James nennen?»
«Ich nenne ihn Jim.»
«Ich kannte James nicht besonders gut.»
Ihr Jim, sein James. Ihre innige Bindung, seine Distanz. Ihr Armband, seine Fesseln. Ihre Gegenwart, seine Vergangenheit.
Er wirkt anders als der hagere, gehetzte Mann auf den Fotos aus der Zeit in Syrien. Er hat zugenommen. Ist muskulöser. Seine Art zu sprechen hat fast etwas Sanftes, etwas Höfliches oder zumindest Kontrolliertes. Vermutlich hat er das geübt, mit seinen Anwälten oder einem Betreuer. Er hat sich genau überlegt, was er sagen darf. Die Situation ist heikel: Sie ist mit der Staatsanwaltschaft gekommen, er mit der Verteidigung. Vor der Tür wartet das FBI. Er steht hier nicht vor Gericht, dennoch muss er sich mit bestimmten Äußerungen vorsehen. Das Gespräch findet nur zwischen Diane und ihm statt, aber beide wissen, dass sie Neuland betreten: Vielleicht besteht der eigentliche Prozess darin, dass sie einander Rede und Antwort stehen.
Nichts wird aufgezeichnet. Alle Telefone und Audiogeräte sind draußen geblieben. Doch im Verlauf der nächsten Stunden ist jede Silbe ein Signal für Wahrheit und Lüge.
Sie hört zu: Das ist jetzt ihre Aufgabe, ihre Pflicht.
Er sagt, dass er schuldig sei, schuldig in allen ihm vorgelegten Anklagepunkten – Verschwörung zum Mord, Entführung mit Todesfolge und der materiellen Unterstützung des Islamischen Staats. Er werde seine Strafe annehmen. «Ich akzeptiere, was mir zugestoßen ist», sagt er. Er habe sich nach westlichem Recht schuldig bekannt, auch wenn er sich wünsche, man hätte nach islamischer Rechtsprechung über ihn gerichtet. Er glaube nicht an das amerikanische Rechtssystem, erkenne es nicht an. Er habe eine Wahl getroffen. «Ich hatte Vorgesetzte. Ich habe getan, was von mir verlangt wurde.» Ja, er sei an der Entführung und Bestrafung von Geiseln beteiligt gewesen. Er habe früh den Befehl erhalten, «sie grün und blau zu schlagen». Ja, er habe James körperlich misshandelt, aber nur zweimal während seiner zweijährigen Gefangenschaft – einmal mit einer Ohrfeige durchs Zellengitter, als er der Meinung war, James habe den Islam beleidigt, das andere Mal mit Faustschlägen, zusammen mit anderen IS-Kämpfern, darunter dem verstorbenen Mohammed Emwazi, von der Presse «Jihadi John» getauft. Es seien nur leichte Prügel gewesen, behauptet er, «hauptsächlich Schläge auf den Körper». Er sei nicht der Mensch, als den die Medien ihn darstellten, sagt er, während sein Blick durch den Raum huscht. An der Hinrichtung sei er nicht beteiligt gewesen. Er habe ihrem Sohn nicht die Kehle durchgeschnitten, das Ganze auch nicht gefilmt. Er sei nicht dabei gewesen, als der abgetrennte Kopf ihres Sohnes auf seinen Rücken gelegt wurde. Er sei ein Soldat des Islams gewesen, sagt er. «Ich war im Krieg.» Er habe seinen Vorgesetzten gehorcht, aber keine Geisel ermordet. Er habe sich den Befehlen gegenüber machtlos gefühlt, sagt er. Ja, er habe Menschen getötet. Einmal habe er einen Gefangenen kaltblütig in den Hinterkopf geschossen. «Ich übernehme die Verantwortung für alle meine Taten.» Er scheue sich nicht vor seiner Vergangenheit, sagt er. «Ich habe diese Wahl getroffen, und Sie haben das Recht zu erfahren, warum.» Er habe gewusst, was er tat, als er Großbritannien in Richtung Syrien verließ. Er habe Gebirge überquert, um dort hinzugelangen. Er habe aus vielerlei Gründen gekämpft, moralischen, politischen, religiösen. Die US-Invasion im Irak. Guantanamo. Abu Ghraib. Der Umgang mit Muslimen weltweit. Sein Leben lang habe er gegen den Imperialismus aufbegehrt. Er habe seine achtjährige Tochter zurückgelassen. Er habe noch nicht abschließend geklärt, was er an seiner Zeit in Syrien bereue, aber es sei einiges. Auch er habe Fragen, bezüglich der Unschuld seiner Opfer, der moralischen Rechtfertigung von Geiselnahmen unter den Gesetzen des Islamischen Staats, der Sprache der Scharia, die während des Krieges verwendet wurde. Aber letztendlich, sagt er, sei er schuldig, ja, schuldig nach US-amerikanischem Recht. Das könne er nicht leugnen. Und doch, sagt er, bleibe seine Schuld theoretisch. Diane müsse bedenken, dass all das unter den Vorzeichen des Krieges geschehen sei. Er habe nur seine Befehle ausgeführt. «Alles, was ich getan habe», sagt er, «ist ohne Böswilligkeit geschehen.»
Sie weiß, dass er lügt.
Minimale Zugeständnisse. Minimale Reue. Konstruiert und so zurechtgeschnitten, dass es gerade noch glaubhaft wirkt.
Und doch ist da etwas unter seinen Lügen – was, kann Diane nicht sagen –, eine zweite Haut, eine andere Version der Wahrheit, etwas Viszerales, Greifbares. Man kann die Hand danach ausstrecken.
Von der Staatsanwaltschaft und ehemaligen Geiseln weiß sie, dass Emwazi der Schlimmste von allen war. Doch Kotey stand ihm nicht viel nach. Außerordentlich grausam, so die Beschreibung. Waterboarding. Nahrungsentzug. Würgegriffe. Elektroschocks. Psychische Folter. Scheinkreuzigungen. Er will Jim nur zweimal geschlagen haben, aber diese Behauptung ist lächerlich angesichts dessen, was sie von heimgekehrten europäischen Geiseln erfahren hat. Jim sei von allen am brutalsten behandelt worden, sagten sie. Man habe ihm pausenlos Leid zugefügt, seelisch und körperlich, ihn gezielt herausgegriffen, um ihn zu misshandeln.
Dieser Mann, denkt sie. Nicht einmal anderthalb Meter entfernt. Er hat meinen Sohn geschlagen. Er war an seiner Hinrichtung beteiligt. Und jetzt sitzt er hier. Mir gegenüber. Fast kann sie seinen Atem spüren.
Er senkt den Kopf und murmelt, als spräche er mit dem Fußboden. «Emwazi hatte es auf James abgesehen», sagt er, ohne den Blick zu heben. Ein schlauer Trick, denkt sie: die Schuld von sich zu weisen und auf den Toten zu schieben. Mohammed Emwazi. Vor knapp sechs Jahren durch einen amerikanischen Drohnenangriff ausgelöscht. Ein Ungeheuer. Und jetzt ein nützliches Ungeheuer.
Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Was soll das bringen? Was soll dabei herauskommen, Kotey weiter nach den Schlägen zu fragen? Wozu die Qual verlängern? Wem nützt es, seine Grausamkeit ans Licht zu bringen? Ihm geht es nur um Selbstschutz. Er wird weiter lügen, und sie will nicht, dass die Zeit zu einer Kakofonie aus Täuschung und Betrug zerrinnt. Darüber hinaus könnte das Gespräch ihr selbst eine scharfe Klinge unter die Nägel treiben, eine Art Echofolter.
Eines weiß sie ganz sicher: Sie ist nicht hier, um Rache zu üben.
Die Minuten verstreichen. Kotey flüchtet sich in geschwollene Reden über den Islam, die Komplexität des Krieges, den chaotischen Aufbau des Staates, die Scharia, Blitzentscheidungen, unterschiedliche Deutungen des Kampfgeschehens. Das kann er gut, sich in Szene setzen, irreführen, Phrasen dreschen. Aber da ist noch etwas anderes. Noch ist es nur eine Ahnung: Was ist das?
Warum hat er sich schuldig bekannt? Wären ihm seine Überzeugungen wirklich so wichtig, hätte er sich dann nicht für ein vollständiges Gerichtsverfahren entschieden?
Ein Bestandteil des Deals ist, dass er nach fünfzehn Jahren in einem amerikanischen Gefängnis nach Großbritannien zurückkehren darf. Lebenslange Haft, ohne Möglichkeit auf Bewährung.
«Gefängnis ist Gefängnis», sagt er.
Aber wenn Gefängnis gleich Gefängnis ist und Leben gleich Leben, warum dann nicht vor Gericht für seine Überzeugungen einstehen? Falls es stimmt, was er sagt, und er nur indirekt an den Hinrichtungen beteiligt war, warum die Wahrheit dann nicht öffentlich äußern? Er behauptet, nicht an das amerikanische Justizsystem zu glauben, doch bislang scheint ihn dieses System ziemlich gut zu behandeln: Ja, er sitzt in Haft, aber die Todesstrafe ist vom Tisch, er ist wohlgenährt, wird beschützt, hat einen ganzen Schwung Anwälte und das Recht auf ein faires Verfahren. Tatsächlich kam der Vorschlag, sich schuldig zu bekennen und im Gegenzug mit den Familien der Opfer zu sprechen, von der Verteidigung. Als ein Schritt Richtung Wahrheit. Ein Weg Richtung Heilung.
Seine Antworten wirken so souverän, dass ihr kurz der Gedanke kommt, unter der Selbstsicherheit könnte sich ein verängstigter Mensch verbergen. Aber vielleicht ist das nur Einbildung: Vielleicht ist da nur ein seelenloses Wesen, schauspielerisch begabt – dass einer lächeln kann und immer lächeln und doch ein Schurke sein –, kaputt und psychotisch, das mit Diane spielt wie mit einem sonderbaren menschlichen Instrument.
Sie will ihm verzweifelt klarmachen, was er der Welt genommen, ihr gestohlen hat: nicht nur den Journalisten und Aktivisten James Wright Foley, ihren Sohn, ihren ältesten Jungen, sondern alles, was Jim verkörperte. Das ist einer der Gründe, warum sie hier ist. Um die Wahrheit zu sagen. Ohne Gefühlsduselei. Ohne Schmalz. Nur die einfache, schlichte Wahrheit. «Jim war Lehrer», sagt sie. Sie lehnt sich nach vorne, ihr Armband klimpert. Er arbeitete mit jugendlichen Straftätern. Auch mit alleinerziehenden Müttern. Als Journalist legte er Zeugnis ab. Er wollte der Wahrheit an Ort und Stelle auf den Grund gehen. Er war gerecht, er war neugierig, ein ausgeglichener Mensch. Jim strebte nach Gleichmut. Wollte Zivilcourage zeigen. Er setzte sich für andere ein. Nach dem Wechsel zum Journalismus verwandte er all seine Kraft darauf, die Weltöffentlichkeit auf das Leid des syrischen Volkes aufmerksam zu machen. Es war seine Pflicht, Zeugnis abzulegen. Zudem war er ein aufmerksamer Sohn. Das älteste von fünf Geschwistern. Ein Freund. Allseits beliebt. Jim sah in jedem Menschen das Gute. Er glaubte daran, dass die Wahrheit kompliziert sein muss. Er hätte Koteys Geschichte aufgeschrieben – und das ohne Vorurteile. Sie sieht ihn an. «Er war ein guter Mensch.»
Kotey bewegt die Füße. Sie hört die Fesseln: kein metallisches Klimpern, sondern ein tiefes, fast dumpfes Geräusch.
Eine Pause wird angekündigt. Sie geht durch die langen Flure des Gerichtsgebäudes. Nachrichten auf ihrem Telefon. So viele Nachrichten. John. Ihre Tochter Katie. Die Foley-Stiftung. Sie wischt sich schnell durch die Liste. «Sie machen das ganz ausgezeichnet», sagt Jenn Donnarumma von der Staatsanwaltschaft, aber Diane ist sich da nicht sicher und überlegt, ob das alles nicht doch ein großer Fehler war. Auf der anderen Seite ist da Jim. Immer Jim, seine Einstellung. Er hätte mehr erfahren wollen. Und es gibt noch mehr zu bedenken. Vielleicht verrät Kotey die Namen einiger hoher Tiere, die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Vielleicht gewährt er ihr Einblick in die Psyche von Geiselnehmern. Vielleicht gibt er preis, wo Jim und die anderen getöteten Geiseln begraben sind.
Als sie in den Raum zurückkehrt, ist sie bereit fortzufahren.
«Was bedauern Sie, Alexanda?»
«Darüber denke ich noch nach», sagt er.
«Was dachten Sie über Jim?»
«Ich hielt ihn für einen typischen weißen Amerikaner.»
«Was wissen Sie von ihm?»
«Ich habe den Dokumentarfilm gesehen.»
«Ja?»
«Ich hielt ihn für einen Optimisten, und ich hielt ihn für naiv. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine das nicht negativ.»
«Er war Ihnen sehr ähnlich, Alexanda, finden Sie nicht?»
«Ich weiß es nicht.»
«Er war ein Wahrheitssuchender.»
«Ja.»
«Er war dunkelhäutig, wie Sie.»
Keine Antwort.
Er blickt auf und sagt: «Ich habe viel Zeit in Isolation verbracht, hatte viel Zeit zum Nachdenken.»
«Ich bin hier, um Ihnen zuzuhören», sagt sie.
Er erklärt wortreich, dass er nicht dem stereotypen Bild des Beatle entspricht, das in den Medien kursiert. Beschwert sich über die Sensationsgier der Boulevardpresse. Das tue ihm weh, sagt er. «Für die Zeitungen ist das einfach und billig. Aber die Leute sollen mich so sehen, wie ich bin.» Er denke oft an seine Mutter, sagt er, an ihre Gefühle, wenn sie solche Berichte lese. Man habe ihn als Schlägertyp bezeichnet, als Hooligan, dabei sei er nur zweimal bei einem Fußballspiel gewesen, einmal als Kind bei England gegen Jugoslawien, das andere Mal bei einem Match von Leyton Orient. Die englischen Sonntagszeitungen hätten geschrieben, er sei Fan der Queens Park Rangers, aber das sei gelogen, die Medien hätten das erfunden, um ihn in eine Schublade zu stecken, ihn zu stigmatisieren: Der Gartenzwerg mit dem weiß-blauen QPR-Trikot vor dem Haus habe in Wirklichkeit seinem Vater gehört. Für manche sei das vielleicht ein unbedeutendes Detail, sagt er, aber ihm sei das wichtig. «Die Presse zeichnet ein verzerrtes Bild von mir, um mich als Monster darzustellen.» Die Zeitungen interessierten sich nur für simple Klischees. «Ob Sie es glauben oder nicht», sagt er, «in Wahrheit habe ich Baseball gespielt. Ausgerechnet amerikanischen Baseball. Ich war First Baseman.» Ja, er habe als Jugendlicher mit Drogen gedealt, mit Kokain. Aber das sei nicht die ganze Wahrheit. Als Dreizehnjähriger sei er von anderen Schülern verprügelt worden. Seine Radikalisierung habe ihre Wurzeln in dieser Gewalterfahrung. Er sei vom griechisch-orthodoxen Glauben zum Islam konvertiert. Habe Zuflucht in der Moschee in Westbourne Park gefunden. Der Islam habe ihm die Idee einer besseren, freieren Gesellschaft vermittelt. Sein Leben sei vielschichtig und kompliziert. Sein Vater stamme aus Ghana und sei gestorben, als er zwei Jahre alt gewesen sei. Seine griechische Mutter sei Therapeutin. Sein älterer Bruder in London habe sich vor langer Zeit von ihm abgewendet. Die Medien könnten ihn als Monster darstellen, sooft sie wollten, aber er kenne die tiefere Wahrheit.
Gegen Mittag öffnet Kotey den Ordner, der vor ihm liegt. «Darf ich Ihnen etwas zeigen?», sagt er. Er schiebt ein paar Fotoausdrucke über den Tisch. Sie durchschaut, was er vorhat: Er versucht alles, um sich zu vermenschlichen. Was hat sie anderes erwartet? Sogar die schlechtesten Menschen wollen geliebt werden.
Sie sieht sich die Fotos an. Ihr Herz schlägt schneller. Seine drei Töchter. Sie sind bildschön. Sie tragen bunte Kleider: babyblau und rosa. Ihre Haare sind sauber gekämmt und zu Zöpfen geflochten. Der Hintergrund ist verschwommen, und sie fragt sich laut, wo die Fotos aufgenommen wurden. «Im Lager», sagt er fast ungeduldig: das heißt, im Flüchtlingslager, das heißt, in Syrien, das heißt, Stacheldraht, das heißt, bewaffnete Wachleute.
Er erzählt, dass er seine Dreijährige nur von Fotos kenne. Er sei vor ihrer Geburt gefasst worden. Das Gesicht seiner Frau zeigt er ihr nicht: das verstoße gegen seinen Glauben, sagt er.
«Sie sind wunderschön», sagt Diane. Sie kann nicht anders. Sie will nicht den Eindruck erwecken, sie wäre weich oder leicht zu manipulieren, aber es stimmt: Beim Anblick der Kinder stockt ihr der Atem. Was muss das für eine Kindheit sein, zwischen Zelten und gespannten Wäscheleinen, mit Hunger und peitschendem Wind?
Ein anderes Foto wird über den Tisch geschoben. Seine achtzehnjährige Tochter in England, die er vor vielen Jahren verlassen hat. Diane ist sich der bizarren Situation bewusst: Der Mann, der wegen Verschwörung zum Mord an ihrem Sohn angeklagt wurde, zeigt ihr seine lebenden Kinder, sogar das, das er im Stich gelassen hat.
Sie schiebt die Fotos zurück. Er hält sie einen Moment in den Händen. «Danke.»
Er strebe nach Ehrlichkeit, sagt er, Mitgefühl, Nachsicht, Abstinenz, Erkenntnis, Achtsamkeit. Die Aufzählung überrascht sie. Achtsamkeit. Irgendwie passt diese Sprache nicht zu ihm. Aber sie weiß, dass er in letzter Zeit Kontakt zu einem Betreuer hatte, und vielleicht lernt er gerade wiederzugeben, was andere seiner Meinung nach von ihm hören wollen. Er sagt, er sei sich nicht sicher, was er mit alldem machen werde, aber eines Tages werde er seinem Gott gegenübertreten.
Seinem Gott gegenübertreten. Der Gedanke verursacht ihr Gänsehaut. Sie fleht ihren eigenen Gott an.
Die Uhr im Raum tickt, unsichtbar.
Es ist ein Tag mit Schatten und Richtungswechseln, Offenbarungen und Lügen. Sein Selbstvertrauen und sein Schweigen wecken in ihr das unbestimmte Gefühl, dass er sich für den Klügsten im Raum hält. Er ist intelligent, ja, aber diese Intelligenz muss sich verstellen. Außerdem ist die klügste Person im Raum immer die, die weiß, dass sie keineswegs die klügste ist: Darin liegt der Widerspruch. Sie fragt sich, ob er eben genau das gesagt hat, was sie hören wollte. Manchmal ist sie blauäugig: Das gibt sie zu. Ja, sie ist anderen gegenüber früher oft viel zu offen gewesen, keine Frage. Man hat sie verletzt. Regierungsvertreter haben sie belogen. Wichtigtuer vom FBI. Das Außenministerium hat sie hinters Licht geführt und auch das Weiße Haus. Politiker. Unterhändler. Informanten. Schwindler. Und jetzt vielleicht auch Kotey. Aber sie weiß auch, dass man blauäugig sein muss, um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen. Sie will sich ihre Offenheit gegenüber der Welt bewahren. Gott istBarmherzigkeit. Und Erbarmen. Und Geduld.
Morgen gibt es noch eine Sitzung. Vielleicht kommt mehr dabei heraus als nur freundliches Geplänkel, vielleicht nichts.
Sie schiebt den Stuhl zurück und bedankt sich. Es ist gefährlich, ihm zu danken, das weiß sie. Aber es muss sein. Vielleicht tut sie es aus reiner Höflichkeit. Vielleicht steckt mehr dahinter.
«In einem anderen Leben», sagt sie, «wären Sie und Jim vielleicht Freunde gewesen.»
Den Abend verbringt sie mit Freunden in D.C. Bei Bouillabaisse und einem Glas Weißwein. Es ist ein ruhiges Beisammensein, und sie reden viel: über ihre Stiftung, die Finanzen, Spendenaktionen, die Suche nach einem neuen Geschäftsführer.
Als Kotey zur Sprache kommt, läuft ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Irgendetwas an diesem Tag ist noch offen. Was, kann sie nicht genau sagen, und sie ist froh, dass sie morgen noch einmal die Gelegenheit hat, mit ihm zu sprechen. Außerdem rechnet sie mit Neuigkeiten über Koteys Mitangeklagten El Shafee Elsheik – die Medien nennen ihn Jihadi Ringo –, der einen Deal bislang abgelehnt hat. Es kursiert das Gerücht, dass er es wahrscheinlich auf einen Prozess ankommen lässt.
Sie ist hundemüde. Es war unglaublich anstrengend, Kotey fünf Stunden lang gegenüberzusitzen. Zu wissen, dass er log. Zu erkennen, dass er keine ehrliche Reue zeigte. Zuzuhören, wie er versuchte, seine Rolle in der ganzen Sache kleinzureden, sich von Gewalt distanzierte. Sie hatte in seinem Leugnen Ansätze von Wahnsinn gespürt. Dennoch hatte er sich ihr geöffnet, mit den Fotos, dem Lächeln, den offenen Händen. Das hatte ihr im Herzen wehgetan. War das alles nur Theater? Waren das alles nur Lügen? Bisweilen hatte sie sogar einen gewissen Charme in ihm entdeckt, auch Anzeichen von Ehrlichkeit. All das hat an ihren Kräften gezehrt, sie noch mehr verwirrt. Aber dass sie verwirrt sein würde, hatte sie schon gewusst, als sie sich zu dem Treffen bereit erklärte. Verwirrt zu sein bedeutet, sich dem Möglichen zu öffnen. Ihre Gefühle ihm gegenüber haben nichts mit Hass zu tun. Auch nicht mit Wut. Oder Mitleid. Sie hat noch keine Worte dafür gefunden.
Vielleicht wird es einfach Zeit, dass sie ins echte Leben zurückkehrt – sich um ihre Stiftung kümmert, um die Lobbyarbeit für andere Geiseln, um ihre gealterte Mutter, dass sie ihre Enkel versorgt, mal wieder einen ruhigen Nachmittag mit John verbringt oder E-Mails mit irgendwelchen Philanthropen wechselt: das echte Leben, zu Hause, auf Augenhöhe mit einer anderen Wirklichkeit.
Alexanda, Kotey, Mister Kotey, Alexe, Alex: Jeder und alle zusammen sind schuldig. Er hat gestanden. Er wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Wozu also jetzt zu ihm durchdringen? All die Angst, all die Wut: seit sieben langen Jahren. Manchmal befürchtet sie, dass ihre Sichtweise naiv und einfältig ist. Vielleicht sollte sie Schluss machen mit dem Gefängnistheater. Hat sie zu viel Zeit in diese Sache investiert? Hätte sie einfach die bleiben sollen, die sie früher war – Krankenschwester, Mutter, Hausfrau, Großmutter?
Manche nennen sie eine Heilige, ausgerechnet: eine Heilige. Sie hört das ziemlich oft, und es irritiert sie, treibt ihr die Schamröte ins Gesicht. Diese Bewunderung ist ihr zutiefst unangenehm. Sie ist, das weiß sie, alles andere als heilig. Ihr Sohn wurde ermordet. Sie fordert Gerechtigkeit. Sie hat eine Stiftung gegründet, die sich für die Rückholung von Geiseln einsetzt. Das war das Einzige, was sie tun konnte. Daran ist nichts Heiliges. Weit gefehlt. Es war eine Möglichkeit, Jim in ihrem Bewusstsein zu bewahren. Jeden Tag, jede Minute. Sie kann die Vorhänge seines Lebens nicht schließen. Sie ist Mutter. Das ist alles, und es ist mehr als genug.
Spätabends fährt sie im Taxi von D.C. zurück ins Hotel, vorbei am Weißen Haus zu den ruhigen Straßen Alexandrias, wo Kotey in seiner Zelle sitzt.
Die Hotelangestellten erkennen sie, als sie die Lobby betritt. In den letzten beiden Tagen hat sie jede Menge Vornamen gehört. Und nicht nur das, sie hat sie sich auch gemerkt. Man nickt und lächelt ihr zu, als sie zu den Fahrstühlen geht. Diese Frau hat etwas Besonderes: Sie sticht heraus und fügt sich dennoch ein, eine Durchschnittsfrau, doch einzigartig.