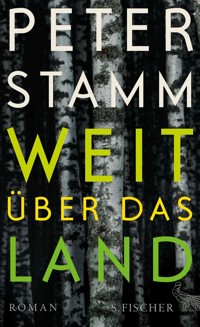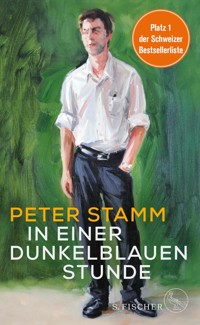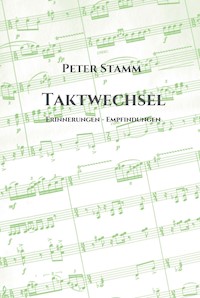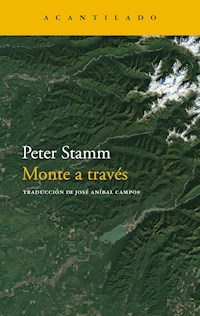7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Tag wie diesem ändert Andreas sein Leben. Ihn packt eine Sehnsucht, die zwischen Heimweh und Fernweh nicht mehr unterscheidet. Er wirft alles hin, verkauft seine Wohnung und kündigt seine Stelle in Paris, um nach einem halben Leben zu der Frau zurückzukehren, die er einmal geliebt hat. Die Gleichheit der Tage war sein einziger Halt, jetzt hofft er auf ein Wunder und darauf, dass alles neu beginnt. Seine Reise führt ihn in die Provinz seiner Jugend und wieder weg bis ans Ufer des Atlantiks, in die Arme einer jungen Frau, deren Liebe er beinah verspielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Peter Stamm
An einem Tag wie diesem
Roman
Roman
Fischer e-books
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. und der Pro Helvetia für die Förderung seiner Arbeit an diesem Roman.
»Es ist ein Tag wie dieser hier, ein wenig später, ein wenig früher, an dem alles neu beginnt, an dem alles beginnt, an dem alles weitergeht.«
Georges Perec
Andreas liebte die Leere des Morgens, wenn er am Fenster stand, eine Tasse Kaffee in der einen, eine Zigarette in der anderen Hand, und auf den Hof hinausschaute, den kleinen, aufgeräumten Hinterhof, und an nichts dachte als an das, was er sah. In der Mitte des Hofes ein mit Efeu bepflanztes, viereckiges Beet, darin ein Baum, aus dem in der Mitte und oben ein paar dünne Äste wuchsen, zurechtgestutzt nach dem wenigen Raum, der zur Verfügung stand. Die leuchtend grünen Container, Glas, Verpackungen, Restmüll, das regelmäßige Muster der Zementplatten, von denen einige etwas heller waren, vor Jahren ersetzt aus irgendeinem Grund. Die Geräusche der Stadt waren nur leise zu hören, ein homogenes Rauschen, dazwischen entfernte Vogelrufe und sehr deutlich das Geräusch eines sich öffnenden und wieder schließenden Fensters.
Dieser besinnungslose Zustand hielt nur wenige Minuten lang an. Noch bevor Andreas die Zigarette zu Ende geraucht hatte, fiel ihm der gestrige Abend ein. Was er denn unter Leere verstehe, hatte Nadja gefragt. Für sie bedeutete Leere einen Mangel an Beachtung, an Liebe, die Abwesenheit von Menschen, die sie verloren hatte oder die sich nicht genug um sie kümmerten. Die Leere war ein Raum, der einmal ausgefüllt gewesen war, oder von dem sie glaubte, er könnte ausgefüllt sein, das Fehlen von etwas, das sie wohl selbst nicht genau hätte bezeichnen können. Er habe keine Ahnung, hatte Andreas gesagt, er interessiere sich nicht für abstrakte Begriffe.
Die Abende mit Nadja verliefen immer gleich. Sie kam eine halbe Stunde zu spät und gab Andreas das Gefühl, er sei es, der sich verspätet habe. Sie hatte sich schön gemacht, trug einen kurzen, eng anliegenden Rock und schwarze Netzstrümpfe. Mit einer theatralischen Geste ließ sie den Mantel auf den Parkettboden fallen. Sie setzte sich aufs Sofa und schlug die Beine übereinander. Für sie schien das der Höhepunkt des Abends zu sein, ihr Auftritt. Sie steckte sich eine Zigarette in den Mund. Andreas gab ihr Feuer und machte ihr ein Kompliment. Er holte aus der Küche zwei Gläser Wein. Nadja musste schon etwas getrunken haben, sie war in aufgekratzter Stimmung.
Meistens aßen sie in einem Lokal in der Nähe. Das Essen war gut genug, und der schwule Kellner schäkerte mit Nadja und setzte sich manchmal, wenn nicht viele Gäste da waren, zu ihnen an den Tisch. Nadja trank und redete zu viel und machte sich zusammen mit dem Kellner darüber lustig, dass Andreas Vegetarier war und dass er immer dasselbe bestellte. Er sagte, er sei kein Vegetarier, er esse einfach selten Fleisch. Spätestens beim Dessert fing Nadja an, über Politik zu reden. Sie war PR-Beraterin und arbeitete gelegentlich für Unterorganisationen der Sozialistischen Partei, deren Ansichten sie auf eine Art vertrat, die Andreas ärgerte. Er sagte dann nicht mehr viel, und sie fragte mit einem aggressiven Unterton, ob sie ihn langweile.
»Ich langweile dich«, sagte sie.
Nein, sagte er, aber er sei Ausländer, er verstehe die französische Politik nicht, interessiere sich nicht dafür. Er halte sich an die Gesetze, er trenne seinen Müll, er erfülle den Lehrplan. Ansonsten wünsche er in Ruhe gelassen zu werden. Nadja ärgerte sich über sein Desinteresse, sie hielt ihm einen Vortrag, es gab Streit. Andreas versuchte, das Gespräch auf andere Themen zu bringen. Dann begann Nadja jedes Mal, von ihrem Exmann zu erzählen, von seiner Lieblosigkeit und Unaufmerksamkeit, und es schien Andreas, als gälten die Vorwürfe ihm. Nadja konnte nicht aufhören sich zu beklagen. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen, und ihre Stimme wurde weinerlich. Die anderen Gäste waren längst gegangen, und der Kellner hatte die Aschenbecher geleert und die Kaffeemaschine gereinigt. Wenn er an ihren Tisch trat und fragte, ob sie noch etwas wünschten, war Nadja wie verwandelt. Sie lachte und flirtete mit ihm, und es dauerte noch einmal eine Viertelstunde, bis Andreas die Rechnung bezahlen konnte.
Auf dem Nachhauseweg war Nadja schweigsam. Sie hatten sich den ganzen Abend nicht berührt. Jetzt hakte sie sich bei Andreas unter. Vor dem Haus, in dem er wohnte, blieb er stehen. Er küsste sie auf die Wangen und dann auf den Mund. Manchmal küsste er sie auf den Hals und kam sich lächerlich vor dabei. Ihr schien es zu gefallen. Vermutlich entsprach es dem Bild, das sie von sich hatte. Die Geliebte, der die Männer zu Füßen liegen, die auf den Hals geküsst wird, die ihre Verehrer verlacht. Am liebsten wäre Andreas jetzt allein gewesen, aber er fragte sie trotzdem, ob sie mit hinaufkomme. Sie sagte, ja. Es klang wie eine Kapitulation.
Nadja gehörte nicht zu jenen Frauen, die schöner wurden, wenn man mit ihnen schlief. Ihre eng anliegenden Kleider waren wie eine Rüstung, wenn sie nackt war, schien sie jeden Halt zu verlieren und sah alt aus, älter, als sie in Wirklichkeit war. Sie ließ alles mit sich geschehen, ließ sich Andreas’ Zärtlichkeiten gefallen, ohne sie zu erwidern. Das, hätte er sagen sollen, verstehe er unter Leere. Diese Abende mit ihr alle zwei Wochen, die Wiederholung des immer gleichen Abends, der immer gleichen Nacht, ohne sich je näher zu kommen. Aber er sagte es nicht. Er mochte die Leere der Wiederholung. Er genoss das Gefühl, dass Nadja mit ihren Gedanken anderswo war, dass sie ihm ihren Körper nur zur Verfügung stellte, bis sie nach einer oder zwei Stunden plötzlich ungeduldig wurde, ihn wegschob und sagte, er solle ihr ein Taxi rufen. Die Leere, das waren diese Abende mit ihr, die Nachmittage mit Sylvie oder die Wochenenden, die er allein zu Hause verbrachte in seiner gemütlichen, gut geheizten Wohnung, an denen er fernsah oder ein Computerspiel spielte oder las. Die Leere war sein Leben, waren die achtzehn Jahre, die er in dieser Stadt verbracht hatte, ohne dass sich etwas verändert hatte, ohne dass er sich eine Veränderung wünschte.
Die Leere sei der Normalzustand, hatte er gesagt, er fürchte sich nicht davor, im Gegenteil.
Manchmal, wenn Andreas auf dem Weg zur Arbeit die Straße überquerte, stellte er sich vor, von einem Bus überfahren zu werden. Die Kollision war wie die Auflösung von dem, was gewesen war, und zugleich ein Neuanfang. Ein Schlag, der die Verworrenheit beendete und Ordnung schuf. Plötzlich war alles von Bedeutung, der Tag und die Stunde, der Name der Straße oder des Boulevards, jener des Busfahrers, Andreas selbst, das Datum und der Ort seiner Geburt, sein Beruf und seine Konfession. Es war ein regnerischer Morgen im Herbst oder Winter. Der nasse Asphalt reflektierte das Licht der Leuchtreklamen und der Autoscheinwerfer. Der Verkehr staute sich hinter dem Bus, der quer in der Fahrbahn stand. Eine Ambulanz kam. Passanten standen herum und gafften. Ein Polizist winkte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Passagiere der vorüberfahrenden Busse reckten die Hälse, starrten aus den Fenstern. Sie begriffen nicht ganz, was geschehen war, und vergaßen es gleich wieder, wenn ein anderes Bild ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein zweiter Polizist versuchte, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Er befragte den Fahrer des Busses, die Verkäuferin der Bäckerei, die alles gesehen hatte, eine weitere Zeugin. Dann würde er ein Protokoll erstellen in mehrfacher Ausführung, eine Akte, die in einem Archiv abgelegt würde, eingereiht in ein Alphabet von Todesfällen. Andreas stellte sich die Maßnahmen vor, die getroffen werden mussten, um ihn aus dem System zu entfernen. Man würde seinen Bruder benachrichtigen, der würde entscheiden müssen, was mit dem Leichnam geschehen soll. Andreas hatte der Versuchung widerstanden, ein Testament zu machen, er hatte es immer eitel gefunden, Anweisungen für den Fall des eigenen Todes zu geben. Vermutlich würde Walter sich für eine Einäscherung entscheiden, das wäre das Einfachste und Vernünftigste. Trotzdem wäre viel Papierkram zu erledigen, mit allen möglichen Ämtern Kontakt aufzunehmen. Man würde die Botschaft einschalten müssen.
Andreas fragte sich, ob eine genaue Abrechnung erstellt würde über die Tage, die er vor seinem Tod gearbeitet hatte. Die Verwaltung der Schule müsste wissen, was zu tun war. Vielleicht gab es ein Merkblatt, Maßnahmen im Falle des plötzlichen Todes ausländischer Lehrkräfte.
Und dann, nach einigen Tagen der Aufregung, nach Briefen und Telefonaten und leisen Gesprächen im Lehrerzimmer, würde es eine bescheidene Beisetzung geben, einen Kranz von der Schule, ein Gesteck von den Kollegen. Walter würde einen großen Strauß kaufen beim Blumendiscount an der Ecke. Er war aus der Schweiz angereist, hatte sich im Viertel ein billiges Hotel genommen und versuchte mit seinem schlechten Französisch alles zu organisieren. Er hatte Andreas’ Agenda gefunden, sein Adressverzeichnis. Für Todesanzeigen war die Zeit zu knapp, aber er rief einige von Andreas’ Bekannten an und bat sie zu kommen. Er wunderte sich über die vielen Frauennamen im Adressverzeichnis, vielleicht war er ein wenig neidisch auf Andreas’ Junggesellenleben. Abends telefonierte er mit seiner Frau und beklagte sich über die Umständlichkeit der Behörden und erkundigte sich nach den Kindern. Dann aß er in einem Restaurant in der Nähe und spazierte noch etwas auf der rue des Abbesses oder der rue Pigalle. Andreas fragte sich, ob sein Bruder in eine Peepshow gehen würde oder zu einer Prostituierten. Er konnte es sich nicht vorstellen.
An der Gare du Nord nahm Andreas den Vorortszug nach Deuil-la-Barre. Er nahm jeden Tag den gleichen Zug. Er betrachtete die Gesichter der Mitreisenden, Gesichter, denen man nichts anhaben konnte. Ein älterer Mann, der ihm gegenübersaß, starrte ihn mit ausdruckslosen Augen an. Andreas schaute aus dem Fenster. Er sah die Gleisanlagen, die Industriegebäude und Lagerhäuser, manchmal einen einzelnen Baum, Masten für Scheinwerfer oder Antennen, mit Graffiti bedeckte Backstein- und Betonmauern. Es war ihm, als sehe er nur Farben, Ocker, Gelb, Weiß, Silber, ein mattes Rot und das wässrige Blau des Himmels. Es war kurz nach sieben, aber Zeit schien keine Rolle zu spielen.
Er fragte sich, ob Walter die Räumung der Wohnung einer Firma überlassen würde. Die Möbel waren nicht billig gewesen, aber was sollte er damit anfangen? Sonst besaß Andreas nicht viel. Persönliche Gegenstände, er hatte sich immer gefragt, was damit gemeint war. Eine kleine Statuette, Diana mit Pfeil und Bogen, im Gehen erstarrt, die er kurz nach seiner Ankunft in Paris auf einem Flohmarkt gekauft hatte, ein paar Plakate von lange zurückliegenden Kunstausstellungen und gerahmte Fotos von Ferienreisen, menschenleere Landschaften im schattenlosen Mittagslicht Italiens und Südfrankreichs. Er besaß kaum Bücher, ein paar CDs und DVDs, nichts Besonderes, nichts Wertvolles. Seine Kleider und seine Schuhe würden Walter nicht passen, der schwerer war und größer als er. Einzig die Wohnung würde etwas abwerfen. Andreas hatte sie zu einem Zeitpunkt gekauft, als das Viertel noch nicht so populär war wie jetzt.
Es war seltsam, dass ausgerechnet sein Bruder, mit dem ihn so wenig verband und dem er noch nicht einmal glich, sich um all das kümmern müsste. Es war Andreas nicht recht, dass sein Tod Umstände machen würde. Aber das ließ sich wohl nicht vermeiden.
Er schaute sich seine Mitreisenden an, das verliebte Paar, das sich an der Tür küsste, zwei Kinder, die miteinander tuschelten, alte Frauen mit müden Gesichtern, Geschäftsleute in billigen Synthetikanzügen, die mit wichtigen Mienen den Wirtschaftsteil der Zeitung lasen. In hundert Jahren seid ihr alle tot, dachte er. Die Sonne würde scheinen, die Züge würden fahren, die Kinder zur Schule gehen, aber er und all diese Menschen, die mit ihm fuhren, würden tot sein und mit ihnen dieser Moment, diese Fahrt, als habe sie nie stattgefunden.
Die Leute, die mit Andreas ausstiegen, schienen jeden Tag andere zu sein. Er blieb einen Moment auf dem Bahnsteig stehen und schaute zu, wie sie sich in alle Richtungen verloren. Obwohl es noch kühl war, zog er die Weste aus. Er fröstelte, aber er liebte diese Kühle des Morgens, die sich wie eine Berührung anfühlte und nicht in die Tiefe drang.
Früher hatte er in einem Vorort noch weiter draußen unterrichtet. Er hatte sich immer wieder um eine Stelle in der Stadt beworben, aber jedes Mal waren ihm Kollegen vorgezogen worden, die älter waren oder verheiratet oder Kinder hatten. Als vor zehn Jahren das Gymnasium in Deuil gebaut worden war, hatte Andreas den Traum von einer Stelle in der Innenstadt längst aufgegeben. Wenigstens war sein Arbeitsweg jetzt nicht mehr so lang.
Er war wie immer eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn im Schulhaus. Im Lehrerzimmer roch es nach Zigaretten, obwohl das Rauchen im ganzen Gebäude untersagt war. Andreas holte sich am Automaten Kaffee und setzte sich ans Fenster. Nach vielleicht einer Viertelstunde kam Jean-Marc, einer der Sportlehrer. Er trug einen Trainingsanzug.
»Hast du geraucht?«, fragte er, während er sich am Waschbecken das Gesicht wusch. Andreas gab keine Antwort.
»In der Schweiz wird doch bestimmt nicht geraucht in den Lehrerzimmern.«
Andreas sagte, er sei seit Ewigkeiten in keinem schweizerischen Lehrerzimmer gewesen.
»Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?«, sagte Jean-Marc.
»Lieber nicht.«
Jean-Marc lachte. Er hatte die Trainingsjacke ausgezogen und wusch sich die Achselhöhlen. Er sagte, es sei eine Schande, dass man hier keine Duschen eingebaut habe für die Lehrer. Er trug ein Deodorant auf, der Geruch verbreitete sich im Raum. Jean-Marc zog sich an. Er holte ein Glas Wasser und setzte sich dicht neben Andreas.
»Du kennst doch Delphine?«, er lehnte sich zurück und machte ein selbstzufriedenes Gesicht. »Wie findest du sie?«
»Sympathisch«, sagte Andreas. »Erfrischend.«
»Das ist das Wort.«
Andreas ging zum Fenster, öffnete es und zündete sich eine Zigarette an. Jean-Marc schaute ihn strafend an.
»Wir haben kürzlich zusammen ein Glas getrunken«, sagte er, »und dann bin ich irgendwie bei ihr gelandet.«
»Und was hat das mit mir zu tun?«
»Seither tut sie, als sei nichts gewesen. Als kenne sie mich nicht.«
»Sei doch froh. Möchtest du, dass sie dich zu Hause anruft?«
Jean-Marc stand auf und hob die Hände. »Natürlich nicht«, sagte er, »aber es ist doch seltsam. Du schläfst mit einer Frau. Und sie ... dabei sieht sie noch nicht einmal gut aus. Ist dir das auch schon passiert?«
»Ich bin nicht verheiratet«, sagte Andreas. Es war grotesk, dachte er, dass er Jean-Marc als seinen besten Freund bezeichnet hätte.
Wenn Andreas abends das Licht gelöscht hatte, lag er noch eine Weile wach. Er hatte die Vorhänge zugezogen, und im dunklen Raum waren nur die Stand-by-Lichter des Fernsehers, des DVD-Players und der Stereoanlage zu sehen. Die roten Leuchtdioden hatten etwas Beruhigendes, sie erinnerten ihn an das ewige Licht in der Kirche, an die Gegenwart Christi, an den er nicht glaubte.
Den Samstag verbrachte er wie immer damit, die Wohnung zu putzen und für die nächste Woche einzukaufen. Vor einigen Jahren war in der Straße ein Film gedreht worden, der zu einem Kultfilm geworden war, und seither kamen Leute aus aller Welt, um die Wirklichkeit an den verträumten Bildern zu überprüfen. Andreas hatte den Film als DVD gekauft, und wenn er ihn sich manchmal anschaute, war es ihm, als seien die Bilder wirklicher als die Straße vor seiner Tür, als sei die Wirklichkeit nur ein Abklatsch der goldenen Filmwelt, eine billige Kulisse. Man musste die Augen schließen, um die Musik zu hören, um die Bilder zu sehen. Dann war Paris genau so, wie er es sich immer vorgestellt hatte.
Andreas mochte es, Teil dieser Kulisse zu sein. Er mochte das Bild von sich, wenn er im Café saß und die Zeitung las oder wenn er mit einer Baguette unter dem Arm durch die Straße ging, mit Tüten voller Gemüse, das eine Woche lang im Kühlschrank liegen würde, bevor er es wegwarf. Wenn Touristen ihn nach den Drehorten des Films fragten, gab er bereitwillig Auskunft. Er antwortete ihnen auf Französisch, selbst wenn er merkte, dass es Deutsche waren oder Schweizer und dass sie Mühe hatten, ihn zu verstehen.
Er war zugleich Statist und Zuschauer eines imaginären Films, ein Tourist, der seit bald zwanzig Jahren durch diese Stadt ging, ohne je ganz anzukommen. Er mochte diese Rolle, hatte nie etwas anderes gewollt. Große Unternehmungen, Veränderungen hatten ihn immer abgeschreckt. Er ging durch die Straßen von St.-Michel oder St.-Germain, stieg auf den Eiffelturm oder schaute sich die Kirche von Notre-Dame an oder den Louvre. Er spazierte über den Pont Neuf und kaufte in den großen Warenhäusern ein, obwohl die Preise absurd waren. Manchmal folgte er irgendwelchen Leuten ein Stück ihres Weges, beobachtete sie beim Einkaufen oder wenn sie in einem Café etwas tranken und ließ sie dann ziehen. Wenn er mit seinen Freunden sprach, die ihr ganzes Leben in Paris gewohnt hatten, staunte er, wie schlecht sie die Stadt kannten. Sie verließen ihre Viertel kaum und hatten die Museen seit ihrer Schulzeit nicht mehr besucht. Statt sich über die Schönheit der Stadt zu freuen, schimpften sie über die Streiks der Metroangestellten, über die schlechte Luft und über fehlende Parks und Spielplätze.
Am späten Nachmittag ging er ins Kino und schaute sich einen amerikanischen Actionfilm an, eine belanglose Geschichte mit spektakulären Stunts und Spezialeffekten. Auf dem Heimweg wurde er von den Türstehern der Sexclubs angesprochen. Früher waren es schmierige junge Männer gewesen, aber seit einiger Zeit waren es immer öfter Frauen, die noch hartnäckiger waren als ihre Kollegen. Andreas schaute geradeaus und machte eine abwehrende Handbewegung, aber eine der Frauen folgte ihm bis zur nächsten Ampel und redete auf ihn ein und sagte, wie wär’s? Kommen Sie herein. Wir haben neue Mädchen.
»Ich wohne hier«, sagte er und ging bei Rot über die Straße, um der Frau zu entkommen.
Er ärgerte sich, dass er immer wieder angesprochen wurde. Es war ihm, als durchschauten die Türsteherinnen seine Tarnung, als wüssten sie etwas von ihm, das ihm selbst verborgen war. Hinter den Kulissen, hinter den undurchsichtigen Türen der Sexclubs und Bars und Erotikmärkte musste es ein hartes, schmutziges Leben geben. Der Gedanke, dass dieses Leben wirklicher sein könnte als sein eigenes, beunruhigte ihn. Er war in all den Jahren nie in einem der Lokale gewesen.
Am Sonntagmorgen schlief er lange. Er frühstückte im Café, las die Zeitung und hörte mit, wie sich am Nachbartisch ein junges deutsches Paar über den weiteren Verlauf des Tages stritt. Sie wollte in den Louvre, er nicht. Als sie ihn fragte, was er denn machen wolle, konnte er es nicht sagen.
Gegen Mittag war Andreas wieder zu Hause. Er korrigierte eine Klassenarbeit, dann blätterte er durch zwei Büchlein, die er am Freitag in der deutschen Buchhandlung gekauft hatte. Sie waren in einer Reihe von Unterrichtstexten erschienen, die er manchmal mit den fortgeschrittenen Schülern las, kurze Kriminalgeschichten über Kunsträuber oder Schmugglerbanden mit einfachem Vokabular, sechs-, zwölf- oder achtzehnhundert Vokabeln, mit denen sich eine ganze Welt beschreiben ließ. Andreas mochte diese Geschichten, obwohl sie entsetzlich banal und berechenbar waren.
Das erste Bändchen legte er schnell weg. Es ging um Ökoterrorismus, ein Thema, das ihn deprimierte und das ihm für seine Schüler ungeeignet schien. Das zweite hieß »Liebe ohne Grenzen«. Auf dem Umschlag war eine Federzeichnung, die ihn an den Stil der sechziger Jahre erinnerte und seltsam berührte: Eine junge Frau und ein junger Mann saßen in einem Straßencafé unter großen Bäumen und lächelten sich an. Andreas las den Klappentext. Die Geschichte handelte von Angélique, einer jungen Pariserin, die eine Stelle als Au-pair-Mädchen in Deutschland annimmt und sich in Jens verliebt, einen Studenten der Meeresbiologie. Die Gastfamilie wohnt in Rendsburg, nahe der dänischen Grenze. Vor vielen Jahren hatte Andreas dort eine Tagung über skandinavische Literatur besucht. Er hatte die Stadt gemocht, obwohl es die ganze Zeit regnete und er kaum etwas von der Gegend sah.
Er las mit den Kindern nicht gern Liebesgeschichten. Bei jedem Kuss gab es Gekicher und Getuschel und dumme Bemerkungen. Aber er hatte sich als Jugendlicher selbst in ein Au-pair-Mädchen verliebt. Irgendwo begann er zu lesen.
Ich konnte mich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Ich musste sie immer wieder ansehen. Der Volkswagen roch nach ihr, nach Sommer, Sonne und Blumenfeldern.
Andreas dachte an Fabienne und wie er mit ihr und Manuel zum Baden gefahren war an einen Weiher. Mit Manuel hatte er das Gymnasium besucht, und während des Studiums trafen sie sich manchmal im Zug. Andreas studierte Germanistik und Romanistik, Manuel machte eine Ausbildung als Sportlehrer. Er hatte einen 2CV, eine alte Kiste, an der ständig etwas kaputt war.
Mit Fabienne verband Andreas eine Liebesgeschichte, die keine gewesen war. Er hatte sie geliebt, über ihre Gefühle war er sich nie klar geworden. Einen Sommer lang hatten sie sich fast täglich gesehen, hatten viel Zeit miteinander verbracht, aber er hatte sich nie getraut, ihr seine Liebe zu gestehen, und Fabienne schien nicht auf ein solches Geständnis zu warten. Als er schon in Paris lebte, schrieb er ihr einen Brief, in dem er endlich über seine Gefühle sprach und den er nie abschickte.
Andreas hatte lange nicht an Fabienne oder Manuel gedacht. Seit Ewigkeiten hatte er nichts von ihnen gehört. Er erinnerte sich vage an eine Geburtsanzeige, ein nichts sagendes Babygesicht, dazu Gewicht und Größe des Neugeborenen, als sei damit etwas gesagt. Vermutlich hatte er gratuliert, vielleicht ein Geschenk geschickt, er wusste es nicht mehr. Bei der Beerdigung seines Vaters hatte er die beiden kurz gesehen, seither nicht wieder.
Er blätterte ein paar Seiten weiter.
Ich nahm ihre Hand und küsste sie. Ein wenig später lagen wir nebeneinander am Kanal.
»Du bist ein merkwürdiger Mensch. Wie soll ich dich verstehen?«
»Du sollst mich gar nicht verstehen, Schmetterling«, gab ich zurück und sah sie an. »Ich verstehe mich ja selber nicht. Oft weiß ich nicht einmal genau, was ich will, siehst du.«
»Schade«, sagte sie leise. »Es wäre jetzt sehr hübsch, wenn du wüsstest, was ich gern möchte.«
In den nächsten zwanzig Minuten sagten wir nicht mehr viel. Als wir aufstanden, klopfte Angélique sich das Gras von den Hosen.
»Du bist nett.«
»Und du bist süß.«
Andreas starrte auf das Buch. Schmetterling, so hatte er Fabienne manchmal genannt, Butterfly, wenn sie Englisch miteinander sprachen, weil ihr Deutsch damals so schlecht war wie sein Französisch. Und sie hatte gesagt, er wisse nicht, was er wolle, mit ihrer überdeutlichen Aussprache. You do not know what you want.
Auch an die Szene erinnerte er sich. Es war ein heißer Tag. Zu dritt waren sie an einen Weiher gefahren. Sie zogen sich im Unterholz um. Manuel sagte, er schwimme auf die andere Seite, und verschwand. Fabienne sonnte sich, sie lag auf dem Rücken und hatte die Augen geschlossen. Andreas erinnerte sich an ihren elfenbeinfarbenen Badeanzug und daran, wie sie ihr Haar hochgesteckt hatte. Er betrachtete sie, und dann beugte er sich über sie. Sie musste den Schatten gespürt haben, den sein Kopf auf ihr Gesicht warf. Sie öffnete die Augen und schaute ihn an.
Er küsste sie, und sie ließ es geschehen. Er legte seine Hand an ihren Hals, streichelte ihre Schulter und berührte ganz flüchtig ihre Brust. Da machte sie sich los und lief hinunter zum Wasser.
Andreas blieb noch einen Moment liegen. Er war verblüfft, dass er es gewagt hatte, Fabienne zu küssen. Er machte einen Kopfsprung in den Weiher und folgte ihr. Fabienne schwamm langsam, den Kopf aus dem Wasser gereckt, um sich das Haar nicht nass zu machen. Andreas musste sich Mühe geben, sie nicht einzuholen. Nach einer Weile kam ihnen Manuel entgegen. Sie drehten um und schwammen mit ihm zum Badeplatz zurück.
Später versuchte Manuel, Fabienne den Butterflystil beizubringen. Er hatte im letzten Semester die verschiedenen Schwimmstile gelernt und spielte sich mit seinen Kenntnissen auf. Vielleicht hatte Andreas sie deshalb Butterfly genannt. Oder hatte Manuel mit dem Namen angefangen? Andreas war sich plötzlich nicht mehr sicher.
Manuel stand neben Fabienne im seichten Wasser und versuchte, sie um die Taille zu fassen, aber sie machte ein paar schnelle Schritte von ihm weg. Manuel verfolgte sie. Als er sie nicht erwischte, spritzte er mit der flachen Hand Wasser nach ihr, und sie rettete sich ans Ufer.
Sie waren an diesem Tag lange am Weiher geblieben. Als es dämmerte, machten sie ein Feuer. Manuel fing an, in seinem schlechten Englisch über Religion zu sprechen. Fabienne widersprach ihm. Sie war katholisch und konnte nichts anfangen mit seinen protestantischen Ansichten, mit seiner Liebe zu Jesus, von dem er sprach wie von einem guten Freund. Andreas spielte den Nihilisten. Er geriet in Eifer. Jetzt war er es, der sich aufspielte mit seinen wohlfeilen Ansichten über die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. Schließlich verbündeten sich Manuel und Fabienne gegen ihn, und er warf ihnen Dinge an den Kopf, die er später bereute. Er schaute Fabienne an und versuchte, in ihren Augen eine Antwort zu lesen auf seinen Kuss. Aber in ihrem Blick war nur Befremden.
Auf dem Heimweg saß sie vorn neben Manuel. Es war eine warme Nacht, sie hatten das Dach des 2CV geöffnet und fuhren über den Hügel zurück zum Dorf. Manuel hielt vor dem Haus von Andreas’ Eltern. Sie verabschiedeten sich, Fabienne beugte sich zwischen den Sitzen nach hinten und küsste Andreas flüchtig auf die Wangen. Er blieb beim Gartentor stehen und schaute dem Wagen nach, bis er am Ende der Straße um die Ecke bog und verschwand. Dann saß er noch lange draußen auf der Treppe und rauchte und dachte an Fabienne und an seine Liebe zu ihr.
Als er sie einige Tage später wiedersah, war sie anders als vorher, freundlich, aber distanziert. Sie fuhren noch ein paar Mal baden, aber Fabienne schien darauf zu achten, nicht mehr mit Andreas allein zu sein. Bald darauf schlug das Wetter um, und es war zu kühl zum Baden. Danach sahen sie sich nur noch mit anderen in der Gruppe, wenn sie zusammen ins Kino gingen oder sich in einem Restaurant trafen. Im Herbst fuhr Fabienne zurück nach Paris, um Germanistik zu studieren. Andreas hatte sie nicht zum Bahnhof begleitet, warum wusste er nicht mehr.
Nachdem Fabienne abgereist war, merkte Andreas erst, wie wenig ihn mit Manuel verband. Sie sahen sich noch ein paar Mal, aber ohne Fabienne waren ihre Treffen langweilig.
Er las die Szene ein zweites Mal. In den Fußnoten wurden die Worte erklärt, die nicht zum Grundwortschatz gehörten.
Kanal – künstlicher Fluss nebeneinander – zusammen küssen – zwei Menschen drücken die Lippen aufeinander
Am Ende des Kapitels gab es Fragen zum Text.
Warum ist Jens enttäuscht? Was wissen Sie von Angélique? Wo liegt Schleswig-Holstein?
Damals am Weiher war Andreas froh gewesen, dass Fabienne davongelaufen war. Er war verliebt in sie, aber für den Moment genügte ihm dieser erste Kuss, diese erste Berührung. In den folgenden Wochen stellte er sich manchmal vor, was geschehen wäre, wenn sie seinen Kuss erwidert hätte. Zusammen liefen sie in den Wald hinein. Sie versteckten sich im Unterholz, zogen sich aus. Sie lagen auf dem Boden, der weich war und warm in Andreas’ Phantasie. Dann rief Manuel nach ihnen, und sie zogen hastig ihre Badesachen an und schlenderten zurück zum Weiher, als sei nichts geschehen. Fabienne schaute Andreas an und lächelte. Manuel musste gemerkt haben, was geschehen war, aber Andreas war es egal. In seiner Vorstellung war er seltsam stolz und feierlich gestimmt. Während der Rückfahrt schwiegen sie. Andreas saß auf der Rückbank und betrachtete Fabienne, ihren gebräunten Hals, auf dem feine, fast durchsichtige Härchen waren, ihre Ohrmuschel, durch die hindurch das Licht schien, das hochgesteckte Haar. Unter dem T-Shirt zeichneten sich ihre Schulterblätter ab und die Träger ihres BHs.
Die Schönheit Fabiennes hatte ihn immer atemlos gemacht. Es war die Schönheit, die Makellosigkeit einer Statue. Er stellte sich vor, wie seine Hände über ihren Körper glitten, der kühl war wie Bronze oder polierter Stein. Fabienne war in seiner Vorstellung das junge Mädchen geblieben, als das er sie kennengelernt hatte, und wenn er an sie dachte, fühlte er sich so jung und unerfahren, wie er es damals gewesen war. Er konnte sich Fabienne nicht verschwitzt vorstellen oder müde, nicht wütend oder erregt. Er konnte sie sich nicht nackt vorstellen.