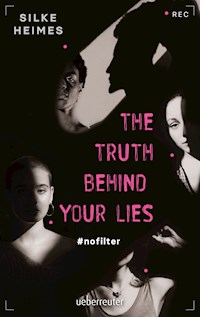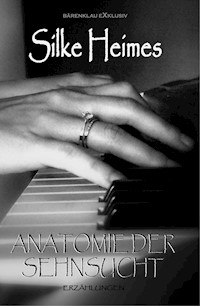
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Silke Heimes lässt in den vorliegenden Erzählungen Sprache klingen, Menschen schweben, auf die Erde fallen und wieder aufstehen.
Sie schafft damit Räume für Blicke und Augenzwinkern, für Verliebtheiten und Verrücktheiten, lässt Menschen Wünsche und Träume sammeln und sich ins Leben stürzen.
Nach ihrem Story-Debut und dem Roman »Die Geigerin« liegt hier nun ein Werk mit 16 neuen Erzählungen vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Silke Heimes
Anatomie der Sehnsucht
Erzählungen
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Nebel
Ein wenig verrückt
Schmeckt es dir nicht
Der Fremde
Carpe Diem
Anatomie der Sehnsucht
Nackt
Immer wieder Regen
Eine kleine Pirouette
Die Hormone
Ein Blockhaus in Kanada
Die Hölle sind die Anderen
Der Maibaum
Ich bin keine Laborratte
Ein zärtliches Gefühl für den Tod
Folgende Bände sind von Silke Heimes ebenfalls erhältlich:
Das Buch
Silke Heimes lässt in den vorliegenden Erzählungen Sprache klingen, Menschen schweben, auf die Erde fallen und wieder aufstehen.
Sie schafft damit Räume für Blicke und Augenzwinkern, für Verliebtheiten und Verrücktheiten, lässt Menschen Wünsche und Träume sammeln und sich ins Leben stürzen.
Nach ihrem Story-Debut und dem Roman »Die Geigerin« liegt hier nun ein Werk mit 16 neuen Erzählungen vor.
***
Nebel
Eine Ansammlung von Tröpfchen, fein wie Spucke, wenige Millimeter Durchmesser, Kondensation feuchter, gesättigter Luft, die den Taupunkt erreicht. Von Bodennebel zu sprechen, ist Unsinn, Nebel hat immer Bodenkontakt, das definiert ihn; ebenso ist es Unsinn, von Hochnebel zu sprechen, Wasser gesättigte Luft ohne Bodenkontakt sind Wolken, Typ Stratus. Ich sehne mich nach einer Welt, in der die Dinge benennbar sind, Namen haben, eindeutig und klar: Strahlungsnebel, Advektionsnebel. Solche Bezeichnungen beruhigen mich; Dinge hingegen, die sich nicht benennen lassen, machen mir Angst. Wie mich die verschiedenen Bezeichnungen beruhigen, beruhigt mich der Nebel selbst; viele Menschen finden, Nebel habe etwas Unbestimmtes, Ängstigendes, aber Nebel ist nichts weiter als eine heterogene Nukleation von Kondensationskernen, klar und greifbar: Kondensationskerne. Nebel ist schön, dicht und intensiv. Wer schon einmal eine Nebelbank mit Strahlenbüscheln gesehen hat, weiß wie schön es ist, wenn das Licht in Strahlen und Büscheln durch den Nebel fällt; das ist ungeheuer schön und beruhigend. Der Nebel folgt bestimmten Gesetzen, kann als Zeichen einer Wetterlage interpretiert werden und dient als Hilfsmittel der Wetterbeobachtung; der Wahn dagegen, das habe ich hier gelernt, wird als Zeichen des Funktionsverlustes interpretiert und dient als Hilfsmittel der Ausgrenzung. Wahn und Gesellschaft werden fein säuberlich voneinander getrennt, es gilt, die vermeintlich Normalen zu schützen, auch wenn die Wahnsinnigen den Schutz viel eher bräuchten; sie sind in der Minderheit, während sich die Mehrheit dazu aufschwingt, zu werten, zu richten und auszugrenzen; sechsundneunzig Prozent der Gesellschaft warm und behaglich unter der Gauß’schen Kurve, dem Dach der Parabel, die Normalität verspricht, Schutz in der Herde.
Wie Meteorologen vor der Orientierungslosigkeit im Nebel warnen, warnen Psychiater vor der im Wahn. Die Wahnsinnigen sind in ihrem Gehirn verloren, sagen sie, man muss sie schützen, sie vor sich und Andere vor ihnen. Man muss Grenzen ziehen, sagen sie, und das sagen sie sehr laut; vielleicht weil sie Angst haben vor der Grenze, auf der sie sich befinden, und die sie ziehen müssen, aus Sorge, irgendwann einmal auf die falsche Seite zu fallen.
Seit dem frühen Morgen Nebel: Frühnebel; keine meteorologisch exakte Bezeichnung, das weiß ich, aber ich mag das Wort, seinen Klang, und dafür bin ich bereit, auf meine sonst so geliebte Eindeutigkeit zu verzichten; und ich kann mir das erlauben, schließlich sitze ich nicht unter der Kurve, warm und behütet, neben den anderen sechsundneunzig Prozent, welche die Parabel als Dach haben; mich zu benehmen, als säße ich darunter, mich zu bemühen, dass man mich versteht, dieses Benehmen und Bemühen kann ich mir sparen, das Dach endet kurz vor meinem Kopf; und das hat den Vorteil, dass ich den Nebel sehe, rieche und schmecke und seine Schönheit erkenne. Von meinem Zimmer aus ist der gegenüber liegende Hügelkamm nicht mehr zu erkennen, die Bäume auf der Wiese vor meinem Fenster sind vom Nebel verschluckt, nur noch das Balkongeländer mit seinen schwarzen Stäben ist zu sehen, mehr nicht. Von ihm habe ich geträumt, von diesem Balkongeländer; ich hänge an den schmiedeeisernen Stäben, meine Füße baumeln ins Leere, fünf Meter bis zum Bodenkontakt. Das Geländer ist irgendwie instabil, deswegen klammere ich mich an die Blumen in den Kästen und stürze, die Blumen samt Wurzeln in der Hand, stürze ich und falle, fünf Meter falle ich, mit den Blumen in der Hand, in die Tiefe; und als ich im Traum meiner Mutter von dem Traum erzähle, und weine, weil innen wie außen alles wund und verletzt von dem Sturz, dem Aufschlagen, dem Bodenkontakt, sagt sie nur, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wegen der Blumen, dass ich mir da keine Sorgen machen soll, sagt sie, weil die Blumen ohnehin verwelkt waren.
Am Morgen, als ich in den Spiegel blicke, das Gefühl, dass mir ein Fremder entgegen blickt, dass mir irgendjemand eine Maske gegeben hat, aber niemand gesagt hat, was hinter der Maske ist; ein dumpfes Gefühl von Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit diesem Gesicht gegenüber, das ich sein soll. Aber ich werde nicht fragen, den Arzt werde ich ganz sicher nicht fragen, nach der Maske und was dahinter ist, den Arzt werde ich schon dreimal nicht fragen; sicher würde er mich nur darauf hinweisen, dass Dezember ist und nicht Februar, kein Fasching, sondern Winter, wird er sagen. Wahrscheinlich nimmt er den Nebel, der seit dem frühen Morgen im Tal herrscht, nicht einmal wahr, wie er nur wahrnimmt, was er will und was sich durch den AMDP bestimmen und mit Gauß bestätigen lässt. Der AMPD, die Bibel der Psychiater, in ihm alles, was die menschliche Psyche zu bieten hat: Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Orientierung, Affekt, Antrieb, Schlaf, Soziales Verhalten, Selbstmordgedanken. Die menschliche Psyche sauber aufgelistet im AMDP, was mir eigentlich gefallen müsste, mir aber nicht gefällt, weil der AMDP beliebig ist, subjektiv und abhängig vom Beobachter; ganz anders als die Messverfahren, die den Nebel bestimmen: Transmissometer, Automated surface observing system, das sind Verfahren, denen man trauen kann, die sind objektiv und unabhängig; das gefällt mir.
Als ich wenig später vor meinem Arzt sitze, wie immer den Schreibtisch zwischen uns, fällt mir, da ich vom Nebel nicht sprechen will, fällt mir nichts zu sagen ein, sodass ich das Bild hinter seinem Kopf betrachte: pastellfarbene Schmetterlinge, die irgendwie zum Wetter passen, sodass ich sie in den Nebel entlasse, der immer dichter wird, so dicht, dass ich mich frage, was für eine Bedeutung diese zunehmende Dichte hat, denn dass sie eine Bedeutung hat, ist klar. Aber ich werde schon noch dahinter kommen; und wenn ich erst erkenne, welche Bedeutung der Nebel hat, werde ich auch wissen, was hinter der Maske ist, die man mir ohne Erklärung und ohne Notwendigkeit vors Gesicht gezogen hat.
Eine Vorwärtsbewegung, sagt der Arzt, Energie braucht eine Richtung und ein Ziel. Ich verzichte darauf, ihm zu erklären, dass ein Nebelbogen die Sonderform eines Regenbogens ist; es spielt keine Rolle, dem Nebelbogen kommt eine rein ästhetische Bedeutung zu, keine meteorologische. Auch das könnte ich ihm erklären, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass mein Arzt sich für meteorologische Ausführungen nicht besonders interessiert, sie im Gegenteil als Teil meines Wahns versteht. Um es einmal ganz deutlich zu sagen: mein Arzt ist blind, nebelblind um genau zu sein. So wie manche Menschen farbenblind sind, ist er nebelblind, freilich ohne es zu wissen. Zu Anfang, in der zweiten Stunde, war ich versucht, ihm die Augen zu öffnen. Nebelblind, wiederholte er, kaum dass ich das Wort ausgesprochen hatte, und lachte, ein gekünsteltes Lachen. Interessante Wortneuschöpfung, sagte er. Jedes Wort, das er nicht kennt, ist für ihn eine Wortneuschöpfung und damit ein Zeichen für den Wahn. Da ist wenig zu machen, Farbenblinden kann man schließlich auch nicht die Farbe Rot erklären; das einzige, was man erreicht, ist ein unverständiges Beharren auf ihrer grauen Weltsicht.
Das Gespräch ist beendet, bevor es richtig begonnen hat. Der Arzt schüttelt meine Hand. Vergessen Sie den nächsten Termin nicht, sagt er. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, noch nie habe ich einen Termin vergessen, auch wenn die Sitzungen nicht besonders hilfreich sind, habe ich noch nie eine vergessen, zumal er mir für jeden neuen Termin einen Zettel gibt. Ich sammele die Zettel, fein säuberlich, Kante auf Kante, schichte ich sie, sodass ich schon einen kleinen Stapel habe, so hoch wie ein Kartenspiel, ein Skatblatt, möchte ich sagen; und wenn der Stapel hoch genug ist, sagen wir, so hoch wie ein Doppelkopfblatt, werde ich die Klinik verlassen. Also sammele ich und freue mich über jeden neuen Termin, jeden Zettel, der auf den Stapel kommt; zumal ich bei den Sitzungen nichts tun muss, außer sitzen, nur sitzen muss ich, auf der anderen Seite des Schreibtischs und aussehen, als würde ich zuhören. Zuweilen, aber nur ganz selten, in Ausnahmefällen so zusagen, erwartet mein Arzt eine Vorstellung, eine Zukunftsidee meinerseits, passend zu dem Ziel und der Richtung, auf das er immer wieder zu sprechen kommt; doch ist er nur mäßig enttäuscht, wenn ich keine Antwort habe. Wenn ich nicht reagiere, zuckt er die Achseln, als sei es eben seine Pflicht, danach zu fragen, eine lästige Pflicht, vielleicht ein wenig sinnlos, nichtsdestotrotz eine Pflicht, die er erfüllen muss, will er weiterhin unter der Kurve sitzen, unter dem warmen Dach von Gauß, der so etwas sicher nie im Sinn hatte, nun aber darüber entscheidet, ob mein Arzt sein Gehalt bezieht, als Entschädigung für die Kompromisse, die er eingehen muss, um weiterhin unter der Kurve zu sitzen.
Eigentlich gefällt es mir ganz gut in der Klinik, ich habe ein Einzelzimmer, sonst ein Privileg der Privaten, das ich mir durch lautes, anhaltendes Schnarchen hart erkämpft habe. Einzelzimmer also und gutes Essen, jeden Tag mehrere Menüs zur Auswahl; und seit ich mich ruhig verhalte, darf ich sogar alleine auf das Klinikareal, unter Angabe von Ziel und Zeit, so nennen sie das hier; ein wenig lächerlich, dieses Ziel und Zeit, da ich sowieso nur auf das Klinikgelände darf, aber so sind die Vorschriften; alles zu meiner Sicherheit, wie sie immer wieder betonen. Mit den Menschen in der Klinik ist es wie mit denen außerhalb, einige sind nett, mit denen kann man sich unterhalten, andere sind eigenartig, aber mit denen muss man schließlich nicht reden; wenn sie mir zu viel werden, gehe ich in mein Zimmer, schließe die Tür und habe nur noch den Nebel. Sobald ich auf ihn zu sprechen komme, lassen mich die Pflegekräfte in Ruhe, als wollten sie dem Wahn keine Nahrung geben. Wenn ich vom Nebel spreche, versuchen sie nicht länger, mich aus dem Zimmer und zu Tätigkeiten zu überreden, die langweilig sind und unnütz, wie das Korbflechten, dessen Sinn ich bis heute nicht verstanden habe, das ich aber mache, weil es zum Programm gehört und ärztlich verordnet ist. Trotz der Sinnlosigkeit des Korbflechtens, spricht auch der Werkstattleiter von Ziel und Richtung; und weil ich keine Lust habe, mir seine fragend nach oben gezogenen Augenbrauen anzusehen, haben wir uns geeinigt, dass ein geflochtener Papierkorb ein ausreichendes Ziel ist.
Ich arbeite langsam, nicht weil ich langsam wäre, sondern weil wir uns dann nicht so schnell auf ein neues Ziel einigen müssen, was unabdingbar scheint, da der Werkstattleiter, der wie der Arzt unter der Gauß’schen Kurve sitzt, etwas vorweisen muss: Fortschritte, meine Fortschritte um genau zu sein, mit denen ich in gewisser Weise seine Existenz sichere. Unglaublich, aber diese Macht besitze ich hier. Doch ich nutze sie nicht, jedenfalls nicht gegen den Werkstattleiter; ich habe kein Interesse, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, er ist nett und harmlos, harmloser jedenfalls als mein Arzt, der ein wenig zwanghaft ist, in Gesten wie in Worten, und ganz sicher nicht umsonst in einer solchen Einrichtung arbeitet; aber das ist ein anderes Thema und nicht mein Problem.
Dass mein Papierkorb ein wenig schief gerät, scheint den Werkstattleiter nicht zu stören. So lange etwas durch die Öffnung passt, sagt er, erfüllt der Korb seinen Zweck, das reicht. Während er mich in Ruhe flechten lässt, liest er oder notiert etwas, vielleicht wie langsam ich flechte, oder dass ich mir dabei mit der Zunge über die Lippen fahre. Aber soll er notieren, was er will, es ist die schwarzweiße Legitimation seiner Person; und was wäre zur Legitimation besser geeignet als etwas Schriftliches, schwarze Buchstaben auf weißem Grund machen sich immer gut. Wer weiß, vielleicht würde ich es ähnlich machen, wäre ich an seiner Stelle.
Während ich flechte, denke ich an den Strahlungsnebel, der durch die nächtliche Ausstrahlung der Erdoberfläche entsteht und meist, besonders bei windschwachen Wetterlagen im Herbst und im Winter, mit einer Strahlungsinversion verbunden ist. Bei der heute herrschenden, von mir laienhaft als Frühnebel bezeichneten Kondensation, dürfte es sich wahrscheinlich um einen solchen Strahlungsnebel handeln, auch wenn es heute alles andere als windstill ist; vielmehr weht ein anständiger Wind, so stark, dass das Rauchen im Freien verboten ist. Föhn, sagen sie; und bei Föhn ist das Rauchen im Freien verboten; das kann man auf den Schildern lesen, die außen an jedem Gebäude angebracht sind, und auf denen eine durchgestrichene Zigarette zu sehen ist, damit auch die Analphabeten keine Ausrede haben. Und weil das Rauchen im Freien verboten ist, muss man eben im Gebäude rauchen. Deswegen frage ich den Werkstattleiter. Darf ich rauchen, frage ich. Nach der Therapie, sagt er, was zu erwarten war, weil während der Therapien ebenso wenig wie bei Föhn geraucht werden darf. Eigentlich habe ich nur gefragt, um überhaupt etwas zu sagen, etwas Unverfängliches, weil ich weiß, dass Strahlungsnebel nicht unverfänglich ist. Strahlungsnebel, da bin ich sicher, dieses Wort hätte der Werkstattleiter sofort notiert und an meinen Arzt weiter geleitet, was nur zu einer Erhöhung der Medikamentendosis geführt hätte, woran ich kein Interesse habe, weil das meinen Aufenthalt unnötig verlängern würde.
Eigentlich hat mein Hausarzt Schuld daran, dass ich in der Klinik bin. Ich hatte einen ganz regulären Termin und dachte, ich könnte ihm vertrauen. Wissen Sie, sagte ich, als er mich fragte, wie es mir geht. Wissen Sie, sagte ich, wenn Nebel über Null Grad an Pflanzen kondensiert, entsteht Tau. Liegt die Temperatur dagegen unter dem Gefrierpunkt, bildet sich Reif. Daraufhin blickte er mich an, als hätte ich etwas ganz Absonderliches gesagt und räusperte sich; gleich zweimal räusperte er sich. Mit Nebel scheinen sie sich auszukennen, sagte er schließlich; und weil das stimmt, und ich mich mit Nebel tatsächlich auskenne, fuhr ich in meinen Erklärungen fort. Bei stabiler Schichtung der Atmosphäre am Boden und Inversion in der Höhe, einer Fumigation also, erklärte ich, sammeln sich verstärkt Partikel an der Inversionsgrenze, und der Dunst, mit seinem hohen Albedo, wirkt in diesem Fall nicht nur nebelerhaltend, sondern geradezu nebelerzeugend. Aber statt sich mit mir über die Grandiosität der Natur zu freuen, zog er lediglich die Augenbrauen in die Höhe, die rechte höher als die linke. Albedo, sagte er; und weil ich einen kurzen Augenblick irrtümlicherweise davon ausging, er habe verstanden, bestätigte ich und wiederholte noch einmal: Ja, es geht um den Albedo. Mit einem Albedo von Null Komma Neun hat Nebel eine außerordentliche Fähigkeit zur Reflexion von Sonnenlicht, und weil die umgebende Luft gerade einmal einen Albedo von Null Komma Zwei hat, neigt Strahlungsnebel zur Selbsterhaltung. Er nickte, aber an seinem skeptischen Gesichtsausdruck erkannte ich, dass er in Wahrheit kein Wort verstanden hatte. Seit wann, fragte er, denken Sie über Nebel nach. In letzter Zeit immer häufiger, sagte ich ehrlich, zu ehrlich, wie sich später herausstellte; aber zu diesem Zeitpunkt sah ich keine Gefahr; ich vertraute ihm wie gesagt. Kann es sein, fragte er, dass der Nebel Sie sehr beschäftigt, fast ein wenig besetzt hält, möchte ich sagen. Besetzt würde ich es nicht nennen, entgegnete ich, aber wenn man bedenkt, dass Nebel weltweit auftritt, finde ich schon, dass man sich damit beschäftigen sollte. Er nickte; und dieses Nicken machte mich wieder ein wenig mutiger. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sagte ich, wie traurig es ist, dass wir in unseren Regionen niemals Eisnebel zu sehen bekommen. Ich will nicht sterben, sagte ich ernst, ohne wenigstens einmal in meinem Leben Eisnebel gesehen zu haben. Aber um Eisnebel zu sehen, fuhr ich fort, müsste man beispielsweise nach Winnipeg, denn Eisnebel entsteht nur, wenn Wasserdampf in sehr kalter Luft, mindestens zwanzig Grad minus, ohne den Umweg über die Kondensation, zu Eiskristallen resublimiert. Ich lächelte, er lächelte. Je kälter also, sagte ich, umso häufiger Eisnebel. Ich glaube, an diesem Punkt ließ ich mich ein wenig von meiner Euphorie hinreißen und erklärte: Bei minus vierzig Grad und einer Wasserdampfquelle kommt es also fast zwingend zu Eisnebel. Fast zwingend, wiederholte ich, weil das doch nun wirklich faszinierend ist. Und mit diesem zweiten: fast zwingend, endete ich, ausgesprochen zufrieden, einen so schwierigen Sachverhalt, so verständlich dargestellt zu haben. Aber er interessierte sich nicht für diese überaus verständliche Darstellung, sondern fragte lediglich: Was ist eigentlich mit Ihrer Arbeit. Und in diesem Augenblick war ich, nach der ganzen Anstrengung, die ich unternommen hatte, ihm den Nebel nahe zu bringen, verständlicherweise ein wenig enttäuscht und, das gebe ich gerne zu, auch ein klein wenig verärgert. Ich hatte ihm existentielle Dinge erklärt, und er fragte mich nach meiner Arbeit, das war schon ein wenig enttäuschend und ärgerlich. Das erklärt vielleicht, warum ich in der Folge möglicherweise etwas zu heftig reagierte, auch das gebe ich zu; aber ich hatte das ungute Gefühl, dass meine Worte ihn überhaupt nicht erreichten und somit verschwendet waren; und das ärgerte mich verständlicherweise, wie es mich auch ärgerte, dass er sich so gar nicht für das Sein, das Leben und die Entstehung von Nebel interessierte. Es schien fast, als wolle er nicht begreifen, dass im Nebel alles enthalten ist, das ganze Leben, die ganze Welt. Und diese ignorante Haltung, diese Borniertheit war mir so unverständlich und zuwider, dass ich aufsprang und ihn am Kragen packte. Er schrie! Eine völlig unangemessene Reaktion, zumal ich nicht vorhatte, ihm etwas zu tun, sondern ihm, zu seinem Besten, nur die Augen öffnen wollte. Aber er schrie weiter, was mich ein wenig verunsicherte, und mir zudem, weil er sehr laut schrie, in den Ohren schmerzten, sodass ich das Geschrei unbedingt beenden musste, da ich Angst um meine Trommelfelle hatte. Um also meine Ohren zu schützen, ohrfeigte ich ihn, ganz leicht nur, so wie man es früher bei hysterischen Frauen getan hatte; und diese Ohrfeige erfolgte wie gesagt auch nur, damit er mit diesem unsinnigen Geschrei aufhörte, es war sozusagen Notwehr. Doch er dachte gar nicht daran mit dem Schreien aufzuhören, schrie im Gegenteil, falls überhaupt möglich, nur noch lauter und höher, was den Schmerz in meinen Ohren ins Unerträgliche steigerte, sodass ich mich gezwungen sah, ihn ein weiteres Mal zu ohrfeigen. Genau in diesem Augenblick trat, vermutlich durch das Geschrei alarmiert, seine Arzthelferin ins Zimmer. Rufen Sie die Polizei, schrie mein Arzt, dieser Mann ist wahnsinnig. Und dass er, der weder eine Ahnung vom Nebel noch vom Dasein hatte, mich als wahnsinnig bezeichnete, machte mich nun wirklich wütend, sodass ich ihn folgerichtig ein drittes Mal und viertes Mal ohrfeigte, möglicherweise auch ein fünftes Mal. Jedenfalls schrie daraufhin auch die Arzthelferin und beide verschanzten sich hinter dem Schreibtisch, als wäre ich ein gemeingefährlicher Verbrecher. Nur weil ich über ein größeres Wissen verfügte als beide zusammen, nur deswegen, dessen bin ich sicher, behandelten sie mich wie einen wahnsinnigen Verbrecher, standen lächerlich zitternd hinter dem dämlichen Eichenschreibtisch, der mir noch nie gefallen hatte, und alarmierten die Polizei.
Genau das mit dem größeren Wissen und dem Nebel, versuchte ich den kurz darauf eintreffenden Polizisten zu erklären, aber auch sie wollten nicht zuhören, sondern bogen mir stattdessen die Arme auf den Rücken und legten Handschellen um meine Gelenke. Das Klicken werde ich so schnell nicht vergessen, das Klicken nicht und auch nicht das kalte Metall an meinen Handgelenken. Und angesichts einer solch rüden Behandlung hätte jeder, das schwöre ich, wirklich jeder hätte sich angesichts einer solchen Ungerechtigkeit seiner Haut gewehrt. Und nichts anderes versuchte ich, trat und biss, weil meine Hände ja auf dem Rücken waren, und ich außer meinen Füßen und meinem Mund nichts hatte, womit ich mich hätte wehren können. Dieses Treten und Beißen hatte allerdings zur Folge, dass der Arzt, im Schutz der Polizisten, zog der Arzt, dieser Feigling, eine Spritze auf, die er mir durch die Hose in den Oberschenkel rammte. Wenige Augenblicke später wurde ich benommen, sodass ich nicht mehr genau erinnere, was passierte. Das nächste, was ich registrierte, war die Ankunft in der Klinik, in der ich natürlich nicht bleiben wollte, sodass ich mich wehrte, was allerdings nur dazu führte, dass man mich auf ein Bett schnallte und mir weitere Spritzen in den Körper, dieses Mal in den Hintern, rammte, so lange, bis ich das Bewusstsein verlor und in einen unruhigen Schlaf glitt, in dem ich träumte, auf ein Bett geschnallt zu sein; und aus dem ich erwachte, um festzustellen, dass ich tatsächlich auf ein Bett geschnallt war, einen Riemen um den Bauch, zwei Riemen um die Handgelenke und zwei um die Knöchel.
Die Sache wurde nicht besser, als ich am nächsten Tag dem Klinikarzt erklären wollte, was passiert war. Er hörte zwar zu, nickte sogar, sodass ich schon dachte, dass er einen ganz vernünftigen Eindruck machte und somit ganz anders war als mein Hausarzt; aber als er mir dann ganz seltsame Fragen stellte, die nichts, aber auch gar nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hatten, da wurde mir klar, dass auch er kein Wort verstand. Sie werden wohl eine Zeit lang bei uns bleiben, sagte er, nachdem ich seine Fragen, die wirklich zu dämlich waren, nicht beantwortet hatte. Das habe ich nicht vor, entgegnete ich. Das liegt leider nicht in Ihrer Hand, sagte er; und es war dieses ›leider‹, das mich erneut wütend machte. Ich gehe, wann ich will, sagte ich, was das Gespräch leider, und in diesem Fall wirklich leider, nicht einfacher machte. Das glaube ich kaum, sagte er nach einer beeindruckend langen Pause. Sie haben Ihren Hausarzt und dessen Helferin geschlagen. Er betonte jedes einzelne Wort, sodass mir schnell klar wurde, dass er sich in diesen einen Punkt, der überdies völlig nebensächlich war, dass er sich in diesen einen Punkt irgendwie verbissen hatte, weswegen es völlig sinnlos war, alles noch einmal zu erklären; er wollte mich missverstehen, das war offensichtlich.
So leicht wechselt man also die Identität, dachte ich, an einem Tag ein ganz normaler Mensch und schon am nächsten Patient in einer psychiatrischen Klinik, um nicht zu sagen Anstalt, was in diesem Zusammenhang ein viel ehrlicheres Wort gewesen wäre, eine klare und eindeutige Benennung, und damit ganz in meinem Sinn. Für das Gespräch mit dem Klinikarzt hatte man mich jedenfalls losgebunden, keine Ahnung warum, aber auf diese Weise war ich wieder Herr über meine Hände und Füße, was ich aber nicht sofort nutzte, vielmehr bemühte ich mich, noch etwas zu retten; ich saß dem Arzt wie ein ganz normaler Mensch gegenüber, und als solcher unternahm ich also einen letzten Versuch, unsere fehlgeschlagene Kommunikation doch noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Sie scheinen mich nicht zu verstehen, sagte ich nachsichtig, freundlich, als Angebot von Mensch zu Mensch, aber er überlegte nicht einmal, keinen Augenblick lang überlegte er, sondern antwortete sofort: Ich verstehe Sie sehr gut. Arrogant und selbstgefällig sagte er das; und wieder war da dieser Schmerz in meinen Ohren, ob dieser lässigen und unverschämten Antwort, dass ich erneut keine andere Wahl hatte, als auch den Klinikarzt zu ohrfeigen. Er reagierte, das muss ich Fairerweise zugeben, etwas beherrschter und souveräner als mein Hausarzt, und schrie nicht, sondern drückte nur, wenn auch etwas hektisch, einen roten Knopf neben der Tür, woraufhin fast augenblicklich vier Pfleger in den Raum stürmten und mich zu Boden warfen, sodass ich kurz darauf wieder auf diesem Bett lag, einen Gurt um den Bauch, je zwei Gurte um Handgelenke und Knöchel. Kurz bevor ich, nach erneuten Spritzen in den Hintern, einschlief, dachte ich noch, dass ich, wenn das Leben so offensichtlich ungerecht mit mir umsprang, dass ich auf diese Weise die Nebelwälder und Nebelwüsten vielleicht niemals sehen würde; jedenfalls nicht, so lange man mich in dieser Klinik widerrechtlich festhielt. Das dies widerrechtlich geschah, war eindeutig, schließlich hatte ich mit keinem Wort zugestimmt, und diese blöde Verfügung, die sie mir vorlasen, und gegen die ich gerne, wie sie sagten, ohne rot zu werden, Widerspruch einlegen konnte, half nicht, diese Tatsache zu verschleiern. Die Verfügung und die Gewalt, die sie mir antaten, hatten nichts mit Recht zu tun, sondern nur wieder damit, wer unter der Gauß’schen Kurve saß, und wer sich an den Rändern aufhielt.
Die Nebelwälder jedenfalls waren in unendliche Ferne gerückt, wie auch Südamerika in unendliche Ferne gerückt war; denn nach Südamerika wollte ich ebenfalls, dort gibt es, was äußerst selten ist, so genannte Epiphyten, die unabhängig von der Regenzeit, sozusagen ganzjährig, an Wasser kommen und auf diese Weise zum Nebel beitragen. Aber auch die würde ich so schnell nicht sehen, und ich hätte weinen mögen. Sie nickten und sagten, dass sie verstünden, aber in Wahrheit verstanden sie nichts. In meiner zweiten Nacht, alleine auf diesem Bett, wurde mir klar, dass ich mit der Wahrheit keine Chance hatte, und mir nichts anderes übrig blieb, als mich zu verstellen. Die ärztliche Verfügung reichte, mich sechs Wochen in der Klinik zu behalten, und es war ihnen freigestellt, eine behördliche Verfügung zu erwirken, die mich auf unbestimmte Zeit in der Klinik halten würde. Nein, mit der Wahrheit war da nichts zu machen, sie konnten nach Belieben verfahren, daran ließen sie keinen Zweifel. Haben Sie das verstanden, hatte mein Arzt nach seinen Ausführungen gefragt, und am liebsten hätte ich ihn, wären meine Hände in diesem Augenblick nicht wieder ans Bett gefesselt gewesen, erneut geohrfeigt. Ich war versucht, ihm zu sagen, dass die Frage nicht war, ob ich verstand, sondern ob sie verstanden, oder warum sie nicht verstanden und zugleich überzeugt waren, zu verstehen, aber ich hielt den Mund, da ich ja gerade erkannt hatte, dass die Wahrheit zu nichts führt.
Das alles liegt sechs Wochen zurück, und ich habe gelernt mit ihnen umzugehen, weiß, was sie hören wollen und sage es, meistens jedenfalls, nur gelegentlich ist die Empörung noch größer als die Einsicht, dann lasse ich mich zu unbedachten Aussagen hinreißen, manchmal sogar zu Beschimpfungen; doch mit jedem weiteren Tag gewinne ich mehr Kontrolle über mich und sie. In den Nächten träume ich mich in die Nebelwüste Namib, mit einer Niederschlagsmenge von zwanzig Millimetern der trockenste Ort der Welt, an dem zweihundert Tage im Jahr Morgennebel herrscht, der sich hundert Kilometer landeinwärts erstreckt: ein Paradies; nichts wünsche ich mir mehr, als diese Einheit von Nebel und mir.
Mein Arzt, vor dem ich das letzte Mal sitze, erzählt mir, ich weiß nicht warum, dass manche Patienten verärgert sind, wenn man sie mittels Medikamenten, so genannter Neuroleptika, wie er mir ungefragt erklärt, aus ihrem Wahn holt. Besonders die Maniker, sagt er, nehmen einem ein solches Eingreifen übel. Er lacht, ein irres Lachen, wie ich finde, jedoch nicht sage, weil es erstens niemanden interessiert, was ich von der psychischen Gesundheit meines Arztes halte, und ich zweitens morgen die Klinik verlasse und nicht so dumm bin, meine Entlassung mit der Wahrheit über die Psyche meines Arztes zu gefährden. Zehn Minuten trennen mich noch von der Freiheit. Mein Arzt redet, ich nicke. Obwohl ich nicht zuhöre, nicke ich, immer wieder und verfolge dabei die Zeit auf der Uhr, die auf seinem Schreibtisch steht. Vier Minuten noch bis zum Ende des Gesprächs, dann sind die dreißig Minuten, die jedes Gespräch dauert, vorbei. Er redet, ich nicke. Er redet, ich sitze gemütlich und nicke. Drei Minuten noch. Er redet, ich denke darüber nach, dass die Verfahren zur Nebelbeseitigung aufwändig und kostspielig sind, sodass sie nur in Sonderfällen angewendet werden, und also nicht in der Wüste, wo man den Nebel Gott sei Dank in Ruhe lässt. Zwei Minuten noch. Mein Arzt redet, ich nicke. Nehmen Sie die verordneten Medikamente, sagt er, das müssen Sie, sonst kann es jederzeit zu einem Rückfall kommen. Ich nicke. Noch eine Minute, unaufhaltsam strebe ich der Nebelwüste entgegen. Er fragt, ob ich alles verstanden habe, ich nicke. Er erhebt sich, gibt mir die Hand, ich drücke sie, nicke ein letztes Mal und verlasse das Zimmer.
***
Ein wenig verrückt
Das Fenster meines Schlafzimmers zeigt nach Osten. Morgens weckt mich die Sonne, natürlich nur, wenn sie scheint, sonst erledigt das der Wecker. Sechs Uhr, das ist meine Zeit. Ich könnte so lange schlafen, wie ich will, aber ich schlafe nie länger als sechs, sonst bin ich den ganzen Tag erschöpft. Das ist merkwürdig, denn eigentlich müsste ich erholt und nicht erschöpft sein, wenn ich lange schlafe, aber dem ist nicht so. Früher konnte ich ohne Probleme bis mittags im Bett bleiben; vielleicht liegt es am Alter, seit heute Nacht bin ich vierzig.
Um Punkt sieben sitze ich an meinem Computer und durchsuche das Netz nach Pilgerstudien. Das Pilgern ist meine neueste Geschäftsidee, Bußgänge für Menschen, die keine Zeit, aber eine Menge zu büßen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, die Sünden anderer auf sich zu nehmen, aber vielleicht hängt der Erfolg alleine vom Glauben ab, wie bei Menschen, bei denen Placebos genauso gut wirken wie das richtige Medikament. Die Pilgeridee steckt noch in den Kinderschuhen, bevor ich den Werbefeldzug starten kann, brauche ich Studien, die belegen, dass man mittels Fremdpilgern ein gesünderes Leben führt und älter wird.
Seit meinem dreißigsten Lebensjahr bin ich selbstständig. Alles, was nach geregelter Tätigkeit aussieht, bereitet mir Übelkeit. Ich ertrage sie nicht, diese Arbeitszwangsjacken. Meine erste Selbstständigkeit waren Entrümpelungen aller Art. Meist wurde ich von den Erben beauftragt. In der Regel wollten sie alles loswerden, und ich durfte behalten, was ich brauchen konnte, was mir das nächste Geschäft einbrachte, Verkäufe aller Art, mit dem ich fast ebenso viel verdiente, wie mit den Entrümpelungen. Ich hätte das Geschäft nie aufgegeben, wären mir nicht zwei zerdrückte Bandscheiben in die Quere gekommen. Nach den Bandscheibenvorfällen widmete ich mich dem Briefmarkenan- und -verkauf, was ein Jahr lang gut lief, bis plötzlich, aus mir unerfindlichen Gründen, das Interesse an Briefmarken erlahmte, und ich mich nach etwas Anderem umsehen musste. Eine Zeit lang war ich das, was man heute als Dogsitter bezeichnen würde, und nichts anderes bedeutet, als dass man für Geld anderer Leute Hunde Gassi führt. Es war ein schöner Job, ich war an der frischen Luft und hatte Bewegung. Weil es unter den Hunden aber immer den einen oder anderen gab, der ununterbrochen kläffte oder biss, gab ich das Geschäft wieder auf. Als nächstes erstellte ich Datenbanken für Pharmafirmen, nett, aber langweilig. Außerdem bekam das Sitzen meinem Rücken nicht, weswegen ich ins Kuriergeschäft wechselte. Doch auch das Fahrrad fahren und Treppen steigen erwies sich als wenig zuträglich für die Bandscheiben, sodass ich es in der Folge mit der Fotografie versuchte. Fotografen gibt es allerdings wie Sand am Meer, und es werden die bevorzugt, die eine Ausbildung haben, wie in Deutschland alles von den richtigen Papieren abhängt. Also ging ich in den Im- und Export von Fischen, was allerdings schon im Ansatz scheiterte, da ich von Fischen keine Ahnung habe.
21. Mai. Einer dieser gefährlich ruhigen Tage, die nur in einer Katastrophe enden können. Ich habe schon zu viele davon erlebt, um noch Illusionen zu haben. Zuweilen hatte ich an diesen Tagen die Idee, künstlich eine kleine Katastrophe herbeizuführen, um eine größere zu verhindern, aber die Tage lassen sich nicht betrügen. Das Telefon klingelt. Meine Mutter. Wie jedes Jahr wünscht sie mir Gesundheit, das höchste aller Güter, wie sie sagt, und fragt mich nach meinen Plänen für den Abend. Ich halte nichts von Geburtstagen, aber das versteht meine Mutter nicht, also sage ich, dass ich Freunde eingeladen habe. Vom Pilgern erzähle ich nichts, meine Mutter ist streng katholisch und würde sich über den Gedanken der Fremdbuße sicher aufregen. »Mit vierzig bist du alt genug, zu wissen, worauf es ankommt«, sagt sie, und ich sage: »Ja«, auch wenn ich keinesfalls weiß, worauf es ankommt. Meine Mutter gehört zu den wenigen Menschen, die zu jeder Zeit wissen, worauf es ankommt. Mich eingeschlossen hat sie vier Kinder groß gezogen, und das Wort meines Vaters als Gesetz geachtet. Dass mein Vater ein Tyrann war, der sich aufspielte wie der Dirigent eines Orchesters, davon hat sie nie etwas wissen wollen. Seit seinem Tod vor drei Jahren geht sie jede Woche auf den Friedhof und stellt Blumen auf sein Grab. »Unsere Ehe war vorbildlich«, sagt sie. »Dein Vater hat es verdient, dass man ihn auch nach dem Tod mit Respekt behandelt. Was sollen außerdem die Leute denken.« Meine Mutter gibt viel auf die Gedanken Anderer. Nicht auszuschließen, dass sich das mittlerweile geändert hat, ich habe sie seit einem Jahr nicht besucht. Ihre Frömmigkeit hat ein Ausmaß angenommen, das mir unerträglich ist. Also, kein Wort vom Pilgern.
Nachdem ich aufgelegt habe, klingelt das Telefon ein zweites Mal. Eine Frau redet aufgeregt auf mich ein und nennt, trotz wiederholter Aufforderung, ihren Namen nicht. Wie ich langsam heraushöre, ist es Rebeccas Nachbarin; so wirr, wie sie redet, muss etwas Schlimmes passiert sein, das Wort Krankenhaus fällt ein paar Mal, und obwohl ich meine Exfrau seit der Trennung vor sieben Monaten nicht gesehen habe, verspreche ich der Unbekannten am Telefon, sofort zu kommen, um Rebecca, wobei auch immer, zu helfen.
Rebecca und ich waren acht Monate verheiratet, und ich weiß bis heute nicht, warum sie mich verlassen hat. Nach der Trennung hatte ich oft das Bedürfnis, sie anzurufen und nach den Gründen zu fragen, aber sie wollte keinen Kontakt. »Für mich ist das auch nicht leicht, das kannst du mir glauben«, sagte sie wiederholt, und ich glaubte ihr, auch wenn ich nicht verstand, warum sie mich verließ, wenn es nicht leicht für sie war. Vielleicht hatte ich mich zu wenig um sie gekümmert. Zwei Monate nach der Hochzeit steckte ich in einem viel versprechenden Projekt mit den Indern, ein location service für die Filmindustrie; Bollywood suchte romantische Drehorte in Europa. Ein low budget Film ohne Honorar für mich, aber ich hoffte, auf diese Weise einen Fuß in die Tür zu bekommen. Zwei Wochen lang kümmerte ich mich um Drehgenehmigungen, Pressekonferenzen und andere Formalitäten. Rebecca und ich hatten lange das Für und Wider des Projektes besprochen und waren, wie ich meinte, einvernehmlich zu dem Schluss gekommen, dass es eine Chance war. Ich nahm einen Kredit auf und arbeitete Tag und Nacht für die Inder. In diesen vier Wochen hatte ich natürlich keinen Kopf für Rebeccas Sorgen, aber ich dachte, wir würden die Zeit überstehen. Ich hatte mich getäuscht.
Weil ich mir kein Auto leisten kann und mein Fahrrad kaputt ist, nehme ich erst den Bus und dann die Bahn. Während der Stunde, die ich für die Fahrt brauche, frage ich mich, was passiert sein könnte. Ein Selbstmordversuch kommt mir in den Sinn, es wäre nicht der erste, einen unternahm Rebecca im Alter von achtzehn und einen kurz bevor wir uns kennen lernten, während unserer Beziehung folgte kein weiterer. Krebs stelle ich mir als nächstes vor, Brustkrebs, bösartig, schnell wachsend, vermutlich tödlich. Ich gehe immer gerne vom Schlimmsten aus, das hilft mir, mit dem weniger Schlimmen gut zu Recht zu kommen.
Rebecca hat rote Haare und eine helle, sonnenempfindliche Haut. Sie ist schlank, hart an der Grenze zur Magerkeit, und so weit ich das beurteilen kann, eine gute Sozialarbeiterin, aber unfähig sich abzugrenzen. Obwohl sie immer bis spät abends arbeitet, hat sie stets das Gefühl, nicht genug zu tun; und jetzt liegt sie selbst im Krankenhaus, zumindest nehme ich das an, aber vielleicht habe ich die Nachbarin auch falsch verstanden. Oder die Nachbarin ist verrückt, möglicherweise eine Klientin von Rebecca.
Ich klingele. »Zweiter Stock, erste Tür rechts«, tönt eine kindliche Stimme aus der Gegensprechanlage. Ich nehme den Fahrstuhl, der sich ruckend in Bewegung setzt. Besagte Tür im zweiten Stock steht einen Spalt breit offen. »Kommen Sie rein.« Die Stimme klingt erstaunlich ruhig, fast ein wenig fröhlich, keine Spur von Verwirrtheit oder Verzweiflung. Zögernd trete ich in den Flur. Die Wände sind orange. Neben der Tür eine Garderobe mit Tierköpfen, ein grüner Krokodilkopf, ein brauner Affenkopf, ein schwarzweißer Kuhkopf, der gelbe Kopf eines Feuersalamanders. Eine einzige türkisfarbene Jacke hängt an der Garderobe. Ich frage mich, was für ein Kopf unter der Jacke sein mag, vielleicht der eines Schweins.
»Wo bleiben Sie denn?« Ich setze mich in Bewegung, der Flur führt in ein Zimmer mit gelben und grünen Wänden, mitten im Zimmer ein rotes Sofa, darauf eine Frau mit langen, schwarzen Haaren, großen, dunkelbraunen Augen, die von einem auffälligen schwarzen Lidstrich umrandet sind. »Bin ich hier richtig?«
»Kommt darauf an, wo Sie hinwollen.«
»Sie sind Rebeccas Nachbarin?«
»Erstaunt?«
»Nein, ich habe Sie mir nur …«
»Anders vorgestellt«, beendet sie meinen Satz und wirft den Kopf in den Nacken. »Tut mir leid. Ich war vorhin wohl etwas durcheinander.« Das ist euphemistisch ausgedrückt, finde ich, sage aber nichts. Sie lacht, und ich habe den Wunsch, mich zu ihr zu setzen, eine Flasche Wein zu öffnen und über etwas Angenehmes zu reden. »Was ist mit Rebecca?«, frage ich stattdessen. Sie lacht erneut. Ich frage mich, ob sie Drogen genommen hat. »Rebecca würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich Sie angerufen habe.«
»Warum ist sie im Krankenhaus?«
»Nichts Schlimmes.«
»Das klang am Telefon aber ganz anders.«
»Ich sagte ja, es tut mir leid. Ich habe lange gezögert, Sie anzurufen, aber ich finde, Sie haben ein Recht, es zu wissen.« Ich nicke, auch wenn ich keine Ahnung habe, auf welches Wissen ich ein Recht haben soll. »Wollen Sie etwas trinken?