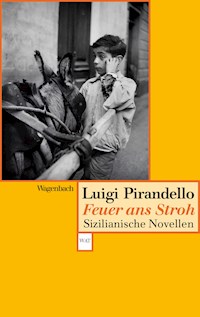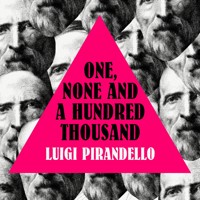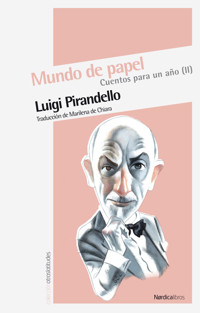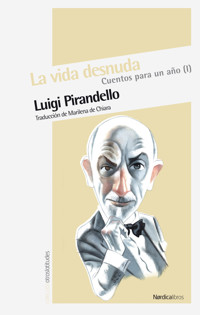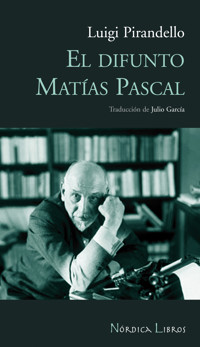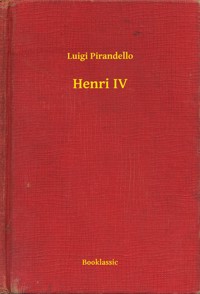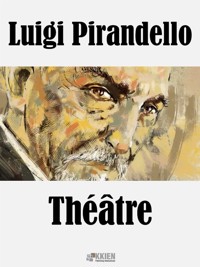14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wiederentdeckung eines großen europäischen Erzählers
Ein Reisender findet sich unversehens in einer fremden Welt wieder – und in den Armen einer schönen Unbekannten; ein Familienvater hat von heute auf morgen seine ganze Sippe gegen sich, wird zum ungeliebten Patron ... Pirandello ist ein unerreichter Meister der subtilen Irritation, des tragikomischen Umkippens vom vermeintlich Realen ins Surreale. In seiner Prosakunst erweist sich die Unbeständigkeit dessen, was man Normalität nennt. Faszinierend zu sehen, wie der Autor aus kleinen Irritationen beiläufig die großen Dramen des modernen Menschen gestaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LUIGI PIRANDELLO
Angst vor dem Glück
Erzählungen
Aus dem Italienischen übersetzt
von Hans Hinterhäuser
Nachwort von Matthias Weichelt
MANESSE VERLAG ZÜRICH
ANGST VOR DEM GLÜCK
Bevor Fabio Feroni, nicht mehr von der einstigen Kraft der Vernunft geleitet, sich entschloss, eine Frau zu nehmen, hatte er, während die anderen auf einem Spaziergang oder in den Cafés Erholung von der täglichen Mühsal suchten, als der Einzelgänger, der er damals war, lange Jahre hindurch sein Vergnügen auf der kleinen Terrasse einer alten Junggesellenwohnung gefunden, wo es neben vielen Blumentöpfen auch Fliegen und Spinnen und Ameisen und andere Insekten in Hülle und Fülle gab, für deren Dasein er sich mit Hingabe und Neugier interessierte.
Besonderen Spaß machte es ihm, den sinnlosen Anstrengungen einer alten Schildkröte zuzusehen, die sich seit Jahr und Tag stur und hartnäckig mühte, die erste der drei Stufen emporzuklettern, über die man von jener Terrasse ins Speisezimmer gelangte.
«Wer weiß», hatte Feroni öfter gedacht, «wer weiß, welche Wonnen sie dort zu finden hofft, wenn ihr Starrsinn nach so vielen Jahren noch nicht erlahmt ist!»
Wenn es ihr mit großer Mühe gelungen war, die Senkrechte zu überwinden, wenn sie schon die krummen Beinchen auf den Rand der Stufe legte und verzweifelt scharrte, um sich nach oben zu ziehen, verlor sie mit einem Male das Gleichgewicht und fiel rücklings auf ihren rauen Panzer zurück.
Feroni wusste natürlich, dass sie, wenn sie auch die erste, dann die zweite und endlich die dritte Stufe überwunden und das Speisezimmer in seinem ganzen Umkreis erforscht hätte, doch wieder auf den Terrassenboden würde zurückkehren wollen; gleichwohl hatte er sie, um sie für die vergebliche Anstrengung vieler Jahre zu belohnen, mehr als einmal genommen und behutsam auf die erste Stufe gesetzt.
Aber er hatte zu seiner großen Verwunderung beobachtet, dass die Schildkröte, aus Angst oder Misstrauen, sich niemals die unerwartete Hilfe zunutze gemacht hatte und, Kopf und Füße unter ihr Schuppendach ziehend, eine geraume Weile unbeweglich wie ein Stein liegen geblieben war, bis sie endlich, langsam kehrtmachend, sich wieder dem Rand der Stufe näherte, indem sie unzweifelhaft zu verstehen gab, dass sie wieder hinunter wollte.
Und so hatte er sie wieder hinuntergesetzt; doch siehe, bald darauf erneuerte sie den ewigen Versuch, aus eigener Kraft jene erste Stufe emporzuklettern.
«Was für ein dummes Vieh!», hatte Feroni das erste Mal ausgerufen. Aber dann war er nach einigem Nachdenken gewahr geworden, dass er dummes Vieh zu einem Tier gesagt hatte, so wie man dummes Vieh zu einem Menschen sagt.
Tatsächlich hatte er dummes Vieh zu ihr gesagt, nicht weil sie in so vielen Jahren der Versuche noch nicht eingesehen hatte, dass jene Stufe zu hoch war und sie notwendigerweise, sich vertikal an sie anklammernd, an einem gewissen Punkt das Gleichgewicht verlieren und auf den Rücken fallen würde; sondern weil sie, wenn er ihr helfen wollte, seine Hilfe ausschlug.
Was folgt aber aus dieser Überlegung? Dass, wenn man in diesem Sinn dummes Vieh zu einem Menschen sagt, man den Tieren eine schwere Beleidigung zufügt, weil man mit Dummheit verwechselt, was Redlichkeit oder instinktive Klugheit in ihnen ist. Dummes Vieh sagt man zu einem Menschen, der gebotene Hilfe nicht annimmt, weil es nicht erlaubt scheint, an einem Menschen zu schätzen, was bei den Tieren Redlichkeit ist.
All dies ganz allgemein!
Feroni hatte im Übrigen seine besonderen Gründe, sich über diese Redlichkeit oder Klugheit, was immer es sein mochte, der alten Schildkröte zu ärgern; er freute sich eine Weile an den komischen und verzweifelten Stößen, die sie, auf dem Rücken liegend, ins Leere tat, und pflegte ihr schließlich, des Anblicks ihrer Leiden müde, einen kräftigen Fußtritt zu versetzen.
Niemals, niemals hatte ihm jemand, bei allen seinen Anstrengungen, nach oben zu kommen, eine hilfreiche Hand reichen wollen.
Und doch, nicht einmal das hätte Fabio Feroni im Grunde sehr geschmerzt, da er die harte Beschwernis des Daseins kannte und den Egoismus der Menschen, der sich daraus ergibt. Aber er hatte im Leben eine andere, sehr viel traurigere Erfahrung machen müssen, durch die er fast ein Recht, wenn auch nicht gerade auf die Hilfe, so doch auf das Mitleid der andern erworben zu haben glaubte.
Und die Erfahrung war diese: dass trotz all seines Eifers immerzu, sobald er nur ganz nahe an dem Ziel war, nach dem er lange Zeit mit allen Kräften seiner Seele umsichtig, geduldig und hartnäckig gestrebt hatte, immerzu das Schicksal, mit dem plötzlichen Losschnellen eines Purzelmännchens, sich ein Vergnügen daraus gemacht hatte, ihn rücklings umzuwerfen, genau wie jene Schildkröte.
Ein grausames Spiel. Ein Windstoß, ein Nasenstüber, eine leichte Erschütterung im schönsten Augenblick, und alles war dahin!
Und man hätte nicht sagen können, dass seine plötzlichen Rückschläge wegen der Bescheidenheit seiner Ambitionen nur geringes Mitleid verdienten. Zunächst – seine Ambitionen waren nicht immer so bescheiden gewesen wie in diesen letzten Zeiten. Und dann … – ja gewiss, je höher, desto schmerzlicher ist der Sturz. Aber ist der, den eine Ameise von einem zwei Handbreit hohen Strauch tut, nicht im Endeffekt dem eines Menschen vergleichbar, der von einem Kirchturm stürzt? Abgesehen davon, dass die Bescheidenheit der Ambitionen dieses kleine Spiel des Schicksals nur umso grausamer erscheinen lassen musste. Ein sonderbares Vergnügen, in der Tat – seine Wut an einer Ameise auszulassen, das heißt an einem armen Teufel, der sich seit Jahr und Tag müht, auf alle mögliche Weise einen kleinen Ausweg zu entdecken und mit allerlei Mitteln und Mittelchen auszubauen, um seine Lebensbedingungen ein wenig zu verbessern; ihn hinterrücks zu überraschen und in einem kurzen Augenblick alle Schlauheit und Spitzfindigkeit zunichtezumachen, die lange Pein einer Hoffnung, die er vorsichtig, gleichsam an einem immer dünneren und unwahrscheinlicheren Fädchen geführt hat.
Nicht mehr hoffen, sich keine Illusion mehr machen, nichts mehr begehren! In völliger Unterwerfung seinen Weg gehen, sich der Willkür des Schicksals überlassen – das war die einzige Möglichkeit: Fabio Feroni begriff es wohl. Aber auch die Hoffnungen, Wünsche und Illusionen lebten, gleichsam ihm zum Trotz, unweigerlich wieder auf: Es waren die Saatkörner, die das Leben selbst ausstreute und die auch auf sein Erdreich fielen, das, wie hart es vom Frost der Erfahrung geworden sein mochte, sie aufnehmen musste und nicht verhindern konnte, dass sie schwache Wurzeln schlugen, dass sie bleich, in trostloser Schüchternheit, in der düsteren und eisigen Luft seiner Verzagtheit emporwuchsen.
Er konnte höchstens so tun, als bemerke er es nicht; oder auch zu sich selbst sagen, es sei nicht wahr, dass er dieses hoffe und jenes begehre; oder dass er sich der kleinsten Täuschung hingebe, könnten sich diese Hoffnung oder jener Wunsch je verwirklichen. Er lebte dahin, als wenn er wirklich nicht mehr hoffe und begehre, als ob er sich wirklich nicht die kleinste Illusion mehr mache; aber er schielte doch immer verstohlen nach der Hoffnung, nach dem Wunsch und nach der versteckten Illusion und folgte ihnen, gleichsam hinter seinem eigenen Rücken, mit verschwiegenem Ernst.
Wenn ihm dann das Schicksal plötzlich ein Bein stellte, fuhr er wohl zusammen, aber er tat so, als habe er nur leicht mit den Achseln gezuckt, lachte grimmig und ertränkte den Schmerz in der bitteren Befriedigung, dass er gar nichts gehofft, gar nichts gewünscht, sich über absolut nichts Illusionen gemacht, dass ihn diesmal das teuflische Schicksal nicht hereingelegt hatte. «Aber das versteht sich von selbst! Aber das versteht sich von selbst!», sagte er in solchen Augenblicken zu seinen Freunden, seinen Bekannten, seinen Arbeitskollegen in der Bibliothek, wo er angestellt war.
Die Freunde sahen ihn an, ohne zu begreifen, was sich von selbst verstehen solle.
«Aber seht ihr es denn nicht? Das Kabinett ist gestürzt!», fügte Feroni hinzu. «Und das versteht sich von selbst!»
Es schien, als begreife er allein die absurdesten und unwahrscheinlichsten Dinge, seit er sozusagen nicht mehr direkt hoffte, sondern zum Zeitvertreib imaginäre Hoffnungen kultivierte, Hoffnungen, die er hätte haben können, aber nicht hatte, Illusionen, die er sich hätte machen können, aber sich nicht machte; und seit er auf solche Weise angefangen hatte, die seltsamsten Beziehungen von Ursache und Wirkung in jeder Kleinigkeit zu entdecken. Heute der Sturz des Kabinetts, morgen die Ankunft des Schahs von Persien in Rom, übermorgen den Ausfall des elektrischen Stroms, der die ganze Stadt für eine halbe Stunde im Dunkeln gelassen hatte.
Kurz, Fabio Feroni hatte sich nun einmal in das verrannt, was er das Losschnellen des Purzelmännchens nannte; und so war er natürlich den wunderlichsten Formen von Aberglauben zum Opfer gefallen, die ihn immer mehr von seinen früheren, beschaulichen philosophischen Meditationen abbrachten und ihn mehr als eine Verrücktheit und Unüberlegtheit hatten begehen lassen.
Eines schönen Tages verheiratete er sich kurzerhand, wie man ein Ei trinkt, um nicht dem Schicksal die Gelegenheit zu geben, ihm alles wieder zunichtezumachen.
In Wirklichkeit hatte er bereits seit Langem (verstohlen, wie gewöhnlich) ein Auge auf jene Signorina Molesi geworfen, die bei der Bibliothek beschäftigt war; und je schöner und anmutiger Dreetta Molesi ihm scheinen wollte, desto öfter erklärte er vor anderen, sie sei hässlich und affektiert.
Seiner Braut, die über seine allzu große Eile klagte, obwohl es auch ihr gar nicht rasch genug gehen konnte, sagte er, alles sei schon seit geraumer Zeit fertig: Die Wohnung sei so und so eingerichtet, sie dürfe sie aber nicht sehen, weil er diese schöne Überraschung für den Hochzeitstag aufhebe; und er wollte nicht einmal verraten, in welcher Straße sie liege, da er fürchtete, sie könnte heimlich mit ihrer Mutter oder ihrem Bruder hingehen, neugierig gemacht durch die bis in die kleinste Einzelheit gehenden Beschreibungen, die er von all ihrem Komfort gegeben hatte, von dem Blick, den man aus den Fenstern genoss, und von den Möbeln, die er gekauft und liebevoll in den verschiedenen Zimmern aufgestellt hatte.
Lange besprach er mit ihr die Hochzeitsreise: Nach Florenz? Nach Venedig? Aber als es so weit war, fuhr er nach Neapel, sicher, dass er so dem Schicksal eins ausgewischt, das heißt, es nach Florenz und Venedig geschickt hatte. Mochte es doch, von Hotel zu Hotel eilend, versuchen, ihm die Freuden der Flitterwochen zu vergällen: Er konnte sie inzwischen ruhig und unbeschwert in Neapel genießen.
Sowohl Dreetta wie die Verwandtschaft waren aufs Höchste erstaunt über den plötzlichen Entschluss, nach Neapel zu reisen, obwohl sie schon ein wenig an diese unvermuteten Umschläge seiner Stimmungen und Vorsätze gewöhnt waren. Sie konnten nicht ahnen, dass sie eine sehr viel größere Überraschung bei der Rückkehr von der Hochzeitsreise erwartete.
Wo war das Haus, die seit Langem bereitete und in allen Einzelheiten beschriebene Heimstatt? Wo denn? Nun, in dem Traum, den Fabio Feroni wie immer für das Schicksal bestimmte, damit dieses sich ein Vergnügen daraus mache, ihn nach Belieben mit einem seiner unvorhergesehenen Willkürakte zu zerstören. Dreetta sah sich bei der Ankunft in Rom in zwei möblierte Zimmerchen geführt, die Fabio im Zug unter den vielen Wohnungsannoncen einer Zeitung ohne großes Aufhebens ausgewählt hatte.
Der Zorn und die Empörung sprengten diesmal alle Fesseln, die ihnen bisher die gute Erziehung und die geringe Vertrautheit auferlegt hatten. Dreetta und die Verwandten schrien Verrat – schlimmer, Betrug. Warum diese Lügen? Warum eine vollständig eingerichtete Wohnung mit allem Komfort erdichten, warum?
Fabio Feroni, der mit diesem Ausbruch gerechnet hatte, wartete geduldig, bis die erste Wut verraucht war, indem er befriedigt über sein Martyrium lächelte und mit den Fingern ein Härchen in der Nase suchte, an dem er ziehen könnte.
Dreetta weinte? Die Verwandten beleidigten ihn? Es war gut so, es war gut so, um all der Freude willen, die er eben noch in Neapel gehabt hatte, um all der Liebe willen, von der sein Herz erfüllt war. Es war gut so.
Warum weinte Dreetta? Wegen einer Wohnung, die es nicht gab? Aber nicht doch, halb so schlimm! Eines Tages würde sie schon da sein!
Und er erklärte den Verwandten, warum er nicht schon vorher die Wohnung eingerichtet und warum er gelogen hatte; er erklärte, es sei im Übrigen ein wenig ihre Schuld, wenn seine Lüge als solche erscheine, sie hätten nämlich zu viele Fragen an ihn gerichtet, als er am Anfang behauptet habe, alles sei seit Langem fertig und er wolle seiner jungen Frau eine schöne Überraschung machen. Das Geld liege bereit, da sei es: zwanzigtausend Lire, die er in so vielen Jahren unter so großen Mühen gespart hatte; und die Überraschung, die er Dreetta bereitet habe, sei die, dass er ihr dieses Geld in die Hand gebe, damit sie, sie allein danach trachten möge, ihr Heim nach ihrem Geschmack einzurichten, als eine Erfordernis und nicht als einen Traum. Aber sie dürfe um Gottes willen auf gar keinen Fall und in nichts der fantasievollen Beschreibung folgen, die er ihr einst gegeben habe; alles müsse ganz anders werden; sie solle mit Hilfe ihrer Mutter und ihres Bruders auswählen; er wolle von nichts erfahren, denn wenn er auch nur im Geringsten diese oder jene Wahl gebilligt und sich daran erfreut habe, dann war alles vergebens! Und er müsse ihnen schließlich im Voraus sagen, dass sie es sich nur aus dem Kopf schlagen sollten, ihn mit ihren Einkäufen und der Einrichtung der Wohnung und allem zufriedenstellen zu wollen; schon jetzt erkläre er sich unter allen Umständen unzufrieden, zutiefst unzufrieden.
Sei es aus diesem Grund, sei es wegen der Herzlichkeit der Hausleute, guter Menschen alten Schlags, Mann und Frau mit einer unverheirateten Tochter – Dreetta hatte es nicht mehr eilig, ihr Heim einzurichten. Sie machten mit den Hausleuten aus, dass sie bei der Geburt des ersten Kindes ausziehen würden.
Indessen waren die ersten Monate der Ehe ein Strom heimlicher Tränen für Dreetta, die sich ihrem Mann anpassen wollte, aber noch nicht gemerkt hatte, dass er das genaue Gegenteil von allem sagte, was er wünschte.
Fabio Feroni wünschte im Grunde seines Herzens all das, was seine junge Frau hätte glücklich machen können; aber da er wusste, dass, hätte er diese Wünsche geäußert und verfolgt, das Schicksal sie ihm sofort zunichtegemacht haben würde, äußerte und verfolgte er die entgegengesetzten Wünsche, um ihm zuvorzukommen: Und die junge Frau hatte ein unglückliches Leben. Als sie endlich dahinterkam und begann, alles in seinem Sinne zu tun, das heißt das genaue Gegenteil von dem, was er sagte, erreichten die Dankbarkeit, die Liebe und die Bewunderung Feronis für sie den Höhepunkt. Aber der Ärmste hütete sich wohl, sie zu bekennen; auch er fühlte sich glücklich und begann davor zu zittern.
Wie sollte er es anstellen, die Freude zu verbergen, von der sein Herz voll war? Den Unzufriedenen zu spielen?
Und wenn er seine kleine Dreetta betrachtete, die schon guter Hoffnung war, dann füllten seine Augen sich mit Tränen; Tränen der Zärtlichkeit und der Dankbarkeit.
In den letzten Monaten machte sich die Frau mit Bruder und Mutter daran, das Haus einzurichten. Fabio Feroni war mehr als je angstvoll erregt. Der kalte Schweiß brach ihm bei allen Jubelrufen seiner kleinen Frau aus, die über den Kauf dieses oder jenes Möbels glücklich war.
«Komm und sieh … Komm und sieh …», sagte Dreetta zu ihm.
Mit beiden Händen hätte er ihr den Mund zuhalten mögen. Zu groß war die Freude; nein, das war ja das Glück, das wahre Glück war da! Unmöglich, dass nicht von einem Augenblick zum andern ein Unglück geschah. Und Fabio Feroni begann mit raschen, verstohlenen Blicken um sich, nach vorne und nach hinten zu sehen, um die Hinterlist des Schicksals aufzuspüren und ihr zuvorzukommen, die Hinterlist, die selbst hinter einem Staubkörnchen lauern konnte; und wie ein großer Kater warf er sich, die Hände voran, auf die Erde, um seiner Frau den Weg zu versperren, wenn er auf dem Boden eine Schale entdeckte, auf der ihr Füßchen hätte ausgleiten können. Vielleicht lag der Hinterhalt gerade da, in jener Schale? Oder vielleicht – aber ja, in jenem Vogelkäfig! Schon einmal war Dreetta auf einen Stuhl gestiegen und hatte sich der Gefahr ausgesetzt zu fallen, als sie den Hanfsamen im Näpfchen nachfüllen wollte. Fort mit diesem Kanarienvogel! Und auf den Protest, auf die Tränen Dreettas hatte er, ganz verstört und mit gesträubten Haaren wie eine geprügelte Katze, zu schreien begonnen: «Um Himmelswillen, ich bitte dich, lass mich machen, lass mich machen!»
Und die aufgerissenen Augen wanderten ruhelos hin und her, so beweglich und glänzend, dass einem angst und bang werden konnte.
Bis sie ihn eines Nachts überraschte, wie er im Hemd, eine Kerze in der Hand, die Hinterlist des Schicksals in den Kaffeetassen suchte, die auf dem Bord der Anrichte im Esszimmer aufgereiht waren.
«Fabio, was machst du denn da?»
«Pst! Still! Ich spüre ihn auf! Ich schwöre dir, diesmal spür’ ich ihn auf! Der spielt mir keinen Streich mehr!»
Plötzlich – war es eine Maus, oder ein Luftzug, oder eine Küchenschabe auf dem bloßen Fuß? – Tatsache ist, dass Fabio Feroni einen Schrei ausstieß, wie ein Bock in die Luft sprang und sich mit beiden Händen an den Bauch fasste, indem er kreischte, da habe er es, das Purzelmännchen, da drinnen, im Bauch drinnen! Und es begann ein tolles Hüpfen und Springen durchs ganze Haus, dann die Treppe hinab und hinaus auf die nächtlich einsame Straße, unter Lachen und Heulen, während Dreetta mit aufgelösten Haaren am Fenster stand und um Hilfe rief.
BERECCHE UND DER KRIEG
I
Die Bierstube
Draußen wieder Sonne. Straßen im Mittagslicht, unter dem glühenden Azur des Himmels, durchschnitten von heftigen violetten Schatten. Und Menschen, die spazieren gehen, voller Leben und bunt gekleidet, luftig und leicht. Stimmen in der Sonne, tönendes Pflaster.
Drinnen hat sich der brave Deutsche fernab der Heimat wenigstens ein bisschen heimatlich eingerichtet in den holzverkleideten vier Wänden seiner Bierstube; und beim Atmen zieht er den dumpfen Geruch der Fässer aus dem benachbarten Keller ein, den fetten Duft der Würstel1, die auf dem Tresen aufgestapelt sind, und den beißenden der Gefäße mit den appetitanregenden Gewürzen, und alle sind mit strengen und zackigen deutschen Lettern versehen, genau wie die glänzenden und lebhaften Plakate in blauer, roter und gelber Farbe, die an den Wänden hängen – mit noch dickeren, noch strengeren, noch zackigeren Lettern: seinen geliebten deutschen Schriftzeichen. Und die Humpen, die bemalten Krügel2, die Schoppengläser, die in schöner Ordnung auf den Regalen stehen, sind wie Schildwachen, die seine Illusionen behüten sollen.
Wenn die Bierstube leer und dämmrig ist, dann erklingt, wie eine ferne, sehnsuchtsvolle Stimme, in seinem tiefsten Innern von Zeit zu Zeit das Lied:
«Nur in Deutschland, nur in Deutschland,
da will ich sterben …»3
Ein breites, herzliches Lächeln auf dem rötlichen Gesicht, hatte er bis gestern mit fröhlichen Gurgellauten seine treuen römischen Gäste begrüßt. Jetzt steht er verdüstert und bewegungslos hinter dem Tresen und grüßt niemanden mehr.
Immer als Erster in der Bierstube, betrachtet ihn Berecche mitleidig bei seinem wackeren Krügel4 von seinem Tisch im Hintergrund aus. Die Gemütsbewegung verleiht ihm einen finsteren Gesichtsausdruck, denn auch seine Lage ist von einem Augenblick auf den andern schwierig geworden.
Bis vor wenigen Tagen pflegte Federico Berecche sich seines deutschen Ursprungs zu rühmen, der außer von dem stämmigen Körperbau, den rötlichen Haaren und den blauen Augen auch vom Familiennamen bezeugt werde, nach seinem Dafürhalten die Verballhornung eines rein deutschen Namens.5 Und er strich alle Vorteile, die Italien das lange Bündnis mit den damals sogenannten Mittelmächten gebracht hatte,6 ebenso heraus wie die offen zutage liegenden Tugenden der deutschen Menschen, die er sich seit vielen Jahren bemühte seiner eigenen Person und der Ordnung seines Lebens und seines Hauses aufzuprägen: Methode vor allem. Methode, Methode!
In der Bierstube haben sie ihn auf einem Marmortischchen in einer Karikatur festgehalten: ein Schachbrett, über das Berecche nach Art der deutschen Infanteristen im Stechschritt hinwegschreitet, eine Pickelhaube auf dem breiten Schädel.
Die spöttische Pointe bezieht sich auf das Schachbrett: wie um zu sagen, dass Berecche so die Welt sieht, in Schachfelder aufgeteilt, und dass er wie die Deutschen in ihr umhergeht: in abgemessenen und regelmäßigen Zügen, eine brave Bauernfigur, gestützt auf den König, die Türme und die Läufer.
Darunter hat ein Witzbold das Wort «Mittelalter»geschrieben und mit einem dicken Ausrufezeichen versehen.
«Deutschland mittelalterlich?», fragte Federico Berecche entrüstet, als er auf dem Marmor des Tischchens die Zeichnung sah, in der er sich natürlich nicht wiedererkannte, wohl aber die deutsche Pickelhaube. – «Deutschland soll mittelalterlich sein? Nein, liebe Leute! An der Spitze der Kultur steht es, an der Spitze der Industrie, an der Spitze der Musik, und dazu die mächtigste Armee der Welt!»
Um dies zu beweisen, hatte er das blau-gelbe Holzschächtelchen aus der Tasche gezogen und seine Pfeife mit einem Streichholz7 angezündet, denn den Gebrauch und die Herstellung der italienischen Wachshölzchen verachtete Berecche als eine Form der Verweichlichung.
Die erste Nachricht, Italien habe sich im europäischen Konflikt für neutral erklärt, hatte Berecche deshalb mit einem Zornesausbruch gegen die italienische Regierung quittiert. «Und der Bündnispakt? Italien macht einen Rückzieher? Und wer wird ihm in Zukunft noch Vertrauen schenken? Neutral? Ist das die Zeit, sich aus dem Fenster zu lehnen, während alle sich bewegen? Stellung muss man beziehen, zum Teufel, und zwar sofort! Und unser Platz …»
Man ließ ihn nicht ausreden. Mit einem Chor der wildesten Proteste, Schmähungen und Beleidigungen fiel man von allen Seiten über ihn her und machte ihn mundtot. – Der Bündnispakt? Nachdem Österreich ihn durch seine Angriffspolitik außer Kraft gesetzt hat! Nachdem Deutschland, wahrlich übergeschnappt, Krieg nach rechts und links und schließlich gar den Sternen erklärt, ohne Rücksprache mit uns, ohne auf unsere besondere Lage Rücksicht zu nehmen! Ignorant! Dummkopf! Was heißt hier Wort halten? Sollen wir zum eigenen Schaden kämpfen? Etwa Österreich siegen helfen? Wir? Und unsere unerlösten Gebiete?8 Und was wird aus unsern Inseln und Küsten, wenn wir die englische und die französische Flotte gegen uns haben? Können wir gegen England sein? Ignorant, Dummkopf!
Anfangs hatte Federico Berecche versucht dagegenzuhalten, indem er seine wütenden Gegner auf das Unrecht und die Beleidigungen Frankreichs verwies. «Tunis! Habt ihr so rasch vergessen, warum der Dreibund entstand? Und gerade eben erst, während unseres Kriegs in Libyen, die Schmuggelgeschäfte mit den Türken? Und morgen – die Ignoranten und Dummköpfe seid ihr! –, da werden wir uns auf dem Campo Formio oder in Villafranca wiedersehen!»9
Dann suchte er, bei jedem Wort unterbrochen, zu beweisen, dass jedenfalls – entschuldigt nur bitte! … neutral bleiben … Aber was heißt hier neutral! Dem Namen, nicht der Sache nach! Denn gibt es in Wirklichkeit einen Akt, der feindseliger sein könnte als dieser? Alles zum unschätzbaren Vorteil Frankreichs! Oh, ihr Schlappschwänze … Neutralität! Hat denn nicht Niccolò Machiavelli … (sie hatten es gewagt, ihn, den pensionierten Geschichtsprofessor, einen Ignoranten zu schimpfen), ja doch, hat nicht Machiavelli in Bezug auf die Gefahren der Neutralität das berühmte Dilemma vorgebracht: «Wenn zwei mächtige Nachbarn von dir in Streit geraten …»10
Ein allgemeiner Aufschrei schnitt ihm das Zitat im Mund ab. Hatte er nicht selbst von einer Neutralität dem Namen, nicht der Sache nach gesprochen? Was hatte das mit Machiavelli und seinem Dilemma zu tun? Ein feindseliger Akt, ja doch! Gegen Österreich, jawohl! Denn Österreich handelt zu unserem Nachteil. Jedenfalls hat es seine Entscheidung getroffen, ohne uns ein einziges Wort zu sagen. Müssen wir nicht dem Schicksal dankbar sein, dass Österreich uns mit seiner unbesonnenen Handlung aus dem Wort entlassen hat? Und morgen, nun … Werden Frankreich und Russland, wenn sie siegen, uns etwa nicht die Vorteile anrechnen, die ihnen unsere Enthaltung eingebracht hat? Lasst nur! England wird schon daran denken, uns zu beschützen, denn es wird keiner Beschneidung unserer Rolle im Mittelmeer zustimmen können, und zwar in seinem ureigensten Interesse.
Mit solchen und ähnlichen Argumenten verteidigte man die Neutralität Italiens, und so leidenschaftlich, dass Berecche sich schließlich geschlagen geben musste und nicht mehr zu widersprechen wagte.
Der Gedanke, dass Italien aufgrund seiner geografischen Lage ein gewichtiges Wort mitzureden haben würde, hat ihn tief beeindruckt. Ein gewichtiges Wort! Bedeutet das nicht, dass das Kriegsglück sich auf die Seite neigen wird, nach der wir uns im günstigen Augenblick drehen? Und wer verliert, ist dann ja wohl klar! «So rüsten wir doch wenigstens auf, zum Teufel!», schrie Berecche mit Donnerstimme und schüttelte die behaarten Fäuste. Bei diesem Aufschrei fühlte sich Federico Berecche in der Tiefe seines Herzens unwillkürlich als Deutscher.
Aber gestern Abend wagte er es in der Bierstube nicht mehr, die Deutschen gegen die schrecklichen Anschuldigungen seiner Freunde zu verteidigen. Kein Einziger war für Deutschland, nicht einmal der schläfrige Fongi, der sonst immer, um des lieben Friedens willen, auf seiner Seite war.
Auch der gute Fongi schwieg sich aus und warf ihm nur von Zeit zu Zeit ängstlich einen schrägen Blick zu, in Erwartung eines plötzlichen Wutausbruchs. Und wirklich war Berecche mehrfach versucht gewesen, ihm seine Faust ins Gesicht zu pflanzen. Er beruhigte sich erst, als die Freunde die Deutschen in Ruhe ließen und auf allgemeinere Themen zu sprechen kamen. Eine Bemerkung beeindruckte ihn besonders, auch wegen der düsteren Miene, mit der ein ihm gegenübersitzender Freund sie in einem Augenblick des Schweigens vorbrachte, während er auf die schaumige Oberfläche in seinem Bierglas starrte. «Alles in allem, und wie unheilvoll auch die Ereignisse, wie schrecklich die Folgen sein werden – über eines dürfen wir uns freuen: dass wir das Glück haben, beim Anbruch eines neuen Lebens dabei zu sein. Vierzig, fünfzig, sechzig Jahre haben wir gelebt und gefühlt, dass es so, wie es war, nicht bleiben konnte; dass die Spannung der Gemüter täglich heftiger wurde und sich über kurz oder lang entladen musste, dass schließlich der Knall kommen würde. Und jetzt ist er gekommen. Schauerlich. Aber wenigstens sind wir mit dabei. Die Unruhe, das Unbehagen, die Angst, die Spannung eines so langen und unerträglichen Wartens werden ein Ende und ein Ventil haben. Wir werden das Morgen schauen. Denn alles wird notwendigerweise anders werden, und wir alle werden aus dieser schrecklichen Erschütterung ganz gewiss erneuert hervorgehen.»
Plötzlich hefteten sich Berecches Blicke auf einen Tisch und auf drei Stühle, von denen die Besucher sich eben erhoben. Er fixierte sie lange und empfand für diese leeren Stühle und diesen verlassenen Tisch einen seltsamen, ständig wachsenden melancholischen Neid.
Er schob diesen Eindruck mit einem tiefen Seufzer beiseite, als ein anderer der versammelten Freunde zu sprechen begann: «Wer weiß! Denkt nur, dass Indien, China, Persien, Ägypten, Griechenland, Rom einmal an der Spitze des Lebens auf der Erde standen. Ein Licht entzündet sich und glänzt für Jahrhunderte in einem Land, auf einem Kontinent; dann wird es langsam schwächer, flackert und erlischt. Wer weiß! Vielleicht ist jetzt Europa an der Reihe. Wer kann die Folgen eines so unerhörten Konfliktes vorhersehen? Vielleicht wird niemand siegen und nur alles zerstört werden: Reichtümer, Industrien, Kulturen. An der Spitze des Lebens wird vielleicht bald Amerika stehen, während hier der Ruin sich allmählich vollenden und eine Zeit kommen wird, wo die Schiffe an den Küsten Europas landen werden, um sie zu erobern.»
Mit einem zweiten, noch tieferen Seufzer sah sich Berecche, zusammen mit dem ganzen Europa, in weiter, weiter Ferne, zurückversetzt in die Nebel einer märchenhaften Vorgeschichte. Bald darauf stand er auf und verabschiedete sich brüsk von den Freunden, um nach Hause zu gehen.
II
Am Abend, unterwegs
Berecche wohnt in einer weit entfernten Querstraße der Via Nomentana.
In dieser kaum erschlossenen und noch unbeleuchteten Querstraße stehen erst drei kleine Villen, Neubauten, zur linken Hand. Zur Rechten sieht man einen ländlichen Zaun, der noch zu verkaufende Bauplätze einfasst, von denen im Dunst des Abends der Duft von frisch gemähtem Gras aufsteigt.
Wie günstig, dass eine der drei Villen einem betagten reichen Prälaten gehört, der da mit drei Nichten wohnt, verwelkten alten Jungfern, die abends abwechselnd eine kleine Leiter hinaufklettern, um vor einem Muttergottesbild aus blauem und weißem Porzellan, das man vor ungefähr einem Monat an einer Ecke des Gebäudes angebracht hat, ein Lämpchen anzuzünden.
Bei Nacht erhellt dieses fromme Lämpchen die einsame Querstraße.
Hier lebt man wie auf dem Land; und als wäre man mitten auf dem Land, hört man in der Stille der Nacht den Lärm der vorüberdonnernden Züge. Sobald Schritte erklingen, erheben hinter dem Gitterzaun der Villen die Hunde ein wütendes Gebell. Aber wenigstens hat Berecche ein wenig freien Raum vor sich und kann die Ruhe genießen.
Von den vier Fenstern seines Erdgeschosses aus schaut er in ein großes Stück Himmel und kann die Sterne sehen, mit denen er des Nachts, in Stunden seiner Muße als ruhiger Rentner, lange Zwiegespräche hält. Die Sterne und den Mond, wenn er scheint. Und im Mondschein die Pinien und Zypressen der Villa Torlonia. Auch ein Stückchen Garten hat er ganz für sich allein, mit einem Springbrunnen, dessen Plätschern in der nächtlichen Stille ihm lieb ist.
Aber ach, die Gattin, die beiden Töchter, die noch im Hause leben, der einzige Sohn, der schon an der Universität Literaturwissenschaft studiert, das Dienstmädchen und jetzt auch der Verlobte der älteren Tochter – sie alle fühlen mitnichten die Poesie der Einsamkeit, des bestirnten Himmels, des Mondes über den Zypressen und Pinien der Patriziervilla und schnauben oder gähnen wie ausgehungerte Hunde beim eintönigen und ewigen Geplätscher jenes bezaubernden Brunnens. Sie kommen sich vor wie verbannt, wie im Exil. Doch Berecche – Methode, Methode, Methode! – lässt sich nicht erweichen und hat den Mietvertrag um weitere drei Jahre verlängert.
Jetzt beschwert und bedrückt der Albtraum einer allgemeinen Zerstörung, die jedes Licht der Wissenschaft und Kultur im alten Europa zum Erlöschen bringen wird, sein Gemüt noch tiefer, wenn er ins Dunkel der abgelegenen und einsamen Straße eintaucht, unter den in vier Reihen angeordneten großen und reglosen Bäumen.
Wie wird das neue Leben aussehen, wenn das schreckliche Durcheinander unter Ruinen erkaltet sein wird? Und wie wird er daraus hervorgehen, mit seinen dreiundfünfzig Lebensjahren?
Andere Bedürfnisse, andere Hoffnungen, andere Gedanken, andere Gefühle. Alles wird sich unvermeidlicherweise ändern. Aber nicht diese großen Bäume, die zu ihrem Glück weder denken noch fühlen können! Wenn sich die ganze Menschheit um sie herum verändert, werden sie die gleichen Bäume geblieben sein, diese und keine anderen.
Federico Berecche hat, ach, große Angst, dass auch er in der Tiefe des Herzens sich nicht mehr wird ändern können, was immer auch in der Zeit geschehen mag, die ihm noch bleibt. Er hat sich daran gewöhnt, jede Nacht mit den Sternen zu plaudern; und bei ihrem kalten Licht haben sich die irdischen Gefühle in seinem Innern gewissermaßen verdünnt. Man möchte es nicht glauben, denn äußerlich erscheint der Wille, auf seine methodische, deutsche Art zu leben, zäh wie zuvor. Doch im Grunde ist er müde und traurig, und das werden die Weltereignisse schwerlich ändern können.
Ob nun die Franzosen, die Russen und die Engländer siegen oder die Deutschen und die Österreicher; ob Italien seinerseits in den Krieg hineingerissen wird oder nicht und das Elend und die Düsternis einer Niederlage erleben muss oder ob alle Städte der Halbinsel im frenetischen Siegestaumel erbeben; ob sich die Landkarte Europas verändert; eines, so viel ist sicher, wird sich niemals ändern: die Abneigung seiner Ehegattin gegen ihn, ihr verschlossener Groll, ihr Bedauern über ein Leben, das ohne eine wahrhaft freudvolle Erinnerung dahingegangen ist. Und keine Macht des Himmels und der Erde wird dem jüngsten Töchterchen, das seit sechs Jahren blind ist, das Augenlicht wiedergeben können.
Wenn er jetzt nach Hause kommt, wird er sie in einer Ecke des Esszimmers sitzen sehen, die wächsernen Hände auf den Beinen, das blonde Köpfchen gegen die Wand gestützt, und weil das erloschene Gesichtchen nicht verrät, ob sie schläft oder wacht, wird er sie wie jeden Abend fragen: «Schläfst du, Ghetina?»
Und Margheritina wird ihm, ohne den Kopf von der Wand zu heben, antworten: «Nein, Papa, ich schlafe nicht.»
Nie sagt sie ein Wort, nie beklagt sie sich, es scheint, als schliefe sie immer, vielleicht schläft sie nie.
Während Berecche unter den großen Bäumen dahinschreitet, räuspert er sich kräftig, denn als starker, auf deutsche Art erzogener Mann kann er es nicht zulassen, dass ihm die Angst die Kehle zuschnürt. Aber alle leben doch im Licht; er selbst lebt im Licht und kann zufrieden sein, während diese schreckliche Sache existiert, dass sein Töchterchen im immerwährenden Dunkel lebt und dasitzt, das Köpfchen an die Wand gelehnt, und auf den Tod wartet: eine Erwartung, die wer weiß wie lange dauern kann.
Ein anderes Leben: andere Gedanken, andere Gefühle. Ach ja! Carlotta, die älteste Tochter, hat vor einem Jahr die Kurse an der Universität aufgegeben, weil sie sich mit einem braven Jungen aus dem Valle di Non im Trentino verlobt hat, Doktor der Literatur und Philosophie an der Universität in Rom; ein braver Junge, von lebhaftem Gemüt, edlen Empfindungen, voll gutem Willen, aber noch ohne Stellung und mehr als jemals zuvor unsicher im Hinblick auf seine Zukunft. Drei Brüder von ihm, die in San Zeno11 leben, sind zum Militär eingezogen worden. Der Vater ist Gemeindevorsteher in San Zeno. Die drei armen Burschen haben sich folglich nicht der verhassten Pflicht entziehen können, für Österreich zu kämpfen; und wer weiß, wenn es für uns schiefgeht, ob sie morgen nicht gegen Italien eingesetzt werden. Welcher Graus! Er selbst hat sich der Einberufung nicht gestellt, und also: Leb wohl, Valle di Non, leb wohl, San Zeno, lebt wohl, alte Eltern. Deserteur ist er, und wenn man ihn morgen festnähme, würde er aufgehängt oder an die Wand gestellt werden. Aber er hofft, dass Italien … wer weiß! Er würde gerne mitmachen, auch auf die Gefahr hin, gegen seine unglücklichen Brüder kämpfen zu müssen. Zusammen mit Faustino würde er zu den Waffen eilen.
Beim Gedanken an Faustino räuspert sich Berecche ein zweites Mal und so stark, dass es ihm fast die Gurgel zerreißt; sein einziger männlicher Nachkomme, sein Augapfel, der sich zum Glück dieses Jahr noch nicht stellen muss – er würde sich freiwillig melden, zusammen mit dem künftigen Schwager. Er könnte es ihm nicht mehr verbieten; aber, zum Teufel – verfluchter Hals, verfluchte Feuchtigkeit der Nacht! –, dann würde auch er, mit seinen geschlagenen dreiundfünfzig Jahren, trotz all dem Fleisch, das nun auf ihm lastet: Dann würde auch er sich freiwillig melden, um Faustino nicht allein gehen zu lassen, um nicht einmal am Tag vor Angst zu sterben bei jeder angekündigten Schlacht, im Wissen, dass Faustino im Feuer stünde. Sissignori! Auch er, Berecche, ginge sich freiwillig melden, trotz seines Bauchs, und Sissignori – selbst … selbst gegen die Deutschen!
Ach, da war es … da war es ja schon, auf einmal, das andere Leben! Der Krieg, mit dem blutjungen Sohn auf der einen Seite, auf der andern dem andern, neuen Sohn, zur Eroberung der unerlösten Gebiete. Wer weiß? Morgen vielleicht …
Berecche ist angekommen; er wendet sich nach rechts und biegt in die einsame Querstraße ein. Da leuchtet im dichten Dunkel das rote Lämpchen vor dem Muttergottesbild. Wunder des anderen Lebens. Berecche bleibt vor dem Lämpchen stehen; von niemandem gesehen, entblößt er den Kopf, um der Madonnina etwas zu sagen.
Sollen die Hunde hinter den Gitterzäunen nur wütend bellen!
III
Der Krieg auf der Karte
Berecche erinnert sich. Vor vierundvierzig Jahren war es. Französische Fähnchen und preußische Fähnchen – damals nur jene beiden – mit Stecknadeln auf die Landkarte geheftet, die über dem Tisch im Esszimmer ausgebreitet war. Kriegsschauplatz.12Was für ein schönes Spiel für ihn, den damals neunjährigen Jungen!
Er sieht es wieder wie im Traum, jenes gelb getünchte Esszimmer des Elternhauses, mit den Petroleumlampen aus Messing und den grünen Schutzschirmen; viele Kästen ringsum und darauf Decken aus einem Tuch mit Blütenmustern; ein bauchiger Krug da, eine Konsole dort und zwei Eckmöbel, das eine mit Körbchen aus farbigen Marmorfrüchten und Wachsblumen, das andere mit einem Ührchen aus Porzellan, das eine Windmühle darstellte – seine heiße Liebe, mit einem zerbrochenen Flügel.
Rund um jenen Tisch, der jetzt als einziges, altersschwaches, unter einem neuen Tischtuch verborgenes Überbleibsel im Schlafzimmer des Sohnes steht, sieht er seinen Vater und ein paar Freunde stehen und über den französisch-preußischen Krieg diskutieren. Bekleidet sind sie mit unschönen, bis zum Hals zugeknöpften Wämsern und breiten, röhrenförmigen Hosen. Gewichste Schnurrbärte und Spitzbärtchen im Stil Napoleons III. oder Rundbärte à la Cavour13. Über jene Landkarte gebeugt, zeichneten sie mit dem Finger den Weg der Heere nach, wobei sie den Angaben und Voraussagen der damals seltenen und verspäteten Zeitungen folgten, kommentierten ihn leidenschaftlich, und keiner ließ, auf dieser oder jener Spur, den Finger des andern in Ruhe. Ein zweiter Finger, und noch einer, und noch einer: Jeder wollte den seinen auf die Karte legen, und jeder dieser Finger, erinnert er sich, gewann in seinen kindlichen Augen plötzlich eine seltsame Persönlichkeit: Der eine, plump und energisch, verweilte eigensinnig auf einen Punkt; ein anderer tanzte nervös und dreist darum herum und wollte über den gleichen Punkt hinauskommen; und noch ein dritter war da, ein krummer kleiner Finger, der sich verstohlen zwischen die beiden drängte, um ihnen zu helfen, und die rückten weg, um ihm Platz zu machen. Und die Schreie, das Schnauben, die Ausrufe oder das schrille Gelächter über diese Finger hinweg, und alles eingehüllt in eine dichte Rauchwolke! Und von Zeit zu Zeit ein Name wie ein Kanonenschuss: «Mac-Mahon!»14
Berecche muss lächeln, wenn er an diese fernen Zeiten zurückdenkt; dann runzelt er die Stirn und sitzt nachdenklich da, die geballten Fäuste auf den geöffneten Knien. Er betrachtet die Landkarte, die er jetzt vor sich hat, mit den vielen bunten Fähnchen. Könnte da im Schreibzimmer vor ihm, dem Alten, jener neunjährige Bub aus der Erinnerung wiederaufleben, der damals Krieg spielte, wer weiß, welchen Spaß er jetzt mit dem neuen, viel größeren, abwechslungsreicheren, komplizierteren Spiel hätte – mit all diesen bunten Fähnchen! Hier Belgien, Frankreich, England gegen Deutschland; dort Deutschland gegen Russland in Ostpreußen, in Polen; drunten Serbien und Montenegro gegen Österreich; und weiter oben, in Galizien, noch einmal Russland gegen Österreich.
Einen Heidenspaß hätte der neunjährige Bub, jene deutschen Fähnchen zu den unterwürfigen Verbeugungen der belgischen durch Belgien eilen zu lassen, in ein paar Sprüngen in Paris zu sein, dort zum Zeichen des Sieges ein paar Fähnchen einzupflanzen, mit den andern kehrtzumachen und sich, wieder mit ein paar Sprüngen, auf Russland zu stürzen, zusammen mit den österreichischen!
Genau so, genau so wie er als neunjähriger Knabe im Spiel – ist es nicht unglaublich? – haben sich die Deutschen doch tatsächlich vorgestellt, handeln zu können – jetzt, nach vierundvierzig Jahren militärischer Vorbereitung! Allen Ernstes haben sie sich gedacht, das neutrale Belgien würde sie einfach so hereinlassen, ohne den geringsten Widerstand zu leisten, Lüttich und Namur preisgeben, damit das unvorbereitete Frankreich Zeit bekäme, seine Truppen zusammenzuziehen, und England, seine ersten Hilfstruppen an Land zu bringen: genau so!
Jeden Abend schreien die Freunde in der Bierstube herum und empören sich über die ruchlose Invasion und die grässlichen Gräueltaten; er, Berecche, hält sich still und abseits, obwohl es in seinem Innern kocht, denn er kann ihnen nicht, wie er gerne möchte, ins Gesicht brüllen: «Dummköpfe! Was soll das Geschrei? Das ist der Krieg!»
Er protestiert nicht und schluckt alles hinunter, denn er ist bestürzt. Bestürzt nicht über jene Invasion, sondern über die kolossale deutsche Bestialität. Bestürzt.
Von der Höhe seiner Liebe und Bewunderung für Deutschland, die mit den Jahren ins Grenzenlose gewachsen war, hat ihn diese kolossale deutsche Bestialität gleich einer Lawine hinabgerissen und alles zertrümmert: die Seele, die Welt, die er sich seit seinem neunten Lebensjahr allmählich aufgebaut hatte, auf deutsche Art, mit Methode und Disziplin in allem: in den Studien, im Leben, in den Gepflogenheiten des Geistes und des Körpers.
Oh, welch ein Absturz! Dieser kleine, neunjährige Bub war gewachsen und gewachsen; war in Liebe und Bewunderung entbrannt; war zu einem gedeihenden und erstarkenden Riesen geworden, der alles besser wusste als die andern, der alles besser machte als die andern und der sich jetzt, nachdem er sich vierundvierzig Jahre lang vorbereitet hatte, als großes, dummes Vieh offenbarte: baumstark, das ja, mit geübten und kräftigen Armen und Beinen, und der sich allen Ernstes vorstellte, noch wie ein wilder neunjähriger Lausbub Krieg spielen zu können oder dass es auf der Welt nur ihn gäbe und die andern gar nichts zählten: in ein paar Sprüngen Belgien zu durchqueren und drei, vier Fähnchen über Paris aufzupflanzen, und dann schnurstracks zurück, nach Sankt Petersburg und Moskau. Und England? «Unglaublich! Unglaublich!»
Vor lauter Fassungslosigkeit kommt Berecche mit dem Ausruf kaum noch hinterher, findet gar kein Ende mehr: «Unglaublich!»
Und mit den Händen kratzt er sich am Kopf und schnaubt, und von den Fähnchen fliegen ein paar weg, andere biegen sich und noch andere fallen um auf der Landkarte.
Dort in seinem Studierzimmer vergraben, wo niemand ihn sieht, fühlt Berecche, wie sich ihm das Herz in der Brust verkrampft, wenn er sich dessen erinnert, was er in der Zeit seiner Studien unter deutscher Methode verstand; wenn er an die unaussprechliche Befriedigung zurückdenkt, die er bei der abendlichen Rückkehr von den Bibliotheken empfand, die Augen müde nach der geduldigen Ausdeutung der Texte und Dokumente, aber mit dem ruhigen Gewissen, dass er alles beachtet hatte, dass nichts ihm entgangen war, dass er keine nützliche und notwendige Nachforschung unterlassen hatte, und wenn er dann am Schreibtisch saß und den Schatz seiner umfangreichen Zettelkästen betastete. Und umso mehr fühlt er sein Herz bluten, wenn er sich jetzt mit stummem Groll eingesteht, dass er, um der Befriedigung willen, die ihm jene Methode verschaffte, insgeheim zu feige war, den aufbegehrenden Stimme seiner Vernunft gegen einige deutsche Behauptungen zu gehorchen, die in seinem Innern nicht nur die Logik, sondern auch seine lateinischen Empfindungen beleidigten: die Behauptung zum Beispiel, den Römern habe die Gabe der Poesie gefehlt; und daneben die These, dass die ganze frühe Geschichte Roms Legende sei. Nun, entweder das eine oder das andere! Wenn jene Geschichte Legende, also erfunden war, wie konnte man dann die Gabe der Poesie leugnen? Entweder Poesie oder Geschichte. Unmöglich, das eine und das andere zu leugnen. Entweder große und wahre Geschichte; oder nicht weniger große und wahre Poesie. Und dabei erinnert er sich der Worte des alten Goethe, nachdem er die ersten beiden Bände der «Römischen Geschichte»von Niebuhr,15 bis zum Ersten Punischen Krieg, gelesen hatte: «Bisher glaubte die Welt an den Heldensinn einer Lucretia, eines Mucius Scävola, und ließ sich dadurch erwärmen und begeistern. Jetzt aber kommt die historische Kritik und sagt, dass jene Personen nie gelebt haben, sondern als Fictionen und Fabeln anzusehen sind, die der große Sinn der Römer erdichtete. Was sollen wir aber mit einer so ärmlichen Wahrheit? Und wenn die Römer groß genug waren, so etwas zu erdichten, so sollten wir wenigstens groß genug sein, daran zu glauben.»16
Goethe, Schiller, vor ihnen Lessing, und dann Kant und Hegel … Oh, als Deutschland klein war, als es noch gar nicht existierte, diese Riesen! Und nun, selbst zum Riesen geworden, hat es sich mit dem Bauch auf die Erde geworfen, die Arme vor der Brust verschränkt und einen Ellenbogen dahin, auf Belgien und Frankreich, gestützt, den andern dorthin, auf Russland und Polen: «So schiebt mich doch weg, wenn ihr dazu fähig seid!»
Wie lange wird das große Vieh sich in dieser Lage halten können?
«O großes Vieh, der Feinde sind viele, viele! Du dachtest, in ein paar Sprüngen alles zu erledigen! Du hast dich getäuscht! Nichts hast du gesehen; du hast nicht gleich gesiegt; da hast du dich so auf die Erde geworfen und die Ellbogen hier und dort eingerammt; wirst du lange Widerstand leisten können? Heute oder morgen werden sie dich wegstoßen, dir die Knochen brechen, dich in Stücke zerreißen!»
Berecche springt auf, mit hochrotem Kopf, keuchend, als hätte er selbst sich gemüht, das große Vieh fortzuschaffen.
IV
Der Krieg in der Familie
Was ist da drüben los?
Schreie, weinende Stimmen im Esszimmer. Berecche eilt herbei; er findet den Verlobten seiner Ältesten, Doktor Gino Viesi aus dem Valle di Non im Trentino, blass, mit Tränen in den Augen und einen Brief in der Hand.
«Neuigkeiten?»
«Die Brüder!», schreit Carlotta erregt und schaut ihn mit rot geweinten und dabei grimmigen Augen an.
Gino Viesi reicht ihm ohne einen Blick den Brief, den er in der zitternden Hand hält.
Zwei der drei Brüder, Filippo, fünfunddreißig Jahre und Vater von vier Kindern, und Erminio, sechsundzwanzig und seit wenigen Tagen verheiratet, sind in Österreich einberufen und nach Galizien geschickt worden … Nun, und? Niemand antwortet.
«Alle beide gefallen?»
Der junge Mann, von einem Weinkrampf geschüttelt, macht, bevor er wieder sein Gesicht verhüllt, ein Zeichen mit einem Finger. Einer.
«Bei einem ist’s gewiss», sagt seine Frau zu Berecche mit leiser, grollender Stimme, während Carlotta aufsteht, um den Verlobten zu stützen und mit ihm zu weinen.
«Erminio?»
Die Gattin, hart, untersetzt, mit zerzausten Haaren, schüttelt den Kopf: Nein!
«Also der andere? Der Vater von vier Kindern?»
Gino Viesi schluchzt lauter an der Schulter Carlottas.
«Und Erminio?»
Die Gattin antwortet gereizt: «Man weiß es nicht – vermisst!»
Augen, zu sehen, wie die andern weinen, wie sie dabei aussehen (vom Äußeren Ginos, des Verlobten der Schwester, den auch sie Gino nennt, hat sie überhaupt keine Vorstellung), Augen zu sehen hat Margherita, die kleine Blinde, nicht, Augen zum Weinen aber hat sie noch; und sie weint still vor sich hin, Tränen, die sie nicht sieht, die niemand sieht, und sitzt abseits in ihrem Eckchen.
«Und nicht einer schreit auf unseretwegen», stößt endlich Gino Viesi hervor, indem er den Kopf von Carlottas Schulter hebt und Berecche gegenübertritt. «Kein Einziger schreit auf um unsertwillen! Niemand tut etwas! Sie haben sie sämtlich auf die Schlachtbank geschickt, die aus Trient und Triest! Und ihr hier wisst alle, dass wir genauso fühlen wie ihr; und dass wir drüben auf euch warten, das wisst ihr! Aber niemand hier empfindet die schreckliche Qual, dass unsere Brüder aus dem gemeinsamen Empfinden herausgerissen und auf die Schlachtbank geschickt werden! Niemand, niemand … Wir wenigen, die wir hier aus Trient und Triest kommen, leben wie Fremde im eigenen Vaterland; und es ist fast ein Wunder, dass Sie als Loyalist mir nicht zurufen, mein Platz wäre dort, um mit meinen Brüdern für Österreich zu kämpfen und zu sterben!»
«Ich?», ruft Berecche verdutzt.
«Sie und alle …», fährt der junge Mann in schmerzlichem Ingrimm fort. «Ich habe es gesehen und gehört: Euch liegt nichts daran; ihr sagt, dass es nicht der Mühe lohnt, wenn Italien sich für Trient einsetze, das Österreich vielleicht eines Tages friedlich abtreten wird, um Triest behalten zu können, das nicht italienisch sein will … Ist es nicht das, was ihr sagt? Ihr sagt es und ihr fühlt es; deshalb habt ihr uns immer mit Füßen treten lassen; ihr seid niemals fähig gewesen, etwas für uns zu erreichen!»
Gino Viesi ist jung und voller Schmerz; deshalb kann er, so wie er dasteht, mit dem schönen, glühenden Gesicht und mit dem schönen, blonden und zerzausten Haarschopf, nicht begreifen, dass nichts so sehr irritiert, als wenn uns in gewissen Augenblicken mit lauter Stimme ein Gefühl vor Augen geführt wird, das insgeheim schon unser eigenes ist, das wir aber in unserm Innern verborgen halten, das wir noch mit gewissen Argumenten ersticken wollen, die sich uns bereits als falsch enthüllt haben; diese Argumente entzünden sich dann an dem Gefühl, das wir, obwohl es das unsere ist, noch der feindlichen Seite zuschreiben, und so sind wir gezwungen, das zu verteidigen, was wir im Grunde als falsch und ungerecht betrachten.
Das ist es, was jetzt Berecche zustößt. Irritiert schreit er dem Jungen zu: «Aber was willst du denn? Dass Italien Österreich daran hindert, die aus Trient und Triest in den Krieg gegen Russland und gegen Serbien zu schicken? Solange ihr unter seiner Herrschaft steht, ist es sein Recht!»
«Ach ja, ‹Recht› sagen Sie?», schreit seinerseits nun Gino Viesi. «Wenn dies das legitime Recht Österreichs ist, was tue dann ich hier, Ihrer Meinung nach? Ich entziehe mich meiner Pflicht, indem ich mich hier aufhalte? Wir müssen alle für Österreich sterben, ist es nicht so? Sagen Sie es nur, los, sagen Sie es. ‹Recht›, aber ja, das des Herrn, der seine Sklaven mit Peitschenhieben schickt, wohin es ihm beliebt! Wer hat je Österreich das Recht zuerkannt, Trient, Triest, Istrien und Dalmatien unter seinem Joch zu halten? Wenn Österreich doch selbst weiß, dass es dieses Recht nicht hat! Jedenfalls tut es alles, um uns zu unterdrücken, um auf unserem Boden jede Spur von Italianität auszulöschen! Ja, Österreich weiß es, ihr nicht, die ihr es gewähren lasst! Und jetzt, einem Krieg gegenüber, der sich von Anfang an als schädlich für uns, als gegen unsere Interessen gerichtet erwiesen hat, da wollt ihr neutral bleiben, nicht wahr? Ist das etwa der richtige Entscheid, statt dass ihr die Waffen für unsere Befreiung und die Verteidigung jener Interessen erhebt, und zwar dort, wo Österreich begonnen hat, sie zu bedrohen?»
«Aber die Neutralität …», versucht Berecche einzuwenden.
Gino Viesi lässt ihn nicht ausreden. «Ja, für euch ist das in bester Ordnung!», fährt er fort. «Denn niemand konnte hierherkommen und euch zwingen, gegen euer Gefühl und gegen eure Interessen zu marschieren und zu kämpfen! Aber habt ihr auch an uns drüben gedacht, die wir Teil eures Gefühls sein müssten, die wir gerade das sind, was ihr eure Interessen nennt. Ihr mit eurer Neutralität habt es zugelassen, dass sie uns ergriffen und zur Schlachtbank gezerrt haben; und obendrein sagt ihr, dass es Österreichs Recht war; und kein Aufschrei um des Bluts unserer Brüder willen! Stattdessen schreien alle: ‹Es lebe Belgien! Es lebe Frankreich!› Auf dem Weg hierher sind mir auf den Straßen Roms die Züge der Demonstranten begegnet. Ein Wahnsinn!»
«Und Faustino?», fragt auf einmal Berecche, zu seiner Frau gewandt.
«Auch er marschiert mit den Demonstranten!», antwortet Gino Viesi unverzüglich. Es lebe Belgien! Es lebe Frankreich!
«Und du lässt ihn einfach ausreißen und sagst mir gar nichts?» Berecche richtete drohend den Zeigefinger gegen die Gattin. «Was ist denn aus mir geworden hier? Ist das die Achtung, die man meinen Ideen, meinen Gefühlen schuldet? Ich sag es dir und allen andern! Ach ja, ‹es lebe Belgien, es lebe Frankreich!›.Sehen möchte ich Frankreich morgen, wenn es mit Hilfe der anderen gesiegt haben wird! Morgen wird er erneut über uns herfallen, der gallische Hahn, wenn er mit Hilfe der anderen seinen Kamm wieder siegreich erheben kann … Oh, ihr Dummköpfe, Dummköpfe, Dummköpfe!»
Nach diesem Wutausbruch eilt Berecche davon und schließt sich in seinem Studierzimmer ein, zitternd und aufgewühlt von der Gewalt, die er sich selbst hat antun müssen.
O mein Gott, was sind das für Sachen, was sind das für Sachen …
Alles ist zusammengebrochen in seinem Innern. Aber kann er zulassen, dass die andern es bemerken? Bis gestern ist Deutschland in seinem Hause sein Prestige, seine Autorität gewesen; alles ist Deutschland für ihn gewesen – bis gestern. Und jetzt das: Kaum kommt das Dienstmädchen am Morgen vom Einkauf zurück, fällt seine Frau über ihn her und fordert von ihm Rechenschaft über die Verteuerung aller Lebensmittel – so viel mehr das Brot, so viel mehr das Fleisch, so viel mehr die Eier –, als hätte er den Krieg gewollt und angezettelt! Mit wundem Herzen muss er, innerlich vernichtet, auch noch in all diesen Vulgaritäten der Gattin ertrinken, und es ist ein Wunder, dass sie ihn nicht auch für die Gefahr verantwortlich macht, der Faustino ausgesetzt ist: vorzeitig einberufen und ins Feld geschickt zu werden, wenn auch Italien in den Krieg hineingezogen wird! Repräsentiert er vielleicht nicht Deutschland in der Familie – Deutschland, das den Krieg gewollt hat?
Sissignori: Um seines Prestiges in der Familie willen muss er es auch weiterhin repräsentieren, sonst … Sonst was? So weit ist es gekommen: Der Sohn läuft von zu Hause fort und schreit, zusammen mit andern Dummköpfen, auf den Straßen der Stadt: «Es lebe Frankreich»;und der andre arme Junge dort, dem sie zwei Brüder umgebracht haben, beschuldigt ihn wegen der Neutralität Italiens und der Abschlachtung der Trentiner und Triestiner bei Lemberg!17
Ah, dreimal niederträchtiges Deutschland! Nicht einmal das hat es vorausgesehen, diese Tragödie im Herzen so vieler, die in Italien und in anderen Ländern unter harter Müh und bitteren Opfern, ihr Gähnen unterdrückend, so viel unverdauliches Zeug hinunterschluckend, Gelehrsamkeit, Musik, Philosophie, sich dazu erzogen hatten, es zu lieben und diese Liebe zu bekennen! Infames Deutschland, so vergilt es jetzt seinen Opfern die Liebe und Bewunderung, die sie ihm viele Jahre lang gezollt haben.
Berecche, unfähig, etwas anderes zu tun, würde es am liebsten mit heimlichen Nadelstichen malträtieren, dort auf der Landkarte mit all den französischen, englischen, belgischen, russischen, serbischen und montenegrinischen Fähnchen!
V
Der Krieg in der Welt
Es ist Abend geworden. Aber er bleibt in seinem Studierzimmer im Dunkeln und geht, die Hand vor dem Mund, hin und her, während er von Zeit zu Zeit einen Blick auf den letzten Schimmer der Dämmerung an den Scheiben der beiden Fenster wirft. Durch das eine nimmt er das rote Lämpchen wahr, das schon vor dem Muttergottesbild an der Villa gegenüber brennt; er runzelt die Stirn und nähert sich dem Fenster. Da sieht er im Schein der großen Lampe, die den Vorhof erhellt, wie seine Frau, an der Hand Margheritina, aus dem Haus geht und den Garten durchquert.
Sie geht, als sei nichts, die liebe Kleine. Wenn man’s nicht wüsste, würde man es nicht glauben, wenn man sie so von hinten sieht. Vielleicht, weil sie sich der Hand anvertraut, die sie führt. Nur wenn man sie aufmerksam beobachtet, sieht man, dass sie das Köpfchen ein wenig steif auf dem Hals hält, die schmalen Schultern ein wenig hochgezogen. Der Kies knirscht nicht unter ihren Füßchen, weil die Seele emporgeflogen ist, um nicht zu berühren, was sie nicht sieht, und der kleine Körper ist fast gewichtslos.
Aber wohin geht sie denn mit der Mamma zu dieser Stunde? Und Faustino, wieso ist er noch nicht wieder zu Hause? Ob Gino Viesi schon gegangen ist?
Berecche beschließt, mit all diesen Fragen zu Carlotta zu gehen. Im Esszimmer ist niemand mehr. Carlotta hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und weint immer noch, auch sie im Dunkeln; auf die Fragen des Vaters antwortet sie im schroffen und unfreundlichen Ton ihrer Mutter: «Gino? Gegangen. Faustino? Weiß ich nicht. Die Mamma? Mit Ghetina beim Monsignore, zur Novene.»
Seit drei Abenden spricht man in der Villa des Monsignore Gebete für den Papst, dem es nicht gut geht, für den Papst, der im Sterben liegt.18
Berecche geht in sein Studierzimmer zurück, tritt wieder ans Fenster und blickt auf die Villa gegenüber, betrübt und voll Mitgefühl für diesen Papst, einen frommen Greis ländlicher Herkunft, den nur die große Lauterkeit seines Glaubens des erhabenen Stuhls würdig macht. Oh, wer mehr als er, der mit Recht Pius heißt, wollte Christus ins Herz der Gläubigen zurückrufen? Und nun liegt er mitten im großen Krieg im Sterben, umgebracht vom Schmerz über den großen Krieg. Sicher wird er auf seinem Totenbett nicht sagen, wie es vielleicht der eine oder andere der um ihn Stehenden leise tut, dass dieser Krieg für Frankreich die gerechte Strafe wegen seiner Verfehlungen gegen die Kirche ist.19 Ruchlosere Sünder sind für ihn sicherlich diejenigen, die es gewagt haben, Gott anzurufen, er möge den Vormarsch und das Gemetzel ihrer Heere beschützen und in ihren grässlichen Siegen ein Zeichen göttlicher Protektion zu erblicken und zu preisen. Er hat nichts mehr gesagt; mit Grauen hat er seine Hand zurückgezogen, von der andere verlangt haben, dass sie diese ungeheuren Verbrechen segne; er hat sich in den Schmerz eingeschlossen, der ihn tötet.
Vermaledeites Licht der Vernunft! Vermaledeite Vernunft, die nicht blind zu werden weiß im Glauben! Er, Berecche, sieht oder glaubt bei diesem Licht viele Dinge zu sehen, die ihn daran hindern, zusammen mit seiner kleinen Margherita, die blind ist im blinden Glauben, für den guten Papst zu beten, der im Sterben liegt. Aber er ist zufrieden, dass seine kleine Margherita dort drüben betet; er ist zufrieden, dass ein Teil seiner selbst, den er so ängstlich liebt, der blind ist und der nichts weiß von seinem Licht der Vernunft, dort für den guten Papst, der stirbt, betet. Es scheint ihm in der Tat, als gäbe er jetzt, dank der blassen, zarten Hände seines blinden Töchterchens, die im Gebet gefaltet sind, etwas – alles, was er kann – von seiner Seele, die nicht mehr zu beten vermag, für das Seelenheil des guten Papstes dahin, der im Sterben liegt.
Inzwischen ist es acht Uhr abends geworden; dann neun, dann zehn, und Faustino ist noch immer nicht zu Hause!
Die Mutter, die schon lange mit Ghetina aus der Villa des Monsignore zurück ist, und die Schwester Carlotta sind mehrere Male ins Studierzimmer gekommen, um ihre Bestürzung zum Ausdruck zu bringen, um ihn mit gefalteten Händen zu beschwören, etwas zu tun, nach ihm zu suchen, um wenigstens zu erfahren, ob ihm, Gott bewahre, etwas zugestoßen ist bei dieser verwünschten Demonstration.
Wütend hat Berecche sie fortgejagt und ihnen zugerufen, er werde gar nichts unternehmen, denn an diesem Schlingel liege ihm nichts mehr, er betrachte ihn nicht mehr als seinen Sohn, und wenn sie ihn niedergetrampelt, verletzt, festgenommen hätten, könne er sich nur freuen, freuen, freuen.
Endlich, kurz nach halb elf, kommt Faustino nach Hause, mit einer Heidenangst vor dem Vater, aber noch glühend erregt von dem, was ihm zugestoßen ist. Festgenommen haben sie ihn. Empörung und Ekel lassen ihn immer noch erbeben ob der Wut der Soldaten – oh, zum Glück gibt es von dieser Sorte nur wenige! –, die ihn festgenommen und misshandelt und ihm zugeschrien haben: «Feigling, das tust du nur, weil du selbst nicht gehen willst, wenn wir morgen im Krieg sind!»
Und jetzt will er erst recht gehen, in den Krieg, in den Krieg, in den Krieg, um den Soldaten, die ihn festgenommen haben, eine würdige Antwort zu geben.
«Sei bloß still!», befiehlt die Mutter, zerzauster denn je. «Wenn dich drüben dein Vater hört!»
Aber Berecche rührt sich nicht aus seiner Studierstube. Er will ihn nicht sehen. Seiner Frau, die ihm seine Rückkehr meldet, befiehlt er, ihm auszurichten, er solle sich ja nicht blicken lassen. Bald darauf steckt Carlotta den Kopf zur Tür herein: «Das Abendessen ist angerichtet. Faustino ist auf seinem Zimmer.»
«Ich bleibe hier! Das Dienstmädchen soll mir das Essen bringen. Ich habe keine Lust, jemanden zu sehen!»
Aber er bringt nichts hinunter. Er hat einen Knoten im Hals, mehr aus Wut denn aus Angst. Doch allmählich beginnt er sich zu beruhigen, er fällt in eine lähmende, ihm wohlbekannte Lethargie. Es ist die philosophische Vernunft, die am Abend langsam von ihm Besitz ergreift.
Berecche steht auf, geht zum nächstgelegenen Fenster, setzt sich und beginnt die Sterne zu betrachten.
Er sieht sie in den unendlichen Weiten, wie vielleicht keiner jener Sterne sie zu sehen vermag, diese kleine Erde, die ohne ein bekanntes Ziel durch jene Räume wandert, von deren Ende man nichts weiß. Ein winziges Körnchen, ein Tröpfchen schwarzen Wassers, so zieht sie dahin, und der Wind, den sie in ihrem Lauf entfacht, in einem Streifen schwach schimmernden Lichts die erleuchteten Spuren menschlicher Wohnstätten auf jenem kleinen Teil, in dem das Körnchen nicht aus Wasser ist. Wenn man in den Weiten des Himmels wüsste, dass auf jenem schwach erhellten Streifen Millionen und Abermillionen unruhiger Wesen leben, die allen Ernstes glauben, von ihrem Körnchen aus dem ganzen Universum Befehle erteilen, ihm ihre Vernunft aufzwingen zu können, ihre Gefühle, ihren kleinen Gott, der ihren Krämerseelen entsprungen ist und den sie für den Schöpfer jener himmlischen Sphären und all jener Sterne halten: Und ja, da nehmen sie sich diesen Gott, der den Himmel und die Sterne geschaffen hat, und beten ihn an, kleiden ihn auf ihre Weise an und fordern Rechenschaft von ihm wegen ihrer kleinen Miseren und Schutz – selbst in ihren tristesten Geschäften, in ihren törichten Kriegen. Wenn man in den Himmeln wüsste, dass in ebendieser Stunde der Zeit, die kein Ende hat, diese Millionen und Abermillionen kaum wahrnehmbarer Wesen in diesem spärlich erleuchteten Streifen in eine wütende Rauferei verstrickt sind aus Gründen, denen sie die höchste Wichtigkeit für ihr Dasein beimessen und um derentwillen sie verlangen, dass sich die Himmel, die Sterne und Gott als Schöpfer dieser Himmel und aller dieser Sterne Minute für Minute mit ihnen beschäftigen sollen, allen Ernstes zugunsten der einen oder der anderen Partei. Meint da einer, dass es in den Himmeln keine Zeit gibt? Dass alles versinkt und hinschwindet in dieser schauerlichen Leere ohne Ende? Und dass auf diesem Körnchen morgen, in tausend Jahren nichts mehr sein wird oder dass man kaum noch sprechen wird von diesem Krieg, der uns jetzt so gewaltig und schrecklich dünkt?
Berecche erinnert sich daran, wie er noch vor wenigen Jahren seine Schüler im Gymnasium Geschichte lehrte: «Um 950 zog Otto, nachdem er die aufrührerischen Dänen zur Räson gebracht hatte, nach Böhmen, um den Herzog Bodeslav zu bekriegen, der seine Unabhängigkeit erklärt hatte, und bis vor Prag gekommen, zwang er jenen Herzog, wieder Vasall des Deutschen Reiches zu werden. In der Zwischenzeit zog sein Bruder Heinrich gegen die Ungarn zu Felde und trieb sie über die Theiß zurück, indem er ihnen das Land abnahm, das sie unter dem Königtum Ludwigs des Kindes erobert hatten …»20
Morgen, in tausend Jahren, wird ein anderer Geschichtsprofessor Berecche seinen Schülern sagen, dass um das Jahr 1914 noch zwei Reiche im Herzen Europas blühend und mächtig waren: eines namens Deutschland, über das ein Wilhelm II. herrschte, aus einer verschollenen Dynastie, die anscheinend den Namen Hohenzollern trug; und Österreich das andere, über das ein uralter Franz Joseph herrschte, aus der Dynastie der Habsburger. Diese beiden Kaiser waren miteinander verbündet und hatten vermutlich, will man bestimmten Informationen Glauben schenken, obwohl es jeder Logik widerspricht, ein Abkommen mit einem gewissen Vittorio Emanuele III