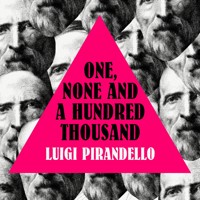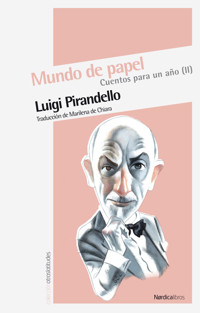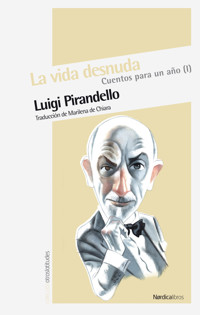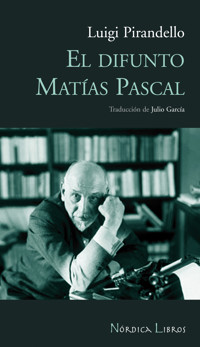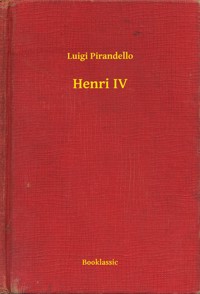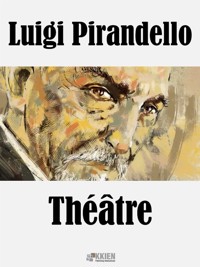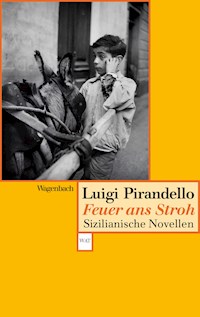
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schönsten Novellen über Pirandellos Heimat Sizilien und ihre Bewohner. Luigi Pirandello, bekannt durch "Sechs Personen suchen einen Autor", gehört mit Lampedusa und Sciascia zu den bedeutendsten Erzählern der sizilianischen Literatur. Dieser Band stellt nicht nur die schönsten Geschichten Pirandellos über seine Heimat und ihre Bewohner vor, sondern auch Geschichten, in denen das Leben die Rolle des Komikers spielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E-Book-Ausgabe 2021
© 1997, 2015 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie © Werner Bischof / Magnum Photos /Agentur Focus.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143211
Auch in gedruckter Form erhältlich: 9783803122827
www.wagenbach.de
Feuer ans Stroh
Da er niemanden mehr hatte, dem er einen Befehl erteilen konnte, hatte Simone Lampo seit einer Weile die Gewohnheit angenommen, sich selber Befehle zu erteilen: So befahl er sich, das Stöckchen in der Hand:
»Simone, daher! Simone, dorthin!«
Seinem Stand zum Trotz erlegte er sich die lästigen Pflichten auf. Bisweilen tat er so, als rebellierte er, um sich dann zum Gehorsam zu zwingen; er stellte also gleichzeitig zwei Gegenspieler auf dem Theater dar und erklärte etwa wütend:
»Nein, das tu ich nicht!«
»Simone, ich prügle dich windelweich. Ich hab’ dir gesagt, fahre den Mist ein! Nein? Päng …!« Damit versetzte er sich selber eine mächtige Ohrfeige und fuhr dann den Mist ein.
An dem Tag, an dem er das Grundstück besichtigte, das einzige, das ihm von allen seinen einstigen Ländereien verblieben war (knapp zwei Hektar Bodenfläche, und die vernachlässigt, da niemand sich darum gekümmert hatte), befahl er sich, die alte Eselin zu satteln, mit der er bei der Rückkehr in das Dorf die bemerkenswertesten Gespräche führte.
Die Eselin stellte bald das eine, bald das andere der abgeschabten Ohren auf und schien ihm geduldig zuzuhören, ungeachtet eines gewissen Ärgernisses, das ihr Herr seit einer Weile ihr zufügte und das sie nicht näher hätte beschreiben können: etwas, das im Gehen unter ihrem Schwanzansatz baumelte.
Es war ein henkelloses Weidekörbchen, das mit zwei Schnüren am Schwanzgurt des Sattels befestigt war und unter dem Schweif des armen Tieres hing, zu dem Zwecke, die Mistkugeln aufzunehmen und schön warm und rauchend aufzubewahren, die das Grautier sonst längs der Straße ausgesät hätte.
Alle Leute lachten beim Anblick dieser alten Eselin mit dem für den Bedarfsfall stets bereiten Körbchen. Jedermann im Ort wußte, wie großzügig Simone Lampo einstmals gelebt und wie gering er das Geld geachtet hatte. Jetzt aber war er bei den Ameisen in die Schule gegangen und hatte bei ihnen diesen Kunstgriff gelernt, um auch nicht das bißchen guten Dung zu verlieren, der dem Boden zugute kommen konnte. Ja, so weit war es mit ihm gekommen!
»Komm, Nina, komm, laß dir diese schöne Dekoration da anlegen! Was sind wir denn noch, Nina? Du nichts und ich niemand. Nur dazu gut, die Leute zum Lachen zu bringen. Aber kümmere dich nicht darum. Es bleiben uns daheim noch ein paar hundert kleine Vögel. Tschio-tschio-tschio-tschio … Sie möchten nicht gegessen werden, aber ich esse sie doch, und der ganze Ort lacht. Es lebe die gute Laune!«
Damit spielte er auf eine andere seiner schönen Erfindungen an, die wirklich würdig war, sich zu dem Körbchen unter dem Schwanz der Eselin zu gesellen.
Ein paar Monate zuvor hatte er so getan, als sei er überzeugt, mit Vogelzucht zu neuem Reichtum gelangen zu können, und er hatte die fünf Zimmer seines Hauses im Ort in einen einzigen Käfig verwandelt (weshalb das Haus auch alsbald den Spitznamen »Narrenkäfig« erhielt). Er selbst hatte sich mit den wenigen Habseligkeiten, die den Zusammenbruch seines Vermögens überlebt hatten, und unter Mitnahme sämtlicher Fenster, Fensterläden und Türflügel, in zwei Kämmerchen des Obergeschosses zurückgezogen, während er die Öffnungen der unteren Zimmer mit Drahtgittern versah, damit die Vögel Luft bekämen.
Von morgens bis abends drang, zur Freude der gesamten Nachbarschaft, aus den fünf Zimmern Gezirpe und Gepiepse, Gesang und Gezwitscher, Amselruf und Finkenschlag: ein dauerndes, ohrenbetäubendes Lärmen.
Seit ein paar Tagen aber hatte Simone Lampo die Hoffnung auf einen guten Erfolg dieses Unternehmens aufgegeben, aß jetzt Vögel zu jeder Mahlzeit und hatte draußen, auf dem Grundstück, den ganzen Apparat von Netzen und Stangen wiederum zerstört, mit dem er jene Vögel zu Hunderten eingefangen hatte.
Die Eselin war nunmehr gesattelt; Simone schwang sich auf ihren Rücken und brach nach dem Ort auf.
Nina hätte den Schritt auch dann nicht beschleunigt, wenn ihr Herr sie wütend mit der Peitsche bearbeitet hätte. Sie schien ihm zum Trotz so langsam dahinzutrotten, damit er um so besser seinen traurigen Gedanken nachhängen könne, zu denen, wie er behauptete, das dauernde Kopfnicken, das die Gangart des Tieres bei ihm bewirkte, nicht wenig beitrug. Ja, so war es. Indem er den Kopf hin und her pendeln ließ und dabei von der Höhe des Eselrückens über die trostlosen, mit dem Erlöschen der späten Dämmerung immer düsterer werdenden Felder hinschaute, konnte er gar nicht anders, als sein Unglück zu beklagen.
Ihn hatten die Schwefelgruben ruiniert.
Alle diese Berge, deren Inneres er um vermeintlicher Schätze willen herausgebrochen hatte! In jedem dieser Berge hatte er ein neues Kalifornien zu finden geglaubt. Ein Kalifornien nach dem anderen, da und dort, überall! Schächte bis in die Tiefe von zweihundert, dreihundert Metern, Ventilationsschächte, Dampfmaschinen, Aquädukte, um das Wasser abzuleiten, und eine Unmenge anderer Kosten; das alles um eines dünnen Schwefelflözes willen, dessen Abbau sich zuletzt überhaupt nicht lohnte. Mehrmals hintereinander hatte er diese traurige Erfahrung machen müssen; aber auch der Schwur, sich nie wieder in Unternehmungen dieser Art einzulassen, hatte ihn nicht von neuen Versuchen abhalten können, so lange, bis er an dem Punkte angelangt war, an dem er sich jetzt befand: sozusagen auf der Straße. Die Gattin hatte ihn verlassen, um mit ihrem reichen Bruder zusammenzuleben, und seine einzige Tochter war aus Verzweiflung ins Kloster gegangen.
So war er jetzt allein und hatte nicht einmal eine armselige Magd im Haus – allein und von unaufhörlicher innerer Wut verzehrt, die ihn veranlaßte, alle diese Narreteien zu verüben.
Ja, er wußte genau, daß es Narreteien waren, und er beging sie, um die Leute zu ärgern, die vor ihm gedienert hatten, solange er reich gewesen war, und die ihn jetzt nicht mehr kennen wollten und sich über ihn lustig machten. Alle, alle machten sie sich über ihn lustig und mieden ihn. Nicht einer, der bereit gewesen wäre, ihm zu helfen und zu sagen: »Gevatter, was tut Ihr? Kommt doch her: Ihr wißt zu arbeiten, habt immer ehrlich gearbeitet; begeht nicht länger Narreteien, beginnt mit mir zusammen eine gute Unternehmung!« Nicht einer.
Und in dieser Verlassenheit, in dieser ätzenden und nackten Einsamkeit wurde seine innere Unruhe immer verzehrender, immer verzweifelter.
Was ihn am ärgsten quälte, war die Unbestimmtheit seiner Lage. Jawohl, er war nicht mehr reich, aber er war auch kein Armer. An die Reichen konnte er sich nicht mehr anschließen; doch die Armen wollten ihn nicht als ihresgleichen gelten lassen, besaß er doch noch immer das Haus im Dorf und das Grundstück dort oben. Aber was brachte ihm das Haus ein? Nichts. Steuern brachte es ihm ein. Und was das Grundstück anging, sah die Sache so aus: ein bißchen Korn, als einziger Ertrag, das in einigen Tagen gemäht werden und ihm, wenn es gut ging, gerade genug einbringen würde, um die Abgabe an den Bischof zu bezahlen … Was blieb ihm also zum Essen übrig? Diese armen Vögelchen. Und wie schwer wurde ihm auch das! Solange es sich darum gehandelt hatte, sie zu fangen und einen Handel mit ihnen zu versuchen, der den Leuten Stoff zum Lachen bieten sollte, mochte das noch hingehen; doch jetzt, in den Käfig treten, die Tierchen einfangen, sie töten und essen …
»Vorwärts, Nina, vorwärts! Schläfst du heute abend? Vorwärts!«
Verflucht das Haus und verflucht das Grundstück, die ihn nicht einmal richtig arm sein ließen, arm und verrückt, hier, mitten auf der Straße, ein Armer ohne Gedanken, wie er deren so viele kannte und in seiner Verzweiflung angstvoll beneidete.
Plötzlich hielt Nina mit gespitzten Ohren den Schritt an.
»Wer ist da?« rief Simone Lampo.
Auf der Brüstung einer Straßenbrücke vermeinte er im Dunkel einen ausgestreckten Menschen zu erkennen.
»Wer ist da?«
Der Mann, der dort lag, hob kaum den Kopf und gab etwas wie ein Grunzen von sich.
»Ah, du bist’s, Nazzaro? Was treibst du da?«
»Ich warte auf die Sterne.«
»Ißt du sie?«
»Nein, ich zähle sie.«
»Und dann?«
Durch diese Fragen geärgert, richtete Nazzaro sich in sitzende Stellung auf und rief zornig aus seinem dichten, wirren Bart hervor:
»Don Simò, geht, belästigt mich nicht! Ihr wißt wohl, daß ich um diese Zeit keine Geschäfte mehr mache, und mit Euch zu sprechen habe ich keine Lust!«
Mit diesen Worten streckte er sich wieder mit dem Bauch nach oben der Länge nach auf der Brüstung aus und wartete auf die Sterne.
Sobald er vier Soldi verdient hatte, sei es mit dem Striegeln von ein paar Tieren, sei es mit irgendeiner anderen nebensächlichen Verrichtung, wurde Nazzaro sogleich zum Herrn der Welt. Für zwei Soldi Brot und für zwei Soldi Obst. Mehr brauchte er nicht. Und wenn ihm jemand vorschlug, über jene vier Soldi hinaus mit irgendwelcher anderer Tätigkeit eine Lira oder gar zehn zu verdienen, lehnte er ab und antwortete geringschätzig auf seine gewisse Art:
»Ich mache keine Geschäfte mehr!«
Er spazierte dann durch die Felder, längs der Meeresküste oder hoch oben in den Bergen. Überall konnte man ihn treffen, wo man ihn am wenigsten erwartet hätte, barfuß, schweigend, die Hände auf dem Rücken und ein Lachen in den hellen, schweifenden Augen.
»Wollt Ihr nun endlich gehen, ja oder nein?« rief er jetzt, richtete sich von neuem auf der Brüstung in sitzende Stellung auf und wurde immer erboster, als er sah, daß Lampo noch immer auf seiner Eselin dasaß und ihn betrachtete.
»Also nicht einmal du willst etwas von mir wissen?« sagte da Simone Lampo und schüttelte den Kopf. »Dabei, laß gut sein, könnten wir zwei trefflich ein Paar abgeben.«
»Mit dem Teufel gebt Ihr ein Paar ab!« knurrte Nazzaro und streckte sich wieder aus. »Ihr seid im Stande der Todsünde, das hab ich Euch schon gesagt!«
»Wegen dieser Vögel?«
»Die Seele, die Seele, das Herz … fühlt Ihr’s nicht brennen in Eurer Brust? Alle diese Geschöpfe Gottes, habt Ihr aufgefressen! Geht fort! Todsünde!«
»Hüh!« sagte Simone Lampo zu seiner Eselin.
Nach ein paar Schritten hielt er von neuem an, wandte sich um und rief:
»Nazzaro!«
Der Vagabund gab keine Antwort.
»Nazzaro«, sagte Simone Lampo nochmals, »willst du mit mir kommen und die Vögel freilassen?«
Mit einem Ruck fuhr Nazzaro auf.
»Ist das Euer Ernst?«
»Ja.«
»Wollt Ihr Eure Seele retten, dann genügt das nicht. Dann müßt Ihr auch das Stroh anzünden!«
»Was für ein Stroh?«
»Das ganze Stroh!« sagte Nazzaro und trat herzu, rasch und leicht wie ein Schatten.
Er legte eine Hand auf den Hals der Eselin, die andere auf Simone Lampos Bein, blickte ihm in die Augen, und fragte nochmals:
»Wollt Ihr wirklich Eure Seele retten?«
Simone Lampo lächelte und antwortete:
»Ja.«
»Wirklich und wahrhaftig? Schwört es mir! Wohlgemerkt, ich weiß, was Euch not tut. Ich denke des Nachts nach und weiß, was not täte, nicht nur für Euch, sondern auch für alle die Diebe, alle die Betrüger, die dort unten in unserem Ort leben; das, was Gott zu ihrer Rettung tun muß und früher oder später immer tut, dessen könnt Ihr gewiß sein! Ihr wollt also wirklich die Vögel in Freiheit setzen?«
»Aber ja, ich hab’s dir ja schon gesagt.«
»Und Feuer ans Stroh?«
»Und Feuer ans Stroh!«
»Gut. Ich nehme Euch beim Wort. Reitet voraus und wartet auf mich! Ich muß noch bis hundert zählen.«
Simone Lampo machte sich wieder auf den Weg, lächelte dabei und sagte zu Nazzaro:
»Abgemacht – ich erwarte dich.«
Unten, längs des Strandes, wurden jetzt die matten Lichter des Örtchens sichtbar. Von der Straße auf der mergeligen Hochebene, die über dem Orte aufstieg, tat sich dem Blick die geheimnisvolle Leere des Meeres auf und ließ das Lichtergrüppchen da unten noch jämmerlicher erscheinen.
Simone Lampo tat einen tiefen Seufzer und runzelte die Brauen. Jedesmal begrüßte er das Auftauchen jener Lichter in der Ferne auf diese Weise.
Für die Menschen, die dort unten bedrückt und zusammengedrängt hausten, gab es zwei Patentnarren: ihn und Nazzaro. Schön, von jetzt ab würden sich diese beiden zusammentun, um die Fröhlichkeit des Ortes noch zu erhöhen! Die Vögel in Freiheit und Feuer ans Stroh! Ihm gefiel dieser Ausdruck Nazzaros, und er sagte sich ihn mehrmals mit zunehmender Befriedigung vor, ehe er den Ort erreichte:
»Feuer ans Stroh!«
Die Vögel schliefen zu dieser Stunde alle in den fünf Zimmern des Erdgeschosses. Dies sollte hier ihre letzte Nacht sein. Morgen – fort! In die Freiheit! Ein großes Wettfliegen! Nach allen Windrichtungen würden sie auseinanderflattern, zurück auf die Felder, frei und glücklich. Ja, was er getan hatte, war wirklich eine Grausamkeit. Nazzaro hatte ganz recht. Todsünde! Lieber trockenes Brot essen.
Er band die Eselin in ihrem elenden Stall an und ging, das Öllämpchen in der Hand, hinauf, um Nazzaro zu erwarten, der, wie er ihm erklärt hatte, zuvor noch bis zu hundert Sterne zählen mußte. Der Narr! Wer weiß, wie er dazu kam? Vielleicht war das eine Art Gottesdienst …
Simone Lampo wartete und wartete und wurde dabei schläfrig. Hundert Sterne! Mehr als drei Stunden mußten seither vergangen sein. Zeit genug, das halbe Firmament zu zählen … Ach was! Vielleicht wollte Nazzaro ihn überhaupt nur zum besten halten, als er sagte, er würde kommen. Es war zwecklos, noch weiter auf ihn zu warten. Eben war Simone im Begriff, sich angezogen aufs Bett zu werfen, als er es heftig an der Tür zur Straße pochen hörte.
Und da war wirklich Nazzaro, höchst aufgeräumt und erregt.
»Bist du gelaufen?«
»Ja. Erledigt!«
»Was ist erledigt?«
»Alles. Wir reden morgen davon, Don Simò! Ich bin sterbensmüde.« Er warf sich in einen Stuhl und begann sich mit beiden Händen die Beine zu reiben, während in seinen Augen – den Augen eines Waldtieres – ein seltsames Lächeln funkelte, von dem auf den Lippen unter dem dichten Bart kaum eine Andeutung zu bemerken war.
»Was ist mit den Vögeln?« fragte er.
»Die sind unten. Sie schlafen.«
»Schön. Ihr seid nicht schläfrig?«
»Doch. Ich habe so lange auf dich gewartet …«
»Früher war’s mir nicht möglich. Legt Euch nieder! Ich bin auch schläfrig und schlafe hier, auf diesem Stuhl. Der ist ganz bequem, macht keine Umstände! Denkt daran, daß Ihr noch im Stande der Todsünde seid! Morgen wollen wir den Bußakt begehen.«
Auf einen Ellenbogen gestützt, betrachtete Simone Lampo ihn vergnügt von seinem Bett aus. Dieser närrische Vagabund gefiel ihm ausnehmend! Der Schlaf war ihm vergangen, und er hatte Lust, das Gespräch fortzusetzen.
»Sag einmal, Nazzaro, warum zählst du die Sterne?«
»Weil es mir Freude macht, sie zu zählen. Schlaft!«
»Warte! Sag mir: bist du zufrieden?«
»Womit?« fragte Nazzaro und hob den Kopf, den er bereits in die auf den Tisch gestützten Arme vergraben hatte.
»Mit allem«, sagte Simone Lampo. »Mit deinem Leben …«
»Zufrieden? Wir sind alle Sünder, Don Simò! Aber kümmert Euch nicht darum. Das wird vorübergehen! Schlafen wir!«
Und wieder vergrub er den Kopf zwischen den Armen.
Simone Lampo richtete sich auf, um die Kerze zu löschen; doch im letzten Augenblick stockte ihm der Atem. Der Gedanke, mit diesem Verrückten zusammen im Dunkeln zu bleiben, ängstigte ihn jetzt ein wenig.
»Sag mir, Nazzaro: möchtest du immer bei mir bleiben?«
»Man sagt nicht immer. Solange Ihr wollt. Warum nicht?«
»Und wirst du mich gern haben?«
»Warum nicht? Aber nicht Ihr als Herr und ich als Diener. Nein, zusammen. Ich bin schon seit einer Weile hinter Euch her, wißt Ihr? Ich weiß, Ihr redet mit der Eselin und mit Euch selber. Und da hab’ ich zu mir gesagt: die Beere reift … Aber ich wollte mich Euch nicht nähern, weil Ihr die Vögel in Eurem Hause gefangenhieltet. Jetzt, da Ihr gesagt habt, daß Ihr Eure Seele retten wollt, werde ich bei Euch bleiben, solange es Euch recht ist. Unterdessen habe ich Euch beim Wort genommen, der erste Schritt ist getan. Gute Nacht!«
»Und den Rosenkranz betest du nicht? Du sprichst doch so viel von Gott!«
»Ich hab’ ihn schon gebetet. Mein Rosenkranz ist der Himmel. Ein Ave-Maria für jeden Stern.«
»Ah, deshalb zählst du sie?«
»Deshalb. Gute Nacht!«
Durch diese Worte ermutigt, löschte Simone Lampo die Kerze. Und kurze Zeit danach schliefen sie beide.
Bei Morgengrauen weckten die ersten Rufe der gefangenen Vögel den Vagabunden, der sich zum Schlafen aus dem Stuhl auf den Fußboden hatte gleiten lassen. Simone Lampo, der an dieses Gezwitscher bereits gewöhnt war, schnarchte noch.
Nazzaro weckte ihn.
»Don Simò, die Vögel rufen uns.«
»Ach ja!« sagte Simone Lampo, war mit einem Schlage wach und riß beim Anblick Nazzaros die Augen weit auf.
Erst erinnerte er sich an nichts mehr. Dann führte er den Gefährten in das Kämmerchen nebenan. Dort hoben sie die Falltür auf und stiegen beide über die Holztreppe in das untere Stockwerk hinab, wo es nach den Exkrementen aller dieser eingeschlossenen Tierchen stank.
Erschreckt fingen die Vögel alle gleichzeitig zu lärmen an und flatterten in einem wilden Durcheinander schlagender Flügel zur Decke empor.
»So viele!« rief Nazzaro voll Mitleid, und in seinen Augen standen Tränen. »Arme Geschöpfe Gottes!«
»Es waren noch mehr!« rief Simone Lampo und wackelte mit dem Kopf.
»Den Galgen hättet Ihr verdient, Don Simò!« schrie ihn der Vagabund an und wies ihm die geballten Fäuste. »Ich weiß gar nicht, ob die Buße genügen wird, zu der ich euch veranlaßt habe! Vorwärts, los! Erst müssen wir sie alle in ein Zimmer bringen.«
»Das ist nicht nötig. Sieh her!« sagte Simone Lampo und ergriff ein Bündel Schnüre, durch die mittels eines komplizierten Systems die Gitter an den Fenstern und Türen festgehalten wurden.
Als er mit aller Kraft daran zerrte, fielen sämtliche Gitter mit höllischem Lärm gleichzeitig herab.
»Jagen wir sie hinaus! In die Freiheit! In die Freiheit! Husch! Husch! Husch!«
Die seit Monaten eingesperrten Vögel kamen anfangs in dem allgemeinen Durcheinander vor Schrecken gar nicht auf den Gedanken, fortzufliegen, mit bebenden Flügeln verharrten sie wie aufgehängt in der Luft. Bis dann die mutigsten unter ihnen, Pfeilen gleich, mit einem Ruf des Jubels und der Angst zugleich davonschossen; jetzt erst folgten die anderen in ganzen Schwärmen, in wirrem Durcheinander. Als wollten sie sich von dem Schrecken erholen, ließen sie sich zuerst auf den Dachsimsen, den Kaminen, den Fenstern, den Balkongittern der benachbarten Häuser nieder und erregten damit unten auf der Straße ein allgemeines Geschrei der Verwunderung. Der vor Rührung weinende Nazzaro und Simone Lampo beantworteten diesen Lärm, indem sie fortfuhren, in den nun schon fast leeren Zimmern zu schreien:
»Husch! Husch! In die Freiheit!«
Dann eilten auch sie an die Fenster, um zuzusehen, wie im frischen Licht des Morgens alle diese freigelassenen Vögel die Straße besetzt hielten. Doch schon tat sich da und dort ein Fenster auf. Lachend versuchte der oder jener Knabe, die oder jene Frau einen der Vögel zu fangen. Da reckte Nazzaro wütend die Arme in die Höhe und brüllte wie ein Besessener:
»Laßt das bleiben! Untersteht euch! Du Schuft! Du gottverlassene Diebin! Laßt sie in Frieden!«
Simone Lampo suchte ihn zu beruhigen:
»Ach was, sei unbesorgt, die lassen sich nicht ein zweites Mal fangen …«
Erleichtert und zufrieden stiegen sie wieder in die oberen Zimmer hinauf. Simone Lampo begab sich zu seinem Öfchen, um Feuer zu machen und Kaffee zu bereiten. Doch Nazzaro zerrte ihn heftig am Arm.
»Nichts da, Kaffee, Don Simò! Das Feuer brennt schon. Ich hab’ es angezündet, heute nacht. Los, laufen wir und sehen wir uns dort drüben das andere Fest an!«
»Das andere Fest?« fragte Simone Lampo erstaunt. »Was für ein Fest?«
»Eines hier, eines dort!« sagte Nazzaro. »Die Buße für all die Vögel, die ihr verspeist habt. Feuer ans Stroh, hab ich’s Euch nicht gesagt? Gehen wir die Eselin satteln, und Ihr werdet es selber sehen.«
Es war Simone Lampo, als loderte eine Flamme vor seinen Augen auf. Er fürchtete, richtig verstanden zu haben. So packte er Nazzaro bei den Armen, schüttelte ihn und schrie:
»Was hast du getan?«
»Ich hab’ das Korn auf Eurem Grundstück angezündet«, antwortete ihm Nazzaro seelenruhig.
Erst war Simone Lampo starr vor Schrecken; dann überkam ihn die helle Wut, und er stürzte sich auf den Verrückten.
»Du? Das Korn? Verbrecher! Ist das wahr? Du hast mein Korn angezündet?«
Nazzaro stieß ihn voll Zorn zurück.
»Don Simò, was spielen wir hier für ein Spiel? Steht Ihr zu Eurem Wort oder nicht? Feuer ans Stroh, habt Ihr mir gesagt. Und ich hab’ Feuer ans Stroh gelegt, zum Heil Eurer Seele!«
»Ins Gefängnis bring’ ich dich!« brüllte Simone Lampo.
Da fing Nazzaro schallend zu lachen an und sagte klar und deutlich:
»Verrückt seid Ihr! Die Seele, wie? So wollt Ihr Eure Seele retten? Nichts zu machen, Don Simò! So erreichen wir nichts.«
»Aber du hast mich zugrunde gerichtet, Verbrecher!« schrie Simone Lampo mit veränderter Stimme, beinahe weinend. »Habe ich denken können, daß du das meintest? Mein Korn anzünden! Und was mach ich jetzt? Wie bezahle ich die Abgabe an den Bischof? Die Abgabe, die auf dem Grundstück lastet?«
Nazzaro sah ihn mit einem Ausdruck verächtlichen Mitleids an:
»Kindskopf! Verkauft das Haus, das Euch zu nichts nütze ist, und befreit das Grundstück von der Abgabe. Das ist schnell getan.«
»Ja«, sagte Simone Lampo mit bitterem Lachen, »und was esse ich inzwischen, ohne Vögel und ohne Korn?«
»Dafür sorge ich«, antwortete ihm Nazzaro ernst und ruhig. »Soll ich nicht bei Euch bleiben? Wir haben die Eselin; wir haben das Grundstück; wir werden den Boden bestellen und wir werden essen. Kopf hoch, Don Simò!«
Simone Lampo war tief betroffen von dem Anblick der heiteren Zuversicht in den Zügen dieses Narren, der vor ihm stand, die Hand zu einer Geste überlegener Sorglosigkeit erhoben und mit einem schönen Lächeln listigen Leichtsinns in den hellen Augen und unter dem dichten, wirren Bart.
Der enge Frack
Gewöhnlich hatte Professor Gori ja viel Geduld mit seiner alten Haushälterin, die nun seit fast zwanzig Jahren bei ihm im Dienst war. An jenem Tag aber hieß es zum ersten Mal in seinem Leben den Frack anziehen, und da geriet er ganz außer sich.
Allein der Gedanke, daß eine Sache von so geringer Bedeutung einen Geist wie den seinen, dem alle Frivolitäten der mondänen Welt fernlagen und der sich einer strengen intellektuellen Disziplin unterwarf, völlig durcheinanderbringen konnte, allein das genügte schon, um ihn gereizt zu machen. Aber diese Gereiztheit wuchs noch mehr, wenn er sich vor Augen hielt, dieser Geist könnte sich dazu hergeben, ein solches Kleidungsstück anzuziehen, das eine dumme Sitte für gewisse zeremonielle Schauspiele vorschrieb, bei denen das Leben sich einbildet, es könnte sich selbst ein Fest oder eine Unterhaltung bieten.
Und das noch dazu, mein Gott, mit diesem riesigen Körper eines Nilpferds, eines vorsintflutlichen Fabeltiers …
Und er fauchte, der Professor, und blitzte seine Haushälterin mit zornigen Augen an, wenn sie sich, kleingewachsen und kugelrund, am Anblick ihres dicken Herrn in diesem ungewohnten Festgewand weidete, ohne zu bemerken, diese Unglückselige, welche Erniedrigung das für alle die alten, anständigen und einfachen Möbel und die armen Bücher in dem unaufgeräumten, fast dunklen Zimmer bedeuten mußte.
Dieser Frack, versteht sich, der gehörte nicht ihm, dem Professor Gori. Er hatte ihn sich nur geliehen. Der Laufbursche eines nahegelegenen Geschäftes hatte ihm einen Armvoll zur Auswahl hinaufgebracht; und nun betrachtete er ihn prüfend, mit den Allüren eines vollendeten arbiter elegantiarum, mit halbgeschlossenen Augen und einem kleinen Lächeln verständnisvoller Überlegenheit auf den Lippen, ließ den Professor sich hierhin und dorthin drehen – »Pardon! Pardon!« – und schloß dann endlich, den Kopf schüttelnd: »Paßt nicht.«
Der Professor fauchte noch einmal vor sich hin und wischte sich den Schweiß ab.
Acht hatte er schon probiert, nein, neun; nein, er wußte gar nicht mehr wie viele. Einer enger als der andere. Und dieser Kragen, in dem er sich wie am Galgen fühlte! Und diese steife Hemdbrust, die ihm, verdreht und schon ganz zerknittert, aus der Weste heraushing! Und diese gestärkte weiße Fliege, die da herabbaumelte und die er erst noch binden mußte, ohne daß er gewußt hätte, wie!
Endlich ließ sich der Laufbursche dazu herab zu sagen: »Na schön, dieser da geht. Was Besseres können wir nicht finden, glauben Sie mir, verehrter Herr!«
Professor Gori durchbohrte zunächst wieder seine Haushälterin mit einem wütenden Blick, damit sie nicht noch ein weiteres Mal sagen sollte: »Wie aus dem Bilderbuch sehen Sie aus! Wie aus dem Bilderbuch!« dann besah er sich den Frack, dem er ohne Zweifel diese zeremonielle Anrede »verehrter Herr« verdankte. Hierauf wandte er sich an den Laufburschen: »Andere haben Sie nicht mehr bei sich?«
»Ich habe ja ohnedies zwölf heraufgebracht, verehrter Herr!«
»Dann ist das also der Zwölfte?«
»Der Zwölfte, jawohl, zu dienen.«
»Dann muß er ja wunderbar passen!«
Er war noch enger als die anderen. Der junge Mann gab, ein wenig gekränkt, zu: »Ein bißchen eng ist er schon, aber das mag hingehen. Wenn Sie die Güte haben wollten, ein wenig in den Spiegel zu sehen …«
»Vielen Dank!« schrie der Professor auf. »Mir reicht schon das Spektakel, das ich Ihnen und meiner Frau Haushälterin gebe.«
Daraufhin machte jener würdevoll eine kaum merkliche Verbeugung und fort war er, mit den anderen elf Fräcken.
»Ist denn das noch zu glauben?« stieß der Professor mit einem wütenden Stöhnen hervor, wobei er versuchte, die Arme zu heben.
Dann trat er zur Kommode, um die dort liegende parfümierte Einladungskarte zu lesen, und fauchte dabei von neuem vor sich hin. Der Treffpunkt war um acht Uhr in der Wohnung der Braut in der Via Milano. Zwanzig Minuten Fußweg! Und es war schon Viertel nach sieben.
Unterdessen trat die alte Haushälterin wieder ein, die den Laufburschen bis zur Tür begleitet hatte. »Still!« gebot ihr der Professor sogleich. »Versuchen Sie mal, ob es Ihnen gelingt, mich mit dieser Fliege vollends zu erwürgen.«
»Sachte, sachte … Der steife Kragen …«, warnte ihn die alte Haushälterin. Und nachdem sie sich mit einem Taschentuch um die zittrigen Hände wohlvorbereitet hatte, ging sie ans Werk.
Fünf Minuten lang herrschte Stille. Für den Professor und das Zimmer rings umher schien die Zeit aufgehoben, als warteten sie auf das Jüngste Gericht.
»Fertig?«
»Hm …«, seufzte sie.
Professor Gori sprang in die Höhe und brüllte: »Lassen Sie das sein! Ich werde es selbst versuchen! Ich halte das nicht mehr aus!«
Aber kaum stand er vor dem Spiegel, da geriet er in einen solchen Zornausbruch, daß die arme Haushälterin erschrak. Zuerst einmal machte er sich selbst eine linkische Verbeugung; aber als er dabei sah, wie sich die beiden Schöße öffneten und gleich wieder schlossen, bäumte er sich auf wie eine Katze, der man etwas an den Schwanz gebunden hat; und als er sich aufbäumte, da ging es krach! – und der Frack platzte unter der einen Achsel auf.
Da wurde er fuchsteufelswild.
»Eine Naht ist geplatzt! Ist ja nur eine Naht geplatzt!« versuchte ihn die herbeilaufende alte Dienerin gleich zu beruhigen. »Wenn Sie ihn einen Augenblick ausziehen wollen, nähe ich es gleich wieder!«
»Aber wenn ich doch keine Zeit mehr habe!« brüllte der Professor, am Ende seiner Nervenkraft. »Ich werde eben so gehen zur Strafe! Jawohl, so … Das heißt dann eben, daß ich niemandem die Hand geben werde. Lassen Sie mich gehen!«
Wütend knotete er sich die Schleife um den Hals, versteckte die Schande dieses Kleidungsstücks unter dem Mantel, und fort ging’s.
Aber letzten Endes, zum Teufel, hätte er doch sehr froh sein müssen! An jenem Morgen wurde schließlich die Hochzeit einer früheren Schülerin gefeiert, die er sehr gerne hatte: Cesara Reis, die mit seiner Hilfe durch diese Hochzeit endlich den Lohn für die vielen Opfer erhielt, unter denen sie in den unendlichen Schuljahren studiert hatte.
Unterwegs begann Professor Gori über das seltsame Zusammentreffen nachzudenken, durch das diese Ehe zustandegekommen war. Jaja; aber wie hieß nur jetzt gleich der Bräutigam, dieser reiche Witwer, der eines Tages in der Lehrbildungsanstalt vorgesprochen hatte, weil er eine Hauslehrerin für seine Töchter suchte?
»Grimi? Griti? Nein, Mitri? Ah ja, richtig: Mitri, Mitri.«
So war es zu dieser Hochzeit gekommen. Die Reis, das arme Mädchen, das mit fünfzehn den Vater verloren hatte, hatte mit heldenhafter Anstrengung für den eigenen Unterhalt und für den der alten Mutter gesorgt, indem sie ein bißchen als Näherin arbeitete und ein bißchen Privatstunden gab, und daneben war es ihr gelungen, das Lehrerinnendiplom zu erwerben. Da er diese Beständigkeit, diese Seelenkraft bewunderte, hatte er sich bemüht, ihr in Rom in den zusätzlich eingerichteten neuen Schulen einen Posten zu verschaffen, und es war ihm gelungen. Als ihn nun dieser Herr Griti fragte …
»Griti, Griti, natürlich! Griti heißt er! Was sag ich da Mitri!« – als er ihn fragte, da hatte er ihm die Reis genannt. Ein paar Tage später kam er wieder, verstört und verlegen. Cesara Reis hatte den Posten als Hauslehrerin nicht annehmen wollen, angesichts ihres jugendlichen Alters und ihres unverheirateten Standes, der alten Mutter, die sie nicht allein lassen konnte, und vor allem der Lästerzungen der Leute. Und wer weiß, mit welchem Tonfall, mit welchem Ausdruck sie ihm das gesagt hatte, die Schelmin!
Ein hübsches Mädchen war sie schon, die Reis: und von jener Art Schönheit, die ihm am besten gefiel: eine Schönheit, der die Pein des Alltags (Gori war nicht von ungefähr Professor für muttersprachlichen Unterricht, er drückte sich wirklich so aus: »die Pein des Alltags«), eine Schönheit also, der die Pein des Alltags die Anmut eines leichten Schmerzes verliehen, die sie in unaufdringlicher, liebenswürdiger Weise geadelt hatte.
Natürlich hatte dieser Herr Grimi …
»Also wenn ich genau überlege, dann fürchte ich jetzt wirklich, der heißt Grimi!«
Natürlich hatte dieser Herr Grimi sich vom ersten Augenblick an unsterblich in sie verliebt. Sowas kommt scheinbar vor. Und drei- oder viermal war er, wenngleich ohne Hoffnung, auf sein Angebot zurückgekommen, aber vergeblich. Und am Ende hatte er ihn, den Professor Gori, gebeten, als Vermittler aufzutreten, damit das Fräulein Reis, das doch so schön, so bescheiden, so tugendhaft war, wenn schon nicht die Hauslehrerin, so doch die zweite Mutter seiner Tochter werden sollte. Und warum eigentlich nicht?
Er hatte mit Freuden den Vermittler gemacht, der Professor Gori, und Fräulein Reis hatte angenommen; und nun wurde die Hochzeit gefeiert, zum Ärger der Verwandten des Herrn … Grimi oder Griti oder Mitri, die sich verbissen gegen diese Verbindung gewehrt hatten:
»Ach hol euch doch der Teufel alle miteinander!«, schloß der dicke Professor, wieder einmal fauchend, seine Überlegung ab.
Unterdessen galt es einen Blumenstrauß für die Braut zu besorgen. Sie hatte ihn ja so sehr gebeten, er solle ihr Trauzeuge werden, aber der Professor hatte sie darauf hingewiesen, das er ihr als Trauzeuge ein Geschenk hätte machen müssen, das dem Wohlstand ihres Bräutigams angemessen gewesen wäre; und das konnte er sich beim besten Willen nicht erlauben. Das Opfer mit dem Frack mußte schon genügen. Aber ein Blumensträußchen, oja, das schon. Und Professor Gori betrat mit großem Zögern und überaus verlegen ein Blumengeschäft, wo man ihm ein großes Bündel Grünzeug mit ganz wenigen Blumen dazwischen zusammenband und zu einem stolzen Preis verkaufte.
Als er in der Via Milano angekommen war, sah er am Ende der Straße, vor dem Tor des Hauses, in dem die Reis wohnte, eine Traube von Neugierigen. Er nahm an, daß er spät dran sei; daß im Hof schon die Kutschen für den Hochzeitszug bereitstünden, und daß alle diese Leute hier beim Défilé dabeisein wollten. Er beschleunigte seinen Schritt. Aber warum sahen ihn all diese Neugierigen so seltsam an? Der Frack war doch unter dem Mantel versteckt. Oder vielleicht … die Schöße? Er blickte sich um. Nein, die waren nicht zu sehen. Was war es dann? Was war geschehen? Weshalb war das Tor halb geschlossen?
Der Pförtner fragte ihn mit bedrückter Miene: »Der Herr kommen zur Hochzeit?«
»Jawohl. Ich bin eingeladen.«
»Aber … wissen Sie, die Hochzeit ist abgesagt.«
»Was?«
»Ja, die arme Frau Reis … die Mutter …«
»Ist sie gestorben?« rief Gori entsetzt, auf das Tor starrend.
»Ja, heute nacht, ganz plötzlich.«
Der Professor stand da, wie vom Blitz getroffen: »Ist das denn die Möglichkeit? Die Mutter? Die Frau Reis?«
Und er warf einen Blick in die Runde, als wollte er in den Augen der Umstehenden die Bestätigung der unglaublichen Nachricht lesen. Der Blumenstrauß fiel ihm aus der Hand. Er bückte sich, um ihn aufzuheben, aber dabei fühlte er, wie die Fracknaht unter der Achsel noch weiter aufplatzte, und hielt mitten in der Bewegung inne. O Gott! Der Frack … natürlich! Der Frack für die Hochzeit, der nun so damit bestraft wurde, daß er unversehens vor dem Tod erscheinen mußte. Was sollte er tun? Hinaufgehen, in diesem Aufzug? Umdrehen und weggehen? – Er hob den Blumenstrauß auf, dann streckte er ihn verwirrt dem Pförtner entgegen.
»Tun Sie mir den Gefallen, bewahren Sie ihn für mich auf.«
Und damit ging er hinein. Er versuchte, immer zwei Stufen auf einmal zu nehmen, aber das gelang ihm nur auf dem ersten Treppenabsatz. Im letzten Stock – verfluchter Bauch! – ging ihm die Luft aus.
Als er in den kleinen Salon geführt wurde, bemerkte er an den dort Versammelten eine gewisse Peinlichkeit, eine sofort unterdrückte Unruhe, als wäre jemand bei seinem Eintritt davongelaufen, oder als wäre eine intime und überaus lebhafte Unterhaltung plötzlich abgebrochen worden.
Da er ja schon von sich aus verlegen war, blieb Professor Gori gleich bei der Türe stehen; er sah sich verwirrt um; er fühlte sich verloren, beinahe so, als wäre er von lauter Feinden umgeben. Das waren lauter große Herren, die da: Verwandte und Freunde des Bräutigams. Diese Alte da drüben war vielleicht seine Mutter, die anderen zwei da drüben, die aussahen wie alte Jungfern, vielleicht seine Schwestern oder Kusinen. Er machte eine ungelenke Verbeugung. (O Gott, da ging das schon wieder los mit dem Frack …) Und noch vornübergebeugt, als würde er von innen her zusammengezogen, warf er einen zweiten Blick ringsumher, als wollte er sich vergewissern, daß auch niemand das Platzen dieser verdammten Naht unter der Achsel gehört hatte. Keiner erwiderte seinen Gruß, fast so, als würden die Trauer und der ernste Augenblick nicht einmal ein leichtes Kopfnicken zulassen. Einige (vermutlich die engsten Freunde der Familie) standen bestürzt rund um einen Herrn, in dem Gori, wenn er genau hinsah, den Bräutigam wiederzuerkennen vermeinte. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und trat eilig hinzu.
»Herr Grimi …«
»Migri, bitte.«
»Ach ja, Migri … eine Stunde denke ich schon darüber nach, glauben Sie mir! Ich habe es schon mit Grimi, Mitri, Griti versucht … aber Migri, das wollte mir einfach nicht einfallen! Entschuldigen Sie … ich bin Professor Fabio Gori, Sie werden sich sicher an mich erinnern … obschon Sie mich nun etwas verändert sehen in diesem …«
»Ich freue mich, wenngleich …«, antwortete der Angesprochene und betrachtete ihn kühl und hochmütig; dann, als fiele es ihm plötzlich ein: »Ach ja, Gori … natürlich! Sie sind also dann … ja, sagen wir, sozusagen der Stifter … indirekt, wenn wir so wollen, der Stifter dieser Ehe! Mein Bruder hat mir von Ihnen erzählt …«
»Wie, wie? Entschuldigen Sie, Sie sind dann also der Bruder?«
»Carlo Migri, wenn Sie gestatten.«
»Danke, danke, natürlich gestatte ich. Was für eine Ähnlichkeit, Donnerwetter. Entschuldigen Sie schon, Herr Gri … ah ja, Migri, aber … dieser Blitz aus heiterem Himmel … Jaja! Natürlich, ich war leider … das heißt, leider nicht: ich habe da sozusagen gar keine Schuld daran … aber ja, natürlich, indirekt, zufällig, konnte man sagen, da habe ich schon mitgewirkt …«
Migri unterbrach ihn mit einer Handbewegung und stand auf.
»Gestatten Sie, daß ich Sie meiner Mutter vorstelle.«
»Aber mit dem größten Vergnügen, ich bitte Sie!«
Er wurde zu der alten Dame geführt, die mit ihrer enormen Beleibtheit das halbe Kanapee ausfüllte; sie war schwarz gekleidet, auf dem Kopf saß eine Art Häubchen, ebenfalls schwarz, in den wolligen Haaren, die das platte, gelbliche, beinahe pergamentartige Gesicht einrahmten.
»Mama, das ist Professor Gori, weißt du, der Andreas Ehe gestiftet hatte.«
Die alte Dame hob schläfrig ihre schweren Augenlider und zeigte, eines mehr, eines weniger geöffnet, ihre ovalen, trüben, fast blicklosen Augen.
»Also, um der Wahrheit die Ehre zu geben«, verbesserte der Professor, wobei er diesmal zitternd auf seine geplatzte Fracknaht achtete, »um der Wahrheit die Ehre zu geben, also … gestiftet, das wäre zuviel gesagt … Ich habe bloß …«
»Sie wollten meinen Enkeltöchtern eine Hauslehrerin verschaffen«, vollendete die alte Dame den Satz mit Grabesstimme. »Sehr gut! So wäre es ja auch tatsächlich richtig gewesen.«
»Ja, natürlich …«, stammelte Professor Gori. »Wenn man die Tugenden und die Bescheidenheit von Fräulein Reis kennt …«
»Oh, sie ist ein braves Mädchen, das bezweifelt niemand!« erkannte die alte Dame sogleich an, wobei sie die Lider senkte. »Und glauben Sie mir, wir bedauern es heute alle zutiefst …«
»Was für ein Unglück! Jawohl, so plötzlich!« rief Gori aus.
»Als ob hier doch wahrhaft der Wille Gottes wirkte«, ergänzte die alte Dame.
Gori sah sie an: »Ein grausames Schicksal …«
Dann blickte er im Salon herum und fragte: »Und Herr Andrea?«
Der Bruder antwortete ihm, Gleichgültigkeit heuchelnd: »Tja … ich weiß nicht, gerade eben war er noch hier. Er wird wohl kurz weggegangen sein, um sich bereit zu machen.«
»Ach so!« rief daraufhin Gori aus, der auf einmal Freude empfand. »Die Hochzeit findet also trotzdem statt?«
»Aber nein! Was für eine Idee!« fuhr die alte Dame dazwischen, überrascht und gekränkt. »Heiliger Gott im Himmel! Mit der Toten im Hause? Ooooh!«
»Ooooh!« echoten die beiden alten Jungfern kreischend und voll Entsetzen.
»Er macht sich bereit zum Wegfahren«, erklärte Migri. »Er hätte ja heute noch mit der Braut nach Turin abreisen sollen. Wir haben dort unsere Papierfabriken, in Valsangone, und da wird er dringend gebraucht.«
»Und … und er wird also … so einfach wegfahren?«
»Es muß sein. Wenn nicht heute, so morgen. Wir haben ihn dazu überredet, beinahe mit Gewalt, den Armen. Hierzubleiben – Sie werden verstehen – das wäre nun nicht mehr sehr klug und auch nicht mehr schicklich.«
»Wo doch das Mädchen … nun ja ganz allein ist …«, fügte die Mutter mit ihrer Grabesstimme hinzu. »Die Lästerzungen …«
»Jaja«, ergänzte der Bruder. »Und dann, die Geschäfte … der Heiratsplan war ja doch ein wenig …«
»Übereilt!« brach es aus einer der alten Jungfern heraus.-
»Sagen wir lieber, etwas improvisiert«, versuchte Migri abzuschwächen. »Und nun bricht dieses schwere Unheil schicksalshaft herein, wie … ja, wie um ein wenig Zeit zum Überlegen zu geben. Ein Aufschub wird notwendig … schon wegen der Trauerzeit … und … Und so kann man die Sache noch einmal überlegen, von allen Seiten betrachten.«
Herr Professor Gori blieb eine ganze Weile lang stumm. Die ärgerliche Verlegenheit, in die ihn diese übervorsichtige, mit Vorbehaltsformeln verbrämte Rede brachte, war im Grunde genau dieselbe, die ihm sein zu enger Frack und die geplatzte Naht unter der Achsel verursachten. In derselben Weise aufgeplatzt schien ihm auch die Logik dieser Rede, und man mußte sie mit derselben Vorsicht bezüglich der unsichtbaren, aufgeplatzten Naht aufnehmen, mit der sie ausgesprochen wurde. Wenn man sie nämlich ein bißchen auf die Probe stellte, wenn man sie nicht so brav unter allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zusammen- und in die Höhe hielt, dann war da die Gefahr, daß – genauso wie der Frackärmel drohte abzureißen – die Heuchelei all dieser Herrschaften aufplatzte und nackt sichtbar würde.
Einen Augenblick lang fühlte er das Bedürfnis, sich dieser Bedrückung und auch dem Ärger zu entziehen, den er in seiner Geistesabwesenheit angesichts des weißen Spitzenkragens empfand, der die schwarze Jacke der alten Dame zierte. Jedesmal, wenn er einen solchen weißen Spitzenkragen sah, kam ihm, wer weiß wieso, das Bild eines gewissen Pietro Cardella in den Sinn, eines Krämers aus seinem fernen Heimatort, der eine enorme Geschwulst im Nacken gehabt hatte. Am liebsten hätte er losgefaucht, aber er hielt sich rechtzeitig zurück und seufzte wie blöde: »Ach ja … das arme Mädchen!«
Ein Chor der Bedauernsformeln für die Braut antwortete ihm. Professor Gori empfand das plötzlich wie Peitschenhiebe und fragte, aufs höchste irritiert: »Wo ist sie? Kann ich sie sehen?«
Migri wies auf eine Tür des Salons: »Dort drinnen, bitte …«
Und Professor Gori ging wütend dort hinein.
Auf dem weißen, untadelig gebügelten Bett lag die Leiche der Mutter, auf dem Kopf eine riesige Haube mit gestärkter Krempe.
Zunächst sah er sonst gar nichts, der Professor Gori, als er das Zimmer betrat. Von dieser wachsenden Gereiztheit erfaßt, über die er sich in seiner Verblüffung und Verlegenheit gar nicht klar Rechenschaft ablegte, mit seinem Kopf, der schon beinahe zu rauchen begann, da erfaßte ihn keineswegs Rührung, sondern vielmehr Ärger über diesen Augenblick, wie über eine regelrechte Absurdität: ein dummer und grausamer Streich des Schicksals, den man nun wirklich um keinen Preis durchgehen lassen durfte!
All diese Steife der Toten erschien ihm wie ein Schauspiel, als hätte die arme Alte sich freiwillig ausgestreckt, dort auf diesem Bett, mit dieser riesigen gestärkten Haube, um das Fest, das für die Tochter vorbereitet war, durch Verrat für sich in Besitz zu nehmen, und beinahe überkam Professor Gori die Versuchung, ihr ins Gesicht zu schreien: »Los, aufstehen, meine liebe alte Dame! Das ist wirklich nicht der Moment für Scherze dieser Art!«