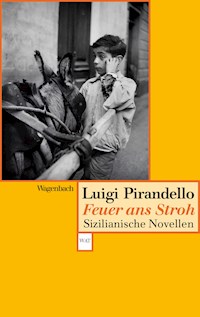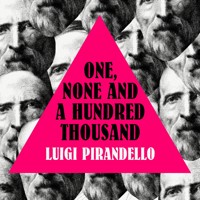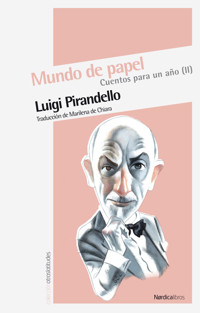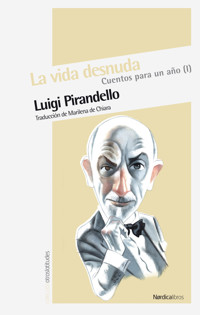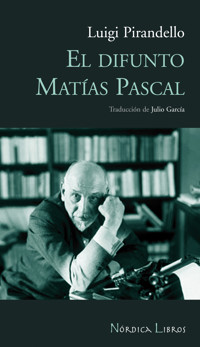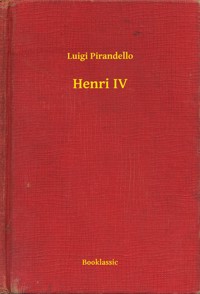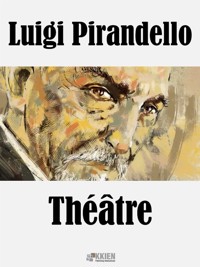Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luigi Pirandello, der Dramatiker und Erzähler, hatte die Angewohnheit, am Sonntagvormittag Sprechstunden für Personen abzuhalten, die aufgrund ihres besonderen Schicksals in seine Stücke oder Erzählungen aufgenommen werden wollten. Manche, die besonders aufsässig waren, schickte er wieder fort, aber den meisten lieh er sein Ohr, und so entstand nicht nur das weltberühmte Theaterstück Sechs Personen suchen einen Autor, sondern auch ein Großteil seiner Novellen. Mit dieser ironischen Selbstbeschreibung seiner Arbeit eröffnet der vorliegende Band, um dann in die ebenso karge wie intensive Lebenswelt Siziliens einzumünden. Große und kleine Tragödien von Witwen und Waisen, Frommen und Frömmlern – Grotesken, die das menschliche Maß übersteigen und doch mitten aus dem Leben gegriffen sind. All diese leidvollen und mit tiefer Empathie beschriebenen Verhältnisse – die alte Mutter, die ihren hilfsbereiten Sohn nicht sehen will, der Mann, der immer im Schlaf lacht, die junge Witwe und der alte Witwer, die sich in ihrer Hochzeitsnacht auf dem Friedhof einfinden – haben ein erschütterndes oder absurdes Geheimnis. Über allem waltet der klare südliche Himmel, in dem der junge Ciàula, der nur die Arbeit im Schwefelbergwerk kennt, eines Nachts zum ersten Mal den Mond entdeckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Pirandello Die erste Nacht
Sizilianische Novellen
Steidl Nocturnes
Aus dem Italienischen von Hanna Dehio, Hans Feist, Theodor Lücke, Joachim Meinert, Kurt Runge und Ludwig Wolde. Die Übersetzungen wurden für das vorliegende Buch überarbeitet.
Inhalt
Die Tragödie einer Person
Der andere Sohn
Unsere Erinnerungen
Wie ein Tag
Die Amme
Pflichten
Du lachst
Ciàula entdeckt den Mond
Die erste Nacht
Nachwort
Die Tragödie einer Person
Es ist eine alte, liebe Gewohnheit von mir, jeden Sonntagmorgen für die Personen meiner künftigen Novellen Sprechstunde abzuhalten.
Fünf Stunden lang, von acht bis eins. Und fast jedes Mal gerate ich dabei in schlechte Gesellschaft.
Ich weiß nicht, wie es kommt; aber gewöhnlich strömt das unzufriedenste Volk von der ganzen Welt zu diesen Audienzen zusammen; von ganz besonderen Leiden Heimgesuchte, in die schwierigsten Verhältnisse Verstrickte!
Ich höre sie alle geduldig an. Mit viel Takt versuche ich sie auszufragen, nehme Kenntnis von Namen und Lebensverhältnissen eines jeden Einzelnen und interessiere mich für ihre Gefühle und ihre Wünsche. Aber ich muss auch hinzufügen, dass es nicht immer eine leichte Aufgabe ist, mit ihnen zu verhandeln. Ich kann ja wohl eine ganze Menge vertragen, aber beschwindeln lasse ich mich nur ungern. Und so bedarf es oft einer langwierigen und gründlichen Untersuchung, um bis auf den Grund ihrer Seelen vorzudringen.
So kommt es manchmal, dass sich auf meine Fragen der eine oder andere ganz wütend aufführt, weil er meint, es mache mir Vergnügen, ihn seiner vermeintlichen Würde zu entkleiden. Dann versuche ich sie eben mit aller Geduld und allem guten Anstand davon zu überzeugen, dass mein Fragen keineswegs überflüssig ist. Ich mache ihnen klar, wie leicht es ist, den Willen eines Menschen nach der einen oder anderen Seite umzubiegen; und wie alles daran liegt, ob wir auch das sein können, was wir sein wollen. Wo das Können fehle, da erscheine das Wollen lächerlich und eitel.
Davon lassen sie sich aber meist nicht gern überzeugen. Dann bemitleide ich sie, denn im Grunde bin ich ein guter Mensch. Aber kann man nicht manches Missgeschick nur richtig bemitleiden, indem man herzlich darüber lacht?
Und so kommt es, dass die Personen meiner Novellen überall verbreiten, ich sei ein grausamer und hartherziger Schriftsteller. Es sollte wirklich mal ein wohlgesonnener Kritiker darauf hinweisen, wie viel Mitleid hinter diesem meinem Lachen steckt.
Wohlgesonnene Kritiker?! Wo gibt es die wohl heute noch?
Nun drängen sich in meiner Sprechstunde manchmal einzelne Personen mit solcher Dreistigkeit vor die anderen, dass ich mich gezwungen sehe, sie an die Luft zu setzen.
Nachher reut sie ihre Heftigkeit, und sie kommen wieder und schwören, sie hätten sich gebessert. Dann antworte ich ihnen mit dem freundlichsten Lächeln, nun müssten sie eben ihre Strafe haben und warten, bis ich wieder Zeit und Lust hätte, mich aufs Neue mit ihnen zu befassen.
Unter den Manierlicheren jedoch sind manche, die leise seufzend im Hintergrund warten, manche aber auch, die, des Wartens müde, an der Tür irgendeines anderen Schriftstellers anklopfen. Es ist mir nicht selten passiert, dass ich in den Novellen meiner Kollegen solchen Personen, die sich erst bei mir vorgestellt hatten, wiederbegegnet bin; so wie ich auch wiederum andere traf, die mit der Gestalt, die ich ihnen gegeben hatte, nicht zufrieden waren und dann anderswo besser abzuschneiden hofften.
Ich beklage mich nicht darüber, denn zwei oder drei »Neue« kommen doch fast jede Woche zu mir. Und oft ist der Andrang so groß, dass ich sogar mehreren gleichzeitig Audienz geben muss. Bis mein Verstand, so gleichsam nach verschiedenen Seiten hingezerrt, sich schließlich weigert und verzweifelt ruft: Entweder einer nach dem anderen, in aller Gemütsruhe, oder zum Teufel alle miteinander!
Ich muss immer daran denken, mit welcher Ergebung einmal ein armer, alter kleiner Mann, der von ferne her kam, darauf wartete, bis er an der Reihe war. Ein alter Kapellmeister namens Icilio Saporini, der im Jahre 1849 beim Sturz der römischen Republik nach Amerika hatte auswandern müssen, weil er irgendein patriotisches Lied komponiert hatte, und der nun nach fünfundvierzig Jahren nach Italien zurückkam, fast achtzig Jahre alt, um hier zu sterben. Ausgesucht höflich, mit seinem dünnen, schrillen Stimmchen, ließ er immer allen anderen den Vortritt. Und schließlich eines Tages – ich war noch in der Genesung von einer langwierigen Krankheit – trat er doch in mein Sprechzimmer, ganz unterwürfig, mit einem schüchtern-schmalen Lächeln auf den Lippen:
»Wenn ich darf … wenn ich auch wirklich nicht störe …«
»Aber ja doch, mein lieber alter Freund! Gerade zur rechten Stunde kommst du heute!«
Und rasch – rasch setzte ich mich an die Arbeit, und in der Erzählung »Von alten Klängen« schenkte ich ihm einen glücklichen Tod.
* * *
Diesen letzten Sonntag kam ich nun ein wenig später als gewöhnlich in mein Sprechzimmer.
Ein langer Roman, den man mir geschickt hatte und der seit mehr als einem Monat darauf wartete, gelesen zu werden, hatte mich bis drei Uhr morgens wach gehalten. Eine seiner Gestalten, die einzig lebendige unter lauter leeren Schatten, hatte mich so stark beschäftigt, dass ich nicht in den Schlaf fand.
Es war ein armer Mann, ein gewisser Doktor Fileno. Der glaubte gegen jede Art von Übel ein höchst wirksames Heilmittel erfunden zu haben, ein unfehlbares Rezept, sich und alle Menschen in allen öffentlichen und privaten Kalamitäten zu trösten.
Eigentlich war diese Erfindung mehr eine Methode als ein Heilmittel oder Rezept. Sie bestand darin, dass man von morgens bis abends Geschichtsbücher lesen soll, um auf die Gegenwart als Geschichte sehen zu lernen, das heißt so, als sei sie schon lange verflossen und ruhe in den Urkunden der Vergangenheit.
Mit dieser Methode hatte er sich von jeder Sorge und Last befreit und, ohne den Tod herbeizuwünschen, den Frieden gefunden. Einen schönen und heiteren Frieden, über den der Ausdruck klagloser Trauer gebreitet war wie etwa der, mit dem die Friedhöfe aus dem Gesicht der Erde zum Himmel noch aufschauen werden, auch wenn es keinen einzigen Menschen mehr geben wird.
Aber Doktor Fileno dachte nicht im entferntesten daran, aus der Vergangenheit etwa Lehren für die Gegenwart ableiten zu wollen. Er wusste ganz genau, dass das töricht gewesen wäre und verlorene Zeit. Denn er war sich klar darüber, dass das, was wir Geschichte nennen, nur etwas verstandesgemäß Zusammengefügtes ist, von den Geschichtsschreibern gemäß ihrer Natur, ihren subjektiven Ansichten und Wünschen, ihren Antipathien und Sympathien gesammelt und verfasst. Und dass es also nicht anginge, dieses mit dem Verstand Gefügte auf das lebendige Leben anzuwenden, das sich in all seinen Besonderheiten und Wirrnissen ständig wandelt. Und noch weniger ließ er es sich einfallen, aus der Gegenwart Regeln oder Prophezeiungen für die Zukunft abzuleiten. Nein, im Gegenteil: er versetzte sich im Geist in die Zukunft, um von dort aus die Gegenwart zu betrachten, und so sah er sie als Vergangenheit.
Ein Beispiel: Ihm war vor wenigen Tagen sein einziges Töchterchen gestorben. Ein Freund besuchte ihn, um ihm sein tiefstes Beileid auszusprechen. Und siehe da, er fand ihn so getröstet, als sei die Tochter schon mehr als hundert Jahre tot. Seine ganze frische Trauer hatte er ohne weiteres zeitlich von sich abgerückt, in die Vergangenheit gedrängt. Und man muss gesehen haben, mit welch ruhiger Würde und Gelassenheit er nun davon sprach.
Kurz und gut, Doktor Fileno hatte diese Methode für sich entwickelt und bediente sich ihrer etwa wie eines umgedrehten Fernrohrs. Er kehrte es nie in die rechte Richtung, um damit in die Zukunft zu blicken. Er wusste, er würde doch nichts von ihr erkennen können. So befriedigte er sein Gemüt damit, dass er von der größeren Linse aus durch die kleinere sah, die er auf die Gegenwart eingestellt hatte derart, dass ihm alle Dinge sogleich ganz klein und entfernt vorkamen. Und seit vielen Jahren trug er sich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben, das sicherlich Aufsehen erregt hätte: »Die Philosophie des Entfernten«.
Während der Lektüre des Romans wurde mir klar, dass der Autor, damit beschäftigt, einen der aller-alltäglichsten Konflikte zu schürzen, sich der besonderen Eigenart dieser einzigen Person gar nicht bewusst geworden war. Zwar war es ihr, der Person, die in sich das Zeug zu einem ganzen Kerl hatte, eine Zeitlang geglückt, den Dichter an der Hand zu nehmen und von den gewöhnlichen Plattheiten seiner Erzählung ein Stückchen Weges abzuführen. Plötzlich aber fiel sie ab und wurde schwach und ließ sich dann einfach ausnützen zu einer ganz verlogenen und törichten Lösung.
Lange Zeit hatte ich wach gelegen in der schweigenden Nacht, das Bild dieser Gestalt vor Augen, und hatte geträumt. Zu schade! Es war so viel Stoff in ihr, ein Meisterwerk daraus zu bilden! Wenn nur der Dichter sie nicht so schmählich missverstanden und vernachlässigt, wenn er sie nur in den Mittelpunkt der Erzählung gebracht hätte, so hätte sich vielleicht auch das, was an Künstlichem und Leblosem in ihr war, umgebildet und wäre lebendig geworden! Und mich überkamen Schmerz und großes Mitleid um dies so kümmerlich verfehlte Leben.
Als ich nun am nächsten Morgen spät in mein Sprechzimmer trat, fand ich dort ein ganz schreckliches Durcheinander, denn eben dieser Doktor Fileno hatte sich lebhaft zwischen meine wartenden Personen gedrängt, die, ihrerseits wiederum erzürnt über den nicht hierher gehörigen Gast, ihn ergreifen und hinauswerfen wollten.
»He holla!«, rief ich. »Was sind das für Manieren, meine Herrschaften? Doktor Fileno, ich habe schon zu viel Zeit an Sie verschwendet. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie gehören ja gar nicht zu mir. Lassen Sie mich jetzt ruhig mit meinen eignen Personen verhandeln und gehen Sie!«
Da malte sich eine so verzweifelte und herzbeklemmende Angst auf dem Gesicht des Doktor Fileno, dass all die anderen – meine Gestalten, die an ihm herumzerrten – einen tödlichen Schreck bekamen und ihn losließen.
»Jagen Sie mich nicht fort! Um Gottes Barmherzigkeit willen, jagen Sie mich nicht fort! Nur fünf Minuten geben Sie mir Audienz! Die Herrschaften werden es schon erlauben. Lassen Sie sich doch bitte, bitte überzeugen!«
Erschrocken und von Mitleid gerührt fragte ich ihn:
»Überzeugen? Wovon denn? Ich bin ja ganz und gar überzeugt davon, dass Sie, mein lieber Doktor, in bessere Hände zu fallen verdient hätten. Aber was soll ich dazu tun? Ich habe mir schon genug Gedanken über Ihr Schicksal gemacht; und jetzt Schluss damit!«
»Schluss damit? Nein, um Gottes willen, nein!«, rief Doktor Fileno aus, und ein Zittern der Empörung ging durch seinen ganzen Leib. »Sie sprechen nur so, weil ich nicht zu Ihnen gehöre. Aber glauben Sie mir, wenn Sie mich verachten – wenn Sie mich verwerfen würden, es wäre weniger grausam für mich als dieses tatenlose Mitleid, das außerdem, verzeihen Sie mir, eines echten Künstlers unwürdig ist. Niemand weiß besser als Sie, dass wir lebendige Wesen sind, viel lebendiger als die Menschen, die da atmen und in Kleidern umherspazieren. Vielleicht weniger wirklich, aber um so wahrer! Man kommt ja auf so verschiedene Art auf diese Welt! Und Sie wissen selbst genau, dass die Natur mit Hilfe der menschlichen Phantasie nur ihr eigenes Schöpfungswerk fortführen will. Wer aber durch diese Zeugungskraft, durch die Phantasie des Menschen, geboren wurde, der ist – auch das wissen Sie, mein Herr! – zu weit höherem Leben bestimmt als die aus dem Schoß einer sterblichen Frau Geborenen. Wer das Glück hat, als lebendige Person auf die Welt gekommen zu sein, der pfeift auch auf den Tod! Er stirbt nicht mehr! Der Mensch muss sterben, der Schriftsteller, der als ihr Schöpfer nur ihr Werkzeug ist; seine Geschöpfe sterben nicht mehr! Und um ewig zu leben, bedarf es auch gar nicht besonders wunderbarer Gaben. Sagen Sie mir doch: Wer war Sancho Panza? Wer war Don Abbondio? Sie leben ewig, denn sie hatten das Glück – lebendiger Samen, der sie waren –, eine fruchtbare Muttererde zu finden, die Phantasie eines Dichters, der ihnen Nahrung und Wachstum zu geben verstand.«
»Aber ja doch, mein lieber Doktor; das ist ja alles ganz schön und gut!«, erwiderte ich. »Doch ich verstehe noch nicht ganz, was Sie eigentlich von mir wollen!«
»So? Das verstehen Sie noch nicht ganz?«, brauste da Doktor Fileno zornig auf. »Dann bin ich vielleicht fehlgegangen? Dann bin ich vielleicht aus Versehen auf den Mond gefallen? Sie scheinen mir ja ein merkwürdiger Schriftsteller zu sein, verzeihen Sie mir! Können Sie in allem Ernst nicht verstehen, wie grauenhaft mein Schicksal ist? Das unbestrittene Privileg zu haben, als ›Person‹ auf der Welt zu sein, heutigen Tages – heutigen Tages, sage ich, wo das Leben so schwierig ist und ein jeder so schwer um seine Existenz kämpfen muss – also dies Privileg zu haben, als lebendige Person geboren und also zur Unsterblichkeit bestimmt zu sein, und dann, mein Herr, solch einem Menschen in die Hände zu fallen! Elend zugrunde gehen zu müssen, ersticken zu müssen in einer Welt von Künstelei, wo man nicht atmen, sich nicht bewegen kann, weil alles falsch ist, angemalt und künstlich zurechtgemacht! Worte und Papier – Papier und Worte! Ein Mensch, der sich in einer Lebenslage findet, die ihm nicht passt, kann sich aus ihr befreien und aus dem Staub machen. Eine arme Person kann das nicht. Sie ist angekettet, festgenagelt an ein Martyrium ohne Ende. Luft! Luft! Leben! Sehen Sie: Fileno – Fileno hat er mich genannt! Glauben Sie ernstlich, dass ich Fileno heißen kann? Solch ein Schafskopf! Nicht einmal einen richtigen Namen hat er mir geben können. Ich, Fileno! Und dann – ausgerechnet ich, der Verfasser der ›Philosophie des Entfernten‹, muss ein so unwürdiges Ende nehmen, muss mich dazu hergeben, ihm seinen albernen Konflikt auflösen zu helfen. Ich soll sie heiraten, nicht wahr? In zweiter Ehe! Diese Gans, diese Graziella, anstatt des Advokaten Negroni soll ich sie heiraten! Na, nun sagen Sie einmal selbst! Sind das nicht Verbrechen, die man mit blutigen Tränen abwaschen müsste? Aber statt dessen – was wird geschehen? Nichts. Stillschweigen. Vielleicht eine schlechte Kritik in zwei oder drei Käseblättchen. Der eine oder andere wird schreiben: ›Schade um diesen armen Doktor Fileno, das wäre einmal eine treffliche Gestalt gewesen!‹ Und damit wird es ausgestanden sein. Zum Tode verurteilt, ich, der Verfasser der ›Philosophie des Entfernten‹, die dieser Schafskopf mich nicht einmal auf meine eigenen Kosten hat drucken lassen können! Na ja, natürlich! Wie hätte ich auch sonst in zweiter Ehe diese Gans, die Graziella, geheiratet! Ach, ich mag gar nicht mehr daran denken. Vorwärts, vorwärts, ans Werk, verehrter Herr! Nehmen Sie sich meiner an, so schnell als möglich. Machen Sie mich lebendig, denn ich weiß, Sie haben all das Leben so gut verstanden, das in mir steckt.«
Bei diesem Vorschlag, den er zum Schluss seines langen Ergusses zornig herausstieß, blieb ich eine Zeitlang still und sah ihm erstaunt ins Gesicht.
»Haben Sie Bedenken? Fürchten Sie etwa, ein Plagiat zu begehen? Aber es ist doch gesetzlich erlaubt! Es ist sogar Ihr heiliges Recht, sich meiner anzunehmen und mir das Leben zu geben, das dieser Schafskopf mir nicht zu geben verstand. Es ist Ihr Recht und mein Recht, verstehen Sie?«
»Mag es Ihr Recht sein, mein lieber Doktor«, erwiderte ich, »und mag es auch gesetzlich erlaubt sein, wie Sie meinen. Aber ich tue dergleichen nicht. Sie brauchen gar nicht weiter in mich zu dringen. Ich tue das nicht. Wenden Sie sich nur an irgendjemand anderen.«
»Und an wen soll ich mich denn wenden, wenn Sie …?«
»Aber das weiß ich doch nicht! Versuchen Sie‘s doch einfach! Vielleicht gelingt es Ihnen, jemanden zu finden, der ganz davon überzeugt ist, dass das gesetzlich erlaubt ist. Wenn nicht, so hören Sie einmal auf mich, mein lieber Doktor Fileno. Sind Sie oder sind Sie nicht der Verfasser der ›Philosophie des Entfernten‹?«
»Ob ich es bin!«, rief er heftig, einen Schritt zurücktretend und die Hände vor der Brust kreuzend. »Daran wagen Sie zu zweifeln? Ah, ich verstehe, ich verstehe schon. Auch das ist die Schuld von dem, der mich so tot gemacht hat. Er hat ja kaum anzudeuten vermocht, kaum eine ganz, ganz entfernte Idee von dem gegeben, was meine Theorien sind. Er hat wohl auch keine Ahnung davon, wie viel Nutzen man aus meiner Entdeckung des umgekehrten Fernrohrs ziehen könnte!«
Hier hob ich die Hand, um ihn zu unterbrechen, und sagte lächelnd: »Sehr wohl! Aber Sie selbst – erlauben Sie einmal – haben Sie Nutzen daraus gezogen?«
»Ich selbst? Wieso ich selbst?«
»Sie beklagen sich über Ihren Dichter. Aber haben Sie denn selbst, mein lieber Doktor, aus Ihrer Theorie den richtigen Nutzen zu ziehen verstanden? Sehen Sie, das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wenn Sie wirklich, wie ich, an die Vorzüge Ihrer Philosophie glauben, warum wenden Sie sie nicht ein wenig auf Ihren eigenen Fall an? Sie suchen heute unter uns einen Schriftsteller, der Sie unsterblich machen soll? Aber nun denken Sie doch einmal an das, was man dereinst von uns armen kleinen Eintagsfederfuchsern sagen wird. Wir sind und wir sind nicht, mein lieber Doktor! Und halten Sie einmal die wichtigsten Dinge, die brennendsten Fragen, die bewundertsten Kunstwerke der Gegenwart unter Ihr berühmtes, umgekehrtes Fernrohr. Ich fürchte sehr, Sie werden dann überhaupt nichts und niemand mehr darin wiederfinden. Darum also: trösten Sie sich, oder vielmehr: bescheiden Sie sich! Und lassen Sie mich jetzt mit meinen armen Personen weiterverhandeln, die zwar unansehnlich und widerborstig sein mögen, aber doch wenigstens nicht von so ausschweifendem Ehrgeiz besessen wie Sie!«
Der andere Sohn
»Ist Ninfarosa da?« – »Sie ist da. Klopft nur!« – Die alte Maragrazia klopfte und ließ sich dann gemächlich auf die abgenutzte Stufe vor der Haustür nieder.
Es war ihr gewohnter Sitzplatz, dieser und so mancher andere vor den Türen der ärmlichen Häuser von Farnia. Sie saß da und schlief oder weinte still vor sich hin. Vorübergehende warfen ihr einen Soldo oder ein Stück Brot in den Schoß, aber sie unterbrach kaum ihren Schlaf oder ihr Weinen, küsste den Soldo oder das Brot, bekreuzigte sich und fing wieder an zu weinen oder zu schlafen.
Sie sah aus wie ein Haufen Lumpen, dicke, schmutzige Lumpen, immer die gleichen, Sommer und Winter, zerrissen und zerfetzt, ohne jede Farbe und durchsetzt mit stinkendem Schweiß und dem Schmutz der Straße. Das gelbliche Gesicht mit den infolge ständigen Weinens rotgeränderten und blutigen Lidern war ein dichtes Netz von Runzeln; aber zwischen Runzeln, Blut und Tränen leuchteten die hellen Augen immer noch wie die der zeitlosen Kindheit. Oft heftete sich jetzt eine gierige Fliege an diese Augen, aber die Alte ging so völlig auf in ihrem Schmerz, dass sie sie nicht bemerkte und also auch nicht verjagte. Das spärliche, dürre, über den Kopf verteilte Haar endete in zwei kümmerlichen, über den Ohren liegenden Knoten. Die Ohrläppchen waren durch das Gewicht massiger Anhängsel zerrissen, die sie in der Jugend getragen hatte. Vom Kinn bis unterhalb der Kehle wurde der schlaffe Hals durch eine schwarze Falte geteilt, die bis zum hohlen Brustkorb weiterlief.
Die Nachbarinnen, die auf der Schwelle saßen, achteten ihrer nicht mehr. Sie hielten sich fast den ganzen Tag über dort auf; die eine flickte Zeug, die zweite las irgendein Gemüse, die dritte stopfte Strümpfe, kurz, jede war mit irgendeiner Arbeit beschäftigt. Sie schwatzten vor ihren niedrigen ärmlichen Häusern, die durch die Tür Licht erhielten, die oft Haus und Stall in eins waren und denselben Kiesboden hatten wie die Straße. Auf der einen Seite stand die Krippe, an der ein Esel oder ein Maultier stampfte, von Fliegen geplagt; auf der anderen das mächtige, breite Ehebett. Dann war da eine lange, schwarze Truhe aus Tannen- oder Buchenholz, die wie ein Sarg aussah, zwei oder drei Strohstühle, der Backtrog und ländliche Geräte. An den rohen rissigen Wänden hingen als einziger Schmuck schlechte Drucke zum Preis von einem Soldo, die die Heiligen des Ortes darstellen sollten. Auf der durch Rauch und Dünger beschmutzten Straße tummelten sich sonnenverbrannte Jungen, einige nackt wie bei der Geburt, andere nur mit einem schmierigen zerlumpten Hemd bekleidet. Hühner scharrten, und die rosigen Ferkel grunzten, während sie mit dem Rüssel im Abfall schnüffelten.
An diesem Tag war von einem neuen Trupp Auswanderer die Rede, der am nächsten Morgen nach Amerika abreisen sollte.
»Saro Scoma geht fort«, sagte eine. »Er lässt die Frau und die kleinen Kinder zurück.«
»Vito Scardia«, fügte eine andere hinzu, »lässt fünf zurück und die Frau in schwangerem Zustand.«
»Ist es wahr«, fragte eine dritte, »dass Càrmine Ronca seinen zwölfjährigen Sohn mitnimmt, der schon in die Schwefelgrube ging? O Heilige Maria, wenigstens den Jungen hätte er der Frau lassen können. Wie wird die arme Seele sich jetzt durchhelfen?«
»Was für ein schreckliches Jammern«, rief mit weinerlicher Stimme eine vierte, die etwas abseits saß, »hört man die ganze Nacht im Haus von Nunzia Ligreci! Ihr Sohn Nico, der gerade vom Militärdienst zurückgekommen ist, will auch fort.«
Als die alte Maragrazia diese Nachrichten vernahm, stopfte sie ihren Mund mit dem Tuch, um nicht in lautes Schluchzen auszubrechen. Aber die Gewalt des Schmerzes bahnte sich einen Weg in die blutunterlaufenen Augen, und es kamen Tränen ohne Ende.
Vor vierzehn Jahren waren auch von ihr zwei Söhne nach Amerika gegangen. Sie hatten ihr versprochen, nach vier oder fünf Jahren wiederzukommen, aber sie hatten dort ihr Glück gemacht, besonders einer, der Ältere, und die alte Mutter vergessen. Jedesmal nun, wenn ein neuer Trupp Auswanderer von Farnia abging, begab sie sich zu Ninfarosa, damit sie ihr einen Brief schriebe, den einer der Reisenden aus Mitleid dem einen oder anderen ihrer Söhne aushändigen sollte. Darauf folgte sie dem Zug, der sich, mit Säcken und Bündeln schwer beladen, zum Bahnhof der nächsten Stadt bewegte, zwischen verzweifelt weinenden und schreienden Müttern, Frauen und Schwestern ein gutes Stück auf der staubigen Straße und heftete unterwegs den Blick starr auf den oder jenen jungen Auswanderer, der eine lärmende Fröhlichkeit heuchelte, um seiner Erregung Herr zu werden und die Verwandten, die ihm das Geleit gaben, abzulenken.
»Alte Närrin«, rief ihr wohl einer zu. »Warum seht Ihr mich so an? Wollt mir wohl die Augen auskratzen?«
»Nein, mein Schöner, ich beneide dich vielmehr«, erwiderte ihm die Alte, »denn du wirst meine Söhne sehen. Erzähl ihnen, wie du mich zurückgelassen hast, und dass sie mich nicht mehr finden werden, wenn sie sich noch lange verzögern.«