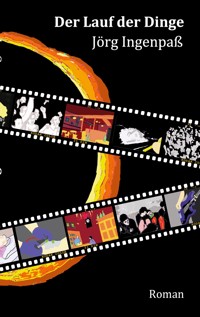Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anleitung zum Glück erzählt vom Glück und Unglück zweier junger Arbeiterfamilien im krisengeschüttelten Ruhrgebiet der 60er bis 80er Jahre. Fünf Protagonisten suchen nach einem Leben, das ihren Ansprüchen entspricht. Dabei erleiden sie Niederlagen und stoßen auf unüberwindbare Hindernisse, erfahren aber auch Momente von Harmonie und Zufriedenheit. Atmosphärisch zwischen dem Niedergang der Stahlindustrie und des damit verbundenen Wertemilieus, den aufreizenden, neuen Botschaften der Popmusik und den Aufbrüchen der 70er Jahre Politbewegung angesiedelt, versuchen sich Peter, Heike, Werner, Marion und Rainer zu orientieren. Gibt es einen Weg für sie, der aus Kohlenstaub, Stahl und einem industriegeprägten Alltagsleben hinausführt? Peter und Marion könnten kaum unterschiedlicher sein. Peter, der sich kraftvoll und rücksichtslos für seine persönliche Freiheit einsetzt - Marion, die träumend und grübelnd ihren Sehnsüchten nachhängt. Die Partner der beiden, Peters Frau Heike und Werner, der Mann von Marion, sind diesen Dynamiken zunächst hilflos ausgeliefert. Doch als Peter seine Frau und seinen Sohn verlässt, werden die Karten neu gemischt ... Am Ende finden sich alle vier in überraschenden Lebenssituationen wieder. Marion landet in einer psychiatrischen Anstalt, Peter wegen Drogenhandels im Gefängnis, Heike und Werner versuchen es gemeinsam mit einer Kneipe. Und Rainer, der Sohn von Marion und Werner, unternimmt einen verzweifelten Ausbruch nach Amsterdam, der ihn unbarmherzig mit den Schattenseiten des Daseins konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Vadda, Mudda und den Pott
Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues.
Samuel Beckett
Inhaltsverzeichnis
Spätherbst '65
Am selben Tag
Einige Tage später
Anfang '66
Ende Winter '66
Frühjahr '66
Frühjahr '67
Mitte '67
Am selben Tag
Silvester '67
Februar '68
Olympia '68
Spät im Frühjahr '69
Hochsommer '69
Mitte '70
Weihnachten '70
Mai '71
Herbst '71
Sommer '72
Kurz drauf
Winter '72/'73
Sommer '73
Frühjahr '74
In der Nacht
Frühjahr '75
Ostern '75
Dieselbe Woche
Frühjahr '76
Montags drauf
Herbst '76
'77
Herbst '77
'78
Spätsommer '78
Frühjahr '80
Irgendwann '80
Um Ostern '81
Um Pfingsten '81
Herbst '81
Irgendwann '82
Sommer '82
Herbst '82
Heikes Geburtstag '83
Mitte '83
Am darauffolgenden Morgen
Spätherbst '65
Der alte, beigefarbene Wecker, dessen Lack schon an einigen Stellen abgestoßen war, so daß er das darunterliegende, dunkle Metall preisgab, klingelte. Seine phosphoreszierenden Zeiger deuteten auf dem milchig weißen Zifferblatt auf fünf Uhr. Marions Hand glitt aus dem warmen Dunkel der Bettdecke hervor und tastete fahrig nach dem Schalter. Der erste Griff ging ins Leere, der zweite war ein Treffer. Der alte Wecker verstummte abrupt. Sie wälzte sich auf die andere Seite.
„Werner, wachwern.“
Der hörte nichts. Oder reagierte einfach nicht.
„Werner. Los jetz, et is fünf.“
Werner schnarchte. Sie griff an seine Schulter und rüttelte unnachgiebig an ihr, bis er schließlich murrend erwachte. Jeden Tag dasselbe leidige Theater mit ihm. Es ging auf das Ende des Herbstes zu, Kälte kroch durch die Ritzen der Holzrahmen in alle Zimmer der kleinen Dachgeschosswohnung. Sie setzte sich vorsichtig auf, rückte sich das Kissen im Rücken zurecht.
„Herrje, Werner, jetzt werd aber ma wach.“
Ihr Blick wanderte durch den Raum, sie sah in ihren Gedanken bereits den Kleiderschrank weiter links stehen, denn dort rechts am gegenüberliegenden Fenster, da würde bald die Wiege ihren Platz haben. Und da, wo der Herrendiener, auf dem Werner, wenn er von der Arbeit kam, Hose und Hemd aufhing, stand, sollten Strampler, Windeln und Babytücher in ein neues Regal. Das müsste Werner noch anbringen, aber sie hatten es bereits abgesprochen. Wäre ihr Bauch nicht so rasant dick geworden, hätte sie schon längst mit dem Umbau angefangen, aber seit einiger Zeit ging es ihr körperlich gar nicht mehr gut. Ihr Rücken schmerzte neuerdings und sie fand kaum in einen erholsamen Schlaf. Wachte sie nachts auf, so musste sie aufstehen und ein wenig auf- und abgehen, sonst hätte sie nicht mehr weiterschlafen können. Schmerzmittel wollte sie ebensowenig nehmen, wie Alkohol trinken. Sie hatte sogar mit dem Rauchen aufgehört, weil ihr Hausarzt, Doktor Grünberg, für die Zeit der Schwangerschaft davon abgeraten hatte. Sie rieb sich ihre müden Augen und setzte sich langsam auf, um sich aus dem Bett zu hieven. Einen Moment verweilte sie ohne jeden Gedanken am Bettrand. Aber vielleicht waren es auch einfach ganz viele Gedanken, so daß es wie ein Rauschen war, in dem sie nichts erkennen konnte. Zwei Schritte bis zum Fenster. Sie drückte zwei Lamellen der Jalousie mit den Fingern leicht auseinander, die Herbstsonne konnte man noch nicht hinter den regenfeuchten Dächern und den russgeschwärzten Schornsteinen, die ihren Rauch in den Morgenhimmel stiessen, erahnen. Während Werner sich aus dem Bett wälzte und durch das angrenzende Wohnzimmer und den darauffolgenden Flur schlaftrunken ins Bad stolperte, schlich sie in die Küche, um frischen Kaffee aufzusetzen und Werners Arbeitstasche, die sie im Flur an sich genommen hatte, zu packen. Sie reckte sich, fuhr mit den Fingern durch ihr langes Haar, das zersaust in alle Richtungen hing, nahm den Kessel von der Herdplatte, ließ Wasser ein, schaltete den Gasherd an und blieb vor ihm stehen. Wie jeden Morgen, wenn Werner zur Arbeit musste, griff sie zum Brotkasten und holte den Laib Steinofenbrot heraus. Die Kurbel der Brotschneidemaschine quietschte, als Marion zwei dicke Scheiben abschnitt und eine dünne für sich. Werner müßte nachschauen, ob er das nicht säubern und ölen könnte. Aber nie stand ihm der Sinn nach solchen Arbeiten. Kam er erstmal von der Arbeit im Stahlwerk nach Hause, so war er zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie legte die Schnitten auf einen Kuchenteller. Sie öffnete den Kühlschrank, bückte sich schnaufend, um die Wurst aus dem unteren Fach zu holen, ihr Rücken tat wieder weh. Sie biß sich auf die Lippen. Bestimmt würde das in den letzten zweieinhalb Monaten noch schlimmer werden. Hätte sie das alles vorher gewußt, aber: ach nein, sie hatten das Kind haben wollen. Sollte es ein Mädchen werden würde es Petra heißen, da waren sie sich einig, aber bei einem Jungen? Werner meinte Hartmut sei ein schöner Name. Sie fragte sich, wie er sowas ernst meinen konnte, heutzutage, wo alle Söhne Ralf oder Uwe hießen. Sie musste ihn unbedingt überzeugen, daß er Rainer heißen sollte, Rainer fand sie schön. Hartmut, nein, das ging gar nicht. Allenfalls vielleicht Ralf, also wenn er mit Rainer partout nicht warm werden mochte.
Werners elektrischer Rasierer hörte auf zu brummen und er schlug ihn auf der Emaille des Waschbeckens aus. Marion ging zurück ins Wohnzimmer, trat an das linke, schmale Fenster neben der kleinen Anrichte, und blickte auf das gegenüberliegende graue Haus ohne Farbe auf dem schadhaften Putz. Bei den Koslowskis gegenüber im dritten Stock brannte noch kein Licht. Das hieß nichts Gutes. Peter hatte verschlafen und würde zu spät losfahren und so würde auch Werner zu spät zur Arbeit kommen. Peter nahm Werner mit seinem alten Brezelkäfer mit zum Siemens-Martin-Werk, wo sie beide arbeiteten. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn Werner mit seinem schwarzen NSU-Rad fahren würde, wie früher, als er noch seine Schlosserlehre machte und bei seinen Eltern wohnte. So wäre er immer pünktlich gewesen. Der Weg war nicht weit, aber bei dem unbeständigen Wetter und zu der Jahreszeit: Sie konnte verstehen, daß er sich von Peter mitnehmen ließ. Sie ließ die Vorhangstange los und drehte sich zu Werner um, der eben das Bad verließ.
„Der Pedda is noch am pennen.“
„Mein lieber Scholli. Rufse ma da an, dat der ma wach wird?“
„Ja gut.“
Sie nahm das Telefon von der Anrichte in der Ecke, setzte sich auf den danebenstehenden Hocker, stellte den grauen Apparat auf die Knie, nahm den Hörer von der Gabel und wählte die Nummer der Koslowskis – bei der Null dauerte es immer eine Ewigkeit, bis die Wählscheibe in ihre Postion zurückgekehrt war, gerade wenn man es eilig hatte – und wartete auf das Freizeichen. Werner zog sich im Schlafzimmer derweil an. Nach dem fünften Klingeln hob Heike am anderen Ende ab.
„Koslowski.“
Marion wunderte sich, daß Heike sich immer mit Nachnamen meldete, wusste sie doch, wer es um die Zeit war und worum es ging.
„Morgen Heike, Marjon hier, weck mal Dein Mann, is schon spät, nich.“
„Oh je, ja, mach ich, inner Viertelstunde isser unten anne Tür.“
„Ja, gut, tschüssi.“
„Tschü-üüs.“
Der Kessel pfiff, Marion legte den Hörer auf die Gabel, sie eilte, ihren Bauch haltend zurück in die Küche, und füllte den bereitstehenden Kaffeefilter bis zum Rand mit kochendem Wasser. Kleine Bläschen bildeten sich und schwammen mit Inseln nicht gelösten Kaffeepulvers auf der Wasseroberfläche. Das Aroma erfüllte die kleine Küche. Marion beugte sich über den weißen Porzellanfilter und sog den Kaffeeduft tief ein. Eine Haarsträhne fiel ihr ins Gesicht und Wohlgefühl breitete sich in ihr aus. Die morgendliche Stille, noch war der neue Tag jungfräulich, nicht befleckt vom hektischen, groben Betrieb des Alltags. Sie setzte sich an den Küchentisch, legte die Beine kurz auf den gegenüberstehenden Stuhl ab. Sie hatte diese Stille immer gemocht, schon früher, als Kind, als sie morgens früh mit Onkel Erwin in der Küche saß. Tante Helga war bereits draußen auf dem Hof, ihr Onkel bereitete das Frühstück zu, kochte sich seinen Muckefuck und sah ihr, wohlwollend eine Zigarette der eigenen Ernte rauchend beim Frühstücken zu, während sie ihm von ihren nächtlichen Träumen, von Gespenstern oder Goldschätzen erzählte. Von der Küchenbank konnte sie, wenn sie sich umdrehte zum Fenster hinausschauen, über die Kartoffelfelder und die rote Beete, die noch im Halbdunkeln lagen. Krähen wackelten zu dieser Jahreszeit dort auf und ab. Nebel lag im Herbst über den Feldern wie Zuckerwatte. Kurz nach Neujahr musste sie zurück in die Stadt ziehen, in der zweiten Klasse muss sie da wohl gewesen sein. Ihre Mutter hatte in einem Warenhaus eine Arbeit als Buchhalterin gefunden. Marion sollte dort zur Schule gehen, hatte Mutter gesagt und neue Freunde finden. Sie grübelte oft über diese Zeit, seitdem sie schwanger war. Immer wieder kamen ihr Szenen aus ihrer Kindheit in den Sinn und ihre Gedanken weilten auf dem Hof am Niederrhein, bei Onkel und Tante. Was sie wohl grade taten? Und wie es den anderen dort ginge? Ob Bernd, ihr Freund aus Kindestagen noch immer in der Nase bohrte?
Werner betrat die Küche. Sie stellte ihm die am Rand angestoßene Tasse hin, goß ihm den frischgebrühten Kaffee ein. Werner mochte die Tasse, weil ihr Henkel größer war und er mit seinen dicken Fingern gut hindurchgreifen konnte. Sie füllte ihre Tasse, gab Milch und Zucker hinzu, setzte sich. Gemeinsam schwiegen sie am Küchentisch mit der dezent gemusterten Resopalplatte und tranken Kaffee. Sie schmierte ihm die Brote, wie jeden Tag, im Kopf noch den Kartoffel- und Rübenfeldern des Niederrheins nachhängend, die eine Schnitte mit grober Blutwurst, die andere mit Gouda, mittelalt. Sie packte ihm zwei hartgekochte Eier von gestern in die Plastikdose, wie jeden Tag, und die Erinnerungen verblassten im Grau des konturlosen Tages.
„So, jetzt sollte der ma langsam fettich sein, wa?“
„Noch fünf Minuten, wart noch, sonst stehse da inne Kälte.“
„Dat der nich kapiert, dat die Maloche mal echt Prä hat.“
Sie nahm die Kaffeekanne und goß den Rest in die zerkratzte Thermoskanne, die Werner zur Arbeit mitnahm. Routiniert verstaute sie die Butterbrote in seiner ledernen Arbeitstasche. Werner holte seine Schuhe aus dem Flur, setzte sich und schnürte sie. Die Küchenuhr zeigte schon zwanzig vor sechs und es schellte an der Tür. Werner rückte den Küchenstuhl, der schon immer ein wackeliges Bein hatte, zurück, nahm sich die Arbeitstasche, ging in den Flur und zog seine Windjacke vom Bügel an der Garderobe.
„Die is jetz aber echt langsam wat zu dünn, nich?“
„Geht schon.“
„Ne, echt.“
„Zieh mich gleich aufe Maloche ja eh um.“
„Ja gut. Wann kümmerse Dich mal endlich um den Stuhl? Irgendwann kracht der zusammen und dann…“
„Ach Marjon, jetz muss ich erstmal aufe Maloche.“ Marion drückte ihrem Mann einen schnellen Kuß auf die Wange.
„Machs gut. Lieb Dich.“
„Bis heut Nachmittach.“
Er strich ihr eine blonde Strähne aus dem müden Gesicht und lächelte, dann drehte er sich um und war auch schon fast aus der Tür raus. Sie atmete tief durch die Nase ein und beim Ausatmen entglitt ihr ein Seufzer. Dabei wanderte ihre rechte Hand zu ihrem Bauch, der immer dicker wurde.
Marion ließ Wasser in den Küchenboiler einlaufen, um zu spülen. Sie wusch die Keramik des Spülsteins mit dem Schwamm aus, stellte die zerkratzte Spülwanne aus grünem Plastik in das Becken, legte die Gläser von gestern Abend hinein und spritzte ein wenig Spüli über das Geschirr. Die Spülwanne, der Wecker, aber auch ein Großteil des Service: Vieles an Mobiliar und Einrichtung hatten sie vor zwei Jahren aus dem Haushalt ihrer Mutter mitnehmen können, Werner war das ziemlich unangenehm gewesen, denn Werner und ihre Mutter mochten sich nicht. Aber er hatte zugeben müssen, daß ihnen für ihre erste gemeinsame Wohnung all die Habseligkeiten nicht ungelegen kamen, denn erst beim Umzug merkten sie, was bei ihnen alles fehlte. Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie sich daran erinnerte, wie Werner das Gesicht verzog, als er die beiden Wäschekörbe mit Haushaltwaren die schmale Treppe im Haus ihrer Mutter heruntertragen musste. Sie hatte ihm hinterhergerufen, er solle aufpassen, daß er nicht falle, und just in dem Moment strauchelte er am schrägen Treppenabsatz des Mezzanins.
Sie ließ das kochende Wasser aus dem Boiler aus, das heiße Naß spritzte aus dem morschen Plastikschlauch des Hahns, der Schaum wanderte über die Gläser, deren Reste sich mit dem Spülwasser vermischten. Sie drehte sich zum Küchentisch um, trank noch den letzten Schluck lauwarm gewordenen Kaffees und legte sie ihre Tasse zu den Gläsern in das sprudelnde Spülwasser. Sie konnte nicht mehr so heiß spülen, wie vor einiger Zeit noch, die Hitze stieg ihr bis in den Kopf, ihr wurde schwindelig und die Knie wurden ihr weich. Noch ein paar Monate, dann war es geschafft. Februar. Ihr graute. Hoffentlich würde ihr Kind gesund zur Welt kommen und hoffentlich würde sie zu ihrer alten Figur zurückfinden. Sie fand sich schrecklich, so dick. Sie konnte weder Röcke tragen, die ihre Figur betonten noch ihre Blusen, die sie sich letzten Sommer gekauft hatte. Sie fühlte sich wie ein Bauerntrampel. Außerdem bereitete es ihr Mühe, diese Kilos täglich herumzuschleppen. Ihre Beweglichkeit war zum Teufel. Ihre Kraft ließ nach, Werner musste ihren Einkauf neuerdings hochtragen, vor allem die Milchtüten, die Saftflaschen und sein Bier schon lange. Dabei war sie früher schlank und sportlich gewesen, hatte stets bei Wettkämpfen einen der ersten Plätze belegt, im Staffellauf und auch auf 800 Meter. Diese unglaubliche Unselbständigkeit, dieses Zurückgeworfensein auf die Hilfe anderer beschämte und quälte sie. Sie drehte das Kofferradio auf der Fensterbank in der Küche lauter. Die Beatles sangen Help! und obwohl sie den Text mehr erahnte, als daß sie ihn verstand, wusste sie, was John meinte.
When I was younger,
so much younger than today,
I never needed anybody's help in any way.
But now these days are gone,
I'm not so self assured,
Now I find I've changed my mind
and opened up the doors.
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won't you please, please help me.
Sie summte mit, den Refrain konnte sie singen, nahm den Schwamm, um einige Verkrustungen von einer Gabel zu lösen. Sie grinste, auch das Besteck kam aus dem mütterlichen Haushalt. Durch das zum Lüften geöffnete Wohnzimmerfenster drang der Lärm des einsetzenden Berufsverkehrs bis in die Küche. Die Straßenbahn kreischte auf den feuchten Schienen, Autoreifen flappten über das nasse Kopfsteinpflaster, Laster dröhnten beim Anfahren an der nahen Ampel. Die morgendliche Stille war nun dahin. Bald würden die Schulkinder die Straße entlanglärmen. In sechs oder sieben Jahren würde auch Rainer oder Petra dabeisein. Sie wünschte es sich so, war so voller Sorge, wenn es um die Zukunft des noch ungeborenen Lebens ging. Immer wieder grübelte sie herum, wurde durch ihre innere Unruhe gelähmt. Sie hatte so viel gelesen über Fehler bei der Geburt, über Kinderlähmung und vor dem Haus auf der Haupstraße hatten sich tödliche Unfälle ereignet. Autofahrer, die Kinder übersahen, die zwischen den parkenden Wagen auf die Fahrbahn rannten. Mechanisch spülte sie den Rest. Teller, Töpfe, fertig. Sie wischte mit dem ausgewrungenem Spültuch über den Beckenrand, griff nach dem Geschirrtuch, ein Grubentuch aus den Tagen, als Werners Vater noch als Bergmann bei der Zeche einfuhr, und trocknete die Gläser, die Tassen, danach Besteck, Töpfe. Im Wohnzimmer hielt sie beim Einräumen die Pilstulpen gegen das Licht. Ein Blick in das erste Hell des Tages. Unten fuhr Auto um Auto die doppelspurige Hauptstraße auf und ab. Dies würde ihr letzter Winter auf der Hochstraße werden, sie hatten es mehrmals besprochen. Im kommenden Jahr würden sie sich eine neue Bleibe suchen. Die Wohnung war zu klein für einen Familienhaushalt. Sie lag im vierten Stock, hatte Schrägen. Sie hatten die Wohnung nur genommen, weil sie seinerzeit keine Lust hatten noch länger zu suchen. Es war ohnehin schwer genug, frisch verheiratet, Werner eben vom Bund zurück und sie als Friseuse, eine Wohnung zu bekommen. Sie stellte das letzte Glas in den Schrank, sah nach dem Kohleofen in der Zimmerecke, öffnete ihn und schürte mit dem Haken die Glut, so daß die Asche in das Schoss fiel. Sie passte auf, daß keine Glut auf ihre Pantoffeln fiel, das hätte noch gefehlt. Das heisse Aschenschoss deponierte sie zum Abkühlen neben den Ofen. Sie wünschte sich eine Etagenheizung, oder besser noch, eine Zentralheizung für die neue Wohnung. Aber in den Genossenschaftswohnungen gab es meist nur Kohleöfen. Sie hasste den Staub, den Dreck und die Löcher, die die Glut in den Linolboden brannte. Der Kohlenmann war vorletzte Woche da gewesen und Marion hoffte, daß die Fuhre Eierkohle diesen Winter reichen möge. Sie schaute auf die gefüllte Kohlentröte und fluchte leise. Sie schaffte es kaum noch, das schwere Ding über den Ofen zu heben, um es zu stürzen und zu leeren, geschweige bis in den Keller und mit der vollen Schütte wieder bis in den Vierten. Dieser Bauch, die Kilos und dazu ihr Rücken. Werner würde wieder gehen müssen, wenn er von der Arbeit kam. Obwohl: Heute würde er später kommen, denn er wollte noch mit Peter in die Stadt, Weihnachtseinkäufe machen. Bestimmt hatte er dann keine Lust mehr in den Keller zu gehen. Ob sie ihm die Schütte heute Nachmittag unten an die Haustür stellen sollte, ob er sie bemerken würde? Sie durchquerte die Zimmer, die Unterlippe zwischen Daumen und Zeigefinger, überlegte, was es noch zu tun gäbe. Eingekauft hatte sie gestern, eigentlich sah die Wohnung aufgeräumt und sauber aus. Um ehrlich zu sein, sah es während der Heizperiode nie richtig sauber aus. Sie reckte sich abermals, war immer noch nicht richtig wach. Marion hätte sich am liebsten wieder ins Bett gelegt. Nicht um zu schlafen. Es kreisten so viele Gedanken in ihrem Kopf, sie hätte kein Auge zugetan. Aber es war, als läge ein Gewicht auf ihrer Brust. Alles fiel ihr schwer, alles war ihr eine Last. Sie beugte sich vorsichtig und kramte einen neuen Staubsaugerbeutel für den alten Vorwerk aus der Herdschublade hervor. Den Vorwerk-Staubsauger ihrer Mutter, ach, der Bestand des mütterlichen Haushalts setzte sich in der Wohnung beliebig fort. Andauernd musste sie den Beutel wechseln, die Asche saß in jeder Fuge, der Ruß in jeder Ecke. Trotzdem war es an den Fenstern kalt. Im Winter spannte sie Schals vor die Fensterbänke, deren Lack brüchig und aufgeplatzt war, da es mal heiß, dann wieder kalt und ein anderesmal feucht war, damit es nicht zog und legte den dunkelroten Türdackel hinter die Korridortür. So ging nicht die ganze Wärme sofort verloren. Es schellte an der Tür. Marion öffnete und hörte den Briefträger.
„Pooost.“
„Wat für Hübner?“
Anscheinend hatte der Postbote sie nicht gehört, sie nahm sich den Haustürschlüssel vom Brett und machte sich auf ihren Filzpantoffeln auf den Weg nach unten zu den Briefkästen, langsam Schritt für Schritt, ihren Bauch in der Hand. Werner hätte geschimpft, daß sie mit Pantoffeln die Treppen stieg, in ihrem Zustand. Aber es war ihr zu lästig, feste Schuhe anzuziehen, zumal sie kaum noch ihre Füße sehen konnte. Unten stand die alte Wandraschek, die hatte immer was auszusetzen, die alte Kröte. Mimte hier die Hauswartin. Hatte bestimmt schon an der Haustür gestanden und auf die Post gewartet, wollte schauen, wer von wo Briefe, Rechnungen, Mahnungen bekam. Ganz schön neugierig, die Giftspritze. Sie mochte die Wandraschek nicht. Bald würden sie in eine neue Wohnung ziehen und die Wandraschek würde hierbleiben und es hätte sich ausgewandraschekt. Neulich hatte die sich tatsächlich über den Lärm bei ihnen beschwert, ob sie nicht leiser laufen könne. Sie hatte nichts Besseres zu tun, als den lieben, langen Tag zu horchen, welcher Mieter, welche Geräusche macht, hanebüchene Vermutungen anzustellen über das Schuhwerk des Nachbarn oder wann wer Wasser laufen ließ oder die Treppe auf- oder abging. So sah die aus.
„Haben Sie das auch gestern gehört? Diesen Höllenlärm?“
„Ach, gun Morn Frau Wandraschek.“
„Ja, ja, guten Morgen Frau Hübner, sagen Sie mal, hören Sie das denn nicht, wenn der Sohn von den Vosskamps immer mit dem Ball spielt? Verbieten sollte man denen das, wissen Sie, das ist unerhört, un-er-hört.“
Marion kam der Tonfall vor wie der Berichterstatter aus dem Volksempfänger, als sie klein war. Harte, akzentuierte Silben, abgehackt und schnell. Woher die Alte wohl kam? Sie hatte weder Dialekt noch Charakter.
„Ach wissense, Frau Wandraschek. Nich datse dat jetz falsch verstehn. Aber, dat sind eben Kinder, so sind die, nich?“
„Ja, ja, Sie müssen es ja wissen. Wenn das bei Ihnen soweit ist, dann ist es vorbei mit meiner Ruhe.“
Die Wandraschek blickte missbilligend auf ihren Bauch. Damit war das Gespräch für Marion beendet. Was bildete sich die Alte eigentlich ein, was oder wer sie wäre? Marion schloß den Briefkasten auf, nahm sich ihre Post, schloß wieder ab und machte auf dem Absatz kehrt.
„Schön Tach noch“
„Ihn‘ auch Frau Wandraschek.“
In der vierten Etage angekommen ging ihr die Luft aus. Die Post war uninteressant: Ein Schreiben ihrer Hausratversicherung über die neuen Konditionen, eine Lotteriewerbung und – wie erwartet – die Stromrechnung der Stadtwerke. Grund genug, sich eine winzige Pause zu gönnen. Sie setzte sich auf die Couch, zog den Sessel heran, legte die Beine dort ab und lehnte sich zurück. Sie schloß die Augen. Vor ihrem inneren Auge lief ein Film ab: Eine neue Wohnung, sonnig und hell ohne Frau Wandraschek in der Etage unter ihnen. Eine moderne, geräumige Erdgeschosswohnug, fliessend Warmwasser in der Küche und mit einem kleinen Garten hinter dem Haus, wo sie im Sommer sitzen und entspannen konnten. Am Wochenende gemeinsam grillen. Vogelgezwitscher statt Straßenlärm und Blütenduft und Schmetterlinge statt des Rußes der Öfen. Im Herbst konnte sie vielleicht Krähen im Garten beobachten, wie damals. Ja, so ein Garten, das wäre was. Nicht die aschfahlen Nachbarhäuser, sondern ein Blick auf einen Strauch, einen Baum, ihr Rainer, ihre Petra, auf der Wiese spielend, im Baum kletternd, vielleicht auf einer Schaukel, Amseln, die nach Würmern suchen und Kleiber, die den Apfelbaum am Stamm hinunterlaufen.
Das metallische Schleifen der Räder auf den Straßenbahnline 13, das durch das offene Fenster drang, riß sie aus ihren Träumereien und vermischte sich mit dem Geräusch der vorüberfahrenden Autos und Laster auf der Straße zu einem steten Rauschen und Kreischen. Wohin die alle fuhren? Sie stand auf, ging in die Küche und machte sich auf dem Mahagonibrettchen, das sie von ihrem Onkel bekommen hatte, eine Schnitte mit Fleischwurst und Senf. Dazu schenkte sie sich ein Glas Sinalco ein und setze sich an den Küchentisch. Es war neun, im WDR begannen die Nachrichten.
Bonn: Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um 26731 auf 118968 angestiegen. Zugleich sank die Zahl der offenen Stellen um 76900 auf 58260. Strukturell ist der Bergbau mit über 30% der bundesweit Beschäftigten am stärksten betroffen. Die Zahl der Arbeitslosen im Ruhrgebiet stieg in den vergangenen 12 Monaten um fast 50% an. Der SPD-Abgeordnete Börner nannte diese Entwicklung alarmierend. Man sehe einen Zusammenhang mit den erstmals seit der Währungsreform negativen Bilanzvorhersagen der deutschen Banken, die Börsen seien beunruhigt, so die Bundesregierung.
Am selben Tag
„Na dann ma los! Mach ma hin, kannze gleich ma dat Gewölbe von Ofen 9 dichtmachen. Zeich den Mohammed ma, wie dat geht.“
„Wat gibt datten? Wieso ich? Soll doch der de Rosa oder der Fritz machen.“
„Sind beide krank. Jetz mach hin und frag nich doof. Sind hier nich im Kindergarten, also echt.“
„Sicher, Meister.“
Sie waren zu spät gekommen. Mal wieder. Siegfried, der Schmelzmeister wusste, daß es Peters Schuld war, wenn sie zu spät kamen. Werner hatte Siegfrieds vollstes Vertrauen, nannte ihn zuweilen Siggi – Werner war ja auch erster Schmelzer am Ofen, er, Peter, war Schütze Arsch. Nun musste er am Nachbarofen aushelfen und dem Türken, der ganz neu war und kaum ein Wort verstand, zeigen, wie alles funktionierte. Die Schmelzhalle lag im Halbdunkel, Licht drang hier den ganzen Tag nur wenig rein. Die drei Standöfen, Nummer Sieben bis Neun, waren alte Dinger, übrig aus der Zeit weit vor dem zweiten Weltkrieg. Die beiden Nachbaröfen Nummer 7 und 9 gaben pro Schicht knapp zweihundert Tonnen Stahl her. Ihr Ofen 8 tat das, wenn er einen guten Tag hatte. Fast doppelt so viel war Standard. Die Engländer hatten sie nach Kriegsende als einzige Öfen im Nordheimer Werk nicht demontiert, da sie veraltet waren. Immer war irgendetwas kaputt, musste geflickt werden. Rund um die Uhr. In Wechselschicht. Das machte ihn ohnehin fertig. Besonders der Wechsel von Mittag- auf Frühschicht brachte ihn um, wenn er am selben Tag acht Stunden später wieder am Ofen stand. Und das war heute der Fall. Der erste Frühschichttag nach der Woche Mittag und sie waren zu spät. Auch Sepp der Oberschmelzer vom Nachbarofen mit seiner schiefen Lippe war sauer und schrie seine Leute an.
„Uweeeee, mach ma hin mit die Tcheiche.“
S-Laute konnte er seit seinem Schlaganfall nicht mehr gerade herausbringen.
„Wat denn?“
„Biche dämlich?...“
Der Rest seiner Rede wurde durch das Laufgeräusch eines Krans vom Schrottplatz verschluckt. An jedem Ofen arbeiteten bis zu fünf Kollegen vom Oberschmelzer bis zum vierten Schmelzer, der die Drecksarbeit machen musste. Schmelzmeister, Betriebsassistent und Betriebsleiter, die arbeiteten ja ohnehin nicht richtig. Als seien die schon einmal nach der Maloche dreckig gewesen oder hätten sich duschen müssen. Er musste sich nach der Arbeit ewige Zeit den Schmutz unter den Nägeln wegbürsten. Peter durchquerte die Halle, an den Lufterhitzern vorbei. Der Lärm nahm zu. Er nahm Kurs auf ihr schäbiges Kabuff. Nebenan befand sich die Messwarte, wo die Kollegen Werte notierten, sich wichtig ausnahmen und Proben ins Labor schicken ließen. Hätte er einen so feinen Job, das wäre was. Wie vermutet saß Ali oder Mustafa oder wie der auch immer hieß, der vierte Schmelzer am Ofen, dort und aß sein Frühstück oder was immer das war, was zwischen dem Zeitungspapier herausschaute.
„Ali, ich muss Dich wat zeigen. Kommse mit, muss dat Gewölbe dicht machen. Hat Prä, der Schröder macht ne Schau.“
„Mohammed.“
„Jetz komm los.“
„Nix Ali, Mohammed. Esse, fertig. Gut, fertig.“
„Nix essen fertig. Ich glaubs dir wohl! Meinze, ich komm für Jux her? Dat wird jetz gemacht und Ende.“
Peter entfuhr ein genervtes Stöhnen, immer gab es Scherereien mit den Alis. Er fingerte eine Reval aus der Tasche und steckte sie sich zwischen die Lippen. Er überprüfte flüchtig seine Schutzschuhe. Sie machten sich gemeinsam auf dem Weg zum Oberofen, mit den feuerfesten Pantinen bestieg er schwerfällig das Gewölbe, Flammen schlugen hoch aus den lecken Stellen. Unter ihnen bliesen die Brennköpfe schon ihr siebzehnhundert Grad heißes Gas-Öl-Gemisch in die Schmelzkammer des Ofens. Er musste höllisch aufpassen, daß er sich nicht den Hintern verbrannte. Er hasste seine Arbeit – von ganzem Herzen. Die alten Silikatsteine lösten sich von Zeit zu Zeit und mussten ausgetauscht werden. Exakt an den Stellen, wo das Feuer herausschlug. Er nahm die neuen Steine entgegen, die Mohammed herbrachte und begann mit seiner Arbeit.
„Scheiße, verfluchte! Drecksscheisse!“
„Wasse is?“
„Ach, dat is hier alles lose. Kannze vergessen.“
„Wasse?“
„Wasse, wasse. Hol mal noch mehr Steine, dat is alles in Arsch. Ganze Gewölbe is in Arsch, ne Doh.“
„Gut, ich mache. Moment, ich mache.“
Während Mohammed loszog, um basische Steine zu holen, hockte Peter sich nieder, nahm eine Kippe aus der Tasche. An den beiden anderen Öfen machten Ausländer seine Arbeit. Türkenarbeit, Itakerarbeit. Wieso musste er, Peter, Türkenarbeit machen? Kreischen, Pfeifen, Ofen 7 war soweit. Peter verzog sein Gesicht, so laut war es. Der Stahl war gekocht und desoxidiert. Der Oberschmelzer informierte den Gießmeister darüber, daß nun Vorkehrungen zum Abstich getroffen würden, Kokillen müssten bereitgestellt werden, alle Mann auf ihre Plätze. Bei ihnen am Ofen 8 würde es wohl noch eine Stunde dauern. Schätzte er. Hoffentlich. Wenn er das Gewölbe geflickt hatte, wollte er seine Ruhe haben. Die Werkssirene gab mit einem Signal an, daß der Abstich bevorstand, er hielt sich kurz die Ohren zu. Heike hatte ja keine Ahnung, was hier vor sich ging, die hatte es gut. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, diese Drecksmaloche sein Leben lang zu machen. Niemals. Es machte ihn kaputt, fertig. Noch sechs elend miese, lange Stunden und er war jetzt schon verschwitzt und hatte eine Brandblase an der Hand und den Schmier der Öfen unter den Nägeln. Und das Schlimmste, er sah weder Himmel noch Wolken, nur Stahl und Dunkelheit.
„Bisse da oben eingepennt, Du Lusche?“
„Wart auf Steine.“
„Warten is ja auch besser als malochen, wa?“
Das hatte er noch nötig, die blöden Sprüche von Meister Schroeder. Immer wenn er eine rauchte, kam der Idiot von Schmelzmeister durch die Halle. Gern würd er den des Nachts alleine auf der Straße treffen, dann würde er ihm auch einen Spruch reinreichen oder die Nase nach innen biegen. Das lief ja mal wieder alles blendend heute, das Hängegewölbe dichtmachen, Schmelzmeister Schroeder, genannt Drecksack, dämlicher, in die Quere kommen. Was würden die kommenden Stunden noch an Herabwürdigungen bringen? Das einzig Gute waren die Schichtzulagen, damit hatte er ein wenig mehr auf dem Konto als bei seiner vorherigen Stelle im Straßenbau. Aber sonst? Beim Straßenbau war er wenigstens an der Sonne, an der frischen Luft, sah ab und an ein hübsches Mädchen vorübergehen und konnte einen Spruch machen, hier war es einfach nur mies. Er rieb sich müde sein Gesicht, die schwarzen Bartstoppeln kratzen an seinen Handflächen.
Als Peter die Zigarette – bis auf den Stummel hinuntergeraucht – durch eines der Löcher im Gewölbe in den Ofen fallen ließ, tauchten Kalle und Uwe auf. Er nahm oben nur Satzfetzen wahr.
„…ma gleich die Temperatur…“
„…holse ma dat Pyrometer…“
„… fettich bis, dann …“
„… Brechprobe innet Labor …“
Ja, ja, mit dem Pyrometer. Das wäre sein Ding gewesen. Mit einem großen Fernglas in die Glut gaffen. Der flüssige Stahl erschien dunkelrot am Anfang des Schmelzprozesses, gegen Ende war er gleissend weiss – bis das Mauerwerk glühte, obwohl Kühlleitungen durch die Ofenmauern führten. Die Temperatur musste man an die Meßwarte übermitteln, wo sie mit den Laborwerten wie Schwefelgehalt und Sauerstoffanteil, die aus den Bruchproben des Stahls bestimmt wurden, notiert wurden. Werner hatte es ihm vor einigen Monaten gezeigt. Wie gerne hätte Peter mit einem Meßinstrument wichtig herumgestanden, die glühende Masse beobachtet und an einem Rädchen gedreht. Was für eine Beschäftigung! Aber es half alles nichts: Er dichtete weiter das Gewölbe mit den Steinen, die Mohammed gebracht hatte, ab. Der war mittlerweile über alle Berge, im wilden Kurdistan. Er schmunzelte kurz, musste an seine alten Karl-May-Bücher denken. Nein, Mohammed war bestimmt rauchen oder im Kabuff essen. Er beobachtete Uwe, der mit seinem Pyrometer dastand und eine entspannte Zeit zu haben schien. Später musste die Temperatur dann und wann mit einem Tauchrohr aus Quarz gemessen werden. Der Genauigkeit wegen. Aber auch das war in Peters Augen Pillepalle. Aber er, Peter, hatte keinen Lehrabschluß, der polnisch-katholische Gott seiner Familie hatte es nicht gut mit ihm gemeint, sondern ihn zu einem Dasein als letzter Schmelzer verdammt. Er hatte die schwerere Arbeit und den geringeren Lohn. Kalle kam an den Ofen.
„Pedda, runter vom Ofen, wenne den dicht hass, gleich ist Abstich, hass auch noch wat anderes zu tun. Sach dem Freddy, der soll dich helfen. Kannz dat Stichloch gleich aufbrennen.“
„Wat gibt datten hier? Willze mich fettichmachen, Kalle?“
„Ach, jetz hab Dich man nich. Führ Dich ma nich auch wien klein Mädchen.“
Sie scherzten, dabei war es Peter ernst. Es war, wieder mal: Seine Maloche. Seine elende, verhasste Maloche. Noch nicht ganz fertig mit den Lecks im Gewölbe, schon wurde er weitergeschickt. Uwe starrte durchs Pyrometer immer noch Löcher in den flüssigen Stahl. Und er musste umständlich vom Oberofen heruntersteigen und auf zum nächsten Kampf. Das Aufbrennen des Stichlochs mochte er noch weniger als das Flicken des Gewölbes oder mit dem nassen Holzkratzer im Ofen herumzufriemeln, um Schlacke und Stahlreste auszuräumen. Er freute sich jetzt schon auf den Feierabend. Noch gut fünf Stunden.
Peter lief unentschlossen neben Werner her. Sie waren in die Stadt gefahren, wollten nach Weihnachtsgeschenken schauen, aber erst einmal brauchte er einen leckeren, wärmenden Glühwein. Er hielt nach einem Stand Ausschau, an dem nicht so viele Rentner standen. Der Stand nahe dem Kinderkarussel war fast leer, das rote Feuerwehauto – ein Leiterwagen – und der Polizeiwagen waren nicht besetzt. Im Hubschrauber saß ein kleiner Junge, der unentwegt die Hupe betätigte.
„Solln wa hier ma?“
„Jou, ist in Ordnug, machen wa.“
„Tach, zwo Glühwein bidde.“
„Kommt sofort, die Herren.“
Es war früher Nachmittag und einige Stände und Fahrgeschäfte hatten noch nicht geöffnet. Die Badstraße hinunter lag Karstadt, da bekamen sie alles, was sie brauchten. Nach diesem Wein oder einem zweiten würden sie schnell in das Warenhaus gehen, und würden schauen, was sie für ihre Frauen kaufen würden: Vielleicht neue Handschuhe oder eine schmucke Halskette, wenn diese nicht zu teuer wäre. Für die Geschenke von Eltern und Schwiegereltern sorgten ihre Frauen. Die zu stark geschminkte Frau Mitte vierzig reichte ihnen den Glühwein aus dem Stand heraus, Peter bezahlte.
„Sachma Wänna. Der Siggi hatse doch nich alle.“
„Wieso meinze?“
„Na, weil der mich heut wien Doofen von ein Ofen zum andern gejaacht hat, wenneweiss wattichmein.“
„Ach, weisse, wenn sich zwei krankmelden, wat soller denn machen?“
„Ja, aber wie der immer tut. Dat möchte ich den an liebsten…“
„Ach, Mensch, Pedda. Ich willdatma sosahngn, der is numa einfach so, ich glaub, dat is gar nix persönliches, weisse.“
„Nee, schon allein heut morgen, da hätt ich…“
„War halt sauer, weil wa zu spät waren. Is doch klar.“
„Jetz fall du mich auch noch innen Rücken. Ich glaubs dir wohl!“
„Willich ja gar nich, aber is doch logisch, dat der sauer war.“
„Weisse, dat is ja alles schön und gut, aber irgendwann, dann hau ich da in Sack. Is mich egal, wat dann is, geht schon irgendwie weiter, wenneweiss wattichmein.“
„Jetz sei man ich blöd. Da innen Werk verdiense ne schöne Stange Geld, in Vergleich zu früher aufe Straße.“
„Ach, ich war mein Leben lang aufe Straße, als Kind schon, unsoweita. Nich ers, als ich beie Hochtief war.“
„Wat soll dat nu wieder heißen?“
„Als Ulligen, nachen Krieg, mein Alten war inne britische Gefangenschaft und mein Mutter war ständig mit meine Schwestern unterwegs, hamstern. Da musst ich schon kucken, wo ich bleiben tu. Gab ja nix.“
„Ich mein, sicher, schon irgendwie, aber wat hattn dat jetz damit zu tun?“
„Ich sach dich dat: Ich bin dat wohl irgendwie aufe Straße gewohnt, nicht inne dunkle Halle und ich bin dat gewohnt, dat ich selbst weiss, wat ich tun und wat ich lassen soll und nich, dat mich dat son Holzkopp erzählen tut, wenneweiss wattichmein.“
„Ach, jetz hör auf mitte Maloche, is Feierabend. …“ Peter nahm einen großen Schluck Glühwein, seine Tasse war bereits halbleer. Er hatte sich in Rage geredet. Werners Tasse stand noch beinahe unberührt da.
„Weiße, früher, da hat mich keiner wat sagen können und dat soll auch ma so bleiben. Ich bin für mich selbst klargekommen, immer, wenneweiss wattichmein.“
„Ach, Pedda, wat sollen dat? Meinze eigentlich bei uns is dat immer alles goldich? Wir sind doch einfache Arbeitsleut. Da musse buckeln, dat is numa so.“
„Bei Euch nich alles goldich? Wat denn? Glaub ich ja nich. Du und dein Marion, da is doch immer alles paletti, oder?“
„Hör do auf. Isset doch nich. Nur weil ich nich am Jammern bin, is doch nich alles rosich. Wat meinsten du?“
„Nochn Glühwein?“
„Jou.“
„Fräulein? Machense noch zwei?“
Dann war Schweigen. Werner leerte seine Tasse. Peter hatte seine längst leer. Peter überlegte, was bei Werner und Marion nicht stimmen könne. Ob sie ihn nicht mehr ranließ oder ob sie Werner wegen irgendetwas die Hölle heiß machte? Er kam zu keinem Ergebnis. Er wusste, daß Werner und Marion sich das Kind wünschten. Nicht so wie bei ihnen. Denn Heike wollte plötzlich ein Kind, als sie hörte, daß Marion schwanger war und er war seinerzeit schon dagegen. Er hatte Heike geheiratet, damit sie eine Wohnung bekamen und er hatte sich damit fester gebunden, als er es eigentlich vorhatte. Nun erwartete Heike auch noch ein Kind und er war noch fester gebunden. Aber er hatte Heike sofort klargemacht, daß das Kind nicht seine Sache war, sondern daß sie sich darum zu kümmern hätte. Die Überschminkte knallte die beiden Glühweintassen auf den Tresen des Standes.
„Prost!“
„Ja, denn.“
Peter nahm seinen Becher und prostete Werner zu. Er spürte, wie er sich langsam entspannte. Trotz der mühsamen Schicht und seinem Ärger mit seinem Meister machte sich allmählich ein wohlig warmes Gefühl in ihm breit, was nicht zuletzt an der langsam einsetzenden Wirkung des Glühweins lag. Hier hätte er stehenbleiben und weitertrinken können.
„Nach dem hier mal beien Karstadt rein und nache Geschenke gekuckt?“
„Ja, muss wohl.“
So sehr stand ihm der Sinn nicht danach.
„Weiße schon, watte kaufen tus?“
„Ma schaun, ne Mütze oder en Schal wolltese
hahm. Vielleicht auch noch ne lecker Tafel Schokolade vonne Konditorei Schmitz aufe Kaiserallee. Und bei Dir?“
„Vielleicht neue Handschuhe, aba ich wollt auch noch nachen Hörwurm nach die neue Beatles Schallplatte kucken, da hab ich dann auch noch wat davon.“
Peter kicherte. Und Werner lächelte, man sah seine Lippen kaum, so schmal war sein Mund. Der Markt hatte sich gefüllt, die Menschen strömten aus den Fabriken und den Büros. Gegenüber am Eingang einer im Winter geschlossenen Eisdiele – der Besitzer war nun bestimmt im sonnigen Italien – hatte sich ein kleiner Chor mit Blechbläsern zusammengefunden, die soeben Petula Clarks Downtown anfingen zu posaunen. Eine Rothaarige mit angeklebtem Weihachtsmannbart, kaum älter als er selbst, begann zu singen.
Just listen to the music of the traffic in the city
Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty
How can you lose?
The lights are much brighter there
You can forget all your troubles, forget all your cares
Als sie auf dem Weg zum Kaufhaus unter Menschenmassen zwischen Ständen mit hangemachtem Nippes und gebasteltem Kram, Bienenwachs-Kerzen, gehäkelten Topflappen und geschnitzten Krippenfiguren und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge entlang gingen, entdeckte Werner einen Stand mit Wollwaren aus Skandinavien. Wer konnte schon wissen, ob die Waren tatsächlich aus dem Norden stammten und von Fjellschafen. Der Mann am Stand erklärte etwas zum Thema, während Werner in den bunten Auslagen wühlte. Peter fiel ein, daß er später mit Heike bei seinen Schwiegereltern zum Abendessen eingeladen war. Das konnte ja noch lustig werden. Er brauchte unbedingt einen weiteren Glühwein zur Vorbereitung auf den Abend, denn immer geriet er mit Heikes Vater aneinander.
„Nee, welchen soll ich denn nu nehmen? Den roten hier oder lieber den braunen?“
„Nimm den hier mit der Mütze in bääsch. Der paßt besser zu dein Frau ihrn Täng.“
Sie verließen den Markt in Richtung des Musikfachgeschäftes in der kleinen Gasse am Bahnhof, wo Peter die Beatles-LP kaufte. Danach überredete er Werner nochmal den Glühweinstand aufzusuchen und dritte schmeckte ihm noch besser als der zweite, nach dem vierten war er bereit für den Aufbruch.
„Jetz mach aba ma hin, Pedda. Kann ich ja nix dazu, wenne wieder mal zu tief ins Glas geguckt hass, ne?“ In einer guten Dreiviertelstunde müssten sie bei Heikes Eltern zum Essen sein. Ihre Mutter feierte ihren Geburtstag nach, den sie der Wirtschaft wegen immer an einem Montag beging. Feiern war zu viel gesagt. Außer ihnen würden nur die Eltern seines Schwiegervaters da sein. Die mütterliche Verwandschaftslinie lag mit Gelenkrheuma und anderen Zipperlein darnieder. Heike war gereizt, weil er nach Alkohol roch. Ach was gereizt, sauer war sie, stocksauer. Sie mochte es nicht, wenn sie zu ihren Eltern eingeladen waren und er bereits was getrunken hatte. Aber sollte sie doch sauer sein, denn ihm stand der Sinn am allerwenigsten auf die kommende Familienfeier.
„Welchen Schlips soll ich denn nehmen?“
„Jetzt stell Dich nich so kariert an, dat liecht doch alles aufen Bett.“
„Ja, ja.“
Wäre Heike aus Stahl, sie wäre gleissend weiss – 1700 Grad Celsius. Aber nüchtern wäre der Pflichtbesuch die Hölle geworden, so war er zumindest in der richtigen Stimmung, das familiäre Kasperletheater zu überstehen.
„Hasse dat Geschenk?“
„Als ob Dich dat jetz interessieren würde. Kerl inne Kiste!“
„Wat denn? Jetz tu man nich so. Sons sachse immer denk mal mit und jetz is dat auch widda falsch, oder wie?“
„Jetz mach Dich einfach fettich, und dann los. Putz Dir Deine Zähne, Du stinks nach Glühwein, dat is ja abartich.“
„Blablabla.“
Peter knöpfte sein Hemd zu, legte seine Krawatte an. Er hoffte, der Abend möge schnell vorübergehen. Morgen musste er wieder in aller Herrgottsfrühe raus.
„Und?“
„Ja, nur noch meine Schuhe, Moment, dann könnwa.“
Peter merkte an Heikes Tonfall, daß sie kurz vor der Explosion stand. Er hatte keine Lust zu streiten, auf der anderen Seite empfand er eine gewisse Freude bei dem Gedanken an eine mögliche Eskalation.
„Hüühüühüü.“
Heikes Vater Helmut wieherte, imitierte ein Schnauben, scharrte mit dem Fuß unter dem Tisch und warf Peter einen wissenden Blick zu. Was sollte das Theater? Peter wusste, daß seine Schwiegermutter den rheinischen Sauerbraten mit Roßfleisch zubereitete. Als Junge, kurz nach dem Krieg, hatte er noch ganz andere Sachen gegessen. Hunger war schlimmer als ein Gaul auf dem porzellanenen Teller. Gott sei Dank hatte er auf dem Weihnachtsmarkt ausreichend vorgeglüht, das gab ihm die nötige Lockerheit, dieses Getue zu ignorieren. Peter versuchte freundlich zu schauen, sich dumm zu stellen und zu lächeln, aber er wusste, es würde ihm auf lange Sicht misslingen.
„Jetz mach ma hin, Pedda, nimm Dich mal wat, damitte stark wirs.“
Heikes Mutter legte ihm eine Scheibe Braten auf den Teller, der Kloß dampfte und die grobe Soße verströmte das typisch würzig-saure Aroma.
„Kinder, haut rein, wer weiß, obbet morgen nochwat gibt.“
„Red kein Mist, klar gibbet wat. Die Reste, jetz setz Dich hin und steh hier nich inne Gegend rum, gudden Appetit allerseits.“
„Gudden Appetit.“
„Gudden Appetit.“
„Mahlzeit.“
Kurt, Helmuts Vater, erhob das Glas, aber keiner schaute auf. Kurt und Meta hatten vor ewigen Jahren ihre Erwerbstätigkeit als Kneipiers beendet und den Hafenmeister an Sohn Helmut und seine Frau abgegeben. Kurt konnte nicht mehr so lange stehen – ein Hüftschaden. Kurt arbeitete als Portier auf dem Pütt und Kurts Frau Meta machte bei einer Industriellenfamilie den Haushalt. Putzte, holte die Kinder von der Schule und kaufte Lebensmittel ein, die sie sich selbst nie hätten leisten können.
„Und, Pedda, wie fühlze dich denn so als angehenden Vadda? Is dat nich schön?“
„Hat die Heike Ihnen dat noch nicht gesagt?“
„Ich will dat aber gern von dir hörn.“
„Wat soll ich Ihnen sagen. Also ich fühl mich auch ohne Kind wohl. Ich hätte dat nich nötich gehabt.“
Heikes Mutter schaute verstört auf, die beiden Alten, gleichermaßen schockiert, saßen mit starrem Blick und aufgerissenen Augen da wie die Ölgötzen. Sollten sie ihm doch den Buckel runterrutschen.
„Wat gibt datten jetz? Wat soll dat denn heißen, nicht nötich gehabt?“
Heike sah Peter vorwurfsvoll an.
„Ja eben genau dat, wat ich sach. Ich häddet nich nötig, son Blaach, wat einen die Haare vonnen Kopp frisst.“
„Sach mal, spinnse?“
Heikes Augen blitzten ihn giftig an und die Farbe ihres Gesichtes erinnerte ihn an das kirschrot des Stahls bei 800 Grad Celsius.
„Wat meinz du denn? Ich hab immer gesacht, dat dat deine Sache is mitten Kind, wenneweiss wattichmein.“
„Aber, aber, Du wirst schon sehen, wennet soweit is, datte gar nix anders mehr wills. Dat war beim Kurt doch datselbe. Männer wollen nie Väter werden. Dat is die Angst vor dat Neue. Und dat ist auch im Tierreich so, lass Dich dat gesacht sein. Dat gibt sich.“
Heikes Großmutter versuchte zu schlichten. Sollte sie. Er wusste es besser, er wollte nie Vater werden und war sicher, daß sich das nicht ändern würde. Er kannte sich aus mit kleinen Kindern. Damals nach dem Krieg beim Hamstern waren kleine Mädchen gefragt. Er musste sich alleine durchschlagen. Musste sich was zu futtern suchen. Aber wenn seine Mutter alleine unterwegs war, um nach Vermisstenanzeigen zu schauen, Hab und Gut auf dem Schwarzmarkt einzutauschen, musste er sich das Geschreie seiner kleinen Schwesterchen anhören und zusehen, daß sie satt wurden, anstatt daß er hätte sich um sich selbst kümmern können. Und so würde es nun auch kommen. Sein hart verdientes Geld würde im Nu am Monatsanfang ausgegeben sein, seine Zeit für sich selbst zu einem Nichts verschwinden. Was konnte ihm also schon die Schwiegermutter seiner Schwiegermutter erzählen? Er tunkte ein Stück Kloß in die braune Soße und schob sich genüßlich die Gabel in den Mund, wohlwissend, daß er hier für einen Eklat gesorgt hatte.
„Wenn dat en Mädel wird und die wird so wie dat Heike, dann hasse aber Spaß, damit dat ma klar is“, versuchte ihn sein Schwiegervater aufzuziehen und er konterte
„Wird alles nich so heiss gegessen wie et gekocht wird.“
„Dat sachs Du! Aba Ihr macht dat schon, nich“ spöttelte er weiter.
„Schaun wa ma.“
Heikes Vater stichelte immer fort. Was hatte dieser wamsbäuchige Mann mit seinem feuerroten Gesicht gegen ihn? Er spürte jedesmal, wenn er auf ihn traf diese unterschwellige Boshaftigkeit, ständig machte der auf seine Kosten Witze, stellte seinen Charakter in Frage. Wie der ihn schon ansah, dabei hatte er dem alten Dresen nie was getan. Peter fragte sich, ob dieser aufgeblasene Kneipier mit allen Schwiegersöhnen so ein Verhältnis unterhalten hätte oder ob es an ihm lag. Er musste zusehen, daß er die Situation noch etwas unter Kontrolle hielt. Hatte keine Lust, es komplett eskalieren zu lassen. Dafür war es noch zu früh am Abend.
„Pedda, nochn Scheibchen Braten?“
„Gern, Frau Dresen, gern doch.“
„Dat is schön. Muss ja wech. Ess ma wat.“
„Aba imma.“
Wie konnte die Frau es nur mit dem stisseligen Alten aushalten? Alles ertrug sie ohne sich zu erregen. Arbeitete mit, machte den Haushalt und steckte diesen Mann mit seinen Launen einfach so weg.
„Wat macht denn die Arbeit?“
Oh, Gott, nicht auch noch das Thema.
„Alles normal.“
Nein, er hatte keine Lust, sich mit dem Alten herumzustreiten, sich provozieren zu lassen. Aber am allerliebsten hätte er ihm die Scheibe Gaul rechts und links um die fleischigen Ohren geschlagen.
„Auch mit die Aufsteherei am Morgen?“
„Sicher. Alles im Griff.“
Heike hatte ihnen wohl gesteckt, was bei ihnen zu Hause lief.
„Na dann is ja alles prima.“
„Ganz genau.“
Nach dem Essen wurde ein Mariacron gereicht. Sieh mal einer an, sie wussten doch noch, was sich gehörte. Sein erster Lichtblick. Noch eineinhalb Stunden, dann wäre der Abend gelaufen und es hiess, nach Hause fahren, endlich. Hoffentlich ging dieses elende Theater daheim nicht weiter, Heike konnte sich sehr gut dranhalten. Manchmal fand sie kein Ende.
Einige Tage später
Heike kniete vor dem Klosett, die schwarze Urethanbrille hochgeklappt. Wischte sich den Mund ab, ein Speichelfaden blieb zwischen Lippe und Handrücken hängen. Sie zog die Kette für die Spülung. Das Erbrochene und der beißend bittere Geruch entschwanden mit dem Wasser in die Versenkung. Ihre Knie zitterten, ihre schwarzen Haare hingen strähnig herunter. Sie hörte Peter aus der Küche etwas rufen, hatte aber nicht verstanden, was.
„Wat?“
„Alles klar?“
„Is schon gut.“
Ihre Morgenübelkeit dauerte an. Länger als bei allen anderen Frauen, die sie gesprochen hatte. Auf Verständnis brauchte sie bei Peter nicht hoffen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, gäbe es keinen Grund für Übelkeit. Es war ihre Sache. Sie hatte immer ein Kind gewollt. Sie hatte immer Familie gewollt. Das hatte sie schon lange vor ihrer Heirat Peter gesagt, damals, als er ihr den Verlobungsring im Café Schmitz überreicht hatte. Er hatte nur geschmunzelt, hatte nicht bemerkt, wie wichtig Familienbande für sie ist, hatte nicht sehen wollen, was Zusammenhalt, Füreinander, Miteinander für sie bedeutet und sie – ja, sie hatte es offensichtlich nicht wahrhaben wollen, daß er es nicht verstand. Wie dumm sie manchmal war! Sie klappte den Klodeckel herunter und ging zum Waschbecken, um sich den Mund auszuspülen. Sie drehte den Kaltwasserhahn auf, einer ihrer Backenzähne schmerzte immer bei kaltem Wasser. Vor zwei Jahren, als sie hier eingezogen waren, hatte er sie auf Händen getragen, war charmant und rücksichtsvoll. Aber seit sie ihm offenbart hatte, daß sie schwanger war, würdigte er sie keines Blickes mehr, suchte Streit, war abweisend und kalt. Und obwohl Peter ein sturer Hund war, hoffte sie.
„Gehsse noch einkaufen“, fragte Peter sie.
„Zum Markt.“
„Bringse von die leckere Bratwurst mit?“
„Wo warse gestern noch?“
„Wieso?“
„Weil Deine Klamotten nache Kneipe stinken.“
„Na und?“
Sie knüllte seine Wäsche, die über den Badewannenrand hing, zusammen und ging in die Küche, wo die Waschmaschine stand. Dort konnte man die Luft schneiden. Peter saß mit der BILD-Zeitung von gestern, einer Tasse Kaffee und einer kokelnden Zigarette am Küchentisch. Er war spät aufgestanden, spät selbst dafür, daß er Mittagschicht hatte. Er sah verkatert aus, sein breites Gesicht wirkte noch gedrungener als sonst und er war weder rasiert, noch hatte er sich die Haare gekämmt.
„Kommsse heut nache Arbeit dann nach Haus?“
„Hmmm.“
„Hä?“
Grummelnd wiederholte Peter sein Hmmm. Heike stopfte die Wäsche in die Waschtrommel. Sie würde die Maschine später einschalten, nach dem Einkauf und so ging sie wieder, ohne Peter weiter zu beachten, ins schmale, im Schachbrettmuster geflieste Bad und wusch sich das Gesicht, bürstete ihre Haare und trug etwas Lippenstift auf. Ihre Haut kam ihr blasser, grauer vor als üblich. Eigentlich hatte sie immer eine frische Gesichtsfarbe und sogar im Winter ein leicht sonnengebräuntes Antlitz. Die Schwangerschaft liess sie unvorteilhaft erscheinen. Schwach, kränklich, beinahe klapperig. Und obwohl sie ihren Bauch mit dem gewissen Stolz angehender Mütter vor sich hertrug, sehnte sie sich nach ihrer vorschwangerschaftlichen Figur. Sie wollte die neue Sommermode auf jeden Fall wieder schlank erleben. Sie verließ das Bad und nahm ihre Mütze von der Garderobe. Sie nahm den Schlüssel vom Haken und ging nochmal in Küche, um den Einkaufszettel zu holen.
„Traach nich so schwer.“
„Nee.“
Sonst sagte Heike Tschüü-üüs oder gab Peter einen Kuß, aber heute hatte sie keine Lust dazu. Was hätte sie auf solch eine dumme Bemerkung auch sagen sollen? Schließlich hatte er ihr auch keine Beachtung geschenkt.
Sie nahm ihren Einkaufsroller und machte sich auf den Weg zum Marktplatz, der grad zwei Blöcke die Mainstraße runter lag, keinen halben Kilometer. Ihre Einkaufsliste war nicht sehr lang, aber die Dinge würden schon ihr Gewicht haben und sie wollte sich nicht überanstrengen. Dazu fehlte ihr die Kraft. Die andauernden Streitigkeiten mit Peter raubten ihr Energie und sie schäumte innerlich schon wieder. Peters Verhalten brachte sie zur Weißglut. Und dann hatte er noch Sonderwünsche, was sie mitbringen solle, und heute Abend käme er wieder nicht und sie würde mit der warmen Mahlzeit allein dastehen. Ja: Wie dumm sie manchmal war. Immer und immer wieder musste sie das feststellen. Vielleicht sollte sie sich zunächst ein wenig ablenken, statt ihrer Pflicht als Hausfrau und angehende Mutter nachzukommen. Dazu wäre bis heute Abend um halb elf, wenn Peter nach Hause kam, immer noch Zeit. Als sie die Straße hinunterging, hielt die Linie 13 an der Haltestelle Mainstraße, sie stieg kurzentschlossen ein.
Heike zog die schwere, mit Schnitzereien verzierte Holztür auf. Als sie die dicken, dunkelgrünen Samtvorhänge, die fleckig und stumpf geworden waren, zur Seite drückte, schlug ihr der Geruch von kaltem Rauch, Alkohol und Körperausdünstungen entgegen. Ihr Vater stand hinter der Theke, hatte die Ärmel seines weißen, kragenspeckigen Hemdes aufgekrempelt und spülte im Becken Pilstulpen und einige Altbiergläser. Er schaute auf und lächelte sie an. In den Wirtsraum drang durch die verqualmten, stumpfen Buntglasfenster kaum ein Strahl Licht.
„Gun Morn Papa, wie gehts denn so?“
„Morn Heike. Wie imma. Gestern war hier echt die Hölle los, wa. Nachem Spiel warense alle hier. Die ganze Mischpoke aussem Block. Willze wat trinken, Töchterchen?“
„Ne Limo vielleicht. Wo steckten Mama?“
„Die is grad nachen Markt, einkaufen. Muss gleich wiederkommen. Wie gehdet Euch denn? Hat der Pedda früh oder wieso bisse allein hier? Is der immer noch am Spinnen, weila Vadda wird, der Hund?“
Sie nahm am kleinen, runden Tisch gegenüber der Theke Platz.
„Ne. Der sitzt noch zu Hause inne Küche und hat Sonderwünsche für zum Essen. Aber wenner nach Haus kommt miefter nach Kneipe.“
„Ich hab Dich imma gesacht, dat der nix taucht. Mensch Meier, da hasse Dich ein angelacht.“
„Wird schon wieda.“
„Und wenn nich?“
„Keine Ahnung, müssen wa kucken. Muss ma kurz aufen Klo.“
Sie stand auf, ging durch den länglichen Raum mit den vier Tischen, in dem sich früher ihr Vater, ihr Großvater und die anderen Sozialisten getroffen hatten. Der Raum grenzte an der Treppe zum Keller. Oft hatte sie auf Anraten ihres Vaters das Licht löschen müssen und viele der jungen Männer und Frauen, es waren weniger Frauen als Männer gewesen, hatten sich in den Wirtschafträumen im Keller der Gaststätte versteckt, bis jemand Entwarnung gegeben hatte und die Luft auf der Straße wieder rein war. Spannend hatte sie das gefunden, ganz klein war sie da gewesen, konnte grad bis an den Lichtschalter langen, war sich des Ernsts der Lage nicht bewußt. Sie wusste ja gar nicht, was das war: Ein Sozialist. Damals war das für sie eine spezielle Art von Familie gewesen, die jungen Männer und die Frauen mittleren Alters, deren Männer teils an der Front kämpften. Viele von ihnen waren heute nicht mehr da und bei einigen wusste Heike daß sie deportiert worden waren oder eine Bombe ihr Haus getroffen hatte. Ihr Vater war wegen seines Sehleidens nie im Krieg gewesen. Ohne Brille war er fast blind. Er hätte nie einen Unterschied zwischen Freund und Feind ausmachen können. Seine Brillengläser ließen ihn aussehen wie einen Maulwurf. Die Füllhöhe eines Bierglases konnte er jedoch mühelos an der Temperatur erkennen. So musste er in einer Munitionsfabrik seinen Dienst für das Vaterland verrichten. Heute trafen sich hier an den Tischen die Arbeitskollegen nach einem Spiel auf dem Bolzplatz oder die Nachbarn aus der Straße, um das Spiel ihres Vereines im Fernsehen zu verfolgen. Heike dachte immer, wenn sie hier war, an ihre Kindheit zurück. Die Wirtschaft besaß eine dichte Atmosphäre, wie eine nomrmale Mietwohnung sie nie hätte haben können. So viele Menschen, Geschehnisse, Generationen. Vielleicht würden Peter und sie die Wirtschaft eines Tages übernehmen. Auf der Toilette roch es nach Ammoniak. Ihre Mutter hatte bereits alles geputzt, ein frisches Handtuch hing am Waschbecken. Sie drehte an dem schwarzen, knirschenden Plastikrad und Seifenpulver rieselte aus dem Spender an der Wand. Während sie sich die Hände wusch, betrachetete sie ihr Spiegelbild, ihre Augen hatten dunkle Ränder. Als sie die Toilette verließ, warf sie am Ende des Flurs einen verstohlenen Blick die Kellertreppe hinunter. Das hatte sie als kleines Mädchen schon immer getan. Der Keller war ihr früher furchtbar groß, feucht und dunkel erschienen und wenn man sie heute fragen würde, so würde sie ihn noch immer so beschreiben. Dort lagerten Fässer, alte Tische, Bänke vom ehemaligen Biergarten hinter der Wirtschaft, eine große Menge Unrat. Hätte sie Brüder gehabt, so hätten die dort Verstecken gespielt, aber ihrer Schwester, die kurz nach dem Krieg an Tuberkulose gestorben war, war der Keller stets zu unheimlich gewesen. Als sie wieder in den Schankraum zurückkehrte, trat ihre Mutter mit zwei großen Einkaufstüten durch den Windfang.
„Heike, dat is ja schön, datte hier bis. Wie gehdet Dich? Wat macht Dein Ulligen?“
„Morn, Mama. Der? Der tritt und macht, ich wird noch bekloppt.“
„Und Dein Männe?“
„Gut.“
„Jetz lüüch ma nicht.“
Ihr Vater mischte sich sofort ein, er konnte nie was lange für sich behalten. Nie konnte er sich auch nur einen Zentimeter zurückhalten.
„Wat denn, wieso, wat is denn?“
„Jammert rum wie ne Memme, weila Wechselschicht hat. Hat Sonderwünsche, wat seine hochschwangere Frau nich all für ihn erledigen soll. Kennzen doch, immer datselbe mit die Polen.“
„Kerl inne Kiste! Papa, jetz mach mal nen Punkt. Faul isser doch auch nich. Nur dat mit die Schichten, dat krichter nich hin.“
„Ja wat denn, Wechselschicht? Wat meinze denn, wie lange Dein Mudda und ich hier immer aufe Beine sind? Hasse uns schoma jammern hörn? Man kann doch froh sein, wennet läuft. Wenn ich…“
„Heiliger Strohsack! Jetz gib ma Ruhe. Schreib ma lieber ‚Kassla mit Grünkohl un Kartoffeln‘ aufe Tafel draussen.“
Heikes Mutter schüttelte lachend den Kopf und ging hinter der Theke durch in Richtung Küche. Alles nahm sie humorvoll hin. Sie hörte, wie Ihre Mutter die Tragetaschen abstellte und folgte ihr, um ihr zur Hand zu gehen.
„Imma datselbe, imma an meckern.“
„Mutter, irgendwie versteh ich en. Is auch in Augenblick echt en Zustand mit den Peter.“
„Aba nutzt ja all nix, is jetz numa so.“
Sie leerten die dreieckigen, braunen Papiertüten auf denen die Namen der Landwirte standen, und breiteten die Waren aus: Mehrere Köpfe Kohl vom Kevelaer Gutshof und Kasselerbraten vom Klever Schlachter Beck.
Heike liebte ihren Vater. Immer war er für sie dagewesen, hatte ihr stets zur Seite gestanden, den Rücken gestärkt. Er war damals zu ihrem Lehrmeister gegangen, als es Ärger gab mit dem Lohn und hatte in der Schule dem Lehrer mit einem Knüppel gedroht, der ihr eine Ohrfeige gegeben hatte, sodaß sie Kopfschmerzen hatte. Was Peter anging, so war ihr Vater seit jeher gegen die Beziehung gewesen. Damals hatte sie richtig Streit mit ihm gehabt, immer wieder – und nie, nie hatte er ein gutes Haar an ihm gelassen. Stets hatte ihr Vater behauptet, daß Peter es mit ihr nicht ernst meine, daß er sie bestimmt einmal verließe und er auch keinen guten Vater abgeben würde. Sie hatten sich lautstark gestritten und es hatte Tränen gegeben. Heike bestritt all dies. Sie war verliebt gewesen und vielleicht war sie es sogar immer noch. Lautstark hatte sie ihrem Vater paroli geboten und Peter in Schutz genommen. Ihr Vater war lauter und lauter geworden, bis ihre Mutter den beiden Einhalt gebot.
Heike hatte noch einen Kaffee mit ihren Eltern getrunken und war mit dem Bus von Warnup und mit der 13 wieder nach Nordheim zurückgefahren. Ihren Einkaufsroller hinter sich herziehend überquerte sie den Marktplatz bis zum Gemüsestand van den Boom. Die dicke Frau mit dem Kopftuch und dem roten Gesicht hinter den Holztresen an den meterlangen Auslagen auf den hölzernen Tischen kippte aus ihrer Drahtschaufel die dickschaligen Kartoffeln in eine Tüte, während sie mit der Kundin sprach, die vor ihr stand. Danach war sie an der Reihe.
„Morgen Frau Koslowski.“
„Morgen, wie issed?“
„Immer datselbe, wissense doch. Hier Markt, da Markt. Wat kann ich Sie anbieten?“
Nachdem Heike bei ihren Eltern den Grünkohl gesehen hatte, hatte sie richtig Appetit darauf bekommen. Sie nahm einen Kohl und noch dazu Schalotten, Kohlrabi für den folgenden Tag und natürlich Kartoffeln. Zum Einlagern über den Winter fehlte ihnen im Keller der Platz.
„Wat macht Ihr Kind?“
„Kerl inne Kiste! Dat macht mich fertich bevor et da is, glaubense?“
„Ja, ja, so is dat bei mich auch gewesen.“
„Herrgott, ich bin froh, wenn dat all vorbei is.“
„Ja, dat glaub ich. Sechsachtenachtzich mach dat dann, Frau Koslowski und grüßense ihrn Mann.“
Beim Bäcker Bäcker Simon holte sie frisches Brot und zwei Brötchen. Im Anschluß machte sie sich auf zum Metzger. Heike blieb kurz vor dem Stand von Metzger Thür stehen und ein Grinsen huschte über ihr Gesicht: Metzger, Peter, Wurst! Sie wusste plötzlich, was zu tun war. Nichts. Sollte Peter sich die Bratwurst doch selbst kaufen! Heike kaufte Kasseler, sie wusste, er hasste das salzige Bratfleisch. Die leckere Bratwurst blieb bei Metzger Thür.
Anfang '66
Peter wischte sich den Dreck von seiner Hose ab und kratzte mit dem linken Mittelfinger öligen Ruß unter den Nägeln der rechten Hand weg. Er fingerte an der Packung Reval in der Brusttasche seiner Arbeitsjacke herum und klopfte, nachdem er endlich erfolgreich war, die Zigarette auf den Tisch, damit sich der Tabak richtig setzte. Die Werkssirene war im Hintergrund zu hören, irgendwann mischte sich das Martinshorn der Werksfeuerwehr dazu. Irgendwo brannte es, war etwas explodiert, vielleicht eine Verschlussklappe durch eine Gasexplosion abgerissen. Hoffentlich hatte niemand davorgestanden. Peter saß mit den Kollegen in der Kammer und hoffte, dass er bis zum nächsten Abstich noch ein wenig Zeit hatte. Der Aschenbecher quoll über, aber das interessierte niemanden.
„Auf Dauer macht Dich dat völlich kaputt, ich sach Dich dat. Seh zu, datte son Job in Bürro kriss. Bis doch nicht doof, Mann.“
„Ich in Bürro?“
„Wat hasse denn für Schangsn? Hier in Stahlwerk. Willsse ewich Schicht machen?“
Karl-Heinz, den alle nur Kalle nannten, redete auf Werner ein, wie auf einen kranken Gaul. Was hatte der an Werner gefressen? Peter ließ seinen Blick vom Seite-3-Mädchen der BILD ab und hörte nun dem Gespräch aufmerksam zu. Kalle, ihr Oberschmelzer, stand kurz vor der Rente. Drei oder vier Jahre würde der noch machen. Dann wäre Schicht. Für immer. Jeder wusste, daß er sich mit allen Vorgesetzten anlegte. Selbst für die größten Idioten riß er sein Maul auf, wo er konnte, ein alter SPD-Mann. Nun versuchte er Werner wegzulotsen. In eine Umschulung oder sowas.
„Nee, ich sach Dich: Seh ma zu, datte hier wech komms, Werner.“