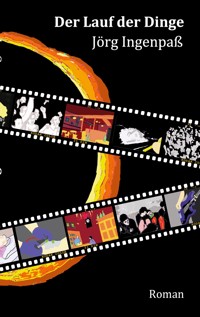Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Knapp fünf Wochen Reha in Sachsen-Anhalt. Wie reagiert der Verfasser auf eine diese Herausforderung? Was wird es mit ihm machen? Wird er es überleben? Hier erfährt man es.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Onkel Arno
Der Autor
ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und hat lange und erfolglos Mathematik und Informatik studiert. Später dann auch noch Anglistik und Kunstwissenschaften oder Romanistik und Musikwissenschaften. So genau weiß er das nicht mehr. Denn das Studium galt nur der Möglichkeit an ein günstiges Ticket für den ÖV zu gelangen. Seit 1995 arbeitet er in der IT, was ihm neben geistiger Verödung ein Burn Out und somit einen Reha-Aufenthalt in Nordsachsen beschert hat.
Der Bericht
ist ein Tagebuch dieses Aufenthaltes. Da er nicht sehr lang ist, soll er an dieser Stelle auch nicht zusammen-gefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Tag 1, Donnerstag
Tag 2, Freitag
Tag 3, Samstag
Tag 4, Sonntag
Tag 5, Montag
Tag 6, Dienstag
Tag 7, Mittwoch
Tag 8, Donnerstag
Tag 9, Freitag
Tag 10, Samstag
Tag 11, Sonntag
Tag 12, Montag
Tag 13, Dienstag
Tag 14, Mittwoch
Tag 15, Donnerstag
Tag 16, Freitag
Tag 17, Samstag
Tag 18, Sonntag
Tag 19, Montag
Tag 20, Dienstag
Tag 21, Mittwoch (Tag der Deutschen Einheit)
Tag 22, Donnerstag
Tag 23, Freitag
Tag 24, Samstag
Tag 25, Sonntag
Tag 26, Montag
Tag 27, Dienstag
Tag 28, Mittwoch
Tag 29, Donnerstag
Tag 30, Freitag
Tag 31, Samstag
Tag 31, Sonntag
Tag 32, Montag
Tag 33, Dienstag
Tag 34, Mittwch (Abreise)
Epilog
Prolog
Als nach beinahe einem Dreivierteljahr der Briefumschlag mit einem Inhalt von nahezu einhundert Seiten an Informationen, Vorschriften und auszufüllenden Formularen ins Haus flattert, bin ich gleichermaßen froh, ob der Zusage für eine Rehabilitation, als auch geschockt, aufgrund des Umfangs. Schnell schlägt aber die Freude in Zweifel um, denn das Programm reicht von Nordic Walking über gemeinsames Basteln bis hin zum Heiltanz. Ersteres würde ich vielleicht in dreißig Jahren machen, wenn ich dann noch lebe und nicht mehr freihändig laufen kann, letzteres nie. Meine Annahme geht dahin, daß nach dem Heiltanz gemeinsam ein Enneagramm ausgemalt und Schädel und Nase vermessen werden. Auch für das Basteln habe ich schon Vermutungen, die etwas mit Seidenmalerei oder Töpfern zu tun haben und ich würde tragischerweise tatsächlich Recht behalten. Meine Bedenken trage ich Freunden und Familie vor, die allesamt meinen, ich solle doch nicht so negativ und kritisch sein. Negativ-sein war sozusagen der Hauptgrund meiner Kur. Psychosomatische Beschwer-den aufgrund Akzeptanzproblematiken. Aber wieso muss man eigentlich immer und allzeit Scheiße akzep-tieren? Egal: Der Rest der Vorbereitung läuft über-raschenderweise recht fluffig: Ich bekomme Gutscheine für die Gepäckabholung und die Fahrt mit der Deutschen Bahn AG zugeschickt und das Gepäck wird auch pünktlich abgeholt. Selber hätte ich es schließlich kaum transportieren können, denn die Pflichtmitnahmeliste übersteigt alles Menschenerdenkbare: Ein Bademantel wird verlangt, den ich im Vorfeld von meinem Vater abstauben konnte. Seit dem sechsten Lebensjahr hatte ich gar keinen mehr besessen. Dieser füllt dann auch bereits zwanzig Prozent des Rauminhaltes des ersten Koffers. Weiter geht es mit Badehosen, wo ich doch selbst an der Ostsee nicht ins Wasser gehe. Es folgen Wanderschuhe, Sportanzug und Hallenturnschuhe, die ich mir auch extra anschaffen musste. Somit hatte mir die Kur schon vor Beginn irrsinnige Einstiegskosten von über dreihundert Euro beschert.
Tag 1, Donnerstag
Die Hinfahrt ist problemlos. Die von der Rentenkasse bereitgestellten Tickets sind korrekt ausgefüllt und der ICE ins Nazibundesland Nummer Eins fährt pünktlich los. Störend ist, daß ich am Vortag eine neue Kreditkarte erhalten habe und mir die neue PIN nicht bekannt ist – aber was soll man auch im Arsch der Welt mit einer Kreditkarte? Weiter und hartnäckiger störend ist, daß ab nachts um eins mein Mobiltelefon kein Netz mehr hatte. Mein Betreiber hatte mir eine neue SIM-Karte zugeschickt und der Vertrag läuft ab Abreisedatum. Hier fehlt mir ebenfalls die PIN und so bin ich digital komplett obdachlos. Die alte SIM stellt kein Netz zur Verfügung und die neue SIM lässt keine Anmeldung zu. Da ich auch recht früh losfahren musste, ist mein Kreislauf ohnehin noch wackelig und so ziehe ich es vor, im ICE zu schlafen, statt mich mit Telefonieproblemen zu befassen. Ich schlafe also ein und werde eine Stunde später mit Halsschmerzen wach. Ich hoffte, daß ich die nette Frau aus Karlsruhe auf dem Nachbarsitz nicht allzu heftig vollgeschnarcht habe. In Leipzig heißt es umsteigen. Ich bin überrascht, daß der Leipziger Bahnhof 26 Gleise hat – mehr als Berlin. Mir fällt das Leipziger Messelied der FDJ ein, in dem es heißt „…ja, die Leipz’ger Messe ist das größte Kaufhaus in der Welt!“ Irgendwas ist da wohl dran. Mit dem Regionalexpress RE50 geht es weiter nach Dahlen. Von dort mit einem kurbetriebseigenen Bus in die Dahlener Heide nach Schmannewitz. Zehn Kilometer ins Nichts. Dann sind wir da: Die Kurklinik ist ein Gebäude aus den Neunzigern und im Grundriss überwiegen stumpfe Winkel, alles ist sechseckig geschnitten. Die Wände sind weiß und so komme ich mir vor wie in einer Mischung aus Krankenhaus und Hotel. An einigen Orten gibt es Holz, so zum Beispiel zwei Einlassungen in Gangwänden, mit Postfächern. Diese sind aus hellem Holz, vielleicht Ahorn. Der Bodenbelag ist ein Kurzflor. Auch hier überwiegen Hundertzwanzig-Grad-Winkel im Muster. Wäre das Muster spiegel-verkehrt, würde man lauter SS-Zeichen erkennen kön-nen. Es finden sich etliche Rot-Nuancen im Teppich: Von hellem lachsrot über persisch-rot und Korallentönen bis zu dunklerem karminrot, rubinrot und burgund. Alles ist sehr dezent gehalten. Das Foyer geht in eine Cafeteria über, die ein gläsernes Dach hat, so daß alles in einem morgendlichen Licht liegt. Hinter dem Eingang im Foyer ist direkt der Empfang, an der zwei Damen mittleren Alters freundlich lächelnd in der Art Berufsbekleidung sitzen, wie man sie auch vom Empfang einer Klinik kennt. Beide sprechen sächsisch. Ich muss mich konzentrieren, um mitzukommen, was nun Sache ist, denn jetzt kommt der Check-In.
Nach zwei Stunden bin ich soweit, daß ich wieder nach Hause fahren will: Zuerst händigt man mir die Schlüssel für das Zimmer und das Schließfach aus – bei Verlust kämen 500 Euro Kosten auf mich zu. Ich schlucke und unterschreibe. Ob die Schlüssel aus einer Platinlegierung sind? TV kostet einen Euro für einen Tag. Ich schlucke erneut. Der Fernseher misst achtzehn Zoll. Ich verzichte, nachdem ich feststelle, daß ich meinen Laptop nicht mit dem Fernseher verbinden kann. WLAN fünf Euro die Woche und dazu ist es lediglich im Foyer und in der Cafeteria verfügbar. Ich schlucke abermals. Also muss ich mit dem Laptop zum Nachrichten lesen immer ins Foyer oder in die Cafeteria. Der Milchkaffee, den es dort vom Automaten gibt, bedeckt grad mal den Boden meiner mitgebrachten Tasse und reicht für ungelogen drei Schlucke. Ich überschlage, daß eine ganze Tasse, von der ich täglich drei trinke, mich neun Euro kosten würde. Also für 27 Euro Kaffee pro Tag. Da hätte ich auch in einem Vier-Sterne-Hotel in Paris einchecken oder Douwe-Egberts komplett aufkaufen können. Wäsche waschen dreifünfzig, ein Waschmittel-Tab fünfzig Cent, trocknen einsfünfzig und zudem Pflicht, denn Wäsche auf dem Balkon trocknen ist untersagt. Privater Besuch auf dem Zimmer: Untersagt. Alkohol: Untersagt. Rau-chen: Untersagt, was mich speziell nicht stört. Ich erinnere mich in diesem Moment an das Buch, das ich neulich über Strafvollzug in den Siebzigern gelesen habe. Dort war auch alles verboten.
Ich betrete mein Zimmer, welches wie ein Hotelzimmer, der Best-Western-Gruppe erscheint: Auch hier finde ich als Einrichtung helle Holztöne. Es gibt Kleiderschränke im Umfang, wie ich es von zu Hause kaum kenne (vier große Türen für mich allein!), Bett, einen Schreibtisch, zwei kleine runde Beistelltischchen. Der Teppich hat dasselbe Muster, wie im Foyer und in den Gängen, nur findet man hier allerlei Grüntöne, angefangen von hellen Mint- und Limettentönen über frischen lind- und apfelgrün, einem Jadeton bis hin zu dunklem seegras-grün, tannengrün und oliv. Das Fenster ist riesig, der Balkon bietet allenfalls für zwei Personen Platz und vorm Balkon steht eine Eiche von vielleicht sechs Metern Höhe. Das Bad hat ein WC, Waschbecken und eine Dusche, die barrierefrei zu betreten ist. Ist ja klar - wir sind ja in einer Klinik. Ich steige unter die Dusche, denn ich habe auf der Hinfahrt nicht wenig geschwitzt und will dem untersuchenden Arzt meinen Körpergeruch ungern zumuten. Nachdem ich das Bad verlassen habe, läuft die Umluft noch Ewigkeiten weiter. Später habe ich mal die Zeit gestoppt: Acht Minuten! Ich ziehe an der Kordel, um sie abzuschalten, doch die Lüftung saugt weiter unbarm-herzig alle Luft aus dem Zimmer. Ich habe mit dem Ziehen der Kordel, ohne es zu wissen, den Alarm ausge-löst und kurz drauf kommt eine Schwester vorbei, die meint, dass es ja mein erster Tag und ich somit ent-schuldigt bin. Zwei Minuten später ruft eine weitere Schwester an und erzählt mir dasselbe. Um halb zwölf gehe ich recht motivationsfrei und ohne jede positive Erwartung zum Mittagessen. Der Speisesaal ist so riesig wie die Kantine unserer Hauptniederlassung in der Firma. Er fasst bestimmt über zweihundert Menschen, die an Vierertischen Platz haben, die in gradlinigen Reihen angeordnet sind. Jeder Tisch und jeder Platz hat eine Nummer. Ich habe 12-3. An meinem Tisch sitzen drei weitere Rehabilitanden: Mir gegenüber eine Polin aus Leverkusen von vielleicht sechzig Jahren, die zwar einen fröhlichen, aber doch eher verschlossenen Ein-druck macht. Neben ihr eine Erfurterin in etwa gleichem Alter, die Roswitha heißt und auf mich einen - wie soll ich sagen - netten, zünftigen Eindruck macht. Neben mir ein Typ um die vierzig, der Unmengen isst und kaum spricht. Insbesondere mich scheint er auch gar nicht wahrzunemen. Spreche ich ihn an, antwortet er Roswitha zugewandt. Egal. Bekloppte gibt‘s ja immer. In der Mitte des Saales befindet sich das Buffet. Ein recht-eckiger Klotz von vielleicht drei mal vier Metern. Dane-ben nochmals ein kleineres Buffet, wie aus zusammengestellten Tischen, an dem es Suppe gibt. Eine gesamte Längsseite besteht aus Fenstern und man kann hinaus auf die Wiese schauen. Auf dem Essensplan sind die Portionen mit 450 bis 500 Kilokalorien ausgezeichnet. Mitnahme von Essen aufs Zimmer: Verboten. Mitbringen von Essen in den Speisesaal: Verboten. Ich fragte mich, ob Verbote eine Genesung begünstigen. Mittags habe ich dann zwei Gespräche mit Ärzten, die ich überraschenderweise als ausnahmslos positiv empfinde. Der Stationsarzt, Oberarzt Doktor Schultz, ist ein Sachse um die fünfzig, der die gesamt Zeit zwar ernst daherkommt, aber trotzdem schmunzelt. Er ist der Meinung, daß ich doch schon viel über mein Problem verstanden hätte und nun nur noch daran arbeiten müsse, daß man eben jede Menge Scheiße zu akzeptieren hat. Ich solle doch einfach alles mit mehr Gleichgültigkeit hinnehmen. Das Gespräch dauert über eine Stunde und ich fühle mich tatsächlich sehr verstanden. Danach geht es zur Psychologin. Die betreuende Therapeutin, Frau Ebeling, ist um die dreißig, superfreundlich und erzählt mir, daß auch sie in der Klinik ähnliche Probleme hätte. Sie könne kaum Menschen helfen, sondern fülle nur Papiere aus. Gleichgültigkeit hält sie für den falschen Weg, vielmehr solle man daran arbeiten, Positives zu sehen und mehr Achtung zukommen zu lassen. Sie kündigt an, daß ich am kommenden Morgen meinen Therapieplan im Briefkasten hätte. Meine Laune bessert sich und hält an, obwohl für das Angebot des Abendessens, welches recht übersichtlich ist, Schmal-hans wohl Küchenmeister war. Wegen des Alkoholver-botes nehme ich mir verbotenerweise eine Buttermilch mit aufs Zimmer und schlafe zügig ein.
Tag 2, Freitag
Um halb sieben schellt der Wecker, da ich um sieben Blut abgenommen bekommen soll. Danach zum Frühstück, was deutlich reichhaltiger ausfällt, als das Abendessen am Vortag, was aber auch keine Kunst ist. Und auch wenn es weder anständiges Müsli, noch Haferbrei gibt, sondern nur Kellogs Cornflakes mit neudeutschen Cerealien, wie Sonnenblumenkernen oder Leinsamen, so ist der Rest wie Schnitt- und Frischkäse annehmbar. Und man kann ja bekanntermaßen ohnehin nicht alles haben. Nach dem Frühstück geht es weiter zum Blutdruck-messen. Wieder 70 zu 130, so wie bei der ersten Untersuchung gestern. Dreimal schaue ich tagsüber in den Briefkasten – kein Therapieplan. Hatte man mich vergessen? Ich lade den Akku meines Laptops und mache mich auf den Weg in die Cafeteria. Ich lese die FAZ, dann den Tagesspiegel. Meine Lieblingszeitung, die Süddeutsche – hebe ich mir für den Schluss auf und muss mit Entsetzen feststellen, daß sie ihr Zugriffskonzept geändert haben. Ohne Abo gibt es nur noch zehn Artikel wöchentlich. Das auch noch! Dann sehe ich meine Mails durch. Ein Bekannter bittet mich, eine Bezahlung für ihn mittels PayPal zu tätigen und beim Versuch gibt es ein Verifizierungsproblem. PayPal meint, sie würden mich daheim anrufen wollen und ich soll dann die 4726 eintippen. Wieso sind die sich verdammt nochmal sicher, daß ich zu Hause bin? Und wieso kann ich die Verifi-zierung nicht umstellen auf Frage nach dem Mädchen-namen meiner Mutter? Ich wiederhole das Loginpro-zedere, hoffe bei einem Neuversuch auf die Frage nach dem Geburtsdatum meines vierten Haustieres und abermals will man mich anrufen und ich soll die 8493 eingeben. Was für ein unsäglich blöder Mist! Mittags stelle ich dann fest, daß ich mit der neuen SIM-Karte meines Handys, die ich inzwischen habe freischalten können, nicht ins Festnetz anrufen kann und auch nicht ins Internet komme, dabei hätte ich dringend mit meiner Bank über meine neue Mastercard, die ich nicht nutzen kann, sprechen wollen. Manchmal ist der ganze neumodische Kram einfach nur hinderlich. Ich erinnere mich, daß ich noch das Buch Technological slavery habe kaufen wollen. Werde ich dann nach der Kur machen. Trotzdem macht mir all dies bedeutend weniger aus, als Qualitätskontrollmaßnahmen, Abnahmetests und anderes Formulargedönse. Gelobt sei, was gleichgültig macht und weder verschreibungspflichtig ist, noch unter dem Betäubungsmittelgesetz steht.
Nachmittags leiste ich mir zwei Milchkaffee und lese. Um kurz vor fünf ruft dann Schwester Cindy an, um mir mitzuteilen, daß ich wohl das Blutdruckmessen vergessen hätte. Cindy: Kommt die aus Marzahn? Nach den beiden Kaffees habe ich dann 80 zu 140 bei einem Puls von 74. Nach dem Abendessen schaue ich zum achten Mal an dem Tag ins Postfach und habe einen Therapie-plan fürs Wochenende: Samstag – 7:15 Blutdruck messen, Sonntag – 7:15 Blutdruck messen. Wenigstens kann man fast ausschlafen. Das ist ja mal nicht nix, was?
Abends stelle ich mir meinen Laptop auf das Fernsehtischchen, nachdem ich den Fernseher selbst – da ich ihn ja nicht benutzen kann – in den linken Kleiderschrank verfrachtet habe. Ich hole meine Festplatte aus dem Wertfach des Kleiderschranks – ein abschließbares Fach für persönliche und wertvolle Dinge – und schließe sie an. In Gedanken beschäftige ich mich bereits, ob ich es heute lieber retro hätte mit den Straßen von San Francisco oder doch lieber mit Haus des Geldes