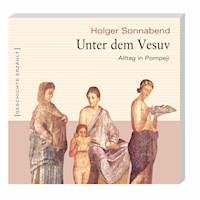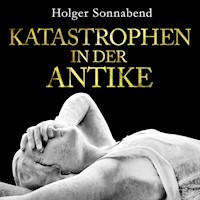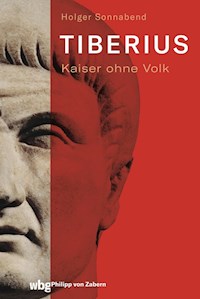6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Die Antike lässt uns auch nach 2000 Jahren nicht los. Gab es den Trojanischen Krieg wirklich? Ist Atlantis mehr als ein Mythos? Wo genau fand die Varusschlacht statt? Jede spektakuläre These zu solchen Fragen interessiert weit über die Fachwelt hinaus, jeder neue Fund findet ein breites Medienecho. Holger Sonnabend wirft einen erfrischend neuen Blick auf die antike Welt und Geschichte, frei nach dem Motto: »Drei-drei-drei, Issos Keilerei« kennt jeder, aber was ist mit »Fünf-null-null« oder »Drei-acht-sieben«? Er trägt Wissenswertes, Überraschendes und Kurioses über Griechen und Römer zusammen und macht uns mit ihren Promis – Caesar, Hannibal oder Perikles – ebenso bekannt wie mit einem Normalo wie dem Bäcker Eurysaces.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Holger Sonnabend
Antike. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Umschlagabbildung: FinePic®
Infografik: Infographics Group GmbH
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961216-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020431-3
www.reclam.de
Inhalt
Edle Einfalt und stille Größe …
Wir stehen voller Ehrfurcht vor den großen Kunstwerken der Antike, bewundern ihre Schönheit, ihre Harmonie, ihre Proportionen. Nehmen wir die Laokoon-Gruppe. Sie ist heute eine der Attraktionen der Vatikanischen Museen in Rom. Dem Mythos zufolge war Laokoon ein Priester in Troja – ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als es unterging. Die angreifenden Griechen hatten auf Anraten des listenreichen Odysseus das Trojanische Pferd in die Stadt geschmuggelt, in dessen Bauch sich einsatzbereite Krieger befanden. Laokoon witterte die Falle, doch die Mit-Trojaner schenkten seinen Warnungen keinen Glauben. Stattdessen schickten die Götter, die auf der Seite der Griechen standen, zwei Schlangen, die den Priester und seine beiden Söhne töteten.
Das berühmte Kunstwerk, 1506 in Rom entdeckt, zeigt den Todeskampf der drei unglücklichen Trojaner. Archäologen streiten sich bis heute, ob es sich um die römische Kopie eines griechischen Originals aus dem 2. Jh. v. Chr. oder um eine römische Eigenkreation aus der Mitte des 1. Jh.s n. Chr. handelt. Doch diese Frage interessiert nur die Experten. Die Sache des Publikums, das in die Museen strömt, ist eine andere. Die Menschen kommen zum Bewundern und Staunen. Dass manche die Antike in Sachen Kunst für unübertrefflich halten, ist die späte Nachwirkung des ebenso unermüdlichen wie erfolgreichen Werbens um die Anerkennung der Vorbildhaftigkeit der antiken Kunst, wie sie von Johann Joachim Winckelmann betrieben wurde. Geboren wurde der Regisseur neuzeitlicher Antikenbegeisterung vor 300 Jahren, genauer: am 9. Dezember 1717, im beschaulichen Stendal. Knapp 51 Jahre später starb er, in Triest, als Opfer eines perfiden Raubmordes. Zwischendurch hatte er genug Zeit, um sich in Italien als Mentor der antiken, insbesondere der griechischen Kunst zu profilieren. Die Laokoon-Gruppe war für ihn Inbegriff von Perfektion und Schönheit. Für sie prägte er die klassisch gewordene Formel »Edle Einfalt und stille Größe« – ein Gütesiegel, das der Antike über die Jahrhunderte hinweg anhaftete.
Edle Einfalt und stille Größe? Die Antike als eine marmorne Welt, gewissermaßen allem Irdischen entrückt, unnahbar und fern? Einfach nur schön und harmonisch?
… und die wirkliche Welt?
Zum Glück war es nicht so. Oder nicht nur so. Die Kunst ist das eine, das Leben das andere. Keiner hat das so überzeugend formuliert wie der große Altertumswissenschaftler Theodor Mommsen. Geboren vor 200 Jahren, am 30. November 1817 in Garding, im hohen Norden Deutschlands, war er genau 100 Jahre jünger als der Antikenenthusiast Winckelmann. Maßstäbe setzte er bereits in den frühen Jahren seines reichen Forscherlebens mit der Römischen Geschichte, die zwischen 1854 und 1856 in zunächst drei Bänden erschien. 1902, ein Jahr vor seinem Tod, bekam er dafür den Literaturnobelpreis. Je nach deren Einstellung faszinierte oder irritierte er seine Leser darin mit einer ganz bewusst aktualisierenden Terminologie. Plötzlich gab es im antiken Rom Bürgermeister, Generäle, Fabrikanten, Ingenieure, Büropersonal. Er befreite die antike Geschichte sowohl von der Staubschicht, die sich über die Jahrhunderte hinweg auf sie gelegt hatte, als auch von der idealisierenden, verklärenden Sicht, wie sie Winckelmann und seine Epigonen verordnet hatten. Mommsen holte die Menschen der Antike vom Podest der Unnahbarkeit herunter in die, wie er selbst sagte, »reale Welt, wo gehasst und geliebt, gesägt und gezimmert, phantasiert und geschwindelt wird«.
Die Antike hasste, liebte, sägte, zimmerte, phantasierte und schwindelte? Gut, dass Winckelmann das nicht mehr miterleben musste. Dabei hätte er auch in seinem von ihm so geschätzten Griechenland eine Lektion darüber erhalten können, dass die Menschen der Antike tatsächlich auch hassende oder sägende Menschen gewesen waren – und dass es in der hohen Politik wie auch im ganz normalen Alltagsleben alles andere als nur heroisch zuging.
Die Akropolis von Athen – Visitenkarte und Aushängeschild einer der berühmtesten griechischen Metropolen in der Antike, Pflichtprogramm für alle Touristen, die sich nach ihrer Heimreise nicht vorwerfen lassen wollen, Wesentliches versäumt zu haben. Dort oben auf der Akropolis befinden sich herausragende Bauwerke wie der Parthenon, das Erechtheion, der Nike-Tempel, die Propyläen. Kunstfreunde geraten ins Schwärmen: Die Bauten künden in ihrer klassischen Erhabenheit von der unvergleichlichen künstlerischen Begabung der alten Griechen. Mag sein. Vor allem aber dokumentieren sie den Willen der antiken Athener, ihren Status als Nummer eins unter den Griechen zu visualisieren – und den Wunsch eines damaligen Spitzenpolitikers, sich ewigen Ruhm zu verschaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, scheute er auch, ganz ohne edle Einfalt und stille Größe, nicht vor offenkundigem Betrug zurück.
Was macht man mit Geld, das man von anderen erhält? Und was leistet man dafür? Fragen, die, wie man weiß, für die Griechen bis heute eine gewisse Bedeutung haben. Ihr großer antiker Vorfahre Perikles hatte vor bald 2500 Jahren eine erstaunliche Antwort parat: »Das Geld gehört nicht denen, die es zahlen, sondern denen, die es bekommen.« Das hielten bereits die Zeitgenossen für eine interessante Sicht der Dinge und überhörten fast den Nachsatz: »… sofern sie für den erhaltenen Betrag die vereinbarte Gegenleistung erstatten«. Das Geld, um das es hier ging, stammte aus der Kasse des »Attischen Seebundes«. So wird ein Bündnissystem genannt, das die Athener im Jahr 478 v. Chr. ins Leben gerufen hatten. Sie versammelten in dieser Allianz mehr als 200 griechische Stadtstaaten. Das Datum 478 v. Chr. ist kein Zufall: Kurz zuvor hatten die Griechen einen Angriff der Perser unter ihrem Großkönig Xerxes zurückgeschlagen, ein Verdienst vor allem der athenischen Flotte. Von daher leiteten die Athener den Anspruch auf Vorherrschaft in Griechenland ab und setzten sich an die Spitze des Bundes, der »attisch« hieß, weil Athen in der Landschaft Attika liegt. Sinn und Zweck des Bündnisses bestanden darin, sich gegen künftige Angriffe der Perser zu wappnen (die dann gar nicht erfolgten, aber das konnte zu diesem Zeitpunkt keiner wissen). Einige der Partner stellten Schiffe zur Verfügung, die meisten aber zahlten Jahr für Jahr einen bestimmten Geldbetrag in eine gemeinsame, bald gut gefüllte Kasse, die man auf der Insel Delos deponierte. Sie sollte als Kriegskasse für den Fall einer persischen Invasion dienen.
Athen war zu dieser Zeit eine Demokratie, sogar die erste Demokratie der Weltgeschichte. Doch bereits damals zeigte es sich, dass die Menschen gerne dem immer selben Führungspersonal vertrauen. So kam es, dass sie Jahr für Jahr Perikles an die Spitze des Staates wählten. Er stammte aus einer alten Adelsfamilie, strahlte Würde aus und gab sich trotzdem gerne volksnah. Und er hatte viele gute Ideen. Eine seiner besten war das Projekt »Wiederaufbau der Akropolis«. Tatsächlich lagen die Bauten dort seit 480 v. Chr. in Schutt und Asche, nachdem die Perser unter Xerxes Athen einen ungebetenen Besuch abgestattet und alle Tempel und Gebäude auf der Akropolis zerstört hatten. 30 Jahre später blies Perikles nun also zum Wiederaufbau. Die Akropolis sollte in neuem Glanz erstrahlen und alles in den Schatten stellen, was es sonst an Bauten gab: ein Schaufenster der Macht der Athener und ihrer Demokratie.
Solch ein Prestigeprojekt erforderte viel Geld. Praktischerweise hatte Perikles ein Gespür für das Akquirieren von Finanzquellen. Es gab doch die Kasse des Seebundes. Er zögerte nicht lange und ließ sie von Delos nach Athen bringen. Jetzt hatte man, dank der großzügigen Beiträge der Partner, jede Menge Kapital. Doch selbst ein populärer Politiker wie Perikles konnte nicht machen, was er wollte: Es gab Proteste in Athen und natürlich auch bei den Bundesgenossen, die sich zu Recht geprellt fühlten. Sie hatten das Geld nicht für die Verschönerung Athens eingezahlt, sondern um sich vor den Persern zu schützen. Was Perikles und seine Freunde da trieben, war, so klagten sie, Betrug. Der Gescholtene lud zu einer Versammlung.
Es kommt zu hitzigen Debatten, zu Rede und Gegenrede. Dann fallen die Worte des Perikles: Das Geld gehöre denen, die es bekommen. – Seine Widersacher kontern: Aber entscheidend sei der Zweck! – Perikles erklärt: Es sei alles in Ordnung, wenn die vereinbarte Gegenleistung erbracht werde. – Das sei die Abwehr der Perser! – Das sei bis vor ein paar Jahren so gewesen. Inzwischen seien die Griechen so gut gerüstet, dass sie das Geld auch für andere Dinge ausgeben könnten. Oder jedenfalls einen Teil davon. – Und dann verrät Perikles der brodelnden Menge, welch einen wirtschaftlichen Segen sein Projekt darstelle: »Wir müssen die Überschüsse auf Werke lenken, die uns nach ihrer Vollendung ewigen Ruhm, während ihrer Ausführung aber allgemeinen Wohlstand versprechen.« Als erfahrener Politiker wusste Perikles, dass man mit dem Argument der Arbeitsplätze immer punkten kann: »So wird es Arbeit in Hülle und Fülle geben. Die vielfältigsten Aufgaben werden jedes Handwerk beleben und jeder Hand Beschäftigung bringen.«
Und so begannen denn im Jahr 447 v. Chr. die Arbeiten auf der Großbaustelle Akropolis. Gelegentlich schauten Besucher aus Rhodos, Samos oder einer anderen Geldgeberstadt vorbei und freuten sich, dass sie ihren Beitrag zur Leistungsschau der Athener hatten beisteuern dürfen – etwa in Form einer marmornen Säule für einen der Tempel oder in Gestalt einer Treppenstufe. Tatsächlich entwickelte sich die Akropolis in den folgenden Jahren zu einem wahren Schmuckstück. Die Oberaufsicht über die Arbeiten übertrug Perikles einem guten Bekannten, der bis heute als einer der größten griechischen Künstler gilt. Zu diesem Zeitpunkt war Phidias noch eher am Anfang seiner Karriere, später sollte er mit der Zeus-Statue im Tempel des obersten griechischen Gottes in Olympia eines der Sieben Weltwunder der Antike produzieren. In Athen aber befehligte er mit Unterstützung seines Freundes Perikles ein Heer von Arbeitern. Genannt werden in den Quellen Zimmerleute, Kupferschmiede, Steinmetzen, Goldarbeiter, Elfenbeinschnitzer, Sticker, Graveure – und dazu auch Färber und Maler. Deren Aufgabe war die farbige Gestaltung der Gebäude und der sie zierenden Figuren. Die Antike war bunt, Tempel und Götterfiguren strahlten einst in den schönsten Farben – in Blau, Gelb, Grün, Rosa. Erst der Zahn der Zeit und spätere Restaurationen führten dazu, dass sie marmorweiß wurden und man sich also die Antike in Weiß vorstellte. Mit speziellen Methoden wie dem Einsatz von ultraviolettem Licht können die originalen Farben heute rekonstruiert werden.
Ein schöner Körper ist desto schöner, je weißer er ist, schrieb Johann Joachim Winckelmann. Er wusste, dass die Antike bunt war, denn das steht bereits bei antiken Schriftstellern. Aber Farbe, so dozierte der Altmeister, trage zur Schönheit bei, sei aber nicht die Schönheit selbst. Theodor Mommsen hat sich nicht zur Farbe der Antike geäußert, weil er anders als Winckelmann kein Kunstexperte war. Ihn interessierte mehr das bunte Leben, die antike Kultur. Und damit hat er Maßstäbe gesetzt, die bis heute nichts von ihrer Aktualität und Modernität verloren haben.
Kompass Antike: Die Zeit – Der Raum – Wichtige Phasen
Die Menschen der Antike wussten natürlich nicht, dass sie in der Antike lebten. Für sie war ihre Zeit die Gegenwart. Erst nachfolgende Generationen machten aus der Antike die Antike. Es begann im 15. Jahrhundert mit Gelehrten, die sich nach alten Zeiten zurücksehnten und ihr Ideal bei den Griechen und den Römern entdeckten. Diesen Humanisten, wie man sie später nannte, folgten im 18. Jahrhundert die Vertreter der Klassik, die, rekrutiert aus Literaten und Kunstfreunden, den alten Kulturen weitere Lorbeerkränze flochten. Zur gleichen Zeit traten erstmals Historiker auf den Plan, mit der bis heute kanonischen Einteilung der Geschichte in Antike, Mittelalter und Neuzeit. Mit dieser Periodisierung wurden die Menschen der Vergangenheit, ohne dass sie daran noch etwas ändern konnten, bestimmten Epochen zugeteilt. Und die Historiker an den Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen gehören seither klar definierten Abteilungen an. Im akademischen Sprachgebrauch heißen sie dementsprechend Althistoriker, Mediävisten und Neuzeitler.
Warum wird man eigentlich Althistoriker? Ist die Geschichte der Neuzeit nicht spannender und aktueller? Diese Fragen werden mir häufig gestellt. Und ich gebe darauf immer zwei ernste Antworten und eine nicht so ernste Antwort. Die weniger ernste lautet: Im Gegensatz zum Zeithistoriker muss ich bei Vorlesungen und Vorträgen nicht befürchten, dass sich Zeitzeugen melden und sagen, es sei alles ganz anders gewesen. Die erste ernste Antwort lautet: Es ist ungemein faszinierend, aus dem Puzzle der Quellen, die für die Antike naturgemäß weniger üppig sprudeln als für spätere Epochen der Geschichte, ein Bild von dieser Zeit zu formen. Das gleicht nicht selten einer aufregenden Detektivarbeit. Und das zweite Argument: Die Antike steht am Anfang und bietet daher die einmalige Gelegenheit zu erforschen, wie die Menschen sich verhielten, als sie noch (fast) alles vor sich hatten – den Staat, die Stadt, die Politik, die Technik, den Krieg, den Frieden und vieles andere mehr, was uns heute als selbstverständlich erscheint.
In welcher Phase der Geschichte genau aber dürfen sich Althistoriker und überhaupt Anhänger der Antike zu Hause fühlen? Das muss geklärt sein, damit sie nicht, was fatal wäre, Geschichts- und Kulturfreunden, die eher mit anderen historischen Epochen sympathisieren, ins Gehege kommen. Zunächst einmal haben sie den unschätzbaren Vorteil, dass sie niemanden vor sich haben. Schließlich ist doch vor der Antike nichts gewesen, von der Steinzeit abgesehen – aber ist das wirklich so? Für die Gelehrten des 18. Jahrhunderts war die Sache klar: Antike – das waren die alten Griechen und Römer. Doch was war mit den Kulturen des Alten Orients? Die ersten Hochkulturen entwickelten sich, lange vor Griechen und Römern, in Mesopotamien und Ägypten, um 3000 v. Chr. Sichtbare Merkmale dieser frühen Zivilisationen waren die Erfindung der Schrift, Sternstunden der Architektur, die Entstehung von Städten und differenzierten Formen des Wirtschaftens, dazu bedeutende Leistungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie. Nicht viel später legten frühe Kulturen im Nahen Osten und in Anatolien nach. Also beginnt die Antike um 3000 v. Chr.?
Ein Gelehrter wie Eduard Meyer hätte diese Ansicht ohne weiteres unterschrieben. 1855 wurde der berühmte Forscher in Hamburg geboren. Er starb 1930 in Berlin, wo er zuletzt als Professor für Alte Geschichte gelehrt hatte. Sein auch heute noch sehr lesenswertes Hauptwerk trägt den schlichten Titel Geschichte des Altertums. Das Vorhaben war überaus ambitioniert: Meyer wollte die Geschichte des gesamten Altertums schreiben. Und er begann nicht bei den Griechen, sondern bei den Ägyptern und den alten Völkern Mesopotamiens. Er konnte dies wagen, weil er, universal gebildet, auch Kenntnisse in den altorientalischen Sprachen und Schriften hatte und daher in der Lage war, die alten Quellen zu lesen und zu verstehen. So erschienen mehrere Bände, der erste 1884, der letzte 1902